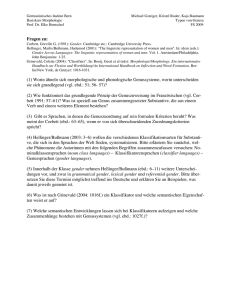Durchkreuzte Helden - Das »Nibelungenlied« und Fritz - Beck-Shop
Werbung

Aus: Natasa Bedekovic, Andreas Kraß, Astrid Lembke (Hg.) Durchkreuzte Helden Das »Nibelungenlied« und Fritz Langs Film »Die Nibelungen« im Licht der Intersektionalitätsforschung April 2014, 322 Seiten, kart., zahlr. Abb., 34,99 €, ISBN 978-3-8376-2647-6 Die Intersektionalitätsforschung befasst sich mit der Überschneidung von Merkmalen der Privilegierung und Marginalisierung wie Geschlecht, Klasse, ›Rasse‹, Nation, Religion, Sexualität, Behinderung und Alter. Diese Studie, ein Gemeinschaftswerk von zehn Literaturwissenschaftler_innen, hat zwei Ziele: zum einen die Erschließung der bislang vor allem soziologisch geprägten Intersektionalitätsforschung für die Literatur- und Kulturwissenschaft, zum anderen ihre Erweiterung um eine historische Perspektive. Als Fallbeispiel dienen drei Zeugnisse der deutschen Literatur- und Filmgeschichte: das mittelalterliche »Nibelungenlied«, Thea von Harbous Roman »Das Nibelungenbuch« (1923) und Fritz Langs zweiteiliger Film »Die Nibelungen« (1924). Natasa Bedekovic (M.A.) lehrt Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Andreas Kraß (Prof. Dr. phil.) lehrt Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Astrid Lembke (Dr. phil.) lehrt Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Weitere Informationen und Bestellung unter: www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2647-6 © 2014 transcript Verlag, Bielefeld 2014-03-20 10-59-08 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 03cd361727343718|(S. 1 ) VOR2647.p 361727343726 Inhalt Einführung: Historische Intersektionalitätsforschung als kulturwissenschaftliches Projekt Andreas Kraß | 7 ÜBERORDNUNG/UNTERORDNUNG Umstrittene Souveränität. Herrschaft, Geschlecht und Stand im Nibelungenlied sowie in Thea von Harbous Nibelungenbuch und in Fritz Langs Film Die Nibelungen Astrid Lembke | 51 Hegemoniale Männlichkeit? Herrschergestalten in Fritz Langs Film Die Nibelungen Peter Somogyi | 75 Siegfrieds königliche Vasallen. Gelingende Subordination in Fritz Langs Film Die Nibelungen Michael R. Ott | 99 EINSCHLÜSSE/AUSSCHLÜSSE Behinderte. Helden. Ability und Disability in Fritz Langs Film Siegfried Nataša Bedekoviü | 121 In/Kommensurabilität. Artikulationen von ›Rasse‹ im mittelalterlichen Nibelungenlied und in Fritz Langs Film Die Nibelungen Beatrice Michaelis | 147 Gottesbrot und Menschenbrei. Essen als Zeichen sozialer Differenzierung im Nibelungenlied sowie in Thea von Harbous Nibelungenbuch und in Fritz Langs Film Die Nibelungen Lisa Pychlau-Ezli | 165 Erste Begegnungen. Paarbeziehungen und Grenzüberschreitungen im Nibelungenlied sowie in Thea von Harbous Nibelungenbuch und in Fritz Langs Film Die Nibelungen Ninja Roth | 189 SICHTBARKEIT/UNSICHTBARKEIT Die Frauen von Bechelaren. Stand, Herkunft und Geschlecht im Nibelungenlied sowie in Thea von Harbous Nibelungenbuch und in Fritz Langs Film Die Nibelungen Regina Toepfer | 211 Siegfrieds Sichtbarkeit. Der vestimentäre Code im Nibelungenlied sowie in Thea von Harbous Nibelungenbuch und in Fritz Langs Film Die Nibelungen Andreas Kraß | 239 Ent/Fesselung des fremden Heros. Sîvrit zwischen Exorbitanz und Assimilation Judith Klinger | 259 Literaturverzeichnis | 303 Autor_innen | 319 Einführung: Historische Intersektionalitätsforschung als kulturwissenschaftliches Projekt A NDREAS K RASS Zu den einflussreichsten Paradigmen der Sozialwissenschaften zählt gegenwärtig die Intersektionalitätsforschung. Ihr Anliegen lässt sich am US-amerikanischen Phänomen des WASP illustrieren. Das Akronym bezeichnet den White AngloSaxon Protestant, d.h. den angelsächsischen Protestanten weißer Hautfarbe. In der privilegierten Bevölkerungsgruppe der WASPs überschneiden sich drei explizite Identitätsmerkmale: das ethnische Merkmal der weißen Hautfarbe, das religiöse Merkmal der protestantischen Glaubenszugehörigkeit und das nationale Merkmal der angelsächsischen Abstammung. In der Regel stellt man sich unter einem WASP eine Person vor, die außerdem über finanziellen Wohlstand verfügt, heterosexuell orientiert ist, dem männlichen Geschlecht angehört, mittleren Alters ist und über gute Gesundheit verfügt. Die explizit genannten Kriterien haben ausschließende Wirkung: People of Color, Afroamerikaner und Muslime beispielsweise können der Gruppe der WASPs per definitionem nicht angehören, sind also von Diskriminierung betroffen. Die impliziten Merkmale des Geschlechts, des Wohlstands, des Alters und der Gesundheit führen, solange die expliziten Merkmale erfüllt sind, eher nicht zur Exklusion, sondern zu einer internen hierarchischen Differenzierung. Es stellt sich somit die Frage, welche Folgen die Überschneidung bestimmter Identitätsmerkmale zeitigt: Wer wird über- oder untergeordnet, ein- oder ausgeschlossen, sichtbar oder unsichtbar gemacht? Wer wird diskriminiert oder privilegiert? Der vorliegende Sammelband unternimmt den Versuch, das Paradigma der Intersektionalitätsforschung für die Literatur- und Kulturwissenschaften fruchtbar zu machen und mit einer historischen Perspektive zu verbinden. Wie verhält es sich mit Dynamiken der Privilegierung und Marginalisierung, Inklusion und Exklusion, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in literarischen Texten und anderen kulturellen 8 | A NDREAS K RASS Werken? Wer ist das Gegenstück zum WASP in den Epen, Romanen, Dramen und Filmen anderer Kulturen und früherer Epochen? Diese Fragen sollen an einem Fallbeispiel erörtert werden, das die Brücke von der Vormoderne zur Moderne und von der Literatur zum Film schlägt, nämlich an einem Vergleich zwischen dem mittelalterlichen Nibelungenlied (um 1200) und seinen modernen Adaptationen in Thea von Harbous Nibelungenbuch (1923) und Fritz Langs Film Die Nibelungen (1924). Diese Beispiele sind für die kulturwissenschaftliche Erprobung der Intersektionalitätsforschung besonders aussagekräftig, weil sie aufgrund ihrer historischen Differenz einen epistemologischen Vergleich erlauben. Das kulturelle Wissen des mittelalterlichen Heldenepos unterscheidet sich tiefgreifend vom kulturellen Wissen seiner neuzeitlichen Bearbeitungen. Während beispielsweise die Kategorie der ›Rasse‹ im Nibelungenlied noch keine Rolle spielt, fließen die (angeblichen) Wissensbestände der neuzeitlichen Rassenlehren in das Nibelungenbuch und den Nibelungenfilm ein, wenn beispielsweise die Hunnen um König Etzel, die im mittelalterlichen Epos als Mitglieder der ritterlich-höfischen Kultur präsentiert werden, in den Bearbeitungen der 1920er Jahre als rudimentär zivilisiertes Volk mit asiatischen Zügen stilisiert wird. Der hunnische König Etzel verfügt im Nibelungenlied zwar über eine andere Herkunft als der burgundische König Gunther oder der niederländische König Siegfried, doch wird diese Differenz nicht im Sinne eines ›rassischen‹ Unterschieds verstanden und zudem durch die gemeinsame Standeszugehörigkeit der betreffenden Souveräne konterkariert. Die folgende Einleitung in Gegenstand und Fragestellung des vorliegenden Sammelbandes umfasst drei Schritte. Zuerst rekonstruiert sie zentrale Thesen und Methoden der sozialwissenschaftlichen Intersektionalitätsforschung. Anschließend beleuchtet sie den in der Sozialwissenschaft, Geschlechterforschung und Literaturwissenschaft verwendeten Terminus der Rolle, um einen gemeinsamen Ausgangspunkt für den interdisziplinären Dialog über Fragen der Intersektionalitätsforschung zu finden. Im dritten und letzten Schritt fragt sie anhand des genannten Fallbeispiels nach der historischen Dimension der Intersektionalitätsforschung. 1. T HESEN UND M ETHODEN DER I NTERSEKTIONALITÄTSFORSCHUNG Die Intersektionalitätsforschung basiert auf dem Konzept der intersection, d.h. der Überschneidung und Überkreuzung verschiedener Identitätskategorien und Diskriminierungsformen in einer Person oder Personengruppe.1 Seit ihren Anfängen in 1 Winker, Gabriele/Degele, Nina: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten, Bielefeld 2009; aus mediävistischer Sicht: Beattie, Cordelia/ Fenton, Kirsten A.: Intersections of Gender, Religion and Ethnicitiy in the Middle Ages, Basingstoke 2010. E INFÜHRUNG |9 den 1980er Jahren hat sich die Intersektionalitätsforschung als eines der leitenden Paradigmen der Sozialwissenschaften etabliert. Der Ursprung der Intersektionalitätsforschung liegt in der feministischen Forschung, die seit den 1990er Jahren zunehmend Wert darauf legte, die Kategorie des Geschlechts nicht isoliert zu betrachten, sondern weitere Kategorien einzubeziehen, die für die Frage nach der sozialen Position und der Handlungsfähigkeit einer Person ebenso wichtig sind und ohne deren Berücksichtigung die Kategorie des Geschlechts nicht ausreichend differenziert analysiert werden kann.2 Aus dieser Perspektive verbindet sich die Diskriminierung, die eine Frau als Frau erlebt, vielfach mit weiteren Diskriminierungen, die aus ihrer sozialen, ethnischen, nationalen, religiösen, sexuellen, gesundheitlichen und altersbezogenen Position erwachsen. a) Mehrfachdiskriminierung und intersektionelle Unsichtbarkeit Wie die Rechtwissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw im Jahr 1991 in einem für die Intersektionalitätsforschung grundlegenden Beitrag gezeigt hat, läuft die separate Fokussierung einzelner Identitätskategorien und Diskriminierungsformen Gefahr, dass die Interdependenzen der Kategorien vernachlässigt und bestimmte Formen der Benachteiligung fortgeschrieben werden.3 Crenshaw zeigt diesen Sachverhalt anhand der prekären Situation afroamerikanischer Frauen auf. Sie stellt fest, dass das Problem des Sexismus vor allem anhand der Diskriminierung weißer Frauen und das Problem des Rassismus vor allem anhand der Diskriminierung schwarzer Männer diskutiert werden. So geraten die schwarzen Frauen aus dem Blick derer, die sich mit Problemen der Diskriminierung befassen. Die Marginalisierung, die afroamerikanische Frauen in der Gesellschaft erfahren, wiederholt sich selbst in denjenigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich der Kritik sexistischer und rassistischer Diskriminierung verschrieben haben. Am Problem der Vergewaltigung tritt dieses Phänomen besonders schmerzhaft zutage. In den USA überschneiden sich Sexismus und Rassismus in der Weise, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit vor allem auf solche Fälle konzentriert, in denen ein schwarzer Mann eine weiße Frau vergewaltigt. Die mögliche Täterschaft eines weißen Mannes wird ebenso vernachlässigt wie die mögliche Vergewaltigung einer schwarzen Frau. Für den weißen Mann bedeutet dieser Mechanismus Schutz vor Verdächtigung, für die 2 Vgl. Walgenbach, Katharina: »Gender als interdependente Kategorie«, in: Katharina Walgenbach u.a. (Hg.), Gender als interdependente Kategorie. Neue Perspektiven auf Intersektionalität, Diversität und Heterogenität, Opladen 22012, S. 23-64; Walgenbach bevorzugt den Begriff der Interdependenz gegenüber dem der Intersektionalität. 3 Crenshaw, Kimberlé: »Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color«, in: Stanford Law Review 43 (1991), S. 1241-1299. 10 | A NDREAS K RASS schwarze Frau gesteigerte Diskriminierung, insofern sie als schwarze Frau sowohl der sexistischen als auch der rassistischen Marginalisierung anheimfällt. Ein anderes, eher kulturgeschichtliches Beispiel, an dem Crenshaw ihr Anliegen verdeutlicht, ist die gerichtliche Verfolgung der US-amerikanischen Rap-Gruppe 2 Live Crew, die für ihre sexistischen Lieder berüchtigt war. Die Perfidie, die sie in dem Gerichtsverfahren erkennt, ist die verschleierte Zielsetzung der Ankläger. Diesen sei es weniger um den Schutz der Frauen als vielmehr darum gegangen, das Ressentiment gegen schwarze Männer, denen eine besondere Bereitschaft zur sexuellen Gewalt unterstellt wird, zu verfestigen. Die vorgebliche Ahndung von Sexismus sei für tendenziell rassistische Zwecke instrumentalisiert worden. Doch auch die Argumentation der Verteidigung, die die Lieder der Rap-Gruppe als karnevaleske Kritik an sexistischen Stereotypen adeln wollte, sei diskriminierend gewesen, weil sie außer Acht gelassen habe, dass es sich um eine reine Männerband handelte, die sexuelle Gewalt gegen schwarze Frauen zum Gegenstand musikalischer Unterhaltung machte. Für Crenshaw ist es signifikant, dass die Pop-Ikone Madonna, die als weiße Frau auf der Bühne häufig mit sexuellen Tabus wie Masturbation, Zölibat, Homosexualität und Gruppensex brach, derartige Gerichtsprozesse nicht fürchten musste. Der Mechanismus der Privilegierung der einen und der Diskriminierung der anderen verläuft auf eine komplexe, analytisch nur schwer zu entwirrende Weise. Sexismus und Rassismus verschränken sich so, dass mehrfach Diskriminierte selbst dann unsichtbar bleiben, wenn scheinbar ihre Sache verfochten wird. Crenshaw hat für den Sachverhalt, dass Mehrfachdiskriminierte oftmals nicht gesehen werden, den Terminus der ›intersektionellen Unsichtbarkeit‹ (intersectional invisibility) geprägt.4 Es handelt sich dabei um das Dilemma der gleichzeitigen Über- und Unter-Inklusion (over-inclusion, under-inclusion).5 Mit dem Begriff der Über-Inklusion ist gemeint, dass eine Teilgruppe einer Gesamtgruppe zugerechnet wird und somit in ihrer Eigenart nicht mehr zur Geltung kommt. So geraten die spezifischen Probleme schwarzer Frauen in generalisierenden feministischen und antisexistischen Diskursen, die die Sache ›der Frauen‹ insgesamt vertreten wollen, aus dem Blick. Im Falle der Unter-Inklusion hingegen werden die schwarzen Frauen aus der Gesamtgruppe der ›Schwarzen‹ ausgespart und kommen somit nicht mehr als Frauen in den Blick. Um die Differenz zwischen Über- und UnterInklusion besser zu verstehen, kann man die Logik der Mengenlehre heranziehen. In zwei sich überschneidenden Mengen (Frauen, Schwarze) liegt eine ÜberInklusion vor, wenn die Schnittmenge (schwarze Frauen) in der ersten Gesamtmen4 Vgl. Knapp, Gudrun-Axeli: »›Intersectional Invisibility‹: Anknüpfungen und Rückfragen an ein Konzept der Intersektionalitätsforschung«, in: Helma Lutz/Maria Teresa Herrera Vivar/Linda Supik (Hg.), Fokus Intersektionalität. Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzepts, Wiesbaden 2010, S. 223-243. 5 Ebd., S. 224f. E INFÜHRUNG | 11 ge (Frauen) aufgeht; und es liegt eine Unter-Inklusion vor, wenn dieselbe Schnittmenge aus der zweiten Gesamtmenge (Schwarze) ausgespart bleibt. Im ersten Fall wird von den schwarzen Frauen gesprochen, als wenn sie einfach nur ›Frauen‹ wären; im zweiten Fall werden die schwarzen Frauen verschwiegen, weil die Gesamtmenge der Schwarzen implizit auf die Teilmenge der schwarzen Männer reduziert wird. Gudrun-Axeli Knapp hat den Gedanken der intersektionellen Unsichtbarkeit um einige wichtige Aspekte bereichert. Sie weist zum einen daraufhin, dass auch der Sachverhalt der multiplen Privilegierung mit einem Unsichtbarkeitseffekt einhergeht. Dies betrifft die Rolle der weißen Männer. Knapp betont, »dass die androzentrische Struktur der symbolischen Ordnung sich nicht in der Markierung von Differenzen und Hierarchien erschöpft, sondern ihren Gipfel geradezu darin findet, dass der androzentrische Maßstab selber unmarkiert bleibt und als unmarkierter universalisiert wird, wie etwa im Begriff des Menschen oder der Person«.6 Es handelt sich also um jenes Phänomen, das in der Sprachwissenschaft als ›generisches Maskulinum‹ bezeichnet wird, nämlich die angebliche Fähigkeit männlicher Nomina und Pronomina, eine Gruppe zu bezeichnen, die Männer und Frauen zugleich umfasst bzw. die nicht zwischen Männern und Frauen differenziert. Es ist also zu unterscheiden zwischen der Unsichtbarkeit der mehrfach Diskriminierten, die aus dem Blickfeld gedrängt werden, und der Unsichtbarkeit der mehrfach Privilegierten, die das gesamte Blickfeld für sich beanspruchen. Der Mann macht sich als Mann unsichtbar, wenn er sich mit dem Menschen ›an sich‹ gleichsetzt. Eine weitere Unterscheidung, die Knapp vorschlägt, betrifft die Wiederholung der intersektionellen Unsichtbarkeit in der psychischen Selbstwahrnehmung der Menschen, also das intrasubjektive Pendant zu den intersubjektiven Verhältnissen. Sie denkt dabei »an Formen der Ausblendung, Verleugnung oder Verdrängung der Zugehörigkeit zu mehrfach diskriminierten oder privilegierten Sozialkategorien«.7 Mehrfach Diskriminierte werden sich oftmals ihrer Situation nicht bewusst und verkennen die Gründe ihrer Marginalisierung; häufig schotten sie sich auch »gegenüber der kränkenden Selbstwahrnehmung als Opfer von mehrfacher Abwertung« ab.8 Auf der Seite der Privilegierten verhält es sich oftmals so, dass die Privilegierten eine »Wahrnehmungsbarriere« errichten, die sie mit affektivem Aufwand verteidigen.9 Eine dritte Erweiterung des Konzepts der intersektionellen Unsichtbarkeit bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen handlungstheoretisch und gesellschaftstheoretisch orientierten Gesellschaftsanalysen. Zur intersektionellen Unsichtbarkeit gehören für Knapp auch die Verschleierungsstrategien, mit denen gesellschaftliche 6 Ebd., S. 227. 7 Ebd., S. 227f. 8 Ebd., S. 228. 9 Ebd., S. 228. 12 | A NDREAS K RASS Systeme jenseits der handelnden Akteure operieren: »Die Formen, in denen sich das Unsichtbarwerden vollziehen kann, reichen von der Naturalisierung, der Normalisierung bis hin zur Verdinglichung des Sozialen. In allen Fällen geht es um die Herstellung eines Scheins von Unmittelbarkeit, d.h. eines Scheins unvermittelter Gegebenheit, Ursprünglichkeit oder Natürlichkeit, der den Einblick in den tatsächlich gesellschaftlich-kulturellen Charakter der Phänomene verstellt«.10 b) Intersektionelle Kategorien und das »etc.«-Problem Kimberlé Crenshaw konzentriert sich auf zwei Kategorien: Geschlecht und ›Rasse‹.11 Beide Kategorien orientieren sich an einer binären Differenz: ›männlich‹ und ›weiblich‹ im ersten, ›weiß‹ und ›schwarz‹ im zweiten Fall. Die Merkmale ›schwarz‹ und ›weiblich‹ verweisen auf Diskriminierung, die Merkmale ›weiß‹ und ›männlich‹ auf Privilegierung. Die Intersektionalitätsforschung hat sich vielfach die Frage gestellt, wie viele Kategorien zu unterscheiden sind. Die Trias der klassischen Kategorien umfasst in der Regel Geschlecht, Klasse und ›Rasse‹.12 Vielfach wird als vierte Kategorie die Sexualität eingefordert, was mit dem spezifischen Forschungsinteresse der Queer Studies zusammenhängen dürfte. Freilich dürfen bei der Betrachtung auch Alter und Religion nicht fehlen. Helma Lutz und Norbert Wenning unterscheiden insgesamt dreizehn Kategorien, die allesamt binär strukturiert sind: (1) Geschlecht (männlich vs. weiblich), (2) Sexualität (hetero vs. homo), (3) ›Rasse‹ (weiß vs. schwarz), (4) Ethnizität (ethnisch vs. nicht ethnisch), (5) Nation (Angehörige vs. Nicht-Angehörige), (6) Klasse (oben/unten), (7) Kultur (›zivilisiert‹ vs. ›unzivilisiert‹), (8) Gesundheit (nicht-behindert vs. behindert), (9) Alter (alt vs. jung), (10) Herkunft (angestammt vs. zugewandert), (11) Besitz (reich vs. arm), (12) Nord/Süd, Ost/West, (13) gesellschaftlicher Entwicklungsstand (modern vs. traditionell).13 In einem Kommentar zur Liste nennen sie weitere Kategorien und Differenzen: Bildung (gebildet vs. ungebildet), Religion (gläubig vs. nicht gläubig), Sprachkenntnisse (standardsprachlich vs. nicht standardsprachlich), Stadt/Land. Die Vielzahl der Kategorien zeigt, dass der Wunsch, das Phänomen der Intersektionalität systematisch zu erfassen, stets präsent, in der Durchführung aber kaum zu erfüllen ist. Judith Butler hat die Schwierigkeit, die Kategorien vollständig zu benennen, auf den Punkt gebracht: »Auch Theorien feministischer Identität, die eine Reihe von Prädikaten wie Farbe, Sexualität, Ethnie, Klasse und Gesundheit aus10 Ebd., S. 231. 11 Zum Gebrauch von Anführungszeichen im Fall der ›Rasse‹ vgl. weiter unten. 12 Vgl. G. Winker/N. Degele: Intersektionalität, S. 15. 13 Lutz, Helma/Wenning, Norbert: »Differenzen über Differenz – Einführung in die Debatte«, in: Dies. (Hg.), Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft, Opladen 2011, S. 11-24, hier S. 20f. E INFÜHRUNG | 13 arbeiten, setzen stets ein verlegenes ›usw.‹ [etc.] an das Ende ihrer Liste. Durch die horizontale Aufzählung der Adjektive bemühen sich diese Positionen, ein situiertes Subjekt zu umfassen; doch gelingt es ihnen niemals, vollständig zu sein«.14 Wie sich die Reihe der Identitätskategorien als unabschließbar erweist, so scheitert vielfach auch die Reduktion der Kategorien auf plausible Binarismen. Im Falle des Geschlechts gibt es nicht nur die Opposition ›männlich‹ vs. ›weiblich‹, sondern auch die Optionen ›inter‹ und ›trans‹; im Falle der Sexualität gibt es nicht nur die Opposition ›hetero‹/›homo‹, sondern auch die Optionen ›bisexuell‹ und ›asexuell‹. Der Punkt, auf den es hier ankommt, ist die Unterscheidung zwischen einer essentialistischen und einer konstruktivistischen Sicht der Dinge. Wenn man die Kategorien und ihre binären Codes aufzählt, so sollte man sich stets der Tatsache bewusst sein, dass man es mit kulturellen Konstruktionen und nicht mit ontologischen Gegebenheiten zu tun hat. Die gesammelten Identitätskategorien sind nicht Wesenseigenschaften von Menschen, sondern kulturelle und soziale Zuschreibungen, die einen strategischen Zweck erfüllen. Dieser besteht in der Etablierung eines hierarchischen Systems von Bevorzugungen und Benachteiligungen, das ideologisch geprägt ist. Schon die Parzellierung der Identität und ihre Rückführung auf binäre Oppositionen, die in der Regel mit impliziten Akten der Privilegierung (männlich, weiß, gesund, jung, heterosexuell, reich etc.) und Diskriminierung (weiblich, schwarz, behindert, alt, homosexuell, arm etc.) einhergehen, sind Strategien dieses ideologischen Systems. Man sollte sich hüten, diese Strategien in der Analyse unhinterfragt zu wiederholen und somit ein weiteres Mal unsichtbar zu machen, was mithilfe des kritischen Blicks sichtbar gemacht werden sollte. c) Der Körper als intersektionelle Kategorie? Nina Degele und Gabriele Winker nehmen zu den Hauptkategorien Geschlecht, Klasse und ›Rasse‹ noch als vierte Kategorie den Körper hinzu. Sie gehen von der Beobachtung aus, dass die Kategorien des Geschlecht und der ›Rasse‹ in der Regel »mit dem Rekurs auf eine vermeintliche Naturhaftigkeit begründet und legitimiert werden«, dass dies aber bei der Kategorie der Klasse »schon längst nicht mehr der Fall sei«.15 Hinsichtlich der Klasse diene der Körper nicht der Strategie der Naturalisierung, sondern der ökonomisch motivierten Optimierung: »Körper können ihren Wert steigern […]. So sind sowohl Alter wie körperliche Verfasstheit, Gesundheit und Attraktivität in den letzten Jahrzehnten in Arbeitszusammenhängen immer bedeutsamer geworden und entscheiden über die Verteilung von Ressourcen«.16 Ausgehend von der erweiterten Reihe der »Strukturkategorien« entwerfen Degele und 14 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main 1991, S. 210. 15 G. Winker/N. Degele: Intersektionalität, S. 39. 16 Ebd., S. 40. 14 | A NDREAS K RASS Winker eine Systematik, die die Vielzahl der Kategorien auf vier Gruppen zurückführt.17 Mit der Kategorie der Klasse verbinden sich die »Klassismen« Bildung und Beruf, mit der Kategorie der ›Rasse‹ die »Rassismen« ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, mit der (aus den Queer Studies entlehnten) Kategorie der Heteronormativität die »Heteronormativismen« Geschlecht und Sexualität und mit der neuen Kategorie des Körpers die »Bodyismen« Behinderung und Alter. Zur Begründung der Strukturkategorie des Körpers verweisen die Autorinnen darauf, dass der Körper heutzutage »immer weniger als Naturtatsache, sondern als Kulturprodukt[]« erscheine.18 Dies ist insofern überzeugend, als Schönheit, Gesundheit und Alter zunehmend als ökonomische Ressourcen angesehen werden, die man durch bestimmte Praktiken wie Sport, Kosmetik und plastische Chirurgie optimieren kann: »Zur Bedingung sozialer und das heißt auf dem Arbeitsmarkt gewinnbringend einsetzbarer Wertschätzung gehören Jugendlichkeit, Schönheit, Fitness und Gesundheit«.19 Zur Markierung dieses Phänomens gibt es im englischen Sprachraum bereits eigene Termini wie lookism, ageism und ableism.20 Die Einführung des Körpers als vierte Strukturkategorie vermag vieles zu klären, und der angedeutete Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Körpers von der Naturalisierung zur Optimierung, von der natürlichen Gegebenheit zur kulturellen Ressource ist allemal erhellend. Doch erscheint auch eine Perspektive als plausibel, die den Körper nicht als eigene Kategorie klassifiziert, sondern als übergreifende Dimension, die alle Kategorien – wenn auch in je verschiedener Weise – betrifft. Gewiss trifft zu, dass die Kategorien der ›Rasse‹ und des Geschlechts eher auf einen naturalisierten Körper verweisen, die Kategorie der Klasse hingegen eher auf einen optimierten Körper. Doch ist darauf hinzuweisen, dass auch Hautfarbe und Geschlecht längst schon zum Gegenstand der kosmetischen und chirurgischen Manipulation geworden sind. Im Falle der Hautfarbe geht es dabei um einen Wechsel innerhalb des binären Codes schwarz/weiß, im Falle des Geschlechts um die Anpassung an ein heteronormatives Ideal, das paradoxerweise wiederum auf das Register der Natur verweist. Weiter ist zu bedenken, dass in den Epochen der Vormoderne der Körper durchaus noch als natürlicher Garant der Klasse verstanden wurde. Dem Adel wurde ein besonderes Charisma zugesprochen, das mit somatischen Vorstellungen einherging. Entscheidend ist, dass sämtliche Kategorien in der einen oder anderen Form auf die Dimension des Körpers bezogen sind, dass der Körper in der einen oder anderen Form stets als Garant oder Medium einer Kategorie vorgestellt wird. 17 Ebd., S. 41. 18 Ebd., S. 49. 19 Ebd., S. 51. 20 Ebd., S. 51. E INFÜHRUNG | 15 Die performative Dimension des Körpers ist besonders ausgiebig in den Gender Studies verhandelt worden. Seit Judith Butler ist die kategoriale Differenzierung zwischen natürlichem (sex) und kulturellem (gender) Geschlecht überholt. Der natürliche Körper ist immer schon ›gegendert‹, ist immer schon ein performativ hergestellter Effekt des kulturellen Körpers. Diese These lässt sich in der Weise verallgemeinern, dass der Mensch auch hinsichtlich aller anderen Kategorien über einen zweifachen Körper verfügt, wobei der natürliche nicht mehr vom kulturellen Körper zu trennen ist. Die Unterscheidung zwischen sex und gender wäre auf alle anderen Kategorien zu übertragen, auch wenn nur in wenigen Fällen die Möglichkeit einer lexikalischen Differenzierung zur Verfügung steht. Die vermeintlich natürlichen Körper sind in jedem Fall kulturelle Konstrukte – sei es, dass dieser Sachverhalt verschleiert (Geschlecht, Rasse) oder thematisiert (Klasse) wird. Dieser Sachverhalt tritt deutlicher hervor, wenn man die Schwierigkeiten berücksichtigt, die sich in deutschsprachigen Debatten mit der Kategorie der ›Rasse‹ verbinden. Der Begriff wird in der Regel umschrieben (›ethnische Zugehörigkeit‹) oder – wie auch in dieser Einführung – in einfache Anführungszeichen gesetzt. Damit soll markiert werden, dass die Kategorie der ›Rasse‹ einem biologistischen Denken entspringt und von rassistischen Ideologien belastet ist. Es gibt einen weit verbreiteten gesellschaftlichen Konsens, dass die Erinnerung an die nationalsozialistische Rassenpolitik es verbiete, den Begriff der ›Rasse‹ im deutschen Diskurs distanzlos zu verwenden. In anderen Ländern, beispielsweise den USA, stellt sich die Situation anders dar, zumal dort die Heterogenität der ethnischen Zugehörigkeiten und die Verschiedenheit der Hautfarben ein vergleichsweise selbstverständlicher Bestandteil der diskursiven und praktischen Alltagskultur sind. Es stellt sich die Frage, ob man der Gefahr des Rassismus entrinnt, indem man den Begriff der ›Rasse‹ umschreibt oder in einfache oder doppelte Anführungszeichen setzt. Kann diese Form der Vermeidung oder Markierung nicht ihrerseits ungewollt zur Verschleierung von Rassismus führen? Diese Problematik ließe sich theoretisch verallgemeinern und für die Intersektionalitätsforschung insgesamt nutzbar machen, indem man entweder – wie Degele und Winker – alle Identitätskategorien beim Namen nennt oder indem man alle Identitätskategorien in einfache Anführungszeichen setzt und konsequent nur noch von ›Geschlecht‹, ›Klasse‹, ›Rasse‹, ›Alter‹ etc. spricht. Die zweite Option hätte den Vorzug, dass sie das Bewusstsein für die kulturelle Konstruiertheit der körperlichen Dimension aller Kategorien stets präsent hielte. 16 | A NDREAS K RASS d) Methodologische Schlussfolgerungen Wie sich zeigte, besteht eines der methodologischen Hauptprobleme der Intersektionalitätsforschung im Umgang mit den Kategorien. Fraglich ist, wie viele Kategorien zu unterscheiden sind und wie sie sich systematisieren lassen; fraglich ist der Status der Kategorien zwischen essentialistischen und konstruktivistischen Perspektiven; fraglich ist auch, ob der Körper als eigene Kategorie zu werten ist oder als Dimension, die alle Kategorien betrifft. Leslie McCall hat in ihrem Aufsatz The Complexity of Intersectionality (2005) einen Versuch vorgelegt, auf der Basis bisheriger Studien eine systematische Methodologie der Intersektionalitätsforschung zu entwerfen, die sich auf das jeweils zugrundeliegende Verständnis der Kategorien bezieht .21 Sie unterscheidet drei Ansätze: antikategoriale Komplexität, interkategoriale Komplexität und intrakategoriale Komplexität. Der antikategoriale Ansatz zielt auf die Dekonstruktion der Kategorien; er versteht die intersektionellen Kategorien als soziale Fiktionen, die, indem sie Differenzen setzen, Ungleichheiten produzieren. Der interkategoriale Ansatz bedient sich der analytischen Kategorien in provisorischer Weise, um die wechselnden Verhältnisse der Ungleichheit zwischen sozialen Gruppen zu beschreiben. Der intrakategoriale Ansatz steht in der Mitte zwischen dem antikategorialen Ansatz, der Kategorien ablehnt, und dem interkategorialen Ansatz, der Kategorien strategisch nutzt; er fokussiert den intersektionellen Status bestimmter sozialer Gruppen, um ihre interne Komplexität zu enthüllen. Diese Ansätze schließen einander nicht aus. Der antikategoriale Ansatz entspringt einem Denken, das die essentialistische und naturalisierende Begründung von Kategorien hinterfragt. Auch wenn diese Kategorien letztlich soziale Konstruktionen darstellen, steht doch ihr erheblicher Einfluss auf die gesellschaftlichen Verhältnisse außer Frage; insofern empfiehlt es sich, die Kategorien – wie es der interkategoriale Ansatz hält – strategisch als Instrumente der Analyse heranzuziehen. Während der interkategoriale Ansatz eher das Zusammenspiel der Kategorien betrachtet, legt der intrakategoriale Ansatz Wert auf eine Sichtweise, die nach der internen Differenzierung bestimmter Kategorien fragt, also zum Beispiel die Kategorie des Geschlechts – grammatisch gesprochen – anhand der Kategorien der Klasse, der ›Rasse‹ etc. flektiert. Dem intrakategorialen Ansatz wohnt bereits eine dekonstruktive Tendenz inne, weswegen McCall ihn gemeinsam mit dem antikategorialen Ansatz abhandelt. Weitere methodologische Schlussfolgerungen lassen sich aus den vorausgehenden Überlegungen ableiten. Wie angesprochen, wäre es sinnvoll, die Erkenntnisse der Gender Studies auf alle Kategorien anzuwenden und nach der performativen Dimension nicht nur des Geschlechts, sondern auch der ›Rasse‹, der Klasse, der Se21 Mc Call, Leslie: »The Complexity of Intersectionality«, in: Signs 30 (2005), S. 17711800. E INFÜHRUNG | 17 xualität, des Alters, der Behinderung etc. zu fragen. Wie man in den Gender Studies vom Konzept des doing gender spricht, so kann es theoretisch und methodisch sehr erhellend sein, auch von doing class, doing race, doing age, doing (dis)ability usw. zu sprechen. Freilich ist dabei zu bedenken, dass die Kategorien nicht immer mit bestimmten Handlungsmöglichkeiten einhergehen, sondern gerade auch Handlungsmöglichkeiten einschränken können. Dem doing steht immer auch die Option des being done entgegen, und oftmals lassen sich diese Aspekte nicht wirklich auseinanderhalten. Es macht einen Unterschied, ob sich jemand bestimmter Handlungsmuster bedient, um seinen privilegierten Status auszuagieren, oder ob jemand bestimmten Handlungsmustern unterworfen und somit in eine diskriminierte Position versetzt wird. Tendenziell verweisen die binären Codes, auf die die Kategorien in der Regel programmiert sind, auf den Gegensatz von doing und being done, von Privilegierung einerseits und Diskriminierung andererseits. Wenn man den Körper nicht als eigenständige Kategorie, sondern als alle Kategorien betreffende Dimension klassifiziert, so kann man Ähnliches für den Raum postulieren. Der Körper ist im übertragenen Sinne ›Schauplatz‹ der Kategorien, der Raum ist es im wörtlichen Sinne. Das Subjekt ist stets nicht nur an einen Körper, sondern auch an einen Raum gebunden; es ist, überspitzt formuliert, immer auch ein Körper, der sich im Raum bewegt und jenseits von Körpern und Räumen keine Existenz hat. Der Raum bietet gewissermaßen den Rahmen, der bestimmte Achsen der Ungleichheit aktiviert, der bestimmte Merkmale privilegiert oder marginalisiert. Der Raum ist zugleich jene Dimension, in der sich die körperbezogenen Subjekte begegnen, in der sie durch sozialen Kontakt ihre Machtverhältnisse aushandeln. Als dritte Dimension neben Körper und Raum wäre noch die Zeit zu nennen; auf diesen Punkt wird zurückzukommen sein, wenn es um die Frage nach der historischen Dimension der Intersektionalitätsforschung gehen wird. 2. E RSTE E RWEITERUNG : I NTERSEKTIONALITÄTSFORSCHUNG L ITERATURTHEORIE UND Die Intersektionalitätsforschung ist in der Literaturwissenschaft bislang noch kaum rezipiert worden. Zwar analysiert man literarische Texte mit aller Selbstverständlichkeit aus den Perspektiven der Gender Studies, Queer Studies, Postcolonial Studies etc., doch fehlt es noch an dem Versuch, die entsprechenden Forschungsrichtungen und Forschungsgegenstände im Sinne der Intersektionalität systematisch zu verschränken. Dies ist in doppelter Hinsicht bedauerlich. Zum einen könnte die Literaturwissenschaft, insbesondere in ihrer kulturwissenschaftlichen Ausrichtung, viel von der Intersektionalitätsforschung lernen; zum anderen könnte auch die bis- 18 | A NDREAS K RASS her vor allem sozialwissenschaftlich geprägte Intersektionalitätsforschung in mancher Hinsicht von der Literaturwissenschaft profitieren. Einen ersten Ansatz dazu haben Degele und Winker bereits vorgelegt. Sie untersuchen in ihrer intersektionellen Ungleichheitsanalyse nicht nur die Ebenen der Identitätskonstruktionen und strukturellen Herrschaftsverhältnisse, sondern dezidiert auch die »Ebene symbolischer Repräsentationen«.22 Die Repräsentationsebene umfasst für sie die »kulturelle[n] Symbole«, die an der Herausbildung sozialer Ungleichheit beteiligt sind.23 Gemeint sind damit »Bilder, Ideen, Gedanken, Vorstellungen und Wissenselemente, welche Mitglieder in einer Gruppe, Gemeinschaft oder Gesellschaft kollektiv teilen«.24 Es versteht sich von selbst, dass die Literatur an der Produktion kultureller Symbole erheblichen Anteil hat. Doch ist auch die Ebene der Identitätskonstruktionen einzubeziehen, da ja insbesondere die Gattung des Romans vielfach von nichts anderem handelt als der Konstruktion einer Identität, nämlich der Identität einer imaginären Figur. Den erlebten Welten stehen erzählte Welten gegenüber, und zugleich sind die erzählten Welten Teil der erlebten Welten. Insofern ist es eine terminologische Verkürzung, wenn man von symbolischen ›Repräsentationen‹ spricht, weil dies dem Missverständnis Vorschub leisten könnte, dass die Literatur die Lebenswelt abbildet. Was die Literatur leistet, geht weit über die Repräsentation von Wirklichkeit hinaus; sie ist nicht mimetisch in dem einfachen Sinn, dass sie die Welt in ähnlicher oder verfremdeter Weise abbildet und nachahmt. Der Literatur wohnt die genuine Fähigkeit zur Konstruktion imaginärer Welten inne, die Teil der realen Welt sind und sie in entscheidender Weise mit prägen. Literatur ist, um eine andere Metapher zu benutzen, immer auch ein Probehandeln, der Versuch, einen Spielraum zu schaffen, in dem Unvordenkliches gedacht und Unanschauliches zur Anschauung gebracht werden kann. Aus der Konfrontation zwischen der realen Welt und der fiktiven Welt, die sich auf jene in komplexer Weise bezieht, erwächst ein Raum der Reflexion und Imagination, der die gesellschaftliche Lebenswelt der Leser_innen überspannt. Die Gattungen der Literatur, insbesondere das Epos, der Roman und das Drama, etablieren imaginäre Welten, die aus Figuren bestehen, die in bestimmten Räumen und zu bestimmten Zeiten agieren. Daher ist es eine zentrale Aufgabe der literarischen Analyse, mit erzähl- und dramentheoretischen Mitteln die Konstellationen der Figuren-, Raum- und Zeitstruktur zu untersuchen. Hinzu kommt im Falle des Romans noch die Frage der Perspektivierung, der mehr oder weniger lenkenden Instanz eines Erzählers, der einen impliziten Adressaten im Blick hat. Diese Differenzierungen, die zum täglichen Brot der Literaturwissenschaft zählen, können viel22 G. Winker/N. Degele: Intersektionalität, S. 20. 23 Ebd., S. 18. 24 Ebd., S. 21, unter Bezug auf Schützeichel, Rainer: Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung, Konstanz 2007, S. 451; vgl. auch S. 55-59. E INFÜHRUNG | 19 leicht auch helfen, sozialwissenschaftliche Ansätze der Gesellschaftsanalyse weiter auszudifferenzieren. Um die Intersektionalitätsforschung mit literaturwissenschaftlichen Perspektiven zu vermitteln, bietet sich ein Konzept an, das für die Gesellschaftswissenschaften, die Literaturwissenschaften und die Geschlechterforschung gleichermaßen relevant ist. Es handelt sich um einen Begriff, der eng mit der Vorstellung verknüpft ist, dass die Welt eine Bühne sei (theatrum mundi). Gemeint ist das performative Konzept der Rolle, das nachfolgend unter den Gesichtspunkten der ›sozialen Rolle‹ (Gesellschaftswissenschaften), der ›Geschlechterrolle‹ (Geschlechterforschung) und der ›Handlungsrolle‹ (Literaturwissenschaften) entfaltet werden soll. Zwar ist der Rollenbegriff inzwischen vielfach aus guten Gründen in neue Konzepte transformiert worden. In den Gesellschaftswissenschaften spricht man heute eher vom ›Habitus‹ als von der ›sozialen Rolle‹, in der Geschlechterforschung eher von ›Gender‹ als von der ›Geschlechterrolle‹. Für die interdisziplinäre Vermittlung der Intersektionalitätsforschung erweisen sich gleichwohl beide Ansätze als hilfreich: sowohl der Vergleich des jeweiligen Rollenkonzepts wie auch die Rekonstruktion der Gründe für die jeweilige terminologische Verschiebung. a) Gesellschaftswissenschaften: Soziale Rolle/Habitus Ralf Dahrendorf unterscheidet in seinem Buch Homo Sociologicus, einem »Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle«, zwischen sozialer Position einerseits und sozialer Rolle andererseits.25 Jeder Mensch, so stellt er fest, müsse »in der Regel eine Mehrzahl von Positionen einnehmen«, und es sei wahrscheinlich, »dass die Zahl der auf Einzelne entfallenden Positionen mit der Komplexität von Gesellschaften wächst«.26 Daher sei es Aufgabe der Soziologie, die »Einheit des Menschen aufzulösen in Elemente, aus denen menschliches Handeln sich aufbaut«.27 In seiner Aufzählung der betreffenden Elemente nennt Dahrendorf zahlreiche Kategorien, die auch in der Intersektionalitätsforschung geläufig sind: »Für jede Position, die ein Mensch haben kann, sei sie eine Geschlechts- oder Alters-, Familien- oder Berufs-, National- oder Klassenposition oder von noch anderer Art, kennt ›die Gesellschaft‹ Attribute und Verhaltensweisen, denen der Träger solcher Positionen sich gegenübersieht und zu denen er sich stellen muß«.28 Neben den Kategorien des Geschlechts, der Klasse, der Nation und des Alters führt Dahrendorf auch den familiären und beruflichen Status an. Das fiktive 25 Dahrendorf, Ralf: Homo Sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle, 16. Auflage mit einem neuen Vorwort, Wiesbaden 2006 [Erstdruck 1965]. 26 Ebd., S. 30, meine Hervorhebung. 27 Ebd., S. 23. 28 Ebd., S. 27. 20 | A NDREAS K RASS Beispiel, an dem er seine Rollentheorie illustriert, ist »Herr Schmidt«, seines Zeichens deutscher Studienrat und Familienvater.29 Dahrendorf wählt somit eine Person, die als weißer, wohlhabender, heterosexueller Mann im privilegierten Zentrum des Patriarchats steht und keiner Minderheitengruppe angehört. Dahrendorf nimmt das Merkmal der sexuellen Orientierung zwar nicht in die Liste der sozialen Positionen auf, geht aber in seinen Ausführungen über das Geschlecht darauf ein: »Als Mann darf Herr Schmidt keinen Geschlechtsverkehr mit anderen Männern unterhalten«.30 Die ausdrückliche Erwähnung der Homosexualität ist vor dem Hintergrund des Paragraphen 175 zu verstehen, der nach dem Krieg in der von den Nationalsozialisten verschärften Form in das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland übernommen wurde und erst 1969 – vier Jahre nach dem ersten Erscheinen von Dahrendorfs Buch – entschärft wurde. Die Kategorien der ›Rasse‹ und der Religion bleiben hingegen unsichtbar, sowohl in der Liste als auch in den Ausführungen. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass der Normalbürger Schmidt christlichen Glaubens und europäischer Abstammung ist. In seinen Ausführungen zur sozialen Rolle bringt Dahrendorf dann die Analogie zum Theater ins Spiel: »[Z]u jeder sozialen Position gehört eine soziale Rolle. Indem der Einzelne soziale Positionen einnimmt, wird er zur Person des Dramas, das die Gesellschaft, in der er lebt, geschrieben hat. Mit jeder Position gibt die Gesellschaft ihm eine Rolle in die Hand, die er zu spielen hat. Durch Positionen und Rollen werden die beiden Tatsachen des Einzelnen und der Gesellschaft vermittelt«.31 Unter sozialen Rollen ist also die Performanz der sozialen Positionen in der Gesellschaft zu verstehen. Die Metapher der Rolle verweist darauf, dass der Mensch in seinen typischen Verhaltensweisen auf gesellschaftliche Erwartungen reagiert und vorgeschriebene Handlungsmuster in die Tat umsetzt: »Wenn wir von sozialen Rollen sprechen, dann ist stets nur von erwartetem Verhalten die Rede […]. Die Vermittlung von Einzelnem und Gesellschaft geschieht nicht schon dadurch, daß der Einzelne handelt oder soziale Beziehungen unterhält, sondern erst in der Begegnung des handelnden Einzelnen mit vorgeprägten Formen des Handelns«.32 Mit anderen Worten sind soziale Rollen »Bündel von Erwartungen, die sich in einer gegebenen Gesellschaft an das Verhalten der Träger von Positionen knüpfen«.33 Die Metapher des Bündels lässt sich auf das Anliegen der Intersektionalitätsforschung beziehen, die Kategorien im Zusammenhang zu betrachten. Wie Dahrendorf weiter ausführt, »verrät das Aussehen eines Menschen oft, ›wer er ist‹, d.h. welche sozia- 29 Ebd, S. 29 u.ö. 30 Ebd., S. 37. 31 Ebd., S. 32. 32 Ebd., S. 34 (meine Hervorhebung). 33 Ebd., S. 33. E INFÜHRUNG | 21 len Positionen er einnimmt«.34 Das äußere Erscheinungsbild des Menschen ist für seine soziale Position ebenso signifikant wie das Verhalten. Zur Aufführung der sozialen Rolle gehören, so könnte man sagen, auch Kostüm und Maske. Entsprechend unterscheidet Dahrendorf zwischen Rollenverhalten und Rollenattributen: »Soziale Rollen bezeichnen Ansprüche der Gesellschaft an die Träger von Positionen, die von zweierlei Art sein können: einmal Ansprüche an das Verhalten der Träger von Positionen (Rollenverhalten), zum andern Ansprüche an sein Aussehen und seinen ›Charakter‹ (Rollenattribute)«.35 In den letzten Jahrzehnten wurde Dahrendorfs rollentheoretische Terminologie weitgehend von der von Pierre Bourdieu geprägten Theorie des ›Habitus‹ abgelöst. Die Rollentheorie ist damit nicht völlig obsolet geworden, zumal sich viele ihrer Thesen in der Habitustheorie wiederfinden. Im Zusammenhang der Intersektionalitätsforschung lassen sich vier Vorzüge benennen, die dem Begriff des ›Habitus‹ eignen. Erstens vermag er die Komplexität dessen, was die Rollentheorie als Konglomerat sozialer Positionen und Rollen beschreibt, in einem schlüssigen Begriff zusammenfassen. Zweitens erlaubt er, die problematische Vorstellung der ›Identität‹ zu umgehen, indem er den Akzent vom Sein auf das Tun einer Person verschiebt. Drittens ist die dialektische Auffassung von Performativität hilfreich, die der ›Habitus‹ im Sinne Bourdieus impliziert: als Produkt des Handelns einerseits (opus operatum) und als Prinzip des Handelns (opus moderandi) andererseits. Damit wird viertens deutlich, dass das Handeln einer Person nicht als frei gewählte Rolle zu verstehen ist, sondern als Spannung von eingeübtem und ausgeübtem Verhalten, von Disposition und Praxis. b) Geschlechterforschung: Geschlechterrolle/Gender Schon Dahrendorf macht in seinen Ausführungen deutlich, dass das Bild der Rolle nicht dazu verleiten dürfe, sie als scheinbar und beliebig aufzufassen: »Während die Uneigentlichkeit des Geschehens für das Schauspiel konstitutiv ist, wäre sie im Bereich der Gesellschaft eine höchst mißverständliche Annahme«.36 Diese Differenzierung weist bereits auf die Unterscheidung zwischen Performanz und Performativität voraus, die Judith Butler in ihrem Buch Das Unbehagen der Geschlechter vornimmt. Wie Butler am Beispiel der Drag Queen erläutert, findet die performance des Geschlechts auf der Bühne statt, wenn ein Mann eine Frauenrolle spielt; die performativity des Geschlechts hingegen ist ein alltägliches Drama, dem der Mensch nicht ohne weiteres entrinnen kann. So formuliert Butler in Anspielung auf die Metaphorik des Theaters: »In welchem Sinne ist die Geschlechtsidentität ein 34 Ebd., S. 34. 35 Ebd., S. 33. 36 Ebd., S. 27. 22 | A NDREAS K RASS ›Akt‹ [act]? Ähnlich wie andere rituelle gesellschaftliche Inszenierungen [dramas] erfordert auch das Drama der Geschlechtsidentität eine wiederholte Darbietung [performance]«.37 Die Unausweichlichkeit der Geschlechtsidentität zeigt sich darin, dass sie durch beständige Repetition eingeübt wird, bis sie den Effekt der ›Eigentlichkeit‹ hervorruft. Butler bedient sich zwar der Metaphorik des Theaters, wenn sie von »drama«, »act« und »performance« spricht, distanziert sich aber explizit vom Begriff der Geschlechterrolle (gender role). In ihrem 1988 erschienenen Beitrag Performative Acts and Gender Constitution vergleicht Butler die sozialwissenschaftliche mit der theaterwissenschaftlichen Rollentheorie und führt aus: »As a consequence, gender cannot be understood as a role which either expresses or disguises an interior ›self,‹ whether that ›self‹ is conceived as sexed or not. As performance which is performative, gender is an ›act,‹ broadly construed, which constructs the social fiction of its own psychological interiority«.38 Ganz ähnlich schreibt sie in ihrem 1993 erschienenen Aufsatz Critically Queer: »The misapprehension about gender performativity is this: that gender is a choice, or that gender is a role, or that gender is a construction that one puts on, as one puts on clothes in the morning«.39 Hinsichtlich seiner Performativität ist das Geschlecht also nicht als gespielte Rolle aufzufassen, sondern als Handlung, die das gesellschaftliche Phantasma eines Wesenskerns hervorbringt. Entsprechend distanziert sich Butler von der Rollentheorie der Gesellschaftswissenschaften: »As opposed to a view such as Erving Goffman’s which posits a self which assumes and exchanges various ›roles‹ within the complex social expectations of the ›game‹ of modern life, I am suggesting that this self is not only irretrievably ›outside‹, constituted in social discourse, but that the ascription of interiority is itself a publically regulated and sanctioned form of essence fabrication«.40 Mit diesen Sätzen macht Butler unmissverständlich klar, dass das Geschlecht keine Rolle ist, die eine Person – und sei es aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen – angenommen hätte und die somit noch vom Selbst dieser Person unterschieden werden könnte. Vielmehr versteht sie das Selbst bereits als Effekt der Rollenzuschreibung. Kurz gesagt: Die Rolle generiert die Fiktion eines Selbst. Während also die Aufführung einer Geschlechterrolle auf der Bühne die Differenzierung zwischen Schauspieler und gespielter Rolle zulässt, ist eine solche Diffe37 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main 1991, S. 206 [Gender Trouble, S. 140]. 38 Butler, Judith: »Performative Acts and Gender Constitution. An Essay in Phenomenology and Feminist Theory«, in: Theatre Journal 40 (1988), S. 519-531, hier S. 528 (Hervorhebung im Original). 39 Butler, Judith: »Critically Queer«, in: GLQ. A Journal of Lesbian and Gay Studies 1 (1993), S. 17-32, hier S. 21 (meine Hervorhebung). 40 J. Butler: Performative Acts, S. 528. E INFÜHRUNG | 23 renzierung im Falle der Geschlechtsidentität (im Sinne von Gender) nicht möglich, da deren beständige Ausübung die Illusion eines dahinterliegenden Wesenskerns allererst hervorbringt. Insofern ist es auch missverständlich, wenn man, wie es oft geschieht, den englischen Terminus ›gender‹ als (soziale oder kulturelle) Geschlechterrolle übersetzt; inzwischen ist das Wort eingedeutscht und kann auch in dieser Form verwendet werden: ›Gender‹. Die Verwendung impliziert, dass man Geschlecht nicht als natürliche Gegebenheit versteht, sondern als kulturelles Geschlecht, das das anatomische Geschlecht (›sex‹) einschließt und nicht im Sinne einer angenommenen ›Rolle‹ von der Person selbst unterschieden werden kann. Butlers Thesen sind in der Sozialwissenschaft auch jenseits der Gender Studies rezipiert worden. So betont Bourdieu in seinem Buch über den männlichen Habitus mit Bezug auf Butler: »Die Geschlechter sind alles andere als bloße ›Rollen‹, die man (in der Art der drag queens) nach Belieben zu spielen vermöchte, denn sie sind in die Körper und ein Universum eingeprägt und beziehen daraus ihre Macht«.41 c) Literaturwissenschaften: Handlungsrolle/Figur Wie Dahrendorf hervorhebt, stammt der Begriff der ›Rolle‹ aus dem Bereich des Theaters.42 Er meint zunächst die Schriftrolle, die den Text des Schauspielers enthält, bezeichnet dann aber auch metonymisch den gespielten Charakter selbst. Zu unterscheiden ist demnach – dies gilt auch für den Spielfilm – zwischen drei Sachverhalten: dem Schauspieler (einer empirischen Person), dem Charakter (einer fiktiven Figur) und den Worten und Handlungen, die das Textbuch vorgibt (der Rolle im engeren Sinne). Wenn Dahrendorf von sozialen Rollen spricht, so meint er die Einheit dieser drei Komponenten, wie ja auch der Zuschauer im Theater oder Kino nur den in der Rolle sprechenden und handelnden Schauspieler zu Gesicht bekommt. Der Schauspieler kann die Bühnenrolle ablegen, wenn er das Theater oder den Filmset verlässt, nicht aber die soziale Rollenerwartung, die die Gesellschaft an ihn richtet. Auch in der Literaturwissenschaft ist von Rollen die Rede, nämlich im Zusammenhang der strukturalistischen Analyse von Erzählungen.43 Wladimir Propp hatte aus zahlreichen russischen Zaubermärchen eine Sequenz von einunddreißig narrativen Einheiten destilliert, die er in acht Handlungskreisen zusammenfasste. Jedem Handlungskreis ist ein Handlungsträger zugeordnet: Held, Gegenspieler, falscher 41 Bourdieu, Pierre: Die männliche Herrschaft, Frankfurt am Main 2005, S. 178, Anm. 36. 42 R. Dahrendorf: Homo Sociologicus, S. 22. 43 Vgl. zusammenfassend Grob, Thomas: »Aktant«, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft 1 (1997), S. 32 f.; aus mediävistischer Perspektive: Warning, Rainer: »Formen der Identitätskonstitution im Höfischen Roman«, in: Odo Marquard/Karlheinz Stierle (Hg.), Identität, München 1979, S. 553-589. 24 | A NDREAS K RASS Held, Schenker, Helfer, Sender, Prinzessin, Vater der Prinzessin. Auf dieser Grundlage entwickelte Algirdas Julien Greimas eine Erzählgrammatik, die zwischen Handlungsträgern (›Aktanten‹), Handlungsrollen (›aktantielle‹ bzw. ›thematische Rollen‹) und handelnden Figuren (›Akteuren‹) unterscheidet. Die ›aktantielle Rolle‹ ist eher syntaktisch-abstrakt, die ›thematische Rolle‹ eher semantisch-konkret gedacht; gemeinsam ergeben sie die handelnde Figur. Wie zwischen Handlungsträger und Handlungsrolle zu unterscheiden ist, so verbietet sich auch die Gleichsetzung von Handlungsträger und handelnder Figur. Denn in einer Figur können mehrere Rollen zusammenfallen, wie sich auch umgekehrt eine Rolle auf mehrere Figuren verteilen kann. Dieser Sachverhalt lässt sich an einer Szene aus dem Nibelungenlied illustrieren. König Gunther muss bei seiner Werbung um Brünhild eine Reihe von Wettspielen bestehen, denn nur wer die isländische Prinzessin im Kampf überwindet, kann sie für sich gewinnen. Brünhild ist in diesem Fall nur eine Figur, vereint aber zwei Handlungsrollen in sich: die Handlungsrolle der Prinzessin, die vom Helden zu erwerben ist, und die Handlungsrolle des Vaters der Prinzessin, der den Helden im Zweikampf am Erwerb seiner Tochter zu hindern sucht. Wie man literaturtheoretisch zwischen Rolle und Figur unterscheiden muss, so auch zwischen Figur und Person. Wer bei der Lektüre des Nibelungenlieds Brünhild begegnet, hat es mit einer fiktiven Figur zu tun, die keine Existenz jenseits des Textes hat, aber von den Rezipient_innen dennoch nach dem Vorbild einer empirischen Person imaginiert wird. Roland Barthes erläutert diesen Sachverhalt im Rahmen einer beispielhaften Analyse von Honoré de Balzacs Erzählung Sarrasine.44 In einem sehr dicht und abstrakt formulierten Abschnitt mit der Überschrift »Person und Figur« führt er aus: »Wenn identische Seme wiederholt denselben Eigennamen durchqueren und sich in ihm festzusetzen scheinen, entsteht eine Person. Die Person ist also ein Produkt der Kombinatorik: die Kombination ist relativ stabil (von der Rückkehr der Seme markiert) und mehr oder weniger komplex (mit Merkmalen, die mehr oder weniger kongruent, mehr oder weniger widersprüchlich sind); diese Komplexität bestimmt die ›Persönlichkeit‹ der Person«.45 Wenn Barthes in diesem Zusammenhang von einer Person spricht, so meint er nicht eine reale, sondern eine virtuelle Person. Er zielt auf den Realitätseffekt, der sich bei der Lektüre einstellt, wenn sich im Laufe des Textes bestimmte Zeichen unter dem Namen einer erzählten Figur versammeln. Barthes illustriert diesen Vorgang mit der Metapher des Magnetfelds: »Der Eigenname funktioniert wie das Magnetfeld der Seme; indem er virtuell auf einen Körper verweist, zieht er die semische Konfiguration in eine evolutive (biographische) Zeit«.46 Über einen Körper verfügt die virtuelle Person nur in dem Maße, wie die Vorstellung eines Körpers vom Text evoziert und von den Le44 Barthes, Roland: S/Z, Frankfurt am Main 21994, S. 71f. 45 Ebd., S. 71. 46 Ebd., S. 71. E INFÜHRUNG | 25 senden imaginiert wird. Die Figur aber ist der Zeichenkomplex, der dieser Imaginationsleistung vorausliegt: »Ganz anders ist die Figur: keine Kombination von Semen mehr, die auf einen bürgerlichen Namen festgelegt sind, die Biographie, die Psychologie, die Zeit können sich ihrer bemächtigen; eine nicht standesmäßige, unpersönliche, achronische Konfiguration symbolischer Beziehungen«.47 Die Figur, verstanden als zeichenhafte Konfiguration, entbehrt der Biographie und Psychologie, des Namens und Standes, der Zeit und des Raums. Sie ist, wie Barthes auch sagt, eine »symbolische Idealität«.48 Auch auf die Rolle kommt Barthes zu sprechen. Er grenzt Person, Figur und Rolle in folgender Weise voneinander ab: »Als Figur kann die Person zwischen zwei Rollen hin- und heroszillieren, ohne daß diese Oszillation einen Sinn hätte, denn sie findet außerhalb der biographischen Zeit statt (außerhalb der Chronologie): die symbolische Struktur ist vollständig reversibel: man kann sie in allen Richtungen lesen. So können die Frau-als-Kind und der Erzähler-als-Vater, die einen Moment lang in den Hintergrund getreten waren, zurückkehren und die Frau-alsKönigin und den Erzähler-als-Sklaven überdecken«49. Somit geht auch Barthes von der Möglichkeit aus, dass sich in einer Figur mehrere Rollen überlagern oder eine Rolle auf mehrere Figuren verteilt. Im Falle der von Barthes untersuchten Erzählung (Balzacs Erzählung Sarrasine) wechseln die Figuren zwischen verschiedenen Rollen, gehen sie verschiedene Rollenbeziehungen ein. Dass sie dies können, hängt mit der semiotischen Verfasstheit von Rolle und Figur zusammen. Sie sind eine »symbolische Struktur« und als solche »vollständig reversibel« und in alle Richtungen lesbar. Insofern Rolle, Figur und Person in der Vorstellungskraft der Rezipient_innen wieder in eins fallen, sind sie nur verschiedene Aspekte desselben semiotischen Phänomens. Daher kann Barthes formulieren, dass die Person als Figur zwischen zwei Rollen zu wechseln vermag. d) Methodologische Schlussfolgerungen Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Vergleich der gesellschaftswissenschaftlichen, geschlechtertheoretischen und literaturtheoretischen Rollenkonzepte für die Intersektionalitätsforschung ziehen? Betrachtet man Geschlecht, Klasse, ›Rasse‹, Nation, Religion, Sexualität, Alter und Behinderung unter dem Gesichtspunkt der Rolle, so wird noch einmal der Sachverhalt evident, dass es sich nicht um natürliche Gegebenheiten, sondern um kulturelle Konstruktionen handelt. Zugleich wird die performative Dimension der betreffenden Kategorien deutlich, denn sie ist das verbindende Element der erläuterten Rollenkonzepte. Wenn Dahrendorf betont, 47 Ebd., S. 71f. 48 Ebd., S. 72. 49 Ebd., S. 72. 26 | A NDREAS K RASS dass soziale Rollen nicht dem Willen oder der Natur des Individuums entspringen, sondern vielmehr den Erwartungen, die die Gesellschaft an das Aussehen und Verhalten des Individuums richtet, so wird klar, dass es sich um Konstruktionen handelt, die von den Individuen ›aufgeführt‹ werden. Butler geht einen Schritt weiter, wenn sie den Begriff der ›Rolle‹ gänzlich ablehnt, um der Fiktion eines Selbst, das jenseits der Rolle existiere, entgegenzuwirken. Die fiktionale Dimension, auf die Butler hinweist, lässt sich mit der literaturwissenschaftlichen Unterscheidung zwischen fiktiven Figuren und empirischen Personen in Beziehung setzen, denn auch die Vorstellung, dass sich hinter einer Romanfigur ein ›Selbst‹ befände, ist aus erzähltheoretischer Perspektive naiv. Festzuhalten ist ferner, dass Literatur, Theater und Film entscheidenden Anteil an der Konstruktion der sozialen Rollen (bzw. eines Habitus) haben. Bei den Rollen, die Literatur, Theater und Film anbieten, handelt es sich um Modellierungen sozialer oder kultureller Rollenerwartungen. Zugleich liefern sie oftmals eine kritische Reflexion dieser Erwartungen mit. Insofern bieten Epen, Romane, Dramen und Filme geeignete Ansatzpunkte für die Rekonstruktion der sozialen Rollen einer bestimmten Kultur in einer bestimmten Epoche. Die dramentheoretische Unterscheidung zwischen Rolle, Charakter und Schauspieler einerseits und die erzähltheoretische Unterscheidung zwischen Rolle, Figur und Person andererseits können mit dem gesellschaftswissenschaftlichen Konzept der sozialen Rolle verknüpft und somit für die Intersektionalitätsforschung methodisch nutzbar gemacht werden. Die Unterscheidung zwischen Person und Figur könnte geeignet sein, um den subjektphilosophischen Sachverhalt zu markieren, dass das Subjekt von den sozialen und kulturellen Vorbildern, mit denen es konfrontiert wird, allererst hervorgebracht wird.50 Die erzähltheoretische Erkenntnis, dass eine Figur mehrere Handlungsrollen in sich vereinen kann, kommt der Vorstellung der Intersektionalitätsforschung entgegen, dass sich das Individuum als Schnittpunkt oder Bündel verschiedener Kategorien konstituiert und dass sich dieser Konstitutionsprozess performativ vollzieht. 3. Z WEITE E RWEITERUNG : I NTERSEKTIONALITÄTSFORSCHUNG L ITERATURGESCHICHTE UND Dahrendorf bezieht in seine Überlegungen eine historische Perspektive ein, wenn er feststellt, dass »auch soziale Rollen ständigem Wandel« unterliegen.51 Degele und 50 Vgl. Butler, Judith: Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt am Main 2001. 51 R. Dahrendorf: Homo Sociologicus, S. 40. E INFÜHRUNG | 27 Winker geben hierfür ein Beispiel, wenn sie im Zuge ihrer Überlegungen über den Status des Körpers feststellen, dass die Naturalisierung der Klassenzugehörigkeit »schon längst nicht mehr der Fall sei«.52 In der Tat bedarf es einer Historisierung der intersektionellen Kategorien. Dabei sind zwei Aspekte zu unterscheiden: zum einen die Historisierung der einzelnen Kategorien, zum anderen die Historisierung des Zusammenspiels der Kategorien. Ansatzpunkte für den Entwurf einer historischen Intersektionalitätsforschung bieten historiographische Studien wie Jeffrey Richards Buch über Minority Groups in the Middle Ages (1991) und der kürzlich erschienene Sammelband Intersections of Gender, Religion and Ethnicity in the Middle Ages (2011) von Cordelia Beattie und Kirsten A. Fenton. Während Richards nach sechs mittelalterlichen Minoritäten (Ketzer, Hexen, Juden, Prostituierte, Homosexuelle, Aussätzige) fragt, fokussieren Beattie und Fenton drei intersektionelle Kategorien, nämlich Geschlecht, Religion und Ethnizität. Richards arbeitet heraus, dass die Diskurse über die mittelalterlichen Minderheiten so flexibel waren, dass eine Minderheit durch die andere substituiert werden konnte. So waren nicht nur die Prostituierten und Homosexuellen auf die Sexualität bezogen, sondern auch die Hexen und Ketzer, denen sexuelle Rituale unterstellt wurden, oder auch die Aussätzigen, deren Krankheit als Strafe für sexuelle Vergehen gedeutet werden konnte. Diesen Sachverhalt könnte man auch als intersektionelle Diskriminierung beschreiben. Beattie und Fenton betonen die Andersartigkeit des Mittelalters gegenüber der Neuzeit: »For the modern period, the core focus has often been ›race‹, class, and gender. However, taking the approach into a medieval realm helps to shed a different light because these categories are not as apparently self-evident (socially or analytically) in the pre-modern world«.53 Auch die mediävistische Literaturwissenschaft bietet geeignete Ansatzpunkte für die historische Intersektionalitätsforschung, weil sich anhand literarischer Texte aus verschiedenen literaturgeschichtlichen Epochen die Genealogie, Mutabilität und Konvertibilität der Kategorien rekonstruieren lässt.54 a) Intersektionelle Kategorien in mediävistischer Sicht Die Alterität des Mittelalters bietet einen guten Ansatzpunkt, um die intersektionellen Kategorien zu historisieren. Aus mediävistischer Sicht stellen sich Klasse, ›Rasse‹, Geschlecht, Sexualität, Religion, Nation, Alter und Behinderung anders dar als heute. Diese Differenz lässt sich am Beispiel des Nibelungenlieds und seiner modernen Bearbeitungen illustrieren. In den 1920er Jahren kommen Wissensbestände 52 G. Winker/N. Degele: Intersektionalität, S. 39. 53 C. Beattie/K.A. Fenton: Intersections, S. 2. 54 Vgl. Richards, Jeffrey: Sex, Dissidence and Damnation: Minority Groups in the Middle Ages, London/New York 1994. 28 | A NDREAS K RASS ins Spiel, die im Mittelalter noch keine Relevanz hatten. Für die Kategorie des Geschlechts ist das Bild der ›neuen Frau‹ zu nennen, die sich auch sportlich betätigt (Brunhild als Athletin); für die Kategorie der ›Rasse‹ ist an die modernen Rassenlehren zu denken, die einen Unterschied zwischen zivilisatorisch überlegenen und unterlegenen Völkern machen (Etzel als ›asiatischer‹ Herrscher); für die Kategorie der Nation sind die nationalistischen Mythologien der deutschen Politik anzuführen, die sich auf germanische Traditionen beruft (Siegfried im Nibelungenland als ›germanischer‹ Held). Im Folgenden sei in aller Kürze ein Überblick über die intersektionellen Kategorien aus mediävistischer Sicht versucht, der sich auf die ritterlichhöfische Gesellschaft und Dichtung des Hochmittelalters beschränkt. Diese Herangehensweise, die von den modernen Gegebenheiten ausgeht und ihnen die mittelalterlichen Konzepte zuordnet, ist nur eine Möglichkeit der Historisierung der intersektionellen Kategorien. Man könnte auch von den mittelalterlichen Kategorien ausgehen, und ihnen die modernen Pendants zuordnen. Dieser zweite Weg würde mindestens teilweise zu anderen Resultaten führen. (1) Klasse: Für das Mittelalter sollte man eher von Stand als von Klasse sprechen.55 Die idealtypische Ständeordnung des Mittelalters umfasst Adel, Klerus und Bauern. Die gesellschaftliche Hierarchie – Niklas Luhmann spricht von der stratifikatorisch differenzierten Gesellschaft des Mittelalters im Unterschied zur funktional differenzierten Gesellschaft der Moderne56 – wird als Ausdruck der göttlichen Schöpfungsordnung und somit als Gegebenheit aufgefasst, die der Mensch nicht verändern darf. Der mittelhochdeutsche Terminus für Stand lautet leben und meint die gottgegebene Lebensform. Während der Klerus und seit dem Hochmittelalter auch die Rittergesellschaft jeweils eine eigene Literatur hervorgebracht haben, in denen sie ihre Selbstbilder modellieren, ist dies bei den Bauern, die des Lesens und Schreibens unkundig waren, nicht der Fall. Aussagen über Bauern, die in der höfischen Dichtung getroffen werden, sind ideologisch geprägt und stehen zur sozialen Realität der Bauern nur in einem sehr entfernten Verhältnis. Die höfischen Dichtungen des Hochmittelalters, insbesondere der höfische Roman und der Minnesang, zeichnen das Bild einer höfischen Gesellschaft, die eine spezifische Körperlichkeit für sich beansprucht. Der Adel nimmt für sich in Anspruch, über ein charismatisches Heil (mhd. saelde) zu verfügen, das sich in den strahlenden Körpern der Ritter und Damen manifestiert. Adel präsentiert sich als Epiphanie. Der Wohlgestalt und Leuchtkraft des adeligen Körpers entspricht der äußere Habitus, der sich durch farbig glänzende Kleidung und eine kultivierte Form des Sprechens, Essens, Gehens auszeichnet. Dieser Habitus macht den Adel als solchen sichtbar und markiert 55 Vgl. Oexle, Otto Gerhard u.a.: »Stand, Klasse«, in: Geschichtliche Grundbegriffe 6 (1990), S. 155–284. 56 Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 81998, Bd. 2, S. 678-707. E INFÜHRUNG | 29 die privilegierte Stellung, die der Adel für sich reklamiert. Ferner schreibt sich der Adel eine besondere Form der Liebe (minne) zu, eine veredelte und veredelnde Form des Begehrens, das sich nur auf adelige Körper richten kann.57 Das ausgeprägte Inklusionsbedürfnis der hochmittelalterlichen Adelsgesellschaft, das in der höfischen Dichtung zum Ausdruck kommt, wird in der literaturwissenschaftlichen Forschung auch als ›Aristophilie‹ bezeichnet.58 Gemeint ist die narzisstische Disposition eines gesellschaftlichen Standes, der vor allem sich selbst begehrt. Im Nibelungenlied gehören nicht nur die Niederländer und Burgunden, sondern auch die Höfe um Brunhild und um Etzel der höfischen Adelsgesellschaft an. Selbst die Nibelungen, deren Welt von Zwergen und Drachen bevölkert ist, werden von Königen beherrscht, die Siegfried bei Erbstreitigkeiten übervorteilt. Die Burgunden werden als differenzierte Hofgesellschaft dargestellt, die aus einem inneren (Familie) und einem äußeren (Hofämter) Kreis besteht. Die Thronfolge verläuft über die männliche Linie, die Königswürde geht vom verstorbenen Vater Dankrat auf den erstgeborenen Sohn Gunther und seine Brüder über. Das Nibelungenlied präsentiert zwei Formen der Herrschaftsfähigkeit: traditionale Herrschaft einerseits als realisiertes Prinzip (Gunther), charismatische Herrschaft andererseits als optionales, aber nicht realisiertes Prinzip (Siegfried). (2) Geschlecht: Mit der Kategorie des Geschlechts befassen sich die Gender Studies, die in der germanistischen Mediävistik fest etabliert sind.59 Das mittelhochdeutsche Wort gesleht bezeichnet nicht Gender, sondern Stamm und Familie. Die Alterität der mittelalterlichen Vorstellungen von Geschlecht im engeren Sinne ist in der kritischen Debatte um Thomas Laqueurs Buch Making Sex diskutiert worden.60 Laqueur zeigt, dass im Unterschied zur modernen Vorstellung der absoluten Geschlechterdifferenz (two-sex model) die vormoderne Medizin von der Vorstellung der relativen Geschlechterdifferenz (one-sex model) ausging. Gemeint ist, dass Mann und Frau nach vormodernem Verständnis im Prinzip über dieselben Geschlechtsorgane verfügen, die im Falle der Frau eingestülpt und im Falle des Mannes ausgestülpt seien. Michel de Montaigne erzählt noch im 16. Jahrhundert die Geschichte eines Mädchens, das beim Sprung über einen Zaun zum Jungen geworden 57 Zur Geschichte der Liebe vgl. Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimitität, Frankfurt am Main 1982. 58 Vgl. Schultz, James: Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of Sexuality, Chicago/London 2006, S. 79. 59 Vgl. Klinger, Judith: »Gender-Theorien: Ältere deutsche Literatur«, in: Claudia Benthien/ Hans Rudolf Velten (Hg.), Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neue Theoriekonzepte, Reinbek 2002, S. 267-297. 60 Laqueur, Thomas: Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud, Frankfurt am Main/New York 1992; vgl. auch Cadden, Joan: Meanings of Sex Difference in the Middle Ages: Medicine, Science, and Culture, Cambridge 1993. 30 | A NDREAS K RASS sei, weil die Erhitzung des Körpers zur Ausstülpung der Geschlechtsorgane geführt habe.61 Auch wenn diese Vorstellung nicht dem heutigen naturwissenschaftlichen Wissen entspricht, ist sie doch für das mittelalterliche Denken und Wissen über das Verhältnis von Mann und Frau signifikant. In der höfischen Dichtung des Hochmittelalters spiegelt sich das Konzept der relativen Geschlechterdifferenz in der Weise, dass die anatomischen Differenzen zwischen den Geschlechtern selten thematisiert werden, die Schönheit der Kleidung aber eine große Rolle spielt. Die Gewänder der Ritter und Damen unterscheiden sich nur graduell, vor allem in der Länge der Kleider, die im Falle der Frauen bis zum Boden, im Falle der Ritter bis zu den Knien reichen. Das männliche Bein nimmt den Rang eines sekundären Geschlechtsmerkmals ein, es wird oftmals mithilfe von geschlitzten Kleidern exponiert.62 In den Anfängen der höfischen Dichtung steht das Begehren nach dem eigenen Stand tendenziell über dem Begehren nach dem anderen Geschlecht. Für die Adelsgesellschaft ist die externe Abgrenzung von den anderen Ständen zunächst wichtiger als die interne Abgrenzung gemäß den Geschlechtern. Erst im Spätmittelalter tritt das Begehren nach Geschlechterdifferenz in den Vordergrund, was sich auch in der zunehmenden Trennung der männlichen und weiblichen Mode zeigt. Ein zentrales Thema der höfischen Dichtung um 1200 ist die Konkurrenz zwischen homosozialen und heterosozialen Geschlechterbeziehungen. Während in der traditionellen Welt der Heldenepen das Prinzip der Waffenbrüderschaft zwischen Kriegern dominiert und Frauen kaum in den Blick kommen, erzählen die höfischen Romane von Rittern, die ihr Begehren auf eine Dame ausrichten und ihre Männlichkeit in der Liebe erweisen. Auch der höfische Ritter bewährt sich noch im Kampf, doch führt er ihn um einer Dame willen, deren Schönheit ihn zum Sieg führen soll. Im Nibelungenlied mischt sich die männlich-homosoziale Orientierung der Heldenepik mit der heterosozialen Orientierung des höfischen Romans. Kriemhild und Brünhild überschreiten die Geschlechtergrenzen, indem sie martialische Züge aufweisen, die in der Welt der Heldenepik sonst männlichen Helden vorbehalten sind. Während Brünhild ihre Stärke einbüßt, gewinnt Kriemhild sie erst im zweiten Teil des Nibelungenlieds hinzu. Ein Gegenbild zur ›männlichen Frau‹ ist der effeminierte Mann, der im Nibelungenlied in Form des hunnischen Stutzers einen Auftritt hat (NL 1885 f.).63 (3) ›Rasse‹: Die Kategorie der ›Rasse‹ ist im Mittelalter noch nicht bekannt. Das deutsche Wort wurde erst im 17. Jahrhundert aus dem französischen Wort race 61 Vgl. Greenblatt, Stephen: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance, Berlin 1990, S. 66-91 (»Dichtung und Reibung«). 62 Vgl. Kraß, Andreas: »Das Geschlecht der Mode. Zur Kulturgeschichte des geschlitzten Kleides«, in: Gertrud Lienert (Hg.), Die Kunst der Mode, Oldenburg 2005, S. 26-51. 63 Vgl, Kraß, Andreas: »Der effeminierte Mann. Eine diskursgeschichtliche Skizze«, in: Ralph J. Poole (Hg.), Hard Bodies, Münster 2009, S. 35-52, hier S. 42f. E INFÜHRUNG | 31 entlehnt, von dem auch das englische Wort race abstammt. Das französische Wort geht wiederum auf das italienische Wort razza zurück, dessen weitere Herkunft unklar ist. Wenn das Wort ›Rasse‹ fehlt, so fehlt auch die Vorstellung einer naturwissenschaftlich begründeten Abgrenzung verschiedener Gattungen von Menschen. Gleichwohl gibt es im Mittelalter Vorstellungen, die man aus heutiger Perspektive als protorassistisch oder ›rassisierend‹ bezeichnen kann. In der höfischen Dichtung besteht die Tendenz, alle Figuren, die außerhalb der höfischen Welt angesiedelt sind, als physisch markierte Wesen darzustellen. Der Artusritter Iwein begegnet im Wald einem ›wilden Mann‹, der sich durch eine monströse Anatomie auszeichnet. Später mutiert Iwein selbst zu einem vergleichbaren Wesen, wenn er dem Wahnsinn verfällt, auf eine primitive Daseinsstufe zurückfällt und seine Hautfarbe schwarz wird. In diesem Zustand wird der vormals höfische Artusritter als môr (›Mohr‹) bezeichnet. Umgekehrt wechselt im Heldenepos Kudrun der schwarze Siegfried von Mohrland bei seiner Hochzeit mit einer Christin die Haut- und Haarfarbe zu Weiß und Gold. Als rassisierend kann man die dämonische Darstellung der Heiden, also der Nichtchristen werten, die oft als teuflische Wesen mit monströsen Körpern dargestellt werden. Die Haut der höfischen Menschen hingegen wird als strahlend weiß imaginiert; wenn die Liebe ins Spiel kommt, mischt sich die Farbe Rot hinzu. In der berühmten Blutstropfenszene im Parzival wird die männliche Hauptfigur von drei Blutstropfen im Schnee an seine Geliebte erinnert. Das Weiß des Schnees steht für den Teint der höfischen Dame, das Rot des Bluts für ihre Lippen und Wangen. Den Critical Whiteness Studies bietet die Mediävistik ein reiches Forschungsfeld.64 Für das Nibelungenlied ist festzuhalten, dass die Herrscherinnen und Herrscher fremder Völker noch nicht mit ›rassischen‹ Attributen versehen werden. Die isländische Königin Brünhild und der hunnische König Etzel stammen zwar aus Sicht des burgundischen Königshauses aus fremden Ländern, sie gehören aber dennoch der höfischen Welt an. Die Vorstellung, dass Brünhild eine wilde Amazone sei und Etzel einem primitiven Volk vorstehe, findet sich erst in den neuzeitlichen Bearbeitungen des Nibelungenlieds. (4) Sexualität: Der Kategorie der Sexualität widmen sich die Queer Studies, die inzwischen ebenfalls einen Platz in der germanistischen Mediävistik gefunden haben.65 Die historische Veränderlichkeit dieser Kategorie ist besonders deutlich zu greifen.66 Im Mittelhochdeutschen werden Verben wie bî ligen (›mit jdm. schlafen‹) 64 Vgl. Bonnett, Alastair: White Identities: Historical and International Perspectives, Harlow 2000. 65 Vgl. Kraß, Andreas: »Queer Studies«, in: Christiane Ackermann/Michael Egerding (Hg.), Literatur- und Kulturtheorie in der Germanistischen Mediävistik, Berlin 2014 (im Druck). 66 Vgl. Kraß, Andreas: »Kritische Heteronormativitätsforschung. Der queer turn in der germanistischen Mediävistik«, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 128 (2009), S. 95106. 32 | A NDREAS K RASS benutzt, um den Geschlechtsakt auszudrücken. Der Begriff der Sexualität wurde erst im 19. Jahrhundert geprägt; er ist an die Neuzeit gebunden und kann daher nicht ohne weiteres auf die vormoderne Epochen übertragen werden.67 Sexualität ist ein neuzeitliches Dispositiv, das mit einem bestimmten anthropologischen Entwurf einhergeht. Michel Foucault legt dies am Beispiel der Homosexualität dar. Erst seit dem 19. Jahrhundert wurde ein Mensch, der eine Person des gleichen Geschlechts begehrte, als ›Homosexueller‹ bezeichnet; zuvor galt er als ›Sodomit‹. Homosexualität ist ein pathologischer, Sodomie ein moraltheologischer Begriff.68 Während Sodomie als sündhaftes Handeln, als zu bestrafendes Fehlverhalten nach dem Vorbild der Bewohner des biblischen Sodom galt, wird Homosexualität als übergreifendes Persönlichkeitsmerkmal definiert, das es medizinisch zu beschreiben gilt. Dem homosexuellen Mann und der homosexuellen Frau wird ein bestimmter Habitus unterstellt, die gleichgeschlechtliche Orientierung als Symptom einer spezifischen Disposition begriffen. Die vormoderne Vorstellung der Sodomie ist auf ein Tun bezogen, die moderne Vorstellung der Homosexualität auf ein Sein. Die Alterität zwischen mittelalterlicher und neuzeitlicher Konzeption von Sexualität hat James A. Schultz in seinem Buch Courtly Love, the Love of Courtliness, and the History of Sexuality eingehend untersucht. Sie wird auch am Beispiel effeminierter Männlichkeit deutlich, die heutzutage als homosexuell, in der Vormoderne aber im Gegenteil als heterosexuell verstanden und in der höfischen Dichtung oftmals sogar als begrüßenswerte Eigenschaft des Ritters propagiert wurde.69 Im Nibelungenlied wird anhand der in je verschiedener Weise scheiternden Ehepaare Kriemhild/Siegfried, Brunhild/Gunther und Kriemhild/Etzel heterosexuelles Begehren zugleich propagiert und problematisiert. Homosexualität wird – im Unterschied zu anderen höfischen Epen wie dem Eneasroman – nicht thematisiert, kommt aber andeutungsweise in der bereits angesprochenen Figur des hunnischen Stutzers zur Geltung. (5) Nation: Auch die Kategorie der Nation ist in der höfischen Dichtung des Mittelalters noch kaum relevant. Nach mittelalterlicher Vorstellung verwies die natio auf eine kollektive Zugehörigkeit, die sich an den Kriterien der Abkunft (genus), Bräuche (mores), Sprache (lingua) und Gesetzgebung (leges) orientierte.70 In einer Zeit, die Herrschaft eher auf dem Prinzip des Personenverbands als auf dem Prinzip des Territoriums gründet, sind Verwandtschafts- und Lehensbeziehungen relevanter 67 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen (Sexualität und Wahrheit 1), Frankfurt am Main 1987. 68 Vgl. Thoma, Lev M./Limbeck, Sven (Hg.): Die sünde, der sich der tiuvel schamet in der helle. Homosexualität in der Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Ostfildern 2009. 69 Vgl. A. Kraß: Der effeminierte Mann. 70 Bartlett, Robert: The Making of Europe, Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350, Princeton 1993, hier S. 197. E INFÜHRUNG | 33 als die Zugehörigkeit zu einem raum- und bevölkerungsbezogen gedachten Staat.71 Die Gattungen der höfischen Dichtung unterscheiden sich auch hinsichtlich der Völker und Herrschaftsbereiche, von denen sie erzählen. Die Artusromane spielen in imaginären Räumen und Ländern, die sich nicht auf die historischen Geographien des hohen Mittelalters beziehen lassen. Die Antikenromane sind ihrer stoffgeschichtlichen Herkunft entsprechend in der antiken Geographie angesiedelt, die aufgrund ihrer zeitlichen Entfernung schon mehr oder weniger mythologisch geworden ist. Viele Brautwerbungsepen (›Spielmannsepen‹) inszenieren einen tendenziell kolonialistischen Gegensatz zwischen Orient und Okzident, wobei der Osten vielfach als begehrenswerte Wunderwelt dargestellt wird. Im heldenepischen Nibelungenlied sind die Herrschaftsbereiche an reale Orte wie Worms und Xanten geknüpft; es schildert Kämpfe der Burgunden gegen die Völker der Dänen, Sachsen und Hunnen. Zugleich erzählt das Nibelungenlied von märchenhaften Räumen und Völkern wie dem Land der Nibelungen mit seinen Drachen und Zwergen. Relevanter für die mittelalterlichen Verhältnisse ist die Zuordnung zum gesellschaftlichen Stand, denn die höfische Gesellschaft und höfische Kultur zeitigten eine integrative Wirkung über Landesgrenzen und Herrschaftsbereiche hinaus. (6) Religion: Die Kategorie der Religion ist in der höfischen Dichtung des Hochmittelalters in vollem Maße etabliert. Der mittelhochdeutsche Begriff lautet gelouben (›Glauben‹). Wenngleich sich die weltliche Adelsgesellschaft in mancher Hinsicht von der geistlich-klerikalen Kultur distanziert, ist sie doch ganz dem christlichen Weltbild des Mittelalters verhaftet. Die höfische Dichtung nimmt zahlreiche Anleihen an die geistliche Literatur. In solchen Dichtungen, die religiöse Differenzen thematisieren, ist vielfach formelhaft von »Christen, Juden und Heiden« die Rede, um die drei Hauptreligionen zu bezeichnen; mit den Heiden sind die Muslime gemeint. Oftmals wird die ›heidnische‹ Welt dämonisiert und mit teuflischen Zügen ausstatten. In solchen Fällen eignet den religiösen Vorstellungen eine rassisierende Tendenz. Diese eignet heldenepischen Erzählungen wie dem Rolandslied, höfischen Romanen wie dem Wigalois Wirnts von Grafenberg und Legendenerzählungen wie dem Heiligen Georg Reinbots von Durne. Dem Willehalm Wolframs von Eschenbach attestiert die Forschung hingegen einen religiösen Toleranzgedanken. Religiöse Differenz ist auch Thema der Kreuzzugsdichtung, in den Kreuzliedern des Minnesangs wird der ritterliche Konflikt zwischen Frauen- und Gottesdienst thematisiert. Im Nibelungenlied gehören Bischöfe, Priester und Kapläne zur erzählten Welt, wenn auch eher am Rande. Kriemhild stellt ihre Verbindung mit Etzel unter die Bedingung, dass dieser zum Christentum konvertiert und sich taufen lässt. 71 Geary, Patrick J.: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nationen, Frankfurt am Main 2002. 34 | A NDREAS K RASS (7) Dis/Ability: Das Wort ›Krüppel‹ ist bereits im Mittelalter geläufig, wird in der höfischen Dichtung aber selten gebraucht.72 Das Motiv des Aussatzes kommt in mehreren höfischen Texten vor, besonders prominent in einer Novelle Hartmanns von Aue (Der arme Heinrich) und einem Roman Konrads von Würzburg (Engelhard). In beiden Fällen gewinnen die Aussätzigen durch eigene Opferbereitschaft oder die eines anderen ihre Gesundheit zurück. In historischer Perspektive erweist sich Behinderung als kulturelle Konstruktion.73 Im Sinne einer diskursiven Vorgeschichte der Behinderung lohnt ein Blick auf literarische Figuren der höfischen Epik, denen abweichende Körpergröße (Zwerge, Riesen) oder eine monströse, oftmals tierähnliche Körpergestalt eignet. Diese Figuren zeichnen sich gerade nicht durch einen Mangel an Handlungsfähigkeit aus, sondern erscheinen als besonders stark und mächtig. Ein Beispiel ist der höfische Ritter Guivreiz, mit dem es Erec im gleichnamigen Artusroman Hartmanns von Aue zu tun bekommt. Guivreiz ist ein überaus starker Zwerg (getwerc), der mit dem Artusritter Freundschaft schließt. Im Nibelungenlied bewacht der kampftüchtige Zwerg Alberich den Nibelungenhort. Als eine Form der Behinderung kann auch Siegfrieds verwundbare Stelle gewertet werden, deren Kenntnis Hagen nutzt, um den sonst so exorbitanten Helden mit einem Lanzenstich zu töten. (8) Alter: Da zum Ideal der höfischen Kultur die Jugend gehört, wird die Kategorie des Alters eher selten thematisiert. In der höfischen Dichtung des Mittelalters wird Alter vielfach mit Weisheit, Würde und Autorität assoziiert, sofern die betreffenden Figuren Teil der höfischen Gesellschaft sind. Im Minnesang begegnen sogenannte Alterslieder, in denen der Sänger in der Rolle des alternden Mannes über die Vergänglichkeit des Lebens nachsinnt.74 Als Gegenbild figurieren unwürdige Alte, die ihr Begehren nicht zu zügeln wissen, so beispielsweise in Neidharts Winterliedern oder in den humoresken Novellen des Spätmittelalters (Mären). Sie werden eher der bäuerlichen Welt zugeordnet. Im Nibelungenlied wird der Königsmutter Ute Respekt gezollt, doch kommt ihr jenseits der Fürsorge für ihre Tochter Kriemhild kein Handlungsspielraum zu; politisch gesehen bleibt sie eine irrelevante Figur. 72 Zum Thema Behinderung im Mittelalter vgl. Nolte, Cordula (Hg.): Homo debilis. Behinderte – Kranke – Versehrte in der Gesellschaft des Mittelalters, Affalterbach 2009. 73 Vgl. Bösel, Elsbeth/Klein, Anne/Waldschmidt, Anne (Hg.): Disability History. Konstruktionen von Behinderung in der Geschichte. Eine Einführung, Bielefeld 2010. 74 Von Bloh, Ute: »Zum Altersthema in Minneliedern des 12. und 13. Jahrhunderts: Der ›Einbruch‹ der Realität«, in: Thomas Bein (Hg.), Walther von der Vogelweide. Beiträge zu Produktion, Edition und Rezeption, Frankfurt am Main 2002, S. 117-144.