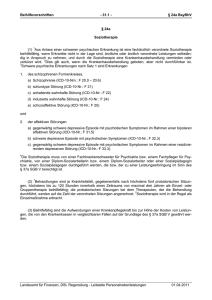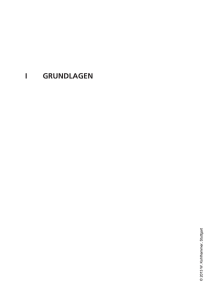1 Vortrag Calw-Hirsau 29.04.2010 (Dr. med. T. Kaeser, Facharzt für
Werbung

Vortrag Calw-Hirsau 29.04.2010 (Dr. med. T. Kaeser, Facharzt für Psychiatrie u. Psychotherapie) Jugendliche und comorbide Störungen Nachdem im ersten Teil des Vortrages die Historie der Klinik, konzeptionelle Gesichtspunkte und statistisches Material vorgestellt wurden, möchte ich jetzt aus der Sicht des klinisch tätigen Psychiaters zwei Patientengruppen mit comorbiden Störungen und deren typische Problematik vorstellen: 1 Zum einen die Patienten mit psychotischen Störungen, zum anderen unsere Patienten mit einer ADHS-Störung. Bei einem Prozentsatz von fast 90 % comorbider Störungen im Jahre 2009 stellt die Anzahl der Patienten mit psychotischen Störungen mit 62 % unverändert den Löwenanteil der Patienten mit comorbiden Störungen, die ADHS-Störung ist mit ca. 8% vertreten. Zunächst zu unseren Patienten mit der Zusatzdiagnose einer psychotischen Störung. Hierunter fallen sowohl Patienten mit einer Schizophrenie als auch mit der Diagnose einer substanzinduzierten psychotischen Störung. Sehr häufig ist eine Unterscheidung zwischen einer substanzinduzierten psychotischen Störung und einer schizophrenen Störung mit zusätzlicher Suchtmittelabhängigkeit äußerst schwierig, und dies nicht nur durch die „Verwischung“ der zeitlichen Abfolge zwischen Sucht, Konsummuster und psychotischen Symptomen. Häufig können auch die Patienten hierzu nur vage und ungenaue Angaben bei ausgeprägten Zeitgitterstörungen machen. Hierdurch ist eine eingehendere Anamnese und chronologische Einordnung häufig kaum möglich. Diese große differentialdiagnostische Unsicherheit bei der Unterscheidung zwischen drogeninduzierter psychotischer Störung versus endogener schizophrener Prozesspsychose ist jedoch nicht nur durch eine schwierige und häufig unklare Anamnese bedingt, sondern spiegelt auch den gegenwärtig noch unzureichenden Wissens- und Forschungsstand wider. So bietet die Diagnoseverschlüsselung im ICD-10 bezüglich der substanzinduzierten psychotischen Störung kaum Hilfestellungen und bleibt unklar: psychotische Störung ist eine Gruppe von Symptomen, die gewöhnlich während oder unmittelbar nach dem Substanzgebrauch auftritt und durch lebhafte Halluzinationen, typischerweise akustische, Wahn- oder Beziehungsideen gekennzeichnet ist. Die Störung geht typischerweise innerhalb eines Monats, zumindest teilweise, innerhalb von 6 Monaten vollständig zurück. Dieser psychotische Zustand sollte während oder unmittelbar nach der Einnahme einer Substanz (gewöhnlich innerhalb von 48 Stunden) auftreten. Im ICD-10 kommt es dann zu einer weiteren Einschränkung: eine verzögert auftretende psychotische Störung, welche mehr als zwei Wochen nach dem letzten Substanzkonsum beginnen kann, ist bei der verzögert auftretenden psychotischen Störung einzuordnen. Wir haben definitionsgemäß im ICD-10 keine Unterscheidung zwischen suchtmittelinduzierter und schizophrener Psychose bezüglich der Symptomatik (bei der drogeninduzierten psychotischen Störung wird lediglich noch nach Unterformen z. B. schizophreniform, vorwiegend wahnhaft, vorwiegend halluzinatorisch unterschieden). Lediglich das Zeitkriterium (gewöhnlich während oder unmittelbar nach dem Substanzgebrauch, vollständige Rückbildung innerhalb von 6 Monaten) spielt eine Rolle und selbst dieses Zeitkriterium wird dann bei der verzögert auftretenden psychotischen Störung eingeschränkt (mehr als 2 Wochen nach dem letzten Substanzkonsum). Wenn man dann noch hinzu nimmt, dass unsere Patienten selbst häufig nur sehr ungenaue Angaben machen, scheint die Verwirrung komplett. Diese Unsicherheit bei der Unterscheidung zwischen drogeninduzierter psychotischer Störung und endogener schizophrener Prozesspsychose mit 2 begleitendem Substanzmittelkonsum zeigt sich auch in den Zuweisungsdiagnosen von vorbehandelnden Kliniken, wo eine klare Unterscheidung häufig nicht getroffen wird oder wechselnde Diagnosen (drogeninduzierte Psychose versus Schizophrenie) bei verschiedenen stationären Aufenthalten in der gleichen Klinik gestellt werden. Generell zeigt sich die Tendenz bei häufigeren psychotischen Episoden in Kombination mit einer Suchtmittelabhängigkeit im Verlauf dann die Diagnose einer Schizophrenie zu stellen. Dies wird jedoch auch nicht richtiger, wenn die Sucht parallel zur psychotischen Störung weiter läuft. Dies zeigt den gegenwärtig unzureichenden Wissens- und Forschungsstand. Generell zeigen beide Krankheitsbilder, sowohl die Schizophrenien als auch die drogeninduzierten psychotischen Störungen eine große Variabilität und Heterogenität. Bei den Schizophrenien ist uns dies geläufig, aber auch bei den substanzinduzierten psychotischen Störungen gibt es eine große Variabilität bezüglich Häufigkeit und Schweregrad als auch Dauer substanzinduzierter psychotischer Phasen. Auch die Gruppe der Schizophrenien selbst ist heterogen und kein zusammenhängendes Krankheitsbild. Ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei substanzinduzierten psychotischen Störungen sein. Es ist letztlich also unklar, ob es sich bei diesen beiden psychotischen Störungsbildern um verschiedene Krankheitsentitäten, möglicherweise mit einer gemeinsamen „Endstrecke“, oder um ein Kontinuum mit unterschiedlichen Ausprägungsgraden handelt, mit einer gemeinsam zugrunde liegenden Ursache. Die klassifikatorischen Systeme richten sich jedoch nur nach deskriptiven beschreibenden Phänomenen und Zeitkriterien. Legt man jedoch die vom ICD-10 geforderten Zeitkriterien einer psychotischen Störung an und berücksichtigt die häufig nur geringen und kurz anhaltenden abstinenten Phasen unserer Patienten ist – falls überhaupt eine Unterscheidung möglich ist – in den meisten Fällen eher von einer drogeninduzierten psychotischen Störung auszugehen und die Diagnose einer schizophrenen Prozesspsychose eher zurückhaltend zu stellen. Gibt es wirklich keinerlei psychopathologischen Unterschiede zwischen einer Schizophrenie und einer drogeninduzierten psychotischen Störung? Häufig treffen wir bei „echten“ schizophrenen Patienten bizarre, abgehobene, magisch anmutende und teilweise schwer nachvollziehbare eindeutig „verrückte“ Wahninhalte an, häufig kombiniert mit ausgeprägten formalen Denkstörungen, wohingegen bei rein drogeninduzierten psychotischen Störungen die psychotisch wahnhafte Symptomatik sich häufig im typisch Alltäglichen abspielt und einen viel „normaleren“ Charakter zeigt. Wo der rein schizophrene Patient sich häufig von höheren, geheimnisvollen Mächten verfolgt und bedroht fühlt, fühlt sich der drogeninduziert psychotische Patient eher von konkreten Personen, häufig aus seinem Drogenmilieu übertrieben wahnhaft verfolgt und beobachtet. Das viel weiter von der Realität entfernte psychotische Erleben ist meines Erachtens typisch für den schizophrenen Patienten und viel seltener bei drogenausgelösten psychotischen Symptomatiken anzutreffen. Ist dies jetzt alles akademische Haarspalterei? Der Streit um des Kaisers Bart? Wechselt man auf die Patientenebene, wird rasch deutlich, dass dem nicht so ist. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die betroffenen Patienten und deren 3 medikamentöse Behandlung. Zum einen besteht bei vielen Patienten eine große Verunsicherung bezüglich ihrer Diagnose (drogeninduzierte Psychose versus Schizophrenie) als auch bezüglich der Notwendigkeit einer längerfristigen, vielleicht sogar jahrelangen neuroleptischen Behandlung gemäß den Empfehlungen bei der Schizophrenie. Erschwerend kommt hinzu, dass suchtkranke Patienten mit psychotischen Störungen häufiger und stärker unter Nebenwirkungen einer Neuroleptika-Medikation (insbesondere EPS-Nebenwirkungen auch unter atypischen Neuroleptika) leiden als schizophrene Patienten. Auch scheinen häufiger auftretende drogeninduzierte psychotische Episoden im Verlauf zunehmend schlechter auf eine neuroleptische Medikation anzusprechen, in der Folge ist die Gefahr einer Chronifizierung bezüglich der psychotischen Symptomatik dann sogar höher als bei einer endogenen schizophrenen Prozesspsychose. Dies zeigt sich auch in einer Zunahme einer „psychopharmakologischen Polypragmasie“ seitens vorbehandelnder Kliniken. Viele Patienten mit einer zusätzlichen psychotischen Störung (insbesondere bei mehreren psychotischen Phasen in der Vorgeschichte) treten die Entwöhnungsbehandlung in unserem Haus mit einer Kombination diverser Psychopharmaka, insbesondere mehrerer Neuroleptika an. Hierunter sind am häufigsten Kombinationen mehrerer atypischer Neuroleptika anzutreffen, teilweise jedoch auch die Kombination eines oder mehrerer Atypika mit einem konventionellen, klassischen Neuroleptikum. Ich möchte hier nur das Beispiel eines Patienten nennen, der mit Risperdal-, Zyprexa- und Glianimon-Medikation in unsere Klinik kam. Das Zurückgreifen auf herkömmliche, klassische Neuroleptika scheint der klinischen Erfahrung zu folgen, dass in manchen Fällen konventionelle Neuroleptika rascher und stärker antipsychotisch wirken, was insbesondere bei schwerer psychotischer Symptomatik und chronischeren Verläufen eine Rolle spielen mag. Dies führt jedoch bei diesen – in vielen Fällen ohnehin nebenwirkungsempfindlichen – Patienten zu noch stärkeren Nebenwirkungen der psychopharmakologischen Medikation. Häufig werden von Patienten auch, entweder aus Unkenntnis oder Schamgefühlen – Nebenwirkungen bezüglich sexueller Funktionen (Libidominderung, erektile Dysfunktion, Impotenz) verschwiegen. Dies stellt die Patienten vor eine „Geduldsprobe“ und schränkt teilweise auch die Medikamenten-Compliance, insbesondere bezüglich einer neuroleptischen Behandlung, erheblich ein. Wenn man dann zusätzlich noch berücksichtig, dass bei unseren Patienten in den meisten Fällen auch eine berufliche Wiedereingliederung Zielsetzung der Behandlung ist, auf der anderen Seite gravierende NeuroleptikaNebenwirkungen (eingeschränkte Motorik, vermindertes Reaktionsvermögen, eingeschränkte kognitive Fähigkeiten) die Auswahlmöglichkeiten eines potenziellen Arbeitsplatzes erheblich einschränken und berufliche Rehabilitationsmöglichkeiten bei der Diagnose Schizophrenie seitens potenzieller Kostenträger (Arbeitsagentur, Rentenversicherungsträger) teilweise starken Einschränkungen unterworfen sind, zeigt sich ebenfalls die Brisanz dieser scheinbar so „haarspalterischen“ differentialdiagnostischen Unterscheidung. Häufig stellt sich dann – insbesondere auch auf Wunsch des Patienten – die Frage eines ausschleichenden Reduktions/Absetzversuches der neuroleptischen Medikation. Aus meiner Sicht ist hier ein pragmatisches Vorgehen sinnvoll. Ein rein „dogmatisches“ sich beschränken auf klassifikatorische Diagnosestellungen (gemäß ICD-10) ist häufig nicht sinnvoll: Zum einen ist die differentialdiagnostische Unterscheidung sowieso äußerst schwierig und unklar, zum zweiten ist häufig eine 4 dauerhafte Medikation schwierig zu vermitteln aufgrund starker Einschränkungen. Die Entscheidung eines ausschleichenden Absetzversuches erfordert eine enge Anbindung unserer Patienten an die psychiatrische Sprechstunde sowie eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem gesamten Behandlungsteam, bietet – entsprechende Stabilität des Patienten unter Berücksichtigung der Vorgeschichte – mehrere Vorteile: 1.) Häufig ist dies die einzige Behandlungsalternative bei gravierenden Medikamenten-Nebenwirkungen. 2.) Im Falle erneuter psychotischer Dekompensationen ohne neuroleptische Medikation fördert dies in vielen Fällen die Medikamenten-Compliance bei dem betroffenen Patienten für eine längerfristige neuroleptische Medikation. 3.) Eine klarere Einschätzung bezüglich des individuellen Vulnerabilitätsausmaßes und Risikos für potenzielle psychotische Exazerbationen ohne NeuroleptikaMedikation ist möglich. Setzt man die Zeitkriterien des ICD-10 bei drogeninduzierten psychotischen Störungen voraus (max. 6 Monate), trifft dies genau in den Zeitraum unserer Behandlungsdauer. Letztlich wird ja auch bei der Schizophrenie aufgrund der großen Heterogenität der Verläufe ein pragmatisches Vorgehen empfohlen, in dem bei entsprechender Stabilität nach einer ersten psychotischen Episode zwei Jahre lang neuroleptisch behandelt und dann ein Absetzversuch empfohlen wird. Insgesamt erscheint mir ein Versuch, das Vulnerabilitätsausmaß individuell bei einem Patienten abzuschätzen wichtiger und richtiger, als ein starres Regime, vielleicht noch verschärft durch ein übertriebenes Sicherheitsdenken nach dem Motto: „Ich empfehle dem Patienten eine mindestens zweijährige neuroleptische Dauermedikation, lasse mich auf keine Absetzversuche ein, dann kann auch nichts passieren.“ Der Klinikalltag einer Rehabilitationsklinik bietet zahlreiche Stressoren (Beziehungsgestaltung, Konflikte mit Mitpatienten, erhöhte Anforderungen in der Arbeitstherapie und durch berufliche Praktika, zunehmende Alltagsanforderungen im Rahmen der Adaptionsbehandlung etc.), so dass hier die Chance einer individuelleren Einschätzung des Vulnerabilitätsrisikos eines Patienten unter erhöhten Stressanforderungen besteht, ebenso auch die Möglichkeit – wenn dies auch ein sehr anspruchsvolles Ziel ist – der Herausarbeitung spezifischer Stressoren für einen Patienten. So kann z. B. für einen schüchtern-gehemmten, mit sozialphobischen Ängsten behafteten Patienten ein spezifischer Stressor sowohl für Rückfälligkeit als auch für psychotische Symptome erhöhte Anforderungen an seine Durchsetzungs- und Abgrenzungsfähigkeit sein, z. B. in einem Bereich der Arbeitstherapie mit erhöhten Team- und Stressanforderungen (Patientenküche). Dieses Herausarbeiten möglicher spezifischer Stressoren und der Vulnerabilität für psychotische Symptome im Einzelfall eröffnet damit auch zusätzliche therapeutische Interventionsmöglichkeiten für die Zusammenhänge zwischen individuellem Vulnerabilitätsausmaß, spezifischen Stressoren und deren Zusammenhänge mit Sucht, Psychose und Persönlichkeit. Allerdings besteht hierbei die Gefahr, dass unsere Patienten mit einer zusätzlichen psychotischen Störung sehr auf ihre Psychose fokussieren, so dass die Bearbeitung ihrer Suchterkrankung in den Hintergrund zu treten droht. Auch besteht die Gefahr, dass unsere Patienten sich teilweise im sinne einer harm-reduction überwiegend an der Reduzierung negativer Konsequenzen orientieren, nach dem Motto: „Ich will 5 clean bleiben, damit ich keine Psychose mehr bekomme.“. Es ist dann immer wieder erforderlich, die Suchterkrankung in den Vordergrund zu rücken und den Patienten nachhaltig zu verdeutlichen, dass ihre psychotische Störung (zumindest sofern sie rein drogeninduziert ist) nachgeordnet ist und Verlauf und Prognose der Zusatzdiagnose „psychotische Störung“ mit dem Verlauf der Suchterkrankung steht und fällt. So äußerte z. B. einer meiner Patienten immer wieder in der Sprechstunde, er wolle seine neuroleptische Medikation noch während der Behandlung bei uns abgesetzt bekommen. Da er durchgängig über mehrere Monate stabil war, setzte ich dann ausschleichend seine Zyprexa-Medikation ab. Allerdings verstand ich lange Zeit nicht, warum er so vehement auf ein Absetzen bestand, da er die Medikation exzellent vertrug und keinerlei Nebenwirkungen zeigte (keine Gewichtszunahme, keine Sedierung). Erst im Verlauf erzählte er mir dann, dass er nach der Entwöhnungsbehandlung draußen im Alltag keine Neuroleptika mehr nehmen wolle, da er der Meinung sei, dass er ohne Neuroleptika leichter eine Psychose bekäme und die Angst vor einer erneuten psychotischen Symptomatik ohne Medikation ihn eher daran hindere, wieder rückfällig zu werden. Wenige Wochen nach Absetzen der neuroleptischen Medikation wurde dieser Patient dann unter erhöhten Stressanforderungen (Teamarbeit in der Küche, Konflikte mit Mitpatienten, anstehende Adaptionsbehandlung im Haus Heidelberg mit erhöhten Alltagsanforderungen) wieder psychotisch. Diese psychotische Phase ließ sich dann in guter Zusammenarbeit mit dem Patienten durch eine erneute neuroleptische Medikation mit Zyprexa abfangen, allerdings war eine interkurrente Verlegung in das ZfP Nordbaden erforderlich. Auf dem Hintergrund eines symbiotisch-überängstlich-überfürsorglichen Erziehungsstiles der Mutter, welche immer wieder ängstlich-besorgt auch bei uns in der Klinik anrief, um sich nach ihrem Sohn zu erkundigen, und der gleichermaßen vorsichtigen und etwas konfliktscheuen Art des Patienten mit der Neigung, „sich verrückt zu machen“, wurde sein individuelles Vulnerabilitätsrisiko deutlich. Mittlerweile hat er die Notwendigkeit einer längerfristigen neuroleptischen Medikation eingesehen und kann besser seine spezifischen Stressoren einschätzen und an seinen Vulnerabilitätsrisiken arbeiten, in dem er z. B. lernt, gelassener zu werden, mehr an seine Ressourcen und Stärken zu glauben, sich weniger verrückt zu machen und sich Schritt für Schritt von der Mutter „abnabelt“ unter Einbeziehung seiner Eltern, insbesondere der Mutter in Form von Familiengesprächen. Ohne ein Eingehen auf den Patienten und einen Absetzversuch der Neurolepsie wären diese Zusammenhänge wahrscheinlich zumindest längst nicht so deutlich geworden, sein spezifisches Vulnerabilitätsrisiko, nicht nur hinsichtlich der Psychose, sondern auch hinsichtlich potenzieller Rückfälle wäre nicht so deutlich geworden. Letztlich wurde hierdurch auch seine Medikamenten-Compliance gefestigt. Dies ist eine PatientenKasuistik gewesen, bei der durch das Absetzen der Medikation die Notwendigkeit einer längerfristigen neuroleptischen Medikation deutlich wurde auf Grund eines hohen Vulnerabilitätsrisikos. Bei diesem Fall ist durchaus die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie zu erwägen (psychotische Symptome nach 4 Monaten Abstinenz, allerdings nicht nach 6 Monaten, langsame und zögerliche Rückbildung der psychotischen Symptome, insbesondere Ich-Störungen in Form von Gedankenausbreitung). Aber selbst in diesem Falle ist eine klare Unterscheidung zwischen drogeninduzierter versus schizophrener Psychose (noch) nicht möglich und vielleicht erst durch eine weitere Verlaufsbeobachtung zu treffen. Wichtiger als eine 6 differentialdiagnostische Unterscheidung „drogeninduziert versus schizophren“ erscheint mir deshalb eine Einschätzung des Vulnerabilitätsausmaßes bei einem Patienten, da dies viel mehr Relevanz und Aussagefähigkeit hat, als eine reine „Etikettierung“ durch eine Diagnose. Mag dieser Patient ein Beispiel sein für die Notwendigkeit einer längerfristigen Neuroleptika-Einnahme, so gibt es umgekehrt zahlreiche Patienten, welche sich nach Absetzen einer neuroleptischen Medikation auch unter erhöhten Stressanforderungen stabil zeigen, so dass bei diesen Patienten dann von einem deutlich geringeren Vulnerabilitätsrisiko ausgegangen werden kann. Da dies für den Alltag viel mehr Relevanz besitzt als eine „reine“ Diagnose, erscheint mir der Ansatz der Vulnerabilitätsabschätzung viel versprechender und praxisnäher, als der Versuch einer rein deskriptiven Unterscheidung. Bis dies jedoch auch Einzug in unsere Diagnosesysteme findet und damit auch den Patienten gerechter wird, ist sicherlich noch viel Forschungsarbeit und Wissenszuwachs nötig. Eine weitere Patientengruppe, auf die ich jetzt eingehen möchte, sind unsere Patienten mit einer ADHS-Störung, immerhin 8 % unserer Patienten in 2009. In den letzten Jahren wurde der ADHS-Störung im Erwachsenenalter immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was sich auch in einer zunehmenden Behandlung dieser Thematik in der Öffentlichkeit z. B. Fernsehsendungen etc. zeigt. Letztlich ist es eigentlich verwunderlich, dass eine derart häufige Störung quasi viele Jahrzehnte übersehen wurde und man noch bis vor wenigen Jahren davon ausging, dass diese Erkrankung eine reine kinder- und jugendpsychiatrische Diagnose darstellt. Letztlich zeigt dies, dass wir nur das sehen und erkennen, was wir kennen. Dies ist gleichzeitig eine Mahnung an uns alle, kritisch und neugierig zu bleiben, offen und aufgeschlossen Neuem gegenüber zu sein, manchmal querdenkend Alterhergebrachtes in Frage stellend. Tugenden, die Kinder noch haben und unsere ADHS-Patienten oft behalten haben. Mittlerweile weiß man, dass die ADHS-Störung zu einem hohen Prozentsatz, allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaße bis in das Erwachsenenalter persistiert. Natürlich sind Zahlen noch mit Vorsicht zu genießen, allerdings ist davon auszugehen, dass weit mehr als 50 % der Patienten ADHS-Symptome auch noch im Erwachsenenalter haben, allerdings in sehr unterschiedlicher Ausprägung: Bis zu 15% zeigen das unveränderte Vollbild der ADHS, 65 % eine Besserung der ADHSSymptome und nur 20 % eine vollständige Remission. Häufig lässt zwar die ausgeprägte motorische Unruhe im Erwachsenenalter nach und weicht eher einer inneren Unruhe (innerer Motor, wie getrieben sein) mit nur noch diskreter motorischer Hyperaktivität (Fingertrommeln, Fußwippen, Verknoten der Füße, Abneigung gegen körperlicher Ruhe und Entspannung), Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite, erhöhte Ablenkbarkeit, erhöhtes Arousal, ausgeprägte Impulsivität und desorganisiert-chaotisches Verhalten, emotionale Instabilität und geringe Affektkontrolle sind jedoch häufige Problembereiche der ADHS-Störung im Erwachsenenalter. Früh zeigt sich diese Störung bereits in der Schule mit Schulproblemen (Klassenwechsel, Sitzenbleiben, Schulwechsel, Schulabbruch ohne Abschluss), weitere Probleme im Arbeitsleben schließen sich an (keine Ausbildung, geringere Qualifikation, häufigere Arbeitsplatzwechsel, Probleme mit Vorgesetzten, längere Arbeitslosigkeitszeiten etc.). Typisch sind „chaotisch“ erscheinende Biographien, gekennzeichnet durch zahlreiche Abbrüche und Wechsel. Nicht nur 7 Arbeitsprobleme häufen sich, sondern auch Beziehungsprobleme in Form von häufigen Trennungen, erhöhten Scheidungsraten, interpersonellen Problemen, Geschwisterrivalitäten, stark belastete Verhältnisse zu den Eltern, aber auch erhöhte Unfallrisiken, Führerscheinverluste und dissozial-delinquente Entwicklungen. Mehr als 70 % der erwachsenen ADHS-Patienten zeigen zusätzlich comorbide Störungen in Form von Substanzmissbrauch, Angststörungen, sozialen Phobien, depressiven Störungen, Störung des Sozialverhaltens, oppositionellen Störungen bis hin zur dissozialen Persönlichkeitsstörung. Teilweise sind mit der ADHS-Störung auch zusätzliche Teilleistungsstörungen oder Tickstörungen vergesellschaftet. Mittlerweile ist gesichert, dass ADHS ein Risikofaktor für die Entwicklung von Suchterkrankungen darstellt (wobei noch offen ist, ob ADHS ein eigenständiger Risikofaktor ist oder durch die Comorbidität mit anderen Störungen zum Risikofaktor wird). Darüber hinaus sprechen die bisherigen Ergebnisse für einen suchtprotektiven Effekt der Psychopharmakotherapie: Das Risiko, das Vollbild einer Substanzabhängigkeit zu entwickeln, wird durch eine rechtzeitige Medikation gesenkt. Dies deckt sich mit den Erfahrungen unserer ADHS-Patienten: kein einziger wurde konsequent und dauerhaft als Kind medikamentös behandelt, in vielen Fällen erfolgte nicht einmal eine Diagnosestellung, in wenigen Fällen war zwar die Diagnose gestellt worden, jedoch ohne durchgängige, suffiziente Behandlung, nur in ganz wenigen Fällen erfolgte allerdings sehr spät, nach der Pubertät, eine medikamentöse Behandlung. In diesen Fällen war jedoch bereits ein Suchtverhalten etabliert und die Behandlung mit Methylphenidat wurde dann Bestandteil der Suchterkrankung. Ähnlich wie bei psychotischen Störungen ist auch die ADHS-Störung eine wahrscheinlich heterogene Gruppe von Erkrankungen mit polygenetischer Vererbung, unterschiedlichen Prägnanztypen (ADHS, ADS, möglicherweise dissozialer Subtyp) und enger Verschränkung zwischen Umwelt, Lernerfahrungen und Genetik. Wahrscheinlich wird – ebenso wie bei den psychotischen Störungen – nicht die ADHS-Störung vererbt, sondern eine tiefer liegende Regulationsstörung genetisch determiniert im Sinne einer erhöhten Sensibilität/Empfindlichkeit für Umwelteinflüsse und äußere Reize basierend auf einer Dopamin-Regulationsstörung bei verändertem Dopamin-Rezeptorgen und verminderter Reizweiterleitung der dopaminergen Wirkung an den Synapsen. Diese tiefer liegende Störung kann dann unter anderem zu einer ADHS-Störung führen, impliziert jedoch wahrscheinlich auch ein höheres Risiko für die Entwicklung einer Tabakabhängigkeit (fast alle unserer ADHS-Patienten rauchen, haben überdurchschnittlich früh mit regelmäßigem Rauchen angefangen), unter günstigen Bedingungen ist durch diese erhöhte Sensibilität für äußere Reize jedoch durchaus auch ein erhöhtes Maß an Kreativität und künstlerischem Talent verbunden, so dass nicht zwangsläufig eine negative Entwicklung die Folge sein muss. Zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens sind erfolgreich trotz oder aber vielleicht auch gerade wegen ihrer ADHS-Störung (Louis de Funès, Tim Mälzer, Jamie Oliver). Worauf es mir ankommt, ist keine reine Symptom-Auflistung, sondern die Entwicklung eines tieferen Verständnisses für die Lebenswelt und die Erfahrungen eines ADHS-Kindes und welche Konsequenzen sich für dieses Kind (sofern es nicht adäquat behandelt wird) ergeben können. Hierzu genügt ein einfaches Gedankenexperiment: Stellen Sie sich einfach vor, Sie seien als Kind mit einem 8 Makel behaftet, der Sie auffällig macht und auf Ablehnung stoßen lässt. Erschwerend soll noch dazu kommen, dass diese „Auffälligkeit“ nicht klar zu benennen ist, wie z. B. abstehende Ohren, sondern unklar bleibt und Ihnen vielleicht sogar als böse Absicht unterstellt wird. Wozu führt das? Dies führt dazu, dass Sie sich als Außenseiter fühlen, als Sonderfall, als auf irgendeine Weise unerklärlich von den Anderen abweichend, ohne zu wissen, warum. Die häufige Ablehnung und Kritik an Ihrer Person führt dann dazu, dass Sie sich wertlos fühlen, sich nichts zutrauen, ein negatives Selbstbild entwickeln und sich im schlimmsten Falle sogar selbst schuldig und verantwortlich hierfür fühlen, zumal Ihre „Auffälligkeit“ Ihnen nicht erklärt wird. Wenden wir diese Mechanismen jetzt auf unser ADHS-Kind an: Es ist unkonzentriert, zappelig und erhöht ablenkbar, unstrukturiert-chaotisch, vergisst vieles und reagiert sehr stark auf seine Umwelt und ihm dargebotene äußere Reize. Überall eckt es an, stört, wird ermahnt, zur Ordnung gerufen, sanktioniert. Dies nicht nur in der Schule, sondern auch daheim im Umgang mit Eltern und Geschwistern. Gleichzeitig weiß es nicht, was mit ihm los ist, es merkt nur, dass es anders ist und auf Ablehnung stößt. Vielleicht wird ihm sein Verhalten sogar als absichtlich provozierend und bösartig unterstellt. Was lernt so ein Kind? Ich bin anders, ich bin Außenseiter, ich kann nichts. Es entwickelt ein geringes Selbstwertgefühl und ein negatives Selbstbild. Es lebt mit einem ständigen „Hintergrundrauschen“ von Ermahnungen, Zurechtweisungen, Kritik und negativen Bewertungen. Gleichzeitig ist es in seiner Orientierung ständig nach außen gerichtet aufgrund seiner erhöhten Sensibilität für Umwelt- und Sinneseinflüsse. Diese Außenorientierung führt zu einer starken Außenattribuierung und Externalisierung, das heißt häufig wird ein rigides, an äußeren Regeln und Normen orientiertes Wertesystem etabliert, mit ständigem Vergleich mit anderen Menschen nach dem Motto: „Wenn der das darf, darf ich das auch.“ Logischerweise entwickeln diese Patienten dann ein geringes Selbstwertgefühl, bleiben überwiegend nach außen auf ihre Umwelt bezogen und machen häufig einen Abgleich zwischen äußeren Reizen und Verhaltensweisen anderer Menschen und ihrem eigenen Verhalten. Korrespondierend hierzu ergaben Umfragen bei erwachsenen ADHS-Patienten überwiegend negative Erinnerungen an ihre Kindheit mit dem Resümee wenig auf 9 das Erwachsenenalter vorbereitet worden zu sein. Dieses geringe Selbstwertgefühl mit negativem Selbstbild bei gleichzeitig ausgeprägter Außenattribuierung lässt viele comorbide Störungen der ADHS-Störung erklärbar werden: Aufgrund des häufigen negativen „Hintergrundrauschens“ bei gleichzeitig negativem Selbstbild und hoher Kränkbarkeit/Empfindlichkeit neigen die Betroffenen zu impulsiven Verhaltensweisen, insbesondere im Kontakt mit „Autoritätspersonen.“ Ihr geringes Selbstwertgefühl führt bei kleineren Anlässen (siehe Außenattribuierung) zu häufigen reaktiven kurzen depressiven Einbrüchen, bei den oft nur selten vorkommenden positiven Rückmeldungen dann zu überdreht fast hypomanisch anmutenden Stimmungsbildern, insgesamt also zu einer stark situativ abhängigen Stimmung Aufgrund der häufigen Zurückweisungen und der Stigmatisierung sind auch ausgeprägtere Ängste bis hin zu sozialen Phobien verständlich. Die raschen Stimmungswechsel orientieren sich nach Rückmeldung von Erfolg oder Misserfolg. Ihre Ängstlichkeit und ihr negatives Selbstbild scheint häufig im Kontrast zu stehen zum lauten, impulsiven und teilweise herumkasperndem Verhalten, was häufig zunächst zu einer Überschätzung ihrer sozialen Fertigkeiten und/oder ihres Selbstvertrauens führt. Da die ADHS-Störung per se bereits mit vielerlei unangenehmen Symptomen (motorische Unruhe mit dem Gefühl des Getriebenseins, Schlafstörung etc.) verbunden ist und in der Folge häufig zahlreiche negative Konsequenzen nach sich zieht, erscheint der Weg in die Sucht nicht verwunderlich. Einerseits um negativen Gefühlen und Konsequenzen zu entfliehen, andererseits als Möglichkeit der Selbstmedikation, um ruhiger, entspannter und konzentrierter zu sein (Amphetamine, THC). 10 Insgesamt zeigen die in unserem Hause behandelten Patienten mit ADHS häufig auch eine ausgeprägte Störung des Sozialverhaltens und der Impulskontrolle, weniger lediglich eine „reine“ ADHS. Es zeigte sich eine sehr große Bandbreite von nur sehr leichten bis hin zu schwer ausgeprägten, die Rehabilitationsfähigkeit einschränkender Symptomatik. Im klinischen Alltag zeigte sich dies daran, dass bei den schwereren Fällen fast eine „Blickdiagnose“ reichte, bei milderer Symptomatik, insbesondere bei reiner ADSStörung eine längere Verhaltensbeobachtung (insbesondere in Situationen, welche eine erhöhte konzentrative Dauerbelastbarkeit erfordern) sowie eine eingehende Fremd- und Eigenanamnese erforderlich ist. Zusätzlich erfolgt eine ADHS-Testung (Wender-Reimherr-Interview, Kurzform der Wender Utah Rating Scale, ADHSSelbstbeurteilungsskala), möglichst eine Fremdanamnese und Hinzuziehung früherer Schulzeugnisse. Die Therapie der ADHS-Störung im Erwachsenenalter umfasst mehrere Bausteine. Bei ausgeprägter Symptomatik sollte zusätzlich zur möglichst störungsspezifischen Psychotherapie und Psychoedukation eine medikamtöse Behandlung erfolgen. Hinsichtlich der medikamentösen Behandlung schwerer ADHS-Störungen im Erwachsenenalter ist die Situation jedoch nach wie vor sehr unbefriedigend, da es bis dato kein zugelassenes Medikament zur Erstbehandlung einer ADHS-Störung im Erwachsenenalter gibt und somit jede medikamentöse Erstbehandlung im Off-LabelUse erfolgen muss. Dies erfordert im Einzelfall einen Kostenantrag bei der zuständigen Krankenkasse im Sinne eines individuellen Heilplanes, was in der Praxis jedoch auf große Schwierigkeiten stößt. Der Goldstandard einer Behandlung – eine Behandlung mit Methylphenidat – unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz und birgt die Gefahr des Missbrauches. Einige unserer ADHS-Patienten haben bereits früher wahrscheinlich aufgrund ihres unbehandelten, oder zu spät erkannten ADHS Methylphenidat missbräuchlich eingesetzt, da sie bereits Suchtverhalten etabliert hatten. Somit sollte eine Behandlung mit Methylphenidat im Erwachsenenalter im Off-Label-Use meiner Ansicht nach nur schwereren Fällen vorbehalten sein, bei denen eine strenge Nutzen-Risikoabwägung erfolgen sollte. Bei dieser Abwägung sollte meiner Ansicht nach das Risiko für erneuten Suchtmittelkonsum durch die unbehandelte ADHS-Störung höher liegen als das Risiko eines Missbrauches von Methylphenidat im Rahmen der Suchterkrankung, was letztendlich jedoch eine äußerst schwierige Abwägung bedeutet. Ein Medikament der zweiten Wahl ist Atomoxetin (Strattera), dieses Medikament – ebenfalls im Off-Label-Use – ist jedoch sehr teuer. In unserer Klinik gab es nach viermonatiger Strattera-Medikation bei einem Patienten Regressanforderungen seitens der Krankenkasse, ein entsprechender Antrag zur Verordnung von Atomoxetin im Off-Label-Use wurde von der Bezirksprüfungsstelle abgelehnt mit der paradoxen Begründung: Die Schwere der ADHS-Störung und der mögliche Nutzen einer medikamentösen Behandlung sei in diesem Einzelfalle nachvollziehbar, eine Kostenübernahme könne jedoch nicht erfolgen, da die Datenlage nicht ausreichend sei und das Medikament nicht die Zulassung hierfür habe. Durch eine solche Ablehnung wird die Antragstellung im Sinne eines individuellen Heilplanes zur Kostenübernahme ad absurdum geführt, da sie ja mit dem pauschalen Hinweis des Off-Label-Use abgelehnt wird. Somit bleibt lediglich der Weg der Selbstzahlung für den Patienten, was bei Atomoxetin aufgrund der hohen Medikamentenkosten kaum möglich ist. 11 Letztlich bleibt dann „nur“ eine medikamentöse Behandlung zusätzlicher comorbider Störungen, welche häufig im Zusammenhang mit der ADHS-Störung stehen, wie z.B. depressive Symptome, Angststörung oder sozialphobische Störungen möglich mit einem auch die ADHS-Symptomatik beeinflussenden noradrenergen (Venlafaxin, „Trevilor“) oder dopaminergen (Bupropion,“Elontril“) Antidepressivum. Da mittlerweile eine Medikation mit Atomoxetin aus oben genannten Gründen trotz guter Erfahrungen ausscheidet, behandeln wir derzeit unsere Patienten bei ausgeprägterer ADHS-Störung überwiegend mit Venlafaxin oder Bupropion. Hierbei sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich und reichen von Status idem bis hin zu sehr deutlichen Befundverbesserungen. Leider gibt es – analog der antipsychotischen Medikation – bisher keine validen Auswahl- und Prognosekriterien hinsichtlich der bei der ADHS-Störung empfohlenen Medikamente. Zur Illustrierung einige Patientenkasuistiken: Ein sehr unauffälliger 22-jähriger Patient mit reiner ADS-Störung, welche erst durch eingehende Anamneseerhebung und Testung offensichtlich wurde, profitiert derzeit deutlich von einer medikamentösen Behandlung mit Bupropion, berichtet von einer deutlichen Besserung seiner Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne. In diesem Falle standen uns seine damaligen Grundschulzeugnisse (untypisch für Suchtpatienten) zur Verfügung, hieraus einige Auszüge: Grundschulklasse 2: „Christian zeigte einen unterschiedlichen Arbeitswillen. Trotz individueller Hilfen fand er zu keiner beständigen Arbeitsweise. Eine Leistungsverbesserung kann nur erfolgen, wenn Christian konzentrierter arbeitet, die Ordnung in seinen Arbeitsmaterialien verbessert und jede Hausaufgabe gewissenhafter erledigt.“ Grundschulklasse 4: „Meistens ist Christian mit seinen Gedanken völlig abwesend, zeigt wenig Interesse und muss immer wieder ermuntert werden, dem Unterricht zu folgen. Arbeiten ohne besonderen Aufforderungscharakter erledigt er ungern und oberflächlich. Schriftliche Arbeiten werden oftmals aus Bequemlichkeit nicht angefertigt. Schwierigkeiten weicht er gerne aus.“ Sekundarschule Klasse 5: „Christian sollte im Unterricht konzentrierter mitarbeiten, seine Hausaufgaben erledigen und seine Arbeitsmaterialien mitführen.“ Ein zweiter 25-jähriger Patient zeigte sich zunächst hinsichtlich seiner ADHS-Störung ebenfalls sehr unauffällig, da er durch eine äußerst rigide mit Strafen verbundene Erziehung wie „domptiert“ seine ADHS-Symptome unterdrückte, was er jedoch selbst als sehr qualvoll „wie ein Dampfkochtopf“ erlebte. Dieser Patient profitierte deutlich von einer Medikation mit Venlafaxin, zeigte sich hierunter deutlich ruhiger, konzentrierter, ausgeglichener und weniger impulsiv. Ein weiterer 36-jähriger Patient zeigte eine sehr schwere ADHS-Störung mit massiver motorischer Unruhe und Hyperaktivität mit exzessivem Marathonlaufen und ausgepägter Hypersexualität (exzessive nächtliche Masturbation) zur Spannungsreduktion. Dieser Patient profitierte zunächst von einer Medikation mit Venlafaxin, lehnte dies jedoch im weiteren Verlauf vehement ab, so dass er in der Folge nicht mehr rehabilitationsfähig war und entlassen werden musste. Dies leitet über zur Reaktion von ADHS-Patienten auf eine erstmalige Medikation ihrer ADHS-Störung. Diese Reaktion erlebe ich sehr unterschiedlich: Manche Patienten sind sehr entlastet und erleichtert, berichten z.B. zum ersten Mal – wie bei 12 einem Falle – seit 7 Jahren wieder länger lesen zu können (davor nur Comics oder kurz Artikel). Andere Patienten jedoch wie der zuletzt genannte Patient erleben sich als unvertraut-unbekannt verändert und tun sich äußerst schwer damit, sich als anders zu erleben oder bisherige Strategien (exzessiver Sport etc.) abzulegen, haben sich vielleicht sogar in ihrer „Nische“ eingerichtet. Auch dies ist nicht weiter verwunderlich, da sich die Patienten ja nicht anders kennen, diesen unterschiedlichen Reaktionen muss man jedoch gewahr sein und Rechnung tragen. Obligat ist eine entsprechende psychoedukative Aufklärung bezüglich der ADHSStörung. Diese war in der Vergangenheit bei unseren Patienten bisher so gut wie nie erfolgt. Die Psychoedukation sollte jedoch nicht nur ein defizitäres Krankheitsmodell vermitteln, sondern auch positive Ressourcen der ADHS-Störung wie Energie, Neugier, Kreativität, Phantasie, Mut, Anpassungsfähigkeit und teilweise die Fähigkeit zur Hyperfokussierung bei starkem Interesse vermitteln. Generell ist es bei diesen Patienten wichtig, ressourcenorientiert zu arbeiten, denn negative Bewertungen („Hintergrundrauschen“) kennen sie zur Genüge aus ihrer Kindheit und Jugend. Darüber hinaus besteht in einem strukturierten Kliniksetting immer die Gefahr, dass sie erneut als „Störenfriede“ auffallen und sich dann durch Ermahnungen, Zurechtweisungen oder andere negative Sanktionen ihr bisheriges Lebensmuster wiederholt. Hilfreich für diese Patienten kann auch sein, zum ersten Mal andere ADHS-Patienten zu sehen und das Gefühl der „Einzigartigkeit“ dadurch zu verlieren. Zur Erhöhung der Konzentration und Minderung der erhöhten Ablenkbarkeit und zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung bei der typischen starken Außenattribuierung der ADHS-Patienten sind zusätzlich Achtsamkeitsübungen sinnvoll. Diese haben den großen Vorteil, dass sie nach anfänglicher Übung und Anleitung vom Patienten selbst problemlos fast jederzeit in den Alltag integriert und im Alltag angewendet werden können und keine „Extratherapiezeit“ benötigen. Eine sinnvolle Ergänzung hierzu sind dann Anleitungen und Übungen zur Handlungsplanung und – strukturierung zur Chaosreduzierung und Erhöhung der Eigenkontrolle. Analog den Patienten mit zusätzlicher psychotischer Störung besteht auch bei ADHS-Patienten die Gefahr, dass sie zu sehr auf ihre comorbide Störung fokussieren und ihre Suchterkrankung hierdurch in den Hintergrund zu treten droht. Dies gilt es dann immer wieder zu berücksichtigen und zu korrigieren. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass sich manche Patienten auf ihre ADHS-Störung reduzieren nach dem Motto: “Dafür kann ich nichts, das ist mein ADHS.“ Hier ist es immer wieder wichtig, ihnen zu vermitteln, dass sie ADHS haben und nicht ADHS sind und durchaus große Beeinflussungs- und Kontrollmöglichkeiten haben, die sie jedoch erst lernen müssen. Und Lernen ist halt häufig gerade eine Schwierigkeit beim ADHS. Vor allem, wenn man dazu Geduld braucht. Abschließend möchte ich einige allgemeine Prinzipien darstellen, die aus meiner Sicht für eine Behandlung von Suchtpatienten mit comorbiden Störungen in besonderer Weise wichtig sind: 1. Vernetzung Gerade bei Patienten mit comorbiden Störungen scheint eine Vernetzung mit verschiedensten stationären und ambulanten Einrichtungen sinnvoll. Diese müssen vielfältigster Natur sein. So ist z.B. gerade für unsere jungen suchtmittelabhängigen Erwachsenen mit einer ADHS-Störung eine Kooperation mit Bildungseinrichtungen (Schulen, Berufsbildungszentren) sinnvoll, des weiteren mit Spezialambulanzen, aber 13 auch therapeutischen Wohnheimen, mit enger Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Therapeuten etc.. Genauso wichtig wie eine externe Vernetzung ist jedoch auch eine interne Vernetzung mit „gestufter“ Behandlung der Patienten. So z.B. eine Behandlung in unserem Haupthaus in der Fachklinik Eiterbach, danach eine mehr am Alltag und Berufsleben orientierte Adaptionsbehandlung im Haus Heidelberg, danach gegebenenfalls ein Wechsel in eine betreute Nachsorgewohngemeinschaft in Heidelberg mit Anbindung an ein ambulantes Hilfesystem (Selbsthilfegruppe, Suchtberatungsstelle, psychiatrische Institutsambulanz, ambulante Psychotherapie, Arbeitsvermittlung). 2. Interdisziplinarität Gerade wegen der comorbiden Störungen ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachrichtungen und Fachleuten unabdingbar. Häufig ist es noch so, dass Suchtpatienten mit comorbiden Störungen (insbesondere z.B.Borderlinepatienten) sprichwörtlich zwischen den Stühlen sitzen und eine Fachrichtung (z.B. Sucht) an die andere Fachrichtung (z.B. Allgemeinpsychiatrie) verweist. Oder aber es wird auf das eigene Fachgebiet fokussiert: So vermutet der Suchttherapeut bei einer psychotischen Dekompensation eines Suchtpatienten mit einer zusätzlichen drogeninduzierten Psychose zunächst einmal einen Rückfall als Auslöser, der allgemeinpsychiatrisch Tätige denkt vielleicht zunächst erst einmal an einen durch Stress ausgelösten psychotischen Schub, wobei in manchen Fällen das eine das andere überhaupt nicht ausschließt. Hier wäre eine engere Zusammenarbeit und ein Hinausschauen über den „eigenen Tellerrand“ sinnvoll und wichtig. Heutzutage zeigt sich immer mehr, dass eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Disziplinen unabdingbar ist, wenn man mit komplexen Systemen zu tun hat. Und schließlich ist das komplexeste System, das wir kennen, der Mensch. 3. Pragmatismus Aus meiner Sicht sind „dogmatische“ Haltungen nicht sinnvoll und konstruktiv. In den Anfängen der Fachklinik Eiterbach z.B. war es fast ein Tabuthema, Patienten mit einer Suchterkrankung und zusätzlichen psychotischen Störungen medikamentös/neuroleptisch zu behandeln und ordnete dies süchtigem Verhalten zu. Mittlerweile ist dies an der Tagesordnung und eine Selbstverständlichkeit. Möglicherweise wird die Entwicklung in eine ähnliche Richtung gehen bei schwereren ADHS-Patienten und einer Suchterkrankung: Derzeit wird noch häufig argumentiert, dass eine Methylphenidatbehandlung bei ADHS-Störungen und gleichzeitiger Suchterkrankung kontraindiziert sei aufgrund des Missbrauchspotenziales von Methylphenidat. Meines Erachtens ist eine umgekehrte Argumentation einleuchtender: Dass nämlich ein schweres unbehandeltes ADHS im Erwachsenenalter eher zurück zur Sucht führt als eine Medikation mit einem Stimulanz. Vielleicht ist es eine deutsche Eigenart, abstrakt herumzutheoretisieren, anstatt etwas pragmatisch auszuprobieren und aus den Erfahrungen zu lernen. 4. Strukturiertes ressourcenorientiertes Therapiesetting mit zusätzlichen sozialtherapeutischen und pädagogischen Maßnahmen 14 Gerade Patienten mit comorbiden Störungen, insbesondere mit ADHS und psychotischen Störungen benötigen ein stark strukturiertes Setting, häufig eher stützend-ressourcenorientiert und weniger konfrontativ arbeitend. Aufgrund der comorbiden Störungen zeigt diese Patientengruppe häufig deutliche Reifungsdefizite und Einschränkungen in der Kompetenz alltags- und lebenspraktische Fähigkeiten. Teilweise zeigen sich die Patienten deutlich entwicklungs- und reifungsverzögert, so dass auch sozialpädagogische und sozialtherapeutische Interventionen und Maßnahmen nötig sind. So erhalten z.B. viele unserer Patienten (insbesondere ADHS-Patienten mit Teilleistungsstörungen wie Legasthenie oder Rechenschwäche) Unterricht in Deutsch, Mathematik und teilweise Englisch. Ausblick Wie bereits im Anfangsteil des Vortrages gezeigt, hat sich eine Verschiebung der Hauptsuchtproblematik ergeben, so wurde die Opiatabhängigkeit als Hauptsuchtmittel erstmals durch die Cannabisabhängigkeit abgelöst. Wir sehen im Zusammenhang damit und mit dem zusätzlichen „Vormarsch“ von Stimulanzien und Partydrogen eine Zunahme jüngerer Suchtpatienten mit teilweise erheblichen Sozialisations/Reifungsdefiziten und Einschränkungen der Kompetenz alltags- und lebenspraktischer Fähigkeiten. Insofern sind diese Patienten zwar volljährig, vom Reifegrad her jedoch eigentlich noch auf dem Stand pubertierender Jugendlicher. Dies ist aus meiner Sicht jedoch nicht ein typisches Problem von Suchtkliniken, sondern ein allgemein gesellschaftliches Phänomen. Kinder und Jugendliche zeigen sich heute weniger sozialisiert, stärker sich selbst überlassen, zeigen teilweise erhebliche Sozialisationsdefizite, sind mehr „spaß- und freizeitorientiert“, haben häufiger Probleme mit Autoritätspersonen, zeigen teilweise eine geringere Leistungsbereitschaft und orientieren sich eher nach dem „Lustprinzip“. Diese Problematik wird auch von Schulen, Lehrern und Arbeitsgebern geschildert und scheint jetzt auch in den Suchtkliniken angekommen zu sein. Dies erfordert aus meiner Sicht in Zukunft eine noch engere interdisziplinäre Vernetzung und Verstärkung pädagogischer Maßnahmen in Kliniken. Möglicherweise kommt eine „Welle“ folgender Patienten auf uns zu: 15 Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. 16 17