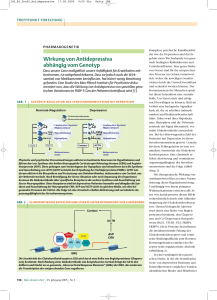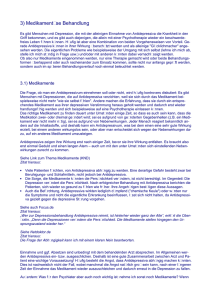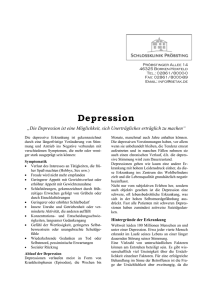Antidepressiva - Hilfe für die kranke Seele - Schlosspark
Werbung

PHARMAZEUTISCHE ZEITUNG Ausgabe 3/2015 Antidepressiva Hilfe für die kranke Seele Von Annette Mende, Berlin / Nur eine Minderheit der Patienten mit behandlungsbedürftiger Depression wird gemäß den aktuellen Standards therapiert. Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist der Widerstand, den viele Patienten gegen die Behandlung leisten. Er richtet sich insbesondere gegen die eingesetzten Medikamente. »Lediglich 10 bis 20 Prozent der depressiven Patienten in Deutschland erhalten eine adäquate Therapie«, sagte Thomas Müller-Rörich, erster Vorsitzender der Depressionsliga, beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin. Diese eklatante Unterversorgung liegt sicher auch an der immer noch vorhandenen Stigmatisierung der Erkrankung und dem Mangel an Psychotherapieplätzen. Doch »selbst wenn es gelänge, das Bild von der Depression als das einer Krankheit wie jede andere in der Gesellschaft zu etablieren und eine ideale Versorgungssituation zu schaffen, würden nicht alle Patienten die Hilfe erhalten, die sie brauchen«, glaubt Müller-Rörich. Denn es gehört zum Wesen der Krankheit Depression, dass Betroffene sich einer Therapie entziehen wollen. Der Krankheit ausgeliefert »Eine Depression fühlt sich nicht an wie eine behandelbare Krankheit, sondern wie ein schlimmer persönlicher Fehler«, sagte Müller-Rörich. Er weiß, wovon er spricht, denn er war selbst schon einmal schwer depressiv. Betroffene seien dem eigenen abwehrenden, von Hoffnungslosigkeit geprägten und oft selbstzerstörerischen Denken und Fühlen ausgeliefert, ohne daran etwas ändern zu können. Man empfinde sich selbst als minderwertig und schäme Patienten haben Angst, sich einem Arzt anzuvertrauen, zum einen weil sie dessen Urteil fürchten und zum anderen, weil sie keine Medikamente verordnet bekommen wollen. »Man vermutet, dass die Arzneimittel die eigene Persönlichkeit verändern, verkennt dabei aber völlig, dass es die Depression ist, die einen manipuliert und die Psyche in eine unrealistisch negative Wahrnehmung zwingt«, sagte Müller-Rörich. Die mit der Erkrankung einhergehende Scham und die Überzeugung von der eigenen Minderwertigkeit tun ein Übriges: »Ich kann meine persönlichen Probleme doch nicht mit einer Pille bekämpfen«, lautet die Überzeugung. So dachte auch die Journalistin Heide Fuhljahn, die jahrelang unter einer Depression litt, bevor sie sich 2006 in einer psychiatrischen Klinik behandeln ließ. Ihre Erfahrungen mit der Krankheit und mit sowohl psychotherapeutischer als auch medikamentöser Therapie dokumentiert ihr Buch »Kalt erwischt«, das sie beim DGPPN-Kongress vorstellte. »Heute halte ich Antidepressiva, wenn man ordentlich mit ihnen umgeht, für relativ harmlose Medikamente«, sagte Fuhljahn in Berlin. »Sie können eine Psychotherapie nicht ersetzen. Aber sie können das Überleben sichern, wenn das Leid des Patienten so groß wird, dass er es sonst nicht aushält.« »Antidepressiva haben einen festen Platz in der Therapie der unipolaren Depression«, bestätigte Professor Dr. Tom Bschor von der Schlosspark-Klinik Berlin. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, war in der Vergangenheit nicht immer unumstritten. Bschor zitierte eine Studie von Dr. Irving Kirsch aus dem Jahr 2008, der damals als PsychologieProfessor an der Universität Hull tätig war (»Plos Medicine«, DOI: 10.1371/journal.pmed.0050045). Kirsch fand, dass es bei einer leichten Depression keinen relevanten Unterschied ausmacht, ob man einen Patienten mit einem Antidepressivum oder mit einem Placebo behandelt. Erst bei einer schweren Depression seien Antidepressiva im Vorteil, was ihre Gabe trotz möglicher Nebenwirkungen rechtfertige. Großer Placebo-Effekt »Eine Empfehlung für oder gegen Antidepressiva kann sich natürlich nicht allein auf eine Studie stützen«, sagte Bschor, der als Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft einer der Autoren der deutschen S3-Leitlinie zur unipolaren Depression ist. Eine weitere, von Jay Fournier 2009 im Fachjournal »JAMA« publizierte Untersuchung sei jedoch zu demselben Ergebnis gekommen (DOI: 10.1001/jama.2009.1943). Diese Erkenntnis habe die S3-Leitlinie mit der Empfehlung aufgegriffen, dass Antidepressiva bei leichten depressiven Episoden nicht generell zur Erstbehandlung gegeben werden sollen, sondern allenfalls unter besonders kritischer Berücksichtigung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses. Bei einer mittelgradigen depressiven Episode soll Patienten eine Therapie mit einem Antidepressivum angeboten werden. Auch bei schwerer Depression empfiehlt die Leitlinie die medikamentöse Therapie, im Unterschied zur mittelschweren Erkrankung dann aber in Kombination mit Psychotherapie. Der Placebo-Effekt hat einen großen Anteil an der Wirkung von Antidepressiva. Lehnt ein Patient die Einnahme ab, hat es daher wenig Sinn, ihn dazu zu überreden. Der Psychologe Kirsch ist nicht erst seit 2008 das Enfant terrible der Psychopharmaka. Bereits zehn Jahre zuvor veröffentlichte er in »Prevention & Treatment« eine Arbeit mit dem provokanten Titel »Listening to Prozac but Hearing Placebo« (Volume 1, Article 0002a, June 26, 1998). Anhand einer Metaanalyse kam er darin zu dem Schluss, dass der Placebo-Effekt einen außerordentlich hohen Anteil an der Wirkung antidepressiver Medikamente hat. Kirsch schreibt ihm 51 Prozent, dem pharmakologischen Effekt dagegen lediglich 25 Prozent der Wirkung zu. Die fehlenden 24 Prozent führt er auf eine spontane Besserung der Beschwerden zurück, die auch ohne jede Behandlung von selbst eintritt. Foto: Imago/Westend61 »Auch dieses Ergebnis konnte bestätigt werden«, sagte Bschor. Professor Dr. Winfried Rief von der Universität Marburg errechnete 2008 im »Journal of Affective Disorders« für den pharmakologischen Effekt zwar einen Anteil von 32 Prozent an der Wirkung antidepressiver Arzneimittel, »aber die Größenordnung ist dieselbe«, so Bschor (DOI: 10.1016/j.jad.2009.01.029). Offenbar ist der Placebo-Effekt bei Antidepressiva also sehr ausgeprägt. »Für die Behandlung kann man daraus mehrere Botschaften ableiten«, sagte der Psychiater. Erstens: Patienten, die nicht wollen, sollte man nicht zu Medikamenten drängen. Zweitens: Ein Wechsel des Arzneistoffs bei ausbleibender Wirkung bringt oft nichts. »Das bestätigen alle Studien zu dieser Fragestellung: Es ist dieselbe Wirkung, als hätte man das alte Präparat weitergegeben«, sagte Bschor. Stattdessen sollte man etwas anderes versuchen, etwa eine Lithium-Augmentation oder eine Wirkspiegel-Bestimmung. Damit lässt sich feststellen, ob überhaupt genügend Wirkstoff im Blut des Patienten ankommt, oder ob dieser vielleicht zufällig ein Ultra-rapid-Metabolizer ist, der den Arzneistoff sehr schnell abbaut. Verordnungszahlen steigen »Antidepressiva sind heute absolute Boomprodukte«, sagte Bschor und verwies auf den »Arzneiverordnungsreport«, wonach im Jahr 2013 in Deutschland 1341 Millionen definierte Tagesdosen (DDD) zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung verordnet wurden. »Die Verordnungszahlen sind seit den 1990er-Jahren so stark gestiegen, dass wir uns mittlerweile mit der Frage beschäftigen müssen, ob sie zu häufig gegeben werden.« So ließe sich in manchen Fällen diskutieren, ob ein Antidepressivum tatsächlich indiziert ist, oder ob man nicht vielmehr ein Alltagsproblem des Betroffenen für krankhaft erkläre, indem man es mit einem Medikament behandelt. Angesichts dieser Entwicklung muss auch die Sicherheit der Antidepressiva unter besonders genauer Beobachtung stehen. Damit beschäftigt sich unter anderem das Projekt Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie (AMSP), das Professor Dr. Waldemar Greil von der LMU München vorstellte. AMSP ist ein Zusammenschluss von 64 psychiatrischen Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in denen schwere und unerwartete unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) eingeführter Psychopharmaka in der Praxis erfasst werden sollen. Auslöser für die Gründung des Projekts war das gehäufte Auftreten von Agranulozytosen unter dem Neuroleptikum Clozapin, das erstmals in den 1970er-Jahren auffiel. Eine Depression fühlt sich nicht an wie eine behandelbare Krankheit, sondern wie ein schlimmer persönlicher Fehler. Foto: Imago/Imagebroker Nebenwirkungen im Fokus »Im AMSP-Projekt erfassen wir zweimal jährlich die Medikation und Dosierungen all unserer Patienten«, sagte Greil. Diese Daten ließen nicht nur Rückschlüsse auf mögliche, bislang noch unbekannte UAW zu, sondern bildeten auch die Versorgungsrealität auf psychiatrischen Stationen ab. Sie zeigen, dass 70 bis 80 Prozent der stationär behandelten Patienten Antidepressiva erhalten, auch diejenigen mit bipolarer Depression und BorderlinePersönlichkeitsstörung. »Eine weitere Beobachtung ist, dass immer häufiger mehrere Arzneimittel gleichzeitig gegeben werden«, sagte Greil. Im Durchschnitt erhalte jeder Patient vier Medikamente. Diese Entwicklung gehe aber nicht mit einer steigenden Zahl an Interaktionen einher, im Gegenteil: »Wir sehen eine zunehmende Polypharmazie, aber abnehmende Risiken«, so Greil. Das zeige, dass insbesondere neuere Wirkstoffe günstige Interaktionsprofile aufweisen. Die Risiken mögen weniger geworden sein, auf einem relativ hohen Niveau bewegen sie sich aber immer noch. Das zeigen Zahlen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), die Dr. Martin Huber vorstellte. Demnach stehen Medikamente der ATC-Gruppe N – Arzneimittel mit Wirkung auf das Nervensystem – nach den antineoplastischen und immunmodulierenden Wirkstoffen auf Platz zwei bei der Anzahl der gemeldeten Nebenwirkungen. Rund ein Viertel der Nebenwirkungsberichte aus der Gruppe N kommen durch Psychoanaleptika zustande, zu denen die Antidepressiva gehören. Am häufigsten sorgt dabei Venlafaxin für Probleme, gefolgt von Mirtazapin und Citalopram. »Das entspricht in etwa den Verordnungszahlen«, sagte Huber. Angesichts der Verordnungshäufigkeit ist das bemerkenswert, denn diese ist zwar gestiegen, liegt aber immer noch weit unter der von beispielsweise Herz-Kreislauf-Medikamenten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Antidepressiva generell nebenwirkungsträchtigere Medikamente sind als beispielsweise Blutdrucksenker. Denn die Anzahl Spontanmeldungen erlaubt keinen Rückschluss auf die absolute Häufigkeit von UAW, wie Huber betonte.