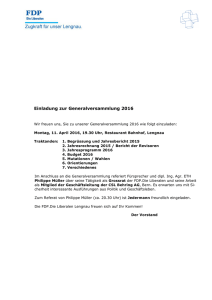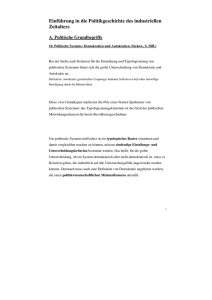Die Institutionalisierung der liberalen Demokratie: Deutschland im
Werbung
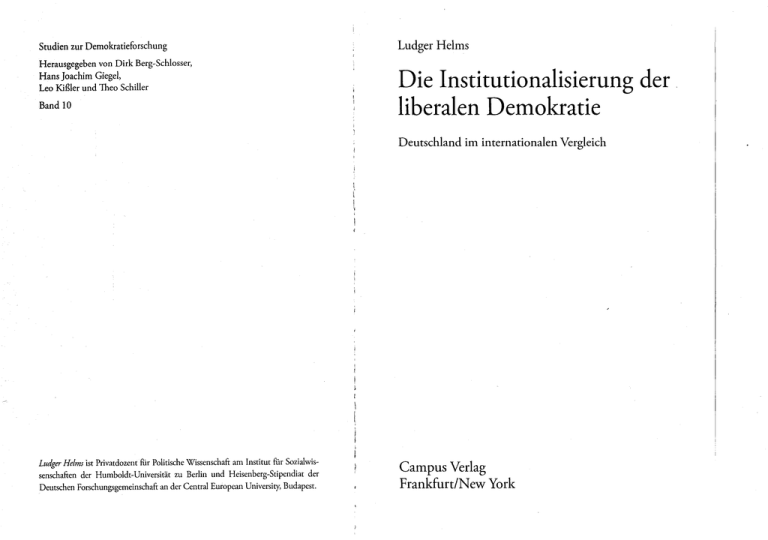
Studien zur Demokratieforschung Ludger Helms Herausgegeben von Dirk Berg-Schlosser, Hans Joachim Giegel, Leo Kißler und Theo Schiller Band 10 Die Institutionalisierung der liberalen Demokratie Deutschland im internationalen Vergleich Ludger Helms ist Privatdozent für Politische Wissenschaft am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin und Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Central European University, Budapest. Campus Verlag Frankfurt/New York Inhalt Vorwort 7 1 Einleitung: Die Institutionalisierung der liberalen Demokratie 9 2 Wahlrecht und Wahlsystem: Die institutionellen Filter politischer Repräsentation 25 3 Politische Parteien: Das Rückgrat der repräsentativen Demokratie 49 4 Interessengruppen: Agenten der Zivilgesellschaft? 83 5 Massenmedien: Spiegel und Katalysatoren politischer Macht 109 6 Das Parlament: Die demokratische Herzkammer des gezähmten Leviathan 136 7 Die Exekutive: Institutionen und Akteure am Gipfel des staatlichen Herrschaftssystems 161 8 Der Bundesstaat: Die Institutionalisierung des territorialen Pluralismus 193 9 Verfassungsgerichtsbarkeit: Die Vollendung der konstitutionellen Gewaltenteilung 225 10 De-Institutionalisierung und Internationalisierung als Gefährdungen der liberalen Demokratie? 249 Literatur 275 Vorwort Ein Buch sollte eigentlich für sich selbst sprechen. Angesichts nicht nur der geradezu atemberaubenden Vermehrung der sozialwissenschaftlichen Literatur, sondern auch des heute zu beobachtenden Ausmaßes an thematischer, theoretischer und methodischer Fragmentierung der internationalen Sozialwissenschaften mag ein kurzes Geleitwort dennoch gestattet sein. Die Studie möchte trotz ihrer betont schlicht gehaltenen Architektur nicht, oder jedenfalls nicht primär, ein Handbuch sein, das einen unkomplizierten Zugriff auf unterschiedliche Ausschnitte eines komplexen Themas verspricht, sich dafür aber willfährig des Anspruchs begibt, in seiner Gesamtheit gelesen zu werden. Durch ein solches Selbstverständnis würde eine breit angelegte monographische Arbeit ihre offensichtlichste Stärke gegenüber der Vielzahl von Sammelbänden preisgeben, in denen entweder editorisches Chaos regiert und die intellektuelle Synthese nahezu vollständig dem Leser überlassen bleibt oder aber, so vor allem in vielen »crossnational studies«, sämtliche Kapitel ein und demselben sterilen Aufbauschema unterworfen werden, um dem Herausgeber die Abfassung einer vergleichenden Zusammenschau so leicht wie möglich zu machen. Das Buch will insbesondere kein weiteres in der langen Reihe von Werken sein, die vor allem durch Zahlen zu seinen Lesern sprechen. Die für das Thema besonders wichtigen Datenhandbücher, von denen auch diese Studie profitiert hat, wurden dem Verzeichnis der übrigen zitierten Literatur am Ende des Bandes vorangestellt, um zu ihrer Benutzung zu ermuntern. Ansonsten gehört der Verfasser zu jenen, die auf die Kraft des Wortes, auf die sprachlich-argumentative Fähigkeit zur Darstellung, Analyse und Bewertung komplexer Phänomene und Zusammenhänge setzen. Wie jede Untersuchung, die nicht lediglich vom Ehrgeiz gewissenhafter Deskription getragen ist, baut auch diese auf einem breiten theoretischen Fundament. Im Gegensatz zu anderen Werken der Demokratieforschung handelt es sich bei der hier vorgelegten Arbeit gleichwohl nicht um eine 8 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE theoretische Studie. Sie stellt den Anspruch, theoretisch fundiert im Sinne von »theoretically informed« zu sein, ist dabei jedoch durchwegs von einem instrumentellen Verhältnis zur Theorie bestimmt, dem es darum geht, politisch-gesellschaftliche Phänomene in »real-world countries« fassbar zu machen. Die Anfang 2007 abgeschlossene Arbeit ist aus einem mehrjährigen Forschungsprojekt hervorgegangen, welches von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Heisenberg-Programms auf denkbar großzügige Weise gefördert wurde. Die unterschiedlichen Teile der Untersuchung wurden – größtenteils im Rahmen ausgedehnter Forschungsaufenthalte an der Harvard University, der London School of Economics, der University of Tokyo und der Universität Göttingen – auf jenen drei Kontinenten geschrieben, von denen diese Studie handelt. Den zahlreichen Kollegen, mit denen ich dabei zusammentreffen konnte, sei an dieser Stelle herzlich für ihre Gastfreundschaft gedankt. Berlin, im Februar 2007 Ludger Helms 1 Einleitung: Die Institutionalisierung der liberalen Demokratie Aus Sicht der heutigen Politikwissenschaft handelt es sich bei Demokratie um etwas, das niemals ist, sondern ständig wird (von Beyme 1994: 9). Selbst nach einem engeren, institutionenbasierten und staatszentrierten Begriffsverständnis bleibt die Demokratie ein dynamisches Konzept, eine potentiell »gefährdete Staatsform« (Leisner 1998), deren politische Überlebensfähigkeit sich stets aufs Neue im Kontext vielfältiger Herausforderungen zu bewähren hat. Gerade deshalb sind Demokratien nicht nur, aber auch auf institutionelle Grundlagen angewiesen, die ein notwendiges Maß an Stabilität mit einem hinreichenden Maß an Flexibilität zu verbinden wissen. Dem historisch und international vergleichenden Studium dieser institutionellen Grundlagen der liberalen Demokratie ist die vorliegende Studie gewidmet. So zentral politische Institutionen für die Demokratie, so prominent diese innerhalb der Demokratieforschung sind, so schillernd und vieldeutig ist der Institutionenbegriff. Dies kann nur zum Teil als eine Folge der Multidisziplinarität der Institutionenforschung gesehen werden. Selbst innerhalb einzelner Disziplinen existiert kein allgemein akzeptierter Begriff der politischen Institution, ja wird dies unter Verweis auf die komplementären Erkenntnispotentiale unterschiedlicher Institutionenbegriffe und der ihnen korrespondierenden Forschungsansätze nicht einmal immer als wünschenswert erachtet (Immergut 1998: 25). Hier ist nicht der Ort für eine ausgreifende Rekonstruktion der theoretischen Debatte über politische Institutionen.1 Auf eine terminologische Grundlegung kann jedoch auch eine Studie nicht verzichten, die auf die empirische Dimension politischer Institutionen in den konsolidierten liberalen Demokratien konzentriert ist. —————— 1 Für den spezielleren Bereich der Vergleichenden Regierungslehre hat der Verfasser vor einigen Jahren einen Überblick vorgelegt, auf den an dieser Stelle verwiesen sei; vgl. Helms (2004). Auf Jahre hin als maßgebliches Referenzwerk behaupten dürfte sich der international besetzte Band von Rhodes/Binder/Rockman (2006). 10 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Weithin konsensfähig dürfte heute die Feststellung sein, dass es sich bei Institutionen (1) um ein auf mittlerer oder Meso-Ebene angesiedeltes Konzept handelt, dass (2) Institutionen sowohl formale als auch informale Aspekte aufweisen und dass sie (3) ein gewisses Maß an Legitimität, welches über die Präferenzen individueller Akteure hinausgeht, sowie ein gewisses Maß an Stabilität besitzen (Lowndes 1996: 182). Jenseits dieser Bestimmungsmarken verbleiben beträchtliche Spielräume. Dem gerade innerhalb der Vergleichenden Regierungslehre ausgesprochen einflussreichen Ansatz des »akteurzentrierten Institutionalismus« (Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000) zufolge handelt es sich bei Institutionen um Regeln bzw. Regelsysteme, die das Handeln individueller und korporativer Akteure begrenzen, zum Teil aber auch erst ermöglichen. Diesem Verständnis nach verbleiben etwa Parlamente, Parteien oder Interessengruppen als korporative Akteure bzw. Organisationen ausdrücklich außerhalb des Institutionenbegriffs (Scharpf 2000: 77) – im Gegensatz zu parlamentarischen Geschäftsordnungen, Parteistatuten oder Verbandssatzungen. Abhängig vom jeweiligen Erkenntnisinteresse kann sich dieser Zugang als ausgesprochen nützlich erweisen wie die zahlreichen von ihm beeinflussten Arbeiten dokumentieren. Hier wird – zumindest was die Konzeption auf der Meta-Ebene betrifft2, bei der es um die Auswahl der Untersuchungsgegenstände der Studie geht – gleichwohl von einem weiteren Verständnis politischer Institutionen ausgegangen, das international nicht weniger verbreitet ist. Dieses schließt Organisationen nicht aus, ja betrachtet diese, sofern sie »den Prozeß der politischen Handlungskoordination – der Meinungsbildung, Konfliktaustragung, Konsensbildung, Entscheidungsfindung und des Entscheidungsvollzugs – strukturieren« (Seibel 1997: 363), sogar als die besonders wichtigen politischen Institutionen.3 Vom älteren Institutionalismus der frühen, noch stark rechtswissenschaftlich geprägten Regierungslehre setzt sich der hier entwickelte Zugang zum einen dadurch ab, dass er nicht auf die formalen Institutionen be- —————— 2 3 Etwas anderes gilt für die theoretischen Grundlagen der Analyse von Institutionalisierungsprozessen selbst. Vgl. FN 15. Damit ist zugleich eine Abgrenzung gegenüber sozialen Institutionen gezogen. Diesem Verständnis politischer Institutionen folgt auch die von Peter Mair herausgegebene Reihe »Comparative Political Institutions«, aus der in den vergangenen Jahren mehrere wichtige Arbeiten über die politischen Institutionen ausgewählter westlicher Länder hervorgegangen sind (etwa Schmidt 2003; Elgie 2003; Judge 2005). EINLEITUNG 11 schränkt bleibt, sondern auch die informalen Institutionen berücksichtigt. Letztere unterscheiden sich von ersteren nicht dadurch, dass sie für die Struktur des demokratischen Prozesses prinzipiell weniger bedeutend wären. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Historisch gingen viele formale Institutionen aus informalen Institutionen hervor. Umgekehrt werden etablierte formale Institutionen durch informale Institutionen überlagert bzw. ergänzt. So kommt kaum eine der »Koalitionsdemokratien« Westeuropas ohne ein umfangreiches informales Regelwerk zur Optimierung des intra-gouvernementalen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses aus (Müller/Strøm 2000a).4 Aus systematischer Hinsicht gehören zu den wichtigen Unterschieden formaler und informaler Institutionen die Bedingungen ihrer Entstehung und ihres Fortbestands: Anders als im Falle formaler Institutionen liegen diese nicht in den Händen Dritter, sondern in jenen der beteiligten Akteure selbst (Farrell/Héritier 2003: 583). Da sie nicht justiziabel sind, können die regelbezogenen Elemente informaler Institutionen nur so lange Geltung beanspruchen wie sie von sämtlichen der durch sie betroffenen Akteure anerkannt werden. Die wichtigste Voraussetzung für die Entstehung und den Bestand informaler Institutionen mit inklusivem Potential bildet ein hinreichendes Vertrauen auf Seiten der involvierten Akteure (Farrell/Knight 2003); erst auf dieser Grundlage können sich speziellere Kosten-Nutzen-Abwägungen von Akteuren entwickeln, aus denen informale Institutionen ihre funktionale Existenzberechtigung beziehen. Eine zweite Abgrenzung gegenüber älteren Beiträgen der Vergleichenden Regierungslehre im Stile von »Verfassungssystematiken« ergibt sich aus der Berücksichtigung der Dynamik politischer Institutionen. Das hier entwickelte Institutionenverständnis weist starke Bezüge zur geschichtswissenschaftlichen Institutionenanalyse auf, wobei dort zuweilen über das Ziel hinausgeschossen wurde, wenn Institutionen, wie bei Reinhard (2000: 125– 126), geradezu als »Prozesse« begriffen werden. Unmittelbarster Ausdruck des besonderen Interesses dieser Studie an der Dynamik politischer Institutionen ist die Aufnahme des Begriffs der »Institutionalisierung« in den Titel des Werkes. Er ist nicht minder definitionsbedürftig als jener der Institution selbst. —————— 4 Wie dieses Beispiel bereits zeigt, muss es sich bei informalen Institutionen keineswegs zwingend um Erscheinungen handeln, die aus demokratietheoretischer Perspektive grundsätzlich als negativ bzw. problematisch zu bewerten wären (Lauth 2000: 25–26; Helmke/Levitsky 2004); vgl. Abschnitt 10.1. 12 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Auf komplexere Konzepte der Institutionalisierung stößt man bis heute am ehesten in der politischen Soziologie (etwa Nedelmann 1996). Institutionalisierung meint dort vor allem den Prozess der gesellschaftlichen Internalisierung von Werten und Normen. Ein solches Verständnis kennzeichnet indes nicht nicht nur soziologische Beiträge zum Studium politischer Institutionen, sondern hat verbreiteten Niederschlag auch in soziologisch beeinflussten Arbeiten der Politikwissenschaft und der interdisziplinär geprägten Politischen Kultur-Forschung gefunden. Nicht zuletzt einige Studien über die so verstandene Institutionalisierung der Demokratie in Deutschland nach 1945 erlangten Referenzcharakter für das weitere Forschungsfeld (Lepsius 1990). Im Zuge der ausgreifend geführten Diskussion über die »innere Teilung« Deutschlands nach 1990 bilden Arbeiten dieser Richtung bis heute einen wichtigen Bestandteil der Literatur über die Demokratie der Bundesrepublik (etwa Gabriel/Falter/Rattinger 2005). Dabei wurde der »Wandel der demokratischen Institutionen« gelegentlich ausdrücklich mit der »Entwicklung der Demokratievorstellungen« gleichgesetzt (Fuchs 1997). In diesem Kontext entwickelte international vergleichende Perspektiven beziehen sich üblicherweise auf die jungen Demokratien Mittel- und Osteuropas unter Einschluss Ostdeutschlands (etwa Pollack u.a. 2004; Klingemann/Fuchs/Zielonka 2006). Diesen Beiträgen ist gemein, dass sie primär an der gesellschaftlichen Verinnerlichung von politischen Institutionen, an Prozessen des »institutional learning«, und nicht so sehr an den Institutionen selbst, interessiert sind. Einen frühen Meilenstein der genuin politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit Institutionalisierung stellt die große Studie Samuel Huntingtons aus den späten sechziger Jahren dar. Für Huntington (1968: 12) bezeichnet Institutionalisierung den Prozess, durch den Organisationen und Verfahren Wert und Stabilität erlangen. Als Kriterien, die über den jeweils erreichten Grad der Institutionalisierung entscheiden, werden genannt: »adaptability« (weiter spezifiziert anhand der Kriterien Existenzdauer, erfolgreicher Elitenaustausch und funktionale Anpassungsfähigkeit von bzw. innerhalb von Institutionen), »complexity«, »autonomy« und »coherence«. In einem etwa zeitgleich entstandenen grundlegenden Beitrag von Nelson Polsby (1968) über das speziellere Thema der »legislative institutionalization« wird der Schwerpunkt stärker als bei Huntington auf die interne Ausdifferenzierung von Institutionen als Kernaspekt von Institutionalisierung gelegt. EINLEITUNG 13 Das von Huntington und Polsby entwickelte Verständnis von Institutionalisierung hat in der jüngeren, zumal in der deutschen Politikwissenschaft eine erstaunlich geringe Resonanz gefunden. Selbst der Begriff begegnet einem beinahe ausschließlich im Umfeld der Systemwechselforschung. Dort erscheint Institutionalisierung zumeist streng auf den Akt der Verfassungsgebung bezogen (Merkel/Sandschneider/Segert 1996a). Diesem Verständnis nach markiert Institutionalisierung das zweite von drei Stadien des Systemwechsels – angesiedelt zwischen der Phase des Zusammenbruchs der alten Ordnung und jener der Konsolidierung (Merkel/ Sandschneider/Segert 1996b: 13).5 Die konkrete Ausgestaltung unterschiedlicher Profile politischer Institutionen – im Sinne des »constitutional engineering« (Sartori 1994) – wird dabei als zentrale Komponente der Institutionalisierung gleichsam mitgedacht, wenn auch nur selten ausdrücklich als solche bezeichnet. Auf ein nicht vollständig anderes, aber »machtsensibleres« und zugleich dynamischeres Verständnis von Institutionalisierung stößt man in Teilen der politik- bzw. verwaltungswissenschaftlichen Literatur über Institutionenwandel im konsolidierten Wohlfahrtsstaat. So bezeichnet »Institutionalisierung« bei Hesse und Benz (1990) eine von mehreren Phasen eines Modells institutionellen Wandels. Ihr gehen voraus die »Auslösung« (institutioneller Veränderungen) und die »Verstärkung« (von Reformenergien), während ihr üblicherweise eine Phase der »reaktiven Anpassung« (innerhalb der neu geschaffenen Strukturen) nachfolgt. »Bei der Institutionalisierung geht es«, so die Autoren, »um die Neuverteilung von Kompetenzen, Einflußchancen, Machtpositionen und Ressourcen. Damit wird der Prozeß zu einer politischen und nur begrenzt steuerbaren Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Interessen« (ebd.: 66). Das dieser Studie zugrunde liegende Verständnis von Institutionalisierung greift die unterschiedlichen Aspekte der früheren politikwissenschaftlichen Forschung auf, modifiziert und erweitert den Fokus der Betrachtung jedoch. Berücksichtigung finden die historische Entstehung politischer Institutionen der liberalen Demokratie (dabei nicht nur der Verfassungsor- —————— 5 Zum Teil wird auch in der Demokratisierungsforschung mit einem weiteren Institutionalisierungsbegriff gearbeitet, in den Aspekte der Verinnerlichung institutioneller Regeln einfließen. Dies geht jedoch gelegentlich zu Lasten terminologischer und analytischer Klarheit, wenn etwa, wie bei Ellen Bos, in definitorischer Absicht festgestellt wird: »In einem institutionalisierten oder konsolidierten System akzeptieren die Entscheidungsträger die Gültigkeit der Regeln« (Bos 2004: 14). 14 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE gane, sondern auch der maßgeblichen politischen Organisationen wie Parteien, Interessengruppen und Massenmedien6), deren Struktur- und Funktionsprofile sowie deren Wandel (unter Einbeziehung von Formen »reformgetriebenen« wie »schleichenden« Wandels). Institutionalisierung meint in diesem Kontext die institutionelle Manifestation und Konkretisierung kontingenter politischer Lösungen von grundlegenden Ordnungs- und Funktionsproblemen der liberalen Demokratie. Institutionentheoretisch gesprochen geht es dabei um den Prozess der sozialen Objektivierung spezieller normativer Verhaltensstrukturen in Form organisierter Vereinigungen (Acham 1992: 26). Politisch gesprochen geht es hingegen darum, unbeschränkte bzw. unkontrollierte Macht einer Person oder sozialen Gruppe auf Institutionen zu übertragen, die nicht nur ein hinreichendes Maß an personenunabhängiger Kontinuität gewährleisten, sondern zugleich den grundlegenden normativen Anforderungen der liberalen Demokratie als staatlicher Herrschaftsform (wie Machtbegrenzung und demokratische Verantwortlichkeit der Regierenden) gerecht werden (Przeworski 1991: 14). Daraus ergibt sich eine doppelte Vergleichsdimension, die sich zum einen auf den Vergleich der historischen Wege, den die Institutionalisierung politischer Institutionen in unterschiedlichen Ländern genommen hat, zum anderen auf den Vergleich der aus diesem Prozess hervorgegangenen demokratischen Institutionen selbst bezieht. Der eigentliche Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Vergleich der als dynamisch und veränderbar begriffenen Struktur- und Funktionsprofile demokratischer Institutionen. Obwohl die Studie viele Impulse der angelsächsischen Demokratieforschung verdankt, wird hier kein deutschsprachiges Pendant der großen englischsprachigen Arbeiten der politikwissenschaftlichen Komparatistik, im Stile etwa der Studien Lijpharts (1984, 1999) oder Almonds und anderer (2004) angestrebt, in denen Deutschland lediglich die Rolle eines gleichberechtigten »Falls« neben zahlreichen anderen zukommt. Stattdessen wird ein Zugang entwickelt, der sich am treffendsten mit dem Begriff des »asymmetrischen Vergleichs« (Kocka 1999) bezeichnen lässt. Er zielt darauf, das, gemessen an einer bestimmten Referenzgruppe, »Normale« und das »Besondere« eines Gegenstandes näher zu bestimmen als dies ohne Vergleich – oder gegebenenfalls selbst im Rahmen eines vollständig sym- —————— 6 Dem entspricht bei Göhler (1987: 18) die Unterscheidung zwischen politischen Institutionen im »engeren Sinne« und solchen im »weiteren Sinne«. EINLEITUNG 15 metrischen Vergleichs7 – möglich wäre. Als Referenzgruppe des internationalen Vergleichs dienen in dieser Studie im Wesentlichen die »trilateralen Länder« (Pharr/Putnam 2000), die konsolidierten Demokratien Westeuropas, Nordamerikas und Japans. Gelegentlich werden, soweit das speziellere Erkenntnisinteresse dies gebietet, weitere Länder wie Kanada, Neuseeland und Australien in die Betrachtung einbezogen. Dieses Ländersample scheint geeignet, um den spezifischen Operationalisierungsproblemen in Studien über das Allgemeine und das Besondere eines Untersuchungsgegenstandes zu begegnen.8 Dafür ist es erforderlich, den Vergleich so zu fokussieren, dass ein hinreichend großes Maß an Unterschiedlichkeit zwischen den verglichenen Gegenständen gegeben ist, deren prinzipielle Vergleichbarkeit aber nicht durch extrem unterschiedliche Grundlagen in Frage gestellt wird. Als wichtige Gemeinsamkeit außerhalb institutioneller Arrangements und der Erfahrung politischer Konsolidierung teilen sämtliche der hier berücksichtigten Länder längere Phasen ökonomischen Wohlstands, der sich unter anderem in deren Mitgliedschaft zur OECD manifestiert. In welchem Verhältnis steht diese Studie zu den Fragestellungen und Perspektiven des weiteren Forschungsbereichs? Auseinandersetzungen über den Exzeptionalismus des eigenen Systems spielten in der deutschen Nachkriegspolitikwissenschaft keine vergleichbare Rolle wie in den USA (Shafer 1991; Lipset 1996) oder Japan (Matsuda 2003). Die ausgreifende Diskussion über einen »Sonderweg« Deutschlands innerhalb der Geschichtswissenschaft9 hat kein politikwissenschaftliches Äquivalent im —————— 7 8 9 Der Preis eines vollständig symmetrischen Vergleichs bestände im Rahmen einer monographischen Studie darin, nur eine sehr kleine Anzahl von Ländern berücksichtigen zu können, oder aber den Vergleich auf einen kleinen Ausschnitt der komparativ studierten Systeme zu beschränken. Daraus folgt, dass der asymmetrische Vergleich kein »zweitklassiger« Vergleich ist, sondern – wie andere Vergleichsformate auch – ein Zugang mit spezifischen Stärken und Schwächen. Sie wurden von Byron Shafer (1999: 449) prägnant resümiert: »The number of individual items upon which nations might differ is effectively indefinite. Worse yet, the differences on any one item, observed closely enough, are as extensive as the number of nations considered. If exceptionalism is not thereby crushed out of existence (or defined into existence everywhere), some way to group major realms of analysis is the only way around this dilemma.« Hervorgehoben sei die in dieser Tradition stehende große Studie Heinrich August Winklers (2000), an deren Ende die These steht, dass es bis 1945 einen »deutschen Sonderweg« gab – der Weg eines tief vom Mittelalter geprägten Landes in die Mo- 16 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Rahmen der Beschäftigung mit dem Regierungssystem der Bundesrepublik gefunden. Am stärksten in diese Richtung schlug die international geführte Auseinandersetzung über die Eigenarten des »German Model« (Dyson 2001; Jochem/Siegel 2002; Kwon 2002; Hassel/Williamson 2004), womit jedoch nie das politische System in seiner Gesamtheit gemeint war, sondern stets nur spezifische Merkmale des politisch-ökonomischen Teilsystems. Auf weiter dimensionierte (wenn auch schwerlich systematisch vergleichend ausgerichtete) Reflexionen über das »Modell Deutschland« – im Sinne eines spezifischen Leistungsprofils der deutschen Nachkriegsordnung auf der Ebene politischer Stabilität und gesellschaftlicher Liberalisierung – stößt man am ehesten im Umfeld der zeitgeschichtlichen Forschung, obwohl auch dieser eine auffallende Zurückhaltung bei der Behandlung des Themas attestiert wurde (Rödder 2006: 346–347). Daran gemessen erscheint die Titelfrage einer jüngeren politikwissenschaftlichen Studie, ob die Bundesrepublik sich endlich »auf dem Weg zur Normalität« befinde (Reutter 2004), mehr als ein rhetorischer Kunstgriff des Herausgebers denn als Programm und Leitmotiv der darin versammelten Beiträge über die Politik der rot-grünen Bundesregierung. Das übergeordnete Ziel der Studie besteht darin, ein tieferes Verständnis der historischen Grundlagen und internationalen Besonderheiten der deutschen Nachkriegsdemokratie zu befördern, als dies die »klassischen« Arbeiten zum Regierungssystem der Bundesrepublik (von Beyme 200410; Ellwein/Hesse 20049; Rudzio 20067; Sontheimer/Bleek 2005; Jesse 19978) eröffnen.10 Damit soll nicht zuletzt der heute kaum mehr bestrittenen Einsicht Rechnung getragen werden, dass einem Verständnis eines Systems —————— derne, in dem vor allem Menschen- und Bürgerrechte nie eine vergleichbar starke Verwurzelung erfuhren wie in den anderen großen Ländern des Westens. 10 Dies ist freilich nicht der erste Versuch in dieser Richtung. Erwähnenswert ist insbesondere der ehrgeizige Band von Eckhard Jesse und Roland Sturm (2003). Dieser ist einerseits sogar weiter dimensioniert als diese Studie, da er zusätzlich zu den politischen Institutionen eine Reihe von Politikfeldern berücksichtigt. Andererseits werden darin gerade einige der wichtigsten politischen Institutionen in einen einzigen Beitrag mit dem Titel »Regierungssystem« gezwängt. Auf die Entwicklung einer spezielleren theoretischen Perspektive wird ebenso verzichtet wie auf einen einheitlichen historisch-internationalen Vergleichsmaßstab. Beides hätte sich im Rahmen eines Gemeinschaftswerkes von annähernd 20 Autoren freilich kaum hätte realisieren lassen. Für eine andere, weniger fachwissenschaftlich interessierte Leserschaft konzipiert ist die vergleichend gehaltene Einführung in das Regierungssystem der Bundesrepublik von Hartmann (2004). EINLEITUNG 17 oder Landes »aus sich selbst heraus« enge Grenzen gesetzt sind.11 Gleichsam nebenbei wird ein spezifischer Mehrwert erzielt, insofern der Vergleich letztlich die Grundlage jeder rational betriebenen Institutionenreform bildet. Aus der historischen Analyse gewonnenen Einsichten kommt dabei – so die zentrale These der Vertreter des »path dependence«-Paradigmas12 – eine zentrale Funktion vor allem mit Blick auf die Beurteilung der real bestehenden Spielräume institutioneller Reformen innerhalb eines Systems zu (vgl. exemplarisch Lehmbruch 2000a). Die aus dem international-vergleichenden Studium der Demokratie gewonnene Kenntnis alternativer institutioneller Lösungen und deren gesellschaftlichen und politischkulturellen Voraussetzungen hingegen bildet die eigentliche Essenz eines transnationalen »policy learning« und jedweder erfahrungsbasierten Strategie des »institutional engineering« (Rose 1993; von Beyme 2001a, 2003a). An dieser Stelle erscheint eine kurze Vergewisserung über den Bedeutungsgehalt des zweiten zentralen Begriffs aus dem Titel dieser Studie angezeigt: die liberale Demokratie. Wie alle genuin politischen Begriffe ist auch derjenige der liberalen Demokratie ein umstrittener, ja nicht selten geradezu umkämpfter Begriff (Göhler/Iser/Kerner 2004). Das gilt in nicht geringem Maße selbst für den akademischen Sprachgebrauch. Eine erste Möglichkeit zur inhaltlichen Bestimmung des Konzepts der liberalen Demokratie ergibt sich aus einer Abgrenzung gegenüber dem, was nicht als liberale Demokratie gelten soll. Den fundamentalen Gegensatz zur liberalen Demokratie, zur Demokratie überhaupt, verkörpert die Autokratie (als Oberbegriff für totalitäre und autoritäre Systeme). Jenseits dieser grundlegenden Unterscheidung zwischen demokratischen und nichtdemokratischen Systemen gibt es unterschiedliche Differenzierungen innerhalb des Konzepts der Demokratie. In der jüngeren Literatur erscheint die »liberale Demokratie« einerseits als normatives Gegenmodell zur »republikanischen Demokratie« und zur »deliberativen Demokratie« (Schultze 2004: 125). Dem kommunitären bzw. —————— 11 Ganz im Sinne des viel zitierten Ausspruchs des »Kronzeugen« der angelsächsischen Komparatistik, Rudyard Kipling, »and what should they know of England who only England know?« (zit. bei King 1993: 415). Theoretisch beleuchtet wird dieses Problem aus politikwissenschaftlicher Perspektive unter anderem bei Rose (1991). 12 Eine der jüngeren »landmark publications« auf diesem Gebiet stammt von Pierson (2004). Eine Differenzierung und problemorientierte Kritik unterschiedlicher Ansätze unter dem Dach des »path dependence«-Paradigmas leisten unter anderem Beyer (2005) und Greener (2005). 18 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE basisdemokratischen Charakter von letzteren entspricht der realistische und elitäre Charakter der liberalen Demokratie, welche auf eine Beschränkung der Beteiligung auf die Sphäre des Politischen, die Regulierung der gesellschaftlichen Konflikte durch Repräsentation und ein Verständnis von Demokratie als Methode zur Herstellung gesamtgesellschaftlich verbindlicher Entscheidungen setzt (ebd.). Ein ganz anderes Verständnis von liberaler Demokratie ergibt sich, wenn diese – auf der Grundlage einer vergleichenden Bewertung der Staatstätigkeit – als Gegenmodell zu einer sozialen Demokratie begriffen wird. Liberale Demokratie erscheint dann als lediglich formale Demokratie, die ihrer möglichen substantiellen und sozialen Komponenten entkleidet ist (Streeck 1998: 13, 18). Aus der Perspektive des frühen 21. Jahrhunderts betrachtet, ginge es bei der »Institutionalisierung der liberalen Demokratie« dann gleichsam um den Aufbau und die Befestigung einer politischen Ordnung, welche wohlfahrtsstaatliche Politik hinter sich lässt und zurückstrebt zu einer Konzeption von Staatlichkeit, die sich in politisch-materieller Hinsicht mehr oder minder auf die institutionelle Gewährleistung des Schutzes der Bürger vor staatlichen Eingriffen beschränkt. Dies ist im Kontext dieser Studie freilich nicht gemeint, wenn von liberaler Demokratie die Rede ist. Bestimmend für diese Untersuchung ist vielmehr eine institutionenbezogene Konzeption von liberaler Demokratie, welche auf den beiden unterschiedlichen konstitutiven Elementen der liberalen Demokratie basiert und dabei prinzipiell offen ist für unterschiedliche Ausgestaltungen von Staatlichkeit auf der Ebene politisch-materieller Leistungen. Damit ein System als liberale Demokratie, oder schlicht als liberal-demokratisch, bezeichnet werden kann, müssen sowohl liberale als auch demokratische Elemente in hinreichendem Umfang verwirklicht sein (Shell 1981; Holden 1993). Im Zuge der Herausbildung des modernen demokratischen Verfassungsstaates wurden liberale Elemente früher und vollständiger verwirklicht als demokratische Elemente. Historisch ist deshalb der liberale Verfassungsstaat bedeutend älter als der demokratische Verfassungsstaat. Selbst in den Vereinigten Staaten oder Frankreich, wo liberale und demokratische Elemente der Herrschaftsorganisation bzw. -ausübung gegen Ende des 18. Jahrhunderts in einem Zuge geschaffen wurden13, blieb das —————— 13 Allerdings wurden die liberalen Komponenten der Verfassungsstaatlichkeit in Frankreich und den USA – im Gegensatz zu späteren Entwicklungen – zunächst EINLEITUNG 19 Recht auf demokratische Teilhabe vermittels Wahlen zunächst einem an heutigen Maßstäben gemessen winzigen Teil der Bevölkerung vorbehalten. Aus Sicht des frühen 21. Jahrhunderts würde man deshalb viele der bereits lange als konsolidiert geltenden alten Demokratien bis in deren jüngere Geschichte hinein nicht ohne Einschränkung als liberale Demokratien bezeichnen wollen. Nach dem in der Politikwissenschaft heute vorherrschenden Verständnis beziehen sich liberale Elemente indes keineswegs ausschließlich auf Aspekte der konstitutionellen Begrenzung einer vor-demokratischen staatlichen Macht, sondern sind gewissermaßen selbst demokratisch geprägt: »The term ›liberal‹ in ›liberal democracy‹ draws attention to two related features of these political systems. First, their claim to democracy rests on responsiveness to the wishes of the citizens, not to some vision of citizens’ best interests as defined by the rulers or by some ideological system. Second, the wishes of a majority are not to override all the political and civil rights of the minorities.« (Powell 2004: 205) Liberale Demokratie meint somit nicht nur »limited government«, sondern auch, und in nicht geringerem Maße, »limited democracy«. In Teilen der jüngeren Demokratisierungsforschung wurde eine speziellere theoretische Perspektive auf die liberale Demokratie entwickelt, die dem historischen Entstehungsverlauf demokratischer Verfassungsstaatlichkeit – mit dem spezifischen Vorsprung der Liberalisierung gegenüber der Demokratisierung – genau entgegengesetzt ist. Ihre besondere Aufmerksamkeit liegt nicht auf dem Kriterium der Gewährleistung eines vollständig demokratischen Wahlrechts (als dem historisch letzten Stadium der Entstehung der alten demokratischen Verfassungsstaaten), sondern auf der Einbettung desselben in ein rechtsstaatliches Institutionensystem. Die zentrale analytisch-theoretische Scheidelinie verläuft hier entlang des Gegensatzes zwischen »liberalen Demokratien« einerseits und (lediglich) »elektoralen Demokratien« andererseits. Regime, in denen die Demokratie abgekoppelt ist von den Prinzipien des liberalen Konstitutionalismus wurden explizit als eine Erscheinungsform von »illiberal democracy« klassifiziert (Zakaira 1997) – ein Typus, der im Hinblick auf die jüngere globale Entwicklungsgeschichte der Demokratie in der Tat als eine problematische —————— nicht primär als liberale Abwehrrechte gegenüber dem Staat begriffen; vielmehr galt der Staat als Garant des Schutzes natürlicher, vorstaatlicher Freiheits- und Eigentumsrechte des Menschen. 20 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE »growth industry« erscheint (ebd.: 23). Weiter gehende konzeptionelle Differenzierungen wurden von Vertretern der deutschen Demokratisierungsforschung vorgeschlagen. So unterscheiden Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Puhle, Aurel Croissant, Claudia Eicher und Peter Thiery verschiedene »Teilregime«, welche erst gemeinsam eine liberale Demokratie konstituieren. Für erforderlich gehalten werden neben dem »Wahlregime« insgesamt vier weitere »Teilregime«: über den Wahlakt hinausgehende politische Teilhaberechte, bürgerliche Freiheitsrechte, horizontale Gewaltenteilungskontrolle sowie das Prinzip effektiver Regierungsgewalt (Merkel u.a. 2003: 48– 56). Die in dieser Studie behandelten Regierungssysteme Westeuropas, Nordamerikas und Japans lassen sich – bei allen Unterschieden14 – eindeutig als liberale Demokratien bezeichnen. In ihnen besitzen Freiheit und Gleichheit, das Recht auf demokratische Beteiligung und zur Artikulation abweichender, oppositioneller Standpunkte sowie das Prinzip politischer Herrschaft auf Zeit einen unverkennbar hohen und nicht mehr prinzipiell in Frage gezogenen Status. Die weiteren Teile der Untersuchung umfassen insgesamt acht Kapitel über einzelne Institutionen sowie ein breiter dimensioniertes Schlusskapitel. Im Zentrum der nächsten vier Kapitel stehen das Wahlrecht und das Wahlsystem, auf deren Grundlage es zur Ermöglichung und Kanalisierung demokratischer Beteiligung der Bevölkerung kommt, die politischen Parteien, die Interessengruppen und die Massenmedien als zentrale politische Institutionen des gesellschaftlichen bzw. intermediären Bereichs. Die darauf folgenden vier Kapitel wenden sich den politischen Institutionen und zentralen Akteuren auf der Ebene des staatlichen Entscheidungssystems zu: dem Parlament, der Regierung und dem Staatsoberhaupt, der territorialen Staatsorganisation und der Verfassungsgerichtsbarkeit. —————— 14 Die deutlichsten Abweichungen vom üblichen Kanon institutioneller Merkmale der liberalen Demokratie finden sich traditionell im britischen Westminster-System. Dieses kennt weder ein kodifiziertes System bürgerlicher Grundrechte noch eine vollständig institutionalisierte Gewaltenteilung. Selbst das Prinzip der Volksherrschaft ist zugunsten der Doktrin der Parlamentssouveränität eigentümlich modifiziert. Vgl. grundlegend Brazier (1999). Stärker als in den anderen Demokratien Westeuropas kam es in Großbritannien im Zuge der europäischen Integration jedoch zu nachhaltigen Veränderungen der zentralen Systemparameter, denen im Ergebnis eine Annäherung an die auf dem Kontinent verbreiteten Ausprägungen der liberalen Demokratie entspricht. Vgl. hierzu Bache/Jordan (2006). EINLEITUNG 21 Zum Teil in bewusster Abkehr von der in der Literatur vorherrschenden Blickrichtung wird die jeweils im Zentrum eines Kapitels stehende Institution konsequent als abhängige Variable behandelt. Die ausgeprägte Interdependenz zwischen unterschiedlichen Institutionen wird damit nicht geleugnet. Im Gegenteil; die systematische Differenzierung zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen schafft erst die Voraussetzung für einen hinreichend präzisen analytischen Zugriff. Die jeweils nicht im Zentrum eines Kapitels stehenden Institutionen werden – im Wechselspiel der Perspektiven – als potentiell bedeutende unabhängige Variablen betrachtet15 und dabei ergänzt um weitere, historische, soziopolitische und kulturelle Determinanten. Wie andere Studien, muss sich auch diese in Selbstbeschränkung üben. Das betrifft zunächst den thematischen Fokus. Zugunsten anderer Aspekte wird auf eine eigenständige Behandlung der Grundrechte und Grundrechtsentwicklung verzichtet.16 Diese Entscheidung gründet freilich nicht in der Einschätzung, dass es sich bei den Grundrechten um ein potentiell entbehrliches Element der liberalen Demokratie handele, obwohl es eine ganze Reihe von Beispielen für eine »verschleppte« oder unvollständige Institutionalisierung bzw. Konstitutionalisierung von Grundrechten auch aus der Familie der konsolidierten Demokratien gibt (Helms 2003a: 45– 46). Gerade mit Blick auf die deutsche Entwicklung müsste eine solche Position als fragwürdig erscheinen. Nach einer historischen Periode, während derer die Grundrechte faktisch außer Kraft gesetzt waren, wurde Deutschland zum Musterfall eines demokratischen Regimes, in dem die Grundrechte einen herausragenden Status, im Falle der Menschenrechte —————— 15 Zum Teil im Sinne einzelner Komponenten der institutionellen Umwelt einer Institution (so im Falle etwa des Wahlrechts und Wahlsystems in Bezug auf die Parteien), üblicherweise aber im Sinne handlungsmächtiger Akteure, die Einfluss auf die Kreation, Stabilisierung und/oder Veränderung einer Institution nehmen (so etwa im Falle der Parteien mit Blick auf das Wahlrecht und das Wahlsystem). In theoretischer Hinsicht wird dabei auf die Annahmen des »akteurzentrierten Institutionalismus« (Mayntz/Scharpf 1995; Scharpf 2000) rekurriert. Nach ihm werden die Handlungsressourcen von Akteuren selbst in hohem Maße von institutionellen Regeln (wie Partizipationsrechten, Vetorechten usw.) bestimmt, entfalten ihre konkrete Wirkung jedoch erst im Zusammenspiel mit den spezifischen Wahrnehmungen und Präferenzen von Akteuren (Scharpf 2000: 86). 16 Verwiesen sei auf die historisch und international ausgreifenden Arbeiten unter besonderer Berücksichtung der deutschen Entwicklung von Kleinheyer (1975) und Grimm (1991) sowie speziell zur Bundesrepublik Pieroth/Schlink (2004). 22 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sogar eine einzigartige Position mit »Ewigkeitsgarantie« und »wehrhafter» Flankierung genießen. Insbesondere die Frage nach den institutionellen Grundlagen und Mechanismen des Demokratieschutzes hätte ohne Zweifel ein würdiges Schlusskapitel dieser Studie abgegeben. Nicht zuletzt mit Rücksicht auf den beträchtlichen Umfang der zu diesem Gegenstand bereits vorliegenden Literatur17 wurde am Ende einem anderen Themenkomplex der Vorzug gegeben. So wendet sich das Schlusskapitel der Studie dem Problem einer möglichen De-Institutionalisierung der liberalen Demokratie und den Wirkungen der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Internationalisierung auf diese zu. Eine zweite Begrenzung betrifft die konkrete Ausgestaltung der internationalen Vergleichsdimension: Nur in einem Teil der Kapitel werden sämtliche der in dieser Studie berücksichtigten Länder in die vergleichende Betrachtung einbezogen. Das gilt ohne größere Einschränkungen für die Kapitel über Wahlrecht und Wahlsysteme, Parteien, Interessengruppen und die Medien. In den übrigen vier Kapiteln – über Parlamente, Regierungen und Staatsoberhäupter, Föderalismus und Verfassungsgerichtsbarkeit – kommen jeweils nur solche Länder ausführlicher zur Sprache, in denen es »vergleichbare« (im Sinne von ähnliche) Strukturen wie in der Bundesrepublik gibt.18 Obgleich weniger unmittelbar einsichtig als im Falle der föderativen Institutionen und der Verfassungsgerichtsbarkeit (die es in einigen Ländern aus der Familie der konsolidierten liberalen Demokratien schlicht nicht gibt), gelten spezifische Vorbehalte auch für die Behandlung der Gegenstände Parlament, Regierung und Staatsoberhaupt. Ein auf diese bezogener Vergleich der Bundesrepublik mit anderen konsolidierten liberalen Demokratien ist sinnvoller Weise auf die Gruppe der parlamentarischen Systeme zu konzentrieren. Andernfalls bestände die Gefahr, den vergleichenden Betrachtungen allzu sehr den Charakter einer exemplari- —————— 17 Vgl. zur historischen Herausbildung der »wehrhaften Demokratie« in Deutschland nach 1945 vor allem Fromme (1960: 164–223) und Scherb (1987); für unterschiedliche politikwissenschaftliche Perspektiven zum Thema Demokratieschutz, zum Teil mit international vergleichendem Fokus, insbesondere Jesse (1980), Boventer (1985), Jaschke (1992), Leggewie/Meier (1995), Backes (1998) und Glaeßner (2003); für eine rechtswissenschaftliche Analyse mit zahlreichen weiteren Nachweisen Thiel (2003). 18 Nicht vollständig unberücksichtigt bleiben jedoch die ungeachtet bestehender Strukturdifferenzen zum Teil existierenden Funktionsäquivalente wie beispielsweise im Falle der Verfassungsgerichtsbarkeit und der Doktrin der Parlamentssourveränität. Vgl. Abromeit (1995). EINLEITUNG 23 schen Auseinandersetzung mit den Merkmalen und Wirkungen der parlamentarischen und präsidentiellen Regierungsform zu geben.19 Einem strengen Begriffsverständnis nach gibt es im präsidentiellen Regierungssystem weder ein Kabinett noch ein Parlament, stattdessen lediglich eine exklusiv auf den Präsidenten zugeschnittene »executive branch« und eine Legislatur (Lösche 1989: 119; von Beyme 1997: 53–56). So instruktiv ein deutschamerikanischer Vergleich zum Verständnis der Systemunterschiede zwischen Parlamentarismus und Präsidentialismus ist (vgl. Thaysen/ Davidson/Livingston 1988; Dittgen 1999; Helms 2003b; Dann 2006), so liegt er doch quer zu dem spezielleren Vergleichsanspruch dieser Studie, welche in ihren Einzelteilen auf die Prämissen des »single-most-cases designs« gebaut ist. Dies ist auch der Grund, warum auf eine vergleichende Einbeziehung der jungen Demokratien, vor allem Mittel- und Osteuropas, verzichtet wurde. Hinzugekommen wären spezifische »analytische Schieflagen«: Synchrone Vergleiche könnten sich nur auf Ostdeutschland, nicht auf Deutschland als Ganzes, beziehen. Die besonderen Bedingungen der Institutionalisierung der Demokratie in Ostdeutschland – der eigentümliche West-Ost-Transfer der staatlichen Institutionenordnung und von Teilen des stärker gesellschaftlich bestimmten Institutionensystems wie des Parteiensystems – sind im Übrigen selbst mit den Konstitutionalisierungs- und Institutionalisierungsprozessen in Osteuropa nicht wirklich sinnvoll vergleichbar.20 Der denkbare diachrone Vergleich der frühen Bundesrepublik mit den jungen Demokratien der Gegenwart hingegen läge quer zum grundlegenden Analysekonzept der Studie, welches darauf ausgerichtet ist, internationale »Wegbereiter« und »Spätentwickler«, Diffusions- und Adaptionsprozesse der Demokratieentwicklung aus einer synchron gestimmten Vergleichsperspektive zu identifizieren und zu analysieren. Das Pendant zu dieser Untersuchung wäre eine breit angelegte Studie, in der Ostdeutschland nicht lediglich mit den osteuropäischen, sondern auch mit außereuro- —————— 19 An einschlägigen Arbeiten herrscht wahrlich kein Mangel. Vgl. etwa Steffani (1983), Lijphart (1992), Stepan/Skach (1993), Linz/Valenzuela (1994), Riggs (1997), Dahl (1997), Siaroff (2003) und Esterbauer (2004). 20 Etwas anderes gilt für die Entwicklung der »politisch-kulturellen Institutionalisierung« der Demokratie in Ostdeutschland und den Ländern Osteuropas, deren vergleichender Analyse sich vor allem die Kultursoziologie angenommen hat. Vgl. statt vieler Pickel u.a. (2006). 24 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE päischen »Transitionsstaaten« und »Transitionsgesellschaften« verglichen würde. Sie ist noch zu schreiben. 2 Wahlrecht und Wahlsystem: Die institutionellen Filter politischer Repräsentation Keine Konzeption von repräsentativer Demokratie ist denkbar ohne die Möglichkeit politischer Beteiligung des Volkes in Form von Wahlen. Entsprechend zentral für die institutionelle Dimension liberaler Demokratie sind das Wahlrecht und das Wahlsystem. Beide Begriffe sind miteinander verwandt, aber nicht deckungsgleich. Nach heute vorherrschendem Verständnis ist der Begriff des Wahlrechts bedeutend weiter dimensioniert als der des Wahlsystems. Er umfasst alle rechtlich in der Verfassung, in Wahlgesetzen und Wahlordnungen fixierten Normen, die die Wahlen von Körperschaften oder Amtsträgern regeln. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wem das aktive oder passive Wahlrecht unter welchen Bedingungen zugestanden wird. Demgegenüber bilden Wahlsysteme nur einen Ausschnitt des umfassenderen Wahlrechts. Technisch gesprochen beinhalten sie den Modus, nach dem die Wähler ihre Partei- bzw. Kandidatenpräferenz in Stimmen ausdrücken und diese in Mandate übertragen werden. Aber dies hat weitreichende politische Implikationen: »Electoral systems are the practical instruments through which notions such as consent and representation are translated into reality« (Bogdanor 1983: 1). Da die Existenz eines allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts weithin zu den institutionellen Grundvoraussetzungen der liberalen Demokratie gezählt und in den konsolidierten liberal-demokratischen Systemen folglich als gleichsam selbstverständlich vorausgesetzt wird, interessiert sich die Politikwissenschaft im Rahmen ihrer Beschäftigung mit den heute konsolidierten Demokratien (im Gegensatz zur Demokratisierungsforschung) kaum mehr für Fragen des Wahlrechts im engeren Sinne. Ausnahmen betreffen am ehesten speziellere Aspekte wahlrechtlicher Reformoptionen wie beispielsweise die Absenkung des Wahlalters oder die Einführung eines »Elternwahlrechts«21 oder Studien mit —————— 21 Vgl. hierzu mit zahlreichen weiteren Hinweisen Westle (2006). 26 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE breitem historischem Fokus.22 Unvergleichlich größer war und ist das Interesse der internationalen Politikwissenschaft an Wahlsystemen. Dabei galt die Wahlsystemforschung lange Zeit als ein auffallend unterentwickelter Forschungsbereich (Lijphart 1985: 3). Heute zählt die Beschäftigung mit Wahlsystemfragen hingegen nach einhelligem Urteil zu den vollständig etablierten Bereichen der Demokratieforschung (Lijphart 2005: xii; Shugart 2005: 50–51), deren Befunden sogar eine weit überdurchschnittliche Aufmerksamkeit auf Seiten politischer Entscheidungsträger zuteil wird. Wie andere politische Institutionen können Wahlsysteme entweder als abhängige oder als unabhängige Variable studiert werden. Die vergangenen Jahrzehnte der internationalen Forschung wurden von Arbeiten dominiert, die dem Wahlsystemen den Status einer unabhängigen Variable zuwiesen und dabei insbesondere nach den Auswirkungen von Wahlsystemen auf das Parteiensystem fragten. Einen Meilenstein dieser Forschungsrichtung bildet die rasch zum internationalen Referenzwerk aufgestiegene Studie Maurice Duvergers (1959), in der sogar gesetzmäßige Beziehungsmuster zwischen bestimmten Wahlsystemen und Parteiensystemen identifiziert wurden (ebd.: 219). Die vor dem Hintergrund einer mächtigen Demokratisierungswelle ausgreifend geführte »constitutional engineering«-Debatte der neunziger Jahre bekräftigte die »eindimensionale Fragerichtung« (Nohlen 2000: 416) nochmals (vgl. insbesondere Sartori 1994: 27–79). In jüngeren Beiträgen dieser Richtung bildet indes keineswegs immer das Parteiensystem die zentrale zu erklärende Variable; alternativ wurden etwa die möglichen Wirkungen unterschiedlicher Wahlsysteme auf die Wahlbeteiligung, »gender«-bezogene Aspekte der Elitenrekrutierung oder den Zusammenhalt politischer Parteien im Parlament untersucht (Franklin 2004; Norris 2004; Gallagher 2005). Seit kürzerem zeichnet sich eine internationale Trendwende hin zu ausgeglicheneren Perspektiven ab. Sofern nicht gar explizit nach der Prägewirkung des Parteiensystems auf das Wahlsystem (Colomer 2005) oder den Determinanten des historischen Wandels von Wahlsystemen bzw. den Tendenzen der Wahlsystement- —————— 22 Erwähnt sei die große Studie Buchsteins (2000), in der dieser den aufwendigen Nachweis führt, dass die Annahme eines gleichsam »natürlichen« Zusammenhangs zwischen Demokratie und geheimer Wahl sowohl in historischer als auch ideengeschichtlicher Hinsicht weitgehend der Grundlage entbehrt und lediglich Ausdruck einer modernen liberalen Perspektive ist. Vor allem in den USA wurde die öffentliche Abstimmung historisch von jenen politischen Kräften, die auf Demokratisierung drängten, nicht nur nicht bekämpft, sondern sogar forciert. WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 27 wicklung (Boix 1999; Benoit 2004; Lundell 2005; Nohlen 2005) gefragt wird, werden Einflüsse auf das Wahlsystem und Wirkungen des Wahlsystems zumindest in etwa gleichberechtigt behandelt (Gallagher/Mitchell 2005).23 Die weiteren Ausführungen knüpfen an diesem zweiten, jüngeren Entwicklungsstrang der internationalen Wahlsystemliteratur an, indem sie sich dem vergleichenden Studium der zentralen Charakteristika und Determinanten von Wahlsystemen zuwenden.24 Diese Analyse ist eingebettet in einen Abriss der historischen Evolution von Wahlsystemen und der Ausbreitung des demokratischen Wahlrechts. 2.1 Die Ausbreitung des demokratischen Wahlrechts und die Frühgeschichte der Wahlsystementwicklung 2.1.1 Die historische Ausbreitung des Wahlrechts Die Evolutionsgeschichte des demokratischen Wahlrechts in den heute konsolidierten Demokratien folgte keinem einheitlichen Muster. Unterschiedlich war nicht nur der Zeitpunkt, zu dem das allgemeine und gleiche Wahlrecht schließlich eingeführt wurde, sondern auch die historische Entwicklungsdynamik, die zu diesem Ziel führte. Jene Länder, in denen es zuerst zu einer – freilich zunächst begrenzten – Ausweitung demokratischer Partizipationsrechte kam, waren keineswegs jene, in denen das allgemeine Wahlrecht schließlich ohne Einschränkungen25 als erstes verwirklicht wurde. Das gilt schon für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer, während die vollständige Einbeziehung der weiblichen Bevölkerung in den Kreis der Wahlberechtigten durch noch bemerkenswertere —————— 23 Freilich bauen auch diese Arbeiten auf wichtigen älteren Studien dieser Richtung (etwa Rokkan 1970; Bogdanor/Butler 1983), die jedoch weitgehend im Schatten des Duverger’schen Paradigmas verblieben. 24 Die Wirkungen von Wahlsystemen werden im Rahmen dieser Untersuchung zum Teil in Kapitel 3 über Parteien und Parteiensysteme behandelt. Vgl. für eine detailliertere Analyse der spezifischen Wirkungen des Wahlsystems auf das Parteiensystem der Bundesrepublik statt vieler Cappoccia (2002). 25 Unberücksichtigt in dieser Aussage bleibt eine Reihe speziellerer Beschränkungen, von denen einige weiter unten anzusprechen sind (vgl. Abschnitt 2.3 und 8.2.3). 28 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE landesspezifische Entwicklungen und historische Diskrepanzen gekennzeichnet war. Trotz aller regionalen Unterschiede der internationalen Wahlrechtsentwicklung, von denen einige sogleich zu beleuchten sind, gab es grundlegende länderübergreifende Gemeinsamkeiten. Dazu gehörten nicht zuletzt die mit unterschiedlicher Akzentuierung vorgetragenen Begründungen für die Vorenthaltung bzw. Beschränkung der allgemeinen und gleichen Wahl sowie die konkreten Mechanismen zu deren Verhinderung. Während es bei der Nichtgewährung eines unbeschränkten Wahlrechts darum ging, den Wohlstand und die Macht der herrschenden Klasse zu sichern, konzentrierten sich die öffentlich formulierten Begründungen hierfür auf unterschiedliche Aspekte materiellen Eigentums. Zum einen wurde der Besitz von Eigentum bzw. die Fähigkeit zu dessen Erwerb als Nachweis allgemeiner intellektueller Befähigung hingestellt; zum anderen wurde argumentiert, dass nur die ökonomisch unabhängige Klasse über hinreichend Zeit verfüge, um die Entwicklungen des Gemeinwesens in einem Maße zu verfolgen, welches eine rationale Wahlentscheidung erst ermögliche. Einem weiteren Argument zufolge war mit materiellem Wohlstand, der potentiell dem Gemeinwesen zugute komme, zugleich aber durch dieses gefährdet werden könne, geradezu ein Recht auf überproportionale politische Mitentscheidung verbunden. Noch zweifelhafter war eine vierte Begründung: Nur der Wohlhabende sei so frei von Eigeninteresse, dass er verantwortliche Entscheidungen für das Gemeinwesen als Ganzes treffen könne (Goldstein 1983: 6–7). Die wichtigsten Mechanismen zur institutionellen Verhinderung einer unbeschränkt allgemeinen und gleichen Wahl bestanden neben der Knüpfung des Wahlrechts an beträchtliches Vermögen oder einen Mindestbildungsstandard in der Gewährung zusätzlicher Stimmen für Besitz und Bildung, der Nicht-Gewährleistung der geheimen Wahl sowie der Festsetzung eines bestimmten Mindestwahlalters. Letzteres war insoweit klassenspezifisch diskriminierend, als die durchschnittliche Lebenserwartung von Arbeitern eine deutlich geringere war als jene von Mitgliedern der besitzenden Schicht. Die unterschiedlichen Mechanismen konnten im Einzelfall auf delikate Weise miteinander verknüpft sein. So wurde in Italien zwischen 1860 und 1912 von potentiell wahlberechtigten Männern ein Nachweis der Lesefähigkeit und über die Entrichtung eines Minimums an direkten Steuern gefordert. In Schweden wurde 1909 zwar das vermögensbezogene Kriterium der Wahlberechtigung gelockert, aber zur Kompensa- WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 29 tion des damit verbundenen Effekts zugleich das Mindestwahlalter von 21 auf 25 Jahre hoch gesetzt (ebd.: 8, 17). Die historischen Wege der heutigen konsolidierten liberalen Demokratien in das Reich eines vollständig demokratisierten Wahlrechts verliefen im Einzelnen sehr unterschiedlich. Die Vereinigten Staaten waren das erste Land, in dem es – abgesehen von den spezifischen Diskriminierungen der schwarzen Bevölkerung – bereits vor der Mitte des 19. Jahrhunderts, um 1830, zur flächendeckenden Verbreitung des demokratischen Wahlrechts für die männliche Bevölkerung kam.26 Wie später in Europa ging es dabei auch in den USA zunächst um die Wahl der ersten Kammer der Legislative. Allerdings wurde das Recht zu demokratischer Beteiligung schon bald auf die Wahl weiterer staatlicher Organe und Amtsträger ausgedehnt. Wie Samuel Huntington (1968: 93–129) in seiner großen Studie über die Institutionalisierung politischer Institutionen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten gezeigt hat, kann aus der frühen Demokratisierung des Wahlrechts keineswegs geschlossen werden, dass es in den USA bedeutend früher als in Europa zu einer grundlegenden politischen Modernisierung kam. In der Tat ist eher das Gegenteil richtig. Entwicklungen in Richtung einer Rationalisierung bzw. Zentralisierung von Herrschaft und einer Ausdifferenzierung der dazugehörigen Strukturen gab es zuerst (und lange Zeit nur) in Europa. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die außerordentlich verbreitete Erfahrung des Krieges und das von ihr genährte Bedürfnis nach einer starken, zentralisierten Herrschaftsorganisation mit einem hinreichenden Potential zur Führung und Kontrolle großer militärischer Verbände. Hinzu kamen tief greifende, klassenbezogene gesellschaftliche Konflikte über die grundlegende Organisation staatlicher —————— 26 Der Frage, ob das Wahlrecht in der Tradition der klassischen englischen Parlamentstheorie als Konnexinstitut des Eigentumsrechts oder aber im Sinne des Naturrechts, welches das Wahlrecht als eine Erscheinungsform der allgemeinen Menschenrechte begreift, gesehen werden sollte, gingen die Verfassungsväter aus dem Weg, indem sie die Regelung des Wahlrechts weitgehend der Zuständigkeit der Einzelstaaten überließen. Einfluss auf die landesweite Wahlrechtsentwicklung wurde von Washington aus jedoch über eine Reihe grundlegender Verfassungsänderungen genommen. Im Hinblick auf die Demokratisierung des Wahlrechts für die männliche schwarze Bevölkerung kam dem 15. Amendment (1870) überragende Bedeutung zu. Als Reaktion auf die Politik einiger Einzelstaaten, das Wahlrecht an die Zahlung einer »poll tax« oder aber eine »ererbte« Befreiung von dieser zu knüpfen, kam es mit dem 24. Amendment (1964) zu einer weiteren Maßnahme, durch die solche Praktiken ausnahmslos für verfassungswidrig erklärt wurden. 30 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Herrschaft. Dabei erschien die Zentralisierung von Macht aus der Perspektive progressiv gesinnter Kräfte gleichsam als Voraussetzung für die Zerschlagung der traditionellen Herrschaftsordnung. Beide Impulse fehlten in den Vereinigten Staaten. Der Prozess der Demokratisierung vollzog sich folglich im Rahmen der alt hergebrachten, stark gewaltenteilig angelegten Tudor-Institutionen. Ein wenig zuspitzend lässt sich festhalten: Gerade die Nicht-Zentralisierung der traditionellen Herrschaftsorganisation begünstigte (im Zusammenspiel mit dem vergleichsweise hohen Maß an klassenbezogener Homogenität der amerikanischen Gesellschaft) ihre frühe und expansive Demokratisierung. Grundlegende Differenzen treten jedoch nicht nur im Rahmen eines transatlantischen Vergleichs der Wahlrechtsentwicklung zutage. Auch die Entwicklungen innerhalb Europas weisen bemerkenswerte Unterschiede zwischen Ländern auf. Ausgesprochen langwierig waren die einschlägigen Entwicklungsprozesse in Großbritannien. Dort dauerte es von der Großen Wahlsystemreform des Jahres 1832 bis zur Gewährleistung eines unbeschränkten Wahlrechts für die gesamte männliche Bevölkerung des Landes mehr als weitere 80 Jahre, bis 1918. Allerdings verlief dieser Prozess stetig und ohne nennenswerte Rückschritte. Ungewöhnlich schnell hingegen ging die Schaffung eines zunächst noch vielfältig konditionierten, schließlich aber vollständig demokratisierten Wahlrechts in Frankreich vor sich. Dort wurde das allgemeine Wahlrecht für Männer nach einer nur vierjährigen Transformationsphase bereits 1848 verwirklicht. Die anderen europäischen Länder fielen zwischen diese beiden Extreme (Rokkan 1970: 149–150). Frankreich ist indes nicht nur jenes Land mit der rasantesten historischen Entwicklungsdynamik; es belegt auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer einen Spitzenplatz. Die Skala für die heute konsolidierten liberalen Demokratien erstreckt sich von 1848 (Frankreich, Dänemark, Schweiz) bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts (Kanada 1920, Schweden 1921, Japan 1925). Generell gilt: Je später das allgemeine Wahlrecht für die männliche Bevölkerung verwirklicht wurde, umso kürzer war der zeitliche Abstand zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Frauen. So wurde in Kanada und Schweden das allgemeine Wahlrecht für Männer und Frauen gleichzeitig eingeführt. Das extreme Gegenbeispiel verkörpert die Schweiz, wo es zu einer Ergänzung des bereits 1848 geschaffenen Wahlrechts für Männer durch das Wahlrecht für Frauen erst mit einer spektakulären Verzögerung von mehr als hundertzwanzig Jahren (1971) kam. WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 31 Deutschland gehörte im Hinblick auf die Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer geradezu zu den Pionieren und überdies zu jener Gruppe von Ländern, in denen dieser Prozess besonders zügig verlief. Wäre es nach dem Willen der Paulskirchen-Versammlung gegangen, hätte es ein allgemeines Wahlrecht für den männlichen Teil der deutschen Bevölkerung bereits 1848 gegeben. Aber auch die um gut zwei Jahrzehnte verschobene Umsetzung dieser Pläne im Zuge der Schaffung des Norddeutschen Bundes (1869) bzw. des Deutschen Reichs (1871) sicherte Deutschland in der Wahlrechtsfrage noch einen Platz in der Gruppe der »Frühstarter«. Der deutsche Fall erinnert daran, dass die Demokratisierung des Wahlrechts weder gleichbedeutend mit einer Demokratisierung politischer Herrschaft ist noch notwendigerweise den Schlussstein des historischen Entwicklungsprozesses hin zu einer parlamentarischen Demokratie bilden muss. Tatsächlich fielen die einzelnen Entwicklungsschritte, die schließlich zur Konstituierung vollständig demokratisierter parlamentarischer Systeme führten, in kaum einem der älteren demokratischen Verfassungsstaaten zeitlich exakt zusammen.27 Angesichts der konkreten Interessenlage der politisch-gesellschaftlichen Kräfte, die für bestimmte Reformen eintraten, kann das verbreitete Auseinanderfallen von Parlamentarisierung und Demokratisierung kaum überraschen. »The groups which pressed for early parliamentary influence generally did not favour a franchise extension. Regardless of whether they were the leaders of liberal or conservative parties, they essentially were the representatives of upper- and upper-middle-class interests. As such, they tried to postpone suffrage extension since a broadening of the franchise was viewed as a change that would benefit working-class and socialist parties. In countries in which bourgeois parties did not achieve any notable successes in establishing their influence over the executive until late in the nineteenth century, they often had to join formal or informal coali- —————— 27 Während in Großbritannien, aber auch in Belgien und den Niederlanden die schrittweise Ausweitung von Partizipationsrechten die bereits bestehende parlamentarische Ordnung Stück für Stück demokratisierte, folgte in Deutschland wie in Dänemark die Parlamentarisierung der politischen Ordnung, im Sinne einer parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung, der Installation eines allgemeinen und gleichen Männerwahlrechts erst mit großem zeitlichen Abstand nach. Zu den wenigen westeuropäischen Ländern, in denen die Parlamentarisierung des Systems und die Einführung eines demokratischen Wahlrechts zeitlich zusammen fielen, gehört Irland. Vgl. Kohl (1983: 396–397). 32 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE tions with representatives of groups agitating for universal suffrage in order to do so.« (Gerlich 1973: 107–108) Der deutsche Fall zeigt überdies, dass es einen alternativen Weg zur Demokratisierung des Wahlrechts in Abwesenheit einer parlamentarisierten Herrschaftsordnung gab, der nicht aus dem späten Zusammenschluss konservativer und fortschrittlich gesinnter Kräfte entsprang, sondern eher das Ergebnis spezifischer Erwägungen einer konservativen Machtelite war. Dabei ging es schwerlich um die Verwirklichung der Idee der Volkssouveränität. Ausschlaggebend für die »Gewährung« eines demokratischen Wahlrechts in Deutschland zu Beginn des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts waren vielmehr unterschiedliche innen- und außenpolitische Motive, insbesondere die Erwartung, die Obrigkeitstreue der Landbevölkerung als Gegengewicht zum liberalen Bürgertum zu installieren und die Hoffnung, auf der Grundlage der Gewährung des allgemeinen Männerwahlrechts gezielt die nationale Einigung, unter Trennung von Österreich, voranzutreiben (Jesse 1985: 51). Im internationalen Vergleich bildet Deutschland damit zwar einen besonderen Fall, aber keinen Einzelfall. Auch in einigen anderen Ländern mit etablierten dynastischen Autokratien, wie Dänemark oder Österreich, kam es zu überdurchschnittlich weitreichenden Wahlrechtsreformen, und auch in diesen Ländern ging es den Machthabern im Wesentlichen darum, der bestehenden Ordnung durch ein demokratisiertes Wahlrecht ein gewisses Maß an plebiszitärer Legitimation zu verschaffen, die nicht mit einer Demokratisierung der Kontrolle der Auswahl und Rekrutierung der Herrschaftselite »bezahlt« werden musste (Bartolini 2000: 129). Als es in Deutschland gegen Ende des Ersten Weltkrieges schließlich zum Durchbruch der parlamentarischen Demokratie kam (vgl. Abschnitt 6.1), wurde der Regimewechsel zugleich zum Anlass, um auch den weiblichen Teil der Bevölkerung mit dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht auszustatten. Hinsichtlich des Zeitpunktes der Ausweitung des allgemeinen Wahlrechts auf die weibliche Bevölkerung belegt Deutschland im internationalen Vergleich zwar keinen führenden, aber einen respektablen Platz im oberen Mittelfeld der liberalen Demokratien – hinter Ländern wie Neuseeland (1893), Finnland (1906) oder Australien (1908), aber weit vor der Schweiz (1971), Portugal (1974), Griechenland (1952), Japan (1947) oder selbst Frankreich (1946) und Großbritannien (1928). WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 2.1.2 33 Die Evolutionsgeschichte von Wahlsystemen Welches waren die maßgeblichen Wegmarken und Ergebnisse der Evolutionsgeschichte von Wahlsystemen in den heute konsolidierten Demokratien? Analog zu den Entwicklungsprozessen in vielen anderen Bereichen politischer Systeme verlief die Entwicklung von Wahlsystemen in Richtung einer stetigen Ausdifferenzierung institutioneller Profile, welche im nächsten Abschnitt genauer zu betrachten sind. Hier soll es zunächst nur um die grundlegende Unterscheidung zwischen Mehrheitswahlsystemen und Verhältniswahlsystemen und um die großen historischen Entwicklungstrends gehen. Selbst dieser vereinfachende Zugriff macht es erforderlich, sich kurz über das maßgebliche Definitionskriterium von Wahlsystemen zu verständigen. Als Definitionskriterien von Wahlsystemen kommen grundsätzlich die Entscheidungsregel oder aber das Repräsentationsziel in Betracht. Politisch bedeutsamer ist das Repräsentationsziel, also das Ergebnis, das angestrebt wird bzw. zu erwarten ist. Es besitzt nicht selten Verfassungsrang. Daran gemessen ist die Entscheidungsregel, mittels derer ein bezeichnetes Ziel verfolgt wird, zweitrangig. Die enorme Vielfalt von Wahlsystemen der Welt ist zum einen Ergebnis der unterschiedlichen Ausgestaltung und Kombination von Entscheidungsregeln, zum anderen der Möglichkeit unterschiedlicher Kombinationen zwischen Repräsentationsprinzip und Entscheidungsregel geschuldet. Den meisten international gängigen Typologien von Wahlsystemen, die das Repräsentationsziel als Primärmerkmal eines Wahlsystems akzeptieren, ist ein dualistischer Zug eigen (vgl. Sartori 1994: 53; Lijphart 1999: 143– 144; Nohlen 2000: 133–134). Das Repräsentationsziel von Mehrheitssystemen besteht in der Ermöglichung bzw. Beförderung einer möglichst reibungslosen Mehrheitsbildung, dasjenige von Verhältniswahlsystemen hingegen in der möglichst getreuen Abbildung der wahlstimmenbezogenen Kräfteverhältnisse unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Was die Entwicklungsgeschichte von Wahlsystemen in den heute konsolidierten Demokratien betrifft, so gilt: Am Anfang war die Mehrheitswahl. Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts befanden sich ausschließlich Mehrheitswahlsysteme in Anwendung, und zwar sowohl in jenen Ländern mit (noch mehr oder minder) beschränktem als auch in solchen mit (bereits mehr oder minder) universell ausgestaltetem Wahlrecht. Im Zuge der graduellen Ausweitung des demokratischen Wahlrechts und der Entste- 34 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE hung moderner Massenparteien kam es jedoch bald zu Veränderungen auf der Ebene von Wahlsystemen. Vor der Wende zum 20. Jahrhundert vollzogen nur Dänemark (1855) und Belgien (1899) den Wechsel zum Verhältniswahlrecht. Zu einer Phase ausgeprägten Wandels wurde das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Bis 1920 hatten sich Verhältniswahlsysteme in sämtlichen kleineren westeuropäischen Ländern, außerdem in Italien und Deutschland durchgesetzt. Ihre natürliche Heimat fanden Mehrheitswahlsysteme über den Ersten Weltkrieg hinaus in den angelsächsischen Staaten. Wie erklärt die historisch-vergleichend orientierte Wahlsystemforschung diese Dynamik? Bei den frühen Klassikern der international vergleichenden Wahlsystemforschung, wie Karl Braunias (1932) und Stein Rokkan (1970: 147–247), erscheint als zentrales Motiv für den frühen Übergang zum Verhältniswahlrecht in Ländern wie Dänemark und Belgien sowie in einigen der Schweizer Kantone das Bestreben, eine angemessene Repräsentation ethnischer, religiöser und/oder politischer Minderheiten zu gewährleisten. Dies wurde als notwendig erachtet, um über die gezielte Integration der betreffenden Gruppen in das jeweilige Gemeinwesen dessen territoriale und politische Konsolidierung zu ermöglichen. Für die zweite, regional deutlich weiter dimensionierte Welle der Ausbreitung von Verhältniswahlsystemen, die nun auch Länder ohne ausgeprägten kulturellen Fragmentierungsgrad erfasste, war hingegen vor allem das verbreitete Erstarken der Arbeiterklasse bzw. Arbeiterbewegung, ihr Drängen auf Verwirklichung des politischen Gleichheitsprinzips, verantwortlich. Die maßgeblichen Entscheidungen zur Reform der bestehenden Wahlrechtsregime mussten freilich von den machthabenden Eliten getroffen werden. Für die von der drohenden sozialistischen Umwälzung am stärksten gefährdeten bürgerlich-konservativen Kräfte konnte das Verhältniswahlrecht vor dem Hintergrund einer sich formierenden und zunehmend mobilisierten Massenwählerschaft ebenfalls als erstrebenswerte Option erscheinen. Wie Stein Rokkan mit Blick auf die Einführung listengestützter Verhältniswahlsysteme in Kontinentaleuropa feststellte: »The parties wanted to survive and saw that they rated the best chances under a system that would allow them not only to control nominations but also to gain representation even when in minority« (Rokkan 1970: 162). Die jüngere, statistisch-empirisch orientierte Wahlsystemforschung konnte einige der älteren Bewertungen konkretisieren. Nach den Befunden von Carles Boix (1999) stellt das Zusammenwirken der jeweiligen Stärke WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 35 sozialistischer Gruppierungen und der Anzahl alter, nicht-sozialistischer Parteien bzw. das daraus resultierende Maß an Bedrohung auf Seiten der herrschenden politischen Elite den entscheidenden Faktor dar. Dabei gilt: Je höher das Ausmaß an empfundener Bedrohung, desto geringer die im Zuge der Wahlsystemreform geschaffene effektive Sperrklausel (»effective electoral threshold«). Deutschland erscheint dabei geradezu als ein paradigmatischer Fall, der durch eine starke Fragmentierung des konservativen Lagers und eine ungewöhnlich starke sozialdemokratische Partei gekennzeichnet ist. Im Gegensatz dazu konnte in Großbritannien eine der beiden maßgeblichen bürgerlichen Parteien (die Conservative Party) auch unter Beibehaltung des Mehrheitswahlrechts die berechtigte Erwartung hegen, als dominanter Akteur zu bestehen; sie votierte folglich nicht für die Einführung eines Verhältniswahlsystems. Als weitere wichtige Variable, durch die der Effekt der Fragmentierung des konservativen Parteienlagers entscheidend modifiziert wird, erscheint die Größe eines Landes: Die politischen Eliten kleiner Länder führten die Verhältniswahl ein, um ethnische und religiöse Minderheiten gebührend in den politischen Partizipationsprozess einzubinden. In diesen Ländern, die zumeist durch eine »flächendeckende« Präsenz von Konfliktlinien religiöser und manchmal ethnischer Natur geprägt waren, hätte die Aufrechterhaltung der Mehrheitswahl eindeutig die stärkste Minderheit begünstigt. In flächenmäßig großen Ländern mit ausgeprägter regionaler Konzentration religiöser, sprachlicher oder anderer Minderheiten (wie Australien, Kanada und den USA) wurde die Verhältniswahl als Mechanismus für die Gewähr angemessener politischer Beteiligung signifikanter Minderheiten hingegen für entbehrlich gehalten (ebd.: 620–621). Entscheidend ist aber nicht lediglich die flächenmäßige Größe des Landes, sondern auch dessen territoriale Organisationsstruktur: »Even if a country is extremely heterogenous at the national level, if its regions and local districts are rather homoegeneous, a different set of mechanisms – such as federalism and a strict separation of powers – can secure the representation of political minorities and hence make PR superflous. In short, under certain conditions, federalism operates as a (quasi-perfect) substitute for PR and minimizes the potential pressures to abandon a plurality/majority system.« (Boix 1999: 621) Dass dem strategisch motivierten Handeln von Akteuren in den unterschiedlichen Rekonstruktionsversuchen der Entwicklungsgeschichte von Wahlsystemen ein solch prominenter Status zugestanden wird, kann angesichts des ausgeprägten Charakters von Wahlsystemen als »redistributiven Institutionen« nicht überraschen (Benoit 2004: 366–367). Stärker als in 36 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE vielen anderen Bereichen politischer Institutionenreform geht es bei der Durchsetzung oder Verhinderung von Wahlsystemreformen um Machtpolitik in konzentrierter Form. Trotzdem kann machtpolitisch motiviertes strategisches Handeln politischer Akteure allein die Entstehung von Wahlsystemen nicht vollständig erklären. Zunächst gibt es zweifelsohne grundlegende »cultural affinities« zwischen unterschiedlichen politischen Kulturen und Wahlsystemen (Horowitz 2003: 120). Ebenfalls ein eigenständiges Gewicht besitzen historische Erfahrungen; sie konstituieren gleichsam einen »Handlungskorridor«, durch den die theoretisch möglichen Handlungsoptionen in der Verfassungspraxis faktisch eingeschränkt oder zumindest bestimmte Lösungen begünstigt werden (Carstairs 1980: 213–214). Die Befunde der internationalen Forschung suggerieren zudem, dass grundlegende politische Normen (die wiederum die Strategiewahl von Akteuren beeinflussen) ebenfalls eine wichtige Rolle spielen (Blais/Massicotte 1997: 117). Dazu zählt insbesondere die Möglichkeit, dass handlungsmächtige politische Akteure einen Sinn für allgemeinere demokratische, gerade nicht machtpolitisch geprägte Werte besitzen und diesen im Rahmen von Wahlsystemreformerwägungen einen zentralen Stellenwert zuerkennen (Katz 2005: 68–69).28 Speziell für jene Systeme, in denen es sehr früh zu grundlegenden, seither im Kern nicht mehr revidierten Entscheidungen über das Wahlsystem kam, lässt sich bezweifeln, ob überhaupt sinnvoll von gezieltem strategischen Handeln der maßgeblichen politischen Eliten gesprochen werden kann. »[I]n a few cases, there was simply no ›moment of choice‹: decision-makers in Canada, the UK, and the USA were hardly aware that they had ›chosen‹ an electoral system when contested elections began to take place in the nineteenth century or earlier, as awareness of other options, not to mention knowledge of any ›laws‹ linking electoral systems to likely consequences, was very low.« (Gallagher 2005: 538–539) Für historisch jüngere Entscheidungsprozesse über Wahlsystemfragen in den liberalen Demokratien gilt hingegen, dass gelegentlich das Volk selbst eine wichtige Rolle vor allem im Zusammenhang mit der Abschaffung (und anschließenden Reform) bestehender Regeln spielte – sei es in Form von Referenden (wie in Italien oder Neuseeland), sei es durch eine wach- —————— 28 Im Hinblick auf die Geschichte der Wahlsystempolitik in Deutschland sei an die weiter reichenden theoretisch-normativen Grundlagen des frühen Eintretens der SPD während des Kaiserreichs für ein Verhältniswahlsystem erinnert. Vgl. Pulzer (1983: 85). WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 37 sende allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Leistungsfähigkeit des politischen Systems, durch die ein nicht zu ignorierender Handlungsdruck erzeugt wurde (so in Japan oder Israel). 2.2 Entstehung und Wandel des Wahlsystems der Bundesrepublik Der langwierige Entstehungsprozess des Wahlgesetzes zum ersten Deutschen Bundestag wurde von der Forschung der »Schattenseite des Demokratiegründungsprozesses« (Niclauß 1998: 366) im Nachkriegsdeutschland zugerechnet. Tatsächlich war das erste Wahlgesetz, wie es im September 1949 zur Anwendung gelangte, formal betrachtet Besatzungsrecht. Dessen ungeachtet war das Wahlgesetz wesentlich das Ergebnis ausgedehnter Verhandlungsprozesse im Parlamentarischen Rat. Der von diesem vorgelegte Entwurf wurde jedoch zunächst von den Ministerpräsidenten und anschließend auch von den Militärgouverneuren der Alliierten in den Westzonen noch einmal modifiziert, bevor er schließlich in Kraft trat. Der Parlamentarische Rat verständigte sich auf ein Verhältniswahlsystem, bei dem die eine Hälfte der Abgeordneten in Einerwahlkreisen mit Mehrheitswahl gewählt wurde, die andere Hälfte über Landesparteilisten. Die Ministerpräsidenten waren dafür verantwortlich, dass am Ende nicht die Hälfte, sondern 60 Prozent der Abgeordneten als Direktkandidaten gewählt wurden und außerdem eine Fünfprozenthürde in das Wahlgesetz eingefügt wurde. Auf Drängen der Militärgouverneure wurde festgeschrieben, dass die Sperrklausel nicht für das gesamte Bundesgebiet, sondern lediglich für die einzelnen Länder gelten dürfe. Im Lichte insbesondere der Argumente der einflussreichen HermensSchule der deutschen Wahlsystemforschung, die das Scheitern der Weimarer Republik maßgeblich mit der Existenz eines Verhältniswahlsystems erklärte (Hermens 1951), mag die Entscheidung der Nachkriegseliten zugunsten der Verhältniswahl überraschen. Ein genauerer Blick auf die Beratungen verdeutlicht jedoch, dass die schließlich getroffene Entscheidung weder durch Ignoranz gegenüber den politischen und wissenschaftlichen Diskussionen während der Weimarer Republik gekennzeichnet noch Ausdruck prinzipieller Hemmungen gegenüber einem radikalen Neubeginn in der Wahlrechtspolitik war. Zum ersten Aspekt ist anzumerken, dass in der 38 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Weimarer Periode selbst keineswegs schwerpunktmäßig die Parteienzersplitterung, sondern vielmehr die fehlende Personalisierung beklagt wurde (Jesse 1985: 376). Diesem als dominant geltenden Problem wurde nach 1945 mit einem veränderten Verfahren der Kandidatenaufstellung und der Direktwahl der einen Hälfte der Abgeordneten gezielt begegnet. Wichtiger noch waren die unmittelbar wirksamen politischen Kontextbedingungen der Wahlgesetzgebung. So waren bereits vor der Beschlussfassung über das erste Bundeswahlgesetz wichtige Weichen zugunsten des Verhältniswahlprinzips gestellt. In den Ländern hatte sich zu jenem Zeitpunkt, da die Debatte über die Wahlgesetzgebung auf Bundesebene begann, bereits flächendeckend ein Vielparteiensystem etabliert. Mehr noch: In sämtlichen Ländern mit Ausnahme Hamburgs und Schleswig-Holsteins existierten Verhältniswahlsysteme (Lange 1975: 776). Obwohl der politische Entscheidungsprozess über das Wahlsystem nicht frei war von Erwägungen, welche die politische Stabilität des zu schaffenden Gemeinwesens betrafen (so Bawn 1993: 986), bestimmten insgesamt machtbewusste, strategische Erwägungen der einzelnen Parteien sowie die schließlich geschmiedeten Kompromisse den Ausgang der Beratungen (Lange 1975: 809; Niclauß 1998: 360–366; Scarrow 2001). Das gilt zunächst für die Grundsatzentscheidung über die Streitfrage Mehrheitswahl versus Verhältniswahl. Während sich die SPD und die meisten kleineren Parteien früh für die Schaffung eines Verhältniswahlsystems stark machten, trat die Union, am Ende vergeblich, für ein relatives Mehrheitswahlsystem ein. Von den kleineren Parteien optierte nur die DP, die sich angesichts ihrer starken Position in Niedersachsen und Bremen unter diesem System gute Chancen ausrechnete, für die relative Mehrheitswahl. Das Wahlgesetz von 1949 wurde später vom 1. Bundestag für die Bundestagswahl von 1953 modifiziert. Bereits Ende 1952 beschlossen wurde die Abschaffung von Nachwahlen für den Rest der Legislaturperiode – nach Einschätzung einiger Autoren »eine der bedauerlichsten verfassungspolitischen Maßnahmen der Nachkriegszeit« (Hennis 1973: 145–146; zit. bei Jesse 2003: 4). Zu den im Zuge der Verabschiedung des Wahlgesetzes zum 2. Deutschen Bundestag (1953) vollzogenen Änderungen zählte die Veränderung des Verhältnisses zwischen Direkt- und Listenmandaten von 60:40 auf 50:50 und die Modifikation der Sperrklausel, welche nun nicht mehr lediglich auf die einzelnen Länder, sondern auf das Bundesgebiet angewandt wurde. Hinzu kam die Erhöhung der »regulären Mandate« von 400 auf 484 und die Einführung eines Zweistimmensystems: Seither wird WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 39 mit der Erststimme ein Kandidat im Wahlkreis, mit der Zweitstimme eine Landesliste gewählt. Maßgeblich für die Berechnung der einer Partei zugewiesenen Mandate ist die Summe bzw. der Anteil der erzielten Zweitstimmen, wobei die direkt errungenen Mandate abgezogen werden. Erhält eine Partei mehr Direktmandate als ihr nach der Zweitstimmenauszählung Mandate zustehen, so darf sie diese behalten.29 Als Gewinner der Wahlsystemreform des Jahres 1953 erschien die FDP, die mit den Sozialdemokraten und den kleineren Parteien gegen die CDU/CSU und die DP zusammenwirkte, um die grundlegende Struktur des ursprünglichen Wahlgesetzes zu befestigen. Abgesehen davon traten die Liberalen gemeinsam mit der Union, und dabei in Frontstellung gegenüber den übrigen kleineren Parteien, erfolgreich für die Verschärfung der Fünfprozentklausel ein. Das Zweistimmenrecht begünstigte Wahlabsprachen der größeren mit kleineren Parteien, wobei die CDU/CSU und die FDP über insgesamt günstigere Optionen verfügten als die SPD (Lange 1975: 795). 1956 kam es zu einer Reihe weiterer Reformen. Die erste betraf die abermalige Verschärfung der Fünfprozenthürde; seither sind nicht mehr nur fünf Prozent der Stimmen auf Bundesebene oder ein Direktmandat, sondern mindestens drei Direktmandate gefordert, um an der Sitzvergabe beteiligt zu werden. Im gleichen Zuge wurde es den Parteien gestattet, mehrere Landeslisten zu einer Zähleinheit zu verbinden. Ebenfalls 1956 wurde die Briefwahl eingeführt. Seither hat es – von den besonderen Regeln für die Bundestagswahl 1990 (dabei konkret die Regionalisierung der Sperrklausel sowie die Möglichkeit von Listenverbindungen) einmal abge- —————— 29 Die so erzielten Mandate werden als Überhangmandate bezeichnet. Über sie hat sich vor dem Hintergrund ihrer deutlichen Zunahme seit den neunziger Jahren eine rege Diskussion entsponnen. Vgl. hierzu statt vieler mit zahlreichen weiteren Nachweisen Behnke (2003). Überhangmandate wurden auch bereits bei der Bundestagswahl 1949 vergeben, obwohl jeder Wähler bei dieser Wahl nur über eine Stimme verfügte. Dabei war jedem Bundesland eine bestimmte Zahl der »mindestens« 400 zu wählenden Abgeordneten zugeteilt. 60 Prozent dieser Mandate wurden auf der Grundlage relativer Mehrheitswahl in den Wahlkreisen vergeben; die restlichen über Listenmandate. Von den über das Höchstzahlverfahren nach d’Hondt ermittelten Listenmandaten für die einzelnen Parteien wurden die in den Wahlkreisen errungenen Sitze einer Partei abgezogen. Nach § 10 Abs. 3 des Wahlgesetzes blieben die in den Wahlkreisen errungenen Mandate einer Partei auch dann erhalten, wenn ihre Zahl die sich nach der Verteilung ergebende Gesamtzahl überstieg. Vgl. Jakob (1998: 61–62). 40 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sehen – kaum erwähnenswerte Änderungen des Wahlrechts gegeben. Hervorhebenswert erscheint von den späteren Reformen am ehesten die nach langwieriger öffentlicher Auseinandersetzung 1970 vollzogene Absenkung des Mindestalters für die Ausübung des aktiven Wahlrechts von 21 auf 18 Jahre. Wie sind die einzelnen Reformen im Lichte empirischer Erfahrungen zu bewerten? Die Wirkungen der Fünfprozentklausel in ihrer seit 1957 praktizierten Form werden heute ganz überwiegend positiv gesehen. Sie half, das Ziel der Regierungsstabilität zu erreichen, ohne dabei das Prinzip der Chancengleichheit für die kleineren bzw. neue Parteien einer allzu großen Belastung auszusetzen. Als besondere Leistung der Sperrklausel gilt die Verhinderung des Einzugs radikaler Parteien wie der NPD in den Bundestag (Saalfeld 2005: 225–226). Deutlich kritischer fällt das Urteil über das seit 1953 praktizierte Zweistimmensystem aus. Bemängelt wurde insbesondere die mangelhafte Transparenz des Verfahrens, nicht zuletzt aus Sicht der von der Komplexität des Systems allem Anschein nach gelegentlich überforderten Wähler (Schmitt-Beck 1993). Ebenfalls als nicht unproblematisch gilt die Briefwahl. Das international am häufigsten vorgebrachte Argument zugunsten der Briefwahl lautet, dass diese einer strukturell sinkenden Wahlbeteiligung entgegenwirken helfe (Qvortrup 2005: 415).30 In Deutschland wurde die Möglichkeit der Briefwahl dagegen vor allem mit dem Recht eines jeden Bürgers begründet, auch im Falle zeitweiliger Verhinderung »seine« Volksvertretung wählen zu können. Das Problem einer beunruhigend geringen Wahlbeteiligung auf Bundesebene kannte die Bundesrepublik – gemessen an den durchschnittlichen Wahlbeteiligungsraten anderer konsolidierter Demokratien – weder vor der frühen Einführung der Briefwahl noch seither. Skeptisch beurteilt wird heute – vor dem Hintergrund einer praktisch kontinuierlich angestiegenen Briefwählerquote bei Bundestagswahlen31 – vor allem die mangelnde Transparenz des Stimmabgabeverfahrens (Jesse 2003: 6). —————— 30 Vergleichenden Untersuchungen zufolge kam es im Gefolge der Einführung der Briefwahl jedoch nur zu einem kurzfristigen und überdies eher moderatem Anstieg der Wahlbeteiligung. Auch ein weiterer häufig genannter Leistungseffekt der Briefwahl, die Kostenersparnis, scheint nur dann zu gelten, wenn diese die Präsenzwahl vollständig ersetzt (Kersting 2004). 31 Bei der Bundestagswahl 1998 betrug der Anteil von Briefwählern an der Gesamtheit der Wähler erstmals über 15 Prozent. Bei den Wahlen von 2002 und 2005 nahm die Zahl der Briefwähler weiter zu; sie lag nach Auskunft des Bundeswahlleiters bei 18 bzw. 18,6 Prozent. WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 41 2.3 Das deutsche Wahlsystem aus der Perspektive der internationalen Wahlsystemforschung Der Vergleich von Wahlsystemen gestaltet sich schwieriger als es auf den ersten Blick scheinen mag. Innerhalb der internationalen bzw. international vergleichenden Wahlsystemforschung wird der oben eingeführten Unterscheidung zwischen Mehrheitswahl und Verhältniswahl zwar ein zentraler Stellenwert zuerkannt, doch kommen Typologisierungsversuche, die der Vielfalt unterschiedlicher Systeme gerecht werden, schwerlich mit dieser Unterscheidung aus. Selbst überzeugte Verfechter der Basisdifferenzierung zwischen Mehrheits- und Verhältniswahl bestreiten nicht, dass es in der politischen Realität der liberalen Demokratien kombinierte Wahlsysteme gibt. In der jüngeren globalen Entwicklungsgeschichte von Wahlsystemen haben gerade sie sogar die weiteste Verbreitung gefunden (Nohlen 2005: 12). Der Sinngehalt der Bezeichnung kombinierte bzw. »Mischwahlsysteme« bleibt jedoch umstritten. Die Auffassung, dass es eine Mischung zwischen dem Prinzip der Verhältnis- und Mehrheitswahl auch auf der Ebene des Repräsentationsprinzips gibt (so Kaiser 2002), hat weder in Deutschland noch in der internationalen Diskussion nennenswerten Zuspruch erfahren (Klein 2004: 223–224). Die Vielzahl von kombinierten Wahlsystemen, die nicht in die Gruppe der als »klassisch« geltenden Wahlsysteme – die relative und absolute Mehrheitswahl sowie die reine Verhältniswahl (Nohlen 2005: 11) – passen, sind durch ein spezifisches Spannungsverhältnis zwischen Entscheidungsregel und Repräsentationsprinzip gekennzeichnet. Während bei den drei »klassischen« Wahlsystemen das Repräsentationsprinzip und die Entscheidungsregel einander entsprechen (und zwar entweder in der Kombination »Repräsentationsziel: Mehrheitsbildung/Entscheidungsregel: Mehrheit« oder in der Kombination »Repräsentationsziel: Abbildung der Wählerschaft/Entscheidungsregel: der Anteil entscheidet«), werden diese bei gemischten Systemen kombiniert (Nohlen 2000: 133– 134). Die Debatte über den Charakter von »Mischwahlsystemen« besitzt nicht zuletzt im Hinblick auf das Wahlsystem der Bundesrepublik unmittelbare Relevanz. Nach den soeben dargelegten Kriterien wäre es eindeutig irreführend, das deutsche System als ein »Mischwahlsystem« zu klassifizieren – wozu freilich die Tatsache verleitet, dass die Hälfte der Abgeordneten nach der Mehrheitsregel in Einerwahlkreisen, die übrigen nach Proporz 42 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE über die Landeslisten der Parteien gewählt werden. Hinsichtlich des Repräsentationsprinzips ist das deutsche Wahlsystem jedoch eindeutig ein Verhältniswahlsystem, da für die Anzahl der Mandate, die eine Partei erhält, (abgesehen von »Grundmandaten« und »Überhangmandaten«) allein der Anteil der Zweitstimmen maßgeblich ist. Der Tatsache, dass die Hälfte der Abgeordneten als Direktkandidaten in Einmannwahlkreisen gewählt wird, lässt sich in terminologischer Hinsicht am besten mit der Bezeichnung »personalisierte Verhältniswahl« Rechnung tragen. In struktureller Hinsicht am engsten verwandt sind dem deutschen System aus der Familie der konsolidierten liberalen Demokratien die in den frühen neunziger Jahren – nach deutschem Vorbild – reformierten Wahlsysteme Neuseelands und Italiens (bis 2005). Ebenfalls zur Gruppe der Verhältniswahlsysteme gerechnet werden die reinen Listenwahlsysteme, die es in zahlreichen westeuropäischen Ländern – von Skandinavien bis nach Portugal und Spanien – gibt, sowie das in Irland und Malta praktizierte »single transferable vote system«. Den Prototyp des relativen Mehrheitswahlsystems verkörpert Großbritannien, außerhalb Europas die USA. Die absolute Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen und mit zwei Wahlgängen kennt unter den Ländern Westeuropas nur Frankreich. Am nächsten kommt dem französischen System außerhalb Europas das australische Mehrheitswahlsystem, welches auf einen zweiten Wahlgang verzichtet und den Wahlkreisgewinner stattdessen auf der Grundlage der Anzahl abzugebender »alternative votes« ermittelt. Einen einsamen Sonderfall verkörpert das japanische Wahlsystem, welches in vielen vergleichenden Studien aber schlicht den »mixed systems« zugeordnet wird. Freilich berücksichtigen entsprechende Klassifikationen nur einen kleinen Ausschnitt der institutionellen Vielfalt von Wahlsystemen. Zumindest auf einige weitere Aspekte sei an dieser Stelle hingewiesen: Die Bundesrepublik gehört – gemeinsam mit Italien, Japan und Neuseeland – zu den wenigen Systemen der Welt, in denen die Wähler nicht nur zwei Stimmen besitzen, sondern diese auch zwischen zwei unterschiedlichen Parteien aufteilen können. Wie in der Mehrheit der hier berücksichtigten Länder besteht in der Bundesrepublik keinerlei Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Kandidaten ein und derselben Partei zu wählen. Eine solche Option existiert lediglich in Irland und Malta mit deren eigentümlichen »single transferable vote«-Systemen sowie in der kleinen Zahl von Ländern, die ein Listensystem mit Präferenzstimmen praktizieren (Österreich, Dänemark, Finnland und die Niederlande). Eine das deutsche Wahlsystem kennzeich- WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 43 nende Sperrklausel findet sich auch in einigen anderen Ländern, so in den Niederlanden, Österreich, Schweden oder Norwegen. In keinem dieser Länder liegt die Hürde jedoch vergleichbar hoch. Im weiter gefassten Vergleich, unter Einschluss der jungen Demokratien und den in der Demokratisierung begriffenen Länder, erscheinen die hierzulande geforderten fünf Prozent jedoch nicht als exorbitant. Noch deutlich exklusiver als hierzulande sind die Sperrklauseln des polnischen und türkischen Wahlsystems (sieben bzw. zehn Prozent). Die international vergleichende Wahlsystemforschung begnügt sich im Allgemeinen nicht mit einem Vergleich der formalen (künstlichen) Hürden. Im Zentrum vergleichender Studien stehen vielmehr die faktischen (natürlichen) Hürden, die »effective thresholds«. Eine faktische Hürde ergibt sich in der Praxis – alternativ zu der Verankerung einer formalen Sperrklausel im Wahlgesetz – insbesondere in Systemen, in denen nur ein oder wenige Repräsentanten pro Wahlkreis gewählt werden. Aus funktionaler Perspektive erscheinen beide Regeln als zwei Seiten derselben Medaille (Lijphart 1994: 12). Für die Bundesrepublik gilt, dass die »effektive Prozenthürde« identisch mit der formalen Sperrklausel ist. Die stärksten Diskrepanzen zwischen formaler und effektiver Sperrklausel kennzeichnen relative Mehrheitswahlsysteme wie sie in Großbritannien oder den USA Anwendung finden. Dort liegt die effektive Sperrklausel auch ohne formale Prozenthürde bei rund 35 Prozent. Mit deutlich über 15 Prozent ebenfalls auffallend hoch war die effektive Sperrklausel des japanischen bzw. des irischen Wahlsystems der Periode zwischen dem Ausgang der vierziger und den späten achtziger Jahren (ebd.: 40). Auch in zahlreichen anderen Systemen, die ebenfalls keine formale Sperrklausel kennen, liegt die effektive Hürde zum Teil deutlich über derjenigen des deutschen Wahlgesetzes (ebd.: 22, 31, 33). Erwähnenswerte Unterschiede gibt es nicht nur in Bezug auf einzelne Aspekte von Wahlsystemen, sondern auch auf der Ebene des Wahlrechts, von denen abschließend einige hervorgehoben seien. In Westeuropa ist das Wahlsystem mehrheitlich verfassungsrechtlich festgelegt. Deutschland gehört gemeinsam mit Frankreich und Italien und der Schweiz zu jenen Ländern, in denen die einschlägigen Verfahrensvorschriften (abgesehen von wenigen grundlegenden Prinzipien) nicht in der Verfassung, sondern in einem speziellen Wahlgesetz festgeschrieben sind.32 Wie in fast allen —————— 32 Der empirische Effekt einer verfassungsrechtlichen Verankerung des Wahlsystems – insbesondere der Zusammenhang zwischen verfassungsrechtlicher Fixierung 44 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE übrigen konsolidierten liberalen Demokratien liegt die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht in der Bundesrepublik heute bei 18 Jahren; nachdem 1992 auch Österreich die Grenze von 19 Jahren auf 18 Jahre nach unten korrigierte, hält nur noch Japan an einer höheren Mindestaltersgrenze (von 20 Jahren) fest. Wie in der Mehrzahl der konsolidierten liberalen Demokratien existiert in der Bundesrepublik keine Wahlpflicht. Belgien, Italien, Luxemburg, Griechenland und Australien gehören zu jenen Ländern, in denen das Prinzip der Wahlpflicht (trotz zum Teil heftiger Debatten über diesen Gegenstand) weiterhin Bestand hat, während entsprechende Regelungen in den Niederlanden und in Österreich (auf Landesebene) bereits aufgehoben wurden.33 Auch im Hinblick auf Beschränkungen des Wahlrechts befindet sich die Bundesrepublik insgesamt im »mainstream« der liberalen Demokratien.34 Wie in der Mehrzahl der hier berücksichtigten Länder verfügen in der Bundesrepublik ausschließlich als solche anerkannte Staatsbürger über das Recht zur Beteiligung an Wahlen zum nationalen Parlament. Verbreitet sind Ausnahmen von dieser Regel in den angelsächsischen Demokratien. In Neuseeland genügt eine permanente Residenz auch ohne neuseeländische Staatsbürgerschaft. In Großbritannien (und bis 1984 auch in Australien) ist lediglich die Staatsangehörigkeit eines zum Commonwealth gehörenden Landes erforderlich. In Irland ist alternativ zur irischen Staatsbürgerschaft diejenige des Vereinigten Königreichs —————— von Wahlsystembestimmungen einerseits und der Häufigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit von (grundlegenden) Wahlsystemreformen – ist keineswegs eindeutig. Während der Verzicht auf eine verfassungsrechtliche Verankerung des Wahlsystems in Frankreich in der Tat mit einem außerordentlichen Reformeifer einherging, zählen Länder wie Deutschland und die Schweiz auch ohne verfassungsrechtliche Verankerung des Wahlsystems zu jenen Ländern mit ausgeprägter Wahlsystemstabilität. 33 Die Auswirkungen der Wahlpflicht bleiben sowohl in empirischer als auch in normativer Hinsicht umstritten. Während das zentrale Ziel einer größtmöglichen Wahlbeteiligung bereits prinzipiell anfechtbar ist, zeigt ein empirischer Vergleich, dass die Wahlbeteiligung keineswegs in allen Systemen mit Wahlpflicht höher ist als in Ländern ohne Wahlpflicht. So war etwa die Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik im langjährigen Durchschnitt deutlich höher als in Griechenland. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass es in Systemen mit Wahlpflicht einen signifikant höheren Anteil von ungültigen bzw. unausgefüllten Stimmzetteln gibt, womit eine statistisch hohe Wahlbeteiligung tendenziell ad absurdum geführt wird. Vgl. Hirczy de Miño (2000). 34 Die im Folgenden präsentierten Befunde basieren auf den Daten von Blais/ Massicotte/Yoshinaka (2001: 44–49). WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 45 ausreichend. In Portugal sind auch Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedstaaten und Inhaber der brasilianischen Staatsbürgerschaft (mit »equal rights status«) wahlberechtigt. Etwas strenger als im Durchschnitt der konsolidierten liberalen Demokratien sind die Bestimmungen in der Bundesrepublik für die Aufrechterhaltung der Wahlberechtigung im Falle langjähriger Auslandsaufenthalte deutscher Staatsbürger. Die Mehrzahl der hier interessierenden Länder kennt (im auffallenden Gegensatz zu vielen Ländern der sogenannten Dritten Welt) keine derartigen Restriktionen. In Neuseeland, Australien, Kanada, Großbritannien und Dänemark existieren Fristen von einem Jahr bis zu 20 Jahren; sie gelten zum Teil jedoch nur, wenn die Absicht zur Rückkehr besteht. Für deutsche Staatsangehörige gibt es keine derartigen Beschränkungen, solange der alternative Wohnsitz in Europa liegt. In anderen Fällen gilt eine Maximalfrist von zehn Jahren. Deutlich liberaler als in der Mehrzahl der konsolidierten Demokratien sind die Bestimmungen in der Bundesrepublik bezüglich des Wahlrechts von Insassen staatlicher Zwangsvollzugsanstalten. Im Gegensatz zu den Gepflogenheiten in vielen anderen Ländern geht die Verbüßung einer Haftstrafe hierzulande nicht mit einem (vorübergehenden) Verlust des Wahlrechts einher. Restriktiv sind demgegenüber die Regeln bei Demenz; anders als in Kanada, Irland, Italien und Schweden verfügen die Betroffenen in der Bundesrepublik, analog zu der Praxis in den übrigen hier interessierenden Ländern, nicht über das Wahlrecht. 2.4 Konklusion Die Geschichte des Wahlrechts und der Wahlsysteme gehört zu den faszinierendsten Kapiteln der historisch und international vergleichenden Beschäftigung mit den institutionellen Grundlagen der liberalen Demokratie. Die aus einer Betrachterperspektive, der das Wahlrecht und das Wahlsystem als abhängige Variable gelten, gewonnenen Einsichten können dabei als mindestens vergleichbar bedeutender Beitrag zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Institutionen, Gesellschaft und Kultur gelten wie die Befunde der noch immer weitaus prominenteren Wahlsystemwirkungsforschung. Die populäre Vermutung, dass es zur Demokratisierung des Wahlrechts durchwegs im Gefolge von institutioneller Modernisierung und/oder auf 46 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE der Grundlage des maßgeblichen Einflusses progressiv eingestellter politischer Kräfte kam, erweist sich nicht zuletzt im Lichte amerikanischer und deutscher Erfahrungen des 19. Jahrunderts als so nicht haltbar. Die »theoretisch unwahrscheinliche« frühe Demokratisierung des Wahlrechts durch eine konservative und der Demokratie gegenüber skeptisch bis feindlich eingestellte Machtelite weist Deutschland in der internationalen Wahlrechtsgeschichte eine Position zu, die jener vergleichbar ist, die es angesichts der – klassischen theoretischen Erwartungen zufolge kaum minder unwahrscheinlichen – frühen Institutionalisierung des Wohlfahrtsstaates in der Geschichte der Sozialpolitik einnimmt (Schmidt 1988: 117–124). Auch eine zweite, insbesondere in Teilen der Wahlsystemforschung populäre Annahme, nach der sich eine Gesellschaft am Ende jene Institutionen sucht, die am besten zu ihrer politischen Kultur passen, bedarf der Differenzierung. Obwohl es zweifelsohne ausgeprägte Affinitäten zwischen Kulturen und Institutionen gibt, die bestimmte Lösungen historisch unwahrscheinlich und in funktionaler Hinsicht unbrauchbar machen35, entsprangen grundlegende Entscheidungen der Wahlsystempolitik in der Regel spezielleren Erwägungen. Selbst in einem Land wie Großbritannien, in dem das Wahlsystem vor allem von ausländischen Betrachtern geradezu als die institutionelle Verkörperung einer einzigartigen »insularen Mehrheitskultur« gesehen wurde, ging es im 19. Jahrhundert bei der Entscheidung zwischen Kontinuität oder Reform des Mehrheitswahlsystems keineswegs nur um die Suche nach dem optimalen »cultural fit«, sondern auch um die Abschätzung künftiger politischer Erfolgschancen der regierenden Elite.36 Trotz der Eigentümlichkeit seiner Wahlrechts- und Wahlsystemgeschichte gehört Deutschland zu jenen Ländern, die einen wichtigen Beitrag zur internationalen Ausbreitung des demokratischen Wahlrechts geleistet haben. Bei der Institutionalisierung des Frauenwahlrechts kam Deutschland unter den größeren Ländern Westeuropas sogar eine Führungsrolle —————— 35 So wäre die Einführung eines Mehrheitswahlsystems britischer Prägung in einem Land wie der Schweiz schlicht unvorstellbar. 36 Ähnliches suggerieren die jüngeren Erfahrungen der britischen Wahlsystempolitik, welche stark im Zeichen einer Rhetorik zugunsten der Abschaffung der relativen Mehrheitswahl stand – wiederum maßgeblich angetrieben von machtpolitischen Erwägungen relevanter Akteure. Allerdings ließe sich das eigentümliche Verschwinden der Wahlsystemreformpläne von der öffentlichen Agenda als Hinweis nicht nur auf eine veränderte Situationsdeutung der Labour Party, sondern auch als Anzeichen für die politische kulturelle Verwurzelung des Wahlsystems deuten. WAHLRECHT UND WAHLSYSTEM 47 zu. Vor allem das nach 1945 in Deutschland geschaffene System der »personalisierten Verhältniswahl« zählt zu jenen politischen Institutionen, die international viel Anerkennung gefunden haben und gelegentlich gar zum ausdrücklichen Referenz- und Reformmodell erhoben wurden. Zum Teil hat dies gewiss etwas damit zu tun, dass die Stabilität und Funktionsweise des deutschen Regierungssystems zuweilen in übertriebenem Maße auf das Wahlsystem zurückgeführt wird (Jesse 1992: 185). Allerdings schneidet das deutsche Wahlsystem selbst im spezielleren Leistungsvergleich unterschiedlicher Systeme auffallend gut ab. Kennzeichnend für die jüngere Wahlsystemdiskussion in der Wissenschaft und Politik ist die Berücksichtigung mehrerer unterschiedlicher, teils in Spannung zueinander stehender Bewertungskriterien (Horowitz 2003: 116–120; Nohlen 2005: 13–14), welche nach Möglichkeit vollständig berücksichtigt werden sollen. Zu den zentralen Funktionsanforderungen bzw. Bewertungskriterien werden in der Regel zumindest gerechnet: das Maß an Repräsentation (eine angemessene Proportionalität zwischen Stimmen und Mandaten), jenes an Konzentration und Effektivität (im Sinne einer angemessenen Aggregation gesellschaftlicher Interessen zum Zwecke politischer Entscheidungsfindung), das der Partizipation (d.h. der Möglichkeit der Wähler, ihren politischen Willen gezielt zum Ausdruck zu bringen) sowie das der Einfachheit (soll heißen, der Verständlichkeit und praktischen Handhabbarkeit). Als Schwachpunkt des deutschen Systems erscheint dabei am ehesten seine vergleichsweise komplexe Natur. Ansonsten gilt: »Die personalisierte Verhältniswahl mit gesetzlicher Sperrklausel […] erfüllt die Repräsentationsfunktion durch die proportionale parlamentarische Vertretung all der Parteien, welche die Sperrklausel überwunden haben. Dabei ist die Höhe der Sperrklausel noch mit dem Repräsentationsprinzip der Verhältniswahl vereinbar. Sie genügt der Konzentrationsfunktion, indem sie sehr kleine Parteien vom Parlament ausschließt und damit die Bildung parlamentarischer Mehrheiten erleichtert, die gemeinhin als Grundlage stabiler Regierungen in parlamentarischen Regierungssystemen gelten. Die Regierungen stützen sich auf Koalitionsmehrheiten, die nicht künstlich durch den Disproportionseffekt des Wahlsystems zustande kommen, sondern die tatsächlich die Mehrheit der Wählerstimmen verkörpern. Der Partizipationsfunktion genügt die personalisierte Verhältniswahl insofern, als Wählerinnen und Wähler einen Teil der Abgeordneten in Einerwahlkreisen wählen.« (Nohlen 2005: 16) Freilich erschöpft sich die Anerkennung, die das deutsche Wahlsystem gefunden hat, nicht auf den Zuspruch der internationalen Politikwissenschaft und den Respekt ausländischer Reformpolitiker. Auch in der Bun- 48 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE desrepublik selbst gehört das Wahlsystem seit langem zu jenem Teil des politischen Institutionengefüges, das zu Recht als (auch im weiteren, politisch-kulturellen Sinne) vollständig institutionalisiert gilt. Zu einer grundsätzlichen Infragestellung des im ersten Nachkriegsjahrzehnt geschaffenen Wahlsystems kam es zum letzten Mal in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre. Damals erwogen sowohl die CDU/CSU als auch die SPD, die personalisierte Verhältniswahl durch ein Mehrheitswahlsystem zu ersetzen. Für weite Teile der Union verkörperte eine grundlegende Wahlsystemreform sogar den mit Abstand wichtigsten sachpolitischen Grund für die Bildung der ersten großen Koalition auf Bundesebene (Schönhoven 2004: 69–70). Die lange anvisierte Reform scheiterte schließlich am Widerstand der Sozialdemokraten, denen das Festhalten am bestehenden System nach sorgfältiger Abwägung doch die beste Gewähr für eine künftige führende Regierungsbeteiligung auf Bundesebene zu bieten schien. Wie fest das Wahlsystem mittlerweile nicht nur im Bewusstsein der maßgeblichen Parteieliten, sondern auch der Bürger und der öffentlichen Meinung in der Bundesrepublik verankert ist, zeigten die Reaktionen auf das unerwartete Ergebnis der Bundestagswahl 2005. Trotz der ungewöhnlichen Schwierigkeiten der Regierungsbildung und der Unsicherheit der weiteren Entwicklung des Parteiensystems und künftiger Regierungsbildungen wurde eine grundlegende Reform des Wahlsystems von keiner Seite auch nur ernsthaft ins Gespräch gebracht (Helms 2006a: 59–60). Ein eindrucksvollerer Beleg der breiten politisch-gesellschaftlichen Akzeptanz und Verankerung des Wahlsystems lässt sich kaum denken. Gleichwohl gab und gibt es auf der akademischen Ebene gelegentlich Anstöße zu einer Reform des Wahlsystems (etwa Niclauß 1997: 6–7; von Prittwitz 2003; Jesse 2003). Sie zielen jedoch in aller Regel nicht auf eine Veränderung des grundlegenden Repräsentationsprinzips, sondern begnügen sich mit Vorschlägen zu einer behutsamen Optimierung der bestehenden Regeln im Zeichen einer Stärkung bürgernaher Demokratie. 3 Politische Parteien: Das Rückgrat der repräsentativen Demokratie Das Kapitel über die politischen Parteien folgt nicht zufällig auf dasjenige über Wahlrecht und Wahlsystem. Der enge theoretische und empirische Zusammenhang zwischen Wahlen einerseits und Parteien bzw. Parteiensystemen andererseits ist offensichtlich. Unter den vielfältigen Bestimmungsmerkmalen politischer Parteien kommt deren Beteiligung bei Wahlen ein herausragender Stellenwert zu; viele ihrer Funktionen – von der gesellschaftlichen Mobilisierung bis zur politischen Zielfindung und Rekrutierung von politischem Personal – leiten sich von ihr ab. In diesem Sinne handelt es sich bei politischen Parteien zuvörderst um wahlwerbende Gruppierungen, die auf der Grundlage gemeinsamer politischer Überzeugungen danach streben, einen größtmöglichen Anteil an Stimmen und Mandaten zu erwerben, üblicherweise um auf dieser Grundlage an der Besetzung von Regierungsämtern teilzuhaben.37 Nicht von ungefähr entstanden moderne politische Parteien mit hinreichenden organisatorischen Kapazitäten für eine effektive Massenmobilisierung historisch im Zuge der Ausbreitung des demokratischen Wahlrechts. Das funktionale Selbstverständnis politischer Parteien in unterschiedlichen Ländern blieb lange davon abhängig, ob die Herausbildung moderner Parteiorganisationen der Parlamentarisierung des Systems vorausging oder nachfolgte. Während die britischen Parteien sich im Kontext der funktionalen Anforderungen der parlamentarischen Demokratie von Anfang an als Regierungsinstitutionen begriffen, verharrten die deutschen Parteien, weitgehend unbe- —————— 37 Obwohl die normativen und empirischen Funktionen der Parteien in der Bundesrepublik deutlich über deren Beteiligung an Wahlen hinausreichen, kommt diesem Bestimmungsmerkmal auf der Ebene gesetzesrechtlich definierter Kriterien auch hierzulande eine besondere Bedeutung zu: Nach den Bestimmungen des deutschen Parteiengesetzes (§ 2) verliert eine Vereinigung ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtagswahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. 50 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE helligt von den Herausforderungen staatspolitischer Verantwortung, jahrzehntelang auf der Ebene überzeugter »Weltanschauungsparteien« (Johnson 1992). Ebenso offensichtlich ist die zentrale Bedeutung von Wahlen für das Parteiensystem, hier verstanden als die Gesamtheit der zu einem System gehörenden Parteien und deren Beziehungen zueinander. Schließlich wird eines der wichtigsten Strukturmerkmale von Parteiensystemen – das nominale Stärkeverhältnis zwischen den Parteien – unmittelbar durch das Wahlergebnis bestimmt, wobei freilich besonders die parlamentarische Repräsentationsstärke unterschiedlicher Parteien beeinflusst ist vom spezifischen Umrechnungsmodus des jeweiligen Wahlsystems (vgl. Kapitel 2). Auch in Zeiten sich auflösender Sozialmilieus und einer stark gestiegenen Wechselwahlbereitschaft ist das Wahlverhalten von Bürgern allerdings niemals vollständig determiniert durch kurzfristige Kosten-Nutzen-Abwägungen und Kompetenzvermutungen gegenüber Parteien und deren Kandidaten. Obwohl diese Motive der Wahlentscheidung in den vergangenen Jahrzehnten international stark an Bedeutung gewonnen haben (Dalton 2002)38, besitzen alle Parteiensysteme der konsolidierten liberalen Demokratien bedeutend tiefer reichende gesellschaftliche Wurzeln. Noch immer ist die grundlegende Strukturkonfiguration von Parteiensystemen zu einem beträchtlichen Teil Ausdruck der Anzahl und Stärke gesellschaftlicher Konfliktlinien.39 Diese manifestieren sich auf der Ebene parlamentarisch repräsentierter Parteien nach Maßgabe der institutionellen Wirkungen des Wahlsystems. Auf eine besonders große Zahl parlamentarisch repräsentierter Parteien stößt man in Ländern, in denen es zahlreiche parteibegründende gesellschaftliche Konfliktlinien und wenige institutionelle Barrieren des Wahlsystems gibt, so in Finnland, den Niederlanden oder der Schweiz. —————— 38 Nach wie vor keine überzeugenden empirischen Belege gibt es indes für die populäre These vom signifikant gestiegenen Einfluss einzelner Spitzenkandidaten auf das Stimmverhalten bzw. das Wahlergebnis. Vgl. für die Bundesrepublik vor allem Kaase (1994) und Brettschneider/Gabriel (2002), für eine international vergleichende Perspektive King (2002). 39 Vgl. hierzu die »klassische« Studie von Lipset/Rokkan (1967). Die einst von diesen Autoren identifizierten »cleavages« wie Arbeit versus Kapital, Zentrum versus Peripherie etc. wurden seit den siebziger Jahren zunehmend ergänzt bzw. überlagert von einer neuartigen Werte-Konflikt-Dimension, bei der entweder libertäre oder autoritäre bzw. materialistische oder post-materialistische Werthaltungen dominant sein können (Inglehart 1989; Kitschelt 1994). POLITISCHE PARTEIEN 51 Der nächste Abschnitt beleuchtet einige der zentralen Aspekte der Parteiengeschichte, soweit sie für die Argumentation in den nachfolgenden Teilen der Darstellung von Belang sind. Der daran anschließende Teil wendet sich der programmatisch-organisatorischen Struktur und dem Innenleben der Parteien zu, bevor schließlich die wesentlichen Strukturmerkmale der Parteiensysteme in Deutschland und den anderen konsolidierten liberalen Demokratien in den Blick genommen werden. 3.1 Die Herausbildung politischer Parteien im Gefüge des modernen Verfassungsstaates Die Geschichte politischer Parteien ist älter als die des modernen Verfassungsstaates. Das gilt freilich nur, wenn man von einer wenig spezifischen Vorstellung von Parteien ausgeht wie es sie bereits in der griechischen und römischen Antike und auch während des Mittelalters gab (von Beyme 1978: 677–682). Politische Parteien im eigentlichen Sinne entstanden erst im Kontext der repräsentativen Demokratie, auf der Grundlage von deren Toleranz gegenüber der Meinungsfreiheit und ihren spezifischen Anforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit politischer Eliten. Angesichts des charakteristischen Vorsprungs der Vereinigten Staaten bei der Etablierung eines demokratischen Wahlrechts ist es kein Zufall, dass sich auch die Parteien in den USA um mehrere Jahrzehnte früher als in Europa herausbildeten. Verschiedene Ansätze zur Parteibildung gab es seit Gründung der Republik. Die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts markierten jedoch das erste Jahrzehnt, für das in den Vereinigten Staaten von der Existenz bereits ein Stück weit institutionalisierter Parteien – institutionalisiert in organisatorischer Hinsicht, aber zunehmend auch im Selbstverständnis von Kandidaten und Wählern – gesprochen werden kann (Shade 1981). Kennzeichnend für die Frühgeschichte des Parteiwesens ist nicht zuletzt der Umstand, wie ausgesprochen negativ die Parteien lange Zeit gesehen wurden (Faul 1964). Der am häufigsten formulierte Vorbehalt betraf die (vermeintliche) Gefährdung des Gemeinwohls, wenn nicht gar der gesamten staatlichen Ordnung, durch die Parteien. Auf entsprechende Zeugnisse trifft man in der Mitte des 19. Jahrhunderts selbst noch in Großbritannien, so besonders bei David Hume (Jäger 1971). Erst mit Edmund Burke beginnt dort, zunächst keineswegs als herrschende Mei- 52 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE nung, »die theoretische Anerkennung der Parteien als Grundlage des ›alternative government‹« (von Beyme 1978: 692). Die ausgeprägte Ablehnung von Parteien während der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts in Deutschland speiste sich nicht unwesentlich aus den als bedrohlich wahrgenommenen Entwicklungen im revolutionären und nach-revolutionären Frankreich. Aber unabhängig von diesem frühen Impuls eines »Antiparteienaffekts« konnten sich skeptische Distanz und Kritik gegenüber politischen Parteien in Deutschland bedeutend länger halten als in vielen anderen Ländern. Ursächlich hierfür war nicht zuletzt das hierzulande weit über 1848 hinaus vorherrschende, im Kern »parteienfeindliche« Staats- und Gemeinwohlverständnis (Oberreuter 1990a: 17–19). Aus heutiger Sicht ist es – vor allem mit Blick auf die gängigen sozialwissenschaftlichen Differenzierungen zwischen politischen Parteien und sozialen Bewegungen (vgl. Kapitel 4) – bemerkenswert, dass die Vorstellung von politischen Parteien zunächst keineswegs an das Kriterium einer Organisation geknüpft war. Im Gegenteil verband sich mit dem Begriff Partei »seit dem 18. Jahrhundert in erster Linie die Vorstellung einer Gesinnungsgemeinschaft mit sehr scharfer Ablehnung jeder festen Organisation« (Fenske 1994: 12–13). Verantwortlich für den während des gesamten 18. Jahrhunderts ausgesprochen geringen Organisationsgrad von Parteien waren nicht so sehr obrigkeitliche Bestrebungen zur Verhinderung organisatorischer Gruppenbildung, die es freilich auch gab, sondern vor allem das weitgehend mangelne Bedürfnis nach Organisationsbildung. Die Pressefreiheit als Grundfreiheit rangierte weit vor der Forderung nach Vereinsfreiheit (ebd.: 32–33). Etwas anderes gilt für den Großteil des 19. Jahrhunderts. Die umfangreichen Organisationsverbote, die – im Gegensatz zu der Situation in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien – die politische Realität in vielen Ländern Kontinentaleuropas kennzeichneten, wurden von der jüngeren Forschung zu Recht als eine der Kerndeterminanten der Parteienentwicklung herausgestellt. »[T]he emergence of modern parties was not just a function of changing organizational incentives. It also was influenced by the strength of organizational disincentives: in many places party development was retarded by laws deliberately designed to stifle political opinions and political organizations, particularly those that might threaten the status quo.« (Scarrow 2006: 20; Hervorhebung im Original) Dieser Zusammenhang kennzeichnete auch die Entwicklung in Frankreich, von wo die europäische Geschichte organisierter Parteien mit den Zusammenschlüssen der Jakobiner ab 1792 ihren Ausgang nahm. Viele der POLITISCHE PARTEIEN 53 kurz nach der ersten Revolution installierten restriktiven Bestimmungen überdauerten sogar die Etablierung des demokratischen Regimes von 1871, auch wenn sie nun kaum mehr geltend gemacht wurden. Erst kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert erlangten die französischen Parteien denselben Rechtsstatus wie andere Organisationen des Landes. Gerade die historisch orientierte Parteienforschung hat sich von jeher stark an der unterschiedlichen politisch-ideologischen Grundausrichtung von Parteien orientiert und diese nicht selten zum zentralen Ordnungsprinzip ihrer Betrachtungen erhoben.40 Wollte man die historische Grundtendenz in Europa ohne jegliche weitere Differenzierung in einen Satz zusammenfassen41, so wäre darauf hinzuweisen, dass am Beginn der Konservatismus stand, welcher zunächst durch liberale, später durch sozialistische bzw. sozialdemokratische Parteien politisch herausgefordert wurde. Das bedeutet nun freilich nicht, dass der Konservatismus auch den Anfang der Parteiengeschichte im engeren Sinne markierte. Nur in seltenen Ausnahmefällen, so in Frankreich während der Restauration, waren es die Konservativen, die als erste politische Gruppe organisatorische Gestalt als Partei annahmen. Üblicherweise blieb die frühe Gründung konservativer Parteien hingegen »eine organisatorische Antwort auf die Herausforderung des Liberalismus und des Radikalismus« (von Beyme 1984: 67). Dabei wirkte der zur Partei gewordene Konservatismus in der Regel zurück auf die im Einzelfall höchst unterschiedliche Entwicklung der liberalen Parteien. Nicht minder unterschiedlich verlief die Geschichte der Herausbildung der sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien. In Kontinentaleuropa kam es, verglichen mit der Entwicklung in England, zu einem frühen Auftreten von Arbeiterparteien, weil sich die liberalen Parteien des Kontinents in deutlich geringerem Maße als die englischen Liberalen in der Lage zeigten, die Verfechter umfangreicher Sozialreformen politisch einzubinden bzw. zu absorbieren. Das geringere »Absorbierungspotential« der kon- —————— 40 Dies, obwohl nie bestritten wurde, dass ideologische Motive der Parteigründung in unterschiedlichen politischen und regionalen Kontexten historisch häufig später wirksam wurden als etwa regionale Nachbarschaften von Abgeordneten oder berufsbezogene Aspekte (Duverger 1959: 2–3). 41 Differenzierte Überblicke über unterschiedliche Theorien der Parteienentstehung (institutionelle Theorien, Krisensituationstheorien und Modernisierungstheorien) mit umfangreichen Belegen aus der internationalen Entwicklungsgeschichte politischer Parteien bieten LaPalombara/Weiner (1966: 7–21) und von Beyme (1984: 26–40). 54 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE tinentaleuropäischen Liberalen wiederum hatte etwas mit deren schwächerer Parteiorganisation und insbesondere deren deutlich bescheidenerer politischer Machtbasis zu tun (Friedrich 1953: 499–501). Allerdings erscheint bei näherer Betrachtung der internationalen Entwicklungen weniger die Schwäche der Liberalen als das ausschlaggebende Moment für ein starkes Wachstum der sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien. Entscheidend war offenbar vielmehr, ob sie die klarste Alternative zu der jeweils an der Macht befindlichen Partei darstellten – ganz gleich, ob diese Partei nun konservativ oder liberal war (ebd.: 506). Freilich blieb das Spektrum organisierter Parteien nicht lange auf Konservative, Liberale und Sozialisten bzw. Sozialdemokraten beschränkt. Mit wiederum gravierenden Unterschieden zwischen einzelnen Ländern entstanden auch die historisch jüngeren Parteien, wie christliche oder kommunistische Parteien, als Reaktion auf das politische Agieren der bereits bestehenden Parteiformationen. Während die Gründung der kommunistischen Parteien maßgeblich eine Folge der Konflikte über die Haltung der Sozialisten im Ersten Weltkrieg darstellte, formierten sich christliche Parteien zumeist als defensive Reaktion gegen eine liberale und laizistische Gesetzgebung (von Beyme 1984: 116, 139). Auch die von Maurice Duverger (1959) prominent beschriebenen spezifischen Entstehungsmuster und organisatorischen Charakteristika politischer Parteien weisen einen deutlichen Zusammenhang mit deren politisch-ideologischen Profil auf. Das früheste Grundmuster der Parteienstehung nach Duverger geht von der Existenz politischer Gruppen im Parlament aus, auf die historisch die Entstehung von Wahlkomitees folgt, bevor sich schließlich beide zu politischen Parteien vereinen, welche sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments präsent sind (ebd.: 2). Dass die parlamentarischen Gruppen im Allgemeinen vor dem jeweiligen Wahlkomitee entstanden, wird daraus erklärlich, dass es politische Versammlungen mit darin ansässigen Gruppierungen bereits lange vor der Einführung demokratischer Wahlen gab. Die historisch als erste im Parlament vertretenen Gruppierungen aber waren die Konservativen, später ergänzt um die Liberalen, kurzum: die auf Adel und Bürgertum gestützten politischen Kräfte. Da ihre Entstehung vom Kern der parlamentarischen Gruppe aus erfolgte, welche sich gleichsam nachträglich einen außerparlamentarischen Unterbau schuf, der den neuen Anforderungen der Schritt um Schritt entstehenden Massendemokratie gerecht wurde, blieben sie nach Duverger bis in die jüngere Vergangenheit hinein durch eine faktische Vormachtstellung POLITISCHE PARTEIEN 55 der parlamentarischen Eliten gegenüber der außerparlamentarischen Parteiorganisation geprägt (ebd.: 12–14). Ein anderes, dem soeben beschriebenen genau entgegenlaufendes Entwicklungsmuster beschreibt die historische Entstehung der außerparlamentarisch geborenen Parteien. Zu ihnen gehörten, mit wenigen Ausnahmen42, zunächst die sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien, daneben aber auch christliche Parteien oder Bauernparteien. Ihre organisatorische Keimzelle im engeren Sinne waren Wahlkomitees, die nicht selten auf Betreiben äußerer Kräfte wie Vereinigungen, Diskussionsgesellschaften oder auch Zeitungen gegründet wurden. Die beiden maßgeblichen Hintergrundbedingungen für die Entstehung solcher Wahlkomitees waren die graduelle Ausweitung des Wahlrechts und das zunehmende Streben nach Gleichheit und nach Ablösung der alten Eliten. Analog zu der These über die konservativen und frühen liberalen Parteien geht Duverger davon aus, dass sich die spezifische Genese so entstandener Parteien tief in deren organisatorisch-funktionales Gewissen eingebrannt habe und entsprechend nachwirke (ebd.).43 Die unterschiedlichen hier angerissenen Aspekte der Entwicklungsgeschichte politischer Parteien lassen sich, in spezifischer Ausprägung, auch in der deutschen Geschichte wiederentdecken. Zu den Besonderheiten der deutschen Entwicklung gehörte es – bis über die Reichsgründung hinaus –, dass sich die relevanten Prozesse der Parteigründung nicht auf zentralstaatlicher, sondern auf regionaler Ebene vollzogen. Abgesehen davon kam es aber, wie in anderen Ländern auch, zuerst im Lager der Liberalen zur Begründung einer veritablen Parteiorganisation (etwa Deutsche Fortschrittspartei, 1861), kurz darauf zur Etablierung einer Parteiorganisation der Konservativen (etwa Freikonservative Partei, 1867). Während die Parteibildungsprozesse bei Liberalen und Konservativen in Deutschland, gemessen an den Entwicklungen in anderen Ländern Westeuropas, mit einer gewissen Verspätung einsetzten, gelang die Organisationsbildung auf der Linken auffallend früh. Die aus dem Zusammenschluss des 1863 gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (1869) hervorgehende Sozialdemokratische Partei Deutschlands (1875) wurde geradezu »zum Vorbild einer organisierten Partei im In- und Ausland« (von Beyme 1978: 728). Die internationale Vorreiterrolle der deutschen Sozialdemokratie entsprang einem spezifi- —————— 42 Als wichtigste historische Ausnahme können die französischen Sozialisten gelten (von Beyme 1984: 86). 43 Darauf wird im nächsten Abschnitt zurückzukommen sein. 56 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE schen Geflecht unterschiedlicher Faktoren. Für die frühe Etablierung einer Arbeiterbewegung war, abgesehen von stärker sozioökonomischen Einflüssen, in nicht unerheblichem Maße der ausgesprochene Konservatismus großer Teile des liberalen Bürgertums in Deutschland (sowohl in Fragen der Demokratisierung des Wahlrechts als auch der Parlamentarisierung des Regimes) mitbestimmend. Dies forcierte die Bestrebungen innerhalb der Arbeiterbewegung, sobald wie möglich zu einem selbständigen politischen Akteur zu werden. Einen entscheidenden Impuls für die Begründung der SPD als einer autonomen Massenpartei gab schließlich die im internationalen Vergleich frühe Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts im Norddeutschen Bund und ab 1871 auf der Ebene des Reiches (Lösche 1994: 26–27). Um das Fünfparteiensystem, das Deutschland trotz beträchtlicher Wandlungen unter der Oberfläche im Wesentlichen bis 1933 charakterisierte, zu konstituieren, bedurfte es nach der Etablierung der Konservativen, der Nationalliberalen, der Linksliberalen und der Sozialdemokraten nun nur noch des politischen Katholizismus. Dieser wurde seit der Reichsgründung durch das Zentrum repräsentiert. Im Gegensatz zu einigen anderen Parteien des politischen Katholizismus – wie insbesondere deren Schwesterparteien in Österreich und Belgien – nahm das Zentrum vor allem in Fragen konstitutioneller Freiheit keinen betont konservativen Standpunkt ein. Es wies vielmehr, sowohl auf der programmatischen als auch auf der Wählerebene deutliche Züge einer gemäßigten »Volkspartei« auf (von Beyme 1984: 123; Lösche 1994: 35). Das Parteiensystem, das sich nach der Zäsur von 1933–1945 im westlichen Teil Deutschlands, zunächst unter Lizensierungsauflage durch die Alliierten, entwickelte, trug Züge der Kontinuität und des Neubeginns. Während Sozialdemokraten und Kommunisten der Tradition verpflichtet blieben, gab es im Lager der bürgerlichen Parteien grundlegende Neuerungen (Schmollinger/Staritz 1980; Mintzel 1980). Die bis dahin in zwei Gruppen gespaltenen Liberalen vereinigten sich Ende 1948 zur FDP. Sowohl im Falle der CDU als auch der CSU handelte es sich um Neugründungen, welche freilich unter bewusster Anknüpfung an ältere Traditionen erfolgten, aus denen ein neues, christlich-überkonfessionelles Gepräge erwachsen sollte. POLITISCHE PARTEIEN 57 3.2 Bestimmungsmerkmale politischer Parteien und die Parteien der Bundesrepublik aus der Perspektive der vergleichenden Parteienforschung 3.2.1 Parteifamilien Die Zuordnung von Parteien zu unterschiedlichen »Parteifamilien« ist angesichts des seit den sechziger Jahren beobachteten Strebens zahlreicher Parteien, ihre Unterstützungsbasis über die Grenzen einer ideologischsozialen Kernklientel hinaus auszudehnen und sich zumindest der Tendenz nach in »Volksparteien« oder gar »Allerweltsparteien« (Kirchheimer 1965: 27) zu verwandeln, bedeutend schwieriger geworden. Entsprechende Zugänge gelten jedoch zu Recht weiterhin als sinnvoll (Ware 1996: 45–47)44, besonders für den Vergleich des ideologisch-programmatischen Gepräges und der Machtstrukturen von Parteiensystemen. Zumindest an die wichtigsten Merkmale der unterschiedlichen Parteifamilien45 sei an dieser Stelle erinnert: Liberale Parteien waren historisch auf das Ziel einer Begründung des Verfassungsstaates und des demokratischen Rechtsstaats mit einer starken Betonung individueller Freiheitsrechte hin orientiert. Kaum minder charakteristisch war ihr entschiedenes Eintreten für ein kapitalistisches Wirtschaftssystem. Die früh entwickelte skeptische Haltung Liberaler gegenüber jeder Form von »public ownership« transformierte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer Unterstützung expansiver Privatisierungsprogramme und eines »Rückbaus« des Wohlfahrtstaates. Der traditionellen Betonung liberaler Abwehrrechte gegenüber dem Staat wurde später häufig die Forderung nach einem Ausbau direktdemokratischer Beteiligungsrechte an die Seite gestellt. Die Konservativen betonen bis heute in stärkerem Maße als andere Parteien traditionelle moralische Wertvorstellungen, nicht selten auch die Idee der Nation. Vielen konservativen Parteien ging es jedoch nicht ausschließlich um die Verteidigung der ökonomischen und politischen Interessen ihrer unmittelbaren sozialen Trägerschaft; vielmehr speiste sich ein —————— 44 Darauf weisen unterschiedliche empirische Untersuchungen über die Entwicklung der ideologisch-programmatischen Positionen von politischen Parteien in den konsolidierten liberalen Demokratien hin. Vgl. Laver/Hunt (1992), Huber/ Inglehart (1995), Knutsen (1998). 45 Vgl. hierzu im Detail Delwit (2002, 2003, 2005), Kselman/Buttigieg (2003), Talshir (2002) und Kirchner (1988). 58 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Teil ihrer programmatischen Grundüberzeugungen aus einer Art paternalistischer Verantwortung für außerhalb ihrer Kernklientel angesiedelte Teile der Gesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg, und verstärkt seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, wurde in vielen Ländern das Eintreten für eine neo-liberale Wirtschaftspolitik zu einem zentralen Merkmal der Programmatik konservativer Parteien. Christliche bzw. christdemokratische Parteien als weiteres Mitglied der Gruppe bürgerlicher Parteien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Programmatik von Konservativen und Liberalen durch den expliziten Bezug auf christliche Werte. Personalismus, Solidarität und Subsidiarität bilden zentrale Momente des christdemokratischen Gesellschaftsmodells. Kennzeichnend für ihr politisches Weltbild ist ferner der hohe Stellenwert der Familie. Das Konzept der Nation und das Prinzip des »law and order« besitzen bei den meisten christdemokratischen Parteien geringere Bedeutung als bei konservativen Gruppierungen. Andererseits werden individuelle Bürgerrechte deutlich weniger stark betont als bei den Liberalen. In wirtschaftspolitischen Fragen vertreten christdemokratische Parteien innerhalb der Gruppe bürgerlicher Parteien die mit Abstand »großzügigsten« Konzepte wohlfahrtsstaatlicher Politik. Eine zentrale Komponente des politischen Strebens der frühen sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien bildete deren Eintreten für die Demokratisierung des Wahlrechts und den Aufbau eines gegenüber konservativ/liberalen Konzeptionen deutlich stärker auf das Prinzip der Gleichheit gründenden Staats- und Gesellschaftsmodells. Obwohl die Grundlagen des Wohlfahrtsstaates in einigen Ländern, unter ihnen Deutschland, nicht von der Sozialdemokratie, sondern von den Konservativen gelegt wurden, gelten sozialdemokratische Parteien bis heute, und überwiegend zu Recht, als der natürliche Anwalt eines hoch entwickelten Sozialstaats. Das ursprünglich (wenn auch selten mit letzter Konsequenz) vertretene Ziel einer weitreichenden Vergemeinschaftung privater Güter verschwand ab der Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend aus den Programmen sozialdemokratischer Parteien. Im Zuge fortschreitender gesellschaftlicher Modernisierung dehnten viele sozialdemokratische Parteien ihr traditionelles Streben nach Gleichheit stärker als die meisten bürgerlichen Parteien auf den Bereich »gender equality« aus. Grün-alternative Parteien entstanden im Zuge der Herausbildung eines neuen »post-materialistischen« Wertekanons, dessen leidenschaftlichkämpferische Unterstützung sie in Gegnerschaft sowohl zu den bürgerli- POLITISCHE PARTEIEN 59 chen als auch zu den sozialdemokratischen Parteien stellte. Zu den zentralen programmatischen Forderungen grün-alternativer Parteien zählen insbesondere die Unterordnung der Ökonomie unter die Ökologie, die Entwicklung umweltgerechter Lösungen politischer und ökonomischer Probleme, die Förderung alternativer Energien, die Stärkung direktdemokratischer Beteiligungsrechte und die radikale Verwirklichung geschlechterbezogener Gleichberechtigung. Hinzu kam vor allem in der Frühphase der grün-alternativen Bewegung das Eintreten für gewaltfreien Widerstand, pazifistische Konzeptionen internationaler Politik und militärische Abrüstung. Die Bundesrepublik gehört zu jenen Systemen, in denen die beiden »major players« dem Idealtypus der »Volkspartei« in weit überdurchschnittlichem Ausmaß entsprachen bzw. noch immer entsprechen.46 Nichtsdestotrotz sind CDU/CSU und SPD zugleich eindeutig Mitglieder der Familie der christdemokratischen bzw. sozialdemokratischen Parteien.47 Ein solches Gegenüber einer christdemokratischen und einer sozialdemokratischen Partei als Hauptakteuren des Parteiensystems ist keineswegs selbstverständlich: Christdemokratische Parteien spielten eine vergleichbare Rolle wie in der Bundesrepublik nur in wenigen westeuropäischen Ländern, darunter insbesondere Italien (bis 1994), Österreich, Belgien und die Niederlande. Vor allem in den meisten angelsächsischen Ländern (mit Ausnahme Irlands), aber auch in Japan, entspricht der Position der Christdemokraten die einer »echten« konservativen Partei mit üblicherweise deutlich restriktiveren Vorstellungen insbesondere bezüglich der konkreten Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates. Auch die Existenz einer relativ starken Sozialdemokratie in der Bundesrepublik ist keineswegs für sämtliche der liberalen Demokratien typisch. In Kanada und den USA etwa bildet als Gegenüber des konservativen Pols des Parteiensystems keine sozialdemokratische, sondern eine liberale Partei. Unter den größeren angelsächsischen Ländern fällt Großbritannien aus dem Rahmen, insofern es —————— 46 Maßgeblich mitverantwortlich dafür war neben günstigen Voraussetzungen auf der Ebene der politischen Kultur maßgeblich der spezifische sozioökonomische Kontext: Zum einen waren traditionelle soziale Grenzen durch die Erfahrung des Drittes Reiches in erheblichem Maße erodiert; zum anderen wurde die klassenbezogene Konfliktlinie durch den Katholizismus modifiziert, wovon konkret die Union bei der Werbung von Anhängern aus dem Arbeitermilieu profitierte. Vgl. Smith (1982) und Padgett (2000a). 47 Vgl. mit hierzu mit zahlreichen weiteren Nachweisen Bösch (2002) und Walter (2002). 60 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE der dortigen Arbeiterbewegung Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts schließlich gelang, die Liberalen aus der Rolle einer der beiden maßgeblichen Parteien des Systems zu verdrängen und durch die Labour Party zu ersetzen. Allerdings gibt es unter den konsolidierten liberalen Demokratien auch solche, wie insbesondere die skandinavischen Länder und Österreich, in denen die Sozialdemokratie im Durchschnitt der Jahrzehnte seit 1945 noch eine deutlich stärkere Position innehatte als hierzulande. Die Parteifamilien der Liberalen und Grün-Alternativen werden in der Bundesrepublik durch die FDP und Bündnis 90/Die Grünen repräsentiert. Die 1948 gegründete FDP gehört zu jenen liberalen Parteien, die die unterschiedlichen Strömungen des Liberalismus stets in sich vereinte, freilich um den Preis zum Teil heftiger Auseinandersetzungen über den einzuschlagenden politisch-programmatischen Kurs und die damit verbundenen Koalitionsoptionen (Dittberner 2005). Diese nach innen dynamische, aber im Prinzip unumstrittene Einheit bzw. Konzentration des parteipolitisch organisatorischen Liberalismus in der Bundesrepublik bildet einen Gegensatz zu der internen Fragmentierung des liberalen Lagers in einigen anderen Ländern wie Dänemark, Italien, Frankreich, den Niederlanden oder der Schweiz, wo traditionell mehrere (links- und rechts)liberale Parteien nebeneinander existierten und auch parlamentarisch repräsentiert waren. Die deutschen Grünen wurden zu einer der erfolgreichsten Parteien ihrer Art (Müller-Rommel/Poguntke 2002). Die vor allem in der Frühphase heftigen Auseinandersetzungen zwischen »Fundis» und »Realos« haben dem im internationalen Vergleich großen Zuspruch der Partei durch die Wähler keinen Abbruch getan. Nur die grünen Parteien weniger Länder erzielten langfristig ähnlich gute oder bessere Ergebnisse als die Grünen in der Bundesrepublik (darunter vor allem deren Schwesterparteien in den Benelux-Staaten). Selbst die Regierungsbeteiligung von Bündnis 90/Die Grünen auf der zentralstaatlichen Ebene während der Jahre 1998 bis 2005, die vielen anderen Mitgliedern der grün-alternativen Parteifamilie vorenthalten blieb, produzierte bemerkenswert geringe elektorale Kosten – jedenfalls auf Bundesebene, im Gegensatz zum überwiegend miserablen Abschneiden der Grünen auf Landesebene. Mit Ausnahme der frühen Nachkriegszeit gab es in der alten Bundesrepublik, zumindest im Bund, keinen parlamentarisch repräsentierten Vertreter aus der Familie der kommunistischen Parteien. Die im 1. und 2. Bundestag noch vertretene KPD wurde 1956 verboten, wäre aber vermutlich auch ohne diese Maßnahme über kurz oder lang aus dem Bundestag POLITISCHE PARTEIEN 61 ausgeschieden. Die DKP und andere kleinere Parteien der extremen Linken blieben weit davon entfernt, parlamentarischen Repräsentationsstatus auf Bundesebene zu erringen – in besonders deutlichem Gegensatz zu deren mächtigen Schwesterparteien in den romanischen Ländern Südwesteuropas. Erst die deutsche Vereinigung ermöglichte es in Gestalt der PDS einer Partei aus der sozialistisch/kommunistischen Tradition, in den gesamtdeutschen Bundestag einzuziehen.48 Mit dem relativen Bedeutungsgewinn eines Akteurs aus dieser Parteifamilie hat die Bundesrepublik Anteil an einem Trend, der – im Gegensatz zu der Situation in der Mehrzahl der konsolidierten westlichen Demokratien – auch die Entwicklung des Parteienwettbewerbs in Norwegen, Schweden und den Niederlanden kennzeichnet (Stöss/Haas/Niedermayer 2006: 28). Wie in den meisten anderen konsolidierten liberalen Demokratien – mit der wichtigsten Ausnahme Italien, wo der faschistische »Movimento Sociale Italiano« nach 1945 dauerhaft in der italienischen Abgeordnetenkammer vertreten war und nach seiner Umbenennung in »Alleanza Nazionale« 1994 sogar den Sprung in den Kreis der Regierungsparteien schaffte – gab es in der Bundesrepublik keine auf Bundesebene parlamentarisch repräsentierte Partei, die eindeutig dem rechtsradikalen bzw. rechtsextremen Spektrum zuzurechnen war. Am stärksten in diese Nähe gelangte die NPD bei der Bundestagswahl 1969. Bereits 1952 verboten wurde die (bei Wahlen ohnehin nur mäßig erfolgreiche) rechtsextreme Sozialistische Reichspartei (SRP); lediglich zu regionalen Wahlerfolgen gelangten später gegründete Parteien wie »Die Republikaner« und die DVU. Letztere wiesen bzw. weisen einen stark rechtspopulistischen Zug auf und können daher mit Parteien wie dem französischen »Front National«, der italienischen »Lega Nord« oder der österreichischen FPÖ (nach 1985) verglichen werden. Ein genauerer Vergleich der rechtspopulistischen Parteien in Deutschland mit diesen (und anderen) Parteien verdeutlicht jedoch nicht nur Unterschiede im jeweiligen programmatisch-organisatorischen Profil, sondern insbesondere solche auf der Ebene elektoralen Zuspruchs. Im internationalen Vergleich betrachtet blieb die Unterstützung rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in der Bundesrepublik alles in allem sehr bescheiden (Betz 1998; Decker 2000; Ignazi 2003). Als ursächlich dafür können so- —————— 48 Inwieweit die PDS, die sich 2005 in »Linkspartei« umtaufte, als kommunistisch, post-kommunistisch oder aber bereits als vollständig demokratisierte Linkspartei gelten kann, bleibt auch in der jüngeren Literatur umstritten (Lang 2003; Neu 2004). 62 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE wohl das positive Leistungsprofil des bestehenden Parteiensystems mit seinem breiten ideologisch-programmatischen Spektrum als auch das wenig überzeugende programmatische und personelle Angebot von Akteuren des rechtsextremen Spektrums gelten (Stöss 2006: 557). 3.2.2 Das Innenleben der Parteiorganisationen Die Beschäftigung mit der Organisationsstruktur politischer Parteien war von jeher stark auf die Erfassung historischer Wandlungsprozesse hin ausgerichtet. Zu bedeutenden Schüben der Parteienforschung kam es jeweils im Zuge der Entdeckung eines neuen Parteientyps. Das gilt für die Identifikation der »Massen(integrations)parteien« durch Maurice Duverger (1959) und Sigmund Neumann (1956) ebenso wie für die »Entdeckung« der »Electoral-Professional Party« durch Angelo Panebianco (1988) oder der »Kartellpartei« durch Richard Katz und Peter Mair (1995).49 Ein Großteil der jeweils nachfolgenden Forschung war entweder damit beschäftigt, im Rahmen von Fallstudien die Anwendbarkeit bzw. empirische Passgenauigkeit des Modells auf einzelne Parteien zu untersuchen oder aber die von seinen »Erfindern« formulierten Thesen bezüglich der historischen Entwicklungsdimension kritisch zu überprüfen. Gerade weil es bei den international einflussreichsten Arbeiten dieser Richtung darum ging, länderübergreifend gültige Trends der Parteienentwicklung zu identifizieren, blieb deren Bedeutung für die vergleichende Differenzierung von Parteien unterschiedlicher Länder begrenzt.50 Das wohl auffälligste länderübergreifende Kennzeichen der jüngeren Entwicklungsgeschichte von Parteiorganisationen in den konsolidierten liberalen Demokratien bildet der signifikante Rückgang der Mitgliederzah- —————— 49 Freilich ging es bei den international maßgeblichen Beiträgen nicht ausschließlich (und nicht einmal immer primär) um organisatorische Aspekte. Charakteristisch war vielmehr die in der jüngeren Literatur kritisierte, nicht selten unreflektierte Vermischung unterschiedlicher – nämlich organisatorischer, programmatischer und funktionaler – Klassifikationskriterien (Gunther/Diamond 2003: 170). Bei Gunther und Diamond findet sich auch ein eigener organisationsbezogener Typologisierungsvorschlag, dessen Grundtypen lauten: »elite-based parties«, »massbased parties«, »ethnicity-based parties«, »electoralist parties« und »movement parties« (ebd.: 172). 50 Eine (vergleichende) Diskussion der unterschiedlichen Modelle ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu leisten. Vgl. als einschlägigen Überblick Jun (2004). POLITISCHE PARTEIEN 63 len.51 Er kennzeichnet auch die Entwicklung der Parteien in der Bundesrepublik, obwohl die deutschen Parteien – international vergleichenden Studien zufolge (Mair/van Biezen 2001) – schwerlich zu den Extrembeispielen westeuropäischer »Mitgliedermisere« zählen. Letzteres gilt eher für Länder wie Frankreich, Italien oder Großbritannien. Insgesamt behauptet die Bundesrepublik hinsichtlich der durchschnittlichen Mitgliederzahlen ihrer Parteien ihren angestammten Platz im unteren Drittel westeuropäischer Demokratien, weit hinter Ländern wie Österreich oder Finnland, aber vor Frankreich oder Großbritannien. Speziellere Studien zeigen, dass sich die Dynamik des Mitgliederschwunds in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich abgeschwächt hat (Niedermayer 2006); entgegen populärer Vermutungen ist es auch keineswegs zu einer vollständigen sozioökonomischen Nivellierung bzw. Konvergenz der Parteimitgliedschaften gekommen (Biehl 2006: 291). Insgesamt verdienen die Parteien der Bundesrepublik, trotz der Veränderungstendenzen der vergangenen Jahrzehnte, heute in höherem Maße als die Parteien manch anderer Länder aus der Gruppe der konsolidierten liberalen Demokratien das Prädikat »Mitgliederpartei«. Dabei bleibt ungewiss, welchen Wert diese Eigenschaft im Kontext veränderter Rahmenbedingungen des Parteienwettbewerbs besitzt. Zwar gelten Mitglieder aus Sicht der Parteieliten weiterhin verbreitet als »Garanten für die gesellschaftliche Beziehungsfähigkeit der Parteien« (Wiesendahl 2006: 173–174). Kaum zu bestreiten ist jedoch, dass Massenmitgliedschaften von Parteien teils als Ergebnis großzügiger staatlicher Parteienfinanzierung (vgl. Abschnitt 3.4), teils als Folge grundlegend veränderter Bedingungen politischer Mobilisierung in der »Mediengesellschaft« (vgl. Kapitel 5) eine Funktionseinbuße erlitten haben. Auch weiterhin von Bedeutung erscheint eine gewisse Mitgliederdichte von Parteien nicht zuletzt mit Blick auf innerparteiliche Selektions- und Rekrutierungsprozesse. Für die gelegentlich beschworene Gefahr, dass mitgliederarme Parteien mit dünner —————— 51 Zu den Kerndeterminanten der Entwicklung in Westeuropa zählte seit den siebziger Jahren die Entstehung und Etablierung eines alternativen unkonventionellen Beteiligungsmarktes, das zum Teil skandalöse Fehlverhalten von Parteieliten in öffentlichen Ämtern und der daraus resultierende Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Parteien sowie schließlich die wachsende »weltanschauliche Beziehungsschwäche« der Parteien, welche sich in großer Zahl gezielt auf die Mitte des Wählermarktes hin bewegten und dabei zunehmend ihre ideologisch-programmatische Kernidentität einbüßten (Wiesendahl 2006: 97–100). 64 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Personaldecke zur leichten Beute zielstrebiger Karrieristen werden könnten (Zoll 1997: 34), gibt es hierzulande bislang kaum Anzeichen, aber das könnte sich ändern. Neben den unterschiedlichen Aspekten der Mitgliederentwicklung von Parteien hat die jüngere internationale Parteienforschung vor allem die Frage beschäftigt, ob es einen allgemeinen Trend hin zur Zentralisierung von Entscheidungsmacht an der Spitze von Parteienorganisationen gibt. Die Konzentration von politischer Macht an der Parteispitze bildet eine zentrale Komponente des außerordentlich einflussreichen Modells der »Kartellpartei« von Richard Katz und Peter Mair (1995: 19–20). Im Gegensatz zu vielen anderen Aspekten der »Kartellparteien«-These wurde die behauptete Zentralisierungstendenz auch in kritischen Auseinandersetzungen mit den Bewertungen von Katz und Mair nicht prinzipiell in Frage gestellt (vgl. Helms 2001a). Eine wichtige Quelle entsprechender Zentralisierungsdynamiken bilden gezielte organisatorische Reformen. Aus Sicht von Vertretern der »Kartellparteien«-These steht ein Ausbau der Beteiligungsrechte von Parteimitgliedern einer faktischen Zentralisierung von Entscheidungsmacht an der Parteispitze nicht zwingend entgegen. Vielmehr könne durch entsprechende Schritte und einen geschickten Einsatz »plebiszitärer« Instrumente die Parteiführung neue Spielräume insbesondere gegenüber der mittleren Funktionärsebene und den lokalen Parteigliederungen hinzu gewinnen. Zusätzlich befördert wird eine Zentralisierung von politischer Entscheidungsmacht an der Parteispitze nach verbreiteter Einschätzung durch die direkten und indirekten Effekte der medialen Personalisierung von Politik. Gemessen an der Hochkarätigkeit theoretischer Debatten gibt es wenige handfeste empirische Belege für die Richtigkeit der behaupteten Entwicklungstendenz. Zum internationalen »Lehrbeispiel« einer konsequenten Modernisierungs- bzw. Zentralisierungsstrategie wurde die Organisationsreform der britischen Labour Party zwischen Mitte der achtziger und Ende der neunziger Jahre (Seyd 1998). Nicht wirklich vergleichbar ist der ähnlich prominente Fall der italienischen »Forza Italia«. Mit Blick auf diese kann weder von einer evolutionären noch von einer revolutionären Zentralisierung politischer Entscheidungsmacht gesprochen werden. Vielmehr wurde die Parteiorganisation (soweit es eine solche bei »Forza Italia« im klassischen Sinne überhaupt gibt) gleichsam um deren politischen Kopf, Silvio Berlusconi, »herumgebaut« (Poli 2002; Grasmück 2005). POLITISCHE PARTEIEN 65 Die Entwicklung der Parteien der Bundesrepublik ist in dieser Hinsicht nicht eindeutig. Formale organisatorische Zentralisierungsschübe blieben nahezu vollständig aus. Die dominante Entwicklungstendenz auf der Ebene von Organisationsreformen seit den neunziger Jahren verlief bei praktisch allen im Bundestag vertretenen Parteien52 in Richtung einer formalen Stärkung von Mitgliedern im innerparteilichen Willensbildungsund Entscheidungsprozess (Kießling 2001; Poguntke 2002), womit sich die deutschen Parteien mit einer gewissen Verzögerung dem allgemeinen Trend westeuropäischer Parteientwicklung anschlossen. Die praktischen Auswirkungen der unterschiedlichen Reformmaßnahmen, wie die Einführung von Mitgliederplebisziten über Sach- und Personalfragen, blieben freilich denkbar bescheiden (Wiesendahl 2006: 157, 159). Eine wohl auch nur von den wenigsten erwartete »Fundamentaldemokratisierung« innerparteilicher Willensbildung blieb aus. Andererseits gibt es praktisch keine Anzeichen für eine systematische Ausbeutung der neu geschaffenen Strukturen durch eine auf »plebiszitäre Führung« setzende Parteispitze. Aus einer breiteren historischen Perspektive betrachtet, die auch den politisch-kulturellen Handlungskorridor von Akteuren berücksichtigt, scheint es eher, als wenn sich die strukturellen Bedingungen »präsidialer« Parteiführung verschlechtert hätten (Lösche 2005). Zumindest ein genereller Trend in Richtung eines Machtzuwachses in den Händen der Parteivorsitzenden ist nicht erkennbar. Die eindeutigsten Beispiele für besonders machtvolle Parteiführer finden sich in den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Dabei profitierten die Betreffenden nicht unerheblich von der vergleichsweise anspruchslosen Partizipationserwartung der Parteibasis und der »gouvernementalistisch« geprägten politischen Kultur jener Zeit. Jüngere Erfahrungen der Amtsführung von Parteivorsitzenden blieben zumeist deutlich ambivalenter. Paradigmatischen Charakter erreichte in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten allein die einzigartige »Regentschaft« Helmut Kohls über die CDU. Sie wurde auf anspruchsvoller theoretischer Grundlage mit dem Prädikat des »uncharismatic personalism« belegt (Ansell/Fish 1999). Entscheidend für Kohls Machtposition war ein über Jahrzehnte lang gewobenes, über sämtliche regionale und funktionale Ebenen der Partei hinweg gespanntes Netz persönlicher Kontakte und Loyalitätsverhältnisse, auf das schon sein unmit- —————— 52 Eine Ausnahme bildeten die Grünen, die – von anderen Voraussetzungen ausgehend – die zunächst extrem basisdemokratisch geprägte Parteiorganisation schrittweise stärker am Kriterium der Durchschlagskraft der Partei ausrichteten. 66 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE telbarer Nachfolger und langjähriger »Ziehsohn», Wolfgang Schäuble, praktisch keinen Zugriff besaß. Auch die jüngste Entwicklungsgeschichte der großen Volksparteien – unter ihren Vorsitzenden Müntefering, Platzeck und Beck (SPD) bzw. Merkel (CDU) – weist keineswegs eindeutig in Richtung einer strukturellen Stärkung der Parteispitze.53 Dass der innerparteilichen Machtkumulation beim jeweiligen Bundesvorsitzenden hierzulande offensichtliche Grenzen gesetzt sind, hat viel mit einem weiterem Strukturmerkmal der deutschen Parteien zu tun, welches aus international vergleichender Perspektive besehen zwar nicht einzigartig ist, aber gleichwohl zu den strukturellen Besonderheiten gezählt werden kann. Gemeint ist der stark föderativ geprägte Charakter der Parteiorganisationen in der Bundesrepublik, ein gleichsam selbstverständlicher institutioneller Reflex der föderativen Staatsordnung.54 Der organisatorische Aufbau aller etablierten Parteien in der Bundesrepublik folgt dem staatlichen Aufbau der Bundesrepublik (Niclauß 2002: 148–163). Am deutlichsten ausgebildet ist der föderalistische Zug traditionell bei der CDU. Historisch war die starke Stellung vor allem der Landesparteien und ihrer Vorsitzenden gegenüber der Bundespartei entscheidend in der weitgehenden Nichtexistenz einer voll ausgebauten Parteiorganisation auf Bundesebene begründet. Auch die nach dem Wechsel in die Opposition ab 1969 »nachgeholte Parteigründung« führte jedoch kaum zu einer Konzentration von Macht und Ressourcen bei der Bundespartei, sondern eher zu einer Intensivierung innerparteilicher Koordination und Verflechtung (Schmid 1990: 156–158). Vor allem die jüngeren Wandlungen des bundesstaatlichen Entscheidungssystems (vgl. Kapitel 8) sind dafür verantwortlich, dass das politische Gewicht der Landesparteien, und besonders der Ministerpräsidenten, in den vergangenen Jahren – keineswegs ausschließlich in den Reihen der Union – sogar noch zugenommen hat (Schneider 2001; Detterbeck/ Renzsch 2002). Es gilt jedoch, die Maßstäbe zu wahren: Nicht nur an ame- —————— 53 Vgl. zum thematischen Gesamtkontext politische Führung innerhalb der Parteien auch den Band von Forkmann und Schlieben (2005). 54 Einigen Autoren zufolge besteht der entscheidende Dezentralisierungseffekt des Föderalismus sogar weniger in der Aufteilung legislativer und administrativer Kompetenzen zwischen unterschiedlichen Ebenen, als vielmehr in dem nachhaltig machtdistributiven Effekt föderativer Strukturen auf die politischen Parteien. Vgl. Truman (1955). POLITISCHE PARTEIEN 67 rikanischen Standards55 gemessen sind die deutschen Parteien nach wie vor durch ein insgesamt hohes Maß an institutioneller und funktionaler Integration und Zentralisierung gekennzeichnet. Auch in der Gruppe der parlamentarischen Bundesstaaten finden sich Länder, deren Parteien ungleich stärker durch Anzeichen von Regionalisierung und vertikaler Fragmentierung gekennzeichnet sind als die Parteien in der Bundesrepublik (Renzsch 2001). 3.2.3 Parteien und Fraktionen Auffallend stark im Zeichen der Integration steht eine andere Dimension der internen Machtstruktur der Parteien in der Bundesrepublik: das Verhältnis zwischen Parteien (bzw. Parteiorganisationen) und Fraktionen. Die Konstruktion einer länderbezogenen Typologie, welche dieses Charakteristikum des Verhältnisses zwischen Parteien und Fraktionen in Deutschland greifbar macht, wird in doppelter Hinsicht erschwert. Zum einen durch die beträchtlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien eines Systems; zum anderen durch die ausgeprägte historische Dynamik, dem diese Komponente »innerparteilicher« Machtstruktur im weiteren Sinne ausgesetzt war. Gemäß der einflussreichen, am Beginn des Kapitels umrissenen These Duvergers (1959: 12–14) wird die interne Machtstruktur des Verhältnisses zwischen der Parteiorganisation und dem parlamentarisch repräsentierten Teil der Partei (Fraktion) maßgeblich von der jeweiligen Evolutionsgeschichte politischer Parteien geprägt. Danach liegt das machtpolitische Zentrum bürgerlicher Parteien eindeutig in der parlamentarischen Partei bzw. der Fraktion, dasjenige sozialistischer bzw. sozialdemokratischer Parteien hingegen eher innerhalb der Parteiorganisation. In international vergleichenden Arbeiten wurde wenig empirische Evidenz für die (fort- —————— 55 Zum Standardrepertoire der Aussagen über das amerikanische Parteiwesen gehört die (freilich zuspitzende) Feststellung, dass es ungeachtet der Persistenz des Zweiparteiensystems auf Bundesebene in den Vereinigten Staaten ebenso viele unterschiedliche Ausprägungen der Republikaner und Demokraten wie amerikanische Einzelstaaten gäbe und die beiden Bundesparteien lediglich den Charakter von »Dachverbänden« besäßen. Tatsächlich handelte es sich bei den nationalen Organisationen der Demokraten und Republikaner bis in die siebziger Jahre hinein auch in rechtlicher Hinsicht lediglich um konföderative Strukturen. Vgl. statt vieler Epstein (1986) und Mayhew (1986). 68 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE währende) Richtigkeit dieser These gefunden (Helms 1999a). Mit wenigen Ausnahmen ist es über die Jahrzehnte hinweg zu einem weitreichenden Annäherungsprozess bezüglich der grundlegenden innerparteilichen Machtstruktur bürgerlicher und sozialdemokratisch/sozialistischer Parteien gekommen. Ausnahmen von der Regel finden sich noch am ehesten in Skandinavien und den Niederlanden, wobei einschlägige Unterschiede auch in diesen Ländern vor allem die Ebene von Parteistatuten und weniger die Praxis der Parteipolitik kennzeichnen. Stärker ausgeprägt sind entsprechende Unterschiede zwischen bürgerlichen und sozialdemokratisch/sozialistischen Parteien einerseits und grün-alternativen Parteien andererseits. Letztere weisen tatsächlich verbreitet »typisch genetische« Merkmale auf, insofern bei ihnen der Idee außerparlamentarisch verankerter »Graswurzel-Demokratie« und dem »Primat der Bewegung« gegenüber deren parlamentarischen Vertretern in der Regel ein besonderer Stellenwert zuerkannt wird. Auch für die Grünen gilt jedoch, dass entstehungsgeschichtlich bedingte Strukturmerkmale wie diese im Zuge fortschreitender Professionalisierung, gemessen am status quo ante, zum Teil bereits beträchtlich an Profil eingebüßt haben (Burchell 2002). Vollständig andere – und dabei zumeist gravierend undemokratische – innerorganisatorische Machtstrukturen wiederum weist die Mehrzahl der seit den achtziger Jahren zahlreich entstandenen rechtspopulistischen Parteien auf. Sie sind nicht selten ganz auf eine einzelne charismatische Persönlichkeit hin ausgerichtet sind und können von daher im Einzelfall zutreffend als »Persönlichkeitspartei« (Seißelberg 1994) beschrieben werden. Zusätzlich zu diesen Strukturunterschieden zwischen Parteien unterschiedlichen Typs ist das Verhältnis zwischen Parteiorganisationen und Fraktionen durch spezifische historische und die Grenzen einzelner Länder überschreitende Entwicklungsdynamiken gekennzeichnet. Vom Beginn der sechziger Jahre an bis in die frühen achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein kam es in vielen Ländern zu einer signifikanten Aufwertung der Machtposition der Parteiorganisationen gegenüber den Fraktionen. Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen die Tendenz zur Professionalisierung der Parteieliten, die Ausweitung der Funktionsanforderungen der Parteien, der Ausbau staatlicher Finanzhilfen an die Parteiorganisationen, die Einführung unterschiedlicher Komponenten innerparteilicher Demokratie und der Machtzuwachs von Regierungschefs (von Beyme 1984: 386– 389). In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre setzte jedoch vielerorts ein gegenläufiger Trend ein, der nun umgekehrt die »innerparteiliche« Macht POLITISCHE PARTEIEN 69 der Fraktionen stärkte. In vielen Ländern verbesserte sich die finanzielle Situation der Fraktionen erheblich durch neue Formen der Parteienfinanzierung. Ferner wurde die politische Arbeit der Fraktionen als Ergebnis von Parlamentsreformen – darunter sowohl Reformen der parlamentarischen Geschäftsordnungen als auch solche, die den Ausbau der Mitarbeiterstäbe der Fraktionen betrafen – deutlich effizienter. Schließlich schwächte die um sich greifende Tendenz zur Entideologisierung des Parteienwettbewerbs, der Sieg des Pragmatismus über die ideologische Konfrontation, die Stellung der Parteiorganisationen, woraus wiederum ein relativer Machtgewinn der Fraktionen resultierte (Heidar/Koole 2000). Ungeachtet dieser länderübergreifend zu beobachtenden Entwicklungstrends lassen sich unterschiedliche Grundmuster im Verhältnis zwischen Parteiorganisationen und Fraktionen auch auf der Ebene ganzer Systeme bzw. Länder erkennen. Unterschieden wurden Systeme mit ausgeprägter Fraktionsdominanz (wie Großbritannien), mit Parteidominanz (wie Frankreich), mit Faktionsdominanz (wie Japan), ferner solche mit weitreichender funktionaler Autonomie (wie die Vereinigten Staaten und die Schweiz) sowie schließlich solche mit ausgeprägt integrativer Struktur (Helms 2000: 108–116). Die mit Abstand größte Zahl an Ländern aus der Gruppe der konsolidierten liberalen Demokratien fällt entweder in die Kategorie fraktionsdominierter Machtstrukturen oder in jene des integrativen Typs. Für die Gruppe der Systeme mit integrativer Struktur kann die Bundesrepublik als ein paradigmatischer Fall gelten. Bereits in den fünfziger Jahren konstatierte Rudolf Wildenmann (1954: 154) ein Ausmaß an personeller Verflechtung zwischen Partei- und Fraktionsführung, das es überhaupt nur in Ausnahmefällen sinnvoll erscheinen lasse, von einer Beziehung zwischen beiden Einheiten zu sprechen. Entsprechende Diagnosen wurden in der jüngeren Literatur bekräftigt (Herzog 1997; Schüttemeyer 1999). Auf der Ebene der Spitzenrepräsentanten der Parteien erreichte die Tendenz zur Verflechtung zwischen Parteiorganisation und Fraktion ihren historischen Höhepunkt im weiteren zeitlichen Umfeld der Bundestagswahl 2005: Zwischen Anfang 2004 und Mitte 2006 gab es bei jedem der drei »Altakteure« des deutschen Parteiensystems (CDU, SPD und FDP) eine Phase, in der das Amt des Partei- und Fraktionsvorsitzenden in den Händen einer Persönlichkeit (Merkel, Müntefering, Westerwelle) vereint war.56 Praktisch von Beginn an zu den Manifestatio- —————— 56 Entsprechende Personalunionen gab es freilich bereits früher, jedoch nie für alle drei Parteien im Rahmen eines Zeitfensters von nur zwei Jahren. 70 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE nen einer engen Verknüpfung der Partei- und Fraktionseliten gehörte die Struktur innerparteilicher Entscheidungsprozesse über die Kanzlerkandidaturen von Union und SPD (Schüttemeyer 1998: 113–247). Nicht zuletzt aber die (mit Unterbrechungen) seit dem Ausgang der fünfziger Jahre betriebene Praxis informeller Koalitionsgespräche am Schnittpunkt zwischen Kernexekutive, Regierungsparteien und Mehrheitsfraktionen (vgl. Kapitel 7) trug auf seine Weise dazu bei, die funktionale Integration zwischen den Partei- und Fraktionseliten der an der Regierung beteiligten Gruppen zu befördern und zu befestigen. 3.3 Das Parteiensystem der Bundesrepublik aus der Sicht der vergleichenden Parteiensystemforschung In frühen Beiträgen der Parteiensystemforschung wurde vor allem, wenn nicht gar ausschließlich, auf die bloße Anzahl der Parteien abgehoben. Erst später wurden auch die Größenverhältnisse zwischen den zu einem System gehörenden Parteien, der jeweilige Fragmentierungsgrad des Parteiensystems und das in ihm vorherrschende Ausmaß an Symmetrie bzw. Asymmetrie berücksichtigt. Der Fragmentierungsgrad eines Parteiensystems bemisst sich nach der Anzahl der »effektiven Parteien« innerhalb eines Systems.57 Dabei gilt: Je ungleicher das Machtverhältnis zwischen den existierenden Parteien, desto geringer die effektive im Verhältnis zur realen Anzahl von Parteien. Im Gegensatz zum Fragmentierungsgrad ist das jeweilige Ausmaß an Symmetrie bzw. Asymmetrie ausschließlich auf die Stärkeverhältnisse zwischen den beiden größten Parteien nach Stimmen bezogen.58 Veränderungen dieser Größenrelationen werden unter den Begriff der Volatilität gefasst; je umfangreicher die Veränderungen, desto —————— 57 Die Anzahl der »effektiven Parteien« ergibt sich, gemäß des einflussreichen Operationalisierungsvorschlags von Laakso/Taagepera (1979), aus dem Kehrwert der Summe der quadrierten Stimmenanteile aller Parteien. 58 Wie gelegentlich angeregt wurde (Jesse 2006: 30), erscheint es jedoch in der Tat sinnvoll, zumindest am Rande zu berücksichtigen, über welche konkreten Koalitionsoptionen die großen Parteien eines Systems im Einzelfall verfügen. Andernfalls kann es zu Bewertungen kommen, nach denen die formal dominante Partei sich gleichwohl de facto in einer strukturell schwächeren Position befindet als die nach Stimmen und Mandaten »zweite Partei« des Systems. POLITISCHE PARTEIEN 71 höher die Volatilität. Ein weiteres – inhaltliches – Klassifikationskriterium bezieht sich auf den jeweiligen Polarisierungsgrad des Parteiensystems, welcher sich nach der ideologischen Distanz zwischen den Parteien eines Systems bemisst. Dabei kann unterschieden werden nach der ideologischen Distanz zwischen den beiden größten Parteien einerseits und nach dem Ausmaß an Polarisierung des Parteiensystems (unter Berücksichtigung sämtlicher Parteien) andererseits. Auf der parlamentarisch-gouvernementalen Wettbewerbsebene können Parteiensysteme ferner nach dem Grad der Segmentierung vergleichend klassifiziert werden. Damit ist der Grad der »Abschottung« zwischen den unterschiedlichen Parteien eines Systems in Bezug auf die prinzipielle Koalitionsfähigkeit bzw. -willigkeit gemeint. 59 Zu den Merkmalen des deutschen Parteiensystems der vergangenen vier Jahrzehnte gehört zunächst ein vergleichsweise geringes Maß an Fragmentierung und Polarisierung. Das war jedoch bekanntlich nicht immer so.60 Das Parteiensystem der späten vierziger und fünfziger Jahre wies sowohl hinsichtlich der Anzahl parlamentarisch repräsentierter Parteien als auch der ideologischen Polarisierung des Parteiensystems auffallende Parallelen zu der hochgradig fragmentierten und polarisierten Parteienlandschaft der Weimarer Republik auf (Falter 1981). Die große Anzahl parlamentarisch repräsentierter Parteien insbesondere während der ersten Wahlperiode des Bundestages (1949–1953) war nicht zuletzt Ausdruck einer Vielzahl gesellschaftlicher Konfliktlinien mit parteibegründender Qualität. Ihre Wirkung wurde zunächst kaum durch restriktive Wirkungen des Wahlsystems entschärft. Für den auch im internationalen Vergleich beispiellosen Konzentrationsprozess im deutschen Parteiensystem von der Mitte der fünfziger bis zum Beginn der sechziger Jahre waren das allmähliche Verblassen gesellschaftlicher Konfliktlinien (so vor allem der Konflikt zwischen Einheimischen und Vertriebenen) und die außergewöhnlich erfolgreiche Integrationspolitik der Unionsparteien alles in allem entscheidender als die Wirkungen der graduellen Verschärfung der Sperrklausel des Wahlsystems. Das Parteiensystem der Periode 1961 bis 1983 wurde oft als »Zweieinhalbparteiensystem« beschrieben. Während die normativen Ambitionen der meisten deutschen Beobachter (nicht nur während dieser Phase) vor —————— 59 Vgl. zur Diskussion dieser Klassifikationskriterien statt vieler Niedermayer (1996a). 60 Vgl. für eine weiter ausgreifende Darstellung und Analyse der Entwicklungsstufen des deutschen Parteiensystems, welche hier nur in groben Zügen nachgezeichnet werden können, statt vieler von Alemann (2000: 41–77). 72 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE allem auf das britische Parteiensystem gerichtet waren, fand sich das in empirischer Hinsicht vermutlich engste Pendant zum deutschen Parteiensystem jener Jahre in Österreich mit seiner Dreier-Konfiguration aus ÖVP, SPD und FPÖ. Seit den siebziger Jahren kam es in der Bundesrepublik, parallel zu der Entwicklung in vielen anderen Industrienationen, zur Etablierung einer ökologischen bzw. post-materiellen Konfliktlinie, der die Grünen ihre Entstehung und ihren elektoralen Aufstieg verdankten. Die deutsche Vereinigung beendete diese Entwicklungsphase des Parteiensystems, indem sie das bisherige System zu einem Fünfparteiensystem erweiterte. Obwohl sich der Fragmentierungsgrad des Parteiensystems im Zeitraum 1990–2005 gegenüber den drei vorausgehenden Jahrzehnten durch die Etablierung der PDS als fünfter dauerhaft im Bundestag vertretener Partei moderat erhöhte, gibt es nach wie vor wenige westeuropäische Parteiensysteme, die einen deutlich geringeren Zersplitterungsgrad aufweisen als das deutsche, darunter Griechenland, Österreich und Lichtenstein. Im Hinblick auf die Stimmenverteilung handelt es sich selbst beim britischen »Zweiparteiensystem« bereits seit Jahrzehnten um ein Mehrparteiensystem mit beträchtlichem Fragmentierungsgrad. Deutlich stärker fragmentiert als das deutsche Parteiensystem (sowohl auf Stimmen- als auch auf der Mandatsebene) sind vor allem die Parteiensysteme einiger der kleineren westeuropäischen Länder wie insbesondere Belgien und die Schweiz. Von den größeren Ländern weist seit 1994 Italien ein auffallend hohes Maß an Fragmentierung auf, nach einigen Indizes auch Frankreich (Dalton/ McAllister/Wattenberg 2000: 43). Dem historischen Konzentrationsprozess im deutschen Parteiensystem entsprach ein Trend in Richtung Entpolarisierung. Der Polarisierungsgrad des deutschen Parteiensystems zwischen Ende der fünfziger und Anfang der siebziger Jahre war deutlich geringer als im ersten Nachkriegsjahrzehnt. Als von seinen Wirkungen her noch weitreichender als das Verschwinden der zahlreichen Kleinparteien erwies sich die Annäherung zwischen den beiden Volksparteien. Entscheidend verantwortlich für diese war freilich vor allem die kontinuierliche ideologisch-programmatische Zentrumsbewegung der SPD. Die seit den achtziger Jahren wieder zunehmende Polarisierung des Parteiensystems (im Sinne einer Öffnung nach links) war nicht so sehr ein Ergebnis der (nur vorübergehend) wachsenden Distanz zwischen Union und SPD, als vielmehr des Hinzutretens neuer Parteien, zunächst der Grünen und später der PDS. Aus international vergleichender POLITISCHE PARTEIEN 73 Perspektive betrachtet erscheint jedoch auch der Polarisierungsgrad des Parteiensystems im vereinigten Deutschland insgesamt als moderat, nicht zuletzt deshalb, weil es in der Bundesrepublik auf der zentralstaatlichen Ebene – anders als in Italien, Dänemark, Norwegen oder Österreich – keine parlamentarisch repräsentierte radikale, extremistische oder populistische Rechtspartei gibt. Aber auch die Existenz gleich zweier großer »Sozialstaatsparteien«, wie die Union und SPD genannt wurden (Schmidt 2006), ist international keineswegs selbstverständlich und trägt entscheidend zur Konzentration des parteipolitischen Kräftefeldes mit Blick auf grundlegende Fragen staatlicher Politik bei. Zu den klassischen Kennzeichen des deutschen Parteiensystems gehörte ferner eine ausgeprägte Asymmetrie zugunsten der CDU. Bis zum Vorabend der Bundestagswahl von 1998 ging die Union mit nur einer einzigen Ausnahme (1972) aus sämtlichen Bundestagswahlen als stimmenund mandatsstärkste Partei hervor. Während die Christdemokraten ihr zwei Jahrzehnte lang ungebrochenes Monopol bei der Bestellung des Bundeskanzlers Ende 1969 einbüßten, bildete sich die »CDU-Lastigkeit« des Parteiensystems (Kolinsky 1993: 46) auch während der sozial-liberalen Ära nicht zurück. Die strukturelle Überlegenheit der Unionsparteien manifestierte sich dabei nicht nur auf Bundesebene, sondern in mindestens vergleichbarem Maße in den Ländern. Von den vier Bundestagswahlen der »sozial-liberalen Ära« (1969, 1972, 1976 und 1980) gelang es der SPD nur ein einziges Mal (1976), die Union an der Wahlurne zu übertrumpfen. Im Gegensatz zum Fortbestand christdemokratischer Vormacht in den meisten Ländern, kam es hinsichtlich der Stärkeverhältnisse zwischen Union und SPD im Bund seit Ende der neunziger Jahre zu einem Wandel. Aus den beiden ersten der drei Bundestagswahlen der Jahre 1998, 2002 und 2006 ging die SPD als stärkste Partei bzw. Fraktion hervor.61 Selbst die Rückeroberung der Position der stimmen- und mandatsstärksten Partei bzw. Fraktion durch die Union bei der Bundestagswahl 2006 markierte keine Rückkehr zu früheren Hochphasen christdemokratischer Hegemonie. Mit einem Stimmenvorsprung von lediglich einem Prozentpunkt gegenüber der SPD fiel die Führung der CDU/CSU denkbar bescheiden aus, insbesondere gemessen an den haushohen Wahlsiegen der fünfziger Jahre, bei denen die Union im Einzelfall, so bei der Bundestagswahl 1957, um mehr als 18 Prozentpunkte besser abschnitt als die SPD. —————— 61 Anders als 1998 stellten die Sozialdemokraten 2002 jedoch nur aufgrund einer höheren Anzahl von Überhangmandaten die stärkste Fraktion. 74 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Mit der Entwicklung hin zu einem stärker symmetrischen Machtverhältnis der beiden größten Akteure des Parteiensystems steht die Bundesrepublik keineswegs allein. Eine Tendenz zu einer größeren Offenheit der strukturellen Wettbewerbssituation kennzeichnet viele der westeuropäischen Parteiensysteme. Grundsätzlich ähnlich wie in der Bundesrepublik kam es in vielen Ländern – von Belgien und den Niederlanden bis nach Italien – vor allem zu einer deutlichen Schwächung angestammter Vormachtpositionen christdemokratischer Parteien (Walter 1999). Verschiebungen des Gravitationszentrums des Parteiensystems blieben jedoch nicht auf Länder mit ehemals christdemokratischer Hegemonialposition beschränkt. Auch in einigen Ländern mit entgegengesetzten Vorzeichen, d.h. einer langjährigen Asymmetrie zugunsten der Sozialdemokratie, wie in Österreich, Norwegen und Schweden, kam es in den vergangenen Jahren zu stärker ausgeglichenen Kräftekonstellationen bzw. zur Herausbildung einer stärker bipolar geprägten Wettbewerbsstruktur (Stöss/Haas/ Niedermayer 2006: 24). Das wohl bemerkenswerteste Gegenbeispiel eines hochgradig stabilen »hegemonialen Parteiensystems« verkörpert Japan, wo es in den neunziger Jahren nur vorübergehend zu einer Schwächung der jahrzehntelang behaupteten Vormachtstellung der Liberaldemokratischen Partei kam. Seit 1995 ist die LDP erneut als dominante Kraft (wenn auch nicht mehr als einzige Partei) an der Regierung beteiligt; ihr Status als stimmen- und mandatsstärkste Partei stand seit deren Gründung im Jahre 1955 zu keiner Zeit in Frage (Köllner 2005). Zu den weiteren Merkmalen des deutschen Parteiensystems gehört seit den späten sechziger Jahren eine insgesamt geringe bis mäßig starke Segmentierung, ein relativ hohes Maß an prinzipieller gegenseitiger Koalitionsfähigkeit der im Bundestag vertretenen Parteien. Weder die Zunahme der parlamentarisch repräsentierten Parteien von drei auf fünf (von denen eine nach wie vor als »nicht koalitionsfähig« gilt) noch die seit der Vereinigung gewachsene Bipolarisierung des Parteiensystems hat zu einer problematischen Verringerung von Koalitionsoptionen geführt. Die jüngsten Entwicklungen deuten eher darauf hin, dass künftig weitere lagerübergreifende Koalitionsoptionen (wie zwischen der Union und den Grünen) hinzukommen könnten. Die stark auf Kooperation und Kompromiss gestimmten Parameter des staatlichen Entscheidungssystems in der Bundesrepublik tragen mit dazu bei, dass sich die unterschiedlichen Parteien selbst in Hochphasen der Konkurrenz nicht vollständig einander entfremden und zumindest prinzipiell gesprächsbereit bleiben. POLITISCHE PARTEIEN 75 Der insgesamt moderate Segmentierungsgrad des deutschen Parteiensystems ist aus international vergleichender Perspektive betrachtet wenig auffällig. Er findet vielerorts Entsprechungen, vor allem in der Mehrzahl stark fragmentierter Systeme. Dabei macht die nicht nur in Deutschland verbreitete Skepsis gegenüber Minderheitsregierungen im Hinblick auf neue Koalitionsbündnisse, die die Bildung einer Mehrheitsregierung ermöglichen, zuweilen erfinderisch. Daneben gibt es jedoch Länder, unter ihnen Frankreich und Italien, in denen die bipolare Struktur des Parteienwettbewerbs tatsächlich so fundiert ist, dass auch die Segmentierung des Parteiensystems größer und die Palette politisch möglicher Koalitionsoptionen entsprechend kleiner ist als in der Bundesrepublik. Erst recht einen länderübergreifenden Trend verkörpert die gewachsene Volatilität im Sinne von Veränderungen in den stimmenbezogenen Stärkeverhältnissen der einzelnen Parteien zueinander. Sie ist maßgeblich Ausdruck der fortschreitenden Ersetzung dauerhafter, milieubezogener Bindungen an eine bestimmte Partei durch ein stärker kompetenzbasiertes Abstimmungsverhalten (Drummond 2002). Für die Bundesrepublik kann von einer gewachsenen Volatilität allerdings nur im historischen Vergleich der letzten anderthalb Jahrzehnte mit den siebziger und frühen achtziger Jahren gesprochen werden. Gemessen an den Zahlen für das erste Nachkriegsjahrzehnt ist das Ausmaß an elektoraler Volatilität im vereinigten Deutschland noch immer gering. Dies wird insbesondere im Rahmen eines historisch-internationalen Vergleichs greifbar. In den fünfziger Jahren lag Deutschland hinsichtlich der Wählerfluktuation in der Spitzengruppe westlicher Länder, während der neunziger Jahre hingegen in der Gruppe mit der vergleichsweise geringsten Volatilitätsrate (von Beyme 2000: 59). Für alle Systeme gilt, dass steigende Volatilität nicht ohne weiteres mit einer problematischen Destabilisierung des Parteiensystems gleichzusetzen ist. Zu systemverändernden Wirkungen kommt es nur bei signifikanten Wählerbewegungen »zwischen den Blöcken«. In der Bundesrepublik war dies vor allem 1998 der Fall, als es zu schweren Verlusten der Union und großen Gewinnen der SPD kam. Ein weiteres Merkmal des Parteiensystems der erweiterten Bundesrepublik, das in der internationalen Parteiensystemforschung keine vergleichbar zentrale Rolle spielt wie die soeben diskutierten Kriterien, sei abschließend erwähnt: die ausgeprägte regionale Asymmetrie in der elektoralen Unterstützung einzelner Parteien. Durch ein starkes regionales Ungleichgewicht ist keineswegs nur die Unterstützungsbasis der PDS gekenn- 76 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE zeichnet, bei der es sich noch immer ganz eindeutig um eine ostdeutsche Regionalpartei handelt. Ihre Position als drittstärkste Partei des östlichen Wahlgebietes ist unangefochten, während ihre Unterstützung selbst 2005, wo sie mit der WASG paktierte, unterhalb der Fünfprozenthürde verblieb. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (FDP 1990, SPD 2002) schneiden alle übrigen im Bundestag vertretenen Parteien seit 1990 mehr oder minder deutlich besser im westlichen Wahlgebiet ab. Auffallend stark entwickelt ist das West-Ost-Gefälle bei der Union. Nach bescheidenen Differenzwerten von unter vier Prozentpunkten bei den Bundestagswahlen 1990 und 1994 lag ihr im Westen erzieltes Ergebnis im Durchschnitt der drei Wahlen von 1998, 2002 und 2005 bei über elf Prozentpunkten unterhalb des Ergebnisses im östlichen Wahlgebiet. Bei den übrigen drei Parteien (FDP, Grüne und SPD) gibt es, trotz weiterhin gravierender Unterschiede in der regionalen Stimmenverteilung, zumindest eine deutlich greifbare Tendenz in Richtung größerer regionaler Symmetrie. Selbst in seiner gegenwärtigen Form bleibt der spezifische Ost-West-Gegensatz eine deutsche Besonderheit, für die es in den übrigen Ländern Westeuropas keine wirkliche Entsprechung gibt. Durchaus üblich sind jedoch andere Ausprägungen regional stark unterschiedlich beschaffener Muster des Wahlverhaltens. Dabei handelt es sich, wie in Großbritannien oder Italien, in der Regel um einen ausgeprägten Nord-Süd-Gegensatz, für den es in Form der Strukturschwäche der Union im protestantisch geprägten Norden Deutschlands ein (wenn auch nur mäßig stark ausgebildetes) Äquivalent auch hierzulande gibt (Jesse 2006: 34–35). Durch noch deutlich markantere regionale Hochburgenbildungen gekennzeichnet sind die Parteienlandschaften der kulturell und sprachlich fragmentierten Systeme Spaniens oder Belgiens. 3.4 Die rechtliche Institutionalisierung von Parteien und die Parteienfinanzierung Anders als durch den Akt der Verfassungsgebung geschaffene Institutionen sind Parteien Ausdruck der gesellschaftlichen Wirklichkeit und durch rechtliche Vorgaben nur in Grenzen regulierbar. Gleichwohl gibt es Ansätze zu einer rechtlichen Institutionalisierung politischer Parteien. Die ausdrückliche verfassungsrechtliche Normierung von Parteien ist allerdings auf einen recht kleinen Kreis von Ländern beschränkt. Zu ihnen gehört POLITISCHE PARTEIEN 77 mit an erster Stelle die Bundesrepublik, wo den Parteien in Art. 21 GG gleich eine doppelte verfassungsrechtliche Absicherung zuteil wurde – zum einen über die Schaffung eines subjektiven politischen Grundrechts auf Gründung einer Partei und Mitwirkung in dieser, zum anderen über den Weg einer institutionellen Garantie der Partei und ihrer Funktionen (Tsatsos 1990: 775). Eine vergleichbar weitreichende verfassungsrechtliche Institutionalisierung ist selbst in der Mehrzahl jener Länder, in denen es ebenfalls eine verfassungsrechtliche Verankerung der Parteien gibt, selten. Am ähnlichsten sind die einschlägigen Regeln in Portugal, in Frankreich und (seit 1999) in der Schweiz, weniger umfassend in Spanien, Griechenland und Italien. Nicht in allen Ländern, die eine verfassungsrechtliche Normierung der Parteien kennen, finden sich auch spezielle Parteiengesetze (wie in Deutschland, Spanien und Portugal). Andererseits bildet die ausdrückliche verfassungsrechtliche Anerkennung der Parteien keine Voraussetzung für eine rechtliche Institutionalisierung auf einfachgesetzlicher Grundlage wie die Vielzahl von Ländern belegt, in denen es Parteiengesetze, aber keinen verfassungsrechtlichen Status von Parteien gibt. Aus politikwissenschaftlicher Perspektive interessiert zunächst, warum die Parteien in einigen Ländern (verfassungs)rechtlich institutionalisiert sind, in anderen hingegen nicht. Von überragender Bedeutung erscheint die historische Erfahrung von Ländern. Eine verfassungsrechtliche Normierung von Parteien findet sich mit auffallender Häufigkeit in Ländern mit schwacher oder unterbrochener demokratischer Tradition. In diesen Ländern ging es bei der verfassungsrechtlichen Anerkennung der Parteien weniger um die zusätzliche Würdigung von in der Verfassungspraxis besonders prominent positionierten demokratischen Akteuren, sondern eher um eine Normierung mit stark prospektivem Charakter. In Ländern mit erfolgreich bewährter demokratischer Tradition wie Großbritannien oder den Niederlanden erschien ein entsprechender Schritt dagegen verzichtbar bzw. galt gerade die Fernhaltung des staatlichen Zugriffs durch die Mittel des Rechts als eine zentrale politische Freiheitsgarantie (Morlok 1990: 783).62 Weniger einleuchtend sind funktionale Begründungen, die auf den —————— 62 Trotzdem kam es in der jüngeren Vergangenheit mit dem »Registration of Political Parties Act 1998« und dem »Political Parties, Elections and Referendums Act 2000« selbst in Großbritannien zu einer gesetzesrechtlichen Anerkennung der Parteien – ein Schritt, der im Urteil einiger Autoren nicht weniger als den späten Übergang zur vollständigen Anerkennung der Parteien als Element der britischen Verfassung markiert. Obwohl Parteien bereits früher in verschiedenen Gesetzen 78 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Zusammenhang zwischen der systemischen Bedeutung von Parteien und deren verfassungsrechtlicher Anerkennung abheben. Den diesbezüglichen Musterfall verkörpern die USA mit ihren stark auf die Erfüllung von Wahlfunktionen konzentrierten Parteien, welche weder verfassungsrechtlich noch bundesgesetzlich in besonderer Weise hervorgehoben werden (Lösche 2002).63 Nicht ganz in dieses Bild passt die erst vor wenigen Jahren erfolgte ausdrücklich funktionsbezogene verfassungsrechtliche Anerkennung der Parteien in der Schweiz. Als »funktionsarm« wird man die schweizerischen Parteien jedoch nur im direkten Vergleich mit der herausragend zentralen Rolle von Parteien im politischen Entscheidungsverfahren der meisten parlamentarischen Demokratien bezeichnen können. Nicht zuletzt aus rechtlicher Warte, im Hinblick auf andere Bestimmungen der neuen Schweizerischen Bundesverfassung, erscheint die Berücksichtigung der Parteien angemessen. Speziell das in Art. 149, Abs. 2 der Bundesverfassung vorgeschriebene Proporzverfahren für die Wahl des Nationalrates wäre ohne politische Parteien nicht durchführbar. Welchen Unterschied aber macht die rechtliche Institutionalisierung, was folgt aus ihr? Die rechtliche Institutionalisierung allein stärkt die Parteien kaum, obwohl es eine auffallende Korrelation zwischen rechtlicher Institutionalisierung und Parteienstaatlichkeit – im Sinne einer besonders weitreichenden Durchdringung nicht nur des politischen Entscheidungssystems, sondern auch der staatsfernen Sektoren des Gemeinwesens – gibt (Tsatsos 1990: 779).64 Von zentraler Bedeutung ist der Umstand, dass die rechtliche Institutionalisierung die Grundlage für eine öffentliche Finanzierung der Parteien bildet. In der Bundesrepublik wurde das (keineswegs auf Finanzierungsfragen beschränkte) Parteiengesetz vereinzelt schon vor dessen parlamentarischer Verabschiedung als »Parteienfinanzierungsgesetz« —————— Erwähnung fanden, existierten sie bis dahin nicht als »legal entities«. Vgl. Bogdanor (2004: 717). 63 Allerdings gibt es in den USA unterhalb der zentralstaatlichen Ebene ein umfangreiches gesetzliches Regelwerk zu den Parteien, insbesondere im Bereich der Wahlkampfgesetzgebung, sowie eine lange Tradition gerichtlicher Entscheidungen, durch die die Existenz der Parteien institutionell befestigt wurde. In der im amerikanischen Original bereits 1957 veröffentlichten großen Studie Karl Loewensteins erscheinen die USA im Hinblick auf eine (für notwendig erachtete) gesetzliche Institutionalisierung politischer Parteien gar als unerreichtes Vorbild (Loewenstein 2000: 399–401). 64 Vereinzelt wurde die verfassungsrechtliche Anerkennung der Parteien gar als »wichtige Voraussetzung« (von Beyme 2002: 50) des Parteienstaates bezeichnet. POLITISCHE PARTEIEN 79 bezeichnet. Ähnliche Erwägungen und Wahrnehmungen bestimmten die einschlägigen Entscheidungen und Auseinandersetzungen auch in anderen Ländern. Die Parteienfinanzierung in den konsolidierten liberalen Demokratien kennt viele Formen (Tsatsos 1992; Landfried 1994a; Naßmacher 2001). Dem deutschen Modell wurde attestiert, dass es »die schlechteste beider Welten« kumuliere: »großzügige Steuerbegünstigungen wie in Amerika kombiniert mit öffentlicher Finanzierung wie in den kontinentaleuropäischen Ländern« (von Beyme 2002: 51).65 Entsprechend hoch sind die Einkünfte der deutschen Parteien im internationalen Vergleich. Auch für Länder, in denen sich die politischen Parteien mit bescheideneren Mitteln aus öffentlichen Kassen begnügen müssen, gilt jedoch, dass sie im Zuge der staatlichen Finanzfürsorge – nicht zuletzt in der Wahrnehmung der Bevölkerung – zunehmend den Charakter öffentlicher Einrichtungen mit ausgeprägter »Gesellschaftsferne« angenommen haben (van Biezen 2004). Die (verfassungs)rechtliche Anerkennung und die ihr in aller Regel nachfolgende öffentliche Finanzierung von Parteien fördert allem Anschein nach die Entwicklung des Parteienstaates mit allen daraus erwachsenden Problemen für das demokratische System.66 Aber führt die öffentliche Parteienfinanzierung auch zu einer Abschottung der etablierten Parteien auf der Ebene des Parteiensystems? Ungewöhnlich ausgeprägt ist eine Tendenz dazu in Griechenland mit der spezifischen Zuspitzung, dass dort nicht einmal alle etablierten Parteien, sondern nur die jeweilige Regierungspartei begünstigt wird (Foundethakis 2002: 161). Insgesamt scheint es jedoch fraglich, ob die öffentliche Parteienfinanzierung tatsächlich entscheidend zur Institutionalisierung des status quo, zur »Versteinerung« von Parteiensystemen beiträgt. Wichtige Gegenbeispiele liefern die skandinavischen Länder, aber auch Deutschland und Frankreich (Naßmacher 2006: 509). Im breiteren Vergleichskontext wurde sogar die These formuliert, dass bei entsprechend niedrigen Zugangsschwellen (wie sie etwa Deutschland und Dänemark kennzeichnen) neue Parteien durch die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel begünstigt werden. Tatsächlich fanden auch Machtwechsel nach Einführung der öffentlichen Parteienfinanzierung nicht seltener, sondern häufiger statt als vorher (ebd.: 516). —————— 65 Vgl. zum deutschen System der Parteienfinanzierung statt vieler Adams (2005). 66 Vgl. zu den funktionalen und demokratietheoretischen Kosten des Parteienstaates statt vieler Hennis (1998) und von Arnim (2001). 80 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE 3.5 Konklusion Politische Parteien entstanden im Zuge der Demokratisierung staatlicher Herrschaftssysteme im Rahmen gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Nicht nur in normativer Hinsicht bleiben die Parteien auch im Zeitalter der »Etatisierung» mindestens zu einem Teil gesellschaftliche Institutionen. Grundlegende Wandlungen auf der gesellschaftlichen Ebene, wie veränderte Partizipations- oder Kommunikationsbedürfnisse, gehen nicht spurlos an den Parteien vorüber, sie prägen ihr äußeres Erscheinungsbild und mehr noch ihr Innenleben. Nichtsdestoweniger waren die Parteien in ihrer konkreten Gestalt nie nur die »politischen Kinder gesellschaftlicher Konflikte«. Viele der spezielleren Wesensmerkmale von Parteien und des Parteiensystems sind in hohem Maße Reflexe anderer, nicht zuletzt institutioneller Eigenschaften des jeweiligen Regierungssystems. Das zeigt sich im deutschen Fall insbesondere am organisatorischen Aufbau der Parteien wie an deren hoch entwickelter Fähigkeit zum politischen Kompromiss, welche wesentlich ein Ergebnis der Einbettung des Parteiwesens in ein föderatives bzw. verhandlungsdemokratisches System sind. So sehr die Parteien und das Parteiensystem eines Landes von den gesellschaftlichen und politisch-institutionellen Parametern geprägt werden, so stark ist ihr Einfluss auf das jeweilige Regierungssystem. Nicht nur die politische Erfolgsgeschichte Deutschlands nach 1945 ist in hohem Maße den Parteien zu verdanken; auch einige der spektakulären Krisen der liberalen Demokratie (wie in Italien) waren auf das Engste mit den Parteien verknüpft. Die Einsicht in die offensichtlichen Grenzen der rechtlichen Regulierbarkeit von im Kern gesellschaftlichen Institutionen erklärt mit, warum Parteien und Parteiensysteme gleichwohl selten zum direkten Gegenstand ehrgeiziger Staatsreformen gemacht wurden. Weiter gehende Annäherungen an bestimmte, bewunderte Eigenschaften von Parteiensystemen anderer Länder werden im politischen Reformprozess liberaler Demokratien üblicherweise über Wahlsystemreformen angestrebt.67 Davon —————— 67 Dies freilich mit gemischter Erfolgsbilanz. Die alte These von der gleichsam beliebigen Kreierbarkeit von Parteiensystemen auf dem Wege der Wahlsystemreform wird zu Recht kaum noch ernsthaft vertreten. Die Anerkenntnis der maßgeblich politisch-kulturellen Bedingtheit der Wirkungen politischer Institutionen gehört seit langem zum Basiskonsens der internationalen Demokratieforschung (Przeworski 2004). Als erwähnenswert gelten heute eher die seltenen Ausnahmen, POLITISCHE PARTEIEN 81 zeugen die Diskussionen in der Bundesrepublik während der sechziger Jahre ebenso wie die öffentlichen Reformdebatten in vielen anderen Ländern, in denen nicht selten gerade das deutsche Wahlsystem als Schlüssel zu einer erfolgreichen Demokratiereform betrachtet wurde. Was den engeren Bereich der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik betrifft, wurden im Ausland vor allem einige der spezielleren Aspekte – wie die verfassungsrechtliche Institutionalisierung der Parteien im Grundgesetz und die 1959 eingeführte öffentliche Parteienfinanzierung – zum Referenzmodell erhoben, obwohl es sich dabei nicht wirklich um deutsche Erfindungen, sondern eher um die Weiterentwicklung andernorts68 ersonnener Maßnahmen handelte. In Teilen der politikwissenschaftlichen Literatur wurde darüber hinaus gelegentlich auch den deutschen Parteien selbst Modellcharakter zugestanden, im Sinne einer modellhaften Kumulierung bestimmter Eigenschaften. Als eine geradezu sinnbildliche Verkörperung der Kirchheimer’schen »Allerweltspartei« erschien dabei in den achtziger Jahren im Kontext eines weit ausgreifenden internationalen Vergleichs die bayerische CSU (Schmidt 1985: 383). Stärker noch als einzelne Parteien sind Parteiensysteme durch ein außerordentlich hohes Maß an dynamischer Energie gekennzeichnet. Dies erschwert insbesondere das international vergleichende Studium von Parteiensystemen. Neben fortwährender Dynamik und gelegentlichen Anzeichen transnationaler Konvergenz gibt es jedoch eine bemerkenswerte Persistenz charakteristischer Strukturmuster. Die Teilhabe an länderübergreifenden Entwicklungstrends eines Systems führt selten zum vollständigen Verlust von dessen zentralen Unterscheidungsmerkmalen. Das gilt für das Parteiensystem der Bundesrepublik ebenso wie für die Parteiensysteme der anderen liberalen Demokratien.69 Vor allem die in den neunziger Jahren prominent formulierten Erwartungen, dass es auf breiter Front zu einer tief greifenden De-Institutionalisierung von Parteiensystemen im Stile —————— wie Italien in den neunziger Jahren, wo eine Restrukturierung des Parteiensystems tatsächlich durch eine Reform des Wahlsystems gelang (Reed 2001). 68 Im Falle der öffentlichen Parteienfinanzierung war dies Puerto Rico (1957); hinsichtlich der ausdrücklichen Anerkennung der Parteien in der Verfassung ist Italien (1947) zu nennen. 69 Aus diesem Grund erweisen sich populäre Charakterisierungen jüngerer Wandlungsprozesse im deutschen Parteiensystem mit Schlagworten wie »Amerikanisierung« und »Italienisierung« bei näherer Betrachtung – nicht zuletzt der amerikanischen und italienischen Parteipolitik! – als wenig substantiell und im Zweifelsfalle irreführend (Helms 2006b). 82 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE fundamentaler »Parteiensystemwechsel« kommen könne, haben sich nicht bewahrheitet. Bei Anlegung der international üblichen Standards der theoretisch angeleiteten Parteiensystemwandelforschung (Smith 1989a: 353– 354, 1989b: 161) ließe sich von den hier interessierenden Ländern für die Periode nach 1945 allenfalls Italien als Beispiel für ein System anführen, in dem es innerhalb kurzer Zeit zu einer Veränderung des »institutionellen Kerns« des Parteiensystems kam (Helms 1994). Selbst dort haben sich einzelne Elemente der Parteienlandschaft unter der Oberfläche stärker erhalten als dies zunächst den Anschein hatte. All das schließt neue, unvorhersehbare Entwicklungen in den Parteiensystemen der liberalen Demokratien freilich nicht aus. Das Parteiensystem der Bundesrepublik gehört auch nach dessen jüngeren Wandlungen weiterhin zu der großen Gruppe von Systemen vom Typ des »gemäßigten Pluralismus« (Sartori 1976: 181). Auf mittlere Sicht erscheint eine Weiterentwicklung zu einem vollständig demokratisierten »Zwei-Block-System« mindestens so wahrscheinlich wie – und dabei ungleich wünschenswerter als – eine Rückkehr zum »polarisierten Pluralismus« Weimarer Prägung. 4 Interessengruppen: Agenten der Zivilgesellschaft? Stärker noch als die politischen Parteien, welche gelegentlich (vor allem im Falle regierender Parteien) geradezu als Repräsentanten staatlicher Macht erscheinen, sind Interessengruppen als eine alternative Ausprägung intermediärer Institutionen eindeutig in der Gesellschaft beheimatet. Das gilt selbst für Systeme, in denen Interessengruppen in hohem Maße in das staatliche Entscheidungssystem inkorporiert sind. Die maßgeblichen politikwissenschaftlichen Abgrenzungsversuche zwischen Interessengruppen und Parteien sind jedoch zu Recht schwerlich auf deren jeweilige Nähe zum Staat konzentriert.70 Als zentrales Unterscheidungsmerkmal gilt vielmehr das Ziel, politische Ämter zu besetzen, welches üblicherweise das Bestreben von Parteien, nicht aber dasjenige von Interessengruppen kennzeichnet. Zweitens besitzen Parteien in Form von Wählerstimmen eine spezifische Ressource von Parteien, auf die Interessengruppen nicht zurückgreifen können. Als ein drittes wichtiges Differenzierungskriterium gilt schließlich der in aller Regel deutlich unterschiedlich weit dimensionierte thematisch-programmatische Interessenfokus von Interessengruppen und Parteien (vgl. Thomas 2001). Freilich lässt sich auch innerhalb der großen Familie der Interessengruppen nach unterschiedlichen Mitgliedern differenzieren. Dabei ist hier nicht zuerst an das gängige Unterscheidungskriterium der Sektorenzugehörigkeit von Interessengruppen (etwa zum Wirtschafts-, Sozial- oder Kulturbereich) gedacht, sondern an den Unterschied zwischen Interessenverbänden und sozialen Bewegungen. Verbände und Bewegungen unterschei- —————— 70 Dies erschiene fragwürdig insbesondere im Hinblick auf eine Abgrenzung von Interessengruppen gegenüber oppositionellen, gegebenenfalls »staatsfeindlichen« Parteien. Hinzu kommt, dass selbst in Ländern, deren politisches System durch ein enges Verhältnis zwischen Interessengruppen und Staat gekennzeichnet ist, niemals alle oder auch nur die Mehrheit der Interessengruppen in dieses System inkorporiert sind. 84 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE den sich sowohl hinsichtlich ihrer internen Verfahrensgrundlage und ihres Operationsmodus als auch im Hinblick auf ihre zentralen Ressourcen voneinander (Rucht 1993: 263–269): Ist die interne Verfahrensgrundlage von Verbänden durch eine Satzung und eine hohe Rollenspezifikation einzelner Akteure innerhalb dieser Organisation geprägt, so funktionieren interne Prozesse in sozialen Bewegungen auf der Basis freien Aushandelns. Die Rollenspezifikation von Mitgliedern sozialer Bewegungen ist eine deutlich geringere als im Falle von Verbänden. Den zentralen Operationsmodus von Verbänden bildet die Repräsentation von Mitgliederinteressen; bei den Bewegungen sind es eher die Protesthandlungen ihrer Anhänger. Den zentralen Ressourcen von Interessenverbänden wie Expertenwissen und Geld, aber auch die Möglichkeit der Verweigerung bestimmter gesellschaftlich relevanter Leistungen, entspricht auf Seiten sozialer Bewegungen die »Emphase der Anhängerschaft« (ebd.: 268). Obwohl ein geringerer Institutionalisierungsgrad von sozialen Bewegungen zu den zentralen Abgrenzungsmerkmalen gegenüber Verbänden zählt, führen Prozesse der fortschreitenden Institutionalisierung von Bewegungen in der Regel weniger zu einer Annäherung an den Interessengruppentypus der Verbände als vielmehr zu einer Institutionalisierung in Form politischer Parteien wie sie in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik am Beispiel der Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung und den Grünen zu beobachten war. Dieser Zusammenhang kennzeichnet im Übrigen nicht nur das Verhältnis zwischen neuen sozialen Bewegungen und politischen Parteien, sondern dasjenige zwischen Bewegungen und Parteien überhaupt.71 Die Geschichte sozialer Bewegungen und politischer Parteien zeigt jedoch, dass eine Bewegung keineswegs zwangsläufig zu existieren aufhört, sobald sie eine Partei ausgebildet hat. In vielen Ländern bildet eher die Koexistenz ideologisch-historisch »verschwisterter« Parteien und Bewegungen den Normalfall (von Beyme 2000a: 18–21).72 —————— 71 Als das Neue an den neuen sozialen Bewegungen kann nicht zuletzt die vergleichsweise geringere Eingriffstiefe in den gesellschaftlichen Prozess gelten. Während viele der klassischen sozialen Bewegungen gesamtgesellschaftliche Ziele und Utopien vertraten, geht es den neuen sozialen Bewegungen im Allgemeinen lediglich um eine zumeist thematisch begrenzte, dauerhafte Mitgestaltung des politischen Prozesses innerhalb einer als solcher akzeptierten Grundordnung. Vgl. Rucht (2002). 72 Eine weitere traditionelle Abgrenzung von Verbänden gegenüber anderen organisierten Gruppen, die jedenfalls am Rande erwähnt sei, bezieht sich auf den Unterschied zwischen Verbänden und Vereinen. Als konstitutives Bestimmungsmerkmal INTERESSENGRUPPEN 85 Die nachfolgenden Betrachtungen konzentrieren sich auf die Interessenverbände. In Übereinstimmung mit dem Fokus der übrigen Kapitel dieser Studie wird dabei wiederum eine Perspektive entwickelt, deren Kernfokus auf den strukturellen Charakteristika von Interessenverbänden und Verbandssystemen – verstanden als abhängige Variable – liegt. Dies geschieht im Gegensatz zu der eindeutig vorherrschenden Ausrichtung der Literatur über Interessengruppen in den liberalen Demokratien, welche ganz überwiegend die Auswirkungen der Politik von Interessengruppen auf das politische System, den politischen Prozess oder einzelne politische Entscheidungen im Blick hat. Die beträchtliche funktionale Bedeutung von Verbänden für den demokratischen Prozess wird hier vorausgesetzt. Sie stand im Übrigen niemals wirklich in Frage – auch nicht im »verbandsprüden« Deutschland der Vorkriegsepoche und den frühen Jahren der Bundesrepublik. Lange gezweifelt wurde allein daran, ob es einen greifbaren positiven Effekt von Interessenverbandspolitik für das Gemeinwesen gäbe. Das einseitig negative Bild von politisch aktiven Verbänden, die als potentielle Feinde und als Gefährdung des Gemeinwohls erschienen, wurde in der Bundesrepublik seit den sechziger Jahren durch ein offeneres Verständnis von Interessengruppenpolitik ersetzt73 und unterscheidet sich heute nicht mehr grundsätzlich von den vorherrschenden Einschätzungen in anderen Ländern, in denen der Pluralismus und die Demokratie früher heimisch wurden als hierzulande. Hier wie dort sind Interessenaggregation, -selektion, -artikulation, und -integration als Teilkomponenten der gesellschaftlichen Repräsentationsfunktion von Verbänden sowie Partizipation, Legitimation und sozioökonomische Selbstregulierung als sekundäre Verbandsfunktionen für das politische System74 prinzipiell anerkannt. Der nächste Abschnitt beleuchtet einige theoretische und empirische Aspekte der historischen Herausbildung von Interessengruppen. Im daran —————— von Verbänden gilt aus dieser Perspektive »die nachhaltige, auf einen längeren Zeitraum angelegte Einflußnahme auf den politischen Willensbildungsprozeß« (SchuettWetschky 1997: 9, Hervorhebung im Original), die kaum als typisch für die Vielzahl von Vereinen, etwa aus dem Freizeitbereich, angesehen werden kann. 73 Als in politikwissenschaftlicher Hinsicht maßgeblich erwies sich dabei der »NeoPluralismus« Ernst Fraenkels, der nach Einschätzung der meisten Autoren gedanklich im Wesentlichen bereits in den frühen dreißiger Jahren erschaffen wurde (Buchstein/Kühn 1999: 16–17; Fraenkel 1932). Zum eigentlichen Referenzwerk wurde gleichwohl Fraenkels Arbeit über den »Pluralismus als Strukturelement der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie« (Fraenkel 1964). 74 So der Funktionskatalog bei Sebaldt/Straßner (2004: 61–70). 86 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE anschließenden Teil geht es um die unterschiedlichen Ausprägungen von Verbänden in den liberalen Demokratien. Dabei ist sowohl nach funktionalen Merkmalen wie nach Sektorenzugehörigkeit zu differenzieren. Ergänzt wird die Bestandsaufnahme durch einen Vergleich der Verbandssysteme in den konsolidierten liberalen Demokratien – eine Perspektive, die erst in der jüngsten Vergangenheit zu einem festen Bestandteil der internationalen Interessengruppenforschung geworden ist. 4.1 Zur historischen Herausbildung von Interessengruppen Die Bedingungen der Herausbildung von Interessengruppen waren bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein selten expliziter Gegenstand theoretischer Betrachtungen. Von den frühen Klassikern der Interessengruppenforschung bietet David B. Truman (1951) die ausführlichste Beschäftigung mit den strukturellen Entstehungsbedingungen von Interessengruppen. Truman erklärt die Entstehung von Interessengruppen aus dem Gefühl der Unzufriedenheit und Benachteiligung gesellschaftlicher Gruppen, welches maßgeblich in einer signifikanten Veränderung makrosozialer Parameter begründet sei. Zu letzteren werden alle erdenklichen Komponenten und Ebenen sozialen Wandels – Veränderungen ökonomischer, technologischer, logistischer Natur etc. – gerechnet. Die Konzentration auf Prozesse grundlegenden sozioökonomischen Wandels als zentrale Ursache der Entstehung von Interessengruppen kennzeichnet auch das Gros einschlägiger Arbeiten aus der Feder anderer Autoren. Die wichtigste theoretische Gegenposition hierzu stellt der einflussreiche Beitrag Mancour Olsons (1965) dar. Olson zufolge entstehen und entwickeln sich Interessengruppen nur dort, wo diese in der Lage sind, potentiellen Mitgliedern einer Organisation einen spezifischen Vorteil zu bieten, in dessen Genuss sie ohne Mitgliedschaft nicht gelangen. In international weniger beachteten Arbeiten wurde eine Reihe anderer Faktoren identifiziert, die Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung von Interessengruppen haben. Dazu gehören auf makro-sozialer Ebene die politische Kultur eines Landes (Macridis 1961: 40-41), auf mikro-sozialer Ebene etwa die Existenz von »entrepreneurs«, welche ein gewisses Maß an Kapitalressourcen investieren (müssen), um damit möglichen Mitgliedern einer Organisation bestimmte »selective benefits« zur Verfügung stellen zu können (Salisbury 1969). INTERESSENGRUPPEN 87 Im Rahmen dieses kurzen historischen Abrisses sei nur an die wichtigsten makro-sozialen und makro-politischen Bedingungsfaktoren der Entstehung von Interessengruppen erinnert. In politischer Hinsicht war die Entstehung von Interessenverbänden wesentlich mit der Anerkennung der Koalitionsfreiheit im Rahmen der Grundrechte verbunden; darüber hinaus mit der politisch-gesellschaftlichen Anerkennung von Interessengruppen, die für bestimmte, sachlich begrenzte Anliegen eintraten. Bis dahin war es selbst in den aus heutiger Sicht besonders »pluralismusfreundlichen« angelsächsischen Ländern ein weiter Weg. Was das ausdrückliche Verbot jeglicher Vereinigungen des Standes und des Berufes betraf, kam ausgerechnet England (gemeinsam mit Frankreich) eine europäische Vorreiterrolle zu. Der »General Combination Act« (1799) wurde zu einem der international bekanntesten und einflussreichsten Zeugnisse einer kompromisslos-restriktiven staatlichen Interessengruppenpolitik, auch wenn dieser in der englischen Verfassungspraxis nicht sehr lange wirksam blieb (Schulz 1969: 229). Auch unterhalb der Ebene gesetzlicher Verbote gab es zahlreiche Vorbehalte gegenüber den Interessengruppen. In den USA war die verbreitete Abneigung gegen »factions«, wie sie aus den Beiträgen der »Federalists« sprachen, sogar noch stärker auf die Verbände als auf die Parteien bezogen (von Beyme 1974a: 22). Die von Land zu Land variierende staatliche Politik gegenüber Vereinen und Verbänden75 kann nur zum Teil die unterschiedliche Geschwindigkeit erklären, mit der sich gesellschaftliche Gruppierungen (jenseits der Geheimbündelei) etablierten. Wichtiger war das jeweilige Niveau der wirtschaftlichen Modernisierung, der Industrialisierung eines Landes. Nicht nur in Deutschland waren die frühen Verbandsbildungen »Konsequenz und Widerspruch zum liberalen Prinzip Wettbewerb« (Varain 1973: 11). Praktisch überall kam es, freilich mit zum Teil gravierenden landesspezifischen Unterschieden, während der ersten beiden Drittel des 19. Jahrhunderts zu Zusammenschlüssen mit dem Ziel der Artikulation gesellschaftlicher Interessen, die zunehmend an die Stelle personaler oder korporativer Formen der Interessenvertretung des »ancien régime« traten. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Bürokratisierung der politischen Willensbildung erwiesen sich sowohl die traditionellen —————— 75 In Deutschland gab es, anders als in vielen anderen Ländern, bemerkenswerter Weise kein generelles Verbot ständischer oder berufsbezogener Vereinigungen. Volle Vereinigungsfreiheit setzte sich hier in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch (Ullmann 1988: 58–59). 88 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE ständischen Vertretungen als auch die auf persönliche Beziehungen zu Entscheidungsträgern basierenden Formen der Einflussnahme immer mehr als dysfunktional (Ullmann 1988: 21). Dass die ökonomisch-gesellschaftliche Entwicklungsstufe eines Gemeinwesens für die Entwicklung der Interessengruppen im Zweifelsfalle wichtiger war als die staatliche Vereinspolitik, belegt auch der Umstand, dass etwa die Fabrikarbeiter – trotz der vergleichsweise liberaleren staatlichen Vereinspolitik – in Deutschland viel später zu einer sozialen Macht wurden als im (zumindest anfangs) betont repressiven England und Frankreich. Im Rahmen transatlantisch orientierter historischer Vergleiche wird erkennbar, dass es, wie in anderen Bereichen auch, auffallende Unterschiede zwischen den angelsächsischen Ländern (vor allem Großbritannien und den USA) und jenen auf dem europäischen Kontinent gab. Im kontinentalen Europa gelangten viele Organisationen nicht zuletzt dank der Sanktionen der staatlichen Bürokratie zu ansehnlicher Macht. Viele von ihnen wurden nicht nur in ihrer Entstehung gefördert, sondern anschließend auch offiziell von staatlicher Seite anerkannt. Das gilt – nach Überwindung der historischen Phase der Restriktion – besonders für berufsständische Vereinigungen, Räte und Kammern. Hierfür gab es in den USA und Großbritannien kaum wirkliche Entsprechungen. Nicht zu übersehen sind andererseits die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden angelsächsischen Ländern. In den Vereinigten Staaten profitierten die Verbände schon früh von den spezifischen Rahmenbedingungen ihres Handelns. Die für das präsidentielle System kennzeichnende ausgeprägte Initiativmacht des Kongresses in der Gesetzgebung und die Unbestimmtheit der Parteiprogramme gehörten zu jenen Faktoren, die in den Vereinigten Staaten von Beginn an die Entwicklung starker Interessengruppen strukturell begünstigten. Freilich ist auch die geschichtliche Entwicklung Großbritanniens während des 19. Jahrhunderts nicht ohne den großen Einfluss durchsetzungsstarker Reformbewegungen und Interessengruppen vorstellbar. Ein wichtiger Unterschied zu den amerikanischen Interessengruppen bestand jedoch darin, dass sie ihren Einfluss typischer Weise eher im Parlament ausübten, als dass sie auf dieses von außen einwirkten. Während die Interessengruppen in den USA, unabhängig von bestimmten ideologischen Affinitäten, von den Parteien getrennt blieben, verbanden sich die britischen Bewegungen und Gruppen mit den im Parlament vertretenen Parteien oder gründeten solche – dies wiederum eine Entwicklung, die auch INTERESSENGRUPPEN 89 für die kontinentaleuropäischen Länder prägend wurde (Friedrich 1953: 543–545). In Deutschland kam es zu entscheidenden Schritten in Richtung einer modernen »Verbändelandschaft« während des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts (Ullmann 1988: 116–119). Nun gewannen die frei (d.h. ohne spezielle Hilfe von Seiten des Staates) gebildeten Verbände endgültig die Oberhand gegenüber öffentlich-rechtlichen oder staatlich geförderten Interessenvertretungsorganen. Ferner gelang eine Verstetigung der Verbandsarbeit, welche Kontinuität nicht mehr primär an einzelne Personen, sondern an Organisationen knüpfte. Hinzu kam verbreitet eine Ideologisierung der Verbandsforderungen, welche nach außen die partikularen Interessen der Organisation legitimieren, im Innern Mitglieder an die Organisation binden sollte. Der eigentliche »Gründungsboom« der Verbände in Deutschland lag jedoch in der Zeit des Ersten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit. Der Krieg und die Entwicklung der Kriegswirtschaft intensivierten Prozesse der Verbandsbildung und begünstigten zugleich den Zusammenschluss von Verbänden. Zu einem besonderen Kennzeichen der Kriegs- und Nachkriegsjahre wurde die beispiellose Inkorporierung von Interessengruppen in den staatlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Sie wurde auch später nur durch die – qualitativ nicht vergleichbare – Inkorporierung »gleichgeschalteter« Verbände zwischen 1933 und 1945 übertroffen, nicht hingegen durch Ansätze korporativer Politik in der Weimarer Republik oder der Bundesrepublik (ebd.: 278–288). Spitzenverbände, die einen ganzen Wirtschaftssektor umfassten, entstanden erstmals in der Weimarer Republik. Die organisatorische Stärke einzelner Verbände übertraf in dieser Phase jene der noch schwach entwickelten politischen Parteien. Der Wiederaufbau eines demokratischen Systems von Interessengruppen nach 1945 vollzog sich wie jener des Parteiensystems auf der Grundlage alliierter Lizensierung. Das zentrale Ziel dieser Politik bestand darin, die Tätigkeit von NS-Verbänden vollständig zu unterbinden oder, in Ausnahmen, jedenfalls strikt zu kontrollieren. Hinzu trat das Bestreben nach weitreichender (fachlicher oder regionaler) Dezentralisierung. Ungeachtet des organisatorischen Bruchs mit der Vergangenheit gab es so etwas wie eine »indirekte Kontinuität«. »Sie wurde vor allem durch Führungspersonen sowie Verbandsfunktionäre vermittelt. Diese trugen wesentlich dazu bei, den Rekonstruktionsprozeß wieder in die Bahnen der historisch ge- 90 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE wachsenen Verbandsstrukturen einmünden zu lassen« (Ullmann 1988: 265–266). 4.2 Interessenverbände und »Verbändelandschaften« Es gibt sehr unterschiedliche Versuche, die immense Vielfalt von Interessenverbänden in den liberalen Demokratien zu strukturieren. Gelegentlich wurde auf der Grundlage einer funktionalen Bewertung versucht, zwischen Verbänden zu differenzieren, die sich weitgehend auf Einwirkungen im Vorhof des politischen Entscheidungssystems beschränken und solchen, die auf der Grundlage ihrer Vetomacht selbst politische Entscheidungsmacht ausüben (von Winter 1995: 148). Diese Unterscheidung ist in beträchtlichem Maße an das subjektive Urteil des Betrachters geknüpft. Eine entsprechende Verortung von Akteuren bleibt überdies zwangsläufig zeitlich konditioniert, da sie in hohem Maße von der im Einzelfall verfolgten Strategie eines Akteurs sowie der Entwicklung von dessen strukturellen Machtressourcen abhängig ist. In den siebziger Jahren galten verbreitet die Gewerkschaften, seit einigen Jahren hingegen vor allem international agierende Großunternehmen als Akteure, die in hohem Maße direkte politische Entscheidungsmacht ausübten bzw. ausüben. Nimmt man hingegen die Existenz formaler Mitentscheidungsstrukturen (wie insbesondere tripartistische Arrangements) zum Kriterium und grenzt diese von sämtlichen Formen der stärker lobbyistisch geprägten Einflussnahme ab, so wäre eher zu konstatieren, dass selbst die in korporative Strukturen einbezogenen Verbände zumeist zeitgleich auf beide Formen der Interessenvertretung zurückgreifen (Traxler 2003: 558). Ferner lässt sich unterscheiden in »private interest groups«, denen es primär oder gar ausschließlich um die Durchsetzung ihrer exklusiven Eigeninteressen geht, und in »public interest groups«, welche um die Vertretung von Interessen der Allgemeinheit bemüht sind. Die (vor allem in quantitativer Hinsicht) »typischere« Form des Interessenverbands verkörpern zweifelsohne die auf Durchsetzung spezieller Eigeninteressen ihrer Mitglieder hin ausgerichteten Organisationen. In diese Gruppe gehören Gewerkschaften und Unternehmerverbände ebenso wie Vertriebenenverbände. »Public interest groups«, wie etwa Naturschutzverbände, machen zahlenmäßig nach wie vor einen vergleichsweise kleinen Teil der in den INTERESSENGRUPPEN 91 entwickelten Demokratien anzutreffenden Interessenverbände aus. Sowohl im Hinblick auf ihre Zahl als auch auf ihre gesellschaftliche Wahrnehmung haben sie im Zuge der internationalen Ausbreitung post-materieller Interessen seit den siebziger Jahren jedoch länderübergreifend stark an Bedeutung gewonnen. Die geläufigste Differenzierungsvariante (welche freilich mit den zuvor genannten kombiniert werden kann) bleibt die Unterscheidung von Interessengruppen nach der Art des vertretenen Interesses. Unter Bezugnahme darauf lassen sich Interessengruppen unterschiedlichen Sektoren (wie dem Wirtschafts- und Arbeitsbereich, dem sozialen Bereich oder dem Freizeitbereich) zuordnen. Politisch mächtige Interessenverbände sind überwiegend im Bereich Wirtschaft und Arbeit konzentriert. Zu ihm gehören Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände, aber auch einflussreiche Vereinigungen von Selbständigen. Auch in den anderen Bereichen finden sich jedoch nicht selten politisch einflussreiche Verbände. Der »Allgemeine Deutsche Automobil-Club« (ADAC) mit seinen über 15 Millionen Mitgliedern beispielsweise kann, trotz seiner Beheimatung im unverfänglich anmutenden »Freizeitbereich«, im Hinblick auf seinen Einfluss in der Verkehrspolitik kaum als harmloses politisches »Leichtgewicht« klassifiziert werden. Noch deutlich größer ist die Zahl politisch einflussreicher Interessenverbände im bzw. aus dem Sozialbereich. In Deutschland gehören hierzu etwa die unterschiedlichen Kriegsfolgenverbände. In einer älteren Studie wurden zu den »Big Four« der mächtigen und politisch einflussreichen Interessengruppen in Deutschland auch die Kirchen gezählt (Edinger 1986: 183–194). Gegenüber den anderen drei – den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften und den Bauernverbänden – haben die Kirchen angesichts einer anhaltenden Säkularisierungstendenz, welche im Fall der erweiterten Bundesrepublik durch den großen Anteil Konfessionsloser an der Bevölkerung des östlichen Beitrittsgebiets noch deutlich verschärft wurde, in den vergangenen Jahrzehnten vermutlich am stärksten an gesellschaftspolitischer Macht eingebüßt. Trotzdem bleiben die Kirchen, in Deutschland wie in der Mehrzahl der übrigen etablierten Demokratien, zweifelsohne soziale Akteure mit beträchtlichem politisch-gesellschaftlichen Einfluss (Abromeit/Wewer 1989; Minkenberg/Willems 2003). Die weiteren Betrachtungen sind auf die drei zentralen Akteure bzw. Akteursgruppen des Bereichs Wirtschaft und Soziales – Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und landwirtschaftliche Verbände – konzentriert. 92 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Die Interessenvertretung von Unternehmen ist in der Bundesrepublik in hohem Maße ausdifferenziert. Besondere politische Bedeutung kam in der Geschichte der deutschen Nachkriegsdemokratie der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) zu. Der BDA als Dachverband der Arbeitgeber aller Sektoren gehören heute über 1000 Arbeitgeberverbände an; ferner sind ihr 54 Bundesfachverbände und 14 Landesvereinigungen angeschlossen.76 Die BDA begreift sich als sozialpolitische Interessenvertretung der Unternehmen gegenüber dem Staat und den Gewerkschaften. Eines ihrer zentralen Ziele besteht in der Koordinierung der Tarifpolitik der ihr angeschlossenen Verbände. Der BDI ist demgegenüber der Dachverband von 36 industriellen Fachspitzenverbänden, darunter zwei Arbeitsgemeinschaften. Der BDI agiert traditionell als Sprachrohr industrieller Interessen im Bereich der gesamten Wirtschaftspolitik. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHT) schließlich ist als Dachorganisation der insgesamt 81 deutschen Industrie- und Handelskammern für die Interessenvertretung der Wirtschaft gegenüber den entscheidungspolitisch relevanten Akteuren auf der deutschen Bundesebene und gegenüber den europäischen Institutionen verantwortlich. Er ist die umfassendste Vertretung der Unternehmer in Deutschland, da ihm – mit Ausnahme von Handwerksbetrieben, landwirtschaftlichen Betrieben und Freiberuflern – alle Unternehmen als Pflichtmitglied angehören. Obwohl es eine Reihe von Ländern gibt, in denen ebenfalls Kammern mit Pflichtmitgliedschaft existieren (darunter etwa Österreich, Frankreich, Italien, die Niederlande und Spanien), ist das Prinzip einer freiwilligen Mitgliedschaft international insgesamt weiter verbreitet. Der international üblichen Norm entspricht hingegen der privatrechtliche Charakter des DIHK – im Gegensatz zur österreichischen Wirtschaftskammer, bei der es sich um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft handelt. Die Existenz eines Industriedachverbands nach dem Muster des BDI, neben dem zentralen Arbeitgeberverband, besitzt im internationalen Vergleich eher Ausnahmecharakter, obwohl sich eine entsprechende Ausdifferenzierung auch in einigen anderen westlichen Ländern, wie Dänemark oder Irland, findet. Verbreiteter ist die Existenz von »integrierten« Unter- —————— 76 Der Organisationsgrad der BDA ist umstritten; die Zahlen schwanken zwischen 80 Prozent nach Eigenauskunft der BDA und kritischen Schätzungen in Höhe von deutlich weniger als 50 Prozent (Schroeder 1997: 227; Reutter 2001: 84). INTERESSENGRUPPEN 93 nehmerdachverbänden mit Arbeitgeberverbandsfunktionen (Hartmann 1992: 262). Dafür existiert in einigen anderen Ländern deutlich mehr als ein zentraler Dachverband der Arbeitgeber; in Italien gibt es derer mehr als zehn (Funk 2006: 27). Aber in fast allen Ländern mit einem Spitzenverband findet sich ein allgemeiner Verband ohne spezieller definierten Organisationsbereich, während die übrigen Verbände einen höheren Spezifikationsgrad bezüglich ihres Mitgliederprofils aufweisen. Das restriktive Kompetenzprofil der BDA auf dem tarifpolitischen Terrain ist im internationalen Vergleich nicht untypisch; allerdings gibt es eine Reihe von Ländern (etwa Norwegen, Dänemark, Belgien und Griechenland), in denen die Spitzenverbände über deutlich weiter reichende Kompetenzen im Bereich der Tarifpolitik verfügen, bis hin zur Führung und zum Abschluss direkter Tarifvereinbarungen (ebd.: 26). Zu den zentralen Aspekten der jüngeren Diskussion über strukturelle Wandlungsprozesse in der politischen Vertretung industrieller Interessen gehört der Aufstieg von Großunternehmen als selbständigen Interessenvertretern in eigener Sache (Crouch/Menon 1997: 155–158; Crouch 2003: 201–203). In den Vereinigten Staaten gehört eine weitreichende Eigenständigkeit mächtiger Unternehmen seit langem zu den Kennzeichen amerikanischer Interessengruppenpolitik. In Europa steht dieser Entwicklungstrend eher noch am Beginn. Seine Effekte auf den Zustand der Arbeitgeberverbände bleiben bis auf weiteres ungewiss. Hinweise auf einen länderübergreifenden Trend in Richtung eines signifikanten Rückgangs des Organisationsgrades der Arbeitgeberverbände liegen bislang nicht vor. Für einzelne Länder – darunter Deutschland – gibt es aber sehr wohl entsprechende Anzeichen (Funk 2006: 29). Als zentrale Faktoren, die den Verzicht eines Unternehmens auf eine Mitgliedschaft in einem nationalen Arbeitgeberverband begünstigen, wurden im deutschen Kontext genannt: eine eher bescheidene Größe eines Unternehmens, eine ausgeprägte Exportorientierung, ein geringes branchenspezifisches Arbeitskampfrisiko und ein geringer gewerkschaftlicher Organisationsgrad (Schnabel 2005: 187). Ungeachtet des im internationalen Vergleich auffälligen Trends eines abnehmenden Organisationsgrades der BDA seit den neunziger Jahren, gehört Deutschland kaum zu jenen Ländern, die eine eindeutige Führungsrolle bei der Neustrukturierung der Arbeitgeberrepräsentation auf Dach- und Mitgliedsebene spielen. Erwähnenswerte Innovationen gab es bei der Flexibilisierung von Mitgliedschaften (konkret die Ermöglichung von Mitgliedschaften ohne Tarifbindung); im Hinblick auf weiter gehende Fusionen inner- 94 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE halb der nationalen Verbändelandschaft hinkt die Bundesrepublik dem internationalen Trend hingegen eher hinterher (Streeck/Visser 2006). Gewerkschaften lassen sich vor allem anhand der jeweiligen politischideologischen Dimension unterscheiden, mittels derer sie ihre Domänenstruktur definieren. Differenziert werden kann dabei zwischen Richtungsgewerkschaften und Einheitsgewerkschaften. Richtungsgewerkschaften leiten ihre interessenpolitischen Grundsätze und Prioritäten aus bestimmten weltanschaulichen Prinzipien ab, etwa dem sozialdemokratischen Gesellschaftsverständnis. Einheitsgewerkschaften wenden sich demgegenüber an sämtliche Arbeitnehmer, unabhängig von deren politisch-weltanschaulichen Orientierungen. International mit Abstand am weitesten verbreitet sind Richtungsgewerkschaften, vor allem solche sozialistischer bzw. sozialdemokratischer Prägung. Vergleichsweise seltener sind Richtungsgewerkschaften mit anderer politisch-weltanschaulicher Orientierung, wobei das Spektrum von der radikalen Linken bis hin zu christdemokratisch geprägten Verbänden reicht. Ungewöhnlich stark pluralisiert ist die Gruppe von Richtungsgewerkschaften unterschiedlicher politisch-ideologischer Ausrichtung traditionell in den Ländern Südwesteuropas, wo sich die Mehrzahl der bestehenden Verbände anhand dieses Kriteriums voneinander abgrenzen lässt (Traxler 2003: 545). In einigen Ländern sind die Beziehungen der Gewerkschaften zu den in politisch-ideologischer Hinsicht »verschwisterten« politischen Parteien besonders eng, so in Großbritannien, Irland und Schweden, wo es kollektive Mitgliedschaften von Verbänden bzw. deren Mitgliedsgewerkschaften in den betreffenden Parteien gibt. Die Gewerkschaftslandschaft der Bundesrepublik wird durch eine mächtige Einheitsgewerkschaft – den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) – dominiert.77 Trotz seines Charakters als Einheitsgewerkschaft weist der DGB traditionell enge Beziehungen zur Sozialdemokratie auf; dies gilt mit gewissen Abstrichen auch nach dem viel berufenen »Ende der privilegierten Partnerschaft« (Schroeder 2005). Ein »Gegengewicht« bildet auf dieser Ebene der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB), der mit seinen rund 300,000 Mitgliedern indes nicht einmal fünf Prozent der Mitglieder des DGB aufweist. Weiter diversifiziert wurde die Gewerkschaftsland- —————— 77 Vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte Deutschland hingegen zu jenen Ländern, deren Gewerkschaftslandschaft von Richtungsgewerkschaften bestimmt war, ohne dass allerdings die politisch-weltanschauliche Fragmentierung ein Niveau erreichte wie es bis heute vor allem für die romanischen Länder kennzeichnend ist. Vgl. Schneider (2000). INTERESSENGRUPPEN 95 schaft der Bundesrepublik jahrzehntelang durch die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG), bei der es sich um eine berufsorientierte, parteipolitisch unabhängige Gewerkschaft für Angestellte – also letztlich um eine Standesorganisation – handelte. Sie wurde 1949 gegründet und hatte zeitweilig mehr als 500,000 Mitglieder. Im Jahre 2001 fusionierte die DAG mit vier DGB-Gewerkschaften zur Vereinigten Dienstleistungsgesellschaft (ver.di), welche mit deutlich mehr als 2 Millionen Mitgliedern gemeinsam mit der IG Metal zu den beiden mit Abstand größten der seither acht Einzelgewerkschaften unter dem Dach des DGB zählt. Freilich gibt es weitere Verbände, gebildet von Gruppen, die ihre spezifischen Interessenlagen nicht durch den DGB repräsentiert sehen wie etwa der Deutsche Beamtenbund oder der Deutsche Journalistenverband. Die Binnendifferenzierung des DGB mit acht Mitgliedsgewerkschaften und insgesamt 6,778,429 Mitgliedern (2005) ist im internationalen Vergleich betrachtet gering, insbesondere gemessen an der außerordentlich stark fragmentierten Binnenstruktur der jeweiligen gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen in Portugal, Großbritannien oder Irland (Traxler 2003: 549–550). Auffälliger als dieses Merkmal, das der DGB mit Organisationen wie dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) teilt, ist die geradezu spektakuläre Entwicklung seiner Mitgliederzahlen. Mit einer Veränderung der absoluten Mitgliederzahl von knapp –24 Prozentpunkten im Zeitraum 1993 bis 2003 belegte Deutschland unter den westeuropäischen Ländern praktisch konkurrenzlos den negativen Spitzenplatz (Behrens 2005: 30). Der signifikante Mitgliederschwund des DGB erscheint umso dramatischer, wenn man berücksichtigt, dass viele der Spitzenverbände des westlichen Auslands im selben Zeitraum Mitgliederzuwächse, zum Teil in zweistelliger Höhe, zu verzeichnen hatten. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in der Bundesrepublik liegt zwar noch immer über dem der USA oder Frankreichs, aber nichtsdestotrotz deutlich unter dem der meisten übrigen europäischen Länder (Ebbinghaus 2003: 196). Ein fairer Vergleich der Mitgliederentwicklung muss jedoch die spezifischen Auswirkungen der deutschen Vereinigung auf die Organisationsfähigkeit des DGB berücksichtigen. Der DGB profitierte kurzfristig von der ansehnlichen Mitgliederzahl des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), musste im Gefolge der Systemtransformation in Ostdeutschland anschließend aber mit einer drastischen Erosion seiner Mitgliedsbasis zurechtkommen. So waren Austritte in den ostdeutschen Ländern allein im Zeit- 96 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE raum 1991 bis 1995 für 75 Prozent des Mitgliederrückgangs auf Seiten des DGB verantwortlich (Behrens 2005: 31). Analog zu der Situation in den Arbeitgeberverbänden sind organisatorische Ressourcen und tarifpolitische Kompetenzen auch beim DGB auf der Ebene der Einzelgewerkschaften, anstatt auf der Ebene des Dachverbands, konzentriert. Grundlegende Abweichungen von diesem Muster gibt es innerhalb Westeuropas nur vereinzelt, so in Belgien und Norwegen (Traxler 2003: 556–557). Was die Struktur innerverbandlicher Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb des DGB betrifft, so gilt – wiederum in Entsprechung zu der Situation in den Unternehmerverbänden – dass wichtige Entscheidungen schwerlich auf der Ebene von Mitgliederbzw. Delegiertensammlungen gefällt werden. Maßgeblich sind vielmehr die auf der obersten Organisationsebene, in aller Regel von den hauptberuflich im geschäftsführenden Vorstand tätigen Akteuren getroffenen Entscheidungen. Obwohl empirisch gesicherte Einsichten über die Struktur innerverbandlicher Willensbildung- und Entscheidungsfindung kaum verfügbar sind, spricht wenig dafür, im Hinblick auf andere Länder von stärker »basisdemokratisch« geprägten Entscheidungsverfahren auszugehen. Immerhin gibt es andererseits auch kaum Anzeichen dafür, dass die besonders fragwürdigen Standards innergewerkschaftlicher Entscheidungspraxis im Großbritannien der ersten Nachkriegsjahrzehnte, bei der auf innerverbandliche Demokratie praktisch vollständig verzichtet wurde (Fosh/Heery 1990), andernorts Schule gemacht hätten. Der 1948 gegründete Deutsche Bauernverband (DBV) als ein weiterer Akteur aus der Gruppe der traditionellen »Big Four« hat gegenüber der Zeit vor 1945 ein auch für deutsche Verhältnisse hohes Maß an konzentrierter Einheitlichkeit landwirtschaftlicher Interessenvertretung geschaffen. Sein Organisationsgrad liegt bei rund 90 Prozent. Anders als zu Zeiten der Weimarer Republik gibt es praktisch keine landwirtschaftlichen Konkurrenzvereinigungen. Die fortbestehenden Spannungen insbesondere zwischen landwirtschaftlichen Großbetrieben und Kleinbauern, die in einigen anderen Ländern bis heute Ausdruck auch auf der organisatorischen Ebene finden, haben sich dadurch nach innen verlagert. Der entscheidende Einfluss auf das strategische Handeln des DBV liegt bei den einzelnen Landesverbänden, die dem Bundesverband zum Teil auch im Hinblick auf organisatorische Ressourcen deutlich überlegen sind. Als charakteristisch gilt dabei eine faktische Dominanz von in Norddeutschland konzentrierten Großbetrieben (Heinze 1992). INTERESSENGRUPPEN 97 Die zentralisierte Struktur der landwirtschaftlichen Interessenvertretung in Deutschland kontrastiert besonders deutlich mit stärker pluralisierten Systemen wie jenem der Niederlande, wo es im Zuge der auch den landwirtschaftlichen Sektor betreffenden »Entsäulung« der neunziger Jahre zu einer organisatorischen Aufsplitterung landwirtschaftlicher Interessenvertretung kam (Kleinfeld 2001: 302). Strukturelle Abweichungen von dem in der Bundesrepublik realisierten Organisationsmodell des landwirtschaftlichen Sektors gibt es aber auch in institutionell verwandten Systemen wie der Republik Österreich: Als Interessenvertretung der Bauern fungieren dort die auf Landesebene verwurzelten Landwirtschaftskammern (Krammer/Hovorka 2006). Diese gibt es (mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg) auch in den Ländern der Bundesrepublik, doch stellen diese dort schwerlich die entscheidungspolitisch wichtigsten Akteure des landwirtschaftlichen Sektors dar. In vielen Ländern gelten die Bauernverbände als historisch und aktuell besonders einflussreiche und effektive Interessenvertreter – vermutlich nirgendwo mehr als in Irland (Elvert 2001: 210). Freilich korreliert, wie nicht zuletzt der irische Fall suggeriert, der Einfluss landwirtschaftlicher Interessenorganisationen in beträchtlichem Maße mit dem im Ländervergleich stark variierenden Stellenwert des Agrarsektors. Komparative Studien weisen darauf hin, dass es ebenfalls von großer Bedeutung ist, in welchem institutionellen und interessengruppenpolitischen Kontext Interessenverbände operieren. So konnte gezeigt werden, dass der Einfluss der landwirtschaftlichen Lobby in den USA – entgegen der verbreiteten Annahme einer besonders ausgeprägten Anfälligkeit des dortigen staatlichen Entscheidungssystems gegenüber der Beeinflussung durch »special interests« – im langfristigen Vergleich deutlich bescheidener blieb als in den institutionell grundlegend unterschiedlich beschaffenen Systemen Frankreichs und Japans (Sheingate 2001). Bei allen nationalen und regionalen Eigenheiten von Verbänden selbst innerhalb eines Sektors gibt es doch auch größere länderübergreifende Entwicklungstrends. Der aufälligste unter ihnen ist die zahlenmäßige Vermehrung von Interessenverbänden. Sie hat ihren wichtigsten Grund in der international zu beobachtenden kontinuierlichen »Pluralisierung von objektiven Lebensbedingungen und subjektiven Lebensentwürfen« (von Winter 1995: 147). Diese Erfahrung teilen so unterschiedliche Systeme wie die Bundesrepublik und die Vereinigten Staaten (Sebaldt 2004). Zu den verlässlichsten Quellen in Fragen der Anzahl potentiell relevanter Interes- 98 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sengruppen gehört hierzulande die seit den siebziger Jahren vom Präsidenten des Deutschen Bundestages geführte »Öffentliche Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern«. Auf ihr können sich Verbände bzw. Verbandsvertreter auf Antrag registrieren lassen. Waren auf dieser, regelmäßig im Bundesanzeiger veröffentlichten Liste 1974 lediglich 635 Verbände verzeichnet, so stieg deren Zahl bis zum Januar 2007 um mehr als das Dreifache auf 2003 an. Allerdings trifft die These von der wachsenden Pluralisierung und Ausdifferenzierung sektoraler Interessengruppenstrukturen, wie speziellere Untersuchungen belegen, keineswegs flächendeckend zu. Entwicklungsmuster aus dem Bereich zumeist hoch spezialisierter Umwelt-, Sozial- und Kulturverbände sind nicht ohne weiteres generalisierbar. Für die Ebene gewerkschaftlicher Organisationsstrukturen etwa gilt, dass die Differenzierungsprozesse auf der Ebene von Arbeitnehmerinteressen – ihrerseits eine Folge vor allem der Flexibilisierung von Arbeitsprozessen und der Dezentralisierung der Arbeitsbeziehungen – nicht zu einer analogen Fragmentierung der Gewerkschaftsstrukturen führten. Die Zahl der Spitzenverbände in den Ländern Westeuropas blieb nahezu konstant; auch die Veränderungen auf der Ebene der Mitgliedsgewerkschaften verliefen eher in Richtung Konzentration statt Differenzierung (Traxler 2003: 561). In Deutschland stieg im Gefolge der Vereinigung zwar die Zahl der regionalen Untergliederungen vieler Verbände an, kaum hingegen die Anzahl der Verbände selbst (Rudzio 2006: 58). Ursächlich dafür war der beispiellose »Transfer« des westdeutschen Verbändesystems nach Osten. Er blieb im Ergebnis freilich unvollständig. So gibt es sowohl auf der strukturellen als auch auf der funktionalen Ebene spezifische Besonderheiten der Interessengruppenlandschaft in Ostdeutschland (Niedermayer 1996b; Czada 1998; Padgett 2000b) – darunter nicht zuletzt die Selbstorganisationsfähigkeit von Spitzenverbänden –, welche in ihren Auswirkungen so grundlegend sind, dass in vielen international vergleichenden Studien West- und Ostdeutschland als zwei unterschiedliche »Fälle« behandelt werden. Ganz unabhängig von den spezielleren Entwicklungen in der Bundesrepublik ist festzustellen, dass die Existenz länderübergreifender Trends nicht zwangsläufig zu einer weitreichenden Angleichung unterschiedlicher Verbandslandschaften in den etablierten Demokratien führt. Das gilt auch im Hinblick auf die quantitative Dimension von nationalen Verbandspopulationen. Die nationale »Verbandsdichte« variiert im synchronen Ländervergleich sehr deutlich. Einen hohen Erklärungswert für die Größe INTERESSENGRUPPEN 99 einer »Verbandspopulation« besitzt die jeweilige Größe einer Volkswirtschaft (Weßels 2004: 205). Die Größe eines Landes bzw. die Höhe von dessen Bruttosozialprodukt ist im Übrigen nicht die einzige Variable auf der Ebene politischer Systeme mit Einfluss auf den Charakter von Verbändelandschaften. Ebenfalls von Bedeutung ist die jeweilige Staatsstruktur, konkret die Existenz eines Einheits- oder Bundesstaates. Der Einfluss der Staatsstruktur manifestiert sich konkret in der regionalen Homogenität bzw. Heterogenität der Verbandslandschaft eines Systems. Zwar gilt, dass die Verbändelandschaften in den meisten der liberalen Demokratien interregional heterogen sind. Allerdings sind sie in Einheitsstaaten alles in allem homogener als in Bundesstaaten, deutlich homogener allerdings nur im Vergleich mit nicht-unitarischen Bundesstaaten nach dem Muster der Schweiz oder den USA (Armingeon 2002a: 223, 225–226).78 4.3 Verbandssysteme Wie die Betrachtungen des vorausgehenden Abschnittes zeigen, gibt es selbst in einem einzigen System eine unüberschaubare Anzahl unterschiedlicher Interessenverbände, die in scheinbar keinerlei strukturiertem Beziehungsverhältnis zueinander stehen. Dies erschwert nicht nur den über einzelne Sektoren hinausgreifenden internationalen Vergleich, sondern hat bis in die jüngste Vergangenheit hinein die These befördert, dass »Verbändelandschaften weitgehend die systemische Qualität« ermangele (Kropp 2003: 233).79 Seit einigen Jahren gibt es jedoch verstärkt Versuche, den —————— 78 Dass der jeweilige Charakter des Föderalismus in einem System – konkret das ihn kennzeichnende Ausmaß an Unitarisierung – einen maßgeblichen Effekt auf die Ausgestaltung des Systems organisierter Interessen besitzt, haben für den deutschen Fall vor allem Renate Mayntz (1990a) und Gerhard Lehmbruch (2003) gezeigt. Beide betonen jedoch, dass eher von einem interdependenten Entwicklungsprozess zwischen dem Trend zur Unitarisierung staatlicher Politik und den Prozessen gesellschaftlicher Institutionenbildung als von einer einseitigen Prägung der Verbändestruktur durch die föderative Staatsorganisation auszugehen sei. 79 Im Rahmen speziellerer theoretischer Reflexionen wurde argumentiert, dass die relative Seltenheit internationaler Vergleiche innerhalb der Interessengruppenforschung einerseits und die besondere Schwierigkeit, Verbände in eine Systemper- 100 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE internationalen Vergleich innerhalb der politikwissenschaftlichen Verbändeforschung insbesondere durch die Entwicklung von Systemperspektiven zu intensivieren. Das gilt zunächst für den Konfliktlinien-Ansatz. Dass Verbände mit politischem Wirkungsanspruch dann und dort entstehen, wenn bzw. wo es ein gesellschaftliches Bedürfnis danach gibt, Interessen wirkungsvoll zu vertreten, ist eine Binsenweisheit. Die Theorie gesellschaftlicher Konfliktlinien »verlangt« aber, dass es nicht nur unterschiedliche Interessengruppen gibt, welche selbst Ausdruck gesellschaftlicher Interessen sind, sondern dass zugleich konfligierende Interessen existieren, dass es also Interessenkonflikte gibt, um die herum sich direkt aufeinander Bezug nehmende, gegnerische Gruppen organisieren (Weßels 2006: 15). Das ist empirischen Untersuchungen über ausgewählte Länder Westeuropas80 zufolge keineswegs für jede Interessengruppe der Fall. Immerhin sehen aber rund 60 Prozent derjenigen Befragten, die sich von (mindestens) einer Interessenorganisation vertreten fühlen, (mindestens) eine andere als ihren Interessen entgegenstehend an (ebd.: 16). Die Intensität und Reichweite der in Frage kommenden Konflikte bzw. Konfliktlinien ist, wie dieselbe Untersuchung zeigt, sehr unterschiedlich groß. Am mit Abstand stärksten ausgeprägt ist der Konflikt zwischen Umwelt- und Wirtschaftsinteressen, gefolgt von dem zwischen Arbeit und Kapital. Die Bedeutung der einzelnen Konfliktlinien variiert im Ländervergleich jedoch beträchtlich. Sowohl der Konflikt zwischen Wirtschaft und Umwelt als auch derjenige zwischen Arbeit und Kapital ist in Spanien am stärksten und in Großbritannien am schwächsten ausgeprägt. Hinsichtlich der Bedeutung der konfessionellen Konfliktlinien besetzen Nordirland (stark) und Ostdeutschland (schwach) die Extrempole des Ländersamples. Westdeutschland liegt bezüglich der Stärke aller gemessenen Konflikte deutlich über dem Durchschnitt des bearbeiteten Ländersamples. In einem weiteren Schritt gelingt es Weßels (ebd.: 17–20) zu zeigen, dass Verbände nicht lediglich ein System der Interessenvermittlung formen, welches durch konfligierende Interessenkonstellationen geprägt ist, sondern dass in den —————— spektive zu integrieren andererseits in engem Zusammenhang miteinander stehen (von Alemann/Weßels 1997: 11). 80 Berücksichtigt wurden Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien. Für Deutschland wurde zwischen Ost- und Westdeutschland differenziert. Ferner wurde Nordirland, trotz seiner Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich, getrennt ausgewiesen. INTERESSENGRUPPEN 101 Augen der Bürger zugleich starke »Vertretungsallianzen« im Verhältnis zwischen bestimmten Parteien und Verbänden bestehen. So fühlen sich beispielsweise Bürger, die ihre Interessen von den Gewerkschaften vertreten sehen, in überdurchschnittlich hohem Maße von linken Parteien, solche, die sich in besonderem Maße durch die Kirchen vertreten sehen, hingegen vor allem von christdemokratischen Parteien repräsentiert. Sowohl für Deutschland als auch für die anderen berücksichtigten Länder deuten die verfügbaren Daten darauf hin, dass es sich um Strukturen von beträchtlicher Persistenz handelt. Abgesehen vom Konfliktlinien-Ansatz sind Systemverständnisse innerhalb der Interessengruppenforschung vor allem im Rahmen der Erforschung und Bestimmung des Verhältnisses zwischen Verbänden und Staat verbreitet. In der Literatur herrschte lange die Tendenz vor, zwischen Pluralismus und Korporatismus zu unterscheiden und diese als streng voneinander geschiedene gegensätzliche Grundformen der Interessenvertretung in den etablierten Demokratien zu begreifen. Aus der Perspektive des Pluralismus bzw. Neo-Pluralismus streben miteinander konkurrierende Verbände danach, von außen auf den Staat Einfluss zu nehmen und dadurch ihre Interessen in gesamtgesellschaftlich verbindliche Entscheidungen umzusetzen. Im korporatistischen Modell nehmen Interessengruppen hingegen nicht nur Einfluss auf politische Entscheidungen eines mehr oder minder als »black box« gedachten staatlichen Steuerungszentrums, sondern sind zudem an der Formulierung, Ausarbeitung und Implementierung staatlicher Entscheidungen und legislativer Projekte mitbeteiligt. Zumindest der »idealtypische Korporatismus« – welcher eine tripartistische Konstellation (zwischen zwei gegnerischen Interessenverbänden und dem Staat) bezeichnet – ist deshalb »Interessenvermittlungs- und Steuerungsinstrument in einem« (Abromeit 1993: 147–148). In jüngeren Arbeiten der vergleichenden Forschung wurde die Vorstellung eines theoretisch und empirisch ergiebigen Dualismus zwischen Pluralismus und Korporatismus weitgehend aufgegeben. In um Differenzierung bemühten Annäherungen an die Realität des komplexen Verhältnisses zwischen Verbänden und Staat in den liberalen Demokratien wurde etwa zwischen Pluralismus, Elitismus, Etatismus, Neo-Korporatismus und Konsoziationismus unterschieden (Crouch/Menon 1997: 151–155). Selbst in Arbeiten, denen der Gegensatz zwischen Pluralismus und Korporatismus weiterhin als zentrale Ordnungskategorie dient, regiert die Einsicht, dass in der Realität »korporatistische Strukturen […] auf bestimmte Politik- 102 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE felder beschränkt sind und zumeist mit pluralistischer Nachbarschaft koexistieren« (Abromeit/Stoiber 2006: 201). Angesichts der großen Bedeutung, die das korporatistische Paradigma insbesondere für das international vergleichende Studium von Interessenvermittlungsstrukturen spielte bzw. noch immer spielt81, erscheint es sinnvoll, an dieser Stelle die wichtigsten theoretischen und empirischen Aspekte der Korporatismusdebatte in aller Kürze zu rekapitulieren. Dem Begründer des Korporatismus-Paradigmas, Philippe Schmitter, ging es vor allem um die Erfassung der strukturellen Voraussetzungen bzw. Komponenten korporatistischer Interessenvermittlung. Dabei wurde Korporatismus als ein System der Interessenvermittlung definiert, dessen wesentliche Bestandteile in einer begrenzten Zahl singulärer Zwangsverbände organisiert sind, die nicht miteinander in Wettbewerb stehen, über eine hierarchische Struktur verfügen und nach funktionalen Aspekten voneinander abgegrenzt sind. Sie verfügen über staatliche Anerkennung oder Lizenz, sofern sie nicht sogar auf Betreiben des Staates hin gebildet worden sind. Innerhalb der von ihnen vertretenen Bereiche wird ihnen ausdrücklich ein Repräsentationsmonopol zugestanden, wofür sie als Gegenleistung bestimmte Auflagen bei der Auswahl des Führungspersonals und bei der Artikulation von Ansprüchen oder Unterstützung zu beachten haben (Schmitter 1974, 1977). Bei Gerhard Lehmbruch, dem Mitbegründer des korporatistischen Paradigmas, ging es – in komplementärer Ergänzung zu den auf die strukturellen Komponenten des Korporatismus konzentrierten Arbeiten Schmitters – stärker um die prozessualen Komponenten der Absprache und Einbindung als Steuerungsinstrument staatlicher Wirtschaftspolitik (Lehmbruch 1974, 1977). Die jüngere vergleichende Korporatismusforschung ist von dem Bemühen geprägt, sowohl die strukturelle als auch die prozessuale Dimension gebührend zu berücksichtigen, zumeist unter stärkerer Betonung der zuletzt genannten. Die internationale Forschung hat in den vergangenen drei Jahrzehnten zahlreiche unterschiedliche Indizes entwickelt, auf deren Grundlage versucht wurde, den »Korporatismusgrad« in unterschiedlichen liberalen Demokratien zu bestimmen. Zu den in empirischer Hinsicht bemerkenswerten Befunden gehört der Umstand, dass zwischen den unterschiedlichen Indizes ein ausgesprochen hohes Maß an Übereinstimmung besteht. Als hochgradig korporatistisch wurden – auch unter Berücksichtigung unter- —————— 81 Vgl. hierzu statt vieler Traxler (2001) und Molina/Rhodes (2002). INTERESSENGRUPPEN 103 schiedlicher Bewertungszeitpunkte zwischen den sechziger und späten neunziger Jahren – insbesondere Österreich, Norwegen und Schweden klassifiziert. Übereinstimmend als nicht-korporatistisch bewertet wurden hingegen die angelsächsischen Demokratien (USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Großbritannien, Irland) und Italien. Deutschland gilt, gemeinsam mit Ländern wie Dänemark und den Niederlanden, als Beispiel für ein moderat korporatistisches System (Armingeon 2002b: 153–155).82 Detaillierte Einschätzungen lassen sich nur für einzelne Länder und – nicht minder wichtig – für einzelne Perioden formulieren. Signifikante Veränderungen bezüglich des Grades an Korporatismus innerhalb eines Landes blieben den international maßgeblichen Bewertungen zufolge eine große Seltenheit. Innerhalb eines von relativ hoher Stabilität geprägten Gesamtszenarios waren Veränderungen in Richtung einer Intensivierung korporatistischer Interessenvermittlung während der vergangenen rund 20 Jahre vor allem für einige der südwesteuropäischen Länder kennzeichnend (Royo 2002; Crouch 2003: 200–201). In Deutschland verblieben Anläufe zu einer Neugeburt tripartistischer Steuerung in Gestalt des »Bündnisses für Arbeit« hingegen weitgehend, wenn auch nicht vollständig, auf der Ebene symbolischer Politik (Fickinger 2005). Manifestationen von sektoralem Korporatismus im weiteren Sinne hat es in der Bundesrepublik praktisch immer gegeben. Als die eigentliche Hochphase des Korporatismus in der Bundesrepublik gilt jedoch zu Recht die Periode zwischen dem Ende der sechziger Jahre und der Mitte der siebziger Jahre. Während dieser Zeit wurde im Rahmen der sogenannten »Konzertierten Aktion« nach einem tripartistischen Konsens vor allem über Fragen einer gesamtwirtschaftlich verantwortungsvollen Lohnpolitik gesucht. Neben der österreichischen »Sozialpartnerschaft« und dem niederländischen »Sozialökonomischem Rat« galt die »Konzertierte Aktion« vorübergehend als »eins der Paradebeispiele korporatistischer Steuerung« (Abromeit 1993: 166). Ursächlich für ihr frühes Scheitern waren sowohl organisatorische Defizite (insbesondere die Größe und Heterogenität des Teilnehmerkreises) als auch nur kurzfristig überbrückbare inhaltliche Differenzen, speziell über die Frage einer angemessenen Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer an Umsatzzuwächsen der Unternehmen. Eher das Prä- —————— 82 »Sonderfälle« verkörpern Japan, Frankreich und die Schweiz, da in diesen Ländern entweder die institutionellen Voraussetzungen des Korporatismus oder die Einbeziehung der Gewerkschaften in die bestehenden Verhandlungssysteme vermisst werden (ebd.). 104 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE dikat »Multipartismus« verdienen die im weiteren Sinne »korporatistischen Arrangements« in der Gesundheitspolitik (Wiesenthal 1981), welche sich als deutlich langlebiger erwiesen. Die historischen Konjunkturen der Konzertierung in der Bundesrepublik sprechen, zumindest auf den ersten Blick, für die These vom sozialdemokratischen Charakter des Korporatismus (Lehmbruch 1982). Die strukturellen Voraussetzungen korporatistischer Interessenvermittlung und Steuerung auf Seiten des Staates wurden erst im Zuge der erstmaligen Beteiligung der Sozialdemokraten an der Bundesregierung geschaffen (Weßels 1999: 93). Dazu zählte nicht zuletzt das 1967 von der großen Koalition verabschiedete Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (»Stabilitätsgesetz«), welches der Regierung erstmals ein konjunkturpolitisches Instrumentarium an die Hand gab, um die vier potentiell einander widerstrebenden gesamtwirtschaftlichen Kernziele Preisstabilität, Vollbeschäftigung, Wachstum und Außenhandelsgleichgewicht in koordinierter Weise zu verfolgen. Es wurde ergänzt durch die Entwicklung einer mehrjährigen, an gesamtgesellschaftlichen Zielprojektionen orientierten staatlichen Finanzplanung (ebd.: 93). Die in den sechziger Jahren um sich greifende »Planungseuphorie« als eine der Triebfedern des »Makrokorporatismus« verflüchtigte sich lange vor dem Ausscheiden der Sozialdemokraten aus der Bundesregierung im Herbst 1982. Gleichwohl schienen die langen Jahre der Regierung Kohl die These vom sozialdemokratischen Charakter des Korporatismus gleichsam ex negativo zu bestätigen. Zum Kennzeichen der christlich-liberalen Regierung wurde ein Politikstil, der auf korporatistische Formen der Interessenvermittlung und Steuerung weitestgehend verzichtete. Zu den wichtigsten Lehren des Scheiterns des unter der Regierung Schröder praktizierten »Bündnisses für Arbeit« gehört dagegen die Einsicht, dass auch eine führende Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie keinerlei Erfolgsgarantie für korporatistische Interessenvermittlung und Steuerung bietet. Freilich lässt sich über die Ernsthaftigkeit diesbezüglicher Bestrebungen auf Seiten der rot-grünen Koalition spekulieren. Für viele Betrachter ging es der Regierung und insbesondere dem Kanzler bei der gesamten Veranstaltung schon lange vor dem endgültigen Scheitern des Bündnisses im Frühjahr 2003 primär um medienwirksame Selbstpräsentation. Entscheidender war jedoch gewiss die Auflösung der interessenpolitischen und mentalen Voraussetzungen korporatistischer Interessenvermittlung – der Verpflichtungsfähigkeit nach innen und der Kompromissfähigkeit nach außen – auf Seiten der Eliten von INTERESSENGRUPPEN 105 Arbeit und Kapital, die auch ein beherzteres Agieren der Bundesregierung kaum hätte verhindern können (Streeck 2005). Neues Licht auf das spezifische Leistungsprofil des Interessengruppenvermittlungssystems in der Bundesrepublik wirft eine vergleichende Untersuchung von Heidrun Abromeit und Michael Stoiber, in der es vor allem um das bestehende Verhältnis zwischen dem Inklusivitätsgrad eines Interessenvermittlungssystems einerseits und dessen Grad an Symmetrie bzw. Asymmetrie bei der Berücksichtigung der Interessen von Arbeit und Kapital andererseits geht (Abromeit/Stoiber 2006). Das in demokratietheoretischer Hinsicht wünschenswerteste Profil wäre ein System mit hoher Inklusivität und geringer Asymmetrie. Von den neun bei Abromeit und Stoiber untersuchten westeuropäischen Ländern kommt bzw. kam Schweden dieser »Wunschkombination« am nächsten. Das bis in die neunziger Jahre hinein bemerkenswerte Maß an Symmetrie in der politischen Repräsentations- und Einflussstärke zwischen Arbeit und Kapital war dort vor allem Ergebnis der engen Verbindungen zwischen den Gewerkschaften (LO) und der regierenden Sozialdemokratischen Partei Schwedens (SAP). Dadurch konnte die für kapitalistische Gesellschaften typische Vormacht der Arbeitgeberseite ausgeglichen bzw. sogar vorübergehend übertrumpft werden. Für den hohen Inklusionsgrad waren demgegenüber spezifische institutionelle Gelegenheitsstrukturen – darunter insbesondere die »verbändefreundliche« Struktur des Gesetzgebungsverfahrens mit einem zugangsoffenen Vernehmlassungsverfahren und die Existenz von Minderheitsregierungen – verantwortlich.83 Deutschland erscheint dagegen als ein formal relativ stark auf Inklusion gestimmtes System, das jedoch aufgrund der geringen Anzahl institutionalisierter Vetopunkte für den Einfluss von Interessengruppen, der unterschiedlich ausgeprägten Anfälligkeit der politischen Parteien für bestimmte Interessenteneinflüsse sowie den unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen der Interessenorganisation gleichwohl zu hoher Selektivität führt. »Während die grundlegende Asymmetrie zwischen Kapital und Arbeit den meisten Interessenvermittlungssystemen gemeinsam ist, ergeben sich spezifische Selektivitäten in Deutschland zum einen aus dem asymmetrischen Parteiensystem, in dem die Gewinnchancen ungleich verteilt sind […], zum zweiten aus der Bremswirkung des mit einer einzigen historischen Ausnahme (1990er Jahre) bürgerlich dominierten Bundesrats, und zum dritten schließlich aus der besonderen Funktion der —————— 83 Vgl. hierzu auch Czada (1993) 106 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Kammern, die sektorale Selbstregulierung aufs Beste mit quasi autoritativer Interessenvertretung im staatlichen Entscheidungssystem verbinden. Solche Kammern gibt es für Industrie und Handel, für Landwirtschaft, für Ärzte etc. – nicht aber für Arbeit.« (Abromeit/Stoiber 2006: 238)84 4.4 Konklusion Die schillernde Vielfalt bunter Blüten, die der interessenpolitische Pluralismus in Deutschland und den anderen konsolidierten liberalen Demokratien in den vergangenen Jahrzehnten hervorgetrieben hat, ist symbolhaftes Zeugnis der großen Bedeutung, die den unterschiedlichen Gruppen für die politische Lebendigkeit eines demokratischen Gemeinwesens zukommt. Die Artenvielfalt demokratischer Interessengruppen in den entwickelten liberal-demokratischen Systemen ist nicht zuletzt den zahllosen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Vereinigungen mit überwiegend geringem Institutionalisierungsgrad zu verdanken, denen im Rahmen dieser Bestandsaufnahme zugunsten einer tiefer schürfenden Behandlung der etablierten Interessenverbände des Wirtschafts- und Arbeitsbereichs nur ganz am Rande Aufmerksamkeit geschenkt werden konnte. Im Zuge der vielerorts zu beobachtenden Tendenz zur schleichenden Etatisierung der politischen Parteien haben sie im Hinblick auf die gegenwärtige und künftige Gewährleistung des gesellschaftlichen Pluralismus jenseits des staatlichen Institutionensystems sogar an Bedeutung gewonnen. Auch was die Entwicklungsgeschichte von im engeren Sinne politischen Interessengruppen unterschiedlichen Schlags betraf, kann Deutschland kaum zu den internationalen Wegbereitern gezählt werden. Zumindest im Falle von Organisationen des industriellen Sektors stand dem die, vor allem im Vergleich zu England, verzögerte Industrialisierung entgegen. Anders als die politischen Parteien gehörten die Interessengruppen in Deutschland aber auch nicht zu den abgeschlagenen Spätentwicklern. Spezifisch unterentwickelt blieb lediglich das Verständnis für den potentiell —————— 84 Die Nichtexistenz einer Arbeiterkammer in der Bundesrepublik (mit Ausnahme des Landes Bremen) gehört jedoch zu den Kennzeichen nicht nur des deutschen Systems, sondern der Verbändesysteme praktisch sämtlicher westlicher Länder. Lediglich in Österreich gibt es Arbeiterkammern, die erstmals 1920 geschaffen und 1945 neu errichtet wurden. INTERESSENGRUPPEN 107 positiven Beitrag von Interessengruppen zur Demokratie. Vor allem unter intellektuellen Beobachtern und politischen Akteuren hielten sich einschlägige Vorbehalte noch länger als der »Antiparteienaffekt« und das eigentümliche Unverständnis für die parlamentarische Regierungsweise. Nicht nur in Deutschland lange Zeit unterentwickelt blieb die international vergleichende Erforschung von Interessengruppen und Interessengruppenpolitik. Zu einem Katalysator wurde die Begründung des Korporatismusparadigmas in den siebziger Jahren. Der komparative Impuls hat sich jedoch auch nach der Bedeutungseinbuße des Korporatismus als makroökonomischem Steuerungssystem nicht verflüchtigt und seither die unterschiedlichsten Bereiche der Interessengruppenforschung bis hin zu den neuen sozialen Bewegungen und NGOs erobert (Kriesi u.a. 1995; Guigni 2004). Zu den zentralen Befunden der historisch und international vergleichenden Interessengruppenforschung gehört die eigentümliche Ambivalenz zwischen dem scheinbar unaufhaltbar voranschreitenden Prozess der stetigen Vermehrung von Akteuren einerseits und den sektoralen Fusionsund Konzentrationstendenzen andererseits. Hinzu kommt, speziell auf der Ebene international agierender Großunternehmen, eine markante Tendenz zur Individualisierung der Interessenpolitik und -wahrnehmung. Umstritten bleibt vor allem, welche theoretischen Folgerungen aus diesen Entwicklungen zu ziehen sind. Viele Autoren attestieren, nicht selten mit kritischem Unterton, einen Wandel »vom Korporatismus zum Lobbyismus« (von Winter 2004), der von Anhängern der klassischen Pluralismustheorie eher wie eine normativ zu begrüßende Rückkehr zur »Normalität« betrachtet wird. Beides ist so vermutlich nicht haltbar. Einerseits bestehen korporatistische Strukturen in gewandelter Form vielerorts auch nach dem Ende des »makrokorporatistischen Zeitalters« fort (Traxler 2001). Andererseits lässt sich selbst im Hinblick auf Länder, in denen es in den vergangenen Jahren zu einem besonders weitreichenden Rückbau korporatistischer Strukturen gekommen ist, kaum von einem »neuen Gleichgewicht« unterschiedlicher Akteure und Interessen sprechen. Die als Folge vor allem ökonomischer Internationalisierungsprozesse potenzierte Macht global agierender Unternehmen geht mit Herausforderungen einer neuen Dimension einher (vgl. Kapitel 10). Das spezifische Veto- und Drohpotenzial mächtiger Unternehmen macht den Staat zwar nicht zwingend zur leichten Beute ökonomischer Partikularinteressen, aber es hat auch in Europa zu Formen des »reverse lobbying« (Shaiko 1998), der 108 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE gezielten Einflussnahme des Staates auf Akteure des privaten Sektors, geführt, die bislang so nur aus den USA bekannt waren. Die Suche nach geeigneten Antworten auf die im doppelten Sinne (auf Seiten der Interessengruppen wie des Staates) veränderten Bedingungen von Interessenpolitik gehört ohne Zweifel zu den komplexesten Gegenständen auf der internationalen Agenda zur »Demokratisierung der Demokratie« (Offe 2003). 5 Massenmedien: Spiegel und Katalysatoren politischer Macht Von allen großen Institutionen des intermediären Sektors wurden die Medien als letzte zu einem Gegenstand der politikwissenschaftlichen Demokratieforschung. Nach traditionellem politikwissenschaftlichen Verständnis, wie es sich noch immer im thematischen Zuschnitt vieler Referenzwerke zum deutschen Regierungssystem offenbart (vgl. etwa Schmidt 2003; von Beyme 2004), zählen die Medien nicht zum Kreise der genuin politischen Institutionen. Aus dieser Perspektive erscheint auch das Mediensystem weniger als ein Teilbereich des politischen Systems denn als eine eigenständige Sphäre, deren Erforschung vorrangig der Medienwissenschaft obliegt. Während der vergangenen ein bis zwei Jahrzehnte hat sich das Interesse der internationalen Politikwissenschaft an den Medien jedoch unübersehbar deutlich intensiviert. Dabei dominieren Arbeiten, denen es um die Erfassung der vielfältigen Effekte der Medien auf einzelne politische Akteure, das politische Institutionensystem und den politischen Prozess geht. Die in diesem Kontext formulierten Diagnosen reichen von Veränderungen im strategischen und taktischen Verhalten einzelner Akteure, so im Falle der (vermeintlichen) »Präsidentialisierung« politischer Führung in den parlamentarischen Demokratien (Poguntke/Webb 2005), bis zu grundlegenden systemischen Wandlungen der gesamten politischen Ordnung wie sie mit der Rede von der »Mediendemokratie«, der »Mediokratie« oder der »Mediengesellschaft« 85 zum Ausdruck gebracht werden. —————— 85 Dabei handelt es um den vielleicht treffendsten Begriff zur Bezeichnung der verbreitet wahrgenommenen Veränderungen. Nach Jarren (2001: 11) ist die »Mediengesellschaft« insbesondere durch folgende Charakteristika gekennzeichnet: eine quantitative und qualitative Ausbreitung der publizistischen Medien, die Entstehung neuer Medienformen, eine signifikante Zunahme der Vermittlungsleistung und -geschwindigkeit von Informationen durch Medien, eine immer stärkere Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche durch die Medien sowie schließlich eine gewachsene Aufmerksamkeit der Gesellschaft gegenüber den Medien, 110 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt demgegenüber auf den Medien bzw. den Mediensystemen der liberalen Demokratien als abhängiger Variable. Die mangelnde Berücksichtigung länderspezifischer Charakteristika der »Medienlandschaft« markiert einen der zentralen Schwachpunkte vieler der auf die konsolidierten Demokratien konzentrierten Arbeiten des Forschungsfeldes. Während die Demokratisierungsforschung durchaus nach Differenzierung strebt, insofern sie gezielt nach dem jeweils verwirklichten Grad der politischen Freiheit der Medien in »Transformationsländern« und jungen Demokratien fragt (Voltmer 2005), wird die Existenz eines pluralistisch strukturierten Mediensystems als Grundmerkmal freiheitlicher Demokratie in vielen Arbeiten über politische Kommunikationsstrukturen in den alten Demokratien gleichsam als selbstverständlich vorausgesetzt und den teils gravierenden Unterschieden zwischen Mediensystemen einzelner Länder dieser Gruppe allenfalls am Rande Beachtung geschenkt. Spezifische Konfigurationen im Zusammenspiel etwa von Regierungen und Medien, oder ganz allgemein der Stellenwert der Medien im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, werden primär mit den institutionellen Unterschieden auf der Ebene des Verfassungssystems, wie insbesondere dem Gegensatz zwischen parlamentarischer und präsidentieller Regierung, und den kulturellen Eigenheiten politisch-gesellschaftlicher Systeme erklärt (Beyme/Weßler 1998; Pfetsch 2003). Im Folgenden ist zunächst nach den potentiellen politischen Funktionen der Medien in der bzw. für die Demokratie zu fragen. In den daran anschließenden Abschnitten geht es um die Vergegenwärtigung der historischen Grundlagen und Evolution der unterschiedlichen Massenmedien sowie um einen typologisierenden Vergleich der »Medienlandschaften« in den heute etablierten Demokratien. 5.1 Der Stellenwert und die politischen Funktionen der Medien in der Demokratie Als die im engeren Sinne politischen Funktionen der Massenmedien in der Demokratie gelten gemeinhin die Informationsfunktion, die Mitwirkung an —————— welche mit einer steigenden gesellschaftlichen Anerkennung medialer Akteure einhergeht. MASSENMEDIEN 111 der Meinungsbildung sowie die Kontrolle und Kritik anderer politischer Akteure, vor allem der Regierung (Meyn 2004: 24). Weitere Differenzierungen sind freilich möglich, etwa durch die Unterscheidung einer spezielleren Thematisierungsfunktion im Funktionskontext von Kritik und Kontrolle (ebd.: 27). Andere Autoren unterscheiden Primär-, Sekundär- und Tertiärfunktionen (Strohmeier 2004a: 72–75). Als Primärfunktion von Massenmedien erscheint dabei die Herstellung von Öffentlichkeit. Zu den politischen Sekundärfunktionen werden Information und Kontrolle gerechnet. Bei den Tertiärfunktionen – genannt wurden: politische Sozialisation und Integration, politische Meinungs- und Willensbildung sowie »politische Bildung und Erziehung« (ebd.: 73) – handelt es sich um eher mittelbar wirksam werdende Funktionen, sofern sie im Einzelnen überhaupt empirisch nachgewiesen werden können und nicht lediglich als normativ erwünscht gelten. Die Kontroll-, Kritik- und Thematisierungsfunktion von Massenmedien erinnert stark an das Funktionsprofil der parlamentarischen Opposition in der parlamentarischen Demokratie. Es fehlt lediglich die Alternativfunktion, über die die Massenmedien freilich nicht verfügen, auch wenn einige Beobachter den Medien vereinzelt so etwas wie eine effektive Teilhabe an der Regierungsfunktion zuerkennen. Tatsächlich ist es in der internationalen Literatur keineswegs unüblich, die Medien als funktionales Äquivalent effektiv agierender Oppositionsparteien zu betrachten. Entsprechende Bewertungen wurden, kaum überraschend, vor allem für Japan für die Zeit der jahrzehntelangen Alleinherrschaft der LDP formuliert (Krauss 1996: 360); auf einschlägige Interpretationen stößt man jedoch auch in der jüngeren Debatte über die Politik in der Bundesrepublik (Dahrendorf 2002). Die Existenz eines nicht selten ansehnlichen Kontroll- bzw. Oppositionspotentials der Massenmedien gegenüber der Regierung spricht gleichwohl nicht für die populäre Klassifizierung der Massenmedien als »vierte Gewalt«. Als fehlgeleitet erscheint eine solche Klassifikation nicht so sehr deshalb, weil die Medien als Kontrollinstanz sämtlichen der verfassungsrechtlich konstituierten Gewalten gegenüberstehen. Die allseitige Machtbegrenzung, bei der jede der drei konstitutionellen Gewalten (Exekutive, Legislative und Judikative) den übrigen gegenübergestellt ist, bildet gerade das zentrale Kennzeichen klassischer Konzeptionen der institutionellen Gewaltenteilung wie sie bis heute das Regierungssystem der USA prägen (Goldwin/Kaufman 1986; Knight 1989). In struktureller Hinsicht er- 112 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE scheint eine Bezeichnung der Medien als »vierte Gewalt« vielmehr deshalb als verfehlt, weil die Massenmedien in keinem Land den drei konstitutionellen Gewalten im Hinblick auf ihren normativen Status und ihre institutionelle Unabhängigkeit auch nur annähernd gleichgestellt sind. Das gilt schon für den Sektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der in einigen Ländern, wie Spanien oder lange Zeit auch Frankreich, sogar in besonderem Maße als faktischer Hoheitsbereich regierender Mehrheiten betrachtet wurde (Humphreys 1986: 111–158). Vorbehalte gegenüber einem Verständnis der Medien als »vierter Gewalt« sind aber selbst dann angezeigt, wenn es ausschließlich um die Erfassung der funktionalen Dimension der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Akteuren geht. Dann nämlich wären die Medien, ganz im Sinne unterschiedlicher Ansätze der »aufgeklärten« Gewaltenteilungslehre, in einem Kontext mit zahlreichen unterschiedlichen nicht-staatlichen Akteuren zu verorten, die alle im weiteren Sinne kontrollierenden Einfluss auf das Handeln von Akteuren des staatlichen Entscheidungssystems zu nehmen trachten (Loewenstein 1957; von Arnauld 2001; Helms 2006c). In der jüngeren Literatur wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass weder das Gewaltenteilungsparadigma noch das Instrumentalisierungsparadigma der Rolle der Medien in der Demokratie bzw. dem Verhältnis zwischen Massenmedien und politischem System gerecht werden. Vielmehr besteht zwischen dem politischen System im engeren Sinne und dem Mediensystem »ein Interaktions- und Handlungszusammenhang mit wechselseitigen Abhängigkeiten« (Sarcinelli 2005: 111). Im Zentrum dieser Interaktionsbeziehung steht das Prinzip des Tausches zwischen Information gegen Publizität. Freilich wird das dynamische Kräfteverhältnis einer solchen Beziehung maßgeblich durch den jeweiligen Tauschwert der angebotenen Güter bestimmt. Nur auf den ersten Blick mag es so scheinen, als wenn sich das Bedürfnis der Medien nach Informationen und das Streben nach Publizität auf Seiten staatlich-politischer Akteure86 die Waage hielten und gleichsam von selbst ein »harmonisches Miteinander« erzeugten. In den gegenwärtigen konsolidierten Demokratien gibt es stattdessen vielfältige Anzeichen dafür, dass sich Akteure des staatlichen Entscheidungssystems gezwungen sehen, den Medien ganz bestimmte, nicht zuletzt ökono- —————— 86 Für die Akteure des politischen Entscheidungs- und Einflusssystems kommt hinzu, dass die Massenmedien wichtige »Umweltbeobachtungsysteme« darstellen, welche sowohl der Selbstbeobachtung der Politik als auch der Beobachtung der gesellschaftlichen Umwelt dienen (Sarcinelli 2005: 267). MASSENMEDIEN 113 misch verwertbare Leistungen mit hohem Nachrichten- und Unterhaltungswert anzubieten, um dafür im Gegenzug die begehrte Ressource Öffentlichkeit zu erhalten. Das ist im Kern gemeint, wenn in Teilen der Literatur von einer Annäherung und teilweisen Ersetzung der »Logik der Politik« durch die »Logik der Medien« oder einer »Kolonisierung der Politik durch die Medien« die Rede ist (Th. Meyer 2001; Kriesi 2003). Ohne politische Kommunikation, ohne kommunikative Begründungsleistung entbehrt das Handeln politischer Entscheidungseliten in der repräsentativen Demokratie der Legitimität. Politische Entscheidungsträger, die danach streben, eine größtmögliche Legitimität ihres Handelns zu gewährleisten, sind dabei zwingend auf die spezifische Vermittlungsleistung der Massenmedien angewiesen. Das war in gewisser Weise schon immer so, jedenfalls seit der Entstehung der Massendemokratien im 19. Jahrhundert. Bereits in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg bezog der weitaus größere Teil der Bevölkerung sein Wissen über das Handeln des Staates und andere gesamtgesellschaftlich relevante politische Entwicklungen aus den Medien (in diesem Fall der Presse) und nur im Einzelfall über die persönliche Teilnahme an politischen Versammlungen oder ähnlichem. Insofern überrascht es ein wenig, dass die Politikwissenschaft erst seit einigen Jahren mehr oder minder übereinstimmend eine »Mediatisierung« von Politik konstatiert (Bennett/Entman 2001). In der Tat gibt es jedoch Anzeichen dafür, dass die Kommunikationsempfindlichkeit der Gesellschaft, die Kommunikationsabhängigkeit von als legitim empfundener Politik in den konsolidierten Demokratien zugenommen hat (Sarcinelli 2005: 90). Im Zuge dessen haben sich auch die Anforderungen an die Fähigkeiten politischer Spitzenakteure in der jüngeren Vergangenheit sukzessive erhöht. Die erfolgreiche Durchsetzung politischer Vorhaben ist heute weitgehend an das Vermögen geknüpft, sowohl den spezifischen Herausforderungen auf der Ebene von Entscheidungspolitik als auch jenen auf der Ebene von Darstellungspolitik gerecht zu werden. Zwischen beiden besteht ein dynamisches und spannungsgeladenes Verhältnis. Als problematisch muss insbesondere die mögliche – durch die Funktionslogik der »Mediendemokratie« begünstigte – Abkoppelung der Darstellungspolitik von der Entscheidungspolitik gelten (Korte/Hirscher 2000). Über die vielfältigen Herausforderungen der Demokratie durch die Massenmedien – nicht allein die »traditionellen Medien« (Presse, Radio, Fernsehen), sondern auch die »neuen Medien« (wie insbesondere das In- 114 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE ternet) – ließe sich lange handeln.87 In den weiteren Teilen dieses Kapitels geht es stattdessen schwerpunktmäßig um eine Rekonstruktion der historischen Herausbildung der Massenmedien und die Beleuchtung der strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Mediensysteme der konsolidierten Demokratien. 5.2 Die Evolutionsgeschichte der Massenmedien in den heute etablierten Demokratien Am Beginn der Geschichte der Massenmedien stand die Presse. Sie ist das älteste und bis heute in hohem Maße politisch relevante Massenmedium. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein handelte es sich bei den zum Teil seit dem 17. Jahrhundert existierenden Zeitungen (wie der Leipziger Zeitung oder der London Gazette) nicht wirklich um Massenmedien, sondern eher um Medien, die dem mehr oder minder geschlossenen Diskurs innerhalb der herrschenden bürgerlichen Schicht dienten. Für die Entwicklung der Presse zu einem wirklichen Massenmedium war ein Bündel unterschiedlicher Faktoren verantwortlich. Dazu gehörten verschiedene technische Innovationen wie die Telegrafie und das Telefon, ferner die Begründung internationaler Nachrichtenagenturen (wie Reuter in London oder Wolff in Berlin) während der dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts, schließlich die schrittweise Abschaffung rechtlicher Restriktionen wie insbesondere hohe staatliche Gebühren bzw. Steuern für Werbeanzeigen und Druckpapier (Gorman/McLean 2003: 7–8). Bemerkenswerter Weise entsprach der in vielen Ländern parallel zur Demokratisierung politischer Ordnungen sich vollziehenden Herausbildung einer Massenpresse in den seltensten Fällen eine eindeutig auf die Gesellschaft als Ganze bezogene »Politisierung« der Presse. »Ironically, at the very time when the vote was extending democratic national political life in most countries, and when consequently the voice of larger groups in society needed to be heard more than ever, many newspapers were turning their backs on the requirement to service public life. […] (A)s the economic function of newspapers grew, the imperative for revenue that advertising provided made the —————— 87 Vgl. hierzu statt vieler mit zahlreichen weiteren Nachweisen die einschlägigen Forschungsberichte von Street (2005) und Corner/Robinson (2006). MASSENMEDIEN 115 newspaper indispensable to consumers of goods rather than to citizens.« (Chapman 2005: 104) Die Besonderheiten der historischen Entwicklung der Presse in Deutschland waren zu einem beträchtlichen Teil Abglanz der starken regionalen Zerklüftung des Landes während des gesamten 17., 18. und großer Teile des 19. Jahrhunderts. Die regionale Fragmentierung stand der Entwicklung der Presse zu einem echten Massenmedium lange Zeit im Wege. Nicht minder schwer wogen die restriktiven Wirkungen der vergleichsweise späten Anerkennung einer unbeschränkten Pressefreiheit, welche in Schweden bereits 1766, nur wenig später auch in den USA rechtlich institutionalisiert wurde (Hallin/Mancini 2004: 147). Zu einem Meilenstein der Pressegeschichte in Deutschland wurde die Verabschiedung des Reichspressegesetzes 1874. Es ersetzte das ausufernde Geflecht regionaler Pressegesetze und schuf damit gleichsam die rechtliche Grundlage für eine landesweite Presse. Nicht minder wichtig waren die Abschaffung der berüchtigten »Vorzensur« und der staatlichen Lizenzierung der meisten Zeitungen. Gleichwohl blieb das Bismarck-Reich bekanntlich weit davon entfernt, die heute als selbstverständlich geltenden Standards der Meinungs- und Pressefreiheit zu gewährleisten. Bereits im ersten Jahrzehnt des neu geschaffenen Reiches kam es in Form von »Kulturkampf« und »Sozialistengesetz« zu kompromisslos-repressiven Aktionen gegen die katholische Minderheit und die Sozialisten bzw. Sozialdemokraten. Noch die Weimarer Reichsverfassung betrachtete die Pressefreiheit nicht als ein absolutes Grundrecht. In Art. 118 WRV war lediglich ein Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung festgeschrieben. Selbst dieses konnte, insbesondere durch das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten, im Bedarfsfall eingeschränkt werden, wozu es vor allem in der Schlussphase der Weimarer Republik im großen Stile kam. Umfangreiche Presseverbote wurden jedoch selbst auf der Grundlage einfacher Gesetze wie dem Republikschutzgesetz aus dem Juli 1922 durchgesetzt (Altendorfer 2001: 20). Eine zusätzliche schwere Hypothek erwuchs der Presse während der Weimarer Republik aus der Übermacht demokratiefeindlich gesinnter Medienunternehmer, ganz besonders in Gestalt Alfred Hugenbergs. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstand der Hörfunk als ein weiteres Massenmedium. Als das »goldene Zeitalter« des Hörfunks gelten international die dreißiger und vierziger Jahre. Das trifft hinsichtlich des gesellschaftlichen Stellenwertes und der Reichweite des Mediums – im Gegensatz zum Inhalt der Sendungen! – auch für Deutschland zu. In der 116 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE vergleichenden Mediengeschichte werden (neben der Variante eines »totalitären Hörfunks«) zumeist zwei institutionelle Grundmodelle mit weitreichender internationaler Ausstrahlungswirkung unterschieden: das amerikanische Modell eines kommerziellen Rundfunks und das in Großbritannien entwickelte Modell eines »public service«-Rundfunks (Gorman/McLean 2003: 49–55). Der ausschlaggebende Impuls für die Entstehung des privaten Rundfunks amerikanischer Prägung stand niemals in Frage. Die Entwicklungsdynamik speiste sich eindeutig aus den Profitmaximierungsstrategien privater Unternehmen. Weniger Konsens besteht hinsichtlich der historischen Entstehungsbedingungen des britischen Modells des »public service broadcasting«. Einer verbreiteten Lesart zufolge ging es in Großbritannien von Anfang an darum, ein System zu kreieren, das dem »öffentlichen Interesse«, den Bedürfnissen einer freiheitlich-pluralistischen Gesellschaft in besonderem Maße gerecht werden würde. Unbestritten ist, dass der Staat genau diese Linie ab Mitte der zwanziger Jahre gezielt verfolgte. Gelegentlich bezweifelt wurde jedoch, ob damit tatsächlich der maßgebliche Impuls der Frühgeschichte des britischen Rundfunks bezeichnet ist. Nach Einschätzung von Paddy Scannell und David Cardiff waren auch auf der britischen Insel bei allen Beteiligten zunächst ausschließlich ökonomische Erwägungen ausschlaggebend. »The thinking at first was all on the trade side of broadcasting and the creation of a market, and not on the broadcasting side and the nature and content of a programme service« (Scannell/Cardiff 1991: 6). Davon war auch der Staat nicht ausgenommen: »The Post Office, as the state’s major revenue-producing department, foresaw the possibility of considerably increasing its revenues through the licence fee. Indeed, one of the most scandalous features of early broadcasting was the percentage of the licence fee retained by the Post Office to increase the annual amount it earned for the Treasury.« (ebd.: 5–6) In der internationalen Mediengeschichte gilt nicht zuletzt Deutschland als ein Land, in dem der Staat von Beginn an eine führende Rolle bei der Entwicklung des Hörfunks spielte. Obwohl bis in die zweite Hälfte der zwanziger Jahre der private Rundfunk vorherrschend war, gab es zahlreiche »Einmischungen« des Staates, vor allem in Gestalt umfangreicher Genehmigungspflichten. Diese waren nicht immer ausschließlich machtpolitisch motiviert; zumindest vereinzelt spielten auch weiter gehende Ideen wie der Wunsch nach staatlichem Schutz der Gesellschaft vor egoistischen Einzelinteressen eine Rolle (Humphreys 1990: 125). Im Gefolge der Zweiten Weimarer Rundfunkverordnung von 1932 kam es zur Zentralisie- MASSENMEDIEN 117 rung und Verstaatlichung des Rundfunks. Als maßgeblicher Akteur trat dabei das Reichsinnenministerium in Erscheinung, das mehr oder minder offen den gezielten Ausbau des Rundfunks zum politischen Sprachrohr der Regierung propagierte (Altendorfer 2001: 18). Im Rückblick mag dies wie eine Vorbereitung der nationalsozialistischen Rundfunkpolitik erscheinen. Der zentrale Stellenwert, den die Nationalsozialisten dem Hörfunk zumaßen, manifestierte sich auch in quantitativer Hinsicht. So hatte Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkrieges die höchste Anzahl von Hörfunkempfängern in ganz Europa vorzuweisen (Humphreys 1990: 127). Mitte der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts trat das Fernsehen als weiteres Medium hinzu. Während das Radio von Beginn an international ausgerichtet war, blieb das Fernsehen bis zum Beginn der fünfziger Jahre in seiner Reichweite – schon technisch bedingt – im günstigsten Fall auf die jeweiligen nationalen Grenzen, zum Teil auf deutlich überschaubarere regionale Ballungsräume beschränkt. Zu den internationalen Vorreitern der Fernsehentwicklung gehörte auch Deutschland, wo es bereits 1935 zur Aufnahme eines zunächst freilich denkbar bescheidenen Sendebetriebs kam. Eine Besonderheit der deutschen Variante bestand nicht nur in den überwiegend nationalsozialistisch eingefärbten, propagandistischen Programminhalten, sondern auch in der institutionellen Ausgestaltung des Fernsehens: Zu sehen waren die eigens hergestellten Sendungen zunächst ausschließlich an ausgewählten öffentlichen Orten, in sogenannten »Fernsehstellen« oder »Fernsehstuben« rund um Berlin (Hickethier 1998: 40). Ähnliche Praktiken gab es während der Frühzeit des Fernsehens auch in Italien. Bis in die späten vierziger Jahre hinein hielten es Beobachter nicht nur mit Blick auf autoritäre bzw. totalitäre Regime für möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass das Fernsehen seinen »natürlichen Platz« in den großen Lichtspieltheatern (statt in privaten Haushalten) finden werde (Gorman/McLean 2003: 127–128; Briggs 1995). Seine erste Blüte als Massenmedium erlebte das Fernsehen während der fünfziger Jahre in den Vereinigten Staaten. Wie das amerikanische Radio, war auch das amerikanische Fernsehen im Wesentlichen eine Angelegenheit der privaten Wirtschaft. Stärker noch als für die jüngere Vergangenheit gilt dies für die Anfänge des Fernsehens. Die Geschichte des staatlichen Fernsehens begann in den Vereinigten Staaten erst 1951. Damit verkörpern die USA das einzige größere Land der Welt, in dem die Entstehung des privaten, kommerziellen Fernsehens der des staatlichen Fernsehens um viele Jahre vorausging (Bitterman 2006: 14). Und bis heute ist es letzterem 118 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE – bei einem Zuschaueranteil von stets deutlich unter fünf Prozent – nicht einmal ansatzweise gelungen, aus dem langen Schatten des privaten Fernsehens herauszutreten. Das »Urmodell« eines staatlichen (und dabei zugleich staatsfernen) Fernsehens mit ausdrücklicher »public service«-Orientierung verkörperte, analog zu den Entwicklungen im Hörfunksektor, Großbritannien bzw. die British Broadcasting Corporation (BBC). Dieses, nicht die amerikanische Variante, wurde zum zentralen Vorbild der Fernsehentwicklung in den meisten Ländern Europas, vor allem aber in den Commonwealth-Ländern Kanada, Australien und Neuseeland. Zu einem internationalen Referenzmodell wurde Großbritannien jedoch nicht nur wegen der Hochkarätigkeit seines öffentlichen Fernsehens. Bemerkenswerter Weise waren die Briten zugleich europäische Vorreiter bei der Entwicklung des privaten Rundfunks. Bereits 1954 entstand ein kommerzieller Sender, Independent Television (IT), der im Vergleich zu vielen späteren Erscheinungen in diesem Sektor durch eine außerordentlich starke »public service«-Orientierung und hohe Qualitätsstandards gekennzeichnet war (Gorman/McLean 2003: 132). Eine ähnlich frühe Einführung des kommerziellen Fernsehens gab es innerhalb Europas nur in Finnland (1957), wo die Gründung eines privaten Senders sogar den Beginn der »Fernsehgeschichte« des Landes markierte (Österlund-Karinkanta 2004: 56). Außerhalb Europas sind unter den »Frühstartern« zu erwähnen: Australien, wo 1956 ein duales System geschaffen wurde und Japan, wo bereits Ende 1953, nur wenige Monate nach der Etablierung des mächtigen staatlichen Fernsehens (NHK), mehrere kommerzielle Sender den Betrieb aufnahmen (Dunning 2004: 43). Anfang der achtziger Jahre erfasste die Kommerzialisierung des Fernsehens die große Mehrzahl der westeuropäischen Länder. Für den internationalen Trend in Richtung Kommerzialisierung gab es unterschiedliche Gründe: Einer von ihnen war das beständige Drängen einer starken Lobby, insbesondere aus dem Werbesektor, die sich für einen Wandel der Medienstrukturen stark machte. Dabei ging es konkret um die Schaffung und Sicherung ihres Zugangs zu den elektronischen Medien als einer zentralen Komponente des Werbemarktes. Nicht ohne Wirkung war auch das Streben verschiedener sozialer Bewegungen nach einer eigenen Plattform auf der Ebene des Fernsehens. Dabei konnte verschiedentlich an frühere Erfahrungen mit privaten Radiostationen angeknüpft werden. Ferner gab es vielerorts ein starkes gesellschaftliches Bedürfnis nach einer größeren Zahl an Fernsehprogrammen und größerer Programmvielfalt, jenseits des An- MASSENMEDIEN 119 gebots, das durch Einkünfte aus staatlich erhobenen Fernsehgebühren zu finanzieren war. Ein zusätzlicher Impuls insbesondere für die Entstehung des transnationalen Fernsehens entwickelte sich aus dem anhaltenden Trend zu ökonomischer Globalisierung, der sich in Europa nicht zuletzt in Gestalt der europäischen Integration manifestierte (Hallin/Mancini 2004: 274–276). Seit den achtziger Jahren werden die »traditionellen« Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) durch das Internet ergänzt. Ob das Internet als neues Massenmedium gelten kann, ist nicht unumstritten. Kritiker weisen insbesondere darauf hin, dass die Masse der Bevölkerung in den konsolidierten liberalen Demokratien zwar über eine prinzipielle Zugangsmöglichkeit, nicht aber über einen tatsächlichen Zugang zum Internet verfüge (Strohmeier 2004a: 45–46). Dieses Argument entbehrt nicht grundsätzlich der Substanz; der in den meisten Ländern zu beobachtende rasante Anstieg der Zahl von Internetnutzern nimmt ihm jedoch zunehmend den Wind aus den Segeln. Laut einschlägiger internationaler Statistiken88 gab es im September 2006 die größte Internetnutzerdichte in Skandinavien, besonders in Island (86,8 Prozent der Bevölkerung) und Schweden (74,9 Prozent). Ebenfalls eine Internetnutzerquote von über 70 Prozent der Bevölkerung besaßen Länder wie Neuseeland (76,3), Australien (70,7) und, gewiss überraschend, Portugal (74,1). In der Gruppe mit Quoten zwischen 70 und 65 Prozent fanden sich Länder wie die USA (69,3), Kanada (67,9) und Japan (67,2), etwas dahinter Großbritannien (62,5) und Deutschland (61,3). Am vergleichsweise bescheidensten war der Anteil an Internetnutzern in den meisten Ländern Südwesteuropas (mit Ausnahme Portugals). Sowohl in Spanien als auch in Italien und Frankreich lag die Quote bei (zum Teil deutlich) unter 50 Prozent. Gerade in einigen der zuletzt genannten Länder gab es, gemessen an den Zahlen für 2000, jedoch besonders spektakuläre Zuwachsraten. So stieg die Internetnutzerquote im Zeitraum 2000–2006 in Frankreich nur um knapp unter, in Spanien sogar deutlich über 250 Prozent. Bescheidener blieben die Zuwachsraten in den alten »Internethochburgen« Skandinaviens; sie lagen im Durchschnitt der fünf skandinavischen Länder bei etwas über 65 Prozent und damit noch unter den ebenfalls vergleichsweise moderaten Zahlen für Länder wie Kanada und Japan. —————— 88 Zahlen nach: http://www.internetworldstats.com, 06.01.2007; zum Teil eigene Berechnungen des Autors. 120 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Wichtig zu sehen ist ferner, dass sich das Internet nicht als selbständiges, von den übrigen Medien vollständig losgelöstes Medium entwickelt hat. So nutzen vor allem die großen Tages- und Wochenzeitungen das Internet, um ihre Berichterstattung auch online zugänglich zu machen. Ob sich die Präsenz der traditionellen Massenmedien im Internet für diese tatsächlich vorteilhaft auswirkt, bleibt indes fraglich. Zum einen verursacht die Internetpräsenz beträchtliche finanzielle Kosten, die kaum durch die insgesamt bescheidenen Zuwachsraten der jeweiligen Leserschaft gerechtfertigt werden können. Zum anderen gibt es spezifische Einbußen bei der Agendakontrolle durch die Herausgeber etablierter Printmedien und problematische Rückwirkungen auf die journalistische Qualität der Berichterstattung. Die Qualität des Online-Journalismus bleibt, nicht zuletzt bedingt durch den erheblich gesteigerten Zeitdruck, mit dem »breaking news« produziert werden müssen, zum Teil deutlich hinter den traditionellen Standards zurück (Gorman/McLean 2003: 203). Die populäre Rede vom »Internet-Zeitalter« erscheint im Lichte jüngerer Entwicklungen betrachtet als Übertreibung. Zwar gibt es auf internationaler Ebene Anzeichen für eine deutliche Veränderung der Mediennutzung. So ist vor allem die Zirkulationsrate von verkauften Tageszeitungen international rückläufig. Das gilt – bei zum Teil gravierenden Unterschieden zwischen einzelnen Ländern – für Westeuropa wie für die USA und Japan. Während der Periode 2001 bis 2005 kam es in Griechenland, den Niederlanden und Dänemark zu einem Rückgang im zweistelligen Prozentpunktbereich. Die Vergleichswerte für Deutschland und Großbritannien lagen bei jeweils knapp unter –10 Prozentpunkten. Ein bemerkenswerter Trend, der kaum dadurch entschärft wird, dass – dank der massenhaften Entstehung und Verbreitung von Gratiszeitungen89 – die Zeitungsleserrate nicht in gleichem Umfang abnahm wie jene der Zeitungskäufer (World Association of Newspapers 2006). Aus der schleichenden Krise von Teilen des Pressesektors lässt sich jedoch kein überzeugender Beleg für einen Durchbruch des Internets zum internationalen Leitmedium des 21. Jahrhunderts gewinnen. Für die Bundesrepublik zeigen Fallstudien vielmehr, dass das Fernsehen – trotz der scheinbaren Allgegenwart —————— 89 Gratiszeitungen gelten mittlerweile als eine der ernsthaftesten Herausforderungen für die etablierten Zeitungsverlage, aber auch für die Entwicklung des Printmedienjournalismus insgesamt. In Deutschland ist die Bedeutung von Gratiszeitungen, gemessen an den Vergleichsdaten aus dem europäischen Ausland, bislang auffallend gering (Haas 2006; Röper 2006). MASSENMEDIEN 121 des Internets – eindeutig das dominante Leitmedium der Bürger geblieben ist (van Eimeren/Ridder 2005: 503). Obwohl es wenige vergleichbar anspruchsvolle Longitudinalstudien über das Mediennutzungsverhalten in anderen Ländern gibt, gilt das Fernsehen auch andernorts nach wie vor als die mit Abstand wichtigste Quelle politischer Information (Gerstlé 2002: 94). 5.3 Die Vielfalt der Mediensysteme in den konsolidierten Demokratien und das Mediensystem der Bundesrepublik In ihrer bahnbrechenden Studie über die Strukturmerkmale unterschiedlicher Mediensysteme in den westlichen Demokratien unterscheiden Daniel Hallin und Paolo Mancini (2004) drei unterschiedliche Grundtypen von Mediensystemen: ein liberales Modell, ein demokratisch-korporatistisches Modell und ein polarisiert-pluralistisches Modell. Dabei handelt es sich, wie an den gewählten Bezeichnungen erkennbar wird, nicht um Klassifizierungen, die ausschließlich Aspekte des Mediensystems im engeren Sinne berücksichtigen; einbezogen werden auch dessen jeweiliger politischer Kontext und eine Reihe verhaltensbezogener Variablen von Akteuren. Den im engeren Sinne politischen Faktoren kommt dabei der Stellenwert von unabhängigen Variablen zu (ebd.: 47). Die unterschiedenen Modelle werden im Übrigen auf bestimmte Länder bzw. Ländergruppen bezogen. Das liberale oder nordatlantische Modell, dem Hallin und Mancini die USA, Kanada, Großbritannien und Irland zurechnen, zeichnet sich idealtypisch durch ein eindeutig marktdominiertes Mediensystem aus (obwohl es in Großbritannien und Irland eine starke Säule des öffentlichen Rundfunks gibt), in dem sowohl Printmedien als auch elektronische Medien eine zentrale Rolle spielen. Zu den grundlegenden Strukturmerkmalen der Mediensysteme des liberalen Typs gehören ferner: die Vorherrschaft einer neutralen kommerziellen Presse (mit Ausnahme der hochgradig »parteiisch« auftretenden britischen Presse), die Existenz eines professionellen, politisch autonomen Rundfunk(kontroll)systems sowie ein ausgeprägter interner Pluralismus90 als funktionalem Organisationsprinzip des Mediensystems —————— 90 Gemeint ist die Repräsentation unterschiedlicher inhaltlicher Positionen innerhalb eines bestimmten Mediums. Im Gegensatz dazu realisiert sich pluralistische Viel- 122 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE (wiederum mit Ausnahme Großbritanniens, für das eher ein externer Pluralismus kennzeichnend ist). Auf der journalistischen Ebene ist das liberale Modell gekennzeichnet durch eine eher informationsorientierte Form des Journalismus und ein insgesamt hohes Maß an Professionalisierung91 sowie ein System der nicht-institutionalisierten Selbstregulierung. Zu faktischen Einschränkungen journalistischer Autonomie kommt es in diesem System eher aufgrund kommerziellen Drucks als durch Versuche politischer Instrumentalisierung der Medien (ebd.: 198–248). Besonders deutlich unterscheidet sich das liberale/nordatlantische Modell vom polarisiert-pluralistischen oder mediterranen Modell, zu dem bei Hallin und Mancini Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien gerechnet werden. Zu den Merkmalen dieses Systems gehört eine stark politisierte Presse und ein Rundfunksystem, das in hohem Maße von parlamentarischen Mehrheiten bzw. Regierungen gesteuert und kontrolliert wird. Der intensiven Kontrolle des Rundfunkbereichs durch politische Mehrheiten in den staatlichen Leitungsorganen entspricht eine weitreichende staatliche Intervention in anderen Bereichen des Mediensystems; sie manifestiert sich insbesondere in Form staatlicher Subventionszahlungen an die Printmedien. Kennzeichnend für dieses Modell ist eine deutliche Neigung zum externen Pluralismus des Mediensystems. Das historisch außerordentlich hohe Maß an »politischem Parallelismus«, welches das polarisiert-pluralistische Modell kennzeichnet, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts in fast allen zu dieser Gruppe gehörenden Ländern zurückgebildet.92 Auf der Ebene des Journalismus gehört zu diesem Modell eine eher geringe Professionalisierung, eine ausgeprägte Tendenz zur politischen Instrumentalisierung des Journalismus und eine Tradition des stärker kommentarorientierten und nicht selten im engeren Sinne Partei nehmenden Journalismus. Ein weiteres auffallendes Merkmal des pluralistischpolarisierten Modells bildet die vergleichsweise geringe Bedeutung der —————— falt beim externen Pluralismus erst auf der Systemebene, als Folge des Zusammentreffens unterschiedlicher, für sich allein betrachtet einseitiger Positionen. 91 Dabei geht es nicht um formale Kriterien der Professionalisierung (wie einschlägige berufsqualifizierende Abschlüsse oder die Mitgliedschaft in Berufsverbänden), sondern um verhaltensleitende Dimensionen der Professionalisierung wie insbesondere der jeweilige Grad an journalistischer Autonomie gegenüber dem Einfluss anderer Akteure. 92 Die große Ausnahme bildet Spanien, wo es im Gefolge der Demokratisierung in den vergangenen Jahrzehnten eher zu einer Verstärkung entsprechender Tendenzen mit einer Spaltung der Medien in zwei rivalisierende Lager kam (ebd.: 104). MASSENMEDIEN 123 Presse (abzulesen insbesondere an den ausgesprochen bescheidenen Auflagezahlen von Tageszeitungen), woraus sich in den betreffenden Ländern eine ausgeprägte Vormachtstellung der elektronischen Medien als den einzigen wirklichen Massenmedien ergibt (ebd.: 89–142). Zum demokratisch-korporatistischen oder nordeuropäischen Modell schließlich rechnen Hallin und Mancini neben den skandinavischen Ländern, den Niederlanden und Belgien auch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Die Mediensysteme dieser Länder kennen zwar verbreitet Formen staatlicher Intervention (etwa Subventionszahlungen an die Presse93); sie sind jedoch zugleich durch ein hohes Maß an institutionalisierter Pressefreiheit gekennzeichnet. Zu den historischen Merkmalen des demokratisch-korporatistischen Modells zählt eine mächtige Parteipresse, die jahrzehntelang in Nachbarschaft zu einer hoch entwickelten kommerziellen Presse existierte. Seit den siebziger Jahren kam es jedoch flächendeckend zu einem weitreichenden Bedeutungsverlust der Parteipresse, der längst auch einstige Hochburgen wie Österreich erfasst hat. Vor allem das System der landesweit vertriebenen bzw. gelesenen Presse ist jedoch stellenweise noch immer durch eine Neigung zum externen Pluralismus gekennzeichnet. Zu den zentralen Merkmalen der Mediensysteme der demokratischkorporatistischen Länderfamilie gehört ferner ein ausdifferenziertes und im Hinblick auf den Marktanteil entsprechend zentral positioniertes System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dieses erhält seine spezifische Note durch ein System der Kontrolle des Rundfunks, welches auf Machtteilung und Inklusion unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen setzt und damit zwischen das stärker mehrheitsdemokratisch geprägte Modell der mediterranen Länder und das professionelle Modell der nordatlantischen Ländergruppe fällt. Mit Blick auf eine Reihe weiterer Merkmale ist das demokratisch-korporatistische Modell dem liberalen deutlich näher als dem polarisiert-pluralistischen Modell – so hinsichtlich des hohen Professionalisierungsgrades des Journalismus (welcher verbreitet mit einer stark institutionalisierten Form der Selbstregulierung kombiniert wird) wie auch der historisch frühen Entwicklung einer Massenpresse, der bis heute eine ausgesprochen hohe Zirkulationsrate von Tageszeitungen entspricht (ebd.: 144– 197). —————— 93 Das gilt vor allem für Schweden, während Deutschland und die Schweiz die einzigen Länder dieser Gruppe sind, in denen es überhaupt keine direkten staatlichen Subventionen für die Presse gibt (ebd.: 161). 124 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Wie bereits durch die Differenzierungen am Rande deutlich geworden sein sollte, gibt es selbst innerhalb der Grenzen der von Hallin und Mancini unterschiedenen Modelle einen beträchtlichen Pluralismus und gelegentlich Fälle mit einem signifikanten Abweichungspotential gegenüber den jeweils als relevant erachteten Bestimmungsmerkmalen.94 In der Gruppe von Systemen des liberalen/nordatlantischen Typs betrifft dies vor allem Großbritannien, welches im Rahmen einer detaillierten Einzelfallstudie vermutlich an der Grenze zwischen dem liberalen und dem demokratisch-korporatistischen Modell zu verorten wäre. Aus der polarisiert-pluralistischen Gruppe ist hingegen vor allem Frankreich zu nennen, das ebenfalls eine auffallende Nähe zum demokratisch-korporatistischen Modell aufweist. Innerhalb der Gruppe von Ländern, die von Hallin und Mancini dem demokratisch-korporatistischen bzw. nordeuropäischen Modell zugeordnet werden, kann nicht zuletzt Deutschland als ein System mit einer Reihe markanter Besonderheiten gelten. Dem soll im restlichen Teil dieses Abschnittes, im Rahmen einer Rekonstruktion der wichtigsten Strukturentwicklungen des deutschen Mediensystems nach 1945 nachgegangen werden. Aus breiterer historischer Perspektive betrachtet erwies sich die Zeit der Nazi-Herrschaft als ein so einschneidender Bruch mit dem deutschen Pressewesen, dass die heutige Presselandschaft Deutschlands – im Gegensatz zu der Situation in vielen anderen Ländern mit größerer Kontinuität der Demokratiegeschichte – zum größten Teil ein Produkt der Entwicklungen nach 1945 ist (Koszyk 1986).95 Wie in anderen Bereichen stand auch am Beginn des Wiederaufbaus des deutschen Mediensystems die —————— 94 Die Autoren selbst bieten hierfür eine Fülle von weiterem Anschauungsmaterial. In der Tat gehört es zu den besonderen Stärken der Studie von Hallin und Mancini, dass entsprechende Besonderheiten im Rahmen des Möglichen ausdrücklich berücksichtigt werden und konzeptuelle Stringenz nicht auf Kosten empirischer Genauigkeit angestrebt wird. 95 Unterschiede kennzeichnen jedoch auch die Mediengeschichte der frühen Nachkriegszeit in Deutschland und Japan und dabei inbesondere die Medienpolitik der amerikanischen Besatzungsmacht. Anders als in Deutschland kam es in Japan nicht zu einem radikalen Neubeginn des Pressewesens. Sämtliche Zeitungen blieben bestehen, wenngleich es zu personellen »Säuberungen« innerhalb von Verlagen kam. Für die geringe Zahl neuer Zeitungen in Japan waren somit nicht primär restriktive medienpolitische Entscheidungen der Amerikaner, sondern vor allem Rohstoffmangel und veraltete Produktionsanlagen verantwortlich (PlitschKußmaul 1995: 325). MASSENMEDIEN 125 Politik der Alliierten. Die Westmächte entschieden sich für den Weg einer strikt kontrollierten Neugründung einer privatwirtschaftlich-kommerziell organisierten Presse, die vollständig frei von staatlicher Kontrolle sein sollte. Größter Wert wurde auf ein Maximum an Dezentralisierung gelegt, im Sinne eines radikalen Gegenentwurfs zu der hochgradigen Pressekonzentration während der Weimarer Republik. Zu den Kernzielen beim Wiederaufbau der Presse gehörte ferner das Bestreben, der in Deutschland bis dahin weithin unbekannten Tradition einer Trennung zwischen Nachricht und Kommentar, wie sie den angelsächsischen Journalismus seit langem kennzeichnete, zum Durchbruch zu verhelfen. Selbst die Pressepolitik von Briten und Amerikanern in den jeweils von ihnen kontrollierten Zonen wies jedoch beträchtliche Unterschiede zueinander auf. Die Amerikaner verfolgten einen Ansatz, der auf die Etablierung überparteilicher Zeitungen zielte. Aus diesem Grunde wurden entweder Lizenzen an Pressevertreter vergeben, die eine strikt »unparteiische« Linie vertraten, oder es wurde versucht, über die Vergabe von Lizenzen einen Pluralismus zwischen unterschiedlich positionierten Kräften innerhalb des Herausgeberkreises eines Blattes zu gewährleisten. Anders als die Amerikaner sahen die Briten keine Probleme darin, in ihrer Zone Zeitungen mit einer eindeutigen politischen Richtung zuzulassen. Sie vertrauten darauf, dass sich ein pluralistisches Gefüge der Meinungen auf der Ebene des Marktes von Anbietern und Lesern gleichsam von selbst, aus dem freien Spiel der Kräfte ergeben würde. Die Franzosen verfolgten einen Mittelweg, der sich zunächst in größerer Nähe zum amerikanischen Modell bewegte, nach 1947 jedoch stärker dem britischen Ansatz zuneigte. Die politische Liberalisierung des Pressesektors vollzog sich in mehreren Schritten. Die »Vorzensur« von für die Veröffentlichung vorgesehenen Materialien wurde zum Teil bereits ab September 1945 aufgegeben, zunächst von den Amerikanern, wenig später auch in der britischen und französischen Zone. Die »Nachzensur« blieb vorerst bestehen, und vereinzelt wurde gar argumentiert, dass der Umfang an Korrekturen durch die Alliierten nach Abschaffung der »Vorzensur« deutlich zunahm (Humphreys 1990: 32). Ab September 1949 konnte jeder Deutsche (mit Ausnahme der als im Rahmen von Entnazifizierungsverfahren als »Hauptschuldige« identifizierten Personen) wieder eine Zeitung oder Zeitschrift herausgeben, ohne dass hierfür eine spezielle Genehmigung der Alliierten 126 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE erforderlich war.96 Diese Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen schlug sich in einer geradezu dramatischen Zunahme unterschiedlicher Presseerzeugnisse nieder. Verantwortlich für diese war im Kern die Rückkehr der »Altverleger«, welche ganz überwiegend keine Lizenzen erhalten hatten. Innerhalb eines Jahres entstanden rund 750 neue Zeitungen (ebd.: 39). Den sich entwickelnden Auflagenkrieg zwischen den Lizenzblättern, von denen es zu diesem Zeitpunkt im westlichen Teil Deutschlands insgesamt 165 gab, und den über 500 neu hinzugekommenen Zeitungen überstanden die Lizenzblätter deutlich besser als ihre Konkurrenten. In der amerikanischen Zone, die die mit Abstand größte Dynamik erlebte, ging ihre Zahl bis zum Herbst 1951 nur um rund zehn Prozent zurück, vor dem Hintergrund wesentlich größerer Verluste auf Seiten der Altverleger (Koszyk 1986: 320). Die institutionell-organisatorische Konkurrenz zwischen Lizenz- und Altverlegern, die sich zunächst in unterschiedlichen Verbänden – dem Gesamtverband der Deutschen Zeitungsverleger (der Organisation der Lizenzträger) und dem Verein Deutscher Zeitungsverleger – zusammenschlossen, war nicht von langer Dauer. Das zweigleisige System wurde durch die Gründung des Bundesverbandes deutscher Zeitungsverleger im Jahre 1954 überwunden. Zu den während des ersten Jahrzehnts der Bundesrepublik geschaffenen Institutionen der Presse gehört auch der im Herbst 1956 gegründete Deutsche Presserat. Die Initiative für die Gründung des Presserates kam vom Deutschen Journalisten Verband. Er war dem international einflussreichen Modell des British Press Council nachempfunden und sollte für die Presse »so etwas Ähnliches wie ihr moralisches Gewissen« (Meyn 2004: 58) darstellen. Ihm gehören heute zehn Journalisten und eine gleiche Zahl von Verlegern an. Nutznießer des Presserates waren in den vergangenen Jahrzehnten nach verbreiteter Einschätzung jedoch eher die Verleger als die Journalisten. Sein Erfolg bei der Fernhaltung einer expansiveren und intensiveren Kontrolle der Presse durch den Staat wird als deutlich größer be- —————— 96 Formal ausschlaggebend hierfür war das »Gesetz Nr. 5 der Alliierten Hohen Kommission über die Presse, den Rundfunk, die Berichterstattung und die Unterhaltungsstätten« vom 21. September 1949. Die verfassungsrechtliche Garantie entsprechender Aktivitäten bietet Art. 5 GG, der jedem das Recht zuspricht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Ferner werden ebendort auch die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film ausdrücklich gewährleistet. MASSENMEDIEN 127 wertet als seine Leistungen auf dem Gebiet der Selbstregulierung des Pressesektors (Humphreys 1990: 59–60; Baum 2006).97 Ein zentrales Charakteristikum der deutschen Presse nach 1945 bildete stets die begrenzte Bedeutung der nationalen, landesweit gelesenen Presse – im Gegensatz insbesondere zu der stark »nationalisierten« Presselandschaft in Großbritannien, Österreich, Italien oder Spanien und grundsätzlich ähnlich wie in Skandinavien oder Frankreich. Lediglich in den Vereinigten Staaten, Kanada und der Schweiz, wo es kaum oder erst seit kurzem eine nationale Tagespresse von nennenswertem Gewicht gibt, besaß bzw. besitzt die regionale Presse einen noch größeren Stellenwert als in Deutschland (Hallin/Mancini 2004: 25). Die große Mehrzahl der Deutschen liest eine regionale Tageszeitung. Entsprechend groß ist das zahlenmäßige Angebot an Presseerzeugnissen. Die tatsächliche Vielfalt auf dem deutschen Zeitungsmarkt wird jedoch seit langem bezweifelt. Dass sich ein beträchtlicher Teil der regionalen Journalisten hinsichtlich der Themenauswahl an den Vorgaben der maßgeblichen überregionalen Titel – auf der Ebene von Tageszeitungen insbesondere der (liberal-konservativen) Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der (linksliberalen) Süddeutschen Zeitung – orientiert, erscheint unproblematisch. Kritischer bewertet wurde der Umstand, dass der Vielzahl an Zeitungsausgaben kein adäquates Maß an redaktioneller Selbständigkeit von Zeitungen entspricht. Das schwerwiegendste Problem wird jedoch in der Herausbildung lokaler Pressemonopole gesehen; sie bergen die Gefahr struktureller Informationsdefizite, der die betroffene Leserschaft weitgehend machtlos gegenübersteht (Meyn 2004: 79–80).98 Dem Konzentrationstrend im Pressesektor der Bundesrepublik wurde durch die deutsche Vereinigung kein Einhalt geboten. Im Gegenteil. Die mit der »Abwicklung« auch dieses Sektors beauftragte Treuhand verkaufte die ehemals von DDR-Organisationen herausgegebenen Zeitungen in der —————— 97 Eine nur bescheidene Kontrollwirkung ging von den Landespressegesetzen aus. Der Zurückhaltung des Staates auf Landesebene entsprach allenfalls phasenweise eine aktivere Rolle des Bundes in der Pressepolitik. Vor allem mit Blick auf die jüngere Vergangenheit wurde dem Bund gar pointiert ein weit reichender »Politikverzicht« attestiert (Jarren/Donges 2006: 391). 98 International vergleichend ausgerichtete Studien zeichnen ein anderes Bild. Bei Voltmer (2000: 21) erscheint Deutschland im Vergleich der OECD-Länder neben Norwegen, Schweden und der Schweiz als eines der wenigen Länder, in denen – jedenfalls noch zu Beginn der neunziger Jahre – eine überdurchschnittlich große Auswahlmöglichkeit von Informationsquellen auf regionaler Ebene bestand. 128 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Mehrzahl an die großen westdeutschen Verlagshäuser, so dass es allenfalls zu einer gewissen Modifizierung, nicht aber zu einer grundsätzlichen Veränderung der Monopol- bzw. Oligopolverhältnisse kam. Die gelegentlichen »Überraschungseffekte«, die sich im Zuge der Transformation bei der Zuweisung von Verkaufsobjekten zu bestimmten Käufern ergaben, wurden von kritischen Beobachtern eher auf die besondere Inkompetenz der Treuhand als auf irgendeine rationale Strategie zurückgeführt: »Der Verkauf der Zeitungen war ein Lehrstück der Intervention in den Pressemarkt durch eine Stelle, die dazu weder durch ihre Sachkunde noch durch ihre Aufgabe prädestiniert und legitimiert war« (ebd.: 93). Die Pressestrukturen in den neuen Bundesländern ähneln nach verbreiteter Einschätzung denen vergangener DDR-Zeiten weitaus mehr als denen in der alten Bundesrepublik. Eine aufwendige Untersuchung gelangte für das Gebiet der ehemaligen DDR zu dem Ergebnis, dass »lokale Zeitungsmonopole inzwischen die Regel, Wettbewerbsgebiete hingegen die seltene Ausnahme« bildeten (Schneider/Stürzebecher 1998: 212).99 Der ausgesprochen hohe Konzentrationsgrad der ostdeutschen Presselandschaft wird auf spezifische Weise ergänzt durch die Existenz einer (ansonsten praktisch ausgestorbenen) Parteipresse in Form des PDS-Organs, »Neues Deutschland«. Als größeres Problem gilt einigen Beobachtern das »Presseimperium« der SPD (Rudzio 2006: 391–392), welches im Zuge der Entschädigung für NS-Enteignungen entstand. Auf diesem Wege gelangte die SPD zu umfangreichen Beteiligungen an Zeitungsverlagen und Druckereien in den neuen Bundesländern. Der Einfluss der Alliierten auf die Neugründung des deutschen Rundfunks nach 1945 war mindestens vergleichbar groß wie jener im Bereich der Presse. Wie die Presse wurde auch der Rundfunk als ein zentrales Instrument für die »demokratische Umerziehung« der Deutschen betrachtet. Entsprechend deutlich war der Bruch mit den Strukturen und Werten des deutschen Rundfunksystems der Vorkriegszeit (Humphreys 1990: 128– 136). In strukturbildender Hinsicht überwog dabei auf der Markoebene eindeutig der britische Einfluss: Die Institutionen des neu zu schaffenden deutschen Rundfunks wurden nach dem Vorbild der BBC modelliert, als »public service«-Organisationen, die sich weder im Privatbesitz noch unter —————— 99 Ostdeutsche Besonderheiten wurden auch jenseits institutioneller Spezifika, auf der Ebene des Journalismus identifiziert. Als auffällig und problematisch wurde dabei insbesondere »die Fixierung auf Staat und Obrigkeit als prägendes Merkmal der Berichterstattung von Tageszeitungen« (ebd.: 220) bewertet. MASSENMEDIEN 129 direkter Kontrolle des Staates befinden sollten.100 Dieses Grundmerkmal teilten die Rundfunkorganisationen in allen drei Besatzungszonen. Daneben gab es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Zonen. Während die Amerikaner in ihrem unmittelbaren Einflussbereich den Aufbau einer stark dezentralisierten Rundfunkstruktur forcierten, etablierten die Briten in ihrer Zone eine hochgradig zentralisierte und hinsichtlich ihrer Proportionen geradezu »monströse« Korporation: den Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) mit Sitz in Hamburg. Er versorgte außer Hamburg selbst auch Schleswig-Holstein, Niedersachsen und NordrheinWestfalen. Das System in der kleineren französischen Zone folgte eher dem britischen Modell. Den schon von ihrer äußeren Struktur her deutlich voneinander verschiedenen Konzepten entsprachen unterschiedliche institutionelle Lösungen auf der Ebene der internen Kontrollstrukturen.101 Trotz ihres unübersehbar großen Einflusses im Rundfunkbereich zogen sich die Siegermächte auffallend früh, deutlich vor Gründung der Bundesrepublik, beinahe vollständig aus diesem Sektor zurück. Bereits der Aufbau der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) im Sommer 1950 – die ab 1954 ein gemeinschaftlich verwaltetes Fernsehprogramm ausstrahlte – ging in Selbstregie der beteiligten Landesrundfunkanstalten vonstatten. Erst recht die wichtigste weitere Strukturveränderung der fünfziger Jahre – die Aufspaltung des NWDR in den Sender Freies Berlin (SFB), den Westdeutschen Rundfunk (WDR) und den Norddeutschen Rundfunk (NDR) – hatte nichts mehr mit den Siegermächten zu tun, war aber nichtsdestoweniger in beträchtlichem Maße Ausdruck politischer Bestrebungen. Das gilt —————— 100 Das gilt, wie weiter oben angemerkt, auch für zahlreiche andere westeuropäische Länder. Ein tiefer gehender internationaler Vergleich zeigt jedoch, dass der Begriff und das Konzept des »public service« dabei üblicherweise auf die Funktionsbestimmung oder Widmung von Anbietern bezogen werden, während hierzulande die Zuordnung als »öffentlich-rechtliche Anstalt«, also eine juristische Definition, prägend wurde – nach Einschätzung einiger Autoren nur ein Symbol dafür, »dass in keinem anderen Vergleichsland rechtliche Sichtweisen (bis hin zum Bundesverfassungsgericht) eine derartige Bedeutung für die Ausgestaltung der Rundfunkordnung haben wie in Deutschland« (Kleinsteuber 2003: 392). 101 Die Rekrutierung der Rundfunkräte in den von den Amerikanern begründeten Rundfunkanstalten folgte dem »ständischen Prinzip«, das auf eine ausgewogene Repräsentation unterschiedlicher relevanter gesellschaftlicher Gruppen setzte; diejenige in der britischen basierte hingegen auf dem »parlamentarischen Prinzip«, der Wahl von Mitgliedern des Rundfunkrates auf der Grundlage einer Mehrheitsentscheidung der Landesparlamente. 130 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE besonders für die Schaffung des WDR. Der NWDR wurde von Adenauer und anderen prominenten Vertretern der Union wiederholt als unerträglich »SPD-freundlich« kritisiert. Die Begründung des WDR im Jahre 1954 erfolgte deshalb kaum zufällig in einer Phase, in der die Union die Regierungszügel in Nordrhein-Westfalen führte (Kleinsteuber 1982: 21) – eine frühe Episode, die einen ersten Vorgeschmack auf die späterhin zunehmend unverhohlene Politisierung des Rundfunks bzw. die Parteipolitisierung der Rundfunkpolitik geben sollte. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang vor allem an das am Einspruch des Bundesverfassungsgerichts gescheiterte Ansinnen der Regierung Adenauer, eine regierungsnahe Rundfunkanstalt auf Bundesebene mit der Bezeichnung »Deutschland-Fernsehen« zu schaffen. Das erste Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1961 erwies sich als wegweisend, insofern es die Basis für die verfassungsrechtliche Rundfunkhoheit der Länder schuf bzw. befestigte (Altendorfer 2001: 129–132). Nicht zuletzt einige der institutionellen Manifestationen der (seither vielfach bestätigten) Entscheidungshoheit der Länder im Rundfunkbereich – darunter die Struktur von nicht weniger als 15 Landesmedienanstalten, denen die Aufgabe der Rundfunkaufsicht zugewiesen ist – erscheinen aus international vergleichender Perspektive als »weltweite Einzigartigkeit der deutschen Situation« (Kleinsteuber 2003: 389). Die Begründung des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) durch die Länder im Jahre 1963 fällt nach dem Urteil wichtiger Autoren schon nicht mehr in die Phase der Institutionalisierung des deutschen Rundfunksystems, sondern in jene der Korrektur, welche auf die Jahre 1961 bis Anfang der achtziger Jahre terminiert wurde (Jarren/Donges 2006: 392). Zu den weiteren Entwicklungen dieser Phase gehörten insbesondere zahlreiche Organisationsreformen im Bereich der Rundfunkkontrolle, ferner das – lange Zeit erfolglose – Streben verschiedener Medienakteure und einzelner Gruppen innerhalb der Union nach Errichtung eines privaten Rundfunks. Erst 1984 schlug die Geburtsstunde der »dualen Rundfunkordnung«, in der sich ARD und ZDF zunächst SAT-1 und RTL (anfangs noch aus Luxemburg sendend) gegenübersahen.102 Die erforderlichen infrastrukturellen —————— 102 Die für die Bundesrepublik charakteristische Entstehung einer dualen Ordnung durch den Eintritt neu gegründeter privater Sender in das bestehende System verkörpert den Normalfall der westeuropäischen Entwicklung. Die Begründung eines dualen Systems durch die Transformation von öffentlich-rechtlichen Sendern in private, wie in Frankreich, bildet hingegen die Ausnahme (Voltmer 2000: 29). MASSENMEDIEN 131 Voraussetzungen (wie die Bereitstellung neuer terrestrischer Frequenzen und die Verkabelung) wurden im Gefolge des bundespolitischen Machtwechsels von 1982 geschaffen und zunächst in den von der Union regierten Bundesländern umgesetzt. Zur erstmaligen Durchbrechung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols kam es jedoch im Sendebereich des von internen, nicht zuletzt parteipolitischen Querelen gezeichneten NDR. »Als Preis für den Fortbestand der Dreiländeranstalt ließ sich das damals sozialdemokratisch regierte Hamburg auf die Zulassung privater Rundfunk- und Fernsehsender ein« (Hartmann 2004: 102). Die später zahlreich hinzukommenden privaten Sender lassen sich mit wenigen Ausnahmen (wie Viva oder ntv) einer der beiden großen »Senderfamilien«, der heute von ausländischen Investoren kontrollierten ehemaligen Kirch-Gruppe (etwa SAT-1, Pro-7, Kabel 1) oder der von Bertelsmann beherrschten »RTL-Familie« (darunter RTL, RTL-2 und Vox) zurechnen. Vor allem im Osten haben die privaten Anbieter in der Zuschauergunst die öffentlich-rechtlichen Sender (mit Ausnahme der regionalen dritten Programme) mittlerweile deutlich hinter sich gelassen (Zubayr/Gerhard 2006), während »Pay-TV« bislang nirgendwo in Deutschland einen Markt nennenswerter Größenordnung gefunden hat. Letzteres hat nicht unerheblich etwas mit den – aus Sicht entsprechender Anbieter – besonders ungünstigen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik zu tun. Die im Vergleich mit der Situation in den anderen großen westeuropäischen Ländern ausgesprochen weite Verbreitung von Kabel und Satellit und die ungewöhnlich breite Palette frei verfügbarer Programme lassen hierzulande kostenintensive Zusatzangebote bei vielen potentiellen Kunden als verzichtbaren Luxus erscheinen (Kleinsteuber 2004: 82; Limmer 2005: 479–480). Mindestens so auffällig sind die Eigenheiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Dazu gehören, neben dessen föderaler Struktur, die sehr weitgehende Verrechtlichung des Rundfunkbereichs (nicht zuletzt als Ergebnis zahlreicher Rundfunk-Urteile des Bundesverfassungsgerichts) und vor allem das außerordentlich hohe Maß an Parteipolitisierung. »Faktisch haben CDU/CSU und SPD ihren Einflussbereich auf den öffentlichen Rundfunk ständig vergrößern und vielfach monopolisieren können. Die Zusammensetzung von Gremien führt sogar dazu, dass hochrangige Staatsvertreter Einfluss auf Hauhalts-, Programm- und Personalentscheidungen nehmen. […] Damit hat sich im öffentlichen Rundfunk ein Stück weit jene Parteipolitisierung vollzogen, die das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung gegen das so ge- 132 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE nannte »Adenauer-Fernsehen« 1961 verhindern wollte.« (Jarren/Donges 2006: 393–394)103 Zumindest formal gehört Deutschland zu der großen Mehrheit von Ländern, in denen die konkrete Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dem Prinzip des Binnenpluralismus folgt.104 Die breit geführte Debatte über die politische Ausrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender suggeriert jedoch etwas anderes. Einigen wissenschaftlichen Beobachtern zufolge rechtfertigt es die intensive Parteipolitisierung der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender, diese als ein gewaltenkonzentrierendes Element im Regierungssystem der Bundesrepublik zu bewerten (Schmitt Glaeser 2002). Auch die Entwicklungen in der politischen Arena selbst sind kaum dazu angetan, eine gegenteilige Einschätzung zu befördern. Vor allem die ARD wurde von der Union verbundenen oder nahe stehenden Akteuren immer wieder mit dem Vorwurf politischer Unausgewogenheit, konkret der »Linkslastigkeit«, konfrontiert. Anfang 1995 forderten die Ministerpräsidenten Bayerns und Sachsens, Edmund Stoiber und Kurt Biedenkopf, gar die Einstellung des Ersten Programms der ARD – freilich ohne damit in der breiteren Öffentlichkeit auf große Zustimmung zu stoßen (Meyn 2004: 164). Die gewachsene Konkurrenzierung der öffentlich-rechtlichen Medien durch private Sender wird bislang – nicht nur in Deutschland – überwiegend unter dem Aspekt ökonomischer Herausforderungen und daraus folgender programmbezogener Adaptionsprozesse (auf beiden Seiten) betrachtet (Syvertsen 2003: 158–159). Aus einer stärker politischen Perspektive ließe sich die wachsende Bedeutung privatwirtschaftlicher Sender wie multimedialer Großkonzerne auch als eine schleichende Verschiebung des politischen Koordinatensystems zugunsten bürgerlich-liberaler Positionen deuten (Hallin/Mancini 2004: 292–293). —————— 103 Gleichwohl wurde von »Insidern« verschiedentlich die Position vertreten, dass der politische Druck auf die öffentlich-rechtlichen Sender in der jüngeren Vergangenheit nachgelassen habe (Meyn 2004: 153). Als Ursache dafür wird neben der relativen Bedeutungseinbuße der öffentlich-rechtlichen Sender im dualen System auf die gestiegenen Chancen von Politikern, in irgendeinem der zahlreichen Programme zu Wort zu kommen, verwiesen. 104 Zu den wenigen Fällen, in denen auch im Bereich von »public broadcasting« Formen des externen Pluralismus dominieren, gehören die Niederlande und Italien (Voltmer 2000: 36). MASSENMEDIEN 133 5.4 Konklusion Die historische Bilanz Deutschlands bis 1945 auf dem Feld der Entwicklung »demokratiefreundlicher« Medien fällt vergleichbar bescheiden aus wie auf dem Gebiet der Parteiengeschichte. Exemplarischen Charakter erreichten am ehesten einige der negativen Auswüchse des Mediensektors wie der Hugenberg-Konzern der Weimarer Jahre, der in der internationalen Literatur als das erste wirkliche »›multimedia‹ empire« gilt (Humphreys 1990: 14), ganz zu schweigen von der einzigartigen nationalsozialistischen Progaganda-Maschinerie der Jahre 1933 bis 1945. Der mit alliierter Starthilfe nach 1945 eingeleitete Aufbau eines Mediensystems »westlicher Prägung« stand der Ausformung deutscher Besonderheiten nicht im Wege. Zu ihnen gehört – trotz des starken britischen Einflusses in diesem Bereich – vor allem der föderalistische Charakter der Medienlandschaft. Ebenfalls dazu gerechnet werden kann die starke Parteipolitisierung in den Kontrollgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie hat dem Ansehen der öffentlichen Sender im In- und Ausland im Hinblick auf die Qualität des Programms wie deren Glaubwürdigkeit als Informationsquelle jedoch keinen Abbruch getan. Ähnlich wie einzelne Titel der überregionalen Qualitätspresse haben sich auch der öffentlichrechtliche Rundfunk und das Fernsehen den Ruf erworben, zu den international Besten ihrer Art zu zählen. In einer aufwendigen international vergleichenden Untersuchung über die Mediensysteme unterschiedlicher OECD-Staaten erscheint Deutschland (1990) als eines von sieben der insgesamt 17 klassifizierten Systeme, die sowohl im Bereich der Presse als auch des Rundfunks durch gute Werte hinsichtlich der Struktur des politischen Informationsangebots auffielen (Voltmer 2000: 43–44).105 Nicht verschwiegen werden kann in diesem Zusammenhang allerdings, dass —————— 105 Auf der Ebene der Presse wurde danach differenziert, ob die Verbreitung der zehn wichtigsten sich zum Prinzip des internen Pluralismus bekennenden Blätter, gemessen am internationalen Durchschnittswert, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich weit verbreitet sind. Eine gute Bewertung im Bereich des Rundfunksystems setzt voraus, dass dieses ebenfalls eindeutig am Prinzip des internen Pluralismus ausgerichtet und nicht dem direkten Einfluss bzw. der versuchten »Einmischung« von Regierungen ausgesetzt ist. Gemeinsam in einer Gruppe mit Deutschland befanden sich den Befunden dieser Studie zufolge Österreich, Belgien, Finnland, Japan, Norwegen und die USA. Ganz am Ende der Vergleichsskala mit schlechten Werten in beiden Bereichen standen Griechenland, Irland, Italien und Spanien. 134 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE insbesondere die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in der Bundesrepublik ihren Preis hat: Sie gelten als die teuersten öffentlich-rechtlichen Funkmedien der Welt (Rudzio 2006: 399). Stärker noch als manch andere Bereiche bleibt der Mediensektor durch eine hohe Veränderungsdynamik bestimmt. Die international vergleichende Medienforschung konstatiert mit Blick auf die grundlegenden Entwicklungstendenzen unterschiedlicher Mediensysteme einen »Triumph des liberalen Modells« (Hallin/Mancini 2004: 251). Gemessen am status quo ante der frühen Nachkriegszeit hat sich die Mehrzahl der Mediensysteme in den konsolidierten liberalen Demokratien mehr oder minder weit auf das liberale/nordatlantische Modell, wie es prototypisch von den Vereinigten Staaten verkörpert wird, zu bewegt. Die beiden wichtigsten Komponenten dieses Trends, und zugleich die Ursachen der relativen Homogenisierung der Mediensysteme der westlichen Länder, bilden die intensive Kommerzialisierung im Bereich der elektronischen Medien und der wachsende Stellenwert privater Radio- und Fernsehsender in den Angebotsund Nutzungsstrukturen der Mediensysteme. Ausnahmen von diesem Trend betreffen aus der Gruppe der OECD-Staaten lediglich einige der kleineren Länder wie Österreich, die Schweiz und Irland, die über die größeren Nachbarländer Deutschland und Großbritannien jedoch zumindest indirekt an den internationalen Entwicklungen Anteil nehmen. Obwohl von einer internationalen Tendenz zur Annäherung an das amerikanische Modell gesprochen werden kann, weisen die meisten Autoren die These von der »Amerikanisierung« der Mediensysteme anderer Länder zurück. Mit Recht: Zum einen speisen sich viele der maßgeblichen Veränderungsimpulse aus anderen Quellen, im Falle Deutschlands und der anderen europäischen Länder aus innereuropäischen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. Zum anderen gibt es Anzeichen für eine partielle Annäherung des amerikanischen Systems an europäische Strukturen und journalistische Standards, die der »Amerikanisierungs«-These entgegensteht (ebd.: 255). Vor allem im Hinblick auf die konkreten Effekte der globalen Transformation von Mediensystemen ist jedoch Skepsis gegenüber populären Diagnosen der »Amerikanisierung« angezeigt. Überall hat die Kommerzialisierung der Medien deren Charakter als selbständige, genuin politische Akteure gestärkt (Mancini/Swanson 1996: 11). Aber die neue Macht der Medien bleibt eingebunden in unterschiedliche institutionelle und politisch-kulturelle Kontexte, die nur begrenzte Modifikationen der bestehen- MASSENMEDIEN 135 den Systeme zulassen. Das zeigen auch speziellere Studien über die Bundesrepublik: Zwar erscheint das Mediensystem als das vergleichsweise flexibelste und »adaptionsfreudigste« Teilsystem des politischen Systems. Veränderungen auf dieser Ebene werden aber nicht unvermittelt weitergegeben. Angleichungseffekte bleiben weithin auf die allgemeine Ebene ähnlicher Darstellungsformen politischer Akteure beschränkt. Schon »Kampagnestrategien, die stark von der politischen Kultur und Institutionen geprägt sind, erwiesen sich als zu nationalspezifisch, um auch nur Teilaspekte von Übernahmen zu erlauben« (Wagner 2005: 401). Auch und gerade die Evolutionsdynamik der Massenmedien und deren Effekte auf den politischen Prozess in Deutschland sind mit den in anderen Kontexten geprägten Topoi der »Verwestlichung« (Söllner 1999) oder »Westernisierung« (Doering-Manteuffel 1999) besser beschrieben als mit jenem der »Amerikanisierung«. 6 Das Parlament: Die demokratische Herzkammer des gezähmten Leviathan Jahrzehntelang standen die Parlamente im Zentrum der politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit der Demokratie. Und dies nicht von ungefähr – handelt es sich beim Parlament doch gleichsam um den institutionellen Sitz des demokratischen Prinzips, von dem in der parlamentarischen Demokratie (mit der gelegentlichen Ausnahme direkt gewählter Staatsoberhäupter) alle weiteren Staatsorgane ihre demokratische Legitimation herleiten.106 Im viel beschworenen Zeitalter des »Post-Parlamentarismus« scheint die Behandlung der Parlamente hingegen geradezu der besonderen Rechtfertigung zu bedürfen. Die verbreitete Skepsis gegenüber den Parlamenten speist sich vor allem aus der vielfach formulierten (wenn auch nur selten gut belegten) Vermutung über deren schleichenden Einflussverlust im politischen Entscheidungsprozess. Selbst dort, wo es Anzeichen einer ernstzunehmenden entscheidungspolitischen De-Parlamentarisierung gibt107, verliert das Parlament jedoch zumindest in normativer Hinsicht —————— 106 Dass die Formel vom »demokratischen Parlament«, wie Ernst Fraenkel (1973: 114) es ausgedrückte, sich im Laufe der Geschichte »aus einem Paradoxon in einen Pleonasmus« verwandeln konnte, war gleichwohl nicht allein der institutionellen Geburt der parlamentarischen Demokratie zu verdanken, sondern hatte ferner einen grundlegenden Wandel der gesellschaftlichen Vorstellungen von Repräsentation und Demokratie zur Voraussetzung. Im Zuge dessen galt es, die antidemokratischen Aspekte des englischen Parlaments bzw. Parlamentarismus mit der antirepräsentativen demokratischen Ideologie Frankreichs miteinander zu versöhnen und zur Idee der repräsentativen Demokratie zu verknüpfen (Fraenkel 1973: 155). 107 Einige der diesbezüglich relevanten Aspekte werden in Kapitel 10 beleuchtet. Nur begrenzt als eine problematische Einschränkung der Bedeutung des Parlaments akzeptiert werden kann – verbreiteten Klagen zum Trotz – dessen untergeordnete Stellung gegenüber der Regierung innerhalb der parlamentarischen Arena, welche gleichsam ein konstitutives Merkmal parlamentarischer Regierungssysteme darstellt. DAS PARLAMENT 137 nicht an Bedeutung. Im Gegenteil. Auch die theoretischen Vordenker der »post-parlamentarischen Demokratie« wie Arthur Benz (1998) möchten auf die genuin demokratischen Ressourcen des Parlaments und des Parlamentarismus deshalb nicht verzichten, während die Befunde der empirisch vergleichenden Demokratisierungsforschung gar darauf hindeuten, dass eine hinreichende Institutionalisierung der Parlamente den Schlüssel zur Konsolidierung »junger Demokratien« bildet (Fish 2006). Der zentralen Position des Parlaments in der repräsentativen Demokratie entspricht der breite, potentiell das gesamte politische System umspannende Fokus der politikwissenschaftlichen Parlamentarismusforschung. Stärker als die gängigen Klassifikationsvorschläge der Politikwissenschaft in anderen Teilbereichen der Institutionenforschung sind einige der zentralen Verortungskategorien in Bezug auf das Parlament an dessen Verhältnis zu anderen institutionellen Akteuren des Regierungssystems orientiert. Das gilt ganz besonders für die geläufige Unterscheidung von Volksvertretungen in Parlamente und Legislaturen. Als Parlamente werden dabei nur solche Volksvertretungen betrachtet, die über das Recht verfügen, die Regierung aus politischen Gründen abzuberufen. Der Legislatur fehlt dieses Recht; gleichzeitig allerdings ist deren Rolle in anderen Bereichen, so insbesondere bei der Gesetzgebung, eine deutlich stärkere (von Beyme 1999a: 179).108 Da sich die Bezeichnung »Legislatur« für die Volksversammlungen in nicht-parlamentarischen Systemen im Deutschen kaum durchgesetzt hat, wurde vorgeschlagen, das spezifische Funktionsprofil von Parlamenten in parlamentarischen Systemen durch die Hinzusetzung des Adjektivs »parlamentarisch« zu verdeutlichen. In diesem Sinne ist bei Winfried Steffani (1988: 261) im deutsch-amerikanischen Vergleichskontext von »parlamentarischen Parlamenten« die Rede. Die deutschsprachige Literatur erscheint in diesem Punkt rigoroser als die angelsächsische. Obwohl die Differenzierung zwischen »parliaments« and »legislatures« eleganter anmutet als jene zwischen Parlamenten und Legislaturen, stößt man gerade in englischsprachigen Studien auf die Tendenz zur synonymen Verwendung beider Begriffe (etwa Norton 2002: 16, FN 4). Als Oberbegriff dient dann die Bezeichnung »legislative institutions«. Diese ist als funktionsorientierte Bezeichnung freilich ungenau, da ein wesentlicher Anteil an der Gesetzgebungsfunktion, zumindest faktisch, sowohl im parlamentarischen als auch im präsidentiellen System der Exe- —————— 108 Hier geht es, wie unschwer zu erkennen ist, um die Unterscheidung von Volksversammlungen in parlamentarischen und präsidentiellen Regierungssystemen. 138 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE kutive zufällt.109 Als akzeptabler stilistisch-inhaltlicher Kompromiss erscheint es deshalb eher noch, die Vertretungskörperschaften sämtlicher liberaler Demokratien als Parlamente zu bezeichnen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Analyse dreier institutioneller Komponenten, welche die Eigenart von Parlamenten und des Parlamentarismus in besonderer Weise prägen: die Struktur und Funktionsweise des Ausschusssystems, der Stellenwert des einzelnen Abgeordneten und der Fraktion(en) im parlamentarischen Verfahren sowie die institutionelle und politische Chancenstruktur der parlamentarischen Opposition. Alle drei Aspekte werden seit der wegweisenden Studie Nelson Polsbys (1968) über die Institutionalisierung des amerikanischen Repräsentantenhauses und den frühen Adaptionen des Konzepts im Kontext parlamentarischer Demokratien (Gerlich 1973) zu den Kernkomponenten legislativer Institutionalisierung gerechnet. Wie die übrigen Kapitel beginnt auch dieses mit einer Vergewisserung der historischen Grundlagen. 6.1 Historische Wege zur parlamentarischen Demokratie Die Entstehungsgeschichte der parlamentarischen Regierungsform ist außerordentlich komplex. Hier ist nicht der Ort für ausgreifende evolutionsgeschichtliche Betrachtungen110; einige wenige Hinweise müssen genügen. Zentral ist zunächst die Unterscheidung zwischen revolutionären und evolutionären Pfaden zur parlamentarischen Demokratie. Ersterer wird durch Länder wie Großbritannien, Schweden und die Niederlande, die revolutionäre Variante hingegen vor allem durch Frankreich repräsentiert. Deutschland verkörpert unter den heute konsolidierten parlamentarischen Demokratien in historischer Hinsicht einen Sonderfall, insofern hier die ersten Schritte in Richtung auf eine Konstitutionalisierung des Systems (als Vorstufe der Parlamentarisierung) weder im Zuge einer erfolgreichen Re- —————— 109 Davon abzugrenzen sind andere funktionsbezogene Klassifikationen, die an der Leistungsfähigkeit parlamentarischer Versammlungen orientiert sind. So schlägt etwa Patzelt (2003: 14) vor, weitgehend machtlose Vertretungskörperschaften als »Minimalparlamente« zu bezeichnen. 110 Verwiesen sei insbesondere auf von Beyme (1970, 1999a). Speziellere Aspekte wie die historische Beziehung zwischen Parlamentarisierung und Demokratisierung werden in anderen Teilen dieser Studie beleuchtet (vgl. Kapitel 2 und 7). DAS PARLAMENT 139 volution noch als Ergebnis eines beständigen Drängens liberaler Kräfte des Bürgertums erfolgten, sondern auf der Grundlage fürstlicher »Willkürakten« – eine Form des Regimewandels, die in der angelsächsischen Literatur mit dem Prädikat des »self-limited absolutism« (Finer 1997: 1598) bedacht wurde. In der Staatstheorie jener Zeit galten die Parlamente als »gesellschaftliche, nicht staatliche Institutionen« (Oberreuter 1990a: 15), von denen aus – mit Ausnahme des Rechts auf Mitbestimmung in Steuerfragen – lediglich Forderungen an den Staat erhoben werden konnten. Gleichwohl konnten die vom Monarchen einmal etablierten Selbstbeschränkungsrechte nicht ohne weiteres wieder von diesem zurückgenommen werden. Sie waren vielmehr politisch wie rechtlich bindend und nur im Rahmen des formalrechtlich fixierten Verfahrens unter Zustimmung der Volksvertretung revidierbar (Böckenförde 1992: 34).111 Zum Durchbruch der parlamentarischen Demokratie – verfassungsrechtlich manifestiert im Prinzip der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung – kam es in Deutschland spät, formal erst unmittelbar vor dem Ende des Ersten Weltkriegs durch das verfassungsändernde Gesetz vom 28. Oktober 1918. Dieser Schritt stand am Ende einer mehrjährigen Entwicklung. Der seit August 1914 tobende Krieg brachte die konstitutionelle Monarchie zwar nicht unmittelbar zum Einsturz, offenbarte aber in zunehmendem Maße die inhärenten organisatorischen und funktionellen Schwächen des Systems (Boldt 1990: 214). Die das Reich stabilisierende Idee eines politisch-gesellschaftlichen »Burgfriedens« wurde durch den Kriegszustand nach und nach ausgehöhlt. In politisch-gesellschaftlicher Hinsicht führte der Krieg zu einem Machtzuwachs der alten Eliten aus Adel und Militär. In politisch-institutioneller Hinsicht profitierten der Kaiser, dem der militärische Oberbefehl zustand, und die Oberste Heeresleitung (OHL) mit ihrem Weisungsrecht gegenüber der Verwaltung – auf Kosten des Kanzlers und des Reichstags (Gusy 1997: 2). Am Ende spielte vor allem die drohende militärische Niederlage Deutschlands eine ent- —————— 111 Bemerkenswerter Weise konnten es sich gerade etablierte Staaten leisten, zunächst vollständig auf eine Verfassung zu verzichten, ohne damit in besonderem Maße zu einem Ort unbeschränkter Willkür des Staatsapparates gegenüber den Untertanen zu werden. So bildete sich im verfassungslosen Preußen der Jahre 1815 bis 1840 bereits die Tendenz heraus, insbesondere Eingriffe in Freiheit und Eigentum an eine gesetzliche Grundlage zu binden. In diesem Sinne konnte sich der »Gesetzesstaat« im Einzelfall als begrenztes funktionales Äquivalent des noch nicht verwirklichten Verfassungsstaates erweisen (Reinhard 2000: 420). 140 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE scheidende Rolle bei der Beseitigung jener Machtfaktoren, die einer Parlamentarisierung lange entgegenstanden. Zu den wichtigen Wegmarken der Entwicklung zur parlamentarischen Regierungsform vor der Verfassungsänderung vom Oktober 1918 gehörten zunächst die Friedensresolution des Reichstags aus dem Jahre 1917, die Bildung des Interfraktionellen Ausschusses und die Reform des konstitutionellen Budgetrechts (Böckenförde 1988: 214–215). All diese Schritte waren Ausdruck der politisch bestimmend gewordenen Devise, »innere Reformen als Preis weiterer Unterstützung der Kriegsführung« (Gusy 1997: 5). Ab dem Sommer 1918 wirkte schließlich auch die Konzentration von Entscheidungsmacht in der OHL in Richtung einer Parlamentarisierung der Reichsregierung – wenn auch nur insoweit, als diese ein Bestreben entwickelte, die Verantwortung für die unabwendbar scheinende militärische Niederlage auf die Politik abzuwälzen. Ergebnis dieser Politik war die Ernennung Max von Badens zum Reichskanzler am 3. Oktober 1918. Die politischen Umstände der Regierungsbildung lassen es kaum als Übertreibung erscheinen, diesen Schritt als faktische Transformation des Reichs in eine parlamentarische Demokratie zu bewerten (ebd.: 7).112 Ungeachtet der Vielfalt historischer Entstehungsmuster parlamentarischer Demokratien stand der Status Großbritanniens als des »Mutterlandes des Parlamentarismus« nie in Frage. Hier traten viele der entscheidenden Merkmale der parlamentarischen Regierungsweise erstmals in Erscheinung, bevor sie die historisch-politische Entwicklung auch in anderen Ländern prägten. Dazu gehörte seit dem frühen 18. Jahrhundert nicht zuletzt die Herausbildung unterschiedlicher Lager innerhalb des Parlaments als Vorstufe des Dualismus zwischen Regierungsmehrheit und Opposition (Foord 1964; Jäger 1971). 1741 kam es erstmals zu einem Misstrauensantrag der Opposition gegen die Regierung, der nicht auf einer rechtlichen Anklage —————— 112 Der Krieg begünstigte jedoch nicht lediglich die Parlamentarisierung der Monarchie, sondern trug überdies zumindest indirekt zur Entstehung einer parlamentarischen Republik bei, insofern die westlichen Alliierten in der berühmten Note des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson vom 23. Oktober 1918 erklärt hatten, dass sie weder mit der militärischen noch mit der monarchischen Machtelite Deutschlands verhandeln würden. Bei der nun auch seitens der deutschen Öffentlichkeit erhobenen Forderung nach Abdankung des Kaisers ging es jedoch beinahe ausschließlich um die Person Wilhelms II., nicht um die Staatsform. Das rasche Ende der Monarchie durch die Ausrufung der Republik durch Philip Scheidemann am 9. November 1918, unmittelbar nach dem Thronverzicht Wilhelms II., hätte noch wenige Tage vor diesem Ereignis kaum jemand vorherzusagen gewagt. DAS PARLAMENT 141 (»impeachment«), sondern auf einer allgemeinen Anschauung von Politik gründete. Seit den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts wurde der Weg zu einer parlamentarisch verantwortlichen Kabinettsregierung beschritten. Bis zur endgültigen Durchsetzung des Parlaments gegenüber der Krone dauerte es freilich noch mehr als ein weiteres halbes Jahrhundert. Der Viscount Melbourne, der im August 1841 von seinem Amt zurücktrat, war der letzte (und dabei politisch weitgehend außer Gefecht gesetzte) Premierminister, der zwar das Vertrauen der Krone besaß, aber gegen das Parlament regierte (Kluxen 1991: 485–486, 562). Von einer hinreichenden Erfüllung der heute an das Modell der parlamentarischen Demokratie üblicherweise herangetragenen Bewertungsmaßstäbe blieb das britische Regierungssystem indes gleich in doppelter Hinsicht lange entfernt. Auf die erste Einschränkung wurde bereits im zweiten Kapitel dieser Studie, im Rahmen der Rekonstruktion der Genese des demokratischen Wahlrechts hingewiesen: Die Parlamentarisierung politischer Herrschaft ging der vollständigen Demokratisierung des britischen Regierungssystems um viele Jahrzehnte voraus. Noch 1910 verfügten nach Zahlen von Robert Goldstein (1983: 4) lediglich 18 Prozent der Gesamtbevölkerung des Vereinigten Königreichs über das Wahlrecht. Der zweite Aspekt ist kaum minder bedeutend. In dem Maße wie parlamentarische Demokratie mit dem Prinzip demokratischer Öffentlichkeit verknüpft gesehen wird – und das gilt heute als geradezu selbstverständlich –, sind Vorbehalte an der historischen Vorbildfunktion Großbritanniens angezeigt. Wie Philip Manow (2006: 159–165) uns erinnert, gehörte Öffentlichkeit der parlamentarischen Beratungen des britischen Unterhauses gerade nicht zu den frühen und international wegweisenden Merkmalen des Parlamentarismus britischer Prägung. Eine historische Vorreiterrolle in diesem Punkt kam vielmehr Frankreich zu. Während im (nach-)revolutionären Frankreich die Entscheidung zugunsten unbeschränkter Öffentlichkeit der parlamentarischen Verhandlungen gleichsam selbstverständlich aus der Doktrin der Volkssouveränität folgte, womit eine strikte Abgrenzung gegenüber der absolutistischen Praxis gesucht wurde, bildete in Großbritannien das Prinzip der Nichtöffentlichkeit der parlamentarischen Verhandlungen bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein ein zentrales Merkmal des Westminster-Parlamentarismus. Hierzu gehörte (bis 1875) nicht nur der kategorische Ausschluss von Fremden aus dem House of Commons, sondern auch eine in vielfältiger Weise durch Gesetze und 142 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Konventionen beschränkte Presseberichterstattung über parlamentarische Verhandlungen. »In England ging es eben nicht um die Etablierung eines politischen Kommunikationszusammenhangs zwischen Parlament und Gesellschaft, zwischen Repräsentanten und Repräsentierten, sondern um die Frage, wo der angemessene Ort für eine kritische Betrachtung des Regierungshandelns war. Die Vertreter eines strikten Publizitätsverbots im House of Commons argumentierten ganz im Sinne der alten secret-du-roi Doktrin, dass der richtige Platz für die Diskussion jeglicher Beschwerden das Parlament und nicht die Presse sei.« (Manow 2006: 163) Aus deutscher Perspektive ist diese Komponente der historischen Entwicklung des britischen Parlamentarismus umso bemerkenswerter, als die praktisch unbeschränkte Öffentlichkeit parlamentarischer Verhandlungen im britischen Unterhaus – welches heute nicht nur die Beratungen des Plenums, sondern auch die der Ausschüsse in Westminster kennzeichnet – den Gegnern der Nicht-Öffentlichkeits-Regel für Beratungen der Fachausschüsse des Bundestages nicht selten als strahlendes Vorbild wünschenswerter Parlamentsreformen vorgehalten wurde. Freilich: Mehr noch als ein kurzes historisches Gedächtnis ließe sich den Vertretern entsprechender Reformvorschläge vorwerfen, dass sie die Bedeutung der Kontextgebundenheit einzelner institutioneller Regeln unterschätzen. Den Ausschüssen, ja dem Parlament überhaupt, kommt in Großbritannien eine andere Systemfunktion zu als den parlamentarischen Einrichtungen in den stärker gewaltenteilig angelegten parlamentarischen Demokratien des europäischen Kontinents wie der Bundesrepublik. Kaum jemand in Großbritannien erwartet, dass die entscheidungspolitisch maßgeblichen Weichen im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens gestellt werden. Solange es stabile parlamentarische Mehrheiten gibt (und das war in Großbritannien von wenigen Ausnahmen abgesehen nach 1945 stets der Fall), wird über den Inhalt von Gesetzen ganz überwiegend innerhalb der Regierung und damit in aller Regel bereits vor der Eröffnung des parlamentarischen Verfahrens entschieden. Gerade deshalb kann auf die Nicht-Öffentlichkeit der Ausschüsse – als einer institutionellen Vorkehrung, die nicht zuletzt parteiübergreifende Formen der Verhandlung und Kompromissfindung strukturell begünstigt – in Großbritannien verzichtet werden. Dies setzt freilich wiederum eine ausgeprägte politisch-kulturelle Toleranz gegenüber dem Prinzip der unbeschränkten Mehrheitsherrschaft voraus, von der DAS PARLAMENT 143 Deutschland noch immer bedeutend weiter entfernt ist als viele andere Länder aus der Familie der konsolidierten liberalen Demokratien.113 6.2 Institutionelle und funktionale Merkmale des Ausschusssystems Von wenigen Ausnahmen abgesehen handelt es sich bei den Ausschüssen eines Parlaments, unabhängig von deren speziellen Kompetenzen bzw. Funktionen, um »true sub-sets of the legislature« (Strøm 1998: 40), also gleichsam um verkleinerte Spiegelbilder des jeweiligen Hauses.114 Damit werden die parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse, die die Zusammensetzung des Plenums kennzeichnen, prinzipiell auch auf der Ausschussebene gewahrt. Gerade die institutionellen Charakteristika von Ausschüssen bzw. Ausschusssystemen haben jedoch einen beträchtlichen Einfluss darauf, in welchem Maße der politische Entscheidungsprozess in den Ausschüssen lediglich die Machtverhältnisse des Plenums reproduziert. Nach von Beyme (1999a: 224) sind im Hinblick darauf vor allem die Zahl, Größe und Kompetenzen parlamentarischer Ausschüsse von Belang. —————— 113 Hiervon abweichende Positionen wurden auch von Autoren formuliert, die keineswegs in dem Verdacht stehen, die historischen und funktionalen Spezifika des deutschen und britischen Regierungssystems aus dem Blick zu verlieren. Bei Wolfgang Jäger (1994: 105–127), der die lange umstrittene Einführung der Öffentlichkeitsregel in Großbritannien sogar ausdrücklich als mögliches historisches Vorbild einer Parlamentsreform in Deutschland heranzieht, erscheint das Eintreten für ein Öffentlichkeitsgebot der Ausschüsse des Bundestages im Rahmen einer sorgsam abwägenden Reformempfehlung gleichsam als funktionales Äquivalent einer als dysfunktional erachteten plebiszitären Öffnung des Grundgesetzes. Angesehene angelsächsische Beobachter wie Anthony King (2001: 95) bewerten stattdessen – nicht zuletzt im Hinblick auf die Qualität der Gesetzgebung bzw. der Gesetze – gerade die Nichtöffentlichkeit der Verhandlungen in den Bundestagsausschüssen als entscheidenden Vorteil gegenüber dem britischen System. 114 Zwei Ausnahmen hiervon sind zu erwähnen: Die erste bezieht sich auf die in der Familie der Westminster-Demokratien verbreitete Erscheinung des sogenannten »Committee of the Whole House«; dabei fungiert das Plenum als Ausschuss. Die zweite Ausnahme bezieht sich auf die mögliche, aber in der Praxis seltene Einbeziehung von Personen, die keinen Sitz in der betreffenden Kammer haben. Am vergleichsweise häufigsten ist dabei die Einbeziehung von Ministern ohne Parlamentsmandat (ebd.). 144 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Auf diese Aspekte ist sogleich näher einzugehen. Jedenfalls am Rande der Erwähnung wert erscheinen zwei weitere Variablen. Von Bedeutung ist zunächst, ob ein Ausschuss öffentlich oder nicht-öffentlich berät. Wie im vorausgehenden Abschnitt bereits angemerkt wurde, ist davon auszugehen, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit die Erzielung parteiübergreifender Kompromisse – unter sonst gleichen Bedingungen – begünstigt. Eine grundsätzliche Öffentlichkeit der Ausschussberatungen kennen außer Großbritannien nur einige Länder aus der Familie der Westminster-Demokratien. Deutschland gehört zu der großen Mehrzahl von Systemen, in denen die Ausschüsse – von wenigen möglichen Ausnahmen abgesehen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen.115 Nicht minder wichtig ist eine zeitbezogene Variable. Der Faktor »Zeit« wird in der vergleichenden Parlamentarismusforschung noch immer primär im Kontext der Analyse des parlamentarischen »agenda-setting« und der Frage, wer die Entscheidungshoheit über die Beendigung von Ausschussberatungen besitzt, diskutiert (Döring 1995a). Es gibt jedoch weitere bedeutende zeitbezogene Aspekte des parlamentarischen Verfahrens. Für den Einfluss, den die Position eines Ausschusses auf den Inhalt einer Maßnahme hat, ist – wiederum ceteris paribus – nicht zuletzt entscheidend, in welchem Stadium des legislativen Verfahrens die Ausschüsse in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Grundsätzlich gilt: Je früher Ausschüsse mit einer Vorlage befasst werden, desto größer ihr Einfluss auf das Endergebnis parlamentarischer Beratungen und Entscheidungen. Das Verfahren im Bundestag entspricht der in der Mehrheit der konsolidierten liberalen Demokratien üblichen Praxis, dass die Ausschüsse, vor der ausführlichen Beschäftigung des Plenums mit einer Vorlage, tätig werden. In Großbritannien (wie in einigen anderen Ländern vor allem aus der Familie der Westminster-Demokratien) werden Vorlagen hingegen erst im Anschluss an die entscheidende zweite Lesung im Plenum von den Ausschüssen beraten. Dabei gilt für das britische Unterhaus, dass eine in zweiter —————— 115 Gemäß § 69 der Geschäftsordnung des Bundestages finden Beratungen der Bundestagsausschüsse »grundsätzlich nicht öffentlich« statt. Seit 1969 kann ein Ausschuss jedoch die Öffentlichkeit einer Sitzung beschließen, sofern er dies hinsichtlich des Beratungsgegenstandes für angezeigt hält – eine Kann-Bestimmung, die in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Im Zuge der Parlamentsreform 1995 erhielten die Ausschüsse überdies die Möglichkeit, im Einverständnis mit dem Ältestenrat und den mitberatenden Ausschüssen im Rahmen der Schlussberatung einer überwiesenen Vorlage öffentliche Aussprachen durchzuführen. DAS PARLAMENT 145 Lesung angenommene Vorlage im Zuge der anschließenden Beratungen in ihrem Kerngehalt nicht mehr verändert werden darf (Helms 2001b: 410). Von beträchtlicher Bedeutung ist die Anzahl der Ausschüsse. Sie wurde in einen Zusammenhang mit der Macht der Parteien über einzelne Abgeordnete gerückt, wobei – so die These – eine große Anzahl von Ausschüssen der Entscheidungsfreiheit der Abgeordneten zugute komme (von Beyme 1999a: 229). Traditionell klein ist die Zahl parlamentarischer Ausschüsse mit lediglich sechs in Frankreich und Irland, deutlich größer vor allem in den Niederlanden, Österreich oder Dänemark. In den Niederlanden existierten zwischen 1970 und Ende der neunziger Jahre zwischenzeitlich bis zu 35 Ausschüsse (Schnapp/Harfst 2005: 355). Mit (im selben Zeitraum) durchschnittlich 21 Ausschüssen liegt die Bundesrepublik etwas oberhalb des für 23 konsolidierte Demokratien ermittelten Durchschnittswertes (ebd.). Die Anzahl der Ausschüsse ist sinnvoller Weise im Kontext der grundlegenden organisatorischen Struktur des Ausschusssystems zu betrachten. Als ein wichtiges Kennzeichen »starker« Ausschüsse gilt die Orientierung der Ausschussstruktur an der Ressortstruktur der Regierung. Die Vorteile dieses Systems liegen auf der Hand: Auf Dauer ist eine effektive Kontrolle der Exekutive durch einen parlamentarischen Ausschuss praktisch nur auf der Basis von Konzentration und Spezialisierung auf ein bestimmtes Sachgebiet möglich. Dieser Einsicht haben sich wenige Länder verschlossen. Aus international vergleichender Perspektive hervorhebenswert sind heute eher Länder, in denen es eine solche »Spiegelbildlichkeit« zwischen Ausschuss- und Ressortstruktur nicht gibt (Frankreich, Großbritannien, Irland, Belgien, Neuseeland, Portugal und die Schweiz). Die Bundesrepublik gehört zur großen Gruppe jener Systeme, für die eine ressortorientierte Ausschussstruktur seit Jahrzehnten kennzeichnend ist (Schnapp/Harfst 2005: 355). Auch hinsichtlich der durchschnittlichen Ausschussgröße liegt Deutschland im Mittelfeld der konsolidierten liberalen Demokratien. Die Gruppe jener Länder mit der größten Zahl an Mitgliedern pro Ausschuss ist keineswegs identisch mit jenen Ländern, die durch eine besonders geringe Anzahl von Ausschüssen auffallen (ebd.: 358). Das gilt ohne Einschränkung praktisch nur für Frankreich und Griechenland. Zu den wichtigen Variablen, die der simplen Gleichung »wenige Ausschüsse = große Ausschüsse« entgegenstehen, gehören die unterschiedliche Größe von 146 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Parlamenten116 und die unterschiedlich hohe »Ausschussbelastung« von Abgeordneten. Durch auffallend wenige und gleichwohl zahlenmäßig kleine Ausschüsse sind vor allem die Systeme Großbritanniens, Australiens und Neuseelands gekennzeichnet. Die gerade von deutschen Autoren oft hervorgehobene Stärke der Bundestagsausschüsse – die sich zu einem guten Teil aus deren Charakter als Fachausschüssen mit langjähriger Zugehörigkeit von Politikfeldspezialisten der Fraktionen ergibt – wird durch einen internationalen Vergleich von deren Kompetenzen ein Stück weit relativiert. Weder auf der Ebene von Informationsrechten der Ausschüsse noch in Bezug auf deren Initiativrechte und abschließenden Entscheidungsrechte im Gesetzgebungsverfahren nehmen die Ausschüsse des Bundestages eine internationale Spitzenposition ein. Hinsichtlich der Informationsrechte wurde für die Bundesrepublik in Studien mit quantitativem Zugriff ein Platz im oberen Mittelfeld ermittelt (ebd.: 367). Legislative Initiativrechte von Ausschüssen hingegen sind dem Grundgesetz wie der Geschäftsordnung des Bundestages unbekannt; allerdings gilt Entsprechendes für die meisten übrigen Systeme. Nur die Ausschüsse einiger weniger Länder (darunter Schweden, Griechenland und Japan, ferner die Schweiz und die USA) kennen ein selbständiges Gesetzesinitiativrecht, welches angesichts alternativer Wege der Gesetzesinitiative jedoch als »überflüssig« (von Beyme 1999a: 232) bewertet wurde. Noch ungewöhnlicher ist das Recht von Ausschüssen, kleinere Gesetze in letzter Instanz verabschieden zu können, welches in der parlamentarischen Praxis nur in Italien zu größerer Bedeutung gelangt ist. Immerhin gehören die Ausschüsse des Bundestages zu jenen, in denen Regierungsvorlagen gegebenenfalls vollständig umgeschrieben werden können. Dem Plenum dient als Beschlussgrundlage der neue vom Ausschuss verabschiedete Text (an dem freilich weitere Änderungen möglich sind). Entsprechende Regeln finden sich in etwa der Hälfte der hier interessierenden Systeme. In einer ganzen Reihe von Ländern – von Dänemark über die Niederlande und Frankreich bis nach Großbritannien und Irland – berät das Plenum im Anschluss an die Ausschussberatungen hin- —————— 116 Der Bundestag gehört dabei freilich zu den nach absoluten Zahlen großen Volksvertretungen. Angesichts der Bevölkerungsgröße der Bundesrepublik ist indes auch die Zahl von knapp unter 600 Abgeordneten (ohne mögliche Überhangmandate) kaum spektakulär. Als verhältnismäßig groß können an diesem Kriterium gemessen eher das schwedische und das portugiesische Parlament gelten. DAS PARLAMENT 147 gegen die ursprüngliche Regierungsvorlage; die vom Ausschuss gewünschten Änderungen sind der Vorlage lediglich angeschlossen und werden nur berücksichtigt, sofern der verantwortliche Minister keinen Einspruch dagegen erhebt (Strøm 1998: 48–52). Die Funktion parlamentarischer Ausschüsse ist offensichtlich: Selbst in politisch-institutionellen Kontexten, in denen die Ausschüsse nicht Orte des regelmäßigen Zusammentreffens von Politikfeldspezialisten sind, wird durch die Existenz eines verzweigten Systems gleichzeitig tagender Ausschüsse die Gesamtzeit, während der das Parlament mit der Kontrolle der Regierung und deren Gesetzgebungsprogramm befasst ist, faktisch vervielfacht. In aller Regel bewirken die Ausschüsse jedoch nicht nur eine signifikante Verbreiterung der zeitlichen Basis parlamentarischer Kontrolle und Mitregierung, sondern produzieren auch konkrete inhaltliche Kontroll- und Mitregierungsleistungen. Diesbezüglich wurde die funktionale Bedeutung der Ausschüsse mit dem Effekt zweiter Kammern verglichen (von Beyme 1999a: 222–223). Zwei Fragen haben die international vergleichende Ausschussforschung der vergangenen Jahre besonders beschäftigt. Zum einen ging es darum, inwieweit Ausschüsse tatsächlich so etwas wie Strukturen zur Ermöglichung von Kompromiss und (parteiübergreifendem) Konsens darstellen. Nach einer Studie von Erik Damgaard und Ingvar Mattson (2004) erzeugen Ausschüsse – entgegen der prominenten These Giovanni Sartoris (1992: 223–224) – keineswegs mehrheitlich konsensuelle Lösungen. Vor allem in institutionell »starken« Ausschüssen regiere stattdessen der Konflikt. Das markiert einen gleichermaßen überraschenden wie bemerkenswerten Befund. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass sich die vergleichende Analyse Damgaards und Mattsons lediglich auf die Ausschusstätigkeit in einem einzigen Politikfeld, der Arbeitsmarktpolitik, während der achtziger Jahre stützt, so dass die nach wie vor plausible These Sartoris bis auf weiteres nicht als grundsätzlich widerlegt gelten kann. Eine zweite Kontroverse über die Rolle der Ausschüsse in den Parlamenten der konsolidierten Demokratien betrifft das Gewicht und den Einfluss der Ausschüsse im präsidentiellen System der USA und in den parlamentarischen Demokratien Westeuropas (und anderswo). Der klassischen These eines gleichsam »natürlichen« und entsprechend deutlichen Vorsprungs der Ausschüsse im präsidentiellen System gegenüber jenen in parlamentarischen Systemen (Strøm 1998: 21) wurde in der jüngeren Literatur widersprochen, am entschiedensten in einer empirisch vergleichenden 148 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Untersuchung von Kai-Uwe Schnapp und Philipp Harfst (2005). Die von den Autoren präsentierten Daten unterstreichen zwar die Stärke und Macht der Ausschüsse des US-Kongresses als legislativen Kontrolleuren. Allerdings gibt es diesen Daten zufolge eine ganze Reihe von Parlamenten aus der Familie der parlamentarischen Demokratien, deren Ausschusssysteme an das US-amerikanische Referenzmodell mehr oder minder nah heranreichen bzw. dieses im Hinblick auf einzelne Indikatoren sogar übertreffen. Dazu gehören die Bundesrepublik, Dänemark, aber auch Japan – in krassem Gegensatz besonders zu Ländern wie Frankreich und Irland (ebd.: 369–370). Freilich vermag eine statistisch-empirische Bestandsaufnahme im Stile der Studie von Schnapp und Harfst kein »ganzheitliches« Bild zu zeichnen. Das gilt nicht zuletzt wegen der vollständigen Ausblendung historischpolitischer Entwicklungsdynamiken jenseits institutioneller Regeln. Relevant für einen transatlantischen Vergleich sind dabei insbesondere die jüngeren Wandlungen im amerikanischen Regierungssystem. Sie stützen im Ergebnis die Assimilationsthese: Die einst durch Senioritätsregeln und sektorale Interessen zu sprichwörtlicher Macht gelangten Ausschüsse des US-Kongresses gehören zu den großen Verlierern der für amerikanische Verhältnisse geradezu dramatischen »Parteipolitisierung« des legislativen Verfahrens seit den neunziger Jahren, welche ihrerseits Abglanz tief reichender Veränderungen der sozialen und ideologischen Basis der amerikanischen Parteien sind (Layman/Carsey/Horowitz 2006). Sowohl die Anzahl der Kongressausschüsse als auch deren Sitzungsfrequenz hat in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten deutlich abgenommen; auch der einst immense eigenständige Einfluss der Ausschüsse auf legislative Maßnahmen bewegt sich mittlerweile tief im Schatten der gewachsenen parteipolitischen Polarisierung der legislativen Arena (Cohen u.a. 2004). In diesem Sinne verlief die jüngere Entwicklungsgeschichte des amerikanischen Kongresses in Richtung eines stärker »qualified exceptionalism« (Owens/Loomis 2006). 6.3 Abgeordnete und Fraktionen Deutschland zählt zu jenen Ländern, in denen »das freie Gewissen« des Abgeordneten ausdrücklich verfassungsrechtlich anerkannt ist (von Beyme DAS PARLAMENT 149 1984: 375).117 Auch in der öffentlichen Debatte über den Zustand des Parlamentarismus in der Bundesrepublik genießt die in Art. 38 GG niedergelegte Norm der Gewissensfreiheit traditionell einen hohen Stellenwert.118 Wie ein internationaler Vergleich belegt, entspricht dem jedoch weder quantitativ noch qualitativ eine besonders starke Stellung des einzelnen Abgeordneten. Unabhängige Abgeordnete (ohne Fraktionszugehörigkeit) kennt der Bundestag – abgesehen von Akteuren, die nach erfolgter Wahl von ihrer jeweiligen Fraktion ausgeschlossen werden oder ihre Mitgliedschaft zu dieser von sich aus kündigen – praktisch nur insoweit, als möglicherweise einzelne Abgeordnete (kleinerer Parteien) per Direktmandat in den Bundestag gewählt werden, ihre Partei jedoch an den Hürden des Wahlrechts scheitert und infolgedessen keine Fraktion bilden kann (so zuletzt geschehen bei der Bundestagswahl 2002). Als fraktionslose Abgeordnete im weiteren Sinne ließen sich ferner solche Mitglieder des Bundestages bezeichnen, die Repräsentanten einer Partei sind, deren Mandatsanteil lediglich die Bildung einer parlamentarischen Gruppe erlaubt (so im Falle der PDS während der 12. und 13. Wahlperiode des Bundestages). Angesichts der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Parlamentsorganisation in der Bundesrepublik verfügen fraktionslose Mitglieder des Bundestages – gemessen an den Standards fraktionell organisierter Abgeordneter – über lediglich stark eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten (Klein 2004; Morlok 2004). Selbst der autonome Handlungsspielraum fraktionell eingebundener Abgeordneter ist jedoch institutionell eng beschränkt. Das gilt insbesondere für die Rechte des einzelnen Abgeordneten im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren. Gemeinsam mit Österreich, Italien und Spanien ist Deutschland eines der wenigen Länder, in denen einzelne Abgeordnete nicht über das Recht zur Gesetzesinitiative verfügen, dieses vielmehr den Fraktionen bzw. einer Gruppe von Abgeordneten in Fraktionsstärke vorbehalten ist. Die Anforderungen hinsichtlich der numerischen Unterstützung einer parlamentarischen Gesetzesinitiative sind in der Bundesrepublik zudem besonders hoch. Die Erlangung des Fraktionsstatus setzt (nach anfänglich geringeren Hürden) seit 1969 eine Stärke von mindestens fünf —————— 117 Das »freie Mandat« wurde erstmals in der französischen Verfassung von 1791 verfassungsrechtlich normiert. Es bildete einen festen Bestandteil der deutschen Verfassungstradition seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 118 Vgl. mit zahlreichen weiteren Nachweisen Schuett-Wetschky (2005). 150 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Prozent der Mitglieder des Bundestages voraus. Zu Beginn der 16. Legislaturperiode waren dies (trotz der in den neunziger Jahren vollzogenen Verkleinerung des Bundestages) noch immer 30 Abgeordnete. Erschwerend kommt hinzu, dass hierzulande – im Gegensatz etwa zu der Situation in Italien oder Spanien, aber auch in der Schweiz (Helms 1999b: 11–12) – ein ausdrückliches Verbot der Bildung von »gemischten Gruppen« existiert. Zu einer Fraktion dürfen sich nur Vertreter von Parteien vereinen, die in keinem Bundesland im Wettbewerb miteinander stehen. Durch eine institutionell befestigte Vormachtstellung der Fraktionen sind im Übrigen keineswegs nur die Regeln der Gesetzesinitiative gekennzeichnet; Entsprechendes gilt für die Formulierung von Änderungsanträgen in späteren Stadien des Gesetzgebungsverfahrens. Eher noch bemerkenswerter ist der Umstand, dass in der Praxis auch viele parlamentarische Kontrollrechte gegenüber der Regierung – einschließlich solcher, die formal nicht zur Prärogative der Fraktionen gehören – nur »nach Abstimmung« zwischen einzelnen Abgeordneten und ihrer Fraktion zum Einsatz gelangen (Ismayr 2000: 343). Insgesamt lässt sich der Bundestag, mehr noch als die meisten übrigen Parlamente der konsolidierten parlamentarischen Demokratien, treffend als »Fraktionenparlament« (Schüttemeyer 1992) beschreiben.119 Es kann jedoch offenbar nicht oft genug wiederholt werden, dass es sich bei dieser Form der Selbstorganisation von Parlamenten nicht lediglich um eine rationalisierte »Ersatzlösung« für ein eigentlich zu forderndes »Abgeordnetenparlament« handelt. Erst ein hinreichendes Maß an fraktioneller Geschlossenheit vermag die politische Wettbewerbsfähigkeit konkurrierender kollektiver Akteure und damit zugleich die Funktionsfähigkeit parlamentarischer Demokratie als eines im Kern gruppenbasierten Entscheidungssystems zu gewährleisten. Zusätzlichen institutionellen »Rückenwind« erfährt die Position eines primär gruppenbezogenen, »parteienstaatlichen« Repräsentationsmodells in Systemen, in denen die Mandatsverteilung auf der Grundlage von Parteilisten erfolgt (Helms 1999b: 13). Die theoretisch begründbare Relevanz dieses Faktors in der Praxis wird durch die Ergebnisse einschlägiger empirischer Untersuchungen bestätigt: So antworteten Mitte der neunziger Jahre bemerkenswerte 49 Prozent der befragten Mit- —————— 119 Für andere Länder trifft eine solche Charakterisierung freilich zumeist nur im Hinblick auf die funktionale Dimension des Parlamentsbetriebs zu, während der unabhängige rechtliche Status der Fraktionen gegenüber ihren jeweiligen Parteien eine deutsche Besonderheit darstellt (Hauenschild 1968; Hagelstein 1992). DAS PARLAMENT 151 glieder des Deutschen Bundestages auf die Frage, ob ein Abgeordneter mit seiner Partei stimmen solle, falls die Abstimmung zwar für die Partei wichtig sei, ihn selbst aber im Wahlkreis politische Unterstützung kosten könne, mit »eher ja«, hingegen nur 17 Prozent mit »eher nein« (Patzelt 1998a: 339). Die Fraktionsdisziplin im Bundestag war praktisch seit den Anfängen der deutschen Nachkriegsdemokratie stark, freilich mit gewissen Schwankungen (Saalfeld 1995). Die im Gefolge der deutschen Vereinigung gewachsene interne Heterogenität der Fraktionen schwächte die Abstimmungsdisziplin nur vorrübergehend (von Beyme 2000b: 40–41). Die auffallend knappen Mehrheiten regierender Parteien im 13. und besonders im 15. Bundestag haben den internen Zusammenhalt der Fraktionen, vor allem der Mehrheitsfraktionen, neuerlich befördert. Insgesamt gehört die Bundesrepublik zweifelsfrei zum international dominierenden Typus der parlamentarischen Demokratien mit ausgeprägter Fraktionsdisziplin. Die wichtigsten Ausnahmen von der Regel bilden Frankreich und Italien (Torbjörn u.a. 2003: 129), aber selbst die Fraktionen in diesen Ländern erscheinen noch als vergleichsweise stark integrierte Kollektivakteure, wenn das Abstimmungsverhalten von französischen und italienischen Parlamentariern mit den »voting records« der Abgeordneten im US-Kongress verglichen wird. Das gilt auch nach der Neugeburt des »party government« amerikanischer Prägung in den neunziger Jahren. 6.4 Die institutionelle und politische Chancenstruktur der parlamentarischen Opposition Anders als man erwarten könnte, ist das für den Parlamentarismus konstitutive Gegenüber von Regierungsmehrheit und Opposition keineswegs in allen betreffenden Systemen unmittelbar aus dem formal-rechtlichen Regelwerk ablesbar. Das gilt auch für die Bundesrepublik. Grundgesetz und Geschäftsordnung des Bundestages kennen lediglich Minderheitenrechte, nicht aber spezifische Oppositionsrechte nach dem Muster der Parlamente des Westminster-Typs. Unabhängig davon folgt auch das parlamentarische Geschehen im Bundestag eindeutig der Logik eines gruppenbasierten und im Kern bipolar geprägten Wettbewerbsmodells. Zu den zentralen Merkmalen der deutschen Variante eines parteiendemokratischen Parlamentarismus gehört nicht zuletzt die institutionell starke 152 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Position der nicht an der Regierung beteiligten Kräfte. Das betrifft zunächst die institutionelle Opportunitätsstruktur der parlamentarischen Opposition innerhalb der parlamentarischen Arena im engeren Sinne und dabei ganz besonders die Ebene der Mitwirkungs- und Vetorechte. Vor allem vier Komponenten sind zu nennen: das Recht der Opposition zur Mitgestaltung der parlamentarischen Tagesordnung über die Institution des Ältestenrates, das abgesehen von den erwähnten numerischen Restriktionen uneingeschränkte Gesetzesinitiativrecht der Opposition, die proporzmäßige Berücksichtigung der Opposition bei der Vergabe von Vorsitzendenpositionen in den ständigen Ausschüssen des Bundestages sowie insbesondere das Vetopotential, das der parlamentarischen Opposition aus dem Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit für die Verabschiedung verfassungsändernder Gesetze erwächst (vgl. Helms 2002a: 42–49).120 Es gibt wenige Systeme, in denen die parlamentarische Minderheit bei Anlegung dieser Bewertungskriterien über ähnlich weitreichende oder gar darüber hinausgehende parlamentarische Mitwirkungs- und Vetorechte verfügt. Der destruktiven Macht der Opposition innerhalb der parlamentarischen Arena im eigentlichen Sinne sind in Gestalt des »konstruktiven Misstrauensvotums«, welches die parlamentarische Ablösung eines Kanzlers und dessen Regierung nur um den Preis einer unmittelbaren Wahl eines Nachfolgers gestattet, hingegen ungewöhnlich enge Grenzen gesetzt.121 Vergleichbar strenge Regeln kennen innerhalb Westeuropas nur Spanien und Belgien, welche das deutsche Modell in modifizierter Form adaptierten. —————— 120 Als internationale Besonderheit kommt auf der Ebene von Kontrollrechten die als verfassungsrechtlich kodifiziertes Minderheitenrecht ausgestaltete Möglichkeit eines Viertels der Mitglieder des Bundestages hinzu, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu erzwingen. Vgl. hierzu ausführlich Glauben/Brocker (2005) 121 Die Bedeutung dieser Regel für die Regierungsstabilität in der Bundesrepublik bleibt umstritten. Insgesamt scheint mehr dafür zu sprechen, die ausgeprägte Regierungsstabilität nach 1949 primär mit der Struktur des deutschen Parteiensystems zu erklären. Dieses Urteil wird auch durch die Befunde vergleichender Arbeiten gestützt, nach denen weniger parlamentarische Misstrauensvoten als vielmehr Koalitionszerfall den wichtigsten Grund für das Ende von Regierungen in parlamentarischen Demokratien darstellen (von Beyme 1999a: 504–514). Sogar während der durch chronische Regierungsinstabilität geplagten Weimarer Republik, die das »konstruktive Misstrauensvotum« zwar in den Köpfen intellektueller Vordenker, nicht aber auf verfassungsrechtlicher Ebene kannte (Berthold 1997), gab es insgesamt nur einige wenige Fälle, in denen eine Regierung durch ein parlamentarisches Misstrauensvotum aus dem Amt getrieben wurde. DAS PARLAMENT 153 Ein signifikanter Teil der politischen Chancenstruktur der parlamentarischen Opposition in der Bundesrepublik speist sich aus Quellen, die außerhalb des Bundestages liegen. Zu ihnen zählt an erster Stelle der Bundesrat, dessen imposantes Machtpotential an anderer Stelle dieser Studie ausführlich behandelt wird (vgl. Kapitel 8).122 Als kaum minder bedeutend hat sich im Lichte der Erfahrung von mehr als fünfzig Jahren das Recht einer parlamentarischen Minderheit (oder einer Landesregierung, daneben auch der Bundesregierung) erwiesen, ein abstraktes Normenkontrollverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anzustreben. Die abstrakte Normenkontrolle ist freilich nicht die einzige, aber nach weithin einhelliger Einschätzung die für das Verhältnis zwischen Regierung und Opposition wichtigste Verfahrensart. Obwohl auch die Bilanz der im Gefolge verfassungsgerichtlicher Entscheidungen zustande gekommenen Korrekturen am Gesetzgebungsprogramm von Regierungen ansehnlich ist, entwickelt das Instrument der abstrakten Normenkontrolle vor allem – und dies nicht nur im deutschen Kontext – signifikante Vorwirkungen: Es führt zu einer Sensibilisierung regierender Mehrheiten gegenüber den Vorstellungen antragsberechtigter Minderheiten, welche sich üblicherweise in einer deutlich wahrnehmbaren Neigung zu politischer Selbstbeschränkung manifestiert (Landfried 1984; Stüwe 1997; Stone Sweet 2000: 75–79).123 Prinzipiell ähnliche Wirkungen entfalten Referenden, die von einer parlamentarischen Minderheit oder einer bestimmten Anzahl von Bürgern —————— 122 Ebenfalls zu erwähnen sind einige weitere Ressourcen der Opposition, die sich ebenfalls aus der föderativen Staatstruktur des deutschen Regierungssystems ergeben. Auf Bundesebene in Opposition stehende Parteien können in der Regel auf Länderebene Regierungserfahrung sammeln und auf diese Weise entsprechend geschultes Personal rekrutieren. Die von der eigenen Partei geführten Regierungen in den Ländern dienen der Opposition auf Bundesebene zudem als wichtige administrative Ressource für die bundespolitische Oppositionsarbeit. Von Bedeutung ist schließlich auch das im internationalen Vergleich ungewöhnliche Recht von Mitgliedern des Bundesrates, im Bundestag sprechen zu dürfen und jederzeit gehört werden zu müssen (Art. 43, Abs. 2 GG). 123 Besonders groß ist die Wirkung der abstrakten Normenkontrolle in institutionellen Kontexten, in denen die Opposition – anders als im Deutschen Bundestag – ansonsten über wenige Veto- und Mitwirkungsrechte verfügt. Für die V. Republik Frankreich wurde gar die These formuliert, dass die Möglichkeit zur Anrufung des Verfassungsrates durch eine qualifizierte Minderheit der Nationalversammlung bzw. des Senats das einzige ernstzunehmende Vetorecht der parlamentarischen Opposition darstelle (Vandendriessche 2001: 66). 154 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE initiiert werden können.124 Geradezu legendär sind die weitreichenden Effekte des Referendums in der Schweiz, wo die Einrichtung des fakultativen Referendums nicht nur die Struktur des alltagspolitischen Gesetzgebungsprozesses maßgeblich bestimmt, sondern überdies zur historisch wichtigsten Determinante der Regierungsbildung wurde (vgl. Kapitel 7). Aus der Familie der parlamentarischen Demokratien Westeuropas kommen den Schweizer Volksrechten die direktdemokratischen Einrichtungen in den Regierungssystemen Italiens, Dänemarks und Irlands am nächsten (Gallagher/Uleri 1996; LeDuc 2002). Die Bundesrepublik gehört in dieser Hinsicht – was die zentralstaatliche Ebene betrifft – zu jenen Ländern, die nach wie vor vollständig auf repräsentative Entscheidungsverfahren setzen.125 Im Rahmen eines Vergleichs des institutionellen Chancenprofils der parlamentarischen Opposition fällt dies umso mehr auf, als die Möglichkeit, parlamentarische Mehrheitsentscheidungen auch auf direktdemokratischem Wege zu bekämpfen, praktisch das einzige institutionelle Instrument darstellt, das der Opposition im Bundestag nicht zu Gebote steht. Angesichts dieser spezifischen institutionellen Bedingungen lässt sich das Oppositionsmodell der Bundesrepublik aus vergleichender Perspektive als »parlamentszentriert mit starken Mitwirkungs- und Vetorechten« charakterisieren (Helms 2002a: 40). Wie steht es aber um die politischen, insbesondere die parteipolitischen Parameter, durch die die institutionellen Regeln der parlamentarischen Arena erst eigentlich zum Leben erweckt werden? Die Bundesrepublik teilt mit den meisten anderen westeuropäischen Demokratien – die wichtigste Ausnahme bildet Skandinavien – die Tradition, dass Regierungen in aller Regel über eine stabile parlamentarische Mehrheit verfügen und zugleich Koalitionsregierungen sind. Einparteienregierungen und Minderheitsregierungen waren hierzulande auf Ausnahmephasen von kurzer Dauer beschränkt (vgl. Kapitel 7). Die Eigentümlichkeiten der Regierungszusammensetzung und der parlamentarischen Unterstützungsbasis unterschiedlicher Bundesregierungen spiegeln sich in der parteipolitischen Zusammensetzung des Oppositionslagers und dessen Stimmen- und Mandatsstärke wider: In der Frühphase der Bundesrepublik gab es mit der SPD, der Bay- —————— 124 Davon abzugrenzen sind Plebiszite, die nur von der Regierung bzw. einer parlamentarischen Mehrheit initiiert werden können, ferner sämtliche Spielarten direktdemokratischer Instrumente, mit denen lediglich ein bestimmter Gegenstand auf die politische bzw. parlamentarische Agenda gesetzt werden kann. 125 Dies im Gegensatz zu der Situation in den Bundesländern; vgl. Weixner (2002). DAS PARLAMENT 155 ernpartei (BP), den Kommunisten (KPD), der Wiederaufbau-Vereinigung (WAV), des Zentrums, der Deutschen Reichspartei (DRP) sowie des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) insgesamt sieben Oppositionsparteien und zusätzlich drei unabhängige Abgeordnete. Von 1961 bis 1983 saß jeweils nur eine Oppositionspartei im Bundestag (von 1961–1966 und 1982–1983: SPD; von 1966–1969: FDP; von 1969–1982: CDU/CSU). Zwischen 1983 und 1990 gab es zwei Oppositionsparteien (SPD und Grüne), während seit 1990 jeweils drei unterschiedliche Oppositionsparteien im Bundestag vertreten waren (1990–1998: SPD, Grüne, PDS; 1998– 2005: CDU/CSU, FDP, PDS; seit 2005: FDP, Grüne, PDS). In Bezug auf die Stärke der parlamentarischen Opposition sind zum einen die 2., 6. und 16. Wahlperiode (1953–1957, 1966–1969 und seit 2005) hervorhebenswert, während derer die Opposition über weniger als ein Drittel der Bundestagsmandate verfügte und aus diesem Grund viele der besonders wichtigen Minderheitenrechte nicht in Anspruch nehmen konnte. Aus entgegengesetztem Grund erwähnenswert sind die 13. und 15. Wahlperiode; in ihnen besaß die Opposition mit über 49 Prozent der Gesamtheit aller Mandate eine außergewöhnlich starke parlamentarische Repräsentationsbasis.126 Neben der Struktur des Parteiensystems und den von ihm bestimmten Mehrheitsverhältnissen in den politischen Entscheidungsorganen kommt vor allem den gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber politischen Konflikt- und Konsensbildungsprozessen eine herausragende Bedeutung für die Praxis politischer Opposition in einem Land zu, denn keine Oppositionspartei, der es um den Gewinn von Regierungsmacht geht, kann es sich leisten, die in der Bevölkerung vorherrschenden grundlegenden Einstellungen gegenüber unterschiedlichen politischen Verhaltensweisen zu vernachlässigen. Die politische Kultur der Bundesrepublik ist noch immer durch ein auffallendes Maß an »Harmoniebedürftigkeit«, im Sinne einer gewissen Konfliktscheu, geprägt (Grosser 1975; Leggewie 1990). Eine Mehrheit der Bevölkerung erwartet von der Opposition, dass sie sich konstruktiv an der Lösung politischer Probleme beteiligt, und kaum eine deutsche Oppositionspartei verzichtet vollständig darauf, ihre »Regierungstauglichkeit« durch konstruktive Vorstöße zu demonstrieren. Welch ein Unterschied zu der in den Westminster-Demokratien obwaltenden Logik, der —————— 126 Unberücksichtigt bleiben dabei die kurzen Übergangsphasen, in denen Minderheitsregierungen amtierten. Während dieser Phasen verfügten die nicht an der Regierung beteiligten Parteien über eine Mehrheit im Bundestag (vgl. Kapitel 7). 156 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE gemäß Oppositionsparteien der Regierung so viel Freiheit wie nur irgend möglich lassen – in der Hoffnung, dass sie übermütig, träge oder korrupt werde, um dafür am Ende vom Wähler zur Verantwortung gezogen zu werden.127 Das spezifische »Dilemma der Opposition« (Werner 1993) in der Bundesrepublik ergibt sich aus dem doppelten Erfordernis, einerseits den stark kompromissorientierten Präferenzen der Bevölkerung entsprechen zu müssen, andererseits genügend kompetitiv aufzutreten, um sich gegenüber der Regierung in ausreichendem Maße zu profilieren. Die damit verbundenen Herausforderungen wurden in der Geschichte der Bundesrepublik auf unterschiedliche Weise gelöst. Lagerübergreifende Kompromisse in wichtigen Sachfragen gab es in jeder Phase – jedoch in unterschiedlichem Ausmaß und im Kontext unterschiedlicher politischer »Großwetterlagen« und »Generalstrategien« der relevanten Akteure (von Beyme 1997; Helms 2002a: 55–65). Die historischen Hochphasen »leiser« bzw. »konstruktiver« Opposition fallen in den Zeitraum der späten fünfziger bis zur Mitte der sechziger Jahre und vom Ausgang der sechziger bis zum Beginn der siebziger Jahre. Die erste und eigentliche Hochphase einer betont konsensusbetonten Opposition war im Wesentlichen ein Ergebnis der grundlegenden programmatisch-ideologischen Neupositionierung der SPD, welche ihrerseits viel mit der schmerzlichen Erfahrung einer letztlich erfolglosen »Frontalopposition« gegen die Regierung Adenauer zu tun hatte. Zur geradezu symbolhaften Wendemarke wurde das Godesberger Programm der Sozialdemokraten aus dem November 1959. Es wurde außenpolitisch ergänzt durch die programmatische »Friedensrede« Wehners vom 30. Juni 1960 im Deutschen Bundestag. Vor allem in der Spätphase der Regierung Erhard erreichte die demonstrativ zur Schau getragene Kooperationsbereitschaft der Sozialdemokraten ein kaum mehr zu überbietendes Ausmaß. Am Ende dieser »Verwandlung« stand der lang ersehnte Eintritt der SPD in die Bundesregierung, wenn auch zunächst lediglich als Juniorpartner der Union. Ambivalenter war die Erfahrung der Jahre 1969 bis 1972. Zum ersten Mal mit der Oppositionsrolle im Deutschen Bundestag betraut, verfolgte —————— 127 Selbst diese dem deutschen Oppositionsverständnis so offensichtlich entgegengesetzte Logik des Westminster-Parlamentarismus schließt vereinzelte Manifestationen einer »konstruktiven Opposition wider Willen« nicht aus. Zu ihnen kommt es, wenn Regierungen sich im großen Stil der Ideen der Opposition bedienen, ohne formal oder auch nur informal mit dieser zu kooperieren. DAS PARLAMENT 157 die CDU/CSU während der 6. Legislaturperiode zunächst eine Oppositionsstrategie, aus der die Weltsicht einer »verhinderten Regierungspartei« sprach. In keiner früheren oder späteren Legislaturperiode brachte eine Oppositionspartei mehr eigenständige Gesetzesinitiativen in das parlamentarische Verfahren ein als die Christdemokraten im 6. Bundestag, und entsprechend hoch war die Erfolgsquote von Vorlagen aus den Reihen der Minderheit (Veen 1976). Für die Außenwirkung der Opposition entscheidender war freilich die überaus scharfe Opposition der CDU/CSU gegenüber der »Neuen Ostpolitik« der sozial-liberalen Opposition (Jäger 1986: 62–67), aber selbst in der Innenpolitik überwogen streng genommen eher konstruktive als konsenssuchende Töne. Die zahlreichen stärker konfliktgeprägten Phasen im Verhältnis zwischen Regierung und Opposition (gemeint ist primär immer die Beziehung zwischen den beiden großen Parteien) belegen, dass intensive Kooperation und parteienübergreifender Konsens sich nicht gleichsam von selbst aus den grundlegenden institutionellen Parametern ergeben. Diese prägen das Verhalten politischer Akteure nachhaltig, determinieren es jedoch nicht und machen Kompromiss und Konsens somit letztlich zu einer Frage politischen Willens (Oberreuter 2002: 60). Das veranschaulichen insbesondere die jüngeren Erfahrungen aus der Geschichte des Parlamentarismus in der Bundesrepublik, darunter die Spätphase der Regierung Kohl ebenso wie weite Strecken der Regierungszeit Gerhard Schröders und der rotgrünen Koalition, welche beide im Zeichen von intensivem Wettbewerb und Konflikt und wenig Konsens und Kooperation standen (Helms 2005a: 143–144). Gerade die weitgehende Stabilität der im engeren Sinne institutionellen Parameter lenkt den Blick auf längerfristig wirksame Veränderungen in anderen Bereichen, vor allem des Parteiensystems. Die tendenzielle Herausbildung eines »Zwei-Block-Systems« dürfte zumindest primär strategisch motivierte, auf einen »dosierten Machtwechsel« hin spekulierende Formen der kooperativen Opposition künftig unwahrscheinlicher machen. Wo das Ziel der Opposition darin besteht bzw. angesichts einer im Kern bipolaren Struktur des Parteiensystems darin bestehen muss, die Regierungsparteien vollständig aus dem Amt zu treiben – eine »wholesale alternation« (Mair 2002: 94) wie sie die Bundesrepublik auf Bundesebene erstmals 1998 erlebte –, dort ist ein quasi-institutioneller Anreiz gegeben, sich auf die Verfolgung eindeutig konfliktorientierter bzw. wettbewerbsbezogener Oppositions- und Machterwerbsstrategien zu konzentrieren. Die 158 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE jüngsten institutionellen Reformen im deutschen Regierungssystem – vor allem die Reform des Bundesstaates (vgl. Kapitel 8) – könnten eine solche Entwicklung begünstigen; sie stellen ihr zumindest keine zusätzlichen institutionellen Hemmnisse in den Weg. Aus international vergleichender Perspektive betrachtet könnte sich das Verhältnis zwischen Regierung und Opposition damit ein Stück weit dem französischen System annähern, welches neben einer bipolaren Mehrparteienkonstellation durch eine hohe Machtwechselwahrscheinlichkeit gekennzeichnet ist (Cole 2003). 6.5 Konklusion Der prägende Einfluss von Institutionen auf das Verhalten von Akteuren wird heute in der Parlamentarismusforschung ebenso wenig mehr prinzipiell in Frage gestellt wie in anderen Teildisziplinen der Politikwissenschaft. Das erscheint vielfacht gerechtfertigt, ist gleichwohl nicht immer unproblematisch. Selbst anspruchsvolle Beiträge zur Erforschung der »Parlamentskultur«, die sich um Differenzierung und Sensibilisierung für den Sachverhalt bemühen, dass Institutionen nur nach Maßgabe von deren Wahrnehmung und Deutung durch Akteure praktische Wirkung entfalten (vgl. etwa Lemke-Müller 1999), stehen in der Gefahr, die Bedeutung des Erbes älterer institutioneller Entwicklungsstadien zu unterschätzen. Hierzu gehört mit Blick auf die deutsche Entwicklung vor allem die vergleichsweise späte Parlamentarisierung der staatlichen Herrschaftsordnung. Sie war nicht nur dafür verantwortlich, dass der im internationalen Vergleich frühen Demokratisierung des Wahlrechts in Deutschland lange keine wirkliche Teilhabe des Volkes an der Selektion, Rekrutierung und politischen Kontrolle der staatlichen Entscheidungselite entsprach. Wie schon Ernst Fraenkel (1973: 24) aufgezeigt hat, führte der – insbesondere im Rahmen eines deutsch-britischen Vergleichs augenfällige – Umstand, dass sich das parlamentarische Regime in Deutschland deutlich später als die moderne staatliche Bürokratie herausbildete, zu spezifischen Defiziten etwa des parlamentarischen Debattenstils oder auch der parlamentarischen Taktik, die den deutschen Parlamentarismus über die institutionelle Geburt der parlamentarischen Demokratie hinaus prägten. Davon war auch die Bundesrepublik zunächst noch betroffen. Bis in die Mitte der fünfziger Jahre hinein erschien der Bundestag Betrachtern als DAS PARLAMENT 159 eine jener politischen Institutionen der deutschen Nachkriegsdemokratie, die durch ihre relativ geringe Institutionalisierung die Entstehung und Etablierung der »Kanzlerdemokratie« Adenauers begünstigten. Dies änderte sich seit den sechziger Jahren. Aus einer historisch-funktionalen Perspektive betrachtet verlief die graduelle Institutionalisierung des Bundestages in Richtung wachsender Effizienz und Hierarchisierung (Schüttemeyer 1994). Mindestens drei Elemente bestimmen das institutionelle Profil der parlamentarischen Arena in der Bundesrepublik heute: eine insgesamt größere Bedeutung der Ausschüsse als des Plenums, eine klare Unterordnung des einzelnen Abgeordneten unter die Fraktion sowie eine insgesamt großzügige Ausstattung parlamentarischer Minderheiten mit unterschiedlichen Kontroll-, Mitwirkungs- und Vetorechten. In diesem Sinne lässt sich der Bundestag im Kontext anderer Parlamente der konsolidierten liberalen Demokratien betrachtet als ein auf die Fraktionen zentriertes und in diesem Sinne »rationalisiertes« Arbeitsparlament mit einem relativ weitreichenden Mitregierungspotential im legislativen Entscheidungsprozess charakterisieren. Zu den Themen der jüngeren internationalen Forschungsdebatte gehört die Frage, ob Parlamente an einer übermäßigen Institutionalisierung leiden können (Norton 1998a: 201). Die Antwort darauf hängt nicht zuletzt vom Begriff der Institutionalisierung ab, der gerade innerhalb der vergleichenden Parlamentarismusforschung schillernd geblieben ist (vgl. Judge 2003). Bei Philip Norton (1998a: 196) gilt als wichtigster Indikator eines hohen Institutionalisierungsgrades von Parlamenten das Ausmaß der Spezialisierung des Ausschusssystems. Im Rahmen eines engeren, auf ausgewählte europäische Länder konzentrierten Vergleichs erscheint der Bundestag dabei als ein außerordentlich stark institutionalisiertes Parlament (Norton 1998b). Entsprechende Befunde mögen auf den ersten Blick wie Wind in den Segeln von Kritikern des Bundestages wirken, dem seit langem eine Vernachlässigung öffentlichkeitswirksamer Plenumsarbeit vorgeworfen wird – freilich nicht selten auf der Grundlage realitätsfremder (oder zumindest »parlamentarismusfremder«) Erwartungen und Bewertungsmaßstäbe (Schuett-Wetschky 2005). Es ist jedoch offensichtlich, dass ein – im Sinne Nortons – geringer Institutionalisierungsgrad eines Parlaments keineswegs automatisch dessen Leistung und Bedeutung als »Redeparlament« zugute kommt. Das lehrt das Beispiel der französischen Nationalversammlung, welche traditionell über schwache Ausschüsse und eine schwache Position 160 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE im öffentlichen politischen Bewusstsein des Landes verfügt. Aber nicht nicht nur der deutsch-französische Vergleich führt aus Sicht der Bundesrepublik zu akzeptablen Ergebnissen. In der Summe seiner Leistungen gehört der Bundestag ohne Zweifel zu jenen Komponenten des deutschen Demokratiemodells, die dessen Erfolg über Jahrzehnte hinweg zu begründen geholfen haben (Lösche 2000). 7 Die Exekutive: Institutionen und Akteure am Gipfel des staatlichen Herrschaftssystems Gemessen an der amorphen Struktur manch anderer Komponenten und Akteure der liberalen Demokratie scheint die Exekutive auf den ersten Blick in hohem Maße der verbreitet an sie herangetragenen Vorstellung einer hochgradig zentralisiert-integrierten Systemstruktur zu entsprechen. Die strukturelle Überlegenheit der Exekutive gegenüber der Legislative, welche die parlamentarische Demokratie kennzeichnet, wird gerne mit deren größerer interner Geschlossenheit erklärt, während die Wahrnehmung der Exekutive im Präsidentialismus amerikanischer Prägung ohnehin mehr oder minder vollständig auf den Präsidenten als dem einzigen der Verfassung bekannten Repräsentanten der Exekutive konzentriert ist. Die Personalisierung der Medienberichterstattung über Politik tut ein Übriges, um den Eindruck einer hochgradig konzentrierten Exekutivstruktur zu verstärken. Eine solche Sicht entspricht nur bedingt der Realität. Der charakteristische Machtvorsprung der Exekutive im parlamentarischen System hat überwiegend andere institutionelle Ursachen. Und gerade die um Differenzerung bemühte politikwissenschaftliche Exekutivforschung bietet zahlreiche Belege dafür, dass selbst von außen betrachtet strikt hierarchisch organisierte Exekutiven im Innern durch ein dynamisches und multipolares Machtgefüge gekennzeichnet sein können. Bei all diesen Deutungen und Gegendeutungen geht es aber ohnehin lediglich um die politische Exekutive. Zu ihren Mitgliedern werden (in parlamentarischen Demokratien) nach einem engen Verständnis die Kabinettsminister einschließlich des Regierungschefs, nach einem weiteren funktionalen Verständnis außerdem parlamentarische Staatssekretäre bzw. sogenannte »Juniorminister« ohne Sitz im Kabinett gezählt.128 —————— 128 Ihnen entspricht in der Bundesrepublik das 1967 geschaffene Amt des parlamentarischen Staatssekretärs. Vgl. hierzu grundlegend Hefty (2005). In einigen Ländern, 162 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Die vielleicht wichtigste Differenzierung der Politikwissenschaft im Rahmen der Analyse von Exekutivstrukturen bezieht sich jedoch auf die Unterscheidung zwischen politischer Exekutive (Regierung) und administrativer Exekutive (Verwaltung). Den funktionsorientierten Kategorien der klassischen Gewaltenteilungslehre, nach der es sich bei der Exekutive (in Abgrenzung gegenüber der Legislative und Judikative) um die »ausführende Gewalt« handelt, entspricht die administrative Exekutive in sehr viel höherem Maße als die politische Exekutive. Schon für die Ministerialverwaltung gilt indes, dass sie zusätzlich zu ihren rein vollziehenden Tätigkeiten beträchtlichen Anteil an der Formulierung politischer Maßnahmen und Programme hat.129 Diese Funktion charakterisiert umso mehr die politische Exekutive, deren eigentliche Aufgabe in der Führung bzw. Steuerung des politischen Entscheidungsprozesses besteht. Dabei kommt vor allem in parlamentarischen Demokratien der Umsetzung von parteipolitisch definierten Programmzielen durch Parteivertreter in Exekutivpositionen – als politisch-institutionellem Kern des »party government« – eine zentrale Bedeutung zu (Katz 1987; Blondel/Cotta 1996, 2000). Kaum eine heute übliche Vorstellung der politischen Exekutive reicht jedoch so weit, dass sie ohne speziellere Differenzierung auch das Staatsoberhaupt mit einbezöge – ungeachtet der Tatsache, dass die Systemlehre mit Blick auf die Ämtertrennung zwischen Regierungschef und Staatsoberhaupt in der parlamentarischen Demokratie von der Existenz einer »doppelköpfigen Exekutive« spricht.130 In Abgrenzung zur politischen Exekutive lassen sich Staatsoberhäupter in parlamentarischen Demokratien – —————— wie Frankreich, gehören parlamentarische Staatssekretäre auch formal zu den Mitgliedern der politischen Exekutive. 129 Außer Frage steht vor allem die mächtige Position der Regierungsbürokratie in den frühen Stadien des Gesetzgebungsverfahrens, ganz besonders bei der Formulierung des sogenannten »Referentenentwurfs«. Vgl. Mayntz/Scharpf (1975). 130 Das gilt noch am ehesten für Systeme aus der Kategorie der sogenannten »semipräsidentiellen Demokratie« (Duverger 1980; Elgie 2004), welche – gemäß einer Minimaldefinition – durch die Kombination einer parlamentarisch verantwortlichen Regierung mit einem direkt gewählten Präsidenten gekennzeichnet sind. In Systemen dieses Typs, der für viele Autoren lediglich einen Untertyp der parlamentarischen Demokratie darstellt (von Beyme 1999a: 52; Siaroff 2003), gilt das präsidiale Staatsoberhaupt oftmals gar als der eigentliche Kopf der politischen Exekutive, so im Falle des Präsidenten der V. Republik Frankreich zu Zeiten einheitlicher parteipolitischer Mehrheitsverhältnisse. Dabei handelt es sich jedoch um einen Ausnahmefall, der insbesondere mit Blick auf die Bundesrepublik keine besondere Aufmerksamkeit beanspruchen kann. DIE EXEKUTIVE 163 ganz gleich, ob es sich um Erbmonarchen oder gewählte republikanische Staatsoberhäupter handelt – in Anlehnung an einen Vorschlag Harold Laskis (1925: 340–356) als konstitutionelle Exekutive bezeichnen. Zentrale Gegenstände dieses Kapitels sind die politische und die konstitutionelle Exekutive. Aspekte der administrativen Exekutive werden lediglich am Rande behandelt. Der nächste Abschnitt ist der Regierung im engeren Sinne, also der politischen Exekutive, gewidmet. Darauf folgt ein kurzer Exkurs über die administrative Exekutive, unter Konzentration auf deren Verhältnis mit der politischen Exekutive. In einem weiteren Teil werden schließlich die Strukturcharakteristika und Handlungsparameter der Staatsoberhäupter in den heute konsolidierten liberalen Demokratien beleuchtet. 7.1 Die politische Exekutive: Regierungschef und Kabinett Die historischen Vorläufer heutiger Kabinette in den parlamentarischen Demokratien sind älter als das Amt des Premierministers. Schon die Bezeichnung »erster Minister« deutet darauf hin, dass es vor dessen Auftauchen eine Gruppe unterschiedlicher Persönlichkeiten gab, die zum Beraterkreis des Monarchen gehörten. Die historische Herausbildung der Strukturen der politischen Exekutive war hochgradig komplex und verlief, selbst innerhalb eines Landes, selten geradlinig und frei von Rückschlägen – dies in deutlichem Gegensatz zu der auf einen Schlag vollzogenen Schöpfung des Präsidentenamtes in den Vereinigten Staaten durch die Verfassung von 1787.131 Der historische Entstehungsprozess der Position eines Premierministers in Europa gilt in Teilen der jüngeren Geschichtswissenschaft als be- —————— 131 Freilich hat auch die politische Exekutive im präsidentiellen System der USA im Laufe der Geschichte tief greifende Veränderungen erfahren, darunter insbesondere die Schaffung einer »institutional presidency« (Burke 2000) seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, ein umfangreiches Arsenal institutionalisierter Ressourcen zur politischen und administrativen Unterstützung des Präsidenten. Die verfassungsrechtliche Struktur des Präsidentenamtes ist in ihren Grundzügen, trotz zahlreicher wichtiger Urteile des Supreme Court, jedoch bis heute erhalten geblieben. Durch grundlegende Kontinuität ist auch die Geschichte des in der Verfassung nicht erwähnten, aber gleichwohl seit 1787 kontinuierlich existierenden Kabinetts gekennzeichnet (Helms 1999c). 164 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sonders erhellendes Beispiel dafür, wie eine informelle Beziehung zur Grundlage einer formalen Institution werden kann. Wolfgang Reinhard unterscheidet in seiner großen Geschichte der Staatsgewalt zwischen »Günstlingspremierministern des langen 17. Jahrhunderts« und »Premierministern der neuen Generation«, des (späten) 18. Jahrhunderts: »[W]enn ›Minister‹ im 17. Jahrhundert häufiger mit politischer Bedeutung auftaucht, dann ist fast nie ein Amt oder eine Institution gemeint, sondern eine ad hoc entstandene Funktion, ein Auftrag, der allein vom jederzeit widerrufbaren Willensentschluß eines Herrschers abhing« (Reinhard 2000: 166). Als der prominenteste Vertreter dieser Gattung gilt Richelieu. Auch für die Premierminister der neuen Generation – unter ihnen Walpole und Newcastle in England, Kaunitz in Österreich und Münchhausen in Hannover – waren nicht so sehr die Ämter, die sie bekleideten, als das Vertrauen des Monarchen, das sie genossen, ausschlaggebend. »Aber das Vertrauensverhältnis zum Herrscher hatte jetzt stärker sachlich-funktionalen als personal-emotionalen Charakter« (ebd.: 166, 180). Bis zur Herausbildung der Institution eines ressortfreien Premierministers war es von dort freilich noch ein weiter Weg. Das gilt selbst für die singuläre Entwicklung Englands, wo die Etablierung eines Kabinetts im engeren Sinne mit dem Auftreten eines politisch potenten Premierministers in Gestalt Sir Robert Walpoles gegen Ende des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts zeitlich in etwa zusammenfiel. Erst nach 1868, während der Regierungszeit Benjamin Disraelis, tauchte der Titel »Prime Minister« erstmals in einem amtlichen Dokument auf, und erst Henry CampbellBannerman (1905–1908) führte den offiziellen Titel. In Ländern, in denen es früh zu einer Parlamentarisierung der staatlichen Ordnung kam, ging es häufig zunächst darum, die Führung des Kabinetts durch eines seiner Mitglieder durchzusetzen. Bis zur ausdrücklichen rechtlichen Anerkennung des Premierministers als Regierungschef war es nicht ungewöhnlich, die Führung der Kabinettsgeschäfte auf die Schultern von zwei Ministern zu verteilen. Ein entsprechender Modus kennzeichnete selbst die ersten Jahre der langen Amtszeit Walpoles in England; er musste sich bis 1729 die Macht mit Lord Townshend teilen. In anderen Ländern, wie Italien, blieben entsprechende Praktiken bis zum Ende des 19. Jahrhunderts üblich. Im deutschen Kaiserreich, dem exemplarischen Fall einer nicht-parlamentarisierten konstitutionellen Monarchie, gab es demgegenüber im strengen Sinne nur einen politisch verantwortlichen Minister, den Reichskanzler, aber kein echtes Kabinett. Gerade die Erfahrung der älteren DIE EXEKUTIVE 165 parlamentarischen Demokratien lehrt, dass die verfassungsrechtliche Anerkennung des Amtes des Premierministers im Zweifelsfall nicht von annähernd vergleichbarer Bedeutung für die politische Durchsetzungsfähigkeit eines Amtsinhabers ist wie die politischen Rahmenbedingungen seiner Amtszeit. Tatsächlich folgten die Ereignisse, wie in Belgien, nicht selten dem Bestreben, mit der Konstitutionalisierung eine »Flucht nach vorn« anzutreten: »Juristisch gesicherte Kompetenzen sollten eine verlorene politische Machtstellung ersetzen« (von Beyme 1999a: 448). Zu den wichtigsten politischen Determinanten der Stärke eines Regierungschefs zählen neben dem Rückhalt in seiner eigenen Partei die Anzahl und Stärke der an der Regierung beteiligten Parteien und das Ausmaß der parlamentarischen Unterstützung der Regierung. Die beiden zuletzt genannten Aspekte sind zu grundlegenden Kategorien der politikwissenschaftlichen Exekutivforschung geworden. Die zentrale Unterscheidung auf der ersten Achse bezieht sich auf den Gegensatz zwischen Einparteienund Koalitionsregierungen. Für letztere gilt, bei zahlreichen weiteren Differenzierungsmöglichkeiten, dass mindestens zwei Parteien an der Regierung beteiligt sind. Die Alternativoptionen auf der zweiten Achse werden durch Mehrheits- und Minderheitsregierungen repräsentiert, wobei es um die jeweilige parlamentarische Unterstützungsbasis einer Regierung in der ersten Kammer des Parlaments geht. Schon dieses vergleichsweise simple Koordinatensystem lässt die Unterscheidung von mindestens vier Grundtypen zu: (1) Einparteienregierungen mit parlamentarischem Mehrheitsstatus, (2) Koalitionsregierungen mit parlamentarischem Mehrheitsstatus, (3) Einparteienregierungen mit parlamentarischem Minderheitsstatus sowie (4) Koalitionsregierungen mit parlamentarischem Minderheitsstatus. Ein vergleichender Blick auf die parlamentarischen Demokratien Westeuropas lässt deutliche regionale Hochburgen der unterschiedlichen Regierungsformen erkennen: Die eigentliche Heimat von Einparteienregierungen mit parlamentarischer Mehrheitsbasis ist das Vereinigte Königreich. Diesem Muster folgen auch die außereuropäischen Westminster-Demokratien und (jedenfalls der Tendenz nach) Japan, wo zwischen 1955 und 1993 ausschließlich die LDP regierte. Koalitionsregierungen mit parlamentarischem Mehrheitsstatus bilden den »Normalfall« in den meisten Ländern des westeuropäischen Festlands. Minderheitsregierungen – sei es in Form von Einparteienregierungen oder, seltener, Koalitionsregierungen – charakterisieren vor allem die Geschichte der parlamentarischen Demo- 166 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE kratien des »metropolitanen Skandinaviens« (Dänemark, Norwegen und Schweden). Deutschland repräsentiert den in Westeuropa dominanten Typus der Koalitionsregierung mit Mehrheitsstatus. Die übergroße Mehrzahl aller seit 1949 amtierenden Bundeskabinette wurde von mindestens zwei Parteien getragen, die gemeinsam über eine parlamentarische Mehrheit im Bundestag verfügten. Sowohl Einparteienregierungen (worunter man in der Bundesrepublik, vereinfachend, auch Regierungen unter ausschließlicher Beteiligung von CDU und CSU fassen kann) als auch Minderheitsregierungen bildeten Ausnahmen. Kommt es zu diesen Ausnahmesituationen, dann treten Einparteienregierungen und parlamentarischer Minderheitsstatus der Regierung hierzulande zumeist gemeinsam auf. Nach dem in der Bundesrepublik vorherrschenden Parlamentarismusverständnis handelt es sich dabei – im Gegensatz vor allem zur skandinavischen Lesart – um einen untrüglichen Krisenindikator. Tatsächlich resultierten Einparteien-Minderheitsregierungen auf Bundesebene ausschließlich aus dem vorausgehenden Zusammenbruch der bisherigen Regierungskoalition, so im November/Dezember 1962 (CDU/CSU-Regierung unter Konrad Adenauer), im Oktober/November 1966 (CDU/CSU-Regierung unter Ludwig Erhard) und im September 1982 (SPD-Regierung unter Helmut Schmidt). Die Kürze ihres Bestandes – und nicht zuletzt ihre faktische Handlungsunfähigkeit – unterstreichen ihren Ausnahmecharakter noch zusätzlich. Ebenfalls als ungewöhnlich gelten muss die Existenz einer großen Koalition, ein Regierungsbündnis der beiden größten Parteien des Systems (CDU/CSU und SPD). Die erste große Koalition unter Kanzler Kiesinger (1966–1969) kam als Ergebnis des vorzeitigen Auseinanderbrechens der letzten Regierung Erhard gegen Ende des ersten Drittels einer laufenden Legislaturperiode zustande. Aus Sicht der Union bildete sie die einzige Möglichkeit, weiterhin an der Regierung zu bleiben, aus Sicht der Sozialdemokraten zwar nicht die einzig mögliche, wohl aber die mittelfristig aussichtsreichste Option einer Regierungsbeteiligung. Im Gegensatz zur ersten großen Koalition, die bei aller Konkurrenz zwischen Union und SPD doch ein Willensbündnis beider Seiten war, verkörperte die nach der Bundestagswahl von 2005 gebildete große Koalition unter Angela Merkel weitaus stärker eine »von den Umständen«, konkret dem Wahlergebnis vom September 2005, diktierte Notlösung (Helms 2006a). Große Koalitionen stellten jedoch nicht nur hierzulande eine Ausnahmeerscheinung dar. In der Gruppe der parlamentarischen Demokratien DIE EXEKUTIVE 167 Westeuropas erlangten sie die vergleichsweise größte Bedeutung in Österreich. Dort regierten zwischen 1945 und Mitte 2006 für rund 34 Jahre lang Koalitionen aus SPÖ und ÖVP (von 1945–1947 unter Einschluss der KPÖ). Nach der Nationalratswahl vom Oktober 2006 kam es vor dem Hintergrund einer weiteren Ausdifferenzierung des Parteiensystems erneut zur Bildung einer großen Koalition. Die international vergleichende Koalitionsforschung hat Kategorien zur Klassifikation von Regierungen bzw. von Kabinetten vorgeschlagen, die deutlich differenzierter sind als die alltagssprachliche Unterscheidung zwischen kleinen und großen Koalitionen. Unterschieden werden innerhalb der Gruppe von Regierungen mit parlamentarischem Mehrheitsstatus in der Regel: »minimum-winning coalitions«, »minimal-winning coalitions« und »surplus majority coalitions« (Laver/Schofield 1990; Müller 2004).132 Blickt man auf den gesamten Zeitraum seit 1949, so fällt auf, dass es sich bei deutschen Bundesregierungen keineswegs immer um »minimumwinning coalitions« handelte. Tatsächlich waren nur die erste Regierung Brandt (1969–1972), die Regierungen Schmidt der Jahre 1976 bis 1982 und die letzte Regierung Kohl (1994–1998) kleinstmögliche Gewinnerkoalitionen. In allen anderen Fällen wäre rechnerisch, aber eben nicht politisch, die Bildung kleinerer Koalitionen möglich gewesen. Auffallend ist ferner die phasenweise Existenz von Koalitionen, denen mehr Parteien angehören, als gebraucht würden, um der Regierung einen parlamentarischen Mehrheitsstatus zu garantieren (»surplus majority coalitions«). Solche übergroßen Koalitionsmehrheiten gab es vor allem in der Ära Adenauer, zwischen 1953 und 1960. Für die Entscheidung Adenauers bzw. der Union, einige auf den ersten Blick »entbehrliche« kleinere Parteien in die Regierungsverantwortung einzubinden, sprachen unterschiedliche Gründe. Zum einen ging es darum, der Regierung eine größtmögliche parlamentarische Mehrheitsbasis zu sichern, die selbst auf der Ebene verfassungsändernder Maßnahmen möglichst souverän zu handeln in der Lage sein würde. Bei der Einbindung der DP, trotz des Gewinns einer absoluten Mehrheit der —————— 132 Bei einer »minimal-winning coalition« handelt es sich um eine Mehrheitskoalition, die durch das Ausscheiden eines ihrer Mitglieder ihre Mehrheit einbüßen würde. Unter einer »minimum-winning coalition« wird eine (nach Sitzanteilen) – relativ zur absoluten Mehrheit – kleinstmögliche Gewinnerkoalition verstanden. Eine »surplus majority coalition« schließlich ist eine Koalition mit einer »übergroßen« parlamentarischen Mehrheit; sie umfasst mehr Mitglieder als nötig wären, um diese Mehrheit zu garantieren. 168 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE CDU/CSU bei der Bundestagswahl 1957, spielte das Bestreben der Union eine Rolle, ihr auch in Gebieten mit einem geringen Anteil katholischer Wähler eine ausreichende Anhängerschaft zu sichern (Saalfeld 2000: 44– 45). Das einzige spätere Beispiel einer »surplus majority coalition« auf Bundesebene ist den spezifischen Umwälzungen im unmittelbaren zeitlichen Umfeld der deutschen Vereinigung zu verdanken. So gehörten dem christlich-liberalen Regierungsbündnis unter Helmut Kohl zwischen Oktober 1990 und Januar 1991 nicht nur die CDU/CSU und die FDP, sondern auch die ostdeutsche Schwesterpartei der Union, die DSU, an. Beispiele für übergroße Koalitionen finden sich in den meisten westeuropäischen Ländern. Deutlich geringer als in der Bundesrepublik ist deren Anteil im historischen Vergleich nur in den skandinavischen Ländern (außer Finnland), in Irland, Luxemburg und Spanien. In Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich und Italien machten »surplus majority coalitions« zwischen 1945 und dem Ende des 20. Jahrhunderts mehr als ein Drittel aller Regierungen aus (Mitchell 2001; Mattila/Raunio 2004: 271). Die Hochburg überdimensionierter Koalitionen bildet jedoch eindeutig und mit großem Abstand vor allen anderen konsolidierten liberalen Demokratien innerhalb und außerhalb Europas die Schweiz. Dort sind die drei bürgerlich-konservativen Parteien (FDP, CVP, SVP) und die Sozialdemokraten (SPS) bereits seit 1959 ununterbrochen an der Regierung beteiligt. Die in der Schweiz als Revolution mittleren Ausmaßes wahrgenommenen Ereignisse im Gefolge der Nationalratswahl von 2003 – die geringfügige Veränderung des Stärkeverhältnisses der vier an der Regierung beteiligten Parteien als Ergebnis signifikanter Zugewinne der SVP (Dardanelli 2005) – stellen aus vergleichender Perspektive betrachtet lediglich eine bescheidene Modifikation des schweizerischen Modells dar. Das »institutionelle Geheimnis« hinter der jahrzehntelangen Vorherrschaft einer faktischen Allparteienregierung ist in dem weit überdurchschnittlich ausgebauten System der direkten Demokratie und ganz besonders dem fakultativen Gesetzesreferendum schweizerischer Prägung zu sehen (Neidhart 1970; Papadopoulos 2001). Dieses gestattet es, jede beliebige Gesetzesentscheidung des Parlaments einem Referendum zu unterwerfen und damit potentiell zu »kippen«. Historisch lässt sich die Geschichte der Regierungsbildungen in der Schweiz als ein Prozess beschreiben, in dem sukzessive all jene Parteien aus der Opposition in die Regierung »kooptiert« wurden, die das Potential besaßen, die Politik der Regierungsparteien durch Erzwin- DIE EXEKUTIVE 169 gung eines Referendums zu durchkreuzen.133 Seinen Ausgang nahm das Proporzmodell von einem ausschließlich von den Liberalen dominierten Regierungsgremium. Dieses wurde 1891 zunächst durch die Einbeziehung des katholischen Zweiges der damaligen konservativen Opposition (CVP) erweitert; seit 1929 zählt auch die SVP zu den ständigen Bundesratsparteien. Die schweizerischen Sozialdemokraten (SPS) schließlich schafften erstmals 1943 (zunächst lediglich vorübergehend) den Sprung in eine von den Konservativen dominierte Regierung. Werfen wir, bevor wir zur Betrachtung des Innenlebens der politischen Exekutive kommen, zunächst einen Blick auf die wichtigsten Aspekte der Regierungsbildung. Anders als in einer Reihe westeuropäischer Systeme (etwa Belgien, den Niederlanden oder Schweden) gibt es in der Bundesrepublik kein formales »Auskundschaftungsverfahren«, das dem Prozess der eigentlichen Regierungsbildung vorgeschaltet wäre. Der Einsatz von »Informateuren«, denen andernorts die Aufgabe zukommt, die möglichen Alternativen der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierung auszuloten, besitzt hierzulande keine Tradition. Ein entsprechendes Verfahren hat sich angesichts der vergleichsweise überschaubaren Anzahl relevanter Kräfte des Parteiensystems als entbehrlich erwiesen. Seit 1961 ist es – mit Unterbrechungen während der Regierungszeit der sozial-liberalen Koalition – üblich, dass ein schließlich erzielter Konsens über Programm- und Personalfragen in Form eines schriftlichen Koalitionsvertrages fixiert wird. Als Funktion von Koalitionsverträgen wurde, zusätzlich zu der Dokumentation der in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten politischen Positionen und der Schaffung einer »Arbeitsgrundlage« für die Regierungsarbeit, vor allem deren Bedeutung für die innerparteiliche Vermittlung von Verhandlungsergebnissen durch die Parteieliten genannt (Saalfeld 2000: 65). Der Umfang entsprechender Vereinbarungen hat im Zeitverlauf deutlich zugenommen (ebd.: 56). Der durchschnittliche Zeitaufwand für Regierungsbildungen in der Bundesrepublik ist im internationalen Vergleich betrachtet verhältnismäßig gering und liegt im Allgemeinen bei wenigen Wochen. Außergewöhnlich lang war der Regierungsbildungsprozess im Gefolge des schwierigen Ergebnisses der Bundestagswahl vom September 2006; zwischen dem Wahl- —————— 133 Die Abhaltung eines fakultativen Gesetzesreferendums setzt die Unterstützung durch 50,000 (bis 1977: 30,000) Unterschriften oder durch acht Kantone voraus; ein zur Abstimmung stehendes Gesetz tritt nur in Kraft, wenn eine (einfache) Mehrheit der Abstimmenden dies billigt. 170 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE tag und der Ernennung Angela Merkels zur Bundeskanzlerin lagen mehr als 60 Tage. In den meisten Ländern, in denen die Regierungsbildung im Durchschnitt deutlich schneller vor sich geht als in der Bundesrepublik (innerhalb Westeuropas vor allem in Dänemark, Schweden und Norwegen), gibt es einen ungleich höheren Anteil von Einparteienregierungen, die hinsichtlich ihrer Entstehungsbedingungen kaum sinnvoll mit Koalitionsregierungen verglichen werden können. In der Mehrzahl von Ländern, in denen – wie in der Bundesrepublik selbst – unterschiedliche Spielarten von Koalitionsregierungen die typische Regierungsform darstellen, zieht sich der Kabinettsbildungsprozess deutlich länger hin als hierzulande. Dies gilt vor allem für Länder wie die Niederlande, Belgien oder Finnland, in denen die Anzahl beteiligter Regierungsparteien signifikant höher ist als in der Bundesrepublik; Verhandlungen über mehr als drei Monate hinweg stellen dort keine Seltenheit dar (Müller/Strøm 2000b: 561, 570). Den eigentlichen Sonderfall Westeuropas bezüglich der Regierungsbildungsdauer bildet jedoch die V. Republik Frankreich. Dort dauert die Regierungsbildung – trotz der vorherrschenden Existenz von Koalitionsregierungen – im Durchschnitt nicht einmal drei Tage. Sowohl über die parteipolitische Zusammensetzung der Regierung als auch über den künftigen Premierminister wird faktisch direkt durch die Wahl zur französischen Nationalversammlung entschieden; innerhalb der einzelnen Lager werden selbst die konkreten Inhalte des Regierungsprogramms vor der Wahl zur Nationalversammlung verbindlich geregelt (Thiébault 2000: 506–514). Die in der Bundesrepublik (mit Unterbrechungen) seit den frühen sechziger Jahren üblichen schriftlichen Koalitionsabkommen gehören in einigen anderen Ländern noch stärker als hierzulande zu den zentralen Kennzeichen des jeweiligen Regierungsmodells. In Finnland, Luxemburg, Norwegen, Portugal und Schweden arbeiteten sämtliche Koalitionsregierungen seit Beginn der Nachkriegszeit auf der Grundlage von schriftlichen Verträgen. Die Ausnahme in der Familie der westeuropäischen »Koalitionsdemokratien« bildet in dieser Hinsicht eher Italien, wo es nach 1945 kaum schriftliche Koalitionsverträge zwischen den an der Regierung beteiligten Parteien gab (Müller/Strøm 2000b: 574). Eine deutsche Besonderheit verkörpern im internationalen Vergleich weniger die Gepflogenheiten der Koalitionsbildung als vielmehr die verfassungsrechtlich fixierten Modalitäten der Bestellung des Regierungschefs. Die vom Grundgesetz vorgeschriebene geheime Wahl eines Kandidaten für das Amt des Kanzlers durch eine absolute Mehrheit der Mitglieder des DIE EXEKUTIVE 171 Bundestages ist ungewöhnlich.134 Zwar kennen eine Reihe anderer westeuropäischer Demokratien sowie Japan ebenfalls eine Investiturabstimmung über den Regierungschef bzw. die von ihm gebildete Regierung. In der Regel erfolgt diese jedoch weder geheim noch zwingend mit absoluter Mehrheit und überdies häufig eher nach erfolgter Ernennung anstatt im Vorfeld bzw. als deren Voraussetzung. In zahlreichen anderen Ländern (von Großbritannien über die Niederlande und Österreich bis nach Dänemark oder Norwegen) gilt eine Regierung für so lange im Besitz des Vertrauens der parlamentarischen Mehrheit, bis durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum das Gegenteil bewiesen ist (Helms 1996: 699–700). Regierungsbildungen und -umbildungen in der Bundesrepublik sind ansonsten durch eine sehr weitreichende formale Organisationsgewalt des Kanzlers gekennzeichnet. Aus historisch-vergleichender Perspektive wurde die Neubemessung der verfassungsrechtlichen Ressourcen bei der Regierungsbildung gegenüber Weimar gar als der wichtigste Schritt zur Stärkung der Position des Regierungschefs unter dem Grundgesetz bewertet (Niclauß 1999: 31). Als großzügig erscheinen die verfassungsrechtlichen Ressourcen des Kanzlers aber auch im internationalen Vergleich. Während hierzulande gelegentlich die faktische Machtlosigkeit des Kanzlers bei der Auswahl des Regierungspersonals aus den Reihen des Koalitionspartners oder beim Zuschnitt einzelner Ressorts beklagt wurde, verfügen einige der Regierungschefs anderer Länder nicht einmal über das Recht zur Festlegung der Ressortzuständigkeiten oder zur Entlassung einzelner Minister (Helms 1996: 703–704). Wo es um die Bestimmung des Handlungsspielraums des Regierungschefs bei der Regierungsbildung geht, genügt es freilich nicht, dessen formale Kompetenzen zu studieren. Auch die Existenz bzw. Nichtexistenz von Koalitionsverträgen ist kein zuverlässiger Indikator der Macht des Regierungschefs. Nicht überall dort, wo es eine entsprechende Praxis nicht gibt, sind dessen Handlungsspielräume automatisch größer. Dies verdeutlicht auf besonders beeindruckende Weise der Fall Japan: Obwohl es dort —————— 134 Dem Verfassungsgesetzgeber ging es offenbar darum, in Abgrenzung gegenüber dem Weimarer Modell die direkte parlamentarische Legitimation des Kanzlers zu stärken und zugleich den repräsentativdemokratischen Charakter der Selektion des Regierungschefs zu unterstreichen. In der Verfassungspraxis wird über den künftigen Kanzler nichtsdestotrotz üblicherweise durch den Ausgang der Bundestagswahl entschieden – ein Phänomen, das als plebiszitäre Komponente der Kanzlerdemokratie klassifiziert wurde (Niclauß 1987). 172 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE bis in die frühen neunziger Jahre hinein eine einzigartige Phase hegemonialer Einparteienregierung – und mithin keinerlei Informalisierung durch Koalitionspolitik – gab, bestimmte keineswegs der Premierminister über die Ministerauswahl. Die Entscheidungsgewalt über Kandidaten für Ministerämter lag vielmehr in den Händen der mächtigen innerparteilichen Gruppierungen (Faktionen) der langjährigen Regierungspartei LDP, die sich dabei an im Voraus vereinbarten Nominierungsquoten orientierten (Hirose 1994: 59).135 Am nächsten an die japanischen Standards reichten in Westeuropa historisch die ebenfalls stark »faktionalisierten« christdemokratischen Parteien Belgiens und Italiens heran; über Erfahrungen faktionenbasierter innerparteilicher Machtfragmentierung verfügt von den älteren Demokratien außerhalb Europas vor allem Australien (Andeweg 1997: 81). Die Personalkompetenz und die auf die Ressortstruktur der Regierung bezogene Organisationsgewalt des Bundeskanzlers verkörpern wesentliche Komponenten des sogenannten Kanzlerprinzips, welches gemäß Art. 65 GG neben dem Ressortprinzip und dem Kabinettsprinzip eines der drei verfassungsrechtlichen Organisationsprinzipien der Bundesregierung bildet. Viele Beobachter assoziieren mit dem Kanzlerprinzip jedoch primär die Zuweisung der Richtlinienkompetenz an den Kanzler – sie gilt gleichsam als die Krönung verfassungsrechtlich definierter Kanzlermacht.136 Vergessen scheinen heute die Motive für die Einführung der Richtlinienkompetenz nach dem Ersten Weltkrieg. Im Rahmen der Weimarer Reichsverfassung zielte die verfassungsrechtliche Zuweisung der bis in den Wortlaut hinein identisch gefassten Richtlinienkompetenz an den Kanz- —————— 135 Genau genommen beschränkte das ungewöhnliche Ausmaß innerparteilicher Faktionalisierung der LDP nicht nur den personalpolitischen Handlungsspielraum des japanischen Premiers, sondern machte zugleich dessen Position selbst zum Spielball innerparteilicher Machtpolitik. Tatsächlich ist das Amt des japanischen Regierungschefs ist durch ein im internationalen Vergleich exorbitantes Maß an personeller Diskontinuität gekennzeichnet (Masuyama/Nyblade 2004: 254–256); zwischen 1947 und Ende 2006 gab es nicht weniger als 26 unterschiedliche Amtsinhaber. 136 Vor allem in der Rechtswissenschaft hat sich eine weitverzweigte Diskussion über die Natur der Richtlinienkompetenz entsponnen, welche hier nicht im Detail nachzuzeichnen ist. Vgl. für entsprechende Nachweise Schuett-Wetschky (2003, 2004). DIE EXEKUTIVE 173 ler137 weniger auf dessen politische Ermächtigung als vielmehr auf eine Eingrenzung von dessen Handlungsspielraum zugunsten des (ebenfalls neu geschaffenen) Ressortprinzips (Gusy 1997: 135–136). Wie für ihre Weimarer Vorläuferin gilt auch für die Bestimmung des Grundgesetzes, dass diese »zwar eine Verfassungsnorm«, aber »ein politisches, kein rechtliches Schwert« (Oberreuter 1990b: 226) ist. In der jüngeren Literatur räumen mittlerweile selbst Verfassungsrechtler ein, dass der Richtlinienkompetenz letztlich nur eine »Reservefunktion« zukomme, die dem Kanzler in politisch schwierigen Situationen gegebenenfalls eine zusätzliche verfassungsrechtliche Autorität verleihen könne (Maurer 1993: 126–127). Maßgeblich für die politische Durchsetzungsfähigkeit eines Regierungschefs innerhalb der Regierung sind freilich andere Faktoren. Zu ihnen zählt neben allgemeiner politischer Begabung, politischem Sachverstand und hinlänglicher Ausdauer bei der Verfolgung politischer Ziele nicht zuletzt das Ausmaß an Unterstützung durch die eigene Partei (Helms 2005c). Die in der Literatur zum deutschen Regierungssystem häufig gestellte Frage nach der Bedeutung der Personalunion zwischen Bundeskanzler und Parteivorsitzendem138, spielt in den meisten anderen Ländern keine Rolle, weil eine entsprechende Ämterkonzentration die Regel ist. Nicht selbstverständlich ist hingegen die britische Zuspitzung, nach der das Amt des Regierungschefs nach herrschender Verfassungskonvention zwingend an das des Parteivorsitzenden geknüpft ist und ein Verlust des Parteivorsitzes unweigerlich den Rücktritt vom Amt des Regierungschefs nach sich zieht.139 Spezifisch modifiziert, nicht aber prinzipiell aufgehoben ist die zentrale Bedeutung des Parteienfaktors im Falle von parteilosen Regierungschefs (etwa den italienischen Premiers Ciampi und Dini während der neunziger Jahre) oder von Regierungschefs aus kleineren Koalitionsparteien. In diesen Konstellationen entscheidet vor allem der Rückhalt in der —————— 137 Gegenüber Art. 65, Satz 1 GG spezifizierte Art. 56 WRV lediglich dahingehend, dass der Reichskanzler für die von ihm zu bestimmenden Richtlinien der Politik die Verantwortung »gegenüber dem Reichstag« trage, womit das Prinzip der parlamentarischen Verantwortlichkeit besonders herausgestellt wurde. 138 Ein historischer Vergleich der Beziehungen zwischen unterschiedlichen Kanzlern und ihren Parteien zeigt, dass der Parteivorsitz für sich allein betrachtet kaum als bedeutende Machtressource des Kanzlers betrachtet werden kann (Helms 2002b, 2005a: 145–148). 139 Das mit Abstand bekannteste Beispiel dieser Form des Machtverlusts bildet zweifellos der Sturz der britischen Premierministerin Margaret Thatcher durch die konservative Unterhausfraktion im November 1990. 174 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Koalition regierender Parteien über die politische Handlungsfähigkeit des Regierungschefs. Ebenfalls nicht zu unterschätzen sind die einem Regierungschef zu Gebote stehenden administrativen Ressourcen innerhalb der Regierungszentrale, im deutschen Fall des Kanzleramts. Das (im Grundgesetz nicht erwähnte) Bundeskanzleramt besitzt historische Wurzeln, die bis in die Frühphase des Bismarck-Reichs zurückreichen. Zu einer im engeren Sinne politischen Regierungszentrale mit einem parteipolitisch ausgewiesenen Spitzenpersonal wurde die Reichskanzlei als Vorläuferin des Bundeskanzleramts erstmals in der Weimarer Republik. Sie verlor in den Jahren der Nazi-Herrschaft den Großteil ihres potentiellen Einflusses freilich bald an die weitaus mächtigere Parteikanzlei (Schöne 1968). Während der ersten zwanzig Jahre der Bundesrepublik blieb das Kanzleramt ein im Hinblick auf seine personellen und administrativen Ressourcen bescheidenes Haus, aus dem zuweilen gleichwohl, so vor allem unter Adenauers drittem Kanzleramtschef Hans Globke (1953–1963), ein außerordentlich hohes Maß an Führung und Koordination des Regierungsprozesses hervorging. Die eigentliche »Geburtsstunde« des modernen Kanzleramtes schlug zu Beginn der sozial-liberalen Ära (Müller-Rommel 1994: 119). Innerhalb nur eines Jahres verdreifachte sich dessen Personal. Die eigentliche Modernisierungsleistung betraf jedoch die Organisationsstruktur des Kanzleramts, das bis 1958 nur eine einzige Abteilung beherbergte. Unter Kanzler Brandt und dessen ersten Kanzleramtschef Ehmke (1969–1972) wurden erstmals fünf unterschiedliche Abteilungen geschaffen, darunter ein eigener Bereich für die politische Planung. Bei wechselndem Stellenwert des Kanzleramts im Regierungsprozess – als Hochphasen von dessen Einfluss gelten historisch die Regierungsjahre Adenauers und Schmidts sowie die erste Amtszeit Brandts (Müller-Rommel 2000) – betrug dessen Mitarbeiterzahl zu Beginn der Kanzlerschaft Angela Merkels 450 Personen, die in sechs unterschiedlichen Hauptabteilungen tätig waren (Roll 2006).140 Das Bundeskanzleramt fällt im westeuropäischen Vergleich, auch mit anderen großen Ländern, als eine in personeller Hinsicht besonders großzügig ausgestattete Institution auf; Entsprechendes gilt für einen Vergleich der Bundesrepublik mit Japan (besonders vor den dortigen Reformen 1999/2001) und den außereuropäischen parlamentarischen Demokratien des Westminster-Typs. Hinzu kommen der überdurchschnittlich weit be- —————— 140 Vgl. zum Gesamtkomplex mit einem zeitlichen Fokus auf das Bonner Kanzleramt der Jahre 1949 bis 1999 die umfangreiche Studie von Knoll (2004). DIE EXEKUTIVE 175 messene Aufgabenbereich des Kanzleramts und dessen starker Einfluss innerhalb der Exekutive (Müller-Rommel 1993: 133, 135).141 Angesichts der ansehnlichen verfassungsrechtlichen und administrativen Ausstattung des Amtes kann es nicht überraschen, dass deutsche Kanzler in einer vergleichenden (dabei allerdings ausschließlich subjektiven Bewertungen vertrauenden) Untersuchung zu jenen Regierungschefs Westeuropas gerechnet wurden, die über einen auffallend großen Einfluss innerhalb der Regierung verfügen (King 1994: 153). Bemerkenswert ist dies insoweit, als die Bundesrepublik im Gegensatz zu den übrigen fünf genannten Ländern – Großbritannien, Irland, Portugal, Spanien und Griechenland – das einzige System mit praktisch permanenter Koalitionsregierung darstellt.142 Zu jenen Ländern mit einem in struktureller Hinsicht starken Premierminister können ferner Australien und ganz besonders Kanada gezählt werden. Nach Einschätzung einiger Autoren war die Macht kanadischer Premiers dabei bis in die jüngere Vergangenheit hinein sogar (noch) weitreichender als jene britischer Premierminister (Thunert 2000: 102; Malloy 2004: 207). Auch für Systeme mit einer potentiell starken Stellung des Regierungschefs gilt freilich, dass es andere Akteure innerhalb der Exekutive gibt, die über ansehnliche – verfassungsrechtliche und/oder politische – Ressourcen, verfügen. Als wichtigste Einschränkung der autonomen Handlungsmacht von Regierungschefs gilt in den meisten parlamentarischen Demokratien, und so auch in der Bundesrepublik, die Gegenmacht einzelner Minister. Viele Systeme kennen die Zuweisung spezieller Rechts- und Ve- —————— 141 Von »amerikanischen Standards« – sowohl bezüglich der Personalausstattung als auch im Hinblick auf die Personalhoheit des Regierungschefs – bleiben jedoch selbst die Regierungszentralen der größeren westeuropäischen Länder weit entfernt (Patterson 2000). Diesem Sachverhalt entsprechend gibt es in Westeuropa kein echtes Äquivalent für die amerikanische Diskussion über das White House Office des Präsidenten, dessen Personalstärke und funktionale Ausdifferenzierung in jüngeren Arbeiten immer häufiger als Schwächungsmoment, und weniger als Kernressource, präsidentieller Macht erscheinen (Neustadt 2001). 142 Die Existenz von Koalitionsregierungen gilt – unter sonst gleichen Bedingungen – zu Recht als zentrale Variable, durch die der Handlungsspielraum des Regierungschefs tendenziell begrenzt wird (Weller 1997: 44). Wie immer, gibt es jedoch markante Ausnahmen, die vor allem dadurch erklärlich werden, dass die Bedingungen der Koalitionsregierung in unterschiedlichen Ländern deutlich verschieden voneinander sind. So wurde die Rolle des Premierministers in vielen skandinavischen Koalitionsregierungen gerade durch die Komplexität von Koalitionen und die besondere Schwierigkeit, alternative Koalitionen zu bilden, faktisch gestärkt (Arter 2004: 123–125). 176 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE topositionen an einzelne Minister, insbesondere an den Justizminister. In der Praxis erweisen sich andere – persönliche, politische und insbesondere parteipolitische – Faktoren für das Gewicht und Durchsetzungsvermögen eines Ministers indes oftmals als relevanter. Einzelne Minister, gegen die auch ein starker Regierungschef nicht dauerhaft Politik machen kann, finden sich in praktisch jeder Regierung (gelegentlich auch auf formal wenig bedeutenden Positionen). Erwähnenswert sind eher die seltenen Ausnahmen von dieser Regel. Für die Bundesrepublik ließe sich diesbezüglich noch am ehesten auf das erste Jahrzehnt der Kanzlerschaft Konrad Adenauers verweisen.143 Die größte »Narrenfreiheit« genießen in der Regel Minister aus den Reihen des kleineren Koalitionspartners der Partei des Regierungschefs, gegen die nur indirekt vorgegangen werden kann. Aber selbst die Kombination aus formaler Kompetenzstärke und günstigen politischen Rahmenbedingungen führt selten zu einer annähernd vollständigen Neutralisierung von individueller Ministermacht. Sogar für Großbritannien wurde überzeugend argumentiert, dass die ultimative Entscheidungsmacht britischer Regierungen im Allgemeinen in den Händen einer jeweils kleinen Gruppe besonders einflussstarker Minister (unter Einschluss des Premierministers) ruhe (Norton 2000). Im Vergleich zum Ressortprinzip hat das Kabinettsprinzip zwar einen hohen normativen, aber kaum einen vergleichbar zentralen empirischen Stellenwert für die Funktionsweise der politischen Exekutive in der parlamentarischen Demokratie behaupten können (Weller 2003). Anders als Teile der einschlägigen Literatur suggerieren, stellt die in den meisten Ländern zu beobachtende Abkehr vom »textbook cabinet government« indes keineswegs eine Erscheinung der jüngeren Vergangenheit dar. Schon zu Beginn der fünfziger Jahre konstatierte Carl Joachim Friedrich (1953: 421) eine Tendenz der parlamentarischen Systeme, sich allmählich von der kollegialen zur monokratischen Herrschaft zu entwickeln. Die Transformation des klassischen Kabinettsmodells vollzog sich freilich auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Auswirkungen hinsichtlich der Machtverteilung zwischen den entscheidungsrelevanten Akteuren. In einigen Ländern – allen übrigen voran Großbritannien – wurde die ehemals zen- —————— 143 Ausländische Beobachter erkannten damals mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Bundesministern und den Reichsstaatssekretären des Bismarck-Reichs bzw. den amerikanischen »cabinet secretaries« als zwischen den zuerst genannten und den Kabinettsministern anderer parlamentarischer Demokratien der Nachkriegszeit (Ridley 1966: 456). DIE EXEKUTIVE 177 trale Stellung des »full cabinet« vor allem durch die konsequente Verlagerung des Entscheidungsprozesses in Kabinettsausschüsse geschwächt. Daraus resultierte zugleich ein faktischer Machtzuwachs des Premierministers, da dieser den Vorsitz in sämtlichen Ausschüssen führt und auf dieser Grundlage seinen Informationsvorsprung vor sämtlichen übrigen Regierungsmitgliedern signifikant erweitert. In anderen Ländern – zu ihnen gehört die Bundesrepublik – erlangten vor allem informelle Koalitionsgremien wichtige Vorentscheidungsfunktionen auf Kosten des Kabinetts. Überdurchschnittlich bekannt wurde das informale Entscheidungsgremium der ersten großen Koalition, der sogenannte »Kressbronner Kreis«, benannt nach dem Sommersitz Kanzler Kiesingers in der Nähe des Bodensees, wo das erste Treffen dieser Runde im Frühsommer 1967 stattfand (Knorr 1975: 223–229; Schneider 1999: 95–96). Seinen eigentlichen Höhepunkt erreichte das Regieren mit »Koalitionsrunden« jedoch während der Ära Kohl (Schreckenberger 1994). Ab Mitte der achtziger Jahre begannen die Medien damit, den Entscheidungen dieses Gremiums eine deutlich größere Aufmerksamkeit beizumessen als den nachfolgenden, zumeist lediglich formal bestätigenden Beschlüssen des Kabinetts. Auch bei den »Koalitionsrunden« der Regierung Kohl handelte es sich um regelmäßige Zusammenkünfte der Partei- und Fraktionsspitzen der Koalitionspartner. Auffallend im Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen unter anderen Kanzlern war die schwache Repräsentation von Ressortministern. Bereits in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre bildete die Anwesenheit von Ministern in der Koalitionsrunde eher eine Ausnahme als die Regel. Während der 13. Legislaturperiode des Bundestages war Außenminister Klaus Kinkel als einziger führender Bundesminister dauerhaft in der Koalitionsrunde vertreten (Ismayr 2001: 380). Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem »System Kohl« und den informellen Entscheidungssystemen unter anderen Kanzlern bestand darin, dass Kohl von der Existenz dieser Gremien machtpolitisch nachhaltig profitierte. In anderen Fällen, so insbesondere im Rahmen der Kanzlerschaft Schmidts, symbolisierte die Etablierung entsprechender Einrichtungen eher einen schleichenden »Machtverfall« des Kanzlers. Für sämtliche der nach 1949 zu beobachtenden Konstellationen gilt, dass die Verwirklichung des Kanzlerprinzips im Rahmen von informellen Koalitionsgremien nur auf der Grundlage hinreichend großer parteipolitischer Ressourcen des Kanzlers funktionierte. 178 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Einen echten Sonderfall im Hinblick auf das Einflusspotential von Premierminister, Ministern und Kabinett im exekutiven Entscheidungsprozess verkörperte lange Zeit Japan: Das dort unter der hegemonialen Herrschaft der LDP installierte System ließ keinen der genannten Akteure echte politische Handlungsmacht gewinnen. Eine denkbare Charakterisierung dieses Systems als »cabinet government« wurde in der Literatur ebenso vehement zurückgewiesen wie die alternativen Klassifikationen als »prime ministerial government« oder »departmental government«. Charakteristisch war vielmehr eine duale Machtstruktur, die sich aus der Bürokratie einerseits und der Regierungspartei andererseits konstituierte und im Vergleich zu der die gesamte politische Exekutive von untergeordneter Bedeutung war bzw. ist (Mulgan 2003: 84). Erst in der jüngsten Vergangenheit kam es – teils als Folge einer verbesserten Ausstattung des Premiers mit administrativen Ressourcen, teils als Ergebnis eines veränderten Führungsstils – zu Entwicklungen, die einige Beobachter gar von einer Hinwendung zu einem »Westminster style« politischer Führung in Japan sprechen ließen (Köllner 2006). 7.2 Exkurs: Die administrative Exekutive Wenn in den vorausgehenden Abschnitten vom Einfluss einzelner Mitglieder der politischen Exekutive die Rede war, so war damit deren Rolle innerhalb des im engeren Sinne politischen Exekutivterrains gemeint. Die Frage nach dem Einfluss von Mitgliedern der politischen Exekutive lässt sich jedoch auch auf deren Steuerungspotential gegenüber der Ministerialverwaltung beziehen. Eine solche Perspektive eröffnet einen guten Zugriff auf zentrale Charakteristika unterschiedlicher Strukturtypen der administrativen Exekutive.144 —————— 144 Nicht berücksichtigt werden im Rahmen dieses kurzen Exkurses die sehr unterschiedlichen Evolutionsgeschichten und Traditionen der Verwaltung in den konsolidierten liberalen Demokratien, die sich bis heute nicht zuletzt auf der Ebene »administrativer Interessenvermittlung« manifestieren (Lehmbruch 1987). Die historisch und international vergleichende Verwaltungsforschung orientiert sich an den üblicherweise unterschiedenen vier Rechtstraditionen: einer anglo-amerikanischen, einer kontinentaleuropäisch-französischen, einer kontinentaleuropäischdeutschen und einer skandinavischen Tradition. Japan kann wegen des direkten und nachhaltigen Einflusses preußischer Berater beim Aufbau der modernen japa- DIE EXEKUTIVE 179 Ein wichtiges Strukturmerkmal bildet das Größenverhältnis zwischen der Leitungsgruppe innerhalb der Ministerialverwaltung, dem sogenannten »Senior Executive Service«, und dem Kabinett. Dabei gilt: Je geringer das zahlenmäßige Gefälle zwischen Mitgliedern des Kabinetts und der leitenden Ministerialverwaltung, umso höher die politische Steuerbarkeit der Ministerien durch die Minister. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es in einigen der konsolidierten liberalen Demokratien spezifische Erweiterungen des Kabinetts durch Positionen wie »junior ministers« gibt. Ihnen entspricht in der Bundesrepublik das Amt des Parlamentarischen Staatssekretärs. Signifikante Erweiterungen des Kabinetts durch nachgeordnetes politisches Personal sind jedoch nur für die parlamentarischen Demokratien angelsächsischer Prägung typisch. Deutschland gehört mit Norwegen, den Niederlanden und Griechenland zu jenen Ländern mit einer gewissen, aber insgesamt eher schwachen Kabinettserweiterung durch Regierungspersonal im weiteren Sinne. In zahlreichen anderen Ländern, von Schweden über Österreich bis Spanien, existieren keine vergleichbaren Strukturen. Unter Berücksichtigung der gegebenenfalls bestehenden spezifischen Erweiterungen des Kabinetts ergibt sich, dass das auf dieser Grundlage bestimmte Steuerungspotential der politischen Exekutive am größten ist in Ländern wie Neuseeland, Schweden, Norwegen und Irland, erheblich geringer dagegen insbesondere in Österreich und der Schweiz. Die Bundesrepublik kommt in deutlich größerer Nähe zu ihren deutschsprachigen Nachbarländern als zu den Ländern der ersten Gruppe zu liegen (Schnapp 2001: 20–21). Die USA, die ein extrem hohes Gefälle im zahlenmäßigen Verhältnis von »Topbürokraten« und Mitgliedern der politischen Exekutive aufweisen, können angesichts der exorbitant hohen Durchsetzung der Verwaltung mit politischen Stelleninhabern nur bedingt mit den parlamentarischen Demokratien verglichen werden. Damit ist zugleich ein weiterer, außerordentlich wichtiger Aspekt angesprochen: In der Tat interessieren aus Sicht der politischen Exekutive nicht zuletzt die jeweils bestehenden Spielräume für die Rekrutierung (partei-) politisch gleich gesinnten Personals. Hinsichtlich der formalen Strukturen der Verwaltungselite in den liberalen Demokratien bilden die Vereinigten Staaten und Großbritannien die Extrempole eines gedachten Kontinuums (Derlien 1996). Während im amerikanischen »spoils system« im Gefolge von personellen Wechseln im Präsidentenamt traditionell eine riesige Zahl —————— nischen Verwaltungsstrukturen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in systematischer Hinsicht als Vertreter der kontinentaleuropäisch-deutschen Tradition gelten. 180 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE von Positionsinhabern ausgetauscht wird, bleiben personelle Veränderungen im Verwaltungssektor nach Machtwechseln in Großbritannien minimal. Konstitutiver Bestandteil des britischen Modells ist jedoch zugleich die Idee, dass der »Civil Service« parteipolitisch vollständig neutral ist und politische Impulse ausschließlich von der jeweils auf Zeit bestellten Regierungselite bezieht. Die Bundesrepublik nimmt in dieser Hinsicht eine Mittelposition zwischen dem britischen und dem amerikanischen Modell ein. Gemessen an amerikanischen Standards ist der Anteil der politischen Verwaltungselite in den Bundesministerien ausgesprochen gering; immerhin aber existiert ein gesetzlich geregeltes Verfahren, welches es der Regierung gestattet, die Spitzenpositionen in der Ministerialverwaltung mit Personen ihres Vertrauens zu besetzen. Aus politischen Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können potentiell sämtliche »politischen Beamten« (Karrierebeamten in der Ministerialverwaltung bis hinunter zur Besoldungsstufe A 16).145 Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, allen voran Frankreich, gibt es in der Bundesrepublik dafür keine Tradition von »cabinets ministériels« (einer größeren Gruppe von persönlich und politisch vertrauten offiziellen Mitarbeitern des Ministers), denen unter anderem eine wichtige Brückenfunktion im Verhältnis zwischen politischer Führungsebene und Ministerialverwaltung zukommt. Als hochgradig ungewöhnlich können, nicht nur aus deutscher Perspektive, die Beziehungen zwischen politischer und administrativer Exekutive in Japan gelten: Mangels eigener politischer und administrativer Ressourcen fungierten Minister dort in einem für amerikanische wie westeuropäische Verhältnisse gleichermaßen unvorstellbarem Ausmaß als »Ausführungsgehilfen« ihrer Ministerialbürokratie, welche ihre Positionen in langwierigen Verhandlungen mit der LDP-Parteibürokratie formulierte. Die Bildung von Koalitionsregierungen ab Mitte der neunziger Jahre änderte an diesem Muster wenig; vielmehr wurde die etablierte Praxis der LDP von den kleineren Parteien erfolgreich imitiert (Mulgan 2003: 80, 86). Die im Zuge der vor wenigen Jahren durchgeführten Verwaltungsreform, in deren —————— 145 Dies eine Möglichkeit, von der nach allen Regierungswechseln, bei denen es zu einer signifikanten Veränderung der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierung kam, ein mehr oder minder großzügiger Gebrauch gemacht wurde (Derlien 2001). Die besonders hohe Austauschrate im Gefolge des Regierungswechsels von 1998 erklärt sich zumindest teilweise aus dem Umstand, dass es bei dieser Gelegenheit erstmals zu einer vollständigen Auswechslung der Regierungsparteien kam. DIE EXEKUTIVE 181 Rahmen unter anderem die Position »parlamentarischer Vizeminister« in den Ministerien geschaffen wurde (Köllner 2006: 291), haben die institutionellen Bedingungen des Zusammenspiels zwischen politischer und administrativer Exekutive ein kleines Stück weit zugunsten der erstgenannten verändert, ohne bislang einen entscheidenden Wandel zu bewirken. Für alle Länder gilt, dass es informale Formen der Politisierung der Verwaltungselite gibt, die sich auf spezifische Weise mit den formalen institutionellen Strukturen verbinden. In einer vergleichenden Studie, die sowohl die formalen als auch die informalen Strukturparameter im Verhältnis von politischer und administrativer Exekutive berücksichtigt, wurden die »minister/mandarin relations« in den USA als »separate, very politicized« charakterisiert, diejenigen in Großbritannien als »separate, not politicized« und jene in Deutschland als »separate and fairly politicized« (Pollitt/Bouckaert 2000: 42). Die Ergebnisse jüngerer Studien weisen darauf hin, dass die informale Politisierung und besonders die informale Parteipolitisierung in den vergangenen Jahren auf breiter internationaler Front zugenommen hat (Peters/Pierre 2004a) – wobei eines der (nur scheinbar paradoxen) Antriebsmomente der gestiegenen Parteipolitisierung der Verwaltung gerade im schleichenden Terrainverlust der Parteien auf der gesellschaftlichen Ebene gesehen wird: »If there is a declining identification of the public with political parties then it may make sense for the parties to provide some tangible benefits for membership in the form of jobs; if parties cannot attract members with policy, they can at least offer jobs« (Peters/Pierre 2004b: 287). Das Steuerungspotential der politischen Exekutive gegenüber der administrativen Exekutive bestimmt sich jedoch nicht ausschließlich nach dem zahlenmäßigen Stärkeverhältnis beider Seiten und dem formalen und informalen Politisierungsgrad der Ministerialverwaltung. Es kommt ein weiterer Faktor hinzu, der sich in gewisser Weise sogar am unmittelbarsten aus der parteipolitischen Durchdringung der politischen Exekutive im Sinne des »party government« ergibt: die Dauer der Amtszeit von Ministern, ganz besonders die Verweildauer innerhalb eines bestimmten Ressorts. Je länger diese, so größer ist – unter sonst gleichen Bedingungen – die Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich »party government« (anstelle von »administrative government«) einstellt (Rose 1968). Im internationalen Vergleich sind die Amtszeiten deutscher Bundesminister lang; vor allem der Anteil an Ministern mit langjährigen Karrieren innerhalb eines bestimmten Ressorts ist in der Bundesrepublik überdurchschnittlich hoch 182 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE (Bakema 1991: 75, 90). Da deutsche Bundesminister zudem in der Regel schon zum Zeitpunkt ihrer Ernennung ein beträchtliches Maß an Expertise in dem betreffenden Politikfeld vorzuweisen haben – eine Eigenschaft, die im internationalen Vergleich keineswegs selbstverständlich ist, ja nicht einmal überall als normatives Ziel Geltung beansprucht (Laver/Shepsle 1994) – lässt sich insgesamt von einer stark ausgeprägten Professionalisierung der politischen Exekutivelite in der Bundesrepublik sprechen, der ein vergleichsweise hohes Steuerungspotential gegenüber der administrativen Exekutive entspricht. Ein auf weitere Strukturmerkmale der Verwaltung ausgedehnter Vergleich lässt innerhalb Westeuropas Frankreich und Großbritannien als die großen Alternativmodelle erkennbar werden (Heywood/Wright 1997: 79– 86). In mancher Hinsicht, so etwa bezüglich der Abhängigkeit der Zentralregierung von sub-zentralstaatlichen Ausführungsbehörden, ist Deutschland Großbritannien ähnlicher als Frankreich, Italien oder Spanien. Mit Blick auf speziellere Strukturmerkmale der Ministerialverwaltung teilt die Bundesrepublik hingegen mehr mit den kontinentaleuropäischen Ländern als mit Großbritannien, so etwa hinsichtlich des verwirklichten Hierarchiegrades in den Ministerien. Kaum eines der übrigen westeuropäischen Länder weist einen vergleichbar hohen Hierarchisierungsgrad innerhalb von Ministerien auf wie das britische Modell (ebd.: 84–85). Mitverantwortlich für die hohe Autorität und ausgeprägte Fähigkeit britischer »permanent secretaries« in den Ministerien, wirkungsvolle interne Konfliktschlichtung »von oben« zu betreiben, ist dabei nicht zuletzt ihre langjährige Diensterfahrung unter Ministern unterschiedlicher parteipolitischer Couleur. Ungeachtet der ausgeprägten Strukturunterschiede zwischen den administrativen Exekutiven der liberalen Demokratien gibt es, wie jüngere Studien zeigen, jedoch auch gemeinsame Entwicklungstrends. Dazu gehört vor allem die insgesamt gestiegene Kontrolle der politischen Exekutive gegenüber der Verwaltungselite (Page/Wright 1999). Ein entsprechender Trend ist mittlerweile selbst in Großbritannien (Wilson/Barker 2003) und in Japan (Mulgan 2003: 89) unverkennbar. DIE EXEKUTIVE 183 7.3 Die konstitutionelle Exekutive: Monarchen und Präsidenten Wie zahlreiche andere institutionelle Elemente der liberalen Demokratie in Westeuropa entstand auch das Konzept eines institutionell ausdifferenzierten Staatsoberhaupts in Großbritannien. Dort bildete sich im frühen 18. Jahrhundert die Unterscheidung zwischen parlamentarischer Regierung und Staatsoberhaupt heraus. Die späteren Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent knüpften – auf der Grundlage teils fragwürdiger Interpretationen der englischen Verfassungswirklichkeit und von dem Bestreben geleitet, die konkrete Ausgestaltung des Amtes des Staatsoberhauptes den landesspezifischen Bedürfnissen anzupassen – an das englische Vorbild an. Aus der Gruppe der konsolidierten liberalen Demokratien ist die Schweiz das einzige Land, das auf ein institutionell ausdifferenziertes Staatsoberhaupt verzichtet. Nach der Schweizer Bundesverfassung, und so auch in der Verfassungspraxis, ist der für die Dauer eines Jahres bestellte Bundespräsident lediglich Sprecher des vollständig kollegial ausgestalteten Bundesrates und ausdrücklich weder Regierungschef noch Staatsoberhaupt (Altermatt 1992). Die grundsätzliche Frage, ob neben einer demokratisch legitimierten Regierung zusätzlich ein Staatsoberhaupt erforderlich sei, wurde nur in wenigen europäischen Ländern ernsthaft gestellt. Auch in der jüngeren deutschen Geschichte wurde der Verzicht auf ein Staatsoberhaupt stets nur von politisch unbedeutenden Minderheiten angeregt bzw. gefordert – während der Beratungen der Weimarer Nationalversammlung von Vertretern der USPD, nach 1945 von der in der Schweiz gegründeten »Arbeitsgemeinschaft ›Das demokratische Deutschland‹« (Morsey 1999: 47). Das Amt eines funktionell von der Regierung unterschiedenen Präsidenten wurde in Europa zuerst 1875 im Rahmen der III. Republik Frankreich verwirklicht.146 Das französische Modell einer parlamentarischen —————— 146 Der für Europa charakteristische Entwicklungspfad steht in auffallendem Gegensatz zu den historischen Entwicklungen in Amerika. Dort wurde das ältere englische Modell der Tudor-Monarchie, in dem es noch keine institutionell ausdifferenzierte Unterscheidung zwischen Regierung und Staatsoberhaupt gab, zum maßgeblichen Referenzkonzept. Dies zeigte sich zunächst an den verfassungspolitischen Entwicklungen in den Kolonien, später auch bei der Ausgestaltung des Präsidentenamtes in der Verfassung von 1787. Damit behielten die Amerikaner einer- 184 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Republik wurde in der Folgezeit zu einer fruchtbaren Quelle »konstitutionellen Plagiats« (Lane 1996: 68) für all jene Länder, die sich gegen die englische Variante einer parlamentarischen Monarchie entschieden. Dem französischen Modell lag die Vorstellung des Monarchen als »pouvoir neutre« zugrunde, welche – vermeintlich – dem britischen Modell entlehnt war. Die Kernkompetenz einer monarchischen »pouvoir neutre«, wie auch eines republikanischen Staatsoberhaupts dieser Prägung, wurde von der französischen Staatslehre jener Zeit im Recht der Parlamentsauflösung gesehen – eine Prärogative, über die das britische Staatsoberhaupt bereits ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts faktisch nicht mehr verfügte. Die III. Republik Frankreich verkörpert bis heute das klassische Beispiel einer Verfassungskonstruktion mit vollständig unkonditioniertem Auflösungsrecht des Staatsoberhaupts. Hinter ihr blieb selbst die Weimarer Variante zurück. In keiner der gegenwärtigen westeuropäischen Demokratien – mit Ausnahme der V. Republik Frankreich – existiert ein vergleichbar weitreichendes Auflösungsrecht des Staatsoberhaupts wie in der französischen Verfassung von 1875.147 In Finnland als dem einzigen anderen westeuropäischen System, in dem es lange Zeit eine orleanistische Konstruktion des Staatsoberhaupts gab, die in der Verfassungspraxis zeitweilig zu einem Regime des »aufgeklärten Despotismus« (Arter 1981) gedieh, wurde die Macht des Präsidenten durch eine Verfassungsreform im Jahre 2000 deutlich reduziert (Nousiainen 2001). In dieselbe Richtung wie die finnische Reform zielten entsprechende Verfassungsänderungen in Portugal und Griechenland in den achtziger Jahren, durch die die zunächst starke Stellung des Staatsoberhaupts deutlich geschwächt wurde. Im Vergleich mit einigen anderen Ländern kann schon die in der Bundesrepublik verwirklichte alleinige Auflösungsbefugnis des Bundespräsidenten nach gescheiterter Kanzlerwahl (Art. 63, 4 GG) als bemerkenswert gelten (Kaltefleiter 1991) – eine Option, die in der Verfassungspraxis freilich bislang nicht virulent geworden ist.148 —————— seits das traditionelle Konzept der geschlossenen Exekutive bei, demokratisierten es jedoch zugleich und generierten dadurch das bis dahin unbekannte Modell der singulären republikanischen Exekutive (Lehmbruch 1999a). 147 Vgl. zum Gesamtkomplex der Parlamentsauflösung auf aktueller und breiter international vergleichender Basis Patzelt (2006). 148 Die ohnehin stärker eingeschränkte Entscheidungsgewalt des Bundespräsidenten bei der Bundestagsauflösung gemäß Art. 68, 1 GG – von der nach negativ beantworteter Vertrauensfrage des Bundestages nur »auf Vorschlag des Bundeskanzlers« Gebrauch gemacht werden kann – hat sich durch die jüngere Verfassungspraxis DIE EXEKUTIVE 185 Im Hinblick auf die Rolle des Staatsoberhaupts im politischen System – oder präziser: im politischen Entscheidungsprozess – kommt dem Strukturunterschied zwischen parlamentarischer Monarchie und parlamentarischer Republik eine zentrale Orientierungsfunktion zu. Für einen kompetenzstarken Monarchen ist in der konsolidierten parlamentarischen Demokratie kaum Platz. Ausnahmen – insbesondere Luxemburg und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges Belgien – bestätigen die Regel (Lehmbruch 1999a: 122). Situativ und zeitlich begrenzt gelangten monarchische Staatsoberhäupter auch in anderen Ländern zu bemerkenswertem Einfluss auf die Geschicke des betreffenden Landes, so exemplarisch im Falle König Juan Carlos’ während der spanischen »transición« (Bernecker 1998). Unter sonst gleichen Bedingungen gilt jedoch, dass es, von der erwähnten Ausnahme Luxemburgs abgesehen, kein monarchisches Staatsoberhaupt gibt, das kompetenzstärker wäre als eines der in Westeuropa ansässigen republikanischen Staatsoberhäupter. Erst recht keine »Konkurrenz« droht den republikanischen Staatsoberhäuptern Westeuropas vom politisch vollständig neutralisierten japanischen Kaiser. Ebenfalls schwach blieb die Rolle des kanadischen Generalgouverneurs als dem ernannten Stellvertreter der englischen Königin. Eine echte Ausnahme unter den Ländern mit nichtgewähltem Staatsoberhaupt bildet Australien. Der australische Generalgouverneur, der (wie sein kanadisches Pendant) ebenfalls als Stellvertreter der britischen Krone fungiert, verfügt über so weitreichende verfassungsrechtliche Kompetenzen und politische Handlungsspielräume, dass einige Beobachter den Sinn der offiziellen Klassifikation Australiens als parlamentarische Monarchie in Frage gezogen und stattdessen von einem »governor-generalate« gesprochen haben (Nelson 2000: 132). In krassem Gegensatz zu der Situation im britischen Mutterland kann der australische Generalgouverneur noch immer einen Premierminister entlassen, selbst wenn dieser über eine Mehrheit in der ersten Kammer des Parlaments verfügt (ebd.: 121). Für die Entscheidung des Verfassungsgesetzgebers, ein kompetenzstarkes republikanisches Staatsoberhaupt zu schaffen wird aus vergleichender —————— weiter reduziert. Nach den Vorkommnissen aus dem Sommer 2005, als es nach einer »unechten Vertrauensfrage« Kanzler Schröders am 1. Juli 2005 schließlich zur Auflösung des Bundestages durch Bundespräsident Köhler am 21. Juli 2005 und ein bestätigendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. August 2005 kam, hat sich der faktische Spielraum des Bundespräsidenten in vergleichbaren künftigen Situationen verringert (Schenke 2006: 47–48; Schneider 2006a: 135–136). 186 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Perspektive eine zentrale Variable erkennbar: die Struktur des Parteiensystems bzw. die Wahrnehmung desselben als potentielle Gefahr für die Regierbarkeit des Landes (Lehmbruch 1999a: 123). Verstärkend hinzutreten kann der historisch bedingte Wunsch, einer befürchteten Desintegration des Landes durch eine starke personalisierte Autorität ein institutionelles Hemmnis entgegenzusetzen. Im Kreise der westeuropäischen Demokratien verkörpert Frankreich das »Paradebeispiel« für das effektive Zusammenwirken dieser beiden Faktoren. Ähnliche institutionelle Antworten wie bei der Begründung der V. Republik wurden im Rahmen der Verfassungsgebungsprozesse in zahlreichen der hier nicht weiter berücksichtigten jungen Demokratien Osteuropas gegeben (Elgie 1999). Die Struktur des Parteiensystems bildet jedoch eine wichtige Variable nicht nur im Hinblick auf die Ausgestaltung des verfassungsrechtlichen Kompetenzprofils von Staatsoberhäuptern; sie bestimmt auch den Einfluss eines Staatsoberhaupts in der Verfassungspraxis mit. Gutes Anschauungsmaterial liefern die italienischen Erfahrungen des vergangenen Jahrzehnts. Dort kam es zu einer vorübergehenden Aufwertung des Präsidenten, für die maßgeblich Umwälzungen auf der Ebene des Parteiensystems verantwortlich waren (Pasquino 2003). Nicht lediglich vorübergehender Natur war der Wandel der Rolle des Staatsoberhaupts in Finnland. Hier führte das Anwachsen des Koalitionsbildungspotentials der Parteien und die Herausbildung klarer Regierungsmehrheiten (schon vor der Verfassungsreform) zur Verdrängung eines stark auf den Präsidenten zugeschnittenen Modells durch ein majoritär geprägtes System der Parteienregierung (Paloheimo 2003). In allen Ländern kommt darüber hinaus der Persönlichkeit des Amtsinhabers eine wichtige Rolle zu. Ihr Einfluss wird vor allem greifbar, wenn das Handeln unterschiedlicher Amtsinhaber in politischinstitutionell stabilen Kontexten studiert werden kann, wie dies weitgehend für die Bundesrepublik gilt. In kaum einem anderen Bereich wird der Charakter des Grundgesetzes als eines ausdrücklichen Gegenentwurfs zur Weimarer Reichsverfassung so deutlich wie bei der Ausgestaltung des Präsidentenamtes.149 Unabhängig von den veränderbaren personellen Konstellationen machen die verfassungsrechtlichen Parameter präsidentieller Macht nach dem Grundgesetz jede Form präsidentiellen Regierens im engeren Sinne unmöglich. In Ge- —————— 149 Zum tertium comparationis der Weimarer Reichsverfassung und des Grundgesetzes erhoben wird die fundamental unterschiedliche Stellung des Staatsoberhauptes in der grundlegenden Studie von Fromme (1960: 24–163). DIE EXEKUTIVE 187 genüberstellung mit den Kompetenzen anderer gegenwärtiger Staatsoberhäupter der westlichen Länder erscheint das Kompetenzprofil des Bundespräsidenten gleichwohl nicht als vollständig bedeutungslos. In einer vergleichenden Untersuchung von Paul Heywood und Vincent Wright (1997: 80) wird der Bundespräsident als Staatsoberhaupt mit nicht ausschließlich »symbolischen«, sondern wichtigen »prozeduralen« Funktionen klassifiziert. Das Grundgesetz sieht die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung, ein Gremium aus sämtlichen Mitgliedern des Bundestages und einer gleich großen Anzahl von den Landesparlamenten gewählter Vertreter, für die Dauer von fünf Jahren vor. Möglich ist lediglich eine einmalige Wiederwahl. Die aus der ungewöhnlichen Popularität des ersten Bundespräsidenten, Theodor Heuss (FDP), geborene Idee, die zulässige Amtszeit über die maximal mögliche Dauer von zehn Jahren hinaus zu verlängern, wurde bereits Ende der fünfziger Jahre fallen gelassen, nachdem sich die SPD für die Aufstellung eines eigenen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl 1959 entschieden hatte. Auch eine Amtszeit von zehn Jahren wurde nur von drei der acht bis 2004 ausgeschiedenen Präsidenten (Heuss, Lübke und von Weizsäcker) erreicht. Im Gegensatz zum Weimarer Reichspräsidenten besitzt der Bundespräsident bekanntlich keine speziellen Notstandsbefugnisse. Anders als die meisten Staatsoberhäupter der gegenwärtigen Demokratien verfügt er auch nicht über den militärischen Oberbefehl. Bemerkenswert ist dies insbesondere im Rahmen eines Vergleichs der Kompetenzen republikanischer Staatsoberhäupter. Aus der Gruppe der parlamentarischen Republiken Westeuropas verwehrt außer der Bundesrepublik nur Irland dem Präsidenten den militärischen Oberbefehl. Weitere Beschränkungen des Amtes ergeben sich aus der »institutionelle(n) Einmauerung des Bundespräsidenten« (von Beyme 1999b: 24), zu der auch Einrichtungen wie das Bundesverfassungsgericht gehören. In Abkehr vom Weimarer Modell verkörpert nunmehr dieses, nicht mehr der Präsident, die »pouvoir neutre« im deutschen Regierungssystem. Das größte politische Potential erwächst dem Präsidenten aus seinen verfassungsrechtlichen Kompetenzen bei der Regierungsbildung (Nominierung und Ernennung eines vom Bundestag gewählten Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers sowie die Ernennung von Bundesministern), des – freilich mehrfach konditionierten – Rechts zur Parlamentsauflösung 188 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sowie des formalen und (in begrenztem Maße) materiellen Prüfungsrechts in der Bundesgesetzgebung. Mindestens zwei historisch-politische Faktoren sind dafür verantwortlich, dass die bisherigen Bundespräsidenten ihre ohnehin mäßigen Amtsbefugnisse in aller Regel nicht einmal voll ausschöpften. Von Bedeutung war zunächst, dass der erste Amtsinhaber, Theodor Heuss, das neu geschaffene Amt in seinen Möglichkeiten machtpolitisch eher defensiv interpretierte und damit – gleichsam spiegelbildlich zur umgekehrten Ausdeutung des Handlungsspielraums des Kanzlers durch Konrad Adenauer – die grundsätzlichen Parameter des Amtes für alle seine Nachfolger festlegte und überdies eine persönliche Vorbildrolle schuf (Wengst 1999). Zweitens spielte eine Rolle, dass die stabilen und im Allgemeinen durch klare Mehrheitsverhältnisse geprägten politischen Konstellationen der deutschen Nachkriegsgeschichte insgesamt wenig Gelegenheit boten, um die verfassungsrechtlich bestehenden Handlungsoptionen des Präsidenten voll zur Entfaltung zu bringen. Dies gilt besonders für die Nominierung des vom Bundestag zu wählenden Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers (Rudzio 2000: 57–58). Die insgesamt bescheidenen Möglichkeiten des Amtes prägten auch die Präsidentschaft des 2004 gewählten neunten Amtsinhabers, Horst Köhler, der sich in den Augen vieler Beobachter rasch den Status eines »ungewöhnlich politischen« Präsidenten erwarb. Gerade die Episode des doppelten präsidentiellen Vetos gegen zwei Gesetze der großen Koalition (das Gesetz zur Neuregelung der Flugsicherung und das Verbraucherinformationsgesetz) schien zu lehren, dass ein betont offensiver Einsatz institutioneller Kompetenzen kaum (oder möglicherweise gar invers) mit dem politischen Einfluss und Ansehen des Präsidenten korreliert. Eine breitere Zusammenschau der Erfahrungen präsidentieller Amtsführung während der vergangenen Jahrzehnte (vgl. Helms 2005a: 166–168) gestattet die Formulierung einer Reihe allgemeinerer Bewertungen: Vor allem die populäre These einer gleichsam »natürlich konflikthaften« Beziehung zwischen Amtsinhabern unterschiedlicher Parteizugehörigkeit – welche durch den beträchtlichen Ehrgeiz der Parteien, bei der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung ihren Kandidaten durchzusetzen (Helms 1998: 54–59; Oppelland 2001), scheinbar genährt wird – erweist sich bei genauerer Betrachtung als kaum haltbar. Blickt man auf die Präsidentschaften Lübkes und von Weizsäckers, scheint sich eher die gegenteilige These aufzudrängen, nach der sich Präsidenten aus den Reihen DIE EXEKUTIVE 189 der Regierungsparteien um so freier fühlen, die Regierung vorbehaltlos zu kritisieren und zu attackieren, da ihnen nicht der Vorwurf droht, sich damit aus parteipolitischen Motiven heraus zum willfährigen »Handlanger« der parlamentarischen Opposition zu machen. Selbst der weniger eindeutige Fall der Präsidentschaft Horst Köhlers böte Belege zur Stützung dieser These. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Kanzler und Bundespräsident zu Zeiten unterschiedlicher parteipolitischer Kontrolle beider Ämter von »divided government« oder »cohabitation« zu sprechen, erschiene vor allem angesichts des strukturellen Machtungleichgewichts beider Akteure wenig angemessen. Tatsächlich wurden die Bezeichnungen »divided government« und »cohabitation« in der Literatur über die Bundesrepublik eher auf das Verhältnis zwischen Bundestag und Bundesrat bezogen (Kimmel 1998; Sturm 2001). Auch in vielen anderen Ländern, in denen angesichts ansehnlicher präsidentieller Machtbefugnisse von geteilter Macht zwischen Regierung und Staatsoberhaupt gesprochen werden könnte, blieb die tatsächliche Rolle des Präsidenten in der Verfassungspraxis auffallend bescheiden. Einen exemplarischen Fall verköpert Österreich (Müller 2006). Ob aus diesen Beobachtungen gefolgert werden kann, dass das Amt des Staatsoberhaupts zu jenen institutionellen Einrichtungen konsolidierter liberaler Demokratien gehört, denen im Hinblick auf ihre Rolle im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ein »stilles Ende« bevorsteht, erscheint fraglich. Zum einen gilt, dass das Veränderungspotential vor allem des Parteiensystems selbst in konsolidierten Demokratien so beträchtlich bleibt, dass mit einer Revitalisierung der »Reservefunktionen« des Staatsoberhaupts stets zu rechnen ist. Vorbehalte gegenüber einer möglicherweise voreiligen Verabschiedung der Vorstellung eines mehr als lediglich symbolisch handelnden Staatsoberhaupts werden von nüchternen Beobachtern selbst in Großbritannien geltend gemacht (Brazier 1999: 35– 44) – in jenem Land, in dem das Staatsoberhaupt seitens der Verfassungslehre historisch als erstes zu einem »dignified part of the constitution« erklärt wurde. Hinzu kommt ein anderer Aspekt, auf den Roland Czada nachdrücklich hingewiesen hat: Auch wenn es in der Mehrzahl parlamentarischer Demokratien bei einer überwiegend symbolischen Funktion von Staatsoberhäuptern bleiben sollte, mag daraus – im Kontext anderer, internationaler Entwicklungen betrachtet – möglicherweise gar ein faktischer Bedeutungsgewinn der konstitutionellen Exekutive innerhalb von Gemeinwesen er- 190 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE wachsen. Staatsoberhäupter könnten zu »Relikt(en) nationaler Staatlichkeit in einer von Transnationalität und Europäischer Integration geprägten Umwelt« werden und »zumindest eine Empfindung historischer Kontinuität vermitteln« (Czada 1999: 141), die im Dienste identitätsstiftender Funktionen steht. Vor allem für die republikanischen Staatsoberhäupter der parlamentarischen Demokratien könnte überdies gelten, dass sie einen faktischen Bedeutungszuwachs auch angesichts der Kombination von tagespolitischer Abgehobenheit ihres Amtes und der gestiegenen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gegenüber telegenen Auftritten politischer Amtsinhaber in den entwickelten Demokratien erfahren (Jäger 1994: 182– 183). 7.4 Konklusion Die Demokratisierung der Exekutive bildete historisch das eigentliche Herzstück bei der Erschaffung des demokratischen Verfassungsstaates. Deutschland gehört zu jenen Ländern aus der Gruppe der heute konsolidierten liberalen Demokratien, in denen die politische Exekutive als Institution lange außerhalb des demokratischen Kräftefelds verblieb. Auch die historische Entstehung des Amtes des Regierungschefs wies auffallende Unterschiede zu den Entwicklungen in den meisten anderen Ländern auf. Lange bevor sich »echte« Minister und ein kollegiales Entscheidungsgremium herausbilden konnten, etablierte sich der Reichskanzler als eigentlicher politischer Kopf der Exekutive (wenn auch lediglich vorübergehend und ohne hinreichende institutionelle Absicherung gegenüber den Regierungsfunktionen des Kaisers). Erst ab 1918 wurde eine Demokratisierung der Exekutive konsequent angestrebt und institutionell verwirklicht. Der dabei gefundenen Konstruktion eines direkt gewählten Präsidenten als Staatsoberhaupt eines parlamentarischen Systems wuchs sogar beträchtlicher internationaler Einfluss zu (Loewenberg 1997: 2–3). Weit davon entfernt, einen wie auch immer gearteten Vorbildcharakter zu entfalten, blieb die Position des Reichskanzlers im Weimarer System, wenngleich für die »Dauerschwäche« des Kanzlers nur zum Teil verfassungsrechtliche Regeln, stattdessen primär politische Gründe wie insbesondere die brüchige parlamentarische Basis der meisten Regierungen und das ausufernde Netzwerk DIE EXEKUTIVE 191 informaler Regeln der Koalitionsregierung (Haungs 1968: 161–174) verantwortlich waren. Umso mehr Respekt wurde im Ausland der Exekutiv-Konstruktion des Parlamentarischen Rates, vor allem der Institutionalisierung eines handlungsmächtigen Regierungschefs zuteil. Auch für die gegenüber Weimar signifikant erhöhte Durchsetzungsfähigkeit des Kanzlers waren freilich vor allem politische Faktoren wie die signifikant gesteigerte Regierungswilligkeit und -fähigkeit der Parteien ausschlaggebend. Der erste Kanzler und Präsident der Bundesrepublik taten ein Übriges, um die bewusst asymmetrisch konstruierte »doppelköpfige Exekutive« im Sinne des Parlamentarischen Rates zum politischen Leben zu erwecken. Spätere Entwicklungen vermochten die grundlegende Machtkonfiguration in ihrem Bestand nicht zu gefährden. Selbst das Auftreten starker Präsidenten wie Richard von Weizsäcker ging kaum mit einer Schwächung der politischen Position des Kanzlers einher. In der Tat wurde gerade mit Blick auf das Zusammenspiel zwischen Präsident und Kanzler in der Ära Weizsäcker/Kohl die These formuliert, dass der Präsident, indem er öffentlichen Verdruss über die Regierungspolitik gleichsam »absorbiert« habe, indirekt zur Stabilisierung der Position Kohls beigetragen habe (Leicht 1993). Zu den weiteren Kennzeichen der Bundesrepublik gehört das im historischen und internationalen Vergleich hohe Maß an Regierungsstabilität. Das gilt nicht nur für die parteipolitische Zusammensetzung der Regierung, sondern auch für die personelle Struktur der politischen Exekutive. Im Vergleich mit den Regierungschefs und den Ministern anderer konsolidierter liberaler Demokratien erreichten deutsche Bundeskanzler und Bundesminister deutlich überdurchschnittlich lange Amtszeiten. Zu den wichtigsten Systemeffekten der ausgeprägten personellen Kontinuität auf der politischen Leitungsebene von Ministerien zählt ein ansehnliches parteipolitisches Steuerungspotential von Ministern gegenüber der Ministerialbürokratie, welches freilich zusätzlich durch die Existenz politischer Beamter und die starke informale Parteipolitisierung der administrativen Exekutive strukturell begünstigt wird. Davon abgesehen teilt die Bundesrepublik viele der durchschnittlichen Merkmale der anderen konsolidierten parlamentarischen Demokratien, darunter insbesondere die Vorherrschaft von Koalitionsregierungen mit parlamentarischem Mehrheitsstatus. Der Informalisierungsgrad im Rahmen von Koalitionsregierungen, aber auch der Institutionalisierungsgrad des Informalen, ist in der Bundesrepublik überdurchschnittlich ausgeprägt. 192 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Dies mag in der politischen Kultur der Bundesrepublik begründet sein, sagt aber zugleich etwas über die strategisch günstige Positionierung und ansehnliche Macht der kleineren Parteien als den eigentlichen Nutznießern etablierter informaler Entscheidungsstrukturen im Exekutivbereich. Die weitreichende Informalisierung der Regierungsorganisation und des Regierungsprozesses, welche potentiell (wenn auch keineswegs zwingend) zu Lasten der politisch-institutionellen Vormachtstellung des Kanzlers geht, hat die jüngere Forschung nicht daran gehindert, Deutschland als eines jener Länder mit ausgeprägter Neigung zur »Präsidentialisierung« politischer Führung zu charakterisieren (Lütjen/Walter 2000; Poguntke 2005). Die empirische Evidenz zur Untermauerung entsprechender Thesen bleibt freilich bescheiden. Die Mehrzahl einschlägiger Studien, auch über andere parlamentarische Demokratien innerhalb und außerhalb Europas, krankt nicht zuletzt an einer angreifbaren Operationalisierung, bei der Indikatoren der »Präsidentialisierung« zugrunde gelegt werden, die zum Teil schon für das Ursprungsland des Präsidentialismus, die Vereinigten Staaten, als kaum zutreffend erscheinen (Helms 2005b). Die internationale Konvergenz zwischen den konkurrierenden Modellen parlamentarischer und präsidentieller Regierung bleibt begrenzt; ihr Studium kann gleichwohl viel zum Verständnis unterschiedlicher institutioneller Lösungen und ihrer Funktionsbedingungen in unterschiedlichen politischen und politisch-kulturellen Kontexten beitragen. 8 Der Bundesstaat: Die Institutionalisierung des territorialen Pluralismus Anders als die in den bisherigen Kapiteln behandelten Institutionen zählen föderative Institutionen nicht zu den im engeren Sinne konstitutiven Strukturmerkmalen der liberalen Demokratie, ohne die der demokratische Verfassungsstaat im Kern unvollständig bliebe. Bei ihnen handelt es sich lediglich um eine spezifische Manifestation der vertikalen Gewaltenteilung, die grundsätzlich auch andere Formen annehmen kann, sofern nicht ganz auf eine Ergänzung der grundlegenden horizontalen Gewaltenteilungsmechanismen verzichtet wird. In Ländern, in denen es föderative Strukturen gibt, entwickeln diese jedoch regelmäßig einen außerordentlich großen Einfluss – sowohl auf den politischen Prozess und andere politische Institutionen des Systems als auch auf die politisch-materielle Dimension von Politik (Braun 2000; Wachendorfer-Schmidt 2000; Castles/Obinger/ Leibfried 2005). Bundesstaat und Föderalismus werden heute weitgehend als Synonyme verwandt. Der ursprüngliche Bedeutungsgehalt des Wortes »Föderalismus« war breiter und nahm unter anderem Bezug auf Autonomie und Selbstbestimmung kleinerer Einheiten oder besaß, wie bei Kant, starke Anklänge von Internationalismus bzw. Kosmopolitismus. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der amerikanischen Entwicklungen konzentrierte sich der Begriff »Föderalismus« seit Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend auf die innerstaatliche, bundesstaatliche Bedeutung (Maier 1990: 213–214). Es macht gleichwohl bis heute Sinn, begrifflich zwischen Föderalismus einerseits und Bundesstaat bzw. Bundesstaatlichkeit andererseits zu differenzieren (Frenkel 1984: 94). Meint der erste Begriff (»Föderalismus«) eine im Kern pluralistische »Ideologie« (Smith 1987) bzw. ein pluralistisch geprägtes Organisationsprinzip zur Strukturierung des politischen Willensbildungsund Entscheidungsprozesses, so bezeichnet der zweite (»Bundesstaat«) eine institutionelle Ausprägung dieses Prinzips auf verfassungsrechtlicher bzw. staatsorganisatorischer Ebene. Da es unterschiedliche historische Wege der 194 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Institutionalisierung föderaler Ordnungen gibt – darunter auch die stark von außen beeinflusste Föderalisierung eines Gemeinwesens –, müssen die institutionellen Manifestationen des Föderalismus und das auf gesellschaftlicher bzw. politisch-kultureller Ebene angesiedelte Föderalismusverständnis einander nicht vollständig entsprechen. Unabhängig davon besitzt letzteres einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Struktur der Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb eines föderalen Systems; dieser tritt vor allem im Rahmen historischer Evolutionsprozesse der föderativen Ordnung selbst zutage. Dabei wird seit Heinrich Triepel (1907) zwischen »Föderalismus« und »Unitarismus« als den beiden entgegengesetzten Triebkräften unterschieden, die das innere und äußere Erscheinungsbild eines Bundesstaates prägen. Weiterer Differenzierungsbedarf besteht bezüglich der institutionellen Manifestationen von Föderalismus auf der staatsrechtlichen Ebene. Er kann unterschiedliche föderal geprägte Typen der Staatsorganisation hervorbringen, vom Staatenbund, über den konföderalen und unitarischen Bundesstaat bis zum dezentralen Einheitsstaat (Schultze 1992: 96). Als die nach verbreitetem Verständnis »eigentliche« institutionelle Manifestation des Föderalismus kann jedoch der Bundesstaat gelten. Weber (1980: 28) spricht in diesem Zusammenhang vom »Bundesstaat als der staatsrechtlichen Konkretisierung des Föderalismus«. Nur für bundesstaatliche Ordnungen sind eine Aufteilung der Staatsfunktionen zwischen Bund und Gliedstaaten und eine institutionalisierte Mitwirkung der Gliedstaaten an der Politik des Bundes im Rahmen eines völkerrechtlich souveränen Gesamtstaates konstitutiv.150 —————— 150 Aus einer solchen Definition ergeben sich wichtige Abgrenzungsmerkmale bundesstaatlicher Ordnungen gegenüber nicht-föderativen Systemen, in denen es lediglich Regionalisierung oder Dezentralisierung gibt (Oberreuter 1986: 633). Einige Autoren begreifen Dezentralisierung gar explizit als »Antithese zum Föderalismus« (Fassa 1996: 102), da Dezentralisierung die Existenz eines starken, unilateral handlungsfähigen Zentrums voraussetze. In diesen Systemen fehlt, was Renate Mayntz (1990b: 235) als »interdependente Gleichzeitigkeit einer zentralen und regionalen Entscheidungsebene« bezeichnet hat. – Mit Blick auf die Kritik prominenter Vertreter der jüngeren politikwissenschaftlichen Föderalismusforschung, die – zu Recht – auf die Unterkomplexität eines solchen ausschließlich strukturorientierten Merkmalskatalogs zur Beschreibung föderativer Ordnungen hinweisen (Benz 2002: 16), sei festgehalten, dass hier keineswegs davon ausgegangen wird, damit den dynamischen Charakter föderativer Systeme in der Verfassungspraxis einfangen zu können. Es geht lediglich um eine strukturorientierte Minimaldefinition zum Zwecke der Fallauswahl, die im Weiteren zu differenzieren ist. DER BUNDESSTAAT 195 Nur solche Länder aus der Gruppe der konsolidierten liberalen Demokratien, die jedenfalls der Tendenz nach in diese Kategorie fallen, sind Gegenstand dieses Kapitels. Berücksichtigt werden somit, neben der Bundesrepublik, die Regierungssysteme der USA, Kanadas, Australiens, Österreichs, der Schweiz, Belgiens und Spaniens. Dabei gilt gerade Spanien zu Recht als Grenzfall eines »echten« bundesstaatlichen Systems.151 Der Vorteil eines breiten Ländersamples wird hier jedoch höher bewertet als die begründeten Vorbehalte gegenüber einer Klassifikation Spaniens als Bundesstaat. Die beiden nächsten Abschnitte sind den Entstehungsmustern föderativer Ordnungen und deren grundlegenden institutionellen Rahmenbedingungen gewidmet. Im Zentrum der darauffolgenden Abschnitte steht die speziellere Analyse der föderativen Institutionen selbst. 8.1 Die unterschiedlichen Entstehungsmuster föderativer Systeme Der Bundesstaat ist historisch bedeutend jünger als andere Formen föderaler Strukturbildung. Von den föderalen Gebilden der frühen Neuzeit sind insbesondere die Vereinigten Niederlande (1579–1795), die Schweizerische Eidgenossenschaft (1803–1848) und der Zusammenschluss der amerikanischen Kolonien (1778–1787) zu nennen. Bei ihnen allen handelte es sich um »Staatenbünde«. Der Bundesstaat – manche angelsächsischen Autoren sprechen statt von »federation« von »centralized federalism« – entstand auf dem Philadelphia Convent, im Zuge der Ausarbeitung der amerikanischen Bundesverfassung von 1787. Soziale und ökonomische Interessen der relevanten Akteure mögen für die Schaffung des amerikanischen Bundesstaates und seinen mehr oder minder getreuen Nachbildungen in anderen Ländern eine Rolle gespielt haben. Zweifelsohne ebenfalls von Bedeutung waren die sozialen Voraussetzungen und Einflussfaktoren, von der grundsätzlichen Bereitschaft zum politisch-gesellschaftlichen Kompromiss bis zu der Hoffnung auf erweiterte Kommunikationsmöglichkei- —————— 151 Gegen eine eindeutige Klassifizierung Spaniens als Bundesstaat spricht die rechtlich nicht vollständig garantierte Mitwirkung der Gliedstaaten bzw. der Autonomen Gemeinschaften an der zentralstaatlichen Willensbildung (Hanf 1999: 137– 175). 196 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE ten. Als entscheidende Determinante der Entstehung föderativer Ordnungen erscheint jedoch eine signifikante innere oder äußere Bedrohung. Damit diese zur Schaffung einer föderativen Ordnung führt, ist ferner eine regionale Machtverwurzelung von Strukturen erforderlich, die hinreichend stark ist, um eine föderale Konstruktion (anstelle eines Einheitsstaates) zu gebären (Riker 1975: 116). Schon die neuzeitlichen staatenbündischen Zusammenschlüsse in der Schweiz, den Niederlanden und Amerika entstanden im Kontext besonderer außenpolitischer bzw. militärischer Herausforderungen (durch die österreichische bzw. spanische Habsburg-Dynastie bzw. durch die englische Krone). Auch die Geburt des amerikanischen Bundesstaates lässt sich bei näherer Betrachtung als ein Prozess deuten, dessen maßgebliche Impulse dem Bestreben entsprangen, für den Fall eines neuerlichen militärischen Konflikts mit England die Widerstandsfähigkeit der Amerikaner bzw. von deren Gemeinwesen zu erhöhen. Wie William Riker gezeigt hat, lassen sich entsprechende Motivlagen, in freilich unterschiedlich intensiver Ausprägung, auch im Kontext der Entstehung zahlreicher anderer Föderationen von Kanada bis nach Australien nachweisen (ebd.: 117–121). Aus dieser Perspektive erscheint die Gründung des Norddeutschen Bundes (1867) und des Deutschen Reichs (1871) als ein abweichender Fall, der nicht durch Bedrohung und Verteidigung, sondern durch Aggression und Expansionsbestrebungen Preußens gekennzeichnet war. Dass es auf dieser Basis wiederum zur Begründung eines Bundesstaates, nicht eines Einheitsstaates, kam, war dem Umstand geschuldet, dass die zweite Bedingung für die Entstehung eines Bundesstaates (die Existenz hinreichend starker regional verwurzelter Machtstrukturen) sogar in besonderem Maße gegeben war. In der Tat kann, wenn es um die historischen Erfahrungen mit dezentralisierten Formen von Staatlichkeit geht, kaum ein Land auf eine vergleichbare Tradition zurückblicken wie Deutschland. Dabei handelte sich seit dem Mittelalter um eine spezifische Partikularisierung von Macht und Herrschaft als Folge sehr unterschiedlicher Faktoren, zu denen das mehrfache Aussterben von Königshäusern, das Wahlkönigtum sowie das speziellere Problem der Überanstrengung dieses Königtums durch das Kaisertum gehörten (Nipperdey 1986: 61). Auch spätere Entwicklungen und Erscheinungen, noch jene des 19. Jahrhunderts, trugen – im Gegensatz zu den Ereignissen in Amerika – eher den Charakter eines »anarchischen, sich ständig negierenden als eine[s] zentripetalen, sich organisierenden Föderalismus« (Maier 1990: 221). Aus diesem Grunde gelten im histo- DER BUNDESSTAAT 197 risch-internationalen Vergleichskontext zu Recht die USA, nicht Deutschland, als Entstehungsort nicht nur des Bundesstaates, sondern auch einer »echten« föderalistischen Gesinnung auf der gesellschaftlichen Ebene. Anders als bei der Geburt des Norddeutschen Bundes bzw. des Bismarck-Reichs war für die bundesstaatlichen Neugründungen von Weimar und Bonn, neben anderen Einflüssen, ein beträchtliches Maß an empfundener Bedrohung kennzeichnend – 1919 das drohende Szenario einer hoffnungslosen Überforderung der einzelnen regionalen Einheiten durch die umfangreichen Reparationsforderungen der Siegermächte, nach 1945 die Drohung einer gewaltsamen Teilung des Landes durch die Alliierten und die militärische Drohung durch die Sowjets. Zu den weiter reichenden Erwägungen bei der Schaffung des westdeutschen Bundesstaates gehörte ferner die Hoffnung, den Geltungsbereich des Grundgesetzes einst auf die sowjetische Zone ausdehnen zu können (von Beyme 1968: 558). Die jüngere politikwissenschaftliche Forschung hat andere Differenzierungen der Evolutionsgeschichte föderativer Ordnungen entwickelt. So unterscheidet Alfred Stepan (2001: 320) »coming together federations« und »holding together federations«. »Coming together federations« entstanden aus dem freiwilligen Zusammenschluss autonomer Gebietseinheiten. Idealtypisch fanden sich die späteren Gliedstaaten zu einem Souveränitätsverzicht zusammen, um auf der Grundlage des daraus erwachsenden höheren Maßes an äußerer Sicherheit ihre individuelle Identität zu erhalten. »Holding together federations« bilden demgegenüber das Ergebnis einer Parlamentsentscheidung, mit der versucht wurde, den Fortbestand eines (in aller Regel multinationalen) Einheitsstaates durch eine Föderalisierung der staatlichen Strukturen zu gewährleisten. Als eine dritte Kategorie identifiziert Stepan »putting together federations« – Föderationen, in denen (üblicherweise im Rahmen nicht-demokratischer Regime) die Begründung eines Bundesstaates »von oben« betrieben wurde. Diese dritte Kategorie dient in der jüngeren empirischen Forschung vor allem zur Klassifikation von Ländern wie der Sowjetunion. In der deutschsprachigen Literatur trifft man zum Teil auf eigentümliche Verortungen einzelner Länder. So erscheint bei Arthur Benz (2003a: 174) nicht nur Kanada, sondern auch die Schweiz als eine »holding together federation«. Dieser Interpretation kann hier nicht gefolgt werden.152 —————— 152 Bezug genommen wird bei Benz offenbar auf die Tatsache, dass in der Schweiz und Kanada die Einzelstaaten (Kantone bzw. Provinzen) über ein hohes Maß an Selbständigkeit und autonomer Entscheidungsmacht verfügen und im Übrigen 198 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Gemeinsam mit den USA kommt die Schweiz dem Idealtypus einer »coming together federation« sogar besonders nahe (Linder 1994: 38–40). Der kanadische Fall ist weniger eindeutig, gehört aber insgesamt ebenfalls in die Kategorie der »coming together federations« (Stepan 2001: 324; Watts 2002). Im Rahmen einer vergleichenden Klassifikation findet die Bundesrepublik ihren Platz in der Gruppe der »coming together federations« – gemeinsam mit den USA, Kanada, Australien, Österreich und der Schweiz und im Gegensatz zu Belgien und Spanien als klassischen Fällen von »holding together federations«. Wie für Kanada und Österreich trifft eine Klassifizierung der Entstehungsbedingungen des 1949 in Westdeutschland geschaffenen Bundesstaates als einer »coming together federation« nur mit gewissen Einschränkungen zu. Zwar gab es nach 1945 – zusätzlich zu dem erwähnten Bedrohungsszenario – so etwas wie eine »quasi-föderalistische Renaissance« oder doch jedenfalls »eine Renaissance von Regionalismus und Dezentralisierung« (Nipperdey 1986: 99), die sich vornehmlich aus der Katastrophe des Reiches speiste, ferner aus einer prinzipielleren Abneigung gegen Großstaaten, Massenorganisationen etc. Wenig zum klassischen Entstehungsmuster von »coming together«-Föderationen passt hingegen die Tatsache, dass viele der schließlich zur Bundesrepublik vereinten Länder selbst unhistorische Produkte der unmittelbaren Nachkriegszeit waren und kaum gewachsene Identitäten zu verteidigen hatten. Am mit Abstand wichtigsten für die deutsche Entwicklung nach 1945 wurde jedoch der Umstand, dass es – im Gegensatz zu früheren Bundesstaatsgründungen auf deutschem Boden – einen ausgesprochen starken Druck äußerer Kräfte gab, im Westteil Deutschlands eine bundesstaatliche Ordnung zu errichten. Ausschlaggebend war am Ende der Einfluss der Amerikaner, ihr konsequentes Eintreten für eine bundesstaatlich-föderalistische Lösung, welche im Gegensatz zu den stärker einheitsstaatlich geprägten Vorstellungen der Briten und den »konföderalen Ambitionen« der Franzosen stand. Gegen das entschiedene Drängen der USA konnten sich diejenigen innenpolitischen Kräfte, die zunächst für die Begründung eines Einheitsstaates bzw. eine weiter reichende Macht des Bundes eintraten, nicht durchsetzen, ob- —————— durch hochgradig unterschiedliche »Lebensverhältnisse« gekennzeichnet sind. Analytisch ist jedoch zwischen dem Entstehungsmodus einer Föderation einerseits und der Kompetenz- bzw. Ressourcenverteilung und dem Grad der Unterschiedlichkeit der »Lebensverhältnisse« in den einzelnen Gliedstaaten andererseits zu unterscheiden. DER BUNDESSTAAT 199 wohl die Bundesstaatskonzeption des Grundgesetzes stärker gewaltenkonzentrierend war, als es die Amerikaner zunächst gefordert hatten (Spevack 1999: 64). Insgesamt spielten bei der Bundesstaatsgründung 1949 somit zweifellos auch Effekte eines von außen betriebenen »putting together«Föderalismus hinein. Der dominante historische Entwicklungstrend in »coming together federations« verlief in Richtung Zentralisierung. Das gilt selbst für den Prototyp des modernen Bundesstaates in den USA, wo es zu langfristigen Zentralisierungsprozessen vor allem auf Betreiben der in überwältigender Mehrheit ausgesprochen »bundesfreundlichen« Inhaber des Präsidentenamtes kam (Riker 1975: 109–110).153 Zu den sichtbarsten Manifestationen der Schritt um Schritt sich vollziehenden »Institutionalisierung der Vorrangstellung des Bundes« (von Beyme 1968: 558) gehörten der Wandel der Stellung des Wahlmännerkollegiums bei der Wahl des Präsidenten, die durch das 17. Amendment (1912) in der Verfassung verankerte Volkswahl der Senatoren (welche bis dahin von den Legislaturen der Einzelstaaten gewählt wurden) und die Entwicklung der amerikanischen Finanzverfassung. Bis zur Bundesstaatsreform 2006 verlief der langfristig dominante Entwicklungstrend des föderativen Systems in der Bundesrepublik eindeutig in Richtung Zentralisierung. Anteil daran hatten zahlreiche Faktoren, zu denen auch der vereinheitlichende Charakter eines unitarisch geprägten Parteien- und Verbändesystems zählten (Lehmbruch 2003). Aber selbst in einem so stark durch die Selbstbestimmungsrechte der Gliedstaaten gekennzeichneten System wie der Schweiz kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer moderaten Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen beim Bund, vor allem in den Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik (Fagagnini 1991: 48–49). Einen Sonderfall innerhalb dieser Gruppe bildet Kanada. Maßgeblich verantwortlich für die kanadische Entwicklung war die Tatsache, dass sich »federation-building« und »province-building« weitgehend parallel vollzogen und sich die stärker werdende Rolle der Provinzen als Dezentralisierungstendenz innerhalb der Föderation manifestierte. —————— 153 Als wichtigste historische Ausnahme gilt Präsident James Buchanan. Seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam es jedoch zu einem grundlegenderen Wandel der Rolle des Präsidenten bei der Ausgestaltung der föderativen Ordnung, obwohl der betont »föderalismusfreundlichen« Rhetorik der meisten jüngeren Amtsinhaber nicht immer ein entsprechendes Handeln entsprach (Walker 1995; Kincaid 2001). 200 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Hinzu kamen die stark dezentralisierenden Wirkungen der Rechtsprechung durch das »Judicial Committee of the Privy Council« des Vereinigten Königreichs, insbesondere in der Phase von 1890 bis 1930, sowie die Wirkungen eines regional verwurzelten und dezentralisierten Parteien- und Verbändesystems (Watts 2002: 162–163). 8.2 Die institutionelle Einbettung der föderativen Institutionen Wie für alle politischen Institutionen gilt auch und gerade für die föderativen Institutionen, dass sie sinnvoll nur innerhalb ihres Kontextes vergleichend untersucht werden können. Hier geht es zunächst um deren unmittelbaren institutionellen Kontext. Die wichtigste Rahmenbedingung bezieht sich auf die Verbindung der föderativen Institutionen mit dem Typus des Regierungssystems (Parlamentarismus versus Präsidentialismus). Anders als die beiden klassischen Föderativordnungen USA und Schweiz gehört die Bundesrepublik gemeinsam mit allen übrigen hier berücksichtigten Ländern – Österreich, Belgien, Spanien, Australien und Kanada – zu jenen Systemen, die die föderale Ordnung mit der parlamentarischen Regierungsweise verbinden. Gemeint ist dabei die parlamentarische Regierungsform im engeren Sinne, deren herausragendes institutionelles Merkmal das Prinzip parlamentarischer Verantwortlichkeit der Regierung bildet – in Abgrenzung zu einem weiteren Begriffsverständnis, das unter Parlamentarismus sämtliche Repräsentativsysteme subsumiert, in denen das Parlament eine signifikante Rolle spielt. Aus letzterem resultiert bei Steffani (1997: 56) die Feststellung, die Verfassung der Vereinigten Staaten von 1787 sei die erste geschriebene Verfassung gewesen, die Föderalismus und Parlamentarismus miteinander verbunden habe. Die Verbindung des föderativen Prinzips mit dem Prinzip der parlamentarischen Regierung im engeren Sinne wurde hingegen erstmals in Kanada, im Rahmen des »British North American Act« (»Constitution Act«) von 1867, verwirklicht. Während die These, dass der Föderalismus mit dem Präsidentialismus nicht vereinbar sei, eine einsame Blüte der italienischen Verfassungsreformdiskussion der neunziger Jahre blieb (Fassa 1996: 102), gilt die Verbindung zwischen Föderalismus und Parlamentarismus seit langem als problematisch. Dabei handelt es sich keineswegs um eine spezifisch deut- DER BUNDESSTAAT 201 sche Wahrnehmung.154 In Australien wurde das Spannungsverhältnis zwischen dem Prinzip des »responsible government« und dem Bundesstaatsprinzip schon Jahrzehnte vor der »Entdeckung« des Problems in der Bundesrepublik im Kontext der frühen Verfassungsdebatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts heftig diskutiert (Nelson 2000: 142). Hierzulande wird die Diskussion über die Strukturkombination von Bundesstaatsprinzip und parlamentarischer Regierung bis heute im Schatten der bahnbrechenden Studie Gerhard Lehmbruchs Parteienwettbewerb im Bundesstaat geführt (Lehmbruch 1976, 2000b). Ausgangspunkt der Analyse Lehmbruchs ist die Einsicht, dass der Parlamentarismus und der Föderalismus durch gegenläufige Entscheidungslogiken (einem wettbewerbsdemokratischen bzw. einem verhandlungsdemokratischen Modus) bestimmt seien. Verantwortlich für die »partielle Diskontinuität« der politischen Strukturen in der Bundesrepublik ist Lehmbruch zufolge die Entwicklung des Parteiensystems. Während das föderative System der Bundesrepublik im Wesentlichen die schon im Bismarck-Reich entwickelten Regeln der – durch Aushandeln geprägten – Konfliktaustragung übernommen habe, habe das Parteiensystem in Abkehr vom dominanten Modus der Parteipolitik im Bismarck-Reich und während der Weimarer Republik eine neue, durch Polarisierung und Wettbewerb gekennzeichnete Funktionslogik ausgebildet. Letztere Entwicklung ist freilich im Zusammenhang mit der konsequenten Durchsetzung der parlamentarischen Regierungsform nach 1945 zu sehen. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Generalisierung, dass es sich bei der potentiellen funktionalen Unvereinbarkeit von Bundesstaatlichkeit und Parlamentarismus im Kern um ein strukturelles Spannungsverhältnis zwischen Bundesstaatlichkeit einerseits und innerhalb parlamentarischer Systeme sozialisierter Parteien andererseits handelt. Aus vergleichender Perspektive ist indes nicht nur der Umstand bemerkenswert, dass in Australien grundsätzlich ähnliche Debatten geführt wurden wie in der Bundesrepublik, sondern ebenso die Tatsache, dass die Koexistenz beider Strukturprinzipien in einigen der parlamentarischen Bundesstaaten offenbar nicht als besonderes Problem erlebt wird. Dies ist kaum ausschließlich unterschiedlichen nationalen Temperamenten und Demokratievorstellungen zuzuschreiben. Im Verdacht, einen großen Einfluss auf die Struktur des politischen Prozesses zu besitzen standen von —————— 154 Eine autoritative Analyse zur historischen Entwicklung des Verhältnisses zwischen Parlamentarismus und Föderalismus in Deutschland bietet Ritter (2005). 202 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE jeher die institutionellen Konfigurationen politischer Systeme. Der jüngeren Föderalismusforschung ist es gelungen, jene institutionellen Bedingungen zu spezifizieren, von denen eine potentiell erhöhte politische »Störanfälligkeit« parlamentarischer Bundesstaaten ausgeht. Wie Arthur Benz argumentiert, kommt es zu einer erhöhten »Störanfälligkeit« bundesstaatlich organisierter Regierungssysteme, wenn zwei Subsysteme aufeinander treffen, die durch eine »enge Kopplung« der Akteure an die institutionelle Funktionslogik des Systems gekennzeichnet sind (Benz 2003a: 175). Die »enge Kopplung« der Akteure im parlamentarischen Regierungssystem resultiert aus der Gewaltenverschmelzung von Exekutive und Parlamentsmehrheit. Sie gebiert ein dauerhaft kompetitiv geprägtes Gegenüber von Regierungs- und Oppositionsparteien. Zu einer »engen Kopplung« kommt es in föderativen Systemen, wenn ein institutionell begründeter starker Zwang zur Einigung zwischen Vertretern des Bundes und der Gliedstaaten gegeben ist (ebd.). In diesem Sinne verstanden ist das institutionell erzeugte Problempotential am größten in Systemen, die eine zweifache »enge Kopplung« – nämlich »eine enge Kopplung der nicht kompatiblen Funktionslogiken des Parteienwettbewerbs und institutionalisierter Politikverflechtung« (ebd.: 176) – aufweisen. Daraus ergibt sich, dass bestehende Spannungszustände grundsätzlich entweder durch Veränderungen der Struktur des föderativen Systems (ein geringeres Maß an institutioneller Politikverflechtung155) oder aber durch Veränderungen auf der Ebene der Parteien bzw. des Parteiensystems (ein geringeres Maß an streng mehrheitsdemokratischer Prägung des Parteienwettbewerbs mit stark integrierten und zentralisierten Parteien) vermindert bzw. gegebenenfalls aufgelöst werden können.156 Zentraler Gegenstand dieses Kapitels sind jedoch nicht wie in vielen jüngeren Arbeiten der Föderalismusforschung die allgemeinen Bedingungen der Politikgestaltung in Bundesstaaten, sondern die institutionelle Struktur des Föderalismus im engeren Sinne. Das wirft erneut die eingangs (vgl. FN 150) bereits angerissene Frage nach sinnvollen institutionellen —————— 155 Der Begriff der »Politikverflechtung« ist untrennbar mit den Namen Fritz W. Scharpf, Bernd Reissert und Fritz Schnabel verbunden (Scharpf/Reissert/ Schnabel 1976). 156 Was die Bundesrepublik betrifft, setzten angesichts der (vermeintlichen) institutionellen »Unreformierbarkeit« des deutschen Bundesstaates gerade einige der führenden Vertreter der Föderalismusforschung, wie Gerhard Lehmbruch (2000b: 194–199), eher auf eine Entflechtung des Parteienwettbewerbs. DER BUNDESSTAAT 203 Beschreibungsmerkmalen und Analysekategorien föderaler Systeme auf. Die klassische Unterscheidung in duale und kooperative Bundesstaaten wird heute innerhalb der Politikwissenschaft zunehmend abgelehnt mit der Begründung, dass – wenn auch in unterschiedlichem Maße – letztlich alle föderativen Systeme durch Formen der Kooperation und Verflechtung gekennzeichnet seien (Benz 2003a: 173; Grande 2002: 197).157 Gefordert wird stattdessen eine Konzentration auf die spezifische Ausgestaltung des Systems der Politikverflechtung. Die Erfassung der jeweiligen Besonderheiten der Politikverflechtung stellt jedoch spezielle Anforderungen an das zugrunde gelegte Analysekonzept. Andernfalls besteht die Gefahr, dass in neuen »politikverflechtungsbasierten« Typologien wiederum vor allem der Unterschied zwischen dualen und integrativen Bundesstaaten zum Tragen kommt.158 Ein theoretisch anspruchsvolles Konzept zum vergleichenden Studium von Strukturen und Praktiken der Politikverflechtung stammt von Edgar Grande (2002: 197– 198). Darin wird unterhalb des Oberbegriffs »Politikverflechtung« weiter differenziert zwischen Ressourcenverflechtung und Entscheidungsverflechtung. Ressourcenverflechtung meint dabei die Verflechtung finanzieller Ressourcen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite, Entscheidungsverflechtung hingegen »das Ausmaß, in dem die verschiedenen staatlichen Handlungsebenen interdependent sind«, wobei als Kernindikator für den Grad der formellen Entscheidungsverflechtung die Stärke der zweiten Kammer gilt. Die nachfolgenden Betrachtungen schließen an dieses Konzept an, modifizieren es jedoch ein Stück weit, um eine Reihe weiterer institutioneller Komponenten einzubeziehen. Unterschieden wird zwischen Kompetenzverflechtung, Ressourcenverflechtung und Entscheidungsverflechtung. Unter dem Stichwort Kompetenzverflechtung wird die Verteilung —————— 157 Darauf deutet auch der Umstand hin, dass die heute vor allem für sogenannte kooperative Bundesstaaten wie die Bundesrepublik verwendete Bezeichnung des »kooperativen Föderalismus« zuerst für die Entscheidungsprozesse im dualen System der USA geprägt wurde (Weber 1980: 224–226). 158 So in der Typologie von Benz (2003a: 174), in der die beiden integrierten Bundesstaaten Deutschland und Schweiz als Systeme mit institutionalisierter Politikverflechtung und die beiden dualen Bundesstaaten USA und Kanada als weniger stark institutionell verflochtene Systeme erscheinen. Hinzugefügt sei jedoch, dass die erläuternden Ausführungen von Benz hinsichtlich ihrer Tiefenschärfe und Erklärungskraft weit über die vergleichsweise dürre Typologie hinausreichen und zahlreiche weiterführende Gedanken enthalten. 204 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE und Verflechtung von legislativen und administrativen Kompetenzen zwischen Bund und Gliedstaaten behandelt. Ressourcenverflechtung meint, wie bei Grande, den Verflechtungsgrad auf der Ebene finanzieller Ressourcen. Bei der Analyse des Ausmaßes und Charakters der Entscheidungsverflechtung schließlich liegt der Schwerpunkt auf der Bestimmung der Einflussstärke der zweiten Kammer im bundespolitischen Entscheidungsprozess. 8.3 Dimensionen der »Politikverflechtung« im Bundesstaat 8.3.1 Kompetenzverflechtung Mit Blick auf die Kompetenzverflechtung lässt sich zwischen legislativen und administrativen Kompetenzen unterscheiden. Kein Bundesstaat ist durch eine vollständige Verflechtung von legislativen Kompetenzen gekennzeichnet; die Existenz eines gewissen Maßes an legislativer Eigenständigkeit der Ebenen bildet ein konstitutives Merkmal jeder Föderation. Unterschiedlich ist jedoch zum einen das Ausmaß, in dem die Gliedstaaten über autonome legislative Gestaltungsmacht verfügen, zum anderen – und dies ist der eigentlich entscheidende Indikator der legislativen Kompetenzverflechtung – der Umfang der sogenannten »konkurrierenden Gesetzgebung« (und der Rahmengesetzgebung des Bundes). Die autonomen legislativen Handlungsspielräume, über die die deutschen Bundesländer während der vergangenen Jahrzehnte verfügten, nehmen sich im Vergleich mit der Situation in den meisten übrigen Bundesstaaten als auffallend bescheiden aus. Als relativ großzügig erschien das Maß an möglicher legislativer Selbstgestaltung der deutschen Länder allein im Vergleich mit den österreichischen Bundesländern, die nicht einmal die legislative Hoheit über Polizeiangelegenheiten besitzen.159 In der Bundesre- —————— 159 Die extreme Beschränkung der Gesetzgebungskompetenz der österreichischen Bundesländer gemäß der Bundesverfassung von 1920 bzw. 1929 resultierte maßgeblich aus dem entschiedenen Desinteresse der beiden großen politischen Parteien des Systems an einer ausgeprägt föderalistisch geprägten Ordnung. Der Präferenz der Sozialdemokraten für eine starke Zentralregierung als Voraussetzung und Grundlage einer effizienten Wohlfahrtspolitik entsprach auf Seiten der Konservativen der verbreitete Wunsch nach einer Eingliederung Österreichs in das DER BUNDESSTAAT 205 publik gehörten zu den traditionellen Länderkompetenzen außer den Polizeiangelegenheiten insbesondere die Bereiche Schulwesen und Kultur sowie die Kommunalverfassung. Durch die »erste Stufe« der Föderalismusreform der Regierung Merkel160, welche am 1. September 2006 in Kraft trat, wurde das Selbstbestimmungsrecht der Länder jedoch auf verschiedenen Gebieten gestärkt. Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz erlangten die Länder in den Bereichen des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts für Landes- und Kommunalbeamte, des Strafvollzugs, des Versammlungs- und Presserechts sowie beim Ladenschluss- und Gaststättenrecht. Hinzu kamen im Bereich der Bildungs- und Umweltgesetzgebung bestimmte »Abweichungsrechte«. Die deutschen Länder sind im Hinblick auf ihr legislatives Kompetenzprofil einander verfassungsrechtlich vollständig gleichgestellt. Damit unterscheidet sich die Bundesrepublik nicht nur von der föderativen Ordnung des Bismarck-Reichs, in dem es eine Reihe von Sonderrechten für die süddeutschen Staaten gab, die das Machtgleichgewicht innerhalb der Föderation zusätzlich zu den dominanten Effekten der Übermacht Preußens verzerrten, sondern auch von den gegenwärtigen Ordnungen in Kanada, Spanien und Belgien. In Kanada verfügt das französischsprachige Quebec über eine Reihe von Prärogativen auf dem Feld der Bildungs- und Rechtspolitik, die den englischsprachigen Provinzen vorenthalten bleiben. In Spanien gibt es gravierende Unterschiede hinsichtlich des legislativen Selbstbestimmungsrechts der unterschiedlichen Autonomen Gemeinschaften. In Belgien schließlich verfügen die einzelnen Sprachgemeinschaften über unterschiedliche rechtliche Kompetenzen, welche ergänzt werden durch den speziellen Status Brüssels und der deutschsprachigen Minderheit (Stepan 2001: 326–329).161 —————— Deutsche Reich – ein Projekt, für dessen Verwirklichung föderalistische Strukturen im Innern als Hindernis erachtet wurden (Rack 1996: 205). 160 Dabei handelte es sich um die bislang umfangreichste Änderung des Grundgesetzes überhaupt. Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 01.09.2006, 5. 161 Bei der Gewährung unterschiedlicher Rechte an Gebietseinheiten, die in modernen Bundesstaaten stark mit dem multinationalen Charakter einer Föderation korreliert, handelt es sich lediglich um eine von zahlreichen möglichen De-jure-Asymmetrien. Weitere betreffen etwa die Ausgestaltung des Regierungssystems in den Einzelstaaten oder die weiter unten zu behandelnde unterschiedliche Repräsentation von Gebietseinheiten in der zweiten Kammer. Hinzu kommen De-factoAsymmetrien, zu denen insbesondere die unterschiedliche Größe und Wirtschafts- 206 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Neben den relativ bescheidenen eigenständigen Gesetzgebungsspielräumen der deutschen Länder gehör(t)en zu den Kernmerkmalen des deutschen Modells auf der Ebene der Kompetenzverteilung vor allem der ungewöhnlich breit ausgestaltete Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung, die (2006 abgeschaffte) Rahmengesetzgebung sowie die Existenz von »Gemeinschaftsaufgaben« gemäß Art. 91a GG. Seit Beginn der neunziger Jahre gab es mehrere Anläufe, die allesamt auf eine Entflechtung der Zuständigkeiten und besonders auf eine Zurückdrängung der ausgeprägten Vormachtstellung des Bundes zielten. Gemessen an der Verfassungsreform von 1994 sind die Ergebnisse der Bundesstaatsreform 2006 ansehnlich, auch wenn sie naturgemäß viele Wünsche offen liess (Starck 2007). Das exakte Gegenteil zu dem jahrzehntelang in der Bundesrepublik praktizierten, stark auf die konkurrierende Gesetzgebung bauenden System findet sich in Kanada und der Schweiz verwirklicht, wo die legislative Regelungskompetenz in den meisten Bereichen eindeutig zwischen dem Bund und den Provinzen bzw. Kantonen aufgeteilt ist. In den anderen Ländern gibt es zahlreiche Materien, die im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung angesiedelt ist; kein System reicht jedoch an die traditionellen Standards bundesdeutscher Kompetenzverflechtung (vor 2006) heran. Abgesehen von der legislativen Kompetenzverflechtung kann es Verflechtungen auch auf der Ebene administrativer Kompetenzen unterschiedlicher Ebenen geben. Dies ist dann der Fall, wenn eine Ebene der anderen bedarf, um ihre Entscheidungen ausführen zu lassen. Länder, in denen eine solche funktionale Aufteilung von Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen existiert, werden auch als integrierte Bundesstaaten bezeichnet – in Abgrenzung gegenüber dualen Bundesstaaten, für die eine Kompetenzaufteilung nach Politikfeldern kennzeichnend ist. Auf dieser Ebene lässt sich die Bundesrepublik gemeinsam mit Österreich, der Schweiz und – mit Einschränkungen – Spanien dem integrativen Typ zuordnen, während die drei angelsächsischen Föderationen sowie Belgien den dualistischen Typus des Bundesstaates verkörpern. Gleichwohl kennen, in gewissem Rahmen, auch die Systeme dieser zweiten Gruppe von Ländern die Delegation von Verwaltungskompetenzen an die andere Ebene. In Kanada ist dies auf dem Gebiet des Strafrechts sogar ausdrücklich in der Verfassung verankert. —————— kraft von Gebietseinheiten gehören. Vgl. zum Gesamtkontext von Asymmetrie und Asymmetrisierung von Beyme (2003b). DER BUNDESSTAAT 207 Es gibt jedoch auch innerhalb der Gruppe von Systemen mit integrativer Kompetenzstruktur erwähnenswerte Unterschiede. Die Stellung der deutschen Länder bei der Implementation von Bundesrecht ist noch am ehesten mit der diesbezüglichen Rolle der schweizerischen Kantone vergleichbar, obwohl (anders als hierzulande) die Ausführung von Bundesrecht durch die Kantone kein verfassungsrechtlich kodifiziertes Strukturprinzip darstellt und viele der von den Kantonen auszuführenden Bundesgesetze Rahmengesetze sind, die den Kantonen weite Spielräume bei der Umsetzung legislativer Entscheidungen belassen (Linder/Vatter 2001; Braun 2003). Im österreichischen Modell der »mittelbaren Bundesverwaltung« mit ausdrücklicher Weisungsgebundenheit des Landeshauptmanns gegenüber dem Bundesminister (Weber 1987) sind die Spielräume der Länder bei der Implementation von Bundesgesetzen noch geringer als in der Bundesrepublik. Die spanische Variante einer Koexistenz peripherer zentralstaatlicher und autonomer Verwaltungsstrukturen markiert eine Eigentümlichkeit, die der spezifischen Entwicklungsgeschichte des Staates der Autonomen Gemeinschaften geschuldet ist (Martino 2004). Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Bundesrepublik im internationalen Vergleich durch ein ausgesprochen hohes Maß an legislativer Kompetenzverflechtung zwischen Bund und Gliedstaaten gekennzeichnet ist. Auf der Ebene administrativer Kompetenzen gibt es streng genommen keine Verflechtung, sondern vielmehr eine eindeutige Zuweisung der Verwaltungskompetenz an die Länder. Die ausgeprägte Vormachtstellung der Länder hat sich jedoch in der Praxis – vor allem aufgrund einer entsprechenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die den Ländern großzügige Mitsprachrechte bei den von ihnen auszuführenden Gesetzen einräumte (Blair/Cullen 1999) – als Katalysator weiterer Verflechtungen auf der Entscheidungsebene (vgl. Abschnitt 8.3.3) erwiesen. 8.3.2 Ressourcenverflechtung Durch ein hohes Maß an Verflechtung ist auch die Finanzverfassung der Bundesrepublik gekennzeichnet (Renzsch 1991; Kotzor 2002). Die weitreichende ebenenübergreifende Ressourcenverflechtung auf der Einnahmenseite, welche die Bundesrepublik im internationalen Vergleich auszeichnet, erklärt sich vor allem aus dem prominenten Stellenwert von Gemeinschaftssteuern. Sie machen heute rund Dreiviertel des gesamtstaatlichen 208 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Steueraufkommens aus. Gemeinschaftssteuern waren dem Grundgesetz in seiner ursprünglichen Fassung fremd und wurden erst im Zuge späterer verfassungsrechtlicher Reformen des Bundesstaates geschaffen, in Anknüpfung an ältere Traditionen, die nach 1945 von den Alliierten zunächst unterbrochen wurden. Den Anfang machte der sogenannte »kleine Steuerverbund« (Aufteilung von Einkommens- und Körperschaftssteuer) im Jahre 1955. Ihr folgte 1969 die »große Steuerreform» nach, mit der auch die Umsatzsteuer zu einer Gemeinschaftssteuer wurde. Für einen Übergang vom Trennsystem zum Steuerverbund sprach aus Sicht der Länder deren Interesse, die Abhängigkeit einzelner Systemebenen von besonders konjunkturempfindlichen Steuern nach Möglichkeit zu reduzieren – nicht zuletzt, um »stille Gewichtsverschiebungen« zwischen den Ebenen infolge unterschiedlicher Entwicklungen ihrer Steuern soweit wie möglich auszuschließen (Rudzio 2006: 320–321). Das fiskalische Verbundsystem in der Bundesrepublik kontrastiert besonders stark mit den Trennsystemen in den USA und der Schweiz. Unterschiede gibt es aber auch gegenüber den in einigen anderen Ländern etablierten Steuerverbundsystemen. In Kanada wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Steuerverbund zwischen dem Bund und den Provinzen eingerichtet, an dem aber mittlerweile die Provinzen Quebec und Ontario nicht mehr (vollständig) partizipieren (Grande 2002: 200). Seit den sechziger Jahren finden auf gleichsam permanenter Basis intergouvernementale Verhandlungen über Fragen der Steuerharmonisierung und der Kooperation bei der Steuererhebung statt. Der Anteil der von den Provinzen selbst bestimmten Steuereinnahmen erscheint im internationalen Vergleich als »relativ hoch« (Schneider 2006: 23). In Österreich werden nicht weniger als 95 Prozent der Steuern und Abgaben vom Bund als »gemeinschaftliche Bundesabgaben« beschlossen und verwaltet; davon erhalten die Länder und Gemeinden eine im Finanzausgleichsgesetz bestimmte feste Quote, ihren »Ertragsanteil« (ebd.: 26). Gemessen an der hochgradigen ebenenübergreifenden Ressourcenverflechtung auf der Einnahmenseite erscheint das Ausmaß an Verflechtung auf der Ausgabenseite hierzulande als relativ gering. Allerdings kennt auch die Bundesrepublik Formen der Mitfinanzierung von Landes- und Kommunalaufgaben durch den Bund, darunter sogenannte »Investitionshilfen«, die angesichts der Gefahr einer ressourcenbezogenen Aushöhlung der Entscheidungsautonomie der regionalen und lokalen Ebene als nicht unproblematisch gelten. Sie sind jedoch weder von ihrem Umfang noch DER BUNDESSTAAT 209 von ihrem Charakter her mit den konditionierten Zuwendungen des Bundes an die Gliedstaaten in vielen anderen Ländern zu vergleichen. Deutlich intensiver als hierzulande ist die Ressourcenverflechtung auf der Ausgabenseite in den USA, Australien und in der Schweiz, wo die Gliedstaaten einen beträchtlichen Teil ihrer Aufgaben durch direkte Finanzzuweisungen des Bundes finanzieren (Grande 2002: 199). Trotz der moderaten Ressourcenverflechtung zwischen Bund und Gliedstaaten auf der Ausgabenseite ist die ebenenübergreifende Verflechtung finanzieller Ressourcen in der Bundesrepublik dank des breit dimensionierten Steuerverbunds im internationalen Vergleich insgesamt relativ stark. Zumindest der Tendenz nach dürfte dieses Bestimmungsmerkmal deutscher Bundesstaatlichkeit in der Zukunft jedoch ein Stück weit dahinschmelzen, denn überall drängt der finanzbedingte Asymmetrisierungsdruck auf die Einrichtung bzw. den Ausbau von Verbundsystemen (von Beyme 2003b: 251). Jedenfalls am Rande erwähnt sei eine weitere Dimension der Ressourcenverflechtung in der Bundesrepublik, die zwar nicht ebenenübergreifenden Charakter besitzt, aber gerade deshalb eine echte Besonderheit der deutschen Finanzverfassung bildet: der Länderfinanzausgleich gemäß Art. 107 Abs. 2 GG als eine Form horizontaler Ressourcenverflechtung. Die Herstellung »einheitlicher« bzw. seit 1994 »gleichwertiger« Lebensverhältnisse (gemäß Art. 72, Abs. 2 GG) wurde vor allem über Zahlungstransfers innerhalb des horizontalen Finanzausgleichs verfolgt. Dieser ersetzt jedoch auch in der Bundesrepublik nicht vollständig die aus den meisten Bundesstaaten bekannte Ausgleichsfunktion des Bundes. Anders als in der Urfassung des Grundgesetzes vorgesehen, leistet der Bund seit Jahrzehnten umfangreiche Ausgleichszahlungen, seit der Vereinigung nicht zuletzt im Rahmen großzügiger Bundesbeteiligungen an den »Solidarpakten« I und II. Während der horizontale Finanzausgleich im internationalen Vergleich ein echtes Unikum markiert, ist die für die Bundesrepublik charakteristische Anhebung der Finanzkraft der schwächeren Glieder bis nahe an das Durchschnittsniveau heran keineswegs einzigartig. In dieser Hinsicht bilden eher die Schweiz (mit einem Ausgleichsniveau von lediglich 85 Prozent) und vor allem die USA, die überhaupt keinen Finanzausgleich kennen, die international beachtenswerten Ausnahmen (Renzsch 2000; Schneider 2006b).162 Der Länderfinanzausgleich gehört ohne Zweifel zu —————— 162 Für den amerikanischen Verzicht auf einen Finanzausgleich gibt es gesellschaftliche und institutionelle Gründe. Zu den gesellschaftlichen Faktoren zählt die aus- 210 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE den schwierigsten Gegenständen einer fortgesetzten Bundesstaatsreform; seine künftige Gestalt wird das Gesicht des deutschen Bundesstaates der Zukunft nachhaltig prägen. 8.3.3 Entscheidungsverflechtung Welchen Platz in der Familie der konsolidierten demokratischen Bundesstaaten besetzt die Bundesrepublik mit Blick auf die Entscheidungsverflechtung? Wie schon hinsichtlich der Ressourcenflechtung, so gilt auch für die Entscheidungsverflechtung, dass wichtige Komponenten der Verflechtung die horizontale Ebene betreffen. Die ungewöhnlich intensive Kooperation zwischen den Ländern war neben der Zentralisierung von legislativen Entscheidungskompetenzen maßgeblich mit für die hochgradige Unitarisierung (im Sinne einer Vereinheitlichung von materiellen Regeln) verantwortlich, die das deutsche System im internationalen Vergleich auszeichnet. Nach Wolfgang Rudzio (2006: 325) bestand der die Länder beherrschende Gedanke dabei darin, den populären Druck zugunsten einheitlicher und in diesem Sinne als vorteilhaft betrachteter Lösungen durch eine breit angelegte Selbstkoordination aufzufangen, um damit einer möglichen Kompetenzverlagerung auf den Bund zuvorzukommen.163 Eine —————— geprägte geographische Mobilität der amerikanischen Bevölkerung. Das hohe Maß an geographischer Mobilität ist dabei vielfach gerade der Tatsache geschuldet, dass in den Einzelstaaten unterschiedliche Bedingungen hinsichtlich der Besteuerung und öffentlicher Dienstleistungen bestehen und just dies als Chance, nicht als Bedrohung, gesehen wird. Daneben gibt es wichtige institutionelle Variablen: Da es in den USA keine national agierenden starken Parteiorganisationen und weder innerhalb noch außerhalb der legislativen Arena ein »party government« westeuropäischen Stils gibt, geht es, zugespitzt, jedem einzelnen Abgeordneten darum, für seinen persönlichen Wahlkreis eine besonders großzügige finanzielle Förderung des Bundes zu erreichen. Unter diesen spezifischen Bedingungen kann sich eine Philosophie, die die gezielte Förderung ärmerer Einzelstaaten und Regionen ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stellt, kaum entfalten. Für zusätzliche Verzerrungen sorgen die im amerikanischen Verständnis überragende Bedeutung der Landesverteidigung und die Größe des amerikanischen Verteidigungssektors: Unabhängig von der sonstigen Qualität der Lebensverhältnisse, werden Regionen mit militärisch-strategischer Bedeutung mit zusätzlichen Mitteln versehen (Kenyon/ Kincaid 1996: 47). 163 Der spezifische Charakter der horizontalen Selbstkoordination unterscheidet die Bundesrepublik nicht nur im internationalen, sondern auch im historischen Ver- DER BUNDESSTAAT 211 auch im weiter gefassten internationalen Vergleich bemerkenswerte institutionelle Manifestation der horizontalen Selbstkoordination der Länder bildet – trotz mancher Besonderheiten – weniger die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), für die sich strukturell vergleichbare Äquivalente auch in anderen Ländern finden lassen164, als vielmehr die Kultusministerkonferenz (KMK). Ihr Hauptziel besteht in einer Koordination der Bildungspolitik der Länder. Die KMK ist, so auch ihr offizieller Titel, eine »Ständige Konferenz« mit einem eigenen Sekretariat und mehreren ständigen Ausschüssen bzw. Unterausschüssen. Beschlüsse werden nach dem Einstimmigkeitsprinzip getroffen und offiziell im Rahmen einer Loseblattsammlung veröffentlicht, wie dies für Gesetzessammlungen typisch ist. Die Anfang Dezember 2004 beschlossene Reform der KMK, durch die eine administrative »Verschlankung« erreicht werden soll, dürfte das außergewöhnlich hohe Maß an Institutionalisierung weitgehend unangetastet lassen. Im Zentrum der weiteren Betrachtungen soll jedoch die ebenenübergreifende Entscheidungsverflechtung stehen. Auch diese ist in der Bundesrepublik ungewöhnlich intensiv ausgeprägt. Dazu gehören Ressortministerkonferenzen von Bund und Ländern ebenso wie zahlreiche Bund-Länder-Ausschüsse unterhalb der Ministerebene sowie unterschiedliche Planungsräte wie beispielsweise der »Wissenschaftsrat«. Hierfür gibt es in den anderen hier berücksichtigten Bundesstaaten nur vereinzelt echte Entsprechungen. Als Kern der ebenenübergreifenden Entscheidungsverflechtung in föderativen Systemen gilt jedoch zu Recht die Struktur und Stellung zweiter Kammern. Viele der im internationalen Vergleich zutage tretenden Besonderheiten des deutschen Modells betreffen den Bundesrat. Bemerkenswert sind aus vergleichender Perspektive nicht nur die Vor- und Entwicklungsgeschichte des Bundesrates, welche Anhängern des »path dependence«-Paradigmas geradezu als ein Musterbeleg für die These vom starken Einfluss histori- —————— gleich von anderen Regimen. Im Bismarck-Reich stellte sich Unitarisierung als ein mehr oder minder unwillkürlicher Effekt der Dominanz Preußens ein (Lehmbruch 2000b: 105). 164 Erwähnenswert ist diesbezüglich insbesondere die österreichische »Landeshauptmännerkonferenz«, die sich von der MPK jedoch nicht zuletzt durch ihre grundlegend andere Systemfunktion unterscheidet. Die »Landeshauptmännerkon- ferenz« fungiert gleichsam als Bollwerk gegen eine noch weiter reichende Aushöhlung der Länderkompetenzen durch den Bund und als Kompensationselement für den denkbar schwachen österreichischen Bundesrat. Vgl. Bußjäger (2003). 212 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE scher Weichenstellungen auf spätere Entwicklungsoptionen gilt (Lehmbruch 2000a: 78–79). Nicht minder eigentümlich sind dessen Strukturmerkmale. Auf eine elegante Formel gebracht, ist der Bundesrat »unvergleichlich, aber nicht unvergleichbar« (Sturm 2003: 24). Der Bundesrat stellt in formalrechtlicher Hinsicht keine »zweite Kammer« dar (vgl. BVerfGE 37, 363ff., 380); die funktional orientierte politikwissenschaftliche Institutionenforschung klassifiziert ihn gleichwohl zu Recht seit langem als eine solche, da er in der Gesetzgebung eindeutig über eine mehr als lediglich beratende Funktion verfügt (von Beyme 1974b: 367–368). In den Worten Winfried Steffanis (1997: 66) kann der Bundesrat als eine »strukturell nichtparlamentarische, funktionell parlamentarische zweite Kammer« beschrieben werden.165 Einen einzigartigen Charakter besitzt der Bundesrat zunächst hinsichtlich seiner Rekrutierungsbasis. In keinem anderen Land rekrutieren sich die Mitglieder der territorialen Kammer ausschließlich aus den Mitgliedern der Regierungen auf Gliedstaatenebene. Aus dieser Eigentümlichkeit der Rekrutierung folgt, dass es sich beim Bundesrat um ein »ewiges Organ« handelt, das sich (potentiell) im Gefolge jeder Landtagswahl teilerneuert. In mehreren anderen Ländern – darunter die USA, die Schweiz und Australien – wird die zweite Kammer vom Volk gewählt; auch in Belgien und Spanien ist das Volk zumindest im Rahmen eines Mischsystems an der Bestellung der Mitglieder der zweiten Kammer beteiligt. Ebenfalls (im Rahmen unseres Ländersamples) singulär ist der Rekrutierungsmodus für die zweite Kammer in Österreich, wo die Volksvertretungen der Länder die Bundesratsvertreter wählen und in Kanada, wo die Mitglieder des Senats von der Bundesregierung ernannt werden. Die einzelnen Rekrutierungssysteme generieren ein sehr unterschiedliches demokratisches Legimitationspotential, das unweigerlich auch das politische Gewicht zweiter Kammern im bundespolitischen Entscheidungsprozess beeinflusst (siehe weiter unten). Eher unauffällig ist die Position der Bundesrepublik bzw. des Bundesrates im Hinblick auf die »Repräsentationsgerechtigkeit« bei der Bestellung der zweiten Kammer.166 Hinsichtlich der »Überrepräsentation« der —————— 165 Die wichtigste deutschsprachige Ressource für einen über die nachfolgenden Betrachtungen hinausgehenden Vergleich zweiter Kammern bildet der Band von Riescher/Ruß/Haas (2000). 166 Ein vereinfachender Klassifizierungsversuch von Bundesstaaten bezüglich des Repräsentationsmodells unterscheidet schlicht zwischen »Senatsprinzip« (Zuord- DER BUNDESSTAAT 213 bevölkerungsschwachen Gliedstaaten findet sich die Bundesrepublik von acht möglichen erst auf Rang fünf, wobei sie hinsichtlich ihres Wertes jedoch eine eindeutig größere Nähe zu den Ländern auf den Rangplätzen eins bis vier aufweist (USA, Schweiz, Australien, Kanada). Eine von ihrem Ausmaß her nahezu identische »Überrepräsentation« bevölkerungsschwacher territorialer Einheiten wie in der Bundesrepublik findet sich in Spanien. Durch ein gemessen an den Daten für die übrigen Länder extremes Maß an »gerechter Repräsentation« gekennzeichnet sind die österreichische und die belgische Lösung.167 Eine – allerdings sehr starke – Mittelposition nimmt die Bundesrepublik auch hinsichtlich der Reichweite der formalen Mitsprache- bzw. Vetorechte der zweiten Kammer in der Bundespolitik ein. Die Rolle des Bundesrates bei der Personalrekrutierung für andere Bereiche des politischen Systems ist ausgesprochen schwach. Dies ist maßgeblich der Tatsache zu verdanken, dass im Bundesrat nicht individuelle, sondern kollektive Akteure zusammentreffen. Es würde keinen Sinn machen, den weiteren bundespolitischen Aufstieg von Ministerpräsidenten oder einzelnen (weisungsgebundenen) Mitgliedern der Bundesratsdelegation eines Landes mit deren Bundesratszugehörigkeit zu erklären. Obwohl die Existenz kollektiver, zu einheitlicher Stimmabgabe verpflichteter Akteure eine echte deutsche Besonderheit darstellt (Sturm 2003: 24), ist die Rekrutierungsfunktion der zweiten Kammer auch in den anderen hier berücksichtigten Staaten üblicherweise schwach ausgeprägt. Die wichtigste Ausnahme bildet Australien, wo ein Drittel der Mitglieder der Regierung aus dem Senat rekrutiert wird. —————— nung der gleichen Zahl von Vertretern pro Gliedstaat unabhängig von der jeweiligen Bevölkerungszahl) und »Bundesratsprinzip« (Zuordnung einer Zahl von Vertretern pro Gliedstaat, die mit der Bevölkerungszahl korrespondiert). 167 Eine vergleichende Bewertung des jeweils verwirklichten Repräsentationsmodells ist kaum ohne Kenntnis der »Rohdaten« der territorialen Struktur eines Gemeinwesens möglich. Die verbreitete Einschätzung, dass es in der Bundesrepublik extrem ausgeprägte Unterschiede hinsichtlich der Größe und Bevölkerung der einzelnen Länder gäbe, wird durch den internationalen Vergleich relativiert. Richtig ist, dass das größte deutsche Bundesland (Nordrhein-Westfalen) rund 26 Mal größer ist als das kleinste (Bremen). Deutlich geringere Differenzen weisen jedoch nur Österreich (5,6), Belgien (6, wobei nur die drei Regionen gezählt wurden) und Australien (12,6) auf. Der Wert für Spanien liegt geringfügig höher als für die Bundesrepublik. Eine deutlich größere Spannweite hinsichtlich ihrer Bevölkerungsverteilung weisen die USA (65,8), Kanada (81,5) und insbesondere die Schweiz auf, wo die Bevölkerungszahl des Kantons Zürich um mehr als 84 Mal höher ist als jene in Appenzell-Innerrhoden (Watts 1999: 64). 214 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Als »Sprungbrett« bzw. »Postenreservoir« für exekutive Führungsposten dient die zweite Kammer ansonsten noch am ehesten in Belgien und Kanada, wo der gelegentliche Rückgriff auf Senatsmitglieder vor allem der großen Bedeutung des regionalen Proporzprinzips geschuldet ist. Keinen Anteil hat der Bundesrat, darin den meisten übrigen zweiten Kammern des Samples gleichgestellt, an der Jurisdiktion. Diesbezüglich gebührt als Ausnahme von der Regel vor allem der zentralen Rolle des USSenats bei Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten bzw. oberste Bundesbeamte und Bundesrichter Erwähnung. Über rudimentäre Funktionen im Jurisdiktionsbereich, die in den anderen Ländern von einem Verfassungsgericht wahrgenommen werden, verfügen auch der belgische Senat und der schweizerische Ständerat. Durchschnittlich stark ist die Rolle des Bundesrates bezüglich der Wahlfunktion. Der Bundesrat wählt die Hälfte der Bundesverfassungsrichter. Ebenfalls an der Wahl der Verfassungsrichter beteiligt sind der österreichische Bundesrat und der spanische Senat. Über eine Wahlfunktion besonderer Art verfügt der schweizerische Nationalrat, der als Teil der Bundesversammlung an der Wahl der Mitglieder der schweizerischen Bundesregierung beteiligt ist. Klassische parlamentarische Kontrollrechte gegenüber der Regierung, jenseits des Gesetzgebungsverfahrens, besitzt der Bundesrat nicht. Damit steht er den meisten übrigen zweiten Kammern unseres Samples jedoch kaum nach. Bemerkenswert sind eher die Ausnahmen, zu denen der australische Senat mit seinem Recht auf Einrichtung von Untersuchungsausschüssen und ganz besonders der amerikanische Senat zählen. Der USSenat ist die einzige zweite Kammer, die über sogar noch deutlich weiter reichende Kontrollrechte gegenüber der Exekutive verfügt als die erste Kammer der Legislatur. Hervorhebenswert sind aus vergleichender Perspektive einige der administrativen Funktionen des Bundesrates jenseits der auch andernorts üblichen Prüfung von Regierungsverordnungen – etwa dessen Mitwirkung bei der Veräußerung von Bundesvermögen, beim Bundeszwang oder im Falle des inneren Notstands, wofür es in anderen Zweikammersystemen kein Äquivalent gibt. Stark landesspezifisch geprägte Funktionsprofile zweiter Kammern auf der administrativen Ebene gibt es aber auch andernorts, etwa in Belgien, wo der Senat für die Regelung spezieller Fragen der Monarchie, wie insbesondere solche der Thronfolge, zuständig ist. DER BUNDESSTAAT 215 Der zentrale Fokus beim Vergleich zweiter Kammern muss jedoch auf deren Rolle im bundespolitischen Gesetzgebungsverfahren liegen. Weitgehend unabhängig von landesspezifischen Unterschieden verbreitet ist die Sichtweise zweiter Kammern als »chambres de réflexion« (Schüttemeyer/ Sturm 1992: 519–520). Insofern kann es nicht überraschen, dass im Rahmen des internationalen Vergleichs legislativer Kompetenzprofile zweiter Kammern traditionell vor allem deren »negative power« Beachtung geschenkt wurde.168 Der Bundesrat besitzt bekanntlich ein absolutes Veto für zustimmungspflichtige Gesetze und ein suspensives Veto für sämtliche übrigen Gesetze, sogenannte »Einspruchsgesetze«.169 Selbst die Überstimmung eines Bundesratsvetos durch den Bundestag auf dem Felde der »Einspruchsgesetzgebung« ist jedoch gegebenenfalls an besondere Voraussetzungen gebunden. Votiert der Bundesrat gegen ein betreffendes Gesetz mit Zweidrittelmehrheit, so ist auch die Überstimmung dieses Einspruchs an ein entsprechend großes Zustimmungsquorum geknüpft. Ein lediglich aufschiebendes Veto besitzt der Bundesrat bei der Haushaltsgesetzgebung des Bundes. —————— 168 Wenig zu sagen ist demgegenüber zum Gesetzesinitiativrecht zweiter Kammern. Der Bundesrat besitzt ein praktisch uneingeschränktes Gesetzesinitiativrecht, von dem in der Praxis jedoch nur bescheidener Gebrauch gemacht wurde. Von den bei von Beyme (1997: 378–401) dokumentierten 150 wichtigsten Schlüsselentscheidungen der ersten 12 Legislaturperioden des Bundestages (1949–1994) wurden nur vier vom Bundesrat initiiert. Damit unterscheidet sich die legislative Performanz des Bundesrates kaum von denen anderer zweiter Kammern parlamentarischer Systeme, wohl aber von derjenigen des amerikanischen Senats, der im Vergleichszeitraum zahlreiche Schlüsselentscheidungen der Bundesgesetzgebung anstieß. Die sehr unterschiedliche Initiativbilanz beider Körperschaften ist freilich im Kontext eines zentralen Strukturunterschiedes beider Systeme – des Gegensatzes zwischen kollektiven und individuellen Akteuren, die den jeweiligen Entscheidungsprozess prägen – zu betrachten. Eine Gesetzesinitiative durch ein individuelles Mitglied der zweiten Kammer ist, anders als im Falle der amerikanischen Senatoren bzw. des Senats, im deutschen System ausgeschlossen. 169 Die Mischung absoluter und suspensiver Vetomacht verkörpert, wie Roland Sturm (2002: 174) zu Recht hervorhebt, indes keineswegs eine deutsche Besonderheit. In Ländern, in denen die zweite Kammer normalerweise nur über ein suspensives Vetorecht verfügt, wird deren Einspruchspotential bei einer Reihe von Gesetzen (verfassungsändernde Gesetze oder Gesetze, welche die Verfassungsrechte oder sonstige Angelegenheiten der Gliedstaaten betreffen) dadurch aufgewertet, dass ihr entweder ein absolutes Vetorecht zugestanden wird oder besondere Mehrheiten gefordert werden. 216 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Das formale Vetopotential des Bundesrates in der Bundesgesetzgebung ist aus international vergleichender Perspektive besehen ansehnlich, aber keineswegs außergewöhnlich groß. In nicht weniger als fünf der übrigen hier berücksichtigten Länder – in den USA, der Schweiz sowie in Belgien, Australien und Kanada – verfügen die zweiten Kammern über praktisch identische legislative Entscheidungs- und Vetorechte wie die erste Kammer (mit landesspezifischen Einschränkungen vor allem in der Haushaltspolitik des Bundes). Erwähnenswert sind eher die Ausnahmen Österreich und Spanien mit ihren auffallend schwachen zweiten Kammern. In Deutschland umfasst das »Reservat der Gleichberechtigung« (Niclauß 1998: 232), wie das Feld der »Zustimmungsgesetzgebung« auch genannt wurde, im Durchschnitt der ersten 15 Wahlperioden des Bundestages (1949–2005) 53,1 Prozent, während der ersten vier Wahlperioden seit der Vereinigung (1990–2005) durchschnittlich 55,5 Prozent.170 Ein zentrales Ziel der 2006 verabschiedeten Bundesstaatsreform bestand darin, den Anteil zustimmungspflichtiger Gesetze auf 35 bis 40 Prozent abzusenken. Die im Rahmen einer politikwissenschaftlichen Analyse entscheidende Vergleichsdimension betrifft die politischen Bedingungen der Inanspruchnahme formaler Vetorechte in der Verfassungspraxis. Zumindest in den parlamentarischen Bundesstaaten kommt dabei dem parteipolitischen Machtverteilungsmuster zwischen erster und zweiter Kammer eine herausragende Bedeutung zu. Dies spiegeln »realistische« Typologien der Entscheidungs- bzw. Vetomacht zweiter Kammern ebenso wider wie die Vetospieler-Theorie. Bei Arend Lijphart (1999: 211–213) werden lediglich solche zweiten Kammern als »stark« klassifiziert, die durch ein weitreichendes formales Vetopotential gekennzeichnet sind und von einer, gemessen an der parteipolitischen Zusammensetzung der ersten Kammer, gegenläufigen Mehrheit beherrscht werden.171 Bei George Tsebelis gilt als —————— 170 Der Anteil zustimmungspflichtiger Gesetze in der 15. Legislaturperiode (2002– 2005) lag bei 50,8 Prozent. Zahlen auf der Grundlage von Daten der Verwaltung des Bundesrates; vgl. http://www.bundesrat.de, 18.01.2007. 171 Hinsichtlich der Verortung der Bundesrepublik ist Lijphart (1999: 212) jedoch zu widersprechen. Zu den zweiten Kammern mit symmetrischem, im Sinne von (annähernd) vollständig gleichwertigem Machtpotential kann man den Bundesrat, wie soeben dargelegt, nicht rechnen. Großzügigere Bewertungsmaßstäbe können bei der Bestimmung der parteipolitischen Machtverteilungsmuster akzeptiert werden. Mit Blick auf diese wird die Bundesrepublik bei Lijphart (ebd.), freilich wiederum zuspitzend, als bikameralistisches System mit inkongruenter Mehrheitsstruktur bewertet. DER BUNDESSTAAT 217 entscheidend für das Ergebnis des legislativen Entscheidungsprozesses die spezifische Konfiguration von »Vetospielern«, darunter nicht nur ihr jeweiliges institutionelles, sondern auch deren positionsbezogenes Vetopotential. Die formal existierende Vetomacht eines Akteurs kann durch seine Positionierung – und dabei ist nicht zuletzt an seine Position im parteipolitischen Kräftefeld eines Systems zu denken – »absorbiert« werden (Tsebelis 2002: 12). So zentral die jeweils vorherrschenden parteipolitischen Machtverteilungsmuster zwischen erster und zweiter Kammer für ein Verständnis der Funktionsweise bikameraler Arrangements (vor allem, aber nicht nur in parlamentarischen Bundesstaaten) sind, so wenig darf sich ein realistischer Zugang ausschließlich auf diese konzentrieren. Eine weitere wichtige Variable bildet das oben behandelte Rekrutierungsverfahren für die Mitglieder der zweiten Kammer und die damit verbundene demokratische Legitimationsbasis einer Körperschaft. Die demokratische Legitimation einer zweiten Kammer kann objektiv geringer sein als die der ersten, so ganz besonders im Falle einer Ernennung von deren Mitgliedern durch die Regierung der zentralstaatlichen Ebene. Damit daraus tatsächlich eine wirkungsmächtige Variable zur Bestimmung der faktischen Handlungssouveränität einer Kammer wird, ist es jedoch notwendig, dass entsprechende Unterschiede bei der Rekrutierung und der Legitimation auch subjektiv, von den handlungsmächtigen Akteuren selbst, entsprechend bewertet werden. Diese Bewertungen können sich verstetigen und so eine über einen längeren Zeitraum hinweg stabile Verhaltenskonvention generieren. In bewusster Erweiterung eines »rein institutionalistischen« Verständnisses des politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses ist ferner zu berücksichtigen, dass Akteure auch aus taktischer oder strategischer Motivation heraus handeln können.172 Nach Einschätzung langjähriger Beobachter des Entscheidungsprozesses in der Bundesrepublik haben taktische Erwägungen im Laufe der Jahre an Bedeutung gewonnen (Sturm 2002: 174). Fehlgeleitet erscheint hingegen eine andere Argumentation, die darum bemüht ist aufzuzeigen, dass es sich bei der Unterscheidung von Partei- und Länderinteressen auf der Ebene des Abstimmungsverhaltens im Bundesrat weitgehend um eine »fiktive Differenzierung« handelt —————— 172 Durch die Vernachlässigung dieser Dimension sind keineswegs ausschließlich statische Ansätze, etwa aus dem Bereich des Öffentlichen Rechts, gekennzeichnet; mit entsprechender Kritik wurde in der jüngeren Literatur auch das VetospielerTheorem nach Tsebelis bedacht (Benz 2003b: 210, 230). 218 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE (Leunig 2004). Fokussiert wurde dabei auf das (weitgehend unbestritten) enge Verhältnis zwischen der Landesparteipolitik und den Landesinteressen. Der eigentlich brisante Aspekt, der die deutsche Politikwissenschaft seit den siebziger Jahren beschäftigt hat, betrifft freilich die Frage, ob im Zweifelsfalle Landesinteressen auf dem Altar der Bundesparteipolitik geopfert werden, um eine größtmögliche Geschlossenheit des Oppositionslagers zu erreichen. Im Gegensatz zu der Situation in Belgien und Österreich (wo das freilich sehr unterschiedlich große formale Machtpotential der zweiten Kammer durch die Vorherrschaft kongruenter Mehrheiten faktisch neutralisiert wurde173) waren in der Bundesrepublik über längere Zeiträume hinweg auch die politischen Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der bestehenden Mitwirkungs- und Vetorechte der zweiten Kammer gegeben. Für knapp zwei Drittel der gesamten Nachkriegszeit gab es (unterschiedlich große) gegenläufige Mehrheiten zwischen Bundesrat und Bundestag – der nach Australien zweithöchste Wert in der Gruppe der hier berücksichtigten Bundesstaaten (Wagschal/Grasl 2004: 752). Differenziert man zusätzlich nach der Größenordnung einer oppositionellen Mehrheit, die entweder eine relative oder aber eine absolute sein kann, so waren die Handlungsbedingungen aus Sicht regierender Mehrheiten in der Bundesrepublik sogar erheblich ungünstiger als in Australien, wo es selten stark inkongruente Mehrheiten im Sinne eindeutiger Mehrheiten der Oppositionsparteien gab (Swenden 2004: 344–345). Mit einem von gegnerischen Parteien kontrollierten Bundesrat hatten hierzulande vor allem sozialdemokratisch geführte Bundesregierungen zu tun; in weitaus geringerem Maße galt dies für christdemokratisch geführte Regierungen. Während der rund 38 Jahre der Periode 1949–2006, in denen CDU-Kanzler amtierten, sah sich die Bundesregierung nur für etwas mehr als drei Jahre (von Juni bis Oktober 1990 und von Januar 1996 bis September 1998) einer absoluten Mehrheit der Oppositionsparteien im Bun- —————— 173 Das Land mit der bei weitem größten Diskrepanz zwischen formaler Handlungsmacht und tatsächlichem Einfluss der zweiten Kammer im politischen Entscheidungsprozess ist freilich Kanada. Wichtiger als parteipolitische Machtkonstellationen waren dort die Rückwirkungen des spezifischen Rekrutierungssystems auf die zweite Kammer. Die Nicht-Wahl der kanadischen Senatoren erstickte jeden Anspruch auf eine legitime autonome Handlungsmacht des Senats – selbst im Falle inkongruenter parteipolitischer Mehrheitsverhältnisse zwischen erster und zweiter Kammer – im Keim (Franks 1999). DER BUNDESSTAAT 219 desrat gegenüber (Strohmeier 2004b: 720). Für SPD-geführte Bundesregierungen bildete es hingegen eher eine Ausnahme, wenn die bürgerlichen Oppositionsparteien einmal nicht über eine absolute Mehrheit im Bundesrat verfügten. Während der knapp 12 Jahre sozial-liberaler Koalition war dies insgesamt nur für gut dreieinhalb Jahre der Fall (ebd.); auch die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder (1998–2006) sah sich immerhin für gut dreieinhalb Jahre mit einer absoluten Mehrheit der Oppositionsparteien im Bundesrat konfrontiert. Die Vormachtstellung konservativer politischer Kräfte kennzeichnet auch die interne Machtstruktur vieler anderer zweiter Kammern. Die im historisch-internationalen Vergleich wichtigste Ausnahme verkörpert der US-Senat, der bis zur »konservativen Revolution« Mitte der neunziger Jahre mit nur kurzen Unterbrechungen jahrzehntelang von den Demokraten kontrolliert wurde. Gerade in Bezug auf den amerikanischen Senat ist jedoch daran zu erinnern, dass dieser selbst nach dem spektakulären »Parteipolitisierungsschub« der vergangenen Jahre (Evans 2002; Kady II 2006) hinsichtlich seiner Funktionsvoraussetzungen nur bedingt mit den weitaus stärker parteipolitisch regulierten zweiten Kammern parlamentarischer Bundesstaaten vergleichbar ist. Wie weiter oben bereits betont wurde, ersetzt die Identifikation parteipolitischer Machtverteilungsmuster jedoch keine speziellere Bestandsaufnahme des Tuns und Lassens zweiter Kammern. Wichtige Einsichten in die Rolle des Bundesrates im Gesetzgebungsverfahren gestattet die Auswertung von Gesetzgebungsstatistiken. Gemessen an dem seit vielen Jahren dominierenden Oberton des politischen Journalismus in der Bundesrepublik, demzufolge der Bundesrat drohe, die Republik lahm zu legen, ist an der Einspruchsstatistik des Bundesrates bemerkenswert, wie ausgesprochen moderat die Quote endgültig verweigerter Zustimmungen alles in allem blieb. Zwischen 1949 und 2005 versagte der Bundesrat insgesamt nur etwas mehr als einem Prozent aller Gesetzesbeschlüsse und weniger als einem Prozent aller Rechtsverordnungen endgültig die Zustimmung; auch in der jüngsten abgeschlossenen Legislaturperiode (2002–2005) waren die betreffenden Werte nicht signifikant höher.174 Deutlich tiefenschärfere Einsichten als statistische Dokumentationen der Einspruchfrequenz des Bundesrates bieten Fallstudien zu Gesetzgebungsprozessen, in denen sich der Einfluss des Bundesrates auch in seinen —————— 174 Vgl. für statistische Daten die Quellenangabe in FN 170. 220 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE weicheren Formen greifbar machen lässt.175 In ihnen wird zweifelsfrei erkennbar, dass dem ansehnlichen Ressourcenprofil des Bundesrates während der vergangenen Jahrzehnte ein großer politischer Einfluss im Gesetzgebungsverfahren entsprach. In Überblicksdarstellungen wurden im Wesentlichen fünf Gründe für den sehr geringen Anteil endgültig durch den Bundesrat blockierter Gesetze identifiziert (Stüwe 2004: 29–30): ein Einlenken der Regierungsmehrheit gegenüber der Bundesratsmehrheit; das Bemühen der Regierung, bei der Gesetzesformulierung bzw. beim konkreten Zuschnitt einer Maßnahme eine Zustimmungspflichtigkeit nach Möglichkeit zu vermeiden; Zusagen der Bundesregierung an einzelne Länder des gegnerischen Lagers mit dem Ziel, die Oppositionsfront aufzubrechen; die Verkettung von Gesetzesvorhaben, die keine große Aussicht auf Zustimmung des Bundesrates haben mit anderen dringlichen oder populären Maßnahmen sowie schließlich die faktisch begrenzte Möglichkeit des Bundesrates, jede aus inhaltlichen oder gegebenenfalls auch taktischen Motiven heraus unliebsame Maßnahme abzulehnen. Eine für die jüngere Vergangenheit besonders wichtige Variante politischen Handelns bleibt dabei allerdings vollständig unberücksichtigt: die »Lockangebote« der Bundesregierung an einzelne Akteure aus dem Lager parteipolitisch »befreundeter« Landesregierungen. Die strukturell bedeutsame Dimension hinter entsprechenden Vereinbarungen ist in dem Umstand zu sehen, dass die lange Zeit als gleichsam selbstverständlich erachtete Integration zwischen Landesparteien und der Bundespartei tendenziell abgenommen und stattdessen die regionale Dimension des politischen Wettbewerbs in der Bundesrepublik an Bedeutung gewonnen hat (Sturm 1999; Detterbeck/Renzsch 2002). Dies ist Ergebnis vor allem zweier Entwicklungen. Die erste betrifft die tendenzielle Auseinanderentwicklung der Parteiensysteme auf Bundes- und Landesebene; sie manifestiert sich insbesondere auf der Ebene der parteipolitischen Zusammensetzung von Landesregierungen. Von einer auch nur annähernden Entsprechung der Koalitionsmuster auf Bundesebene und in den Ländern kann bereits seit geraumer Zeit keine Rede mehr sein. Anfang 2003 etwa gab es nicht weniger als acht hinsichtlich ihrer parteipolitischen Zusammensetzung unterschiedliche Typen von Landesregierungen (Helms 2005d: 85). Hinzu kommen ökonomische Faktoren: Das als Folge der Vereinigung deutlich gestiegene —————— 175 Vgl. für umfangreiche Nachweise entsprechender Literatur Schindler (1999: 2512– 2537). DER BUNDESSTAAT 221 Gefälle zwischen armen und reichen Ländern hat zu einer strukturellen Verschlechterung der Bedingungen einer parteipolitischen Instrumentalisierung des Bundesrates durch die Bundesparteien beigetragen. Für primär an der (von der Bundespartei formulierten) »Parteiräson« orientierte Positionsnahmen im bundesstaatlichen Entscheidungsprozess fehlt es vielen ärmeren Ländern heute mehr denn je an dem dafür notwendigen Maß an finanzieller Unabhängigkeit. Besonders hinzuweisen ist im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung der politischen Entscheidungspraxis föderativer Systeme auf die konsens-begünstigenden Institutionen des deutschen Föderalismus: Die Erzielung von Kompromissen zwischen Bundesregierung und Bundestag einerseits und Bundesrat andererseits wurde durch die außerordentlich effiziente Arbeit des Vermittlungsausschusses nachhaltig institutionell begünstigt (Lhotta 2000).176 Eine Einrichtung wie der Vermittlungsausschuss gehört dabei keineswegs zur »Serienausstattung« föderativer Systeme. Sie verkörpert lediglich eine von mehreren möglichen Varianten. Zu den Alternativen zählen das Navette-Verfahren, die Abhaltung gemeinsamer Sitzungen beider Kammern, die Parlamentsauflösung und schließlich der Peer-Schub zur Herstellung einer Regierungsmehrheit (Sturm 2002: 171–172). Am ehesten vergleichbar ist der Vermittlungsausschuss in der Bundesrepublik mit verwandten Gremien in den Vereinigten Staaten und der Schweiz, obwohl auch im Rahmen eines Drei-Länder-Vergleichs deutliche Unterschiede zutage treten (Tsebelis/Money 1997). Der deutsche Vermittlungsausschuss zeichnet sich gegenüber den amerikanischen »conference committees« und der schweizerischen »conférence de conciliation« zunächst dadurch aus, dass die Mitglieder des Vermittlungsausschusses, anders als in der Schweiz oder den USA, nicht identisch mit den Mitgliedern der zuvor mit einer Vorlage befassten Ausschüsse beider Kammer sind, sondern vom Bundestag bzw. den Landesregierungen eigens für die Dauer einer Legislaturperiode bestimmt werden. Anders als in der Schweiz und den USA finden die Beratungen des Vermittlungsausschusses grundsätzlich vertraulich, d.h. unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ferner zu erwähnen ist die weitgehende Absenz restriktiver Bestimmungen für Beratungen des Vermittlungsausschusses, der im Gegensatz zu den diesbe- —————— 176 Wie jüngere Studien zeigen konnten, korreliert die Häufigkeit, mit der der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft, deutlich stärker mit den jeweils vorherrschenden parteipolitischen Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat als das Entscheidungsverhalten des Bundesrates in anderen Bereichen (Strohmeier 2004b: 724). 222 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE züglichen Möglichkeiten der schweizerischen »conférence de conciliation« nicht nur über die umstrittene Passage einer Vorlage, sondern über die gesamte Vorlage beraten darf. Im Rahmen eines deutsch-schweizerischen Vergleichs ist darüber hinaus die deutlich intensivere Frequenz, mit der der Vermittlungsausschuss eingeschaltet wird, erwähnenswert – ein Unterschied, der viel mit der Tatsache zu tun hat, dass eine umstrittene Maßnahme in der Schweiz zunächst zwischen National- und Ständerat hin- und herpendelt, bevor als letzter Ausweg die »conférence de conciliation« mit der Aufgabe der Konfliktschlichtung betraut wird. Ein wichtiger deutschamerikanischer Unterschied betrifft die jeweils geltenden Abstimmungsregeln. Während der Vermittlungsausschuss mit Mehrheit seiner Mitglieder beschließt, arbeiten die amerikanischen »conference committees« auf der Grundlage einer »unit rule«, bei der es gegensätzliche Mehrheiten der beiden Delegationen aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat geben kann. 8.4 Konklusion Deutschland verköpert innerhalb der Familie der heute konsolidierten Demokratien historisch den Typus eines Landes, das weder durch die frühe Erlangung nationalstaatlicher Einheit und die Etablierung einer starken Einheitsstaatlichkeit noch durch eine überzeugende politisch-gesellschaftliche Begründung des Föderalismus und der Bundesstaatlichkeit auffiel. Bis heute erscheinen vor allem die gesellschaftlichen Voraussetzungen eines genuin föderativen Gemeinwesens mit der dazugehörigen Wertschätzung von Vielfalt und Vielfältigkeit (auch und gerade auf der Ebene politischer Lösungen und staatlicher Leistungen) wenig entwickelt. Obwohl das Prädikat der »Scheinbundesstaatlichkeit« von den meisten angelsächsischen Betrachtern noch stärker auf Österreich als auf Deutschland bezogen wurde, blieb auch die Bundesrepublik weit davon entfernt, zu einer »federal federation« (Verney 1995: 88) nach dem Muster der Vereinigten Staaten zu werden. Mustercharakter erlangten nach 1945 vor allem einige der institutionellen Komponenten des föderativen Systems in Deutschland. Wie die vorausgehenden Betrachtungen zeigen, besitzen keineswegs alle Komponenten, die nach Lehmbruch (2002: 103) »den institutionellen Kern des deut- DER BUNDESSTAAT 223 schen Bundesstaates« nach 1945 ausmachen – der Exekutivföderalismus mit integrativer Kompetenzstruktur, die Bundesratskonstruktion und die engen finanzwirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Steuerverbund als Kernelement –, internationalen Ausnahmecharakter. Der Vergleich schärft jedoch nicht nur den Blick für das Gemeinsame, sondern auch für die Besonderheiten, die auf der Ebene der föderativen Institutionen zahlreicher und gewichtiger sind als in vielen anderen Teilbereichen des deutschen Regierungssystems. So gehörten zum komplexen System der Politikverflechtung in der Bundesrepublik nach 1969 eine Reihe institutioneller Einrichtungen – allen voran der horizontale Finanzausgleich –, für die es in anderen Systemen tatsächlich kein Pendant gibt. Die auffälligste Besonderheit verkörpert jedoch zweifelsohne der deutsche Bundesrat. Dies scheint auf den ersten Blick nur für seine einzigartige Struktur – die Rekrutierung seiner Mitglieder ausschließlich aus Delegierten der Landesregierungen – zu gelten. Deutlich unspektakulärer ist, aus international vergleichender Perspektive betrachtet, sein formales Machtpotential; in der Tat verfügen viele zweite Kammern der übrigen hier berücksichtigten Länder über zum Teil noch deutlich weiter gehende formale Mitwirkungs- und Vetorechte. Nichtsdestoweniger gilt der Bundesrat mit Blick auf die Verfassungspraxis zu Recht als die mächtigste zweite Kammer der parlamentarischen Bundesstaaten Westeuropas. Maßgeblich verantwortlich dafür waren die außergewöhnlich günstigen politischen Voraussetzungen für eine tatsächliche Inanspruchnahme der unterschiedlichen Vetoinstrumente, allem voran die Struktur der parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse in Bund und Ländern. Diese allein hätten jedoch kaum den spezifischen Charakter politischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse im parlamentarischen Bundesstaat der Bundesrepublik begründen können. Hinzukommen musste eine weitere Bedingung auf der Ebene der politischen Parteien bzw. des Parteiensystems: Aus international vergleichender Perspektive – und speziell im Vergleich mit der Situation in anderen parlamentarischen Bundesstaaten (Renzsch 2001) – erscheint die Bundesrepublik, trotz erkennbarer Tendenzen in Richtung einer Entkoppelung von nationalem und regionalem Parteienwettbewerb, nach wie vor als ein System mit relativ stark zentralisierten bzw. integrierten Parteien. Erst diese Zentralisierung bzw. Integration schuf die Voraussetzungen für die effektive Verfolgung politischer Veto- und Mitregierungsstrategien der nicht an der Bundesregierung beteiligten Parteien über 224 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE den Bundesrat, für die das deutsche Bundesstaatsmodell nach 1945 internationale Berühmtheit erlangte. In mancher Hinsicht erscheint die australische Föderation als die engste Verwandte des föderativen Systems in der Bundesrepublik. Das gilt neben dem parlamentarischen Charakter beider Systeme besonders im Hinblick auf die Stärke der zweiten Kammern. Ein detaillierter Vergleich, wie ihn der belgische Föderalismusexperte Wilfried Swenden (2004) vorgelegt hat, lässt freilich auch die Grenzen deutsch-australischer Gemeinsamkeiten erkennbar werden. Unterschiede betreffen nicht nur den zentralen Gegensatz zwischen integrativer und dualer Kompetenzstruktur im Bereich von Gesetzgebung und Verwaltung oder das deutlich unterschiedliche Ausmaß an Zentralisierung. Unterschiedlich stark sind auch die Rückwirkungen von Zentralisierung und Dezentralisierung auf die zweite Kammer. In Deutschland wuchs die Macht des Bundesrates proportional zu der Zentralisierung der Gesetzgebungskompetenzen beim Bund; in Australien profitierten hingegen beide Kammern des Parlaments in gleichem Maße von der (vergleichsweise moderateren) Zentralisierungstendenz. Aus der spezifischen politisch-institutionellen Konstellation in Australien folgt auch, dass eine Dezentralisierung legislativer Entscheidungskompetenzen – anders als in der Bundesrepublik – kaum zu einem »Schleichpfad« hin zu einer Schwächung des Senats gegenüber dem Repräsentantenhaus werden könnte. Wer, aus welchen Gründen auch immer, die Repräsentation der Interessen regionaler Gebietseinheiten auf Bundesebene schwächen wollte, würde im australischen Kontext aber ohnehin kaum darauf verfallen, eine Entmachtung des Senats zu betreiben, denn weitaus stärker als in der Bundesrepublik erfolgt die Vertretung von Interessen der regionalen Ebene in Australien an der zweiten Kammer vorbei. Damit sind jedoch bereits Aspekte angesprochen, die mindestens so sehr in das Metier des »institutional engineering« wie in das Gefilde der historisch reflexiven und international vergleichenden Institutionenforschung fallen. 9 Verfassungsgerichtsbarkeit: Die Vollendung der konstitutionellen Gewaltenteilung Wie die föderativen Institutionen gehört auch die Verfassungsgerichtsbarkeit nicht zu jenen politischen Institutionen, die man zur gleichsam selbstverständlichen Grundausstattung liberal-demokratischer Systeme zählen könnte. Das gilt insbesondere dann, wenn man von einem engeren Begriff der Verfassungsgerichtsbarkeit ausgeht, welcher voraussetzt, dass es innerhalb der jeweiligen Institutionenordnung ein spezielles Verfassungsgericht gibt, dessen einzige Aufgabe im Schutz und in der Interpretation der Verfassung besteht. Verfassungsgerichtsbarkeit in diesem Sinne wird im Englischen mit dem Begriff »constitutional review« bezeichnet. Allerdings gibt es auch in vielen Ländern, in denen diese institutionelle Voraussetzung nicht erfüllt ist, Formen der gerichtlichen Überprüfung von Gesetzen auf deren Verfassungsmäßigkeit, und zwar im Rahmen der »normalen« Gerichtsbarkeit. Rein quantitativ betrachtet ist diese institutionell »diffuse« Ausprägung von Verfassungsgerichtsbarkeit für die alten Demokratien sogar typischer als die erste Variante.177 Sie wird im angelsächsischen Sprachraum als »judicial review« bezeichnet (Stone Sweet 2000: 32–33). Gleichzeitig dient der Begriff »judicial review« jedoch verbreitet als Oberbegriff, der sowohl »dezentralized judicial review« als auch »centralized systems of judicial review« (»constitutional review«) umfasst (Lijphart 1999: 225). Da es im Rahmen dieses Kapitels nicht zuletzt um die Rekonstruktion der unterschiedlichen Entstehungsbedingungen und Entwicklungspfade der Verfassungsgerichtsbarkeit geht, soll zunächst von ebendiesem breiten Rahmenkonzept der Verfassungsgerichtsbarkeit178 ausgegangen werden, —————— 177 Dies im Gegensatz zu der weltweiten Entwicklungstendenz, welche durch einen starken Einflussgewinn des Modells der »konzentrierten« Verfassungsgerichtsbarkeit gekennzeichnet ist (Starck 2004: 12). 178 In anderer Terminologie umfasst dieses die beiden Optionen einer Verfassungsgerichtsbarkeit »als Funktion oder eigene Institution« (Wahl 2001: 46). Diesem wei- 226 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE der soeben erwähnten spezielleren Unterscheidung hingegen erst im Zuge weiter gehender Betrachtungen der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Beachtung geschenkt werden. Dass die Verfassungsgerichtsbarkeit selbst in ihrer institutionell unselbständigen Variante des »judicial review« nicht zu einem flächendeckend verbreiteten Kennzeichen liberaler Demokratie geworden ist, hat unter anderem damit zu tun, dass jedwede Spielart von Verfassungsgerichtsbarkeit an bestimmte Mindestvoraussetzungen bezüglich des Verhältnisses von Verfassung und Gesetz gebunden ist. Eine wie auch immer konkret ausgestaltete Verfassungsgerichtsbarkeit kann es nur geben, wenn die Verfassung als eine höherrangige Ebene des Rechts, oberhalb der des Gesetzesrechts, akzeptiert ist. Innerhalb einer solchen Konzeption erscheinen Verfassungsgerichte dann nicht nur als »Hüter der Verfassung«, sondern zugleich als verbindliche Interpreten derselben. Damit tragen sie dazu bei, den Vorrang der Verfassung in der Realität des Rechtslebens erträglich zu machen, indem sie eine effektive und dynamische Anpassung der »starren« Verfassungsnormen an die sich ständig wandelnden Bedürfnisse des gesellschaftlichen Lebens leisten und auf diese Weise die notwendigen Fortschritte der Gesetzgebung mit der Statik, dem »höheren Recht« der Verfassung in Einklang halten (Cappeletti/Ritterspach 1971: 109). Eine solche Trennung zwischen Gesetzes- und Verfassungsrecht einschließlich der Anerkenntnis der Suprematie der Verfassung gehört historisch nicht zum gemeinsamen Grundkonsens der konsolidierten liberalen Demokratien, obwohl sie für die große Mehrzahl der in dieser Studie berücksichtigten Länder charakteristisch ist. Den »klassischen Sonderfall« verkörpert Großbritannien, wo die Doktrin der Parlamentssouveränität und der Verzicht auf eine kohärente geschriebene Verfassung eine richterliche Kontrolle von Gesetzen auf deren Verfassungsmäßigkeit kategorisch ausschloss. Großbritannien ist jedoch keineswegs das einzige Land aus der Familie der etablierten liberal-demokratischen Systeme, in denen die Idee der gerichtlichen Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen auf Abwehr stieß. Als Hindernis eines Systems gerichtlicher Normenkontrolle —————— ten Verständnis von Verfassungsgerichtsbarkeit korrespondiert ein entsprechend weiter Verfassungsgerichtsbegriff, unter den Gerichte gefasst werden, denen wesentliche verfassungsgerichtliche Kompetenzen zugewiesen sind; vgl. Weber (1986: 49). VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 227 in den Ländern französischer Tradition wirkte dabei weniger die Parlamentssouveränität als vielmehr die Doktrin der Volkssouveränität.179 Das Bekenntnis zur Volkssouveränität kennzeichnet auf den ersten Blick praktisch alle repräsentativen Demokratien. Selbst in einem Land wie Deutschland, das auf eine Geschichte zurückblickt, die stets durch ein hohes Maß an Skepsis gegenüber dem Prinzip der Volksherrschaft geprägt war und stattdessen stärker auf den Rechtsstaat baute, verzichtet die Verfassung nicht auf den ausdrücklichen Hinweis, dass alle Macht vom Volke ausgehe. Aus einer spezielleren Vergleichsperspektive, die zwischen unterschiedlichen Realmodellen der Legitimation staatlichen Handelns (Volkssouveränität, Parlamentssouveränität und Verfassungssouveränität) unterscheidet (Abromeit 1995), ist der tatsächliche Stellenwert des Volkes in den Verfassungsdoktrinen der liberalen Demokratien aber sehr unterschiedlich stark ausgebildet. Im Kontext der Trias von Volkssouveränität, Parlamentssouveränität und Verfassungssouveränität erscheint die Bundesrepublik dabei als Prototyp eines auf die Doktrin der Verfassungssouveränität gegründeten Gemeinwesens (ebd.: 52–53, 59–61). Der nächste Abschnitt bietet einen kurzen Aufriss der historischen Genese der Verfassungsgerichtsbarkeit, die dem Verständnis des Konzepts insgesamt dienlich ist. Im Anschluss daran geht es darum, die internationale Ausbreitung der Verfassungsgerichtsbarkeit in ihren unterschiedlichen Spielarten zu rekonstruieren. Auf dieser Grundlage sollen schließlich die Strukturmerkmale der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik behandelt und durch eine vergleichende Perspektive profiliert werden. 9.1 Die historischen Ursprünge des »judicial review« im angelsächsischen Konstitutionalismus Trotz wichtiger englischer Impulse stand die Wiege der gerichtlichen Normenkontrolle nicht in England, sondern in den Vereinigten Staaten. Von dort aus breitete sich das Prinzip auf unterschiedlichen Wegen und in je spezifischer Ausprägung nach Europa, in die Commonwealth-Staaten —————— 179 Die daraus erwachsenden Vorbehalte in Frankreich selbst können mittlerweile als weitgehend überwunden gelten. Vollständig abgelehnt wird eine wie auch immer beschaffene richterliche Verfassungskontrolle hingegen nach wie vor in den Niederlanden (Weber 2004: 40). 228 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE und bis nach Japan aus. Die Pionierrolle, die die USA in diesem Bereich spielten, war freilich nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass die Amerikaner zugleich Vorreiter bei der Etablierung des modernen Konstitutionalismus – mit der ausdrücklichen Anerkennung der Suprematie der Verfassung gegenüber dem einfachen Gesetz – waren. Dabei fand das Prinzip des »judicial review« bekanntlich keinen Eingang in die amerikanische Bundesverfassung von 1787. Ein wenig spitz formuliert beruht die seit rund 200 Jahren akzeptierte Kompetenz des Supreme Court zur Überprüfung von Gesetzen am Maßstab der Verfassung nicht auf verfassungsrechtlicher Grundlage, sondern auf »richterlicher Anmaßung« (Noll 1992: 16). Als Geburtsstunde der gerichtlichen Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen in den Vereinigten Staaten gilt die berühmte Entscheidung des Supreme Courts unter Chief Justice Marshall, »Marbury v. Madison« (1803), in der aus dem in Art. VI, Abs. 2 der amerikanischen Verfassung begründeten Vorrang der Verfassung ein richterliches Prüfungsrecht abgeleitet wird, das jedem Richter im Rahmen der Entscheidung eines anhängigen Rechtsstreits zustehe. An der international vorherrschenden Bewertung des »Marbury«-Urteils als Zeugnis des Durchbruchs von »judicial review« sind in der jüngeren Literatur Zweifel angemeldet worden, die sich nicht zuletzt aus der genaueren Erforschung der politisch-historischen Dimension von »judicial review« im amerikanischen Regierungssystem speisen. Darauf sei hier im Rahmen eines weiter ausgreifenden Rückblicks auf die historischen Entstehungsbedingungen der gerichtlichen Normenkontrolle eingegangen. Dass es vor allem in der griechischen Antike, konkret in der athenischen Demokratie, aber auch im Mittelalter einzelne Elemente in der Konzeption von Gemeinwesen gab, die dem modernen Konstitutionalismus hinsichtlich der Vorstellung der Höherrangigkeit bestimmter Normen (von den griechischen »nomoi« bis zum mittelalterlichen Naturrecht) wesensverwandt sind, darf heute als weithin bekannt vorausgesetzt werden. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass historisch paradoxerweise gerade die Suprematie des Parlaments in Großbritannien, die dort bis heute als »Bollwerk« gegen das Konzept des »constitutional review« wirkt, eine Katalysatorfunktion entfaltete, die in den amerikanischen Kolonien der Vorstellung von der Suprematie der Verfassung und der Richter letztlich zum Durchbruch verhalf (Cappelletti/Ritterspach 1971: 78–81). Die Doktrin der Parlamentssouveränität entwickelte sich auch in Großbritannien erst im Gefolge der »Glorious Revolution« von 1688. VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 229 Kennzeichnend für die vorherrschende Rechtsvorstellung während der vorausgehenden rund vier Jahrhunderte war die heute vor allem mit dem Namen Sir Edward Cokes (1552–1634) verbundene Überzeugung, dass das »common law« über dem vom Parlament erzeugten »statutary law« stehe und weite Teile dessen dem Eingriff des Gesetzgebers entzogen seien. Die Aufgabe, den Vorrang des »common law« gegenüber der Willkür des monarchischen Souveräns einerseits und des parlamentarischen Gesetzgebers andererseits zu sichern, fiel in der Lehre Cokes den Richtern zu. Diese Lehre aus der vorrevolutionären Epoche der englischen Geschichte galt auch in den englischen Kolonien in Amerika. Die in England als Ergebnis der »Glorious Revolution« vollzogene Abkehr von dieser Rechtsvorstellung und die gleichzeitige Hinwendung zur Lehre von der Suprematie des Parlaments wurde in Amerika nicht mitvollzogen. Die großen Auseinandersetzungen blieben dort vielmehr am vorrevolutionären Referenzmodell orientiert. Dafür gab es einen wichtigen Grund, der mit der ursprünglichen Vormachtstellung der englischen Gesetzgebung bzw. des englischen Parlaments in den Kolonien zu tun hatte. Viele der englischen Kolonien in Amerika waren zunächst als Handelsgesellschaften gegründet worden, die nach den Statuten der englischen Krone regiert wurden. Funktional betrachtet handelte es sich bei diesen Statuten oder Satzungen um die ersten Verfassungen der Kolonien. In ihnen wurde den Kolonien verbreitet das Recht zuerkannt, Gesetze zu erlassen – sofern diese mit den Gesetzen der englischen Krone bzw. dem Willen des englischen Parlaments vereinbar waren. Diese Stoßrichtung wurde durch zahlreiche analoge Entscheidungen des englischen Privy Council (einer Nachfolgeinstitution des mittelalterlichen »inner council« der Berater des Monarchen und funktionaler Vorläufer des Kabinetts, welches in verfassungsrechtlicher Hinsicht bis heute den operativen Teil des Privy Council verkörpert) untermauert. Somit sorgten die spezifischen entwicklungsgeschichtlichen Entstehungsbedingungen der Kolonien und das Festhalten an der älteren englischen Lehre dafür, dass das jüngere englische Rechtsprinzip der unbeschränkten Vormachtstellung des parlamentarischen Gesetzgebers jenseits des Atlantiks entscheidend zur Entstehung eines dem entgegengesetzten Systems beitrug, in dem Parlamentsgesetze einer gerichtlichen Prüfung unterzogen werden können. An dieser spezifischen Entwicklungslinie knüpften die Kolonien an, als sie im Gefolge des siegreichen Unabhängigkeitskrieges gegen das englische Mutterland die älteren »Satzungen« durch 230 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE neue Verfassungen ersetzten, welche wiederum als höheres – und gerichtlich einklagbares – Recht konzipiert waren. Zwischen 1776 und 1787 verankerten nicht weniger als acht der damals dreizehn Kolonien die Möglichkeit der gerichtlichen Normenkontrolle ausdrücklich in ihrer Verfassung (Epstein/Walker 2001: 87). Die Tatsache, dass das Prinzip einer gerichtlichen Normenkontrolle somit letztlich eine »amerikanische Erfindung« darstellt, die mehr als jedes andere Element des Verfassungsstaates der Neuzeit in anderen Ländern auch just als solche wahrgenommen wurde, hat diesem Institut in den Vereinigten Staaten selbst, vor allem in der Frühphase der Republik, grundsätzliche Kritik keineswegs erspart. Es gab prinzipielle Vorbehalte, die sich aus der Übernahme der Montesquieu’schen Gewaltenteilungslehre mit der ihr eigenen Skepsis gegenüber der »dritten Gewalt« durch die politische Elite der Gründergeneration der Vereinigten Staaten ergaben. Allerdings erwiesen sich diese Barrieren im amerikanischen System der »separation of powers« letzten Endes als deutlich weniger beharrlich als in der Mehrzahl der parlamentarischen Demokratien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (von Beyme 1988: 21–22). Wie oben bereits angedeutet wurde, finden sich in der jüngeren amerikanischen Literatur verschiedene Neueinschätzungen der historischen Herausbildung des »judicial review«. Die wohl wichtigste Frage bezieht sich darauf, inwieweit »Marbury v. United States« aus einer politisch-historischen Perspektive betrachtet tatsächlich jenen Stellenwert für das Konzept des »judicial review« besitzt wie weithin angenommen wird. Viele neuere Untersuchungen bewerten die unmittelbaren Wirkungen des Urteils als relativ bescheiden. Vorbehalte betreffen zum einen den rechtlichen Präzedenzcharakter der Entscheidung. Diesbezüglich wurde darauf hingewiesen, dass bereits der »Judiciary Act of 1789« das Recht der Gerichtsbarkeit anerkannt hatte, Gesetze der Einzelstaaten und des Bundes für nicht verfassungsmäßig zu erklären (Marcus 1996: 26–27). Ferner gab es während der letzten Dekade des 18. Jahrhunderts mehrere Fälle, in denen die Gerichte ohne größeres Aufsehen entsprechende Präzedenzfälle formulierten. In diese Richtung weist schließlich auch die Tatsache, dass der Supreme Court selbst viele Jahrzehnte lang darauf verzichtete, »Marbury« als Quelle des Prinzips gerichtlicher Normenkontrolle zu zitieren; hierzu kam es nicht vor 1887 (Clinton 1989: 120). Die eigentliche Bedeutung des Urteils von 1803 liegt deshalb vermutlich eher darin, dass es eine zentrale Rolle dabei spielte, die prinzipielle und VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 231 zugleich weitgehend abstrakte Unterstützungsbasis für das Prinzip gerichtlicher Normenkontrolle in einem diesbezüglich skeptischen Umfeld zu sichern. »John Marshall […] preserved political support for judicial power by constructing opinions that temporarily separated the issue of judicial review from other contested constitutional and political issues. The Marshall Court did so by vigorously asserting judicial power in theory while declining to exercise it in practice.« (Graber 1999: 36) Das »Marbury«-Urteil des Supreme Court selbst lässt sich als eine Entscheidung deuten, die mit Rüchtsicht auf die politischen Präferenzen des dritten Präsidenten der USA, Thomas Jefferson, getroffen wurde bzw. diesen zumindest deutlich entgegenkam (Epstein/Walker 2001: 74). Die These, dass es dem Marshall Court nicht darum ging, sich als Bastion gerichtlicher Gegenmacht gegenüber der Exekutive und Legislative zu etablieren, wird auch durch den bemerkenswerten Umstand genährt, dass es während der gesamten Amtszeit Marshalls (1801–1835) kein weiteres Urteil gab, durch das ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt wurde. Dazu kam es erneut erst mehr als ein halbes Jahrhundert später in »Scott v. Sandford« (1857). 9.2 Die historische Ausbreitung von »judicial« und »constitutional review« in den heute konsolidierten liberalen Demokratien In einem sehr allgemeinen Sinne kommt dem amerikanischen Modell der gerichtlichen Normenkontrolle eine Vorbildfunktion für sämtliche demokratischen Verfassungsstaaten zu, in deren Verfassungsordnung dieses Prinzip schließlich Eingang fand. Zu differenzierteren Aussagen kann jedoch nur ein systematischer Zugriff gelangen. Die meisten Versuche einer historisch-systematischen Rekonstruktion der Ausbreitung der Verfassungsgerichtsbarkeit in unterschiedlichen demokratischen Systemen basieren auf der oben bereits eingeführten Unterscheidung zwischen einer »diffusen« und einer »konzentrierten« gerichtlichen Normenkontrolle. Dem amerikanischen Modell einer »diffusen« Normenkontrolle, in dem »der oberste Gerichtshof Revisions- und Verfassungsgericht in einem ist« 232 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE (Starck 1990: 24), entspricht das Alternativmodell einer institutionell verselbständigten Verfassungsgerichtsbarkeit wie sie erstmals in der österreichischen Bundesverfassung von 1920 verwirklicht wurde. In der älteren Literatur wurde deshalb zumeist von der amerikanischen und der österreichischen Variante gesprochen (Cappelletti/Ritterspach 1971: 82). In der jüngeren Literatur wird letztere immer häufiger als »österreichisch-deutsches System« (Starck 2004: 12) bezeichnet, worin die große internationale Ausstrahlungswirkung des (ungeachtet anderer Einflüsse) im Wesentlichen nach österreichischem Muster errichteten deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Ausdruck kommt. Ausgewählte Aspekte der Entstehungsgeschichte der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland sind im nächsten Abschnitt zu beleuchten. Hier geht es im Weiteren zunächst um die Topographie der unterschiedlichen Ausprägungen von Verfassungsgerichtsbarkeit in den heute konsolidierten liberalen Demokratien. Zu den Ländern, die dem System der »diffusen« gerichtlichen Normenkontrolle folgten, gehören zunächst Kanada und Australien.180 Im asiatischen Raum zählt zu den Nachahmern des amerikanischen Modells Japan, wo ein entsprechendes System nach dem Zweiten Weltkrieg unter starker Mitwirkung der amerikanischen Besatzungsmacht errichtet wurde. Ausgeprägt war der Einfluss des amerikanischen Modells innerhalb Westeuropas vor allem in Norwegen, dem damit eine europäische Vorreiterrolle zuwuchs (Smith 2000). Von den fünf skandinavischen Ländern wurde ein richterliches Prüfungsrecht historisch nur in Schweden und Finnland abgelehnt; selbst dort kam es im Rahmen größerer Verfassungsreformen in den Jahren 1975 bzw. 1999 zu einer Konstitutionalisierung des (freilich unterschiedlich großzügig ausgestalteten) Prinzips der gerichtlichen Normenkontrolle. Ein genauerer Blick auf die skandinavischen Demokratien lehrt jedoch, dass von der Bereitschaft, sich in Einzelfragen von den USA inspirieren zu lassen, kaum auf weitreichende Übereinstimmungen des —————— 180 Obwohl die Verfassungsgerichtsbarkeit in Kanada erst im Gefolge der Verabschiedung der Grundrechtscharta (»Charter of Fundamental Rights and Freedoms«) im Jahre 1982 vollends aufblühte, gelten die drei angelsächsischen Demokratien gemeinhin als die einzigen Länder, in denen »judicial review« bereits vor dem Zweiten Weltkrieg florierte (Shapiro 2002: 149). Auf der Grundlage dieser Beobachtung bzw. Bewertung wurde die einflussreiche These über die institutionellen Voraussetzungen von »judicial review« formuliert, nach der die Entstehung entsprechender Strukturen vor allem durch die Existenz föderativer Systeme erklärbar ist (ebd.: 149–161). VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 233 politisch-gesellschaftlichen Kontextes geschlossen werden kann, in dem sich »judicial review« zu bewähren hat. Dies zeigt besonders der Fall Dänemark, dessen politisches System als Ganzes stets deutlich stärker im Einflussbereich des britischen als des amerikanischen Demokratiemodells stand. Die Verfassungsgerichtsbarkeit wurde dort niemals verfassungsrechtlich kodifiziert, obwohl sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts als faktischer Bestandteil des dänischen Verfassungsrechts gilt. Das richterliche Prüfungsrecht bildete sich gleichsam als Gewohnheitsrecht heraus. Die Affinität des dänischen Demokratiemodells zum britischen Westminster-Modell manifestiert sich nicht zuletzt in der ausgeprägten Tendenz, im politischen Streitfall den Entscheidungsvorrang jener Institution mit der größten demokratischen Legitimation – dem Parlament – einzuräumen. Diese Verfassungskultur findet ihren Widerhall in einer auffallenden richterlichen Zurückhaltung in Fragen der gerichtlichen Normenkontrolle. Ein wichtiger Unterschied gegenüber dem amerikanischen Mutterland des »judicial review« besteht in der ausgeprägten Homogenität der dänischen Gesellschaft, welche sich in einem hohen Maß an Konsens und Solidarität niederschlägt. Folglich war und ist das funktionale Bedürfnis nach einer unabhängigen Schlichtungsinstitution wie den Gerichten im dänischen Gemeinwesen deutlich geringer als in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern aus der Familie der liberalen Demokratien (Mors 2002: 163–164, 175). Mit je spezifischen Abweichungen hat das amerikanische Modell ursprünglich einen Vorbildcharakter auch in Ländern wie Irland oder der Schweiz entfaltet. Während am irischen System vor allem Elemente der präventiven Normenkontrolle erwähnenswert sind, ist die Besonderheit des schweizerischen Systems – welches in seiner jüngeren Ausgestaltung im Übrigen eher dem Modell der konzentrierten Verfassungsgerichtsbarkeit entspricht (Auer 1984) – in dem Umstand zu sehen, dass sich die richterliche Verfassungskontrolle ausschließlich auf die Kantonsverfassungen, nicht hingegen auf die Bundesverfassung erstreckt. Dem amerikanischen Referenzmodell setzte der österreichische Verfassungsgelehrte Hans Kelsen einen alternativen Typus der »konzentrierten« Verfassungsgerichtsbarkeit entgegen, der erstmals im Rahmen der österreichischen Bundesverfassung von 1920 verfassungspolitisch und -rechtlich realisiert wurde. Dem Modell Kelsens sind im Wesentlichen die folgenden Aspekte eigen (Stone Sweet 2002: 79–80): Das Verfassungsgericht genießt einen Monopolstatus hinsichtlich der Kompetenz, letztinstanzlich über die 234 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes zu entscheiden; gleichzeitig ist sein Kompetenzbereich streng auf die Beilegung verfassungsrechtlicher Streitigkeiten beschränkt; obwohl das Verfassungsgericht zur rechtsprechenden Gewalt gehört, steht es – anders als der Supreme Court der Vereinigten Staaten – außerhalb des normalen Systems richterlicher Gewalt; schließlich kann es im Gegensatz zum amerikanischen Supreme Court Gesetze auf deren Verfassungsmäßigkeit überprüfen, bevor sie angewendet wurden. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass Kelsen bei der Konstruktion seines Modells einer institutionell verselbständigten Verfassungsgerichtsbarkeit nachhaltig vom amerikanischen Modell inspiriert wurde. Rechtsdogmatisch der Reinen Rechtslehre verpflichtet, knüpfte das Konzept historisch-empirisch eher an der Einrichtung des Reichsgerichtshofes an, welcher bei Kelsen zu einem genuinen Verfassungsgerichtshof weiterentwickelt wurde. Für die verfassungspolitische Durchsetzung des Kelsenianischen Modells maßgeblich verantwortlich waren die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Die Situation eines latenten Bürgerkrieges in den Gesellschaften mehrerer europäischer Länder nährte die Sehnsucht nach einer möglichst »unpolitischen« Schlichtungsinstanz (von Beyme 1988: 29–30). Dem amerikanischen Modell schlug dabei seitens der westeuropäischen politischen Eliten unterschiedlicher Lager wenig Sympathie entgegen. Vor allem auf der Linken wurde es verbreitet als ein System wahrgenommen, das eine weitreichende Aufteilung der politischen Entscheidungsgewalt zwischen der Legislative und Exekutive einerseits und der Judikative andererseits institutionalisierte und damit letztlich einer »Regierung der Richter« Vorschub leistete. »Kelsenian constitutional review provided a means of defending constitutional law as a higher law, while retaining the general prohibition on judicial review«, wie ein angelsächsischer Autor formulierte (Stone Sweet 2002: 85). Vertreter der Rechtswissenschaft haben auf einen weiteren, eher unscheinbaren, aber gleichwohl wichtigen Grund für die Errichtung des österreichischen Modells und seinen Einfluss im europäischen Ausland hingewiesen. Danach lässt sich das Bestreben einiger Länder, die Verfassungsrechtsprechung nicht schlicht den bestehenden obersten Gerichtshöfen »aufzusatteln« und stattdessen ein eigenständiges Verfassungsgericht zu schaffen, auch mit dem spezifischen Profil und den Anforderungen des Richteramts dies- und jenseits des Atlantiks begründen. Während den Richtern amerikanischer Gerichte sowohl mit Blick auf die frühe historische Erscheinung der gerichtlichen Normenkontrolle in den USA als auch den Modalitäten der VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 235 Rekrutierung von Richtern des Supreme Court (welche keine Berufsrichter sind) prinzipiell eine hinreichende Eignung und Qualifikation zuzutrauen sei, berge eine Konfrontation einfacher Berufsrichter kontinentaleuropäischen Typs mit der Aufgabe einer »politiksensiblen« Auslegung von Verfassungsnormen die Gefahr einer strukturellen Überforderung in sich (Cappelletti/Ritterspach 1971: 89–90). Zu den Ländern, die dem österreichischen Modell nach 1945 folgten, gehören ohne größere Einschränkungen die Bundesrepublik, Italien, Spanien und Portugal.181 Während in diesen Ländern »vollwertige« Verfassungsgerichte geschaffen wurden, gibt es in Belgien und Griechenland lediglich Schiedsgerichtshöfe mit einem inhaltlich eingeschränkten Kompetenzprofil (Weber 2004: 43). Nicht zufällig ist die Gruppe der Länder mit einem institutionell verselbständigten Verfassungsgericht (mit Ausnahme Belgiens) im Wesentlichen identisch mit jenen Demokratien, die historisch aus autoritären Regimen hervorgingen und ihren verfassungsrechtlichen und demokratischen Neubeginn zugleich mit der Aufnahme besonders ausgiebiger Grundrechtskataloge in ihren Verfassungen symbolisierten (Helms 2003a: 47). Es überrascht nicht, dass die Wirkung »historischer Erfahrungen«, neben der Existenz föderativer Staatsstrukturen, auch in Studien, die sich des Verfahrens der Regressionsanalyse bedienen als erklärungskräftigste Variable für die Entscheidung des Verfassungsgebers zugunsten einer selbständig institutionalisierten Verfassungsgerichtsbarkeit identifiziert wurde (Alivizatos 1995: 585–586). Als Sonderfall in der Gruppe der größeren westeuropäischen Länder galt lange Zeit die V. Republik Frankreich, welche heute jedoch weitgehend übereinstimmend zu jenen Ländern mit »konzentrierter« gerichtlicher Normenkontrolle gezählt wird. Eine erste Besonderheit bezieht sich darauf, dass es sich bei den Mitgliedern des Conseil constitutionnel nicht um Richter handelt. Formal ist keinerlei spezielle fachliche Qualifikation gefordert, insbesondere keine juristische Vorbildung.182 Nicht minder bemer- —————— 181 Für Italien, Portugal und Belgien, ganz besonders aber für Spanien, wurde weniger der österreichische Verfassungsgerichtshof als das deutsche Bundesverfassungsgericht zum direkten Vorbild institutionalisierter Verfassungsgerichtsbarkeit (Knaak 1995). 182 Historischer Hintergrund dieser Bestimmung ist – zusätzlich zu den tief verwurzelten ideologischen Vorbehalten gegenüber jeder eigenständigen Machtposition der »dritten Gewalt« – die bis heute nachwirkende Erfahrung der Franzosen mit den häufig willkürlich anmutenden Eingriffen von Richtern während der vor- 236 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE kenswert ist der Umstand, dass die Verfassungsmäßigkeitsüberprüfung durch den Conseil grundsätzlich präventiven Charakter besitzt. Eine Stellungnahme des Gerichts auf Antrag einer der initiativberechtigten Akteure ist nur vor der Verkündung eines Gesetzes, im Rahmen einer knappen Frist, möglich. Eine weitere institutionelle Beschränkung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich wurde 1974 durch die neu geschaffene Möglichkeit einer parlamentarischen Minderheit, ein Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen, überwunden. Bereits drei Jahre zuvor wurde die Position der Verfassungsgerichtsbarkeit im politischen System Frankreichs durch die aufsehenerregende Entscheidung des Verfassungsrates, die französische Menschenrechtserklärung aus dem Jahre 1789 zu einem Bestandteil der Verfassung der V. Republik zu erklären, strukturell aufgewertet. In der jüngeren Literatur über den Conseil constitutionnel wird dieser gleichsam selbstverständlich zu den einflussreichen politischen Akteuren im französischen Regierungssystem gerechnet (Blachèr 2003; Meunier 2003). 9.3 Entstehungskontext, institutionelles Profil und politische Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts im Vergleich Mit Blick auf die deutsche Verfassungsgeschichte vor dem Zweiten Weltkrieg lässt sich das Bundesverfassungsgericht als das innovativste der insgesamt fünf Verfassungsorgane der Bundesrepublik bezeichnen. Es war in der Tat »die einzige völlige Neuschöpfung des Grundgesetzes« (Fromont 1999: 493). Seine Errichtung markierte gleichsam »die späte Erfüllung eines lang gehegten liberalen Traums des 19. Jahrhunderts« (Blankenburg 1996: 308). Das bedeutet nicht, dass es konkrete Ansätze zur Errichtung eines entsprechenden Systems nicht bereits lange vor der Schaffung der deutschen Nachkriegsordnung gegeben hätte. Eine wichtige Vorläuferfunktion im Hinblick auf die Normenkontrolle kam dem bayerischen Verfassungsgerichtshof zu. Hinsichtlich der gerichtlichen Erledigung bundesstaatlicher Streitigkeiten spielte der Weimarer Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich eine zentrale Rolle. Dabei han- —————— revolutionären Epoche, in der der Richterstand mehrheitlich als erbitterter Gegner liberaler Reformen auftrat (Cappelletti/Ritterspach 1971: 93–94). VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 237 delte es sich nicht lediglich um einen institutionellen Vorgänger von historischem Wert; vielmehr nahm das Bundesverfassungsgericht in der Frühphase seiner Tätig explizit auf die Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs Bezug (Starck 1990: 17). Dass sich die Vorgeschichte der modernen Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland schwerlich als kontinuierliche Erfolgsgeschichte lesen lässt, hat vor allem etwas mit dem folgenschweren Scheitern der PaulskirchenVerfassung und ihren weitreichenden Ambitionen auf Errichtung eines Systems der Verfassungskontrolle zu tun. Während des Bismarck-Reichs herrschte die Auffassung vor, dass Fragen der politischen Ordnung nicht von Richtern in Auseinandersetzung mit der Verfassung, sondern in der politischen Arena mit politischen Mitteln zu entscheiden seien. Die Entscheidungskompetenz bei Streitigkeiten zwischen Bundesgliedern wurde in die Hände des Bundesrates gelegt. Auch die Kompetenzen des Weimarer Staatsgerichtshofes reichten nicht über den Bereich staatsrechtlicher Streitigkeiten hinaus. Die Normenkontrolle wurde dem Reichsgericht anvertraut, und als »pouvoir neutre« im Weimarer System fungierte nicht der Staatsgerichtshof, sondern der Reichspräsident (Wehler 1979). Die Debatten über die Schaffung einer Verfassungsgerichtsbarkeit im Paulskirchen-Parlament standen noch stark unter dem Einfluss des amerikanischen Modells. Die Diskussionen im Parlamentarischen Rat, die sich in theoretischer Hinsicht primär am österreichischen Modell orientierten, wurden demgegenüber maßgeblich geprägt von den unmittelbaren Eindrücken des nationalsozialistischen Unrechtsregimes und dem Bestreben, an konstitutionelle Traditionen aus dem historischen Vorfeld der BismarckÄra anzuknüpfen (von Beyme 1988: 26, 33). Nichtsdestotrotz wurde die konkrete Ausgestaltung einer zu schaffenden Verfassungsgerichtsbarkeit kontrovers diskutiert. Nachdem sich das Konzept einer »wehrhaften Demokratie« als verfassungspolitische Präferenz der Mehrheit herauskristallisiert hatte, verlagerte sich die Auseinandersetzung bald auf die Frage nach der Aufteilung bzw. Zuweisung institutioneller Kompetenzen. Der Bundespräsident als potentieller »Hüter der Verfassung« schied aufgrund der problematischen Weimarer Erfahrungen rasch aus der Diskussion aus, ohne dass damit bereits die Basis für eine Einigung auf eine bestimmte Alternative gelegt war. Von Adenauer und Teilen der CDU wurde zeitweilig eine Lösung favorisiert, nach der der Bundesrat mit der Befugnis ausgestattet werden sollte, sämtliche Gesetzesbeschlüsse des Bundestages auf ihre Verfassungskonformität hin überprüfen und gegebenenfalls aufheben 238 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE zu können. Der Vorschlag entsprang freilich parteipolitischen Erwägungen (konkret der damaligen Dominanz der CDU auf Länderebene) und forderte folglich den Widerspruch der übrigen Parteien im Parlamentarischen Rat heraus. Schließlich fand die Zuweisung der obersten Aufsicht über das Grundgesetz an eine spezielle, eigenständige Institution die Unterstützung einer überfraktionellen Mehrheit, wobei die besondere politische Brisanz des Auswahlverfahrens für die Mitglieder des Gerichts von allen Beteiligten klar erkannt wurde (Niclauß 1998: 237–238). Die konkrete Ausgestaltung der Institution eines Bundesverfassungsgerichts legte der Parlamentarische Rat in die Hände des Gesetzgebers, der seinem Auftrag mit der Verabschiedung des (in der Folge mehrfach geänderten) Bundesverfassungsgerichtsgesetzes von 1951 nachkam. Zu den institutionellen Auffälligkeiten des Bundesverfassungsgerichts gehört aus international vergleichender Perspektive betrachtet dessen Konstruktion als »Zwillingsgericht«, das aus zwei Senaten mit exklusivem Zuständigkeitsbereich und eigenem Richterpersonal besteht. Die ursprünglich realisierte Arbeitsteilung zwischen beiden Senaten wies dem Ersten Senat eine sehr breit bemessene Entscheidungskompetenz zu, während der Zweite Senat sich ausschließlich den »politischen« Angelegenheiten wie der abstrakten Normenkontrolle oder Organstreitigkeiten zu widmen hatte. Wie einer der besten ausländischen Kenner der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit hervorgehoben hat, war diese organisatorische »Zweiteilung« gleichsam institutioneller Ausdruck der alten Auseinandersetzung zwischen denen, die das Gericht aus einer konventionell juristischen Perspektive sahen, und jenen, die dessen politischen Charakter betonten (Kommers 1997: 17). Die ursprüngliche Kompetenzstruktur erwies sich angesichts der chronischen Überlastung des Ersten Senats indes bereits nach wenigen Jahren als reformbedürftig. Der Zuständigkeitsbereich des Zweiten Senats wurde signifikant erweitert. Ferner wurde ein »Kammersystem« mit dem Ziel einer Vorprüfung von Verfassungsbeschwerden durch eine jeweils drei Richter umfassende »Kammer« eingerichtet; sowohl der Zuständigkeitsbereich als auch die Entscheidungskompetenz der Kammern wurden im Rahmen nachfolgender Rationalisierungsmaßnahmen ausgedehnt. Andere Veränderungen des institutionellen Profils des Gerichts betrafen die Anzahl und die zulässige Amtszeit von Richtern. Die ursprüngliche Anzahl von zwölf Richtern pro Senat wurde in zwei Schritten bis Anfang der sechziger Jahre auf acht reduziert. Auch von der Möglichkeit zu Le- VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 239 benszeiternennungen nahm man bereits zehn Jahre nach Errichtung des Gerichts zugunsten einer auf maximal zwölf Jahre beschränkten Amtszeit (ohne Möglichkeit der Wiederwahl) Abschied. Selbst die auf insgesamt 16 reduzierte Zahl von Richtern des Bundesverfassungsgerichts stellt im internationalen Vergleich noch einen Spitzenwert dar; er erscheint angesichts des weit überdurchschnittlich breiten Kompetenzprofils des Gerichts jedoch als vertretbar (Heun 2004: 215). Am nächsten kommt der personellen Ausstattung des Bundesverfassungsgerichts die fünfzehnköpfige Gruppe von Richtern am Obersten Gerichtshof Japans. Am vergleichsweise bescheidensten ist die Anzahl der Mitglieder des amerikanischen Supreme Court und des französischen Conseil constitutionnel mit jeweils neun. Einen Sonderfall bildet das Schweizerische Bundesgericht mit seinen 30 Mitgliedern, von denen jedoch nur ein kleiner Teil mit staats- und verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten befasst ist. Auch die zulässige zwölfjährige Amtszeit von Richtern des Bundesverfassungsgerichts erscheint im internationalen Vergleich als großzügig; sie wird formal (aber – mit Ausnahme der USA – nur vereinzelt in der Praxis) in jenen Ländern übertroffen, in denen es Berufungen auf Lebenszeit gibt (neben den USA auch Belgien und Österreich). Mit lediglich zwei Jahren außergewöhnlich kurz ist die Amtszeit der griechischen Richter, für die jedoch, analog zu den Regeln in einigen anderen Ländern mit eher kurzen Amtszeiten von Richtern, die Möglichkeit der Wiederwahl besteht. Zu den nach einhelliger Auffassung politischsten Aspekten der Organisation des Gerichts gehören die Regeln – und mehr noch die Praxis – der Richterbestellung. Dem formal vorgesehenen Verfahren, nach dem die eine Hälfte der Richter vom Wahlmännerausschuss des Bundestages183 und die andere Hälfte vom Bundesrat jeweils mit Zweidrittelmehrheit gewählt wird, entspricht in der Praxis ein hochgradig informalisiertes Verfahren, das stark im Zeichen einer proporzmäßigen Aufteilung der Richterstellen zwischen den beiden größen Parteien, CDU und SPD, steht (Helms 1999d: 147–148). Ein starker Einfluss parteipolitischer Eliten auf die Richterauswahl, mit häufig proporzorientiertem Ergebnis, kennzeichnet auch das Rekrutierungsverfahren in der Mehrzahl der anderen konsolidierten liberalen Demokratien. Das klassische Beispiel eines Systems mit einem politisierten, aber nicht im engeren Sinne parteipolitisierten Verfahren ohne Proporz verkörpern nach wie vor die USA. Die Auswirkungen der fast —————— 183 Bis 1956 war bei Richterwahl durch den Wahlmännerausschuss des Bundestages eine Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder erforderlich. 240 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE überall prominenten Rolle der Parteien im Rekrutierungsprozess sind umstritten: Gilt sie Kritikern als problematisches Strukturelement, welches sowohl die Integrität als auch das Ansehen der Richter beschädigt, so erscheint sie anderen Betrachtern als eine Komponente, die geeignet ist, die demokratische Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit institutionell zu stärken (von Brünneck 1992: 50). Durch eine beträchtliche Spannweite gekennzeichnet sind die Regeln für die Beteiligung unterschiedlicher staatlicher Akteure am Rekrutierungsverfahren. Eine Wahl der Richter durch das Parlament wie in der Bundesrepublik gibt es nur in der Schweiz und in Belgien. In den meisten anderen westeuropäischen Ländern wirken Legislative und Exekutive zusammen. Dieser Modus kennzeichnet auch das Verfahren in den USA, bei dem Präsident und Senat zur Kooperation gezwungen sind. Weniger üblich ist eine Konzentration der Rekrutierungskompetenzen bei der Bundesregierung, wie in Kanada und Australien, aber auch in Japan184, oder die Einbeziehung der Judikative in das Rekrutierungsverfahren, wie in Portugal und Spanien. Die – nicht nur aus deutscher Sicht – eigenartigste Variante der Richterrekrutierung findet sich in Griechenland, wo die Mehrheit der Richter des Sondergerichtshofes per Losverfahren aus der Gruppe der Richter an den obersten Gerichtshöfen des Landes bestimmt wird (Heun 2004: 218). Vor einer vergleichenden Betrachtung des Kompetenzprofils des Bundesverfassungsgerichts sei noch auf eine weitere, viel beachtete institutionelle Reform der internen Verfahrensorganisation des Gerichts hingewiesen: die 1970 geschaffene Möglichkeit zur Veröffentlichung »abweichender Voten«. Bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates spielte dieser Aspekt noch keinerlei Rolle. Ein entsprechender Plan wurde erstmals im Rahmen der Debatte über das Bundesverfassungsgerichtsgesetz von der SPD verfochten. Dabei scheiterten die Sozialdemokraten jedoch am Widerstand der Union, die den Vorschlag mit dem Hinweis auf befürchtete Autoritätseinbußen des Gerichts zurückwies (Lietzmann 1985: 53–54). Erst als die Christdemokraten 1969 selbst in die Opposition gerieten, gaben sie ihren Widerstand gegen das Institut der »abweichenden Voten« auf. Es ist im Übrigen kein Zufall, dass die Einführung des Sondervotums und die neue Amtszeitregelung für Mitglieder des Gerichts (Festsetzung der —————— 184 Angesichts der jahrzehntelangen Vormachtstellung einer einzigen Regierungspartei, der LDP, waren die Auswirkungen dieser Praxis in Japan besonders markant (Kudo 2004: 229–230). VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 241 Amtszeit auf maximal zwölf Jahre und Verbot der Wiederwahl) gleichzeitig vorgenommen wurden. Die Einführung des Sondervotums – zu der sich später auch eine Reihe anderer europäischer Länder entschloss (von Brünneck 1992: 48–52) – entsprang dem Wunsch nach mehr Transparenz und Offenheit des gerichtlichen Entscheidungsverfahrens. Da hierdurch einzelne Mitglieder des Gerichts ungleich stärker individuell exponiert werden, zielte die neue Amtszeitregelung auf eine zusätzliche Absicherung der richterlichen Unabhängigkeit (Rau 1996: 155–156). Von Ausnahmejahren abgesehen blieb die Quote veröffentlichter Minderheitenvoten seit 1971 im einstelligen Prozentbereich – ein gemessen an den deutlich höheren Zahlen im Ursprungsland des Sondervotums, den USA, bescheidener Wert. Dort findet regelmäßig weniger als die Hälfte aller Supreme Court-Entscheidungen die uneingeschränkte Unterstützung sämtlicher Richter. Die ungleich höhere Quote von »separate opinions« an den Entscheidungen des Supreme Court spiegelt nicht zuletzt die stark unterschiedlichen Rechts- und Rechtsprechungstraditionen beider Länder wider. Im Gegensatz zu den USA gilt für die Bundesrepublik, dass der gerichtliche Entscheidungsprozess seitens der Richterschaft traditionell als Kollegialaufgabe und der hierzulande weitaus üblichere Verzicht auf die Formulierung eines Minderheitenvotums gleichsam als Ausdruck »institutioneller Loyalität« betrachtet werden (Kommers 1997: 26). Das Kompetenzprofil des Bundesverfassungsgerichts erscheint im internationalen Vergleich als geradezu einzigartig großzügig. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen sowohl die Bund-Länder-Streitigkeiten und der Organstreit (als klassische Elemente der Staatsgerichtsbarkeit) als auch die abstrakte und konkrete Normenkontrolle. Hinzu kommt die Verfassungsbeschwerde, die es einer Einzelperson gestattet, sich nach Erschöpfung des Rechtsweges an das Bundesverfassungsgericht zu wenden, sofern sie sich in ihren Rechten verletzt sieht. Aus dem denkbaren Maximalensemble verfassungsgerichtlicher Zuständigkeiten fehlt nur die Popularklage, auf die bewusst verzichtet wurde, um das Gericht nicht in ungebührlicher Weise zur Anlaufstelle von diffusen Bürgerprotesten zu machen. Das Kompetenzprofil des Gerichts ist seit dessen Errichtung im Jahre 1951 praktisch unverändert geblieben. Die 1956 vom Bundestag beschlossene Aufhebung der Möglichkeit, den Bundespräsidenten bzw. die Bundesregierung mit juristischen Fachgutachten zu versorgen, stellt die einzige nennenswerte Korrektur am Zuständigkeitsbereich des Gerichts dar; sie erfolgte im Übrigen auf Anregung der Karlsruher Richter hin. 242 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Den meisten anderen Verfassungsgerichten bzw. obersten Gerichten der konsolidierten liberalen Demokratien fehlen gleich mehrere Zuständigkeiten, über die das Bundesverfassungsgericht verfügt.185 Als »eigentliche Besonderheit der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit« wurde in breit vergleichend angelegten Arbeiten die »Verbindung von institutioneller Selbständigkeit mit der Urteilsverfassungsbeschwerde und dem Organstreit« identifiziert (Wahl 2001: 51). Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht mit dem Organstreit und der Normenkontrolle – im Gegensatz zu den Verfassungs- bzw. obersten Gerichten anderer Länder – mit sämtlichen relevanten Rechtsprechungsaufgaben im genuin politischen Bereich betraut ist.186 Gemessen an der Anzahl vergleichender Studien über viele andere Institutionen der liberalen Demokratie steckt die komparative Erforschung der Rolle von Gerichten im politischen Entscheidungsprozess noch weitgehend in den Anfängen. Traditionell wurde bei der Suche nach grundlegenden, nicht lediglich situativ relevanten Erklärungsfaktoren für den unterschiedlichen Stellenwert von Verfassungsgerichten im politischen Prozess vor allem auf die Wirkungen unterschiedlicher Rechtskulturen rekurriert. In kritischer Reaktion auf diese enge bzw. verengte Sicht hat der griechische Verfassungsrechtsgelehrte Nicos C. Alivizatos für die parlamentarischen Demokratien Westeuropas eine statistisch-empirische Bestandsaufnahme der potentiellen Prägefaktoren vorgelegt, in der auch eine Reihe anderer möglicher Einflüsse gemessen wurden (Alivizatos 1995). Zu den bei Alivizatos (zusätzlich) berücksichtigten Variablen gehören: der institutionelle Dezentralisierungsgrad der staatlichen Ordnung eines Landes, der Polarisierungsgrad des Parteiensystems, die Anzahl von »Veto- —————— 185 Das gilt selbst für die funktional am engsten mit dem Bundesverfassungsgericht verwandten Schwesterinstitutionen, die Verfassungsgerichte Österreichs, Italiens und Spaniens. Keines der Verfassungsgerichte dieser Länder verfügt über die Möglichkeit des Parteiverbots, die dem Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 21, Abs. 2 GG offensteht. Der österreichische Verfassungsgerichtshof ist überdies auch nicht mit Organstreitigkeiten befasst. Vor dem italienischen Corte costituzionale sind demgegenüber keine Verfassungsbeschwerden möglich. Als eigentlicher »Zwillingsbruder« des Bundesverfassungsgerichts erscheint das weitgehend nach seinem Vorbild geschaffene spanische Tribunal constitucional. 186 Ein Vergleich unterschiedlicher Verfahrensarten in der Praxis hat zu der These geführt, dass die abstrakte Normenkontrolle jene Verfahrensart darstelle, bei der das Gericht prinzipiell am stärksten gezwungen sei, sich politisch zu exponieren (Kommers 1997: 28). VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 243 spielern« innerhalb eines Systems187, das Ausmaß »parlamentarischer Anomalien« seit dem Ersten Weltkrieg (Erfahrungen eines Landes mit Diktaturen oder undemokratischen Regimewechseln), schließlich der Einfluss des europäischen Gemeinschaftsrechts und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dabei gelangt Alivizatos zu dem Ergebnis, dass »gerichtlicher Aktivismus« – unter sonst gleichen Bedingungen – vor allem das Produkt dreier Einflussvariablen ist: eines hohen Grades an Dezentralisierung der staatlichen Ordnung, eines hinsichtlich der Links-RechtsDimension hochgradig polarisierten Parteienwettbewerbs sowie einer großen Anzahl von Vetospielern (ebd.: 586). Die Bundesrepublik erscheint dabei als einer jener seltenen Fälle, in dem (mit nur geringfügigen Einschränkungen hinsichtlich des Kriteriums »Polarisierungsgrad des Parteiensystems«) alle institutionellen Faktoren, die eine starke Justizialisierung strukturell begünstigen, gegeben sind. Wer den hohen Stellenwert des Bundesverfassungsgerichts im politischen Prozess der Bundesrepublik erklären will, wird jedoch über rein institutionelle Erklärungsfaktoren hinausgreifen müssen. Vor allem ausländische Beobachter haben den rasanten Aufstieg der Verfassungsgerichtsbarkeit im westlichen Teil Deutschlands nach 1945 in einen engen Zusammenhang mit den ansehnlichen ökonomischen Erfolgen der deutschen Nachkriegsdemokratie gerückt. Bei Martin Shapiro (2002: 159) erscheint dieser Faktor gar als die wichtigste Erklärung für die rasche Verwurzelung der Verfassungsgerichtsbarkeit – »people who are getting rich find it easy to love rights«, wie der Autor spitz formuliert. Als mindestens vergleichbar wichtig wie die ökonomischen Rahmenbedingungen gilt jedoch die Wirkung kultureller Faktoren – konkret die vor allem in der frühen Nachkriegszeit noch auffallend »unpolitische« und wenig demokratiefreundliche politische Kultur der Deutschen. Demnach ist das hohe Ansehen des Gerichts in beträchtlichem Maße auf den ausgeprägten Legalismus und die überwiegend negativen Einstellungen der Bevölkerung zu politischen Konflikten zurückzuführen (von Bryde 2002: 340). Die These passt zu den Befunden der jüngeren empirischen Forschung, welche zeigen konnte, dass das Vertrauen in die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit hoch ist »und dies auf lange Sicht auch unabhängig von konkreten Entscheidungen, —————— 187 Darunter werden in Anlehnung an die Unterscheidung bei Tsebelis (2002) sowohl »partisan vetoplayers« – die Anzahl der Regierungsparteien – als auch »institutional veto players« – wie Staatsoberhäupter oder vetomächtige »zweite Kammern« – verstanden (ebd.: 583). 244 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE ihrer Akzeptanz oder ihrer Ablehnung« (Vorländer/Schaal 2002: 368). Entscheidend für den politisch-gesellschaftlichen Erfolg des Bundesverfassungsgerichts (und mit ihm des abstrakteren Konzepts der Verfassungsgerichtsbarkeit) war ferner die Integrität und Kompetenz seines Personals. Das Bundesverfassungsgericht »konnte eine Autorität, die es im Grunde eher undemokratischen Traditionen verdankt, nutzen, die Deutschen zur Demokratie zu erziehen« (Bryde 1999: 201). Ein wichtiger Impuls ging dabei nicht zuletzt von den zahlreichen kontrovers diskutierten Urteilen des Gerichts aus. Sie waren dafür verantwortlich, dass das Gericht nicht nur wesentlichen Anteil an der politischen Integration, sondern zugleich an der im engeren Sinne demokratischen Integration des Gemeinwesens hatte (Vorländer/Schaal 2002: 370). In politikwissenschaftlichen Bestandsaufnahmen der Funktionen des Bundesverfassungsgerichts im politischen System erscheint die Integrationsfunktion freilich nur als eine neben zahlreichen anderen. Uwe Kranenpohl (2004: 44) nennt derer nicht weniger als acht (mit allerdings vermeidbaren Überschneidungen zwischen den einzelnen unterschiedenen Funktionen). Keineswegs völlig verschieden von der Situation in anderen Ländern, konzentrierte sich die öffentliche und fachwissenschaftliche Aufmerksamkeit auf die Rolle des Gerichts im legislativen Prozess (von Beyme 2001b: 501–504; Landfried 1984, 1988). Über die, gemessen an der Häufigkeit und Prominenz der Beteiligung des Gerichts an politischen Entscheidungen, ausgeprägte Justizialisierung des politischen Prozesses besteht heute weitgehende Einigkeit. Gestritten wird zum einen über die Gründe, zum anderen über die Auswirkungen des nach verbreiteter Einschätzung übermäßig weitreichenden Einflusses des Gerichts. Im Rahmen der Diskussion der Ursachen der prominenten Rolle des Gerichts im politischen Entscheidungsprozess wurde dem populären Vorwurf eines ungebührlichen Aktivismus der Richter die These vom Missbrauch des Gerichts durch die Politik entgegengesetzt (Limbach 1999). Nicht minder konträr sind die Standpunkte im Hinblick auf die Wirkungen der Justizialisierung. In den Augen vieler Beobachter führt die ausgreifende Aktivität des Bundesverfassungsgerichts mit zunehmender Zeitdauer zu einer bedenklichen Begrenzung der dem parlamentarischen Gesetzgeber offenstehenden gestalterischen Alternativen (Landfried 1994b: 119). Andere Autoren bewerten das Verhalten des Gerichts deutlich positiver, im Sinne einer »Verteidigung der Politik gegenüber dem Attentismus der Parteiendemokratie« (Guggenberger 1998: 210). Dabei erscheinen Einmischungen des Gerichts VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 245 als eine – prinzipiell willkommene – »nachholende Politisierung«, der zumeist kompensatorische Züge eigen seien (ebd.: 212; vgl. von Brünneck 1992: 153–184). Kaum weniger umstritten ist die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht lediglich ein »Parallelgesetzgeber« bzw. »Ersatzgesetzgeber« oder gar eine »Gegenregierung« bzw. ein »Gegengesetzgeber« sei. Nicht von der Hand zu weisen ist die Tatsache, dass es immer wieder aufsehenerregende Einzelentscheidungen des Gerichts gegeben hat, mit denen Mehrheitsbeschlüsse des parlamentarischen Gesetzgebers verfassungsrechtlich angefochten wurden. Gerade in den neunziger Jahren gab es wiederholt Anzeichen einer »antizyklischen Urteilspolitik« (Guggenberger 1998: 208). In der jüngeren Vergangenheit gehörten dazu etwa Entscheidungen zur Hochschulgesetzgebung der rot-grünen Bundesregierung (Juniorprofessur, Studiengebühren), ferner das Urteil über das auf höchst eigentümliche Weise zustande gekommene »Zuwanderungsgesetz« (Starck 2003). Weiter ausgreifende historische Bestandsaufnahmen zeichnen jedoch insgesamt ein anderes Bild. Nach einer Untersuchung von Göttrik Wewer (1991) tendierte das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesrepublik eher dazu, die grundlegenden Weichenstellungen politischer Mehrheiten durch seine Spruchpraxis zu unterstützen, anstatt die Position einer »Gegenregierung« einzunehmen. Dies wurde mit dem Bestreben des Gerichts erklärt, sein hohes öffentliches Ansehen durch eine möglichst geschmeidige Einfügung in das politisch-soziale Kräftefeld zu bewahren bzw. zu befördern. Die auffallend kritische Haltung des Gerichts gegenüber zahlreichen Reformmaßnahmen der sozial-liberalen Koalition (Biehler 1990) ließe sich demnach aus der Stärke der Christdemokraten nicht nur im Bundestag, sondern auch und vor allem in den Ländern und im Bundesrat erklären. Als praktisch unvermeidliche Folgewirkung einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit gilt heute die inhaltliche und formale Verrechtlichung des politischen Prozesses: »In the end, governing with judges means also governing like judges«, wie Alec Stone Sweet (2000: 204) in seiner viel beachteten Studie hierzu lakonisch feststellt. Angesichts der kennzeichnenden Verbindung besonders weitreichender verfassungsgerichtlicher Kompetenzen und günstiger politisch-gesellschaftlicher Rahmenbedingungen der Verfassungsgerichtsbarkeit kann es kaum überraschen, dass Deutschland sowohl im Hinblick auf die inhaltliche als auch die formale Verrechtlichung des politischen Prozesses (im Sinne einer großen Bedeutung verfas- 246 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sungsrechtlicher Argumente im Rahmen politischer Auseinandersetzungen) als Musterbeispiel dieser internationalen Entwicklungstendenz gilt (von Brünneck 1992: 130–131). 9.5 Konklusion Die Verfassungsgerichtsbarkeit, insbesondere in ihrer institutionell verselbständigten Variante, gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Erfindungen der jüngeren Geschichte der liberalen Demokratie. Theoretisch für das Gedeihen eines Regimes liberal-demokratischer Prägung nicht zwingend erforderlich, ist die Verfassungsgerichtsbarkeit in den vergangenen Jahrzehnten gleichwohl immer mehr zu einem festen Bestandteil der Idee der liberalen Demokratie und ihrer institutionellen Konkretisierung geworden. Das belegen nicht zuletzt die Verfassungsneugründungsprozesse in den jungen Demokratien Osteuropas. Kaum ein Land verzichtete auf die Schaffung eines Verfassungsgerichts, und in vielen Ländern spielten gerade die Verfassungsgerichte eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung der neuen Ordnung (Brunner 1993; Schwartz 1998).188 Obwohl in Deutschland die Rechtsstaatlichkeit historisch bedeutend größergeschrieben wurde als die Demokratie, blieb der deutsche Beitrag zur Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit bis nach 1945 bescheiden. Umso bemerkenswerter ist es, dass das Bundesverfassungsgericht als institutioneller Träger der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik nicht nur die international bekannteste Einrichtung der gesamten deutschen Nachkriegsordnung (Fromont 1999: 493) wurde, sondern darüber hinaus zu einem wichtigen Referenzmodell für die Schaffung ähnlicher Einrichtungen in anderen Ländern avancierte (Tomuschat 2001: 245, 266). Der heute unbestreitbar zentrale Stellenwert des Bundesverfassungsgerichts als Teil des politischen Systems der Bundesrepublik und als politischer Akteur im staatlichen Entscheidungsprozess passt zu den wenigen Thesen, die die vergleichende Politikwissenschaft über die institutionellen —————— 188 Freilich werden auch die Wirkungen der Verfassungsgerichtsbarkeit in diesen Ländern nicht ausnahmslos positiv beurteilt. Als problematisch gilt insbesondere der Effekt der Verfassungsgerichte dieser Region auf die demokratische Beteiligung und den öffentlichen demokratischen Diskurs über gesellschaftlich umstrittene Themen (Sadurski 2005). VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT 247 Bedingungen einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit hervorgebracht hat. Danach begünstigt die Existenz einer föderativen Ordnung nicht nur die Schaffung eines institutionell selbständigen Verfassungsgerichts, sondern kommt zugleich dessen Position im politischen Prozess zugute: »A constitutional court that is both a rights and a division of powers court is in the best position because, even if its decisions along one of these two dimensions engenders majority opposition, its institutional integrity may be defended by those who want it to act along the other« (Shapiro 2002: 183). Die eigentliche Anziehungskraft des deutschen Modells der Verfassungsgerichtsbarkeit resultierte freilich weniger aus dem institutionellen Regelwerk als vielmehr aus der positiven Leistungsbilanz des Gerichts in der Verfassungspraxis, zu der auch eine bemerkenswerte Dichte und Komplexität der Verfassungsrechtsprechung gehört (Starck 1990: 23). Zur wichtigsten jüngeren Bewährungsprobe des etablierten Systems der Verfassungsgerichtsbarkeit im nationalstaatlichen Rahmen wurde der Prozess der deutschen Vereinigung (Johnson 1994; H. Meyer 2001). Die insgesamt erfolgreiche Bewerkstelligung der neuartigen Herausforderungen durch das ausschließlich mit »Westjuristen« besetzte Gericht wurde als Beleg für die These gewertet, dass der institutionellen Loyalität von Verfassungsgerichten zur Verfassung – ganz besonders in politischen und gesellschaftlichen Umbruchsituationen – im Zweifelsfall eine deutlich größere Bedeutung zukomme als dem biographischen Hintergrund der Richter (Bryde 1999: 205, 208–210). Der Vorbildcharakter, den das Bundesverfassungsgericht im Verhältnis zu den Verfassungsgerichten vieler anderer Demokratien der Nachkriegszeit entfaltete, ist mit dafür verantwortlich, dass auf dem Feld der Verfassungsgerichtsbarkeit – abgesehen von deren historischen Entstehungsbedingungen – noch seltener als im Falle der meisten anderen Kerninstitutionen der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik nach Einflüssen anderer Systeme gefragt wurde. Am ehesten zu entdecken sind spezifische Befruchtungen durch ausländische Entwicklungen auf der Ebene einzelner Aspekte der Gerichtsorganisation wie hinsichtlich der Anzahl und Amtszeit von Richtern. Ein unvergleichlich größeres Gewicht kam und kommt den tief greifenden Auswirkungen der europäischen Integration und dem Aufstieg einer supranationalen europäischen Gerichtsbarkeit für das Selbstverständnis und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts zu. Die Beziehungen zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof entwickelten sich in Etappen und keineswegs 248 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE frei von Widersprüchen (Sturm/Pehle 2005: 131–151; Büdenbender 2005; Scharf 2006). Dabei gingen die Karlsruher Richter phasenweise immer wieder auch auf Konfrontationskurs, nicht zuletzt getragen von dem Bestreben, die deutschen Grundrechte vor den Wirkungen europäischer Rechtsakte zu schützen. Dem entsprach eine Reihe kaum weniger offensiver Urteile des in Luxemburg ansässigen Gerichts, in denen deutsche Gesetze oder sogar einzelne Bestimmungen des Grundgesetzes für unvereinbar mit den europäischen Rechtsnormen erklärt wurden. Von spektakulären Einzelentscheidungen gegensätzlicher Natur abgesehen, beschreibt die dominante Entwicklungsdynamik der vergangenen Jahre die Herausbildung eines mehr oder minder friedlichen Kooperationsverhältnisses zwischen Karlsruhe und Luxemburg. Dieses basiert freilich auf der lange Zeit verweigerten grundsätzlichen Anerkennung der Höherrangigkeit europäischen Rechts gegenüber deutschem Recht durch das Bundesverfassungsgericht, dessen Aufgabe innerhalb eines zunehmend stärker »europäisierten» deutschen Regierungssystems somit im Kern darin besteht, den Schutz des Grundgesetzes zu gewährleisten, soweit dieses europäischem Recht nicht entgegensteht. 10 De-Institutionalisierung und Internationalisierung als Gefährdungen der liberalen Demokratie? Die in den vorausgehenden Kapiteln mehr oder minder isoliert voneinander betrachteten politischen Institutionen der Bundesrepublik fügen sich in der Verfassungstheorie und -praxis zu einem komplexen System zusammen. Ihm sind spezifische Züge eigen, die wiederum vor allem im Rahmen vergleichender Betrachtungen zutage treten. Die zentralen strukturellen und funktionalen Merkmale dieses Systems waren in den vergangenen Jahrzehnten so oft und intensiv Gegenstand der politikwissenschaftlichen Forschungsdebatte, dass es unnötig erscheint, sie hier noch einmal ausführlich zu beleuchten. Lediglich stichwortartig sei an einige der großen Referenzklassifizierungen erinnert. Dazu gehört etwa Manfred G. Schmidts (1996) einflussreiche Charakterisierung der Bundesrepublik als eines »grand coalition state«, womit – in Anknüpfung und Zuspitzung der früheren Befunde vor allem Gerhard Lehmbruchs (1976) – auf die spezifischen, nicht zuletzt institutionell bedingten Aushandlungszwänge im parlamentarischen Bundesstaat abgehoben wurde. Bereits Ende der achtziger Jahre argumentierte Heidrun Abromeit in ähnlicher Richtung, nahm dabei aber eine wichtige Akzentuierung vor. Mit Blick auf die langjährige Vormachtstellung der Christdemokraten im deutschen Parteiensystem sprach Abromeit (1989: 176) von einer »asymmetrischen Konkordanz«. Im Falle einer SPD-geführten Regierung im Bund seien (fast) alle relevanten Parteien am staatlichen Entscheidungsprozess beteiligt, im Falle von unionsgeführten Regierungen hingegen nicht (ebd.: 178) – eine Einschätzung, der knapp zwei Jahrzehnte später wenig Prinzipielles hinzuzufügen ist. Eine breitere Perspektive liegt der international einflussreichen Charakterisierung der Bundesrepublik als eines »semisovereign state« (Katzenstein 1987) zugrunde. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um eine auf die Verhältnisse im Innern, nicht auf die internationale Ebene bezogene Bewertung. Sie berücksichtigt zusätzlich zu den institutionellen Spezifika des deutschen Regierungssystems die Besonderheiten gesellschaftlicher 250 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Organisation und stellt das eigentümliche Zusammentreffen eines dezentralisierten Staates mit einer zentralisierten Gesellschaft als Besonderheit der deutschen Nachkriegsdemokratie heraus. Die jüngere, an die große Studie Katzensteins anschließende bzw. auf diese bezogene Forschung – Hervorhebung verdient der Band von William Paterson und Simon Green (2005) – hat sich vor allem auf die »policy«-bezogenen Effekte der innerstaatlichen »Semisouveränität« konzentriert. Galt die für die alte Bundesrepublik charakteristische Macht gesellschaftlicher Interessen bei Katzenstein als eines der Geheimnisse der sozioökonomischen Erfolgsgeschichte der deutschen Nachkriegsdemokratie, so fällt das diesbezügliche Urteil der meisten Beobachter über das vereinigte Deutschland deutlich skeptischer aus. Nicht zuletzt auf sprachlicher Ebene direkt an Katzenstein schließt ein weiterer Verortungsvorschlag Manfred G. Schmidts (2002: 176) an, bei der die Bundesrepublik – auf breiter internationaler Vergleichsgrundlage – als »semisouveräne Demokratie« klassifiziert wird, gemeinsam mit einer Reihe anderer Länder wie den USA, Italien oder der Schweiz. Dabei geht es um den Grad, in dem das Volk bzw. demokratische Mehrheiten in Regierung und Parlament im Hinblick auf ihre strukturellen Handlungsspielräume innerhalb eines Systems entscheidungssouverän sind.189 In funktionaler Hinsicht erscheint die Bundesrepublik im internationalen Vergleich deshalb nicht zufällig als ein System, in dem die Inklusion und Repräsentation unterschiedlicher politisch-gesellschaftlicher Kräfte besonders großgeschrieben werden, während es um die Transparenz und Zurechenbarkeit von Entscheidungen sowie um die politische und institu- —————— 189 Freilich ließen sich all diese und andere Charakterisierungen ausführlich kritisieren. Das gilt selbst für die besonders instruktive Differenzierung Schmidts zwischen »souveränen« und »semisouveränen Demokratien«. Wenn angesichts der hohen Anzahl von institutionellen Vetospielern ein System wie die Schweiz als »semisouveräne Demokratie« bezeichnet wird, so wird damit eine wesentliche Eigenschaft des schweizerischen Regierungssystems eher verschleiert als erhellt. Im Vergleich mit anderen gegenwärtigen liberalen Demokratien erscheint die Schweiz als ein System, in dem das Volk vermittels eines imposanten Arsenals an »Volksrechten« über eine geradezu einzigartige Souveränität bei der Herbeiführung gesamtgesellschaftlich verbindlicher Entscheidungen, auch gegenüber der Regierung, verfügt (Trechsel/Sciarini 1998; Fossedal 2002). Für die Schweiz wäre im Gegensatz zu anderen, stärker repräsentativdemokratisch beschaffenen Systemen wie der Bundesrepublik deshalb treffender von einer signifikant reduzierten Handlungssouveränität des Staates bzw. der staatlichen Lenkungsinstitutionen Regierung und Parlament – nicht der Demokratie – zu sprechen. DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 251 tionelle Innovations- und Reformfähigkeit des Systems eher mäßig bestellt ist. Freilich gehört zu den Ergebnissen der vergleichenden Demokratieforschung auch die Einsicht, dass sich ein weitgehender Verzicht auf institutionelle Barrieren gegen Mehrheitsherrschaft, wie es die Westminster-Demokratien kennzeichnet, bei der Bewältigung grundlegender politisch-gesellschaftlicher Herausforderungen langfristig nicht unbedingt als Vorteil erweisen muss. Die schnellere Reaktionsfähigkeit stark gewaltenkonzentrierender Systeme muss um den Preis einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von »policy failures« und unzähligen Nachbesserungen politischer Programme erkauft werden – ganz zu schweigen von der ausgeprägten Tendenz reiner Mehrheitsdemokratien, eine im wahrsten Sinne des Wortes exklusive Politik zu betreiben (Schmidt 1992: 209–220; Abromeit 1992b; Lijphart 1999: 275–300). Die mit diesen Bewertungen aufgeworfenen Fragen böten Stoff für ausgreifende Betrachtungen, die sich letztlich um die alte Frage nach der besten Regierungsform, ihren Eigenschaften und Voraussetzungen, drehen würden. Es wäre sehr im Sinne des Verfassers, würden die vorausgehenden Kapitel als Beitrag auch zu dieser Diskussion aufgenommen. Anstelle einer Vertiefung dieser Aspekte sollen im Zentrum dieses Schlusskapitels jedoch andere Fragen stehen, die an Beiträge und Perspektiven der jüngeren internationalen Forschung anknüpfen. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem »governance«-Paradigma zu. Vertretern des »governance«-Ansatzes geht es darum, durch einen theoretisch-konzeptuellen Perspektivwandel den von ihnen perzipierten jüngeren Entwicklungstendenzen in demokratischen Systemen (sowie gegebenenfalls in nicht-demokratischen oder nicht-staatlichen Regimen) Rechnung zu tragen.190 Kennzeichnend für Ansätze dieser Richtung ist das Streben nach Erfassung politischer Entscheidungsprozesse auch und insbesondere jenseits des staatlichen Entscheidungssystems, unter gezielter Berücksichtigung der Rolle gesellschaftlicher Akteure. Wenn von »governance« statt von »government« gelegentlich auch im Hinblick auf politische Entscheidungsprozesse innerhalb des staatlichen Entscheidungssystems gesprochen wird, beispielsweise von »coalition governance« (Müller/Strøm 2000c), so geschieht dies in der Absicht, die gegebenenfalls große Bedeutung verfassungsrechtlich bzw. institutionell nicht —————— 190 Vgl. aus der Fülle einschlägiger Veröffentlichungen mit dem Anspruch einer theoretischen Charakterisierung und Verortung des »governance«-Ansatzes etwa van Kersbergen/van Waarden (2004), Benz (2004), Kjær (2004), von Blumenthal (2005). 252 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE vorgesehener Entscheidungswege und -praktiken hervorzuheben. Aus der Perspektive der auf politische Institutionen konzentrierten Demokratieforschung ließe sich das (oder zumindest ein Teil dessen), was verbreitet als »governance« bezeichnet wird, in alternativer Terminologie als schleichende De-Institutionalisierung bzw. De-Konstitutionalisierung des demokratischen Prozesses beschreiben – im Sinne einer »Auswanderung der Politik aus den Institutionen« (von Blumenthal 2002) bzw. einer »Auswanderung der Politik aus der Verfassung« (Saalfeld 1997).191 Die hiermit im Zusammenhang stehenden Aspekte sind Gegenstand des nächsten Abschnitts. Wie gezeigt werden soll, resultieren wichtige Erscheinungsformen der De-Institutionalisierung politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung in den liberalen Demokratien aus Prozessen einer fortschreitenden Internationalisierung. Der Ausblick der Studie nimmt diesen Befund zum Anlass, um weitere Auswirkungen der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Internationalisierung auf die liberale Demokratie zu erörtern. 10.1 Manifestationen und Grenzen der De-Institutionalisierung als »Auswanderung der Politik aus der Verfassung« Die Beschäftigung mit De-Institutionalisierung erweist sich nicht zuletzt deshalb als schwierig, weil einschlägige Fragen seit vielen Jahren von unterschiedlichen Disziplinen behandelt werden, ohne dass daraus irgendein interdisziplinär akzeptierter Basiskonsens über grundlegende Aspekte der Thematik entsprungen wäre. Intensiv über Fragen der De-Institutionalisierung gearbeitet wurde vor allem in der politischen Soziologie. Sie begreift Prozesse der De-Institutionalisierung verbreitet als eine nachlassende gesellschaftliche Bindungswirkung bestimmter Normen öffentlichen Verhaltens. Ein solches Verständ- —————— 191 Ein wichtiges Merkmal des »governance«-Paradigmas – seine Konzentration auf Aspekte der Problemlösung, welche potentiell auf Kosten der Berücksichtigung von Aspekten politischer Herrschaft (wie Strategien der Machtsicherung und Machterweiterung von Akteuren) geht (Mayntz 2004) – teilen die meisten der stärker in der traditionellen Regierungslehre verwurzelten Beiträge zum Phänomen der De-Konstitutionalisierung bzw. De-Institutionalisierung von Politik und Demokratie nicht. DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 253 nis kennzeichnet auch die soziologisch beeinflusste Untersuchung des Zeithistorikers Peter Steinbach über Kontinuität und Wandel politischer Institutionen in Deutschland, in der vor allem »die sozialrevolutionär legitimierte Deinstitutionalisierung alter Normengefüge« im Zuge der Institutionalisierung nationalsozialistischer Herrschaft behandelt wird (Steinbach 1997: 243). Auch in soziologischen Studien, die den Akzent (selten genug) auf die organisatorisch sich manifestierenden Institutionen selbst legen, wird ein Verständnis von De-Institutionalisierung begründet, dem hier nicht gefolgt werden soll. Das gilt etwa für eine Arbeit von Birgitta Nedelmann (1996: 25), die unter anderem den Mitgliederschwund politischer Parteien als »De-Institutionalisierung« bezeichnet – ein Phänomen, das nach Auffassung des Verfassers besser mit Begriffen wie institutioneller bzw. organisatorischer Wandel beschrieben ist.192 Sofern es um De-Institutionalisierung im Sinne einer Informalisierung von politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen geht, haben vor allem Beiträge aus der Rechtswissenschaft die Parameter der disziplinenübergreifenden Diskussion bestimmt.193 Die bislang erst zum Teil elaborierten Positionen der Politikwissenschaft lassen sich gut in direkter Abgrenzung gegenüber den unterschiedlichen Komponenten des rechtswissenschaftlichen Dogmas greifbar machen. Vor allem zwei Aspekte scheinen dabei erwähnenswert: Erstens wird informales Handelns staatlicher Akteure, anders als in weiten Teilen der Rechtswissenschaft, keineswegs als »staatliches Agieren außerhalb von ›Spielregeln‹« (Wallerath 2003: 99) gesehen. Auch informale Politik kennt Regeln. Sie sind gegebenenfalls flexibler, aber weder zwangsläufig weniger verbindlich noch weniger effektiv als formale Regeln. Zweitens steht in der Politikwissenschaft (und den Sozialwissenschaften insgesamt) informales Handeln nicht prinzipiell unter dem Verdacht, potentiell problematisch zu sein. Grundsätzliche Vorbehalte gegenüber informalen Verfahren und Institutionen finden sich noch am ehesten in Teilen der politikwissenschaftlichen Demokratisierungsfor- —————— 192 Das gilt im Übrigen gerade dann, wenn Institutionen nicht ohne weiteres mit Organisationen gleichgesetzt werden, wofür vor allem weite Teile der Soziologie plädieren. Dann kann die Institution Partei auf unterschiedliche Weise, unter Umständen auch mit sehr wenigen Mitgliedern, organisatorische Gestalt annehmen. 193 Als wichtigstes Referenzwerk auf der interdisziplinären Verständigungsebene kann nach wie vor die große Studie von Schultze-Fielitz (1984) gelten. Der zentrale Stellenwert dieses Werkes ist nicht zuletzt auf die wenig formalistische Art der Betrachtung zurückzuführen, die sie von zahlreichen anderen Beiträgen aus der Rechtswissenschaft abhebt. 254 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE schung, obwohl die schematische Gegenüberstellung von »guter« und »schlechter« Informalität in der jüngeren Literatur auch mit Blick auf politische Prozesse in »Transformationsländern« und jungen Demokratien zunehmend aufgegeben wird (von Steinsdorff 2005; Helmke/Levitsky 2006; Meyer 2006). Die im Vergleich zur Rechtswissenschaft insgesamt bedeutend größere »Offenheit« der Politikwissenschaft gegenüber Manifestationen des Informalen bildet einen Reflex der stärker funktional als positivistisch-normativ geprägten Betrachtung.194 Aus Differenzierungen wie diesen ergibt sich jedoch noch kein hinreichend präziser Zugriff auf den Gegenstand. Im Rahmen dieser Schlussbetrachtung soll der Begriff der De-Institutionalisierung auf das Phänomen der De-Konstitutionalisierung konzentriert werden. Gemeint ist die »Auswanderung« bzw. »Auslagerung von Politik aus den verfassungsrechtlich vorgezeichneten Bahnen«. Damit ist der Fokus der Betrachtung einerseits enger als möglich, zugleich aber auch klarer. Ausgeklammert bleiben Auflösungsprozesse informaler Institutionen, die zu keinem Zeitpunkt auf konstitutioneller Ebene verankert waren. Eine weitere Spezifizierung ergibt sich daraus, dass der Schwerpunkt nicht auf Prozessen liegt, die zwingend als »außerhalb der Verfassung stehend« im Sinne von »verfassungswidrig« zu klassifizieren wären. Dazu ist unter dem Leitbegriff der »Korruptionsforschung« in den vergangenen Jahren eine umfangreiche interdisziplinäre Spezialliteratur entstanden (etwa von Alemann 2005; Kawata 2006). Wie steht es nun in empirischer Hinsicht um die De-Institutionalisierung in der Bundesrepublik und den anderen konsolidierten liberalen Demokratien? Wenig empirische Evidenz gibt es für eine jüngere, länderübergreifende Tendenz zur De-Institutionalisierung innerhalb des staatlichen Entscheidungssystems. Das gilt insbesondere dann, wenn in Anlehnung an Majid Sattars Konzept der Informalisierung nur solche Prozesse als DeInstitutionalisierung bewertet werden, »bei [denen] formale Kommunikations- und Handlungsstrukturen durch informale ersetzt werden – und nicht lediglich ergänzt, also komplementiert werden« (Sattar 2001: 17). In —————— 194 Korrekterweise ist hinzuzufügen, dass auch in Teilen der jüngeren rechtswissenschaftlichen Literatur der positivistische Normbegriff (welcher unterstellt, dass Normen eine fertige Identität besitzen) zunehmend durch stärker interpretative Vorstellungen ersetzt wird. Demnach ist eine Norm immer erst das Produkt ihrer konkreten Anwendung, so dass folglich auch formales Recht stets nur durch Anwendungsakte wirkt. Vgl. Morlok (2003: 57). DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 255 Deutschland sind solche Entwicklungen nicht zuletzt deshalb vergleichsweise unwahrscheinlich, weil hierzulande stets ein ausgeprägtes Bedürfnis der politischen Eliten existierte, wichtige Entwicklungen der Verfassungspraxis möglichst zeitnah auch in der geschriebenen Verfassung zu kodifizieren.195 Davon zeugt die im internationalen Vergleich große Zahl an Änderungen des Grundgesetzes (Busch 2006). In ihnen sind viele Wünsche nach Konstitutionalisierung, die von der Politik oder auch der Wissenschaft formuliert wurden, noch nicht einmal enthalten. Zu den jüngeren Vorstößen gehört, neben zahlreichen Initiativen zur Aufnahme weiterer Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz, der Vorschlag, die prominente Rolle der (künftigen) Mehrheitsfraktionen im Regierungsbildungsprozess auch verfassungsrechtlich anzuerkennen (Zuck 1998). Grundsätzlich spricht viel dafür, Informalisierungsprozesse vor allem in Bereichen zu erwarten, in denen wenig verfassungsrechtliche »Nachführung« von Entwicklungen der Verfassungspraxis betrieben wird. Wohl nicht zufällig handelt es sich bei der Regierung um jenen Bereich des politischen Systems der Bundesrepublik, in dem es auffallend wenige formale Verfassungsänderungen gegeben und sich ein ungewöhnlich dichtes Netz (teils institutionalisierter) informaler Beziehungsstrukturen entwickelt hat. Einschlägige Studien belegen jedoch, dass es selbst auf diesem Feld keinen linearen oder speziell jüngeren Entwicklungstrend im Sinne einer fortschreitenden De-Konstitutionalisierung gibt. Buchstäblich »von Beginn an« (ab dem 1. Bundestag) gab es die für alle parlamentarischen Demokratien übliche funktionale Integration von Regierung und Mehrheitsfraktionen, die innerhalb der Wissenschaft mittlerweile nur noch von Teilen der Rechtswissenschaft als problematische Abweichung vom »alt-liberalen« Gewaltenteilungsmodell des Grundgesetzes bewertet wird.196 Auch speziellere Formen der intra-gouvernementalen Koordination – im Stile von »Koalitionsrunden« und »Küchenkabinetten« – stellen keineswegs eine Erfindung der jüngeren Vergangenheit dar (Rudzio 2002; Müller/Walter 2004). Im Übrigen hat es immer wieder Phasen der relativen De-Informalisierung gegeben – eine Dynamik, die zuletzt im Rahmen eines Vergleichs —————— 195 Vgl. hierzu prinzipiell und kritisch Hennis (1968). 196 Vgl. etwa Ruffert (2002: 1146); die politikwissenschaftliche Gegenposition wurde vielfach formuliert unter anderem von Eberhard Schuett-Wetschky (2000, 2005). Erstaunlicherweise fungiert das »alt-liberale«, auf Regierung und Bundestag bezogene Gewaltenteilungsmodell innerhalb der Bevölkerung nach wie vor verbreitet als Referenzmodell (Patzelt 1998b). 256 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE der Informalisierung des Exekutivbereichs unter den Kanzlern Kohl und Schröder zu beobachten war (Helms 2005d). Festzuhalten ist schließlich, dass die jeweils gefundenen informellen Lösungen das Gerüst formaler Regeln üblicherweise eher ergänzten als vollständig ersetzten bzw. politisch bedeutungslos machten. Die im Vergleich zu Einheitsstaaten deutlich größere Komplexität von bundesstaatlich organisierten Gemeinwesen macht den Aufbau und die Pflege informaler Beziehungen zwischen Akteuren der unterschiedlichen Ebenen föderaler Systeme praktisch unverzichtbar. Gleichwohl ist auch die langfristige Entwicklung im Bereich der »inter-governmental relations« in Bundesstaaten nicht durch eine eindeutige Tendenz in Richtung einer zunehmenden De-Institutionalisierung gekennzeichnet. Spektakuläre Beispiele für umfangreiche, informell betriebene Veränderungen jenseits formaler Verfassungsänderungen sind auf Einzelfälle wie insbesondere Kanada (Smith 2002) beschränkt. Gelegentlich kommt es, wie in anderen Bereichen auch, zur Herausbildung informaler Regeln, die später durch eine Verfassungsreform »eingefangen« werden. Das gilt auch für die Bundesrepublik, wo bestimmte Komponenten des »kooperativen Föderalismus« seit den fünfziger Jahren zunächst informell praktiziert wurden, bevor sie schließlich Eingang in das Grundgesetz fanden (Hesse/Renzsch 1990: 62; Abromeit 1992a: 58). Insofern lässt sich mit Gerhard Lehmbruch (1999b) von einer »Institutionalisierung der Verhandlungsdemokratie« durch die Regierung Kiesinger sprechen, in deren Zuge freilich auch eine Reihe vollständig neuartiger Kooperationsmechanismen, wie die »Gemeinschaftsaufgaben«, geschaffen wurden. Auch für die meisten anderen der hier interessierenden Länder lassen sich, aus unterschiedlichen Gründen, keine signifikanten jüngeren Tendenzen der De-Institutionalisierung im Sinne einer Auswanderung bzw. Auslagerung von Politik aus der Verfassung erkennen. Für die kleine Gruppe konsolidierter Demokratien ohne geschriebene Verfassung (Großbritannien, Neuseeland, bis 1975 auch Schweden) stellt sich streng genommen nicht einmal das Problem. Die gerade in Deutschland so prominente Betrachtung und Problematisierung des Spannungsverhältnisses zwischen Verfassungspraxis und geschriebener Verfassung würde dort (ganz wörtlich) auf Unverständnis stoßen. Dieses ist freilich nicht größer als dasjenige, das deutsche und andere kontinentaleuropäische Betrachter befällt, wenn sie bei der Suche nach dem Verfassungsbegriff des Vereinigten Königreichs auf die entwaffnende Definition eines führenden Verfassungsge- DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 257 lehrten stoßen, »the Constitution is what happens« (J.A.G. Griffith, zit. bei Rose 1996: 165). Grundlegende Unterschiede zur deutschen Entwicklung sind jedoch nicht auf die »verfassungslosen« Staaten der angelsächsischen Länderfamilie beschränkt. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, jenem Land mit der ältesten noch geltenden geschriebenen Verfassung überhaupt, überwiegen die Unterschiede zur deutschen Verfassungspolitik, obwohl es freilich auch markante Ähnlichkeiten wie die zentrale Rolle der Gerichte für den Prozess des Verfassungswandels gibt. Die auffallend geringe Deckungsgleichheit zwischen dem geschriebenen Verfassungsrecht und der amerikanischen Verfassungspraxis erklärt sich nicht nur aus den besonders hohen Hürden der formalen Verfassungsänderung, sondern auch daraus, dass eine größtmögliche Übereinstimmung zwischen der Verfassungspraxis und der geschriebenen Verfassung in den USA nicht einmal als Zielnorm akzeptiert ist. Gerade für die Vereinigten Staaten gilt im Übrigen, dass einige der Meilensteine der De-Konstitutionalisierung – wie die Geburt der »legislative presidency« (Wayne 1978), von der die geschriebene Verfassung nichts ahnen lässt – bereits vor vielen Jahrzehnten gelegt wurden und keineswegs eine jüngere Erscheinung darstellen. Von einem jüngeren Phänomen könnte allenfalls mit Blick auf das hohe Alter der US-Verfassung gesprochen werden.197 Als ein der Bundesrepublik im Hinblick auf die Frequenz von Verfassungsänderungen diametral entgegengesetzter Fall erscheint – trotz augenfälliger Parallelen des politischen und verfassungsrechtlichen Neubeginns nach 1945198 – Japan. Dort gab es seit 1947 nicht eine einzige formale Verfassungsänderung (Masing 2005: 1), übrigens in konsequenter Fortfüh- —————— 197 Das scheint prima vista die These nahe zu legen, dass die Wahrscheinlichkeit weitreichender Emanzipationen der Verfassungspraxis aus den Vorgaben des formalen Regelwerks mit dem Alter einer Verfassung zunimmt. Gerade im Hinblick auf die Stärkung (eines Teils) der Exekutive gibt es jedoch gewichtige Gegenbeispiele, darunter vor allem die V. Republik Frankreich, wo sich die weit über die formalen Kompetenzen des Amtes hinausreichende Machtposition des Präsidenten im Zuge der »Präzedenz-Präsidentschaft« Charles de Gaulles herausbildete. Sie suggerieren, dass ein hohes Alter der Verfassung keine notwendige Bedingung entsprechender Wandlungsprozesse darstellt. 198 Ein tiefer gehender deutsch-japanischer Vergleich eröffnet freilich die Einsicht, dass die Unterschiede in der Entwicklung beider Länder während der frühen Nachkriegszeit, nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Rolle der Amerikaner, beträchtlich waren. Vgl. in diesem Sinne Fukaya (2001) und Furuta (2001). 258 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE rung der Verfassungspolitik früherer Jahrzehnte, denn schon die erste moderne Verfassung Japans von 1889 erfuhr in mehr als einem halben Jahrhundert keinerlei textliche Veränderung. Sie erschien den Japanern gleichsam als »heilige und unverletzbare Schrift«, als »oberster Befehl des Kaisers«, dem gegenüber unbedingter Gehorsam zu leisten war (Inoue 2004: 105–106). Dabei gilt der Konstitutionalismus in Japan bis heute als ein Stück fremder Kultur, der sich das Land gegen Ende des 19. Jahrhundert zunächst nur deshalb annahm, um das damals wichtigste Staatsziel, die Revision ungleicher Handelsverträge mit Europa und Amerika, zu erreichen (ebd.: 112). Die jüngeren politisch-historischen Entwicklungen in Japan sind aus vergleichender Perspektive vor allem deshalb interessant, weil sie ein ungewöhnlich reiches Anschauungsmaterial sowohl für den Prozess der De-Konstitutionalisierung bzw. Informalisierung wie für jenen der Re-Konstitutionalisierung im Sinne einer Zurückdrängung informaler Regeln bergen. Über vergleichbare Erfahrungen dürfte von den westeuropäischen Ländern allein Italien – vor und nach der »partitocrazia« – verfügen. Die während der Regierungszeit Koizumis (2001–2006) eingeleiteten Schritte zu einer Re-Konstitutionalisierung politischer Willensbildungsund Entscheidungsprozesse blieben freilich eingebettet in ein nach wie vor hochgradig informalisiertes System und in ihren Wirkungen entsprechend begrenzt (Köllner 2006). Die bisherigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass Fragen der DeInstitutionalisierung auf der konstitutionellen Ebene nicht ohne Berücksichtigung der zum Teil grundverschiedenen »Verfassungskulturen« von Ländern diskutiert werden können. Dazu gehört zunächst der bereits angesprochene, sehr unterschiedlich ausgeprägte Drang politischer Eliten nach Konstitutionalisierung von als politisch relevant erachteten Aspekten des öffentlichen Zusammenlebens. Auf der Ebene der Gesellschaft kommt jedoch noch etwas anderes hinzu – das, was Peter Häberle (1998: 90) in seiner großen Studie »Verfassungslehre als Kulturwissenschaft« als »die Summe der subjektiven Einstellungen, Erfahrungen und des Denkens sowie des (objektiven) Handelns der Bürger und Pluralgruppen, der Organe des Staates etc. im Verhältnis zur Verfassung als öffentlichem Prozeß« bezeichnet. Andere Autoren mit ähnlichen Erkenntnisinteressen bevorzugen im Rahmen terminologischer Annäherungsversuche den älteren Begriff der politischen Kultur und bemühen sich in historisch und international vergleichenden Studien um die Klärung des Verhältnisses zwischen Verfassung und politischer Kultur bzw. um die Bestimmung des Stellen- DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 259 wertes der Verfassung für eine bestimmte politische Kultur (Franklin/ Baun 1995; Gebhardt 1999a). Dieses Schlusskapitel bietet keinen Raum, um die unterschiedlichen Aspekte dieses faszinierenden Themenfeldes detaillierter zu untersuchen. Zumindest vor einem nahe liegenden Kurzschluss sei jedoch gewarnt: Aus deutscher Perspektive ist man versucht, das hohe Maß an »Verrechtlichung« bzw. Konstitutionalisierung politisch-gesellschaflicher Bereiche einerseits und den zentralen Stellenwert der Verfassung im öffentlichen Bewusstsein199 andererseits als zwei Seiten derselben Medaille zu sehen, welche auch in anderen Ländern eine gleichsam »natürliche Verbindung« eingehen. Dies ist indes nicht der Fall, wie insbesondere das Beispiel der USA lehrt. Dort koexistiert ein im internationalen Vergleich auffallend kurzes Verfassungsdokument mit einer ausgesprochen zentralen Position der Verfassung im öffentlichen Bewusstsein. In der Literatur werden deshalb Deutschland und die USA (wie im Übrigen auch die Schweiz) einhellig den »verfassungszentrierten politischen Kulturen« zugerechnet (Gebhardt 1999b), in Abgrenzung gegenüber politischen Kulturen, in denen anderen Begriffen bzw. Konzepten eine bedeutendere Rolle zukommt als der Verfassung. Als »Prototyp« dieser zweiten Gruppe gilt Frankreich. Zwar lässt sich für die V. Republik von einem wachsenden Respekt gegenüber dem Verfassungstext sprechen, wofür vor allem die Arbeit des Verfassungsrates seit den frühen siebziger Jahren verantwortlich war. Nach wie vor behaupten im Bewusstsein der französischen Öffentlichkeit die ideellen Konzepte der Republik und der Nation jedoch einen höheren Stellenwert als dasjenige der Verfassung (Kimmel 1996). Stärkere Anzeichen für eine Auslagerung politischer Willensbildungsund Entscheidungsprozesse aus der Verfassung finden sich im Verhältnis von staatlichen Institutionen bzw. Akteuren einerseits und Akteuren des privaten Sektors andererseits.200 Dabei gibt es durchaus eine Reihe jüngerer —————— 199 Die Debatte in der Bundesrepublik drehte sich vor allem um das schillernde Konzept des »Verfassungspatriotismus«, welches von Autoren wie Dolf Sternberger (dem Schöpfer des Begriffs) und Jürgen Habermas mit unterschiedlicher politischer Akzentuierung wirkungsmächtig vertreten wurde. Obwohl sich seit der deutschen Vereinigung beide Varianten (wenn auch unterschiedlich stark) erschöpft haben, behauptet das Konzept einen festen Platz innerhalb der jüngeren, breit geführten Patriotismusdiskussion. Vgl. dazu mit zahlreichen weiteren Nachweisen Rößler (2006) und Kronenberg (2006). 200 Es sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es hier um Entscheidungen geht, die offiziell nach wie vor im Namen des Staates erfolgen. Außer Frage 260 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Entwicklungen, die sich eher als eine Re-Konstitutionalisierung des politischen Prozesses im Sinne eines graduellen Bedeutungsverlusts informaler (aber gleichwohl weitgehend institutionalisierter) Arrangements deuten ließen. Gemeint sind die seit den achtziger Jahren verbreitet zu beobachtenden Auflösungsprozesse im Verhältnis von Staat und Verbänden wie sie sich in der ausgeprägten internationalen Tendenz zum Rückbau klassisch tripartistischer Arrangements manifestieren. Diese Prozesse wurden vielerorts begleitet von einer abnehmenden »Verbandsdurchdringung« von Parteien und Parlamenten und einer weitreichenden Schwächung der Gewerkschaften auf praktisch sämtlichen Ebenen (Thelen 2001). Insofern ließe sich ein Trend in Richtung einer strukturellen Verschlankung bzw. Schwächung des in den ersten Nachkriegsjahrzehnten nicht nur in Deutschland gefürchteten (speziell gewerkschaftlich dominierten) »Verbändestaats«201 konstatieren, dem eine relative Stärkung staatlicher Handlungssouveränität gegenüber gesellschaftlichen Akteuren entspräche. Dies ist jedoch nur die halbe Geschichte der jüngeren Veränderungen im Verhältnis von Staat und Akteuren des privaten Sektors. Der Verringerung des institutionalisierten Einflusses insbesondere der Gewerkschaften in Westeuropa vollzog sich gleichsam im Schatten eines international beobachteten strukturellen Machtzuwachses anderer Akteure, allen übrigen voran einzelner, global agierender Großunternehmen. Die Basis für die signifikante Zunahme von Firmenmacht bildet vor allem die nachhaltige Veränderung der globalen Produktionsmärkte. Zu den zentralen Eigenschaften hochgradig internationalisierter Märkte gehört ein signifikant erhöhtes Maß an Unsicherheit und Schnelllebigkeit. Viele der großen Firmen reagieren darauf mit Strategien der »Individualisierung«, mit einem Streben nach maximaler Flexibilität und Freiheit von wie auch immer gearteten Normen und Regeln (Crouch 2003: 201–202). Aus Sicht der Unternehmen sind mit der Globalisierung der Märkte jedoch keineswegs ausschließlich Restriktionen verbunden. Sie eröffnet zugleich neue Spielräume: —————— steht, dass es im Zuge umfangreicher Privatisierungs- und »contracting out«-Prozesse seit den achtziger Jahren in zahlreichen Politikfeldern (vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Energie und Verkehr) zur Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf Akteure des privaten Sektors gekommen ist. Dies geschah jedoch nicht im Zuge schleichender De-Institutionalisierung, sondern auf dem geordneten Wege parlamentarischer Gesetzgebung. 201 Zu den letzten großen Zeugnissen dieser Richtung gehören die beiden Bände von Hennis/Kielmansegg/Matz (1977, 1979). DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 261 Wer mit den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, den geltenden Umweltstandards und nicht zuletzt der Höhe der Unternehmensbesteuerung in einem Land nicht zufrieden ist, kann eine Verlagerung von Investitionen und Produktionsstätten in ein anderes Land erwägen. Regierungen nationalstaatlich organisierter Gemeinwesen müssen ein Interesse daran haben, dies zu verhindern. Zu den klassischen Instrumenten ihrer Politik gehören moralische Appelle und eine Gesetzgebung, die um einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen der vetomächtigen Unternehmen und den Interessen der Bevölkerung bemüht ist. Hinzu kommen jedoch informelle Verhandlungen, an deren Ende häufig sogenannte normersetzende oder normvermeidende Absprachen stehen. Der im Einzelfall verbleibende (autonome) Handlungsspielraum von Regierungen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nicht ohne Bedeutung ist die Größe des öffentlichen Unternehmenssektors in einem Land. Sie kann jedoch nur als eine grobe Orientierungsmarke hinsichtlich der Beschaffenheit des Handlungskorridors von Regierungen gelten, die im Kontext anderer Variablen zu betrachten ist. Wiederum spielen historische und kulturelle Determinanten eine wichtige Rolle. Dies zeigt etwa der Fall Spaniens als eines der westeuropäischen Länder mit einer hohen Privatisierungsquote und einem vergleichsweise kleinen Sektor öffentlicher Unternehmen (Czada 2003: 418). Die umfangreichen Privatisierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre waren dort keineswegs von einer radikalen Liberalisierung des Marktes begleitet, sondern fanden gleichsam im Schatten einer »post-autoritären«, etatistischen Entscheidungskultur statt. Einerseits behielt die Regierung wichtige Mitentscheidungsrechte bis in den Bereich der Personalrekrutierung auf Unternehmensebene in ihren Händen; andererseits blieb die Politik vieler privater Großfirmen durch eine Haltung geprägt, die von außenstehenden Beobachtern als »remarkably timid, deferential towards government«202 beschrieben wurde. Gewisse Spielräume bei der Ausgestaltung des konkreten Verhältnisses zwischen dem Staat und nicht-staatlichen Akteuren gibt es freilich auch auf Seiten der Regierung. Das zeigt schon ein Vergleich des sehr unterschiedlichen Umgangs mit Akteuren des privaten Sektors durch die Regierungen Kohl und Schröder (Helms 2005d). Der Befund passt zu der »Parteiendifferenz«-These, nach der von linken Parteien geführte Regierungen in stärkerem Maße als konservative bzw. bürgerliche Regierungen dazu neigen, —————— 202 The Second Transition – A Survey of Spain, in: The Economist vom 26.06.2004, 4. 262 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE staatlich-gesellschaftliche Verhandlungen zu führen (Seeleib-Kaiser 2002). Dieser Faktor (dessen Wirkung sich im Zuge der »Verbürgerlichung« sozialdemokratischer Parteien jedoch abgeschwächt hat) ist im Zusammenwirken mit dem Wechsel der parteipolitischen Zusammensetzung von Regierungen mit dafür verantwortlich, dass es weder in der Bundesrepublik noch anderswo einen strikt linear verlaufenden Entwicklungstrend in Richtung einer De-Konstitutionalisierung politischer Entscheidungsprozesse gibt. Im Gegensatz zu den unterschiedlichen Anzeichen von De-Konstitutionalisierung innerhalb des staatlichen Entscheidungssystems (wie die Kooperation zwischen Regierung und Mehrheitsfraktionen), die heute praktisch nur noch »konservativen« Rechtswissenschaftlern als problematisch gilt, geht mit einer Informalisierung des Verhältnisses zwischen Regierungen und ausgewählten privaten bzw. privatwirtschaftlichen Akteuren die Gefahr einer Verletzung zentraler Grundnormen demokratischer Politik einher. Hinzuweisen ist zunächst auf den Bedeutungsverlust demokratischer Kontrolle und Transparenz, der mit außerparlamentarischen Verhandlungen zwischen Regierungen und Akteuren des privaten Sektors einhergeht. Dieses Problem ist nicht neu. Es betraf schon die »klassischen« Varianten korporatistischer Interessenvermittlung. Im Vergleich zu den »echten« – tripartistischen – Formen des Korporatismus, welche die Interessen von Arbeit und Kapital jedenfalls auf der Ebene der strukturellen Konfiguration entsprechender Bündnisse gleichberechtigt berücksichtigen, kommt bei den jüngeren Erscheinungsformen der Verhandlungsdemokratie jedoch die Gefahr einer einseitig an den Interessen internationalisierter Unternehmen ausgerichteten Politik des Staates hinzu. Für manche Betrachter, wie Colin Crouch (2004), bildet der Machtzuwachs global agierender Konzerne sogar die zentrale Triebfeder einer fundamentalen Transformation der repräsentativen, sozialstaatlich ausgestalteten Demokratie hin zu einer »post-demokratischen« Form der Regierung, die unter anderem durch gravierende Verzerrungen der Durchsetzungschancen organisierter Interessen, eine weitgehende Nichtberücksichtigung der Interessen von Arbeitnehmern, ein rückläufiges Maß an Umverteilung und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen sowie eine verbreitete politische Apathie des Volkes gekennzeichnet ist. Reformpolitische Patentlösungen für dieses Problem scheint es nicht zu geben. Als Alternative zu einer im deutschen Kontext vorgeschlagenen, jedenfalls teilweisen »Konstitutionalisierung der Verhandlungsdemokratie« DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 263 (Grimm 2003)203, welche außerhalb Deutschlands verbreitet auf institutionell und politisch-kulturell bedingte Vorbehalte treffen dürfte, bliebe möglicherweise lediglich auf eine normativ fundierte Selbstbeschränkung der mächtigen Unternehmen zu hoffen. Dass es sich dabei nicht um eine substanzlose Wunschutopie handelt, suggerieren einige Beiträge aus dem Umfeld der »governance«-Forschung. Danach gibt es im Rahmen entwickelter Zivilgesellschaften auf unternehmerischer Seite offenbar ein gewisses Interesse daran, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit als »gutes« Unternehmen dazustehen (van Kersbergen/van Waarden 2004: 163–164). 10.2 Ausblick – Die liberale Demokratie vor den Herausforderungen der Internationalisierung von Politik, Ökonomie und Gesellschaft Die soeben beschriebene Gefährdung der demokratischen Komponenten der liberalen Demokratie als mittelbare Folge einer internationalisierten Ökonomie bezeichnet nur eine von zahlreichen Wirkungen der Internationalisierung. Ihre Manifestationen und Effekte sind vielfältig und scheinbar allgegenwärtig. Dies hat in den vergangenen Jahren zu einer beispiellosen Blüte von Studien über Ursachen, Manifestationen, Folgen und Probleme der Internationalisierung bzw. Globalisierung geführt, die schwerpunktmäßig Aspekte der Problemlösungsfähigkeit und der materiellen Politik (»policy«) auf der nationalen wie internationalen Ebene behandeln.204 Daran ist hier nicht anzuknüpfen. In Übereinstimmung mit den grundlegenden thematischen Parametern dieser Studie konzentrieren sich die nachfolgenden Betrachtungen vielmehr auf die »polity-« und »politics«-bezogenen Aspekte der multidimensionalen Internationalisierung in den nationalstaatlich verfassten konsolidierten liberalen Demokratien. Dabei geht es um eine komprimierte problemorientierte Rekonstruktion, die vor allem die pro- —————— 203 Besonders hervorhebenswert erscheint der Vorschlag, normvermeidende bzw. normersetzende Absprachen zwischen Regierungen und vetomächtigen Akteuren des privaten Sektors nachträglich zu veröffentlichen und, analog zu den Regelungen bei Gesetzen, dem Prinzip der verfassungsgerichtlichen Normenkontrolle zu unterwerfen (ebd.: 208–209). 204 Vgl. statt vieler mit zahlreichen weiteren Nachweisen Held/McGrew (2003) und Glatzer/Rueschemeyer (2005). 264 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE blematischen Aspekte bzw. Effekte der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Internationalisierung in den Blick nimmt.205 Sie sollen danach differenziert werden, welche Wirkung sie auf die liberalen Komponenten der liberalen Demokratie einerseits und deren demokratischen Komponenten andererseits haben. Verschieben sich die grundlegenden Parameter in Richtung De-Demokratisierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der liberalen Komponenten liberaler Demokratie, womit – unabhängig von der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates auf der Ebene materieller Politik206 – so etwas wie eine historische Rückwärtsbewegung bezeichnet wäre? Unübersehbar sind die restriktiven Auswirkungen der politischen Internationalisierung auf die demokratischen bzw. demokratiebezogenen Komponenten nationalstaatlich verfasster liberal-demokratischer Regime. Politische Internationalisierung betrifft die Bundesrepublik (wie die übrigen Mitgliedstaaten der EU) am unmittelbarsten in Form der europäischen Integration und der »Europäisierung«.207 Die auf der Ebene der Europäischen Union produzierten Entscheidungen sind zwar keineswegs durch eine vollständige Abwesenheit politischer Legitimität gekennzeichnet, doch handelt es dabei – in der Terminologie der jüngeren Demokratietheorie – schwerlich um präferenzbezogene, über einen anspruchsvollen demokratischen Prozess erzeugte »input«-Legitimität, sondern vor allem um eine interessenbasierte »output«-Legitimität (Scharpf 1999: 10–21). Das Ausmaß des europäischen Demokratiedefizits (welches theoretisch und empirisch —————— 205 Dabei steht außer Frage, dass die Internationalisierung, speziell in ihren in Europa zu beobachtenden Erscheinungsformen, nicht ausschließlich problematische bzw. negative Effekte zeitigt. Zu den positiv zu bewertenden Aspekten der Internationalisierung gehören nicht zuletzt das beispiellose Maß an internationaler Freizügigkeit von Personen, die Entstehung einer internationalen »Friedenszone« sowie Anzeichen eines wachsenden Bewusstseins internationaler Solidarität. 206 Diese Dimension des Verhältnisses zwischen Internationalisierung und Liberalisierung im Sinne eines Rückbaus der »sozialen Demokratie« zugunsten einer lediglich »liberalen Demokratie« thematisieren unter anderem Streeck (1998) und, stärker empirisch, Brady/Backfield/Seeleib-Kaiser (2004). 207 In Abgrenzung gegenüber anderen Verständnissen (vgl. etwa Beck/Grande 2004) wird hier davon ausgegangen, dass es sich bei »Europäisierung« nicht um eine regional spezifizierte Form von Transnationalisierung bzw. Supranationalisierung handelt. In Übereinstimmung mit der Mehrheitsmeinung in der jüngeren Literatur werden darunter vielmehr die Rückwirkungen der europäischen Integration auf die unterschiedlichen Dimensionen von Politik (Strukturen, Prozesse und Inhalte) in den EU-Mitgliedstaaten verstanden (Featherstone 2003: 7; Vink 2003). DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 265 abzugrenzen ist gegenüber einem möglichen Legitimitätsdefizit) ist Gegenstand wiederkehrender Kontroversen in der internationalen Europaliteratur.208 Selbst die großzügigste Auslegung könnte jedoch schwerlich zu dem Ergebnis gelangen, dass sich die Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse auf der Ebene der Union durch ein besonders hohes Maß an demokratischer Qualität auszeichnen. Zweifel erscheinen schon an der demokratischen Qualität der unzähligen Nicht-Regierungs-Organisationen angezeigt, die verbreitet geradezu als Verkörperung zivilgesellschaftlich basierter demokratischer Einflussnahme auf staatliche oder quasi-staatliche Entscheidungen gelten, obwohl bei näherer Betrachtung viele von ihnen selbst grundlegende Merkmale demokratischer Organisation vermissen lassen (Greven 2000, 2002; Grant 2002). Kaum je in Frage standen die spezifischen Demokratiedefizite auf der Ebene des supranationalen Entscheidungssystems im engeren Sinne. Von den EU-Institutionen genießt (seit 1979) nur das Europäische Parlament eine direkte demokratische Legitimation. Diese wird zudem eingeschränkt (oder zumindest spezifisch modifiziert) durch Unterschiede in den nationalen Regelungen für die Wahl des Europäischen Parlaments, die ausgeprägte Dominanz innenpolitischer Themen im Europawahlkampf, die Abwesenheit europäischer Parteien sowie schließlich das Fehlen einer echten Parteienkonkurrenz im Sinne von Regierung und Opposition. Auf entscheidungspolitischer Ebene kommt hinzu, dass sich gerade die vergleichsweise weitreichenden Mitwirkungs- und Kontrollrechte des Europäischen Parlaments im Rahmen des sogenannten Kodezisionsverfahrens nicht auf sämtliche »Säulen« bzw. Politikfelder erstrecken, auf denen die EU aktiv ist – ein Umstand, der durch geschickte Strategien des Parlaments, seine formal verbürgten Mitwirkungsansprüche gelegentlich auf informellem Wege auszuweiten (Tömmel 2006: 123–126), nicht zu kompensieren ist.209 Spezifische budgetäre Restriktionen und die fehlende Kompetenz des Europäischen Parlaments zur selbständigen Gesetzesinitiative runden das Bild ab. —————— 208 Eine skeptische Position formulieren – in gezielter Auseinandersetzung mit optimistischeren Deutungen (Majone 1998; Moravcsik 2002) – neben vielen anderen Follesdal/Hix (2006). 209 Selbst wenn es zu den im Verfassungsentwurf von 2004 vorgesehenen Reformen – der Erhebung des Kodezionsverfahrens zum regulären Gesetzgebungsverfahren der EU – käme, wäre damit keine vollständige Gleichberechtigung des Parlaments gegenüber dem Rat erreicht, da die Entscheidungen in zahlreichen Bereichen (so insbesondere in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik) keinen Gesetzescharakter besitzen. 266 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Diese Defizite werden bislang kaum ansatzweise durch eine angemessene Stärkung der nationalstaatlichen Parlamente aufgefangen.210 Als besonders defizitär erscheint die Struktur formaler Kontrollrechte in jenen Ländern Westeuropas, die der EU im Rahmen der »Süderweiterung« beitraten (Maurer 2002: 351, 379–381). In einer Reihe anderer Länder mit auffallend großzügig bemessenen Kompetenzprofilen von Parlamenten (darunter die Bundesrepublik, Österreich und Finnland) sorgte dagegen vor allem die Existenz eines breiten parteienübergreifenden europapolitischen Konsenses dafür, dass die parlamentarische Kontrolldichte gegenüber dem europapolitischen Handeln der Regierung insgesamt eher moderat blieb (ebd.: 382).211 Von landesspezifischen Besonderheiten abgesehen, besteht seit langem ein breiter Konsens der Forschung darüber, dass zu den zentralen innerstaatlichen Auswirkungen der europäischen Integration die Stärkung der Exekutive (gegenüber der Legislative und anderen Akteuren) gehört (Moravscik 1997; Dreier 2002, Helms 2005e: 399–402). Die im engeren Sinne institutionellen Manifestationen der »Europäisierung« auf die nationalstaatlichen Parlamente – vom Transfer legislatorischer Kompetenzen nach Brüssel und Straßburg bis hin zu den negativen Effekten des »qualified majority voting« und der zeitlichen und administrativen Überlastung der Parlamente durch die Flut an EU-Vorlagen (Kassim 2005: 297–298) – werden ergänzt durch wichtige Sekundäreffekte der europäischen »Gipfeldiplomatie«. Dazu zählen der erweiterte Informationsvorsprung der Exekutive und das gesteigerte öffentliche Prestige von Spitzenvertretern der Regierung in der Auseinandersetzung mit anderen Akteuren des Systems, die sich auch im Rahmen »rein innenpolitischer« Konflikte als wichtig erweisen können.212 Somit lässt sich zusammenfassend folgern, dass sowohl die (weiter oben behandelte) ökonomische Internationalisierung als auch die politische Internationalisierung einer De-Parlamentarisierung und damit letztlich —————— 210 Sie würden es selbst im Falle einer Implementation der im Verfassungsentwurf von 2004 vorgesehenen institutionellen Reformen nicht, obwohl mit ihnen graduelle Verbesserungen verbunden wären (Kneip/Petring 2006). 211 Vgl. für detaillierte Analysen der »Europäisierung« des Deutschen Bundestages Saalfeld (2003), Sturm/Pehle (2005: 63–84) und Auel (2006). 212 Es entbehrt nicht der Ironie, dass ausgerechnet diese originär »europäisierungsbedingte« Veränderung in Teilen der Öffentlichkeit bzw. der Fachöffentlichkeit weniger als »Europäisierung« denn als »Amerikanisierung« wahrgenommen wird. Vgl. Abschnitt 7.4. DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 267 einer De-Demokratisierung politischer Entscheidungsprozesse in den liberalen Demokratien (mit EU-Mitgliedschaft) Vorschub leisten.213 Daneben gibt es mindestens eine weitere Dimension der faktischen DeDemokratisierung in den konsolidierten liberalen Demokratien. Sie steht im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Internationalisierung. Gemeint ist der Umstand, dass ein signifikanter Teil der in den konsolidierten liberalen Demokratien lebenden Bevölkerung über kein Wahlrecht zu den nationalen Parlamenten verfügt, obwohl auch er den Gesetzen des betreffenden Staates unterworfen ist und über Steuern und Abgaben gegebenenfalls auch die von staatlicher Seite angebotenen Leistungen mitfinanziert. Dadurch wird der Grundgedanke der Demokratie als institutionalisierte Volksherrschaft, nach der das Volk als Summe der Regierten das Recht besitzt, vermittels der Teilnahme an Wahlen die Auswahl der Regierenden zu bestimmen, strukturell beeinträchtigt. Das »Volk« und die »Regierten« sind nicht vollständig deckungsgleich. Ursächlich hierfür ist im Kern die gesellschaftliche Internationalisierung in Gestalt zwischenstaatlicher Migration. In der jüngeren Demokratietheorie wird kaum mehr bestritten, dass die nationale Identität von Menschen, die Zugehörigkeit zu einem Volk prinzipiell veränderbar und wesentlich kulturell bedingt ist (Benhabib 2002). »Identität ist nichts, was durch die Natur definiert wird – Identität ist durch Kultur bestimmt. Kultur aber ist immer im Fluss, ist niemals fertig. Und deshalb bestimmt Politik mit, worauf sich eine konkrete Identität richtet. Deshalb ist Politik auch ein Faktor, der bestimmt, wer zu einem Volk gehört.« (Pelinka 2003: 46) Das entscheidende formale Bestimmungskriterium der Zugehörigkeit einer Person zu einem Volk – und damit in aller Regel auch zur Gruppe der Wahlberechtigten (sofern nicht ein altersbezogener Ausschlussgrund vorliegt) – bildet die Staatsbürgerschaft.214 Bei der Ausgestaltung des Staats- —————— 213 Auch im Hinblick auf die politischen Prozesse innerhalb nationalstaatlich organisierter liberaler Demokratien bleibt indes offen, inwieweit damit zugleich eine De-Legitimierung politischer Institutionen, Prozesse und Entscheidungen verbunden ist. Im Lichte einer jüngeren einschlägigen Studie (Schneider u.a. 2006) gibt es – in deutlichem Gegensatz zu den kritischen Stimmen aus der Wissenschaft – auf der Ebene des öffentlichen gesellschaftlichen Diskurses in (ausgewählten) konsolidierten Demokratien bislang praktisch keinerlei Anzeichen für eine als solche perzipierte Legimitationskrise nationalstaatlicher Politik. 214 Ausnahmen von dieser Regel gibt es international am ehesten auf kommunaler Ebene, deutlich seltener hingegen bei der Ausgestaltung des Wahlrechts für Wah- 268 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE bürgerschaftrechts in den konsolidierten liberalen Demokratien gibt es grundlegende Unterschiede – nicht zuletzt hinsichtlich der Schwierigkeit, als Ausländer in den Besitz der Staatsbürgerschaft des betreffenden Landes zu gelangen. Das Staatsgehörigkeitsrecht der Bundesrepublik gehört »zu den restriktivsten der EU« (Green 2006: 115); bis zum Jahr 2000 war keine Möglichkeit vorgesehen, die deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund der Geburt im Inland zu erwerben.215 Auch die international übliche Koppelung des Wahlrechts (auf gesamtstaatlicher Ebene) an den Besitz der Staatsbürgerschaft ist freilich nicht prinzipiell dem politischen Gestaltungswillen des Gesetz- bzw. Verfassungsgesetzgebers entzogen. Denkbar sind – wie der neuseeländische Fall zeigt – auch eine Entkoppelung von Staatsbürgerschaft und politischer Bürgerschaft und die Bindung letzterer an den Wohn- und Arbeitsort (Pelinka 2003: 53).216 Die zwischenstaatliche Migration innerhalb Europas und nach Europa, insbesondere Westeuropa, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert. Längst sind auch klassische »Auswanderungsländer« wie Spanien, Portugal oder Irland zu »Einwanderungsländern« geworden. Die vier westeuropäischen Länder mit dem höchsten Anteil von Ausländern an der Bevölkerung (Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien) liegen im weltweiten Ranking der Einwanderungsstaaten gleich hinter den USA (Guiraudon/Jileva 2006: 281–288). —————— len auf gesamtstaatlicher Ebene. Großbritannien, Irland, Portugal, Australien und Neuseeland sind die einzigen Länder aus der Familie der konsolidierten liberalen Demokratien, in denen (bei je unterschiedlichen Regeln im Detail) auch bestimmte Personengruppen ohne die Staatsangehörigkeit des betreffenden Landes an Wahlen auf nationaler Ebene teilnehmen dürfen. Unter ihnen kennt nur Neuseeland ein allgemeines, lediglich an den Aufenthaltsstatus geknüpftes aktives Wahlrecht auf kommunaler und gesamtstaatlicher Ebene. Vgl. Kapitel 2; für eine weiter ausgreifende international vergleichende Analyse relevanter Bestimmungen Waldrauch (2003). 215 Zu erinnern ist jedoch daran, dass die sogenannte »ius sanguinis«-Regel historisch im Zuge der Gründung des Norddeutschen Bundes bzw. des Bismarck-Reichs nicht mit dem Ziel der Exklusion, sondern der Inklusion geschaffen wurde. Sie sollte Zugangserleichterung für die von der »kleindeutschen« Lösung ausgeschlossenen Deutschen in Süddeutschland und Österreich gewährleisten. Nach 1945 wurden die beiden deutschen Staaten bis zur Vereinigung an einer Aufgabe dieses Prinzips durch die umfangreichen Abtrennungen des Staatsgebiets gehindert, »da sie die Inklusion der Deutschen außerhalb der enger gewordenen Grenzen zweier deutscher Teilstaaten ermöglichen mußten« (von Beyme 1996: 84). 216 Unterschiedliche Lösungsmodelle diskutiert Bauböck (2006: 217–221). DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 269 Gleichwohl sind nicht nur, möglicherweise nicht einmal primär die quantitativen Veränderungen auf diesem Feld dafür verantwortlich, dass die Migration heute zu den zentralen Problemen der Demokratie und der Demokratieforschung gerechnet wird. Nach Einschätzung einiger führender Autoren stellen die veränderten normativen Ansprüche, die heute an die Legitimität politischer Herrschaft im liberalen und demokratischen Rechtsstaat gestellt werden, sogar den eigentlich ausschlaggebenden Impuls dar (Bauböck 2006: 221).217 Anders als es scheinen mag, handelt es sich dabei keineswegs um ein »zweitklassiges« Motiv für die Auseinandersetzung mit dem Problem. Vielmehr vereinten sich in den unterschiedlichen Vorstellungen von Demokratie schon immer empirische und normative Aspekte, und zu Veränderungen der empirischen Dimension kam es in aller Regel jeweils erst im Anschluss an hinreichend signifikante Veränderungen normativer Demokratievorstellungen. Reiches Anschauungsmaterial dazu bietet die in Kapitel 2 dieser Studie in wenigen Ausschnitten nachgezeichnete Geschichte der Ausbreitung des demokratischen Wahlrechts seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts. Mit speziellerem Bezug auf die jüngeren politischen Entwicklungen in Europa ist im Übrigen daran zu erinnern, dass mit der Etablierung der Prinzipien des Binnenmarktes – einschließlich der unbeschränkten Freizügigkeit von EU-Bürgern – entsprechende Ansprüche geradezu institutionell geschürt werden. Transformiert sich die liberale Demokratie in den konsolidierten demokratischen Verfassungsstaaten also zu einer Variante, die im Zuge der Internationalisierung von Politik, Ökonomie und Gesellschaft Teile ihrer demokratischen Qualitäten eingebüßt hat, ihre liberalen Komponenten hingegen wirkungsvoll zu schützen weiß? Auf den ersten Blick scheint es so. In der Tat ließe sich dieser Befund sogar dahingehend spezifizieren, dass die politische bzw. politisch vorangetriebene rechtliche Internationalisierung – vor allem, aber nicht ausschließlich in Gestalt der europäischen —————— 217 Die grundlegenden menschenrechtlichen Argumente, die zur Rechtfertigung einer liberalen Handhabung des Staatsbürgerrechts vorgebracht werden, sind jedoch keineswegs neu; sie lassen sich bis zu den französischen und amerikanischen Menschenrechtserklärungen des späten 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Für einige Autoren bildet »die Integration der Gesellschaft unter Beibehaltung der jeweiligen Eigenheiten hin zu einer staatlichen Ordnung« eine zentrale Grundkomponente demokratischer Verfassungsstaatlichkeit, die auch historisch gleichberechtigt neben den klassisch liberalen Komponenten der Ausgrenzung persönlicher Freiheitsräume und der demokratischen Komponente der Teilhabe am Staat steht. Vgl. etwa Hufen (2000: 21–22). 270 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Integration und ihrer Rückwirkungen auf die Nationalstaaten – mindestens zu einer zusätzlichen Absicherung rechtstaatlicher Prinzipien geführt hat.218 Das gilt besonders für den Schutz von Menschenrechten innerhalb der Europäischen Union, für den in hohem Maße die auf eigentümliche Weise einander ergänzenden Tätigkeiten des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) verantwortlich waren bzw. sind.219 »The European courts’ linkage has become a parameter of European governance. Human rights have changed the course of European integration, as they have progressively been superimposed on most EU and national activities by the two courts« (Scheeck 2005: 838). Selbst die Gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik, die zu den weltweit leistungsstärksten und angesehensten Institutionen entwickelter Rechtsstaatlichkeit zählt, wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vereinzelt für Verstöße gegen das Menschenrecht gerügt. So kritisierte der EGMR das Bundesverfassungsgericht wegen übergroßer Längen der Verfahrensdauer, welche als unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention erachtet wurden (Frankfurter Allgemeine —————— 218 Wie Leibfried und Zürn zu Recht anmerken, ließen sich die damit verbundenen Prozesse in gewisser Weise als relative Schwächung nationalstaatlich garantierter Rechtsstaatlichkeit deuten. Ungeachtet der zum Teil recht unterschiedlichen Adaptionsstrategien von Gerichten in den Mitgliedstaaten der EU (Craig 2003; Kassim 2005: 307–310) gilt, dass sich »die Beweislast für Abweichungen von europäischen Vorgaben auf die nationalen Verfassungsgerichte verlagert hat« (Leibfried/Zürn 2006: 48). Die Manifestationen und Grenzen internationaler Rechtsstaatlichkeit jenseits der EU analysiert aus politikwissenschaftlicher Perspektive Zangl (2006). 219 Zunächst besaß keines der beiden Gerichte die Kompetenz, Menschenrechte auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaften zu schützen. Dem in Luxemburg ansässigen Europäischen Gerichtshof ermangelte anfangs das Recht, auf EUEbene einen Schutz von Menschenrechten zu gewährleisten, während der in Straßburg ansässige Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nicht über das Recht verfügte, eine externe Kontrolle über die EU-Institutionen auszuüben, weil die EU als solche nicht eine Partei im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt. Angesichts der jahrzehntelangen Unfähigkeit der nationalstaatlichen Regierungen, hinreichende Kontrollmechanismen zu installieren, strebten die beiden Gerichte von sich aus danach, ihre Kompetenzen nach Kräften auszuschöpfen bzw. zu erweitern. Dabei griffen beide Gerichte zunehmend in den formalen Kompetenzbereich des jeweils anderen ein, woraus sich jedoch weniger rechtliche Kompetenzstreitigkeiten als vielmehr ein – mit Blick auf das damit erreichte Maß an Schutz von Menschenrechten innerhalb der EU – hochgradig funktionales Zusammenspiel beider Seiten ergab. Vgl. Scheeck (2005). DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 271 Zeitung vom 30.06.1997: 6). Ungleich schwerwiegender waren die Wirkungen der politischen und rechtlichen Internationalisierung in Großbritannien, wo die Verabschiedung des »Human Rights Act 1998« zu einem mächtigen Katalysator der Stärkung von »judicial review« im britischen Regierungssystem wurde (Jacobs 1999; Schieren 1999). Zu den verbreiteten Wirkungen der »Europäisierung« der Gerichtsbarkeit gehörte ferner die Aufwertung der einfachen Gerichtsbarkeit bei der Auslegung von national bedeutenden rechtlichen Regeln. Wie im Falle der »europäisierungsbedingten« Aufwertung der politischen Exekutive (vgl. FN 212), wurde auch diese Entwicklung gelegentlich nicht so sehr als »Europäisierung«, sondern als »Amerikanisierung« bewertet (Newell 2005: 39) – eine Interpretation, die auf der Ebene des funktionalen Vergleichs freilich mehr Sinn macht als die tendenzielle Gleichsetzung europäischer Regierungschefs mit amerikanischen Präsidenten. Es gibt jedoch auch Entwicklungen, die eher auf eine De-Liberalisierung der liberalen Demokratie hindeuten. Spezifische Probleme ergeben sich aus dem Phänomen der zwischenstaatlichen Migration: Ohne allzu große Spitzfindigkeit ließe sich das fehlende Recht eines Teils der in den liberalen Demokratien lebenden Bevölkerung auf demokratische Beteiligung an Wahlen zugleich als Einschränkung der liberalen Abwehrrechte gegenüber dem Staat bewerten, da auch Regierungsentscheidungen, die als signifikanter Eingriff in die grundlegenden Bedingungen der persönlichen Lebensgestaltung empfunden werden (seien es Steuererhöhungen, seien es regulative oder protektive Maßnahmen mit restriktivem Charakter), nicht mit einer entsprechenden Wahlentscheidung sanktioniert werden können. Quantitativ und qualitativ bedeutender sind jedoch zweifelsohne andere Entwicklungen, darunter insbesondere die Reaktionen der liberalen Demokratien auf die Bedrohung des internationalen Terrorismus und der zunehmend länderübergreifend organisierten Kriminalität. Dabei handelt es sich bei näherer Betrachtung freilich um zwei sehr unterschiedliche Phänomene. Das zentrale Motiv organisierter Kriminalität besteht in der Maximierung materieller Güter; beim Terrorismus stehen hingegen politische Ziele, die Zerstörung der herrschenden politischen Ordnung innerhalb eines Staates, im Vordergrund. Allerdings gibt es eine Tendenz zur Verwischung der Grenzen: Zum einen beteiligen sich Terroristen zunehmend am internationalen Drogenhandel, um ihre Operationen zu finanzieren; zum anderen nutzen sowohl der Terrorismus als auch transnationale kriminelle Organisationen vom Krieg zerrüttete Staaten als Operationsba- 272 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sen (Jachtenfuchs 2006: 73–74). Grenzverwischungen gibt es auch auf der Ebene politischer Reaktionsstrategien auf den internationalen Terrorismus und die organisierte Kriminalität. So neigt die EU dazu, »Terrorismus als eine spezifische Form von Kriminalität« (Kahl 2006: 123) zu betrachten. Insgesamt können deshalb internationaler Terrorismus und internationale organisierte Kriminalität als je spezifische – pathologische – Erscheinungsformen gesellschaftlicher Internationalisierung gelten. Im Rahmen der Reaktionen des Staates auf diese Herausforderungen kam es – auf der Grundlage des Strebens nach Gewährleistung von Schutz und Sicherheit durch den Staat – zu teils weitreichenden staatlichen Einschränkungen von Freiheitsrechten. Das gilt auch für die Bundesrepublik, obwohl die im Gefolge des Terroranschlags auf das New Yorker World Trade Center vom 11. September 2001 durchgesetzten Reformen im Hinblick auf Einschränkungen ziviler Freiheitsrechte deutlich defensiver blieben als in Großbritannien und den USA (Pradetto 2004; Wilkinson 2006). Auch die EU hat die gewachsene Bedrohung mit einer Reihe restriktiver Maßnahmen beantwortet220, die nicht wenigen Beobachtern als Eingriff in die Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrechte von Bürgern erscheinen (Kahl 2006: 126; Wilkinson 2005). Vor allem die Anti-Terror-Politik der amerikanischen Regierung unter Präsident George W. Bush wurde wiederholt als »a textbook illustration of the ›securitization‹ of key issues for political gain« (Bach 2006: 115) charakterisiert, hinter der das Bestreben einer machtpolitisch motivierten Expansion des Präsidentenamtes im politischen Entscheidungsprozess stehe. Das grundsätzliche Problem einer Gefährdung ziviler Freiheitsrechte durch eine restriktive Politik des Staates bleibt freilich auch dort bestehen, wo diese »in bester Absicht« betrieben wird.221 Ein besonderes Problem ergibt —————— 220 Darunter etwa die Übermittlung persönlicher Daten von Flugreisenden in die USA an amerikanische Sicherheitsbehörden und die mindestens sechsmonatige Speicherung von Telefon- und Internetdaten ohne konkretes Verdachtsmoment. 221 Ähnlich wie in Bezug auf die Legitimitätsproblematik (vgl. FN 213) entspricht der Sensibilität und Kritik in weiten Teilen der Wissenschaft jedoch in den seltensten Fällen ein vergleichbares Betroffenheitsgefühl der Bevölkerung. Das scheint, wie einschlägige Untersuchungen suggerieren, auch für die Bundesrepublik der Fall zu sein: »Bei der Mehrheit stößt die Expansion der Sicherheitskompetenzen eher auf diffuse Zustimmung, wie Meinungsumfragen immer wieder belegen. Der Einschnitt in Bürgerrechte wird als abstrakt empfunden, der Verlust von Datenschutz beispielsweise als nebensächlich bewertet […], Bürgerrechte als etwas potenziell Antiquiertes« (Lange 2006: 104). DE-INSTITUTIONALISIERUNG UND INTERNATIONALISIERUNG 273 sich daraus, dass das vom Staat als Gegenleistung für die begrenzte Einschränkung von Freiheitsrechten gegebene Sicherheitsversprechen nicht mehr zwangsläufig in allen Belangen tatsächlich mit eigenem Personal umgesetzt wird. Kennzeichnend ist vielmehr eine internationale Tendenz zur »Privatisierung von Sicherheit und Aushöhlung des Gewaltmonopols« (Glaeßner 2003: 170–174), aus der sich weitreichende Herausforderungen liberaler und demokratischer Rechtsstaatlichkeit ergeben können.222 Zu den stärker indirekten freiheitsgefährdenden (zudem demokratiegefährdenden) Folgeerscheinungen vor allem der ökonomischen Internationalisierung gehört ferner die Entstehung rechtspopulistischer und rechtsradikaler Strömungen und Bewegungen. Loch und Heitmeyer (2001) qualifizieren autoritäre Entwicklungen ausdrücklich als »Schattenseiten der Globalisierung«. Gesteigerte Rassismus- und Fremdenfeindlichkeitspotentiale erscheinen dabei als mittelbare Folge von gesellschaftlicher »Verunsicherung aufgrund von Kontrollverlusten bzw. -befürchtungen« (Heitmeyer 2001: 515). Freilich ist es möglich und sinnvoll, zwischen unterschiedlichen Gruppierungen zu differenzieren. Während extremistische Gruppierungen die gesamte Idee der Demokratie in Frage stellen, wenden sich radikale Gruppierungen »nur« gegen bestimmte liberale Elemente des Systems, wie etwa den verfassungsrechtlichen Schutz von Minderheiten oder die institutionelle Gewaltenteilung (Mudde 2006: 178). Im Gegensatz zu großen Teilen des 20. Jahrhunderts, während derer demokratische Regime vor allem durch extremistische Bewegungen herausgefordert wurden, bestimmen im frühen 21. Jahrhundert radikale, darunter populistische Kräfte mit anti-liberaler Stoßrichtung das internationale Bild (ebd.: 194). Der politische Einfluss anti-liberaler (und demokratiefeindlicher) Parteien auf die Entwicklung liberal-demokratisch organisierter Systeme bleibt umstritten. In der großen Mehrzahl der konsolidierten liberalen Demokratien betraf die direkte Herausforderung der politischen Ordnung durch radikale Kräfte »lediglich« die Ebene des öffentlichen politischen Diskurses, kaum hingegen die Ebene staatlicher Entscheidungspolitik. Die wichtigste Ausnahme verkörpert das Feld der Immigrationspolitik, auf dem viele Beobachter eine Tendenz zur »Ansteckung« der etablierten demokratischen Parteien erkennen – selbst in einigen Ländern, in denen populisti- —————— 222 Dabei handelt es sich wohlgemerkt um ein »hausgemachtes« Problem, nicht um eine Dimension der Internationalisierung. Für eine nicht lediglich operative Internationalisierung des Gewaltmonopols gibt es bislang kaum Anzeichen (Jachtenfuchs 2006: 88). 274 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE sche Parteien nicht einmal parlamentarischen Repräsentationsstatus erlangten (Guiraudon/Jileva 2006: 288).223 Zumindest Regierungsbeteiligungen von entsprechend zu klassifizierenden Parteien blieben innerhalb der Familie der konsolidierten liberalen Demokratie die große Ausnahme. Zu nennen wären vor allem Italien und Österreich. Die Auswirkungen der parteipolitischen Zusammensetzung auf die Regierung, insbesondere im Hinblick auf den hier interessierenden Aspekt der Einschränkung von Freiheitsrechten, sind jedoch nicht eindeutig. Zum politischen Vermächtnis der Politik der ÖVP/FPÖ- bzw. ÖVP/BZÖ-Koalition in Österreich gehörte nach Einschätzung von Beobachtern unter anderem »mehr Rechtsunsicherheit« (Talós 2006: 240) als Ergebnis einer Schwächung der verfassungsgerichtlichen Normenkontrolle. In Italien forderten manche Aktionen der Regierung Berlusconi die Rechtsstaatlichkeit hingegen so weit heraus, dass zu den jüngeren Veränderungen der italienischen Demokratie paradoxerweise gar eine – vor allem der Beherztheit des italienischen Staatspräsidenten und den Gerichten zu verdankende – relative Aufwertung rechtsstaatlicher Prinzipien gezählt werden kann (Bull/Newell 2006). Diese abschließenden Betrachtungen erinnern uns lediglich daran, dass die liberale Demokratie – auch nach deren politisch und ökonomisch erfolgreicher Konsolidierung – eine außerordentlich verwundbare Staatsform bleibt. Dabei wurden hier nur einige der wichtigsten internationalisierungsbedingten Gefährdungen berücksichtigt.224 Ein Patentrezept zur erfolgreichen Bewahrung der liberalen Demokratie gibt es ebenso wenig wie einen Königsweg zu deren erfolgreicher Institutionalisierung. Bei der Begründung wie bei der Entwicklung der liberalen Demokratie bleibt es eine zentrale Herausforderung verantwortlich handelnder politischer Eliten und deren Ratgeber aus Wissenschaft und Praxis, das länderübergreifend Gültige der Idee des demokratischen Verfassungsstaates mit den spezifischen Bedürfnissen zunehmend komplexerer Gesellschaften und Kulturen zu versöhnen. —————— 223 Zu einer entsprechenden Einschätzung gelangt auch Simon Green (2006: 125) in Bezug auf die politischen Rahmenbedingungen des »Asylkompromisses«, der umstrittenen Reform des Art. 16 GG im Dezember 1992. 224 Eine weit ausgreifende Diskussion der ungezählten inneren Gefährdungen der liberalen Demokratie bietet neben anderen Leisner (1998). Literatur Auswahl wichtiger Datenhandbücher Caramani, Daniele (Hrsg.), 2000: Elections in Western Europe 1815–1996, London: Palgrave. Ebbinghaus, Bernhard/Visser, Jelle (Hrsg.), 2000: Trade Unions in Western Europe since 1945, New York u.a.: Grove’s Dictionaries. Flora, Peter (Hrsg.), 1983/7: State, Economy and Society in Western Europe, 1815–1975. A Data Handbook, 2 Bde, Frankfurt a.M./New York: Campus. Katz, Richard S./Mair, Peter (Hrsg.), 1992: Party Organizations: A Data Handbook, London: Sage. Lane, Jan-Erik/Ersson, Svante O. (Hrsg.), 1999: Politics and Society in Western Europe, 4. Aufl., London: Sage. Lane, Jan-Erik/McKay, David/Newton, Kenneth (Hrsg.), 1997: Political Data Handbook: OECD Countries, 2. Aufl., Oxford: Oxford University Press. Interparliamentary Union (Hrsg.), 1986: Parliaments of the World: A Comparative Reference Compendium, 2. Aufl., Aldershot: Gower House. Rose, Richard (Hrsg.), 2000: International Encyclopedia of Elections, London: Macmillan. Woldendorp, Jaap/Keman, Hans/Budge, Ian, 2000: Party Government in 48 Democracies (1945–1998). Composition – Duration – Personnel, Dordrecht: Kluwer. World Association of Newspapers (Hrsg.), World Press Trends, Paris: World Association of Newspapers (erscheint jährlich). Verzeichnis zitierter Werke Abromeit, Heidrun, 1989: Mehrheitsdemokratische und konkordanzdemokratische Elemente im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 18, 165–180. —, 1992a: Der verkappte Einheitsstaat, Opladen: Leske & Budrich. —, 1992b: Kontinuität oder ›Yekyll-and-Hyde-Politik‹: Staatshandeln in der Schweiz und in Großbritannien, in: Heidrun Abromeit/Werner W. Pommerehne (Hrsg.), Staatstätigkeit in der Schweiz, Bern: Haupt, 15–192. 276 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE —, 1993: Interessenvermittlung zwischen Konkurrenz und Konkordanz. Studienbuch zur Vergleichenden Lehre politischer Systeme, Opladen: Leske & Budrich. —, 1995: Volkssouveränität, Parlamentssouveränität, Verfassungssouveränität. Drei Realmodelle der Legitimation staatlichen Handelns, in: Politische Vierteljahresschrift 36, 4–66. Abromeit, Heidrun/Stoiber, Michael, 2006: Demokratien im Vergleich. Einführung in die vergleichende Analyse politischer Systeme, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Abromeit, Heidrun/Wewer, Göttrik (Hrsg.), 1989: Die Kirchen und die Politik: Beiträge zu einem ungeklärten Verhältnis, Opladen: Westdeutscher Verlag. Acham, Karl, 1992: Struktur, Funktion und Genese von Institutionen aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in: Gert Melville (Hrsg.), Institutionen und Geschichte. Theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde, Köln u.a.: Böhlau, 2–71. Adams, Karl H., 2005: Parteienfinanzierung in Deutschland. Entwicklung der Einnahmestrukturen politischer Parteien oder eine Sittengeschichte über Parteien, Geld und Macht, Marburg: Tectum. Alemann, Ulrich von, 2000: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske & Budrich. —, (Hrsg.), 2005: Dimensionen politischer Korruption. Beiträge zum Stand der internationalen Forschung (Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 35), Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Alemann, Ulrich von/Weßels, Bernhard, 1997: Verbände in vergleichender Perspektive – Königsweg oder Dornenweg?, in: Ulrich von Alemann/Bernhard Wessels (Hrsg.), Verbände in vergleichender Perspektive. Beiträge zu einem vernachlässigten Feld, Berlin: Edition Sigma, 7–28. Almond, Gabriel/Dalton, Russell J./Powell, G. Bingham/Strøm, Kaare (Hrsg.), 2004: Comparative Politics Today: A World View, 8. Aufl., New York: Pierson/Longman. Altendorfer, Otto, 2001: Das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland. Band 1, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Altermatt, Urs, 1992: Schweizer Regierung: Sieben Bundesräte und kein Ministerpräsident, in: Karl-Dietrich Bracher u.a. (Hrsg.), Staat und Parteien. Festschrift für Rudolf Morsey, Berlin: Duncker & Humblot, 237–254. Alvizatos, Nicos C., 1995: Judges as Veto Players, in: Herbert Döring (Hrsg.), Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Frankfurt a.M./New York: Campus, 566–589. Andeweg, Rudy, 1997: Collegiality and Collectivity: Cabinets, Cabinet Committees, and Cabinet Ministers, in: Patrick Weller/Herman Bakvis/R.A.W. Rhodes (Hrsg.), The Hollow Crown: Countervailing Trends in Core Executives, London: Macmillan, 58–83. Ansell, Christopher K./Fish, Steven M., 1999: The Art of Being Indispensible. Non-charismatic Personalism in Contemporary Political Parties, in: Comparative Political Studies 32, 283–312. LITERATUR 277 Armingeon, Klaus, 2002a: Verbändesysteme und Föderalismus. Eine vergleichende Analyse, in: Arthur Benz/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Föderalismus. Analysen in entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Perspektive, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 213–233. —, 2002b: Interest Intermediation: The Cases of Consociational Democracy and Corporatism, in: Hans Keman (Hrsg.), Comparative Democratic Politics, London: Sage, 143–165. Arnauld, Andreas von, 2001: Gewaltenteilung jenseits der Gewaltentrennung. Das gewaltenteilige System in der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 32, 678–686. Arnim, Hans Herbert, 2001: Das System. Die Machenschaften der Macht, München: Droemer. Arter, David, 1981: Kekkonen’s Finland: Enlightened Despotism or Consensual Democracy?, in: West European Politics 4, No. 3, 219–234. —, 2004: The Prime Minister in Scandinavia: ›Superstar‹ or Supervisor?, in: Nicholas D. J. Baldwin (Hrsg.), Legislatures and Executives: An Investigation into the Relationship at the Heart of Government, London: Routledge, 109– 127. Auel, Katrin, 2006: The Europeanisation of the German Bundestag: Institutional Change and Informal Adaptation, in: German Politics 15, 249–268. Auer, Andreas, 1984: Die schweizerische Verfassungsgerichtsbarkeit, Basel: Helbing & Lichtenhahn. Bach, Jonathan, 2006: The Politics of Security: A View from New York Five Years After 9/11, in: Sicherheit + Frieden 24, 113–116. Bache, Ian/Jordan, Andrew (Hrsg.), 2006: The Europeanization of British Politics, London: Palgrave Macmillan. Backes, Uwe, 1998, Schutz des Staates. Von der Autokratie zur streitbaren Demokratie, Opladen: Leske & Budrich. Bakema, Wilma E., 1991: The Ministerial Career, in: Jean Blondel/Jean-Louis Thiébault (Hrsg.), The Profession of Government Minister in Western Europe, London: Macmillan, 70–98. Bartolini, Stefano, 2000: Franchise Expansion, in: Richard Rose (Hrsg.), International Encyclopedia of Elections, London: Macmillan, 117–130. Bauböck, Rainer, 2006: Migration und politische Beteiligung: Wahlrechte jenseits von Staatsgebiet und Staatsangehörigkeit, in: Manfred Oberlechner (Hrsg.), Die missglückte Integration? Wege und Irrwege in Europa, Wien: Braumüller, 209– 223. Baum, Achim, 2006: Pressefreiheit durch Selbstkontrolle, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 38, 6–10. Bawn, Kathleen, 1993: The Logic of Institutional Preferences: German Electoral Law as a Social Choice Outcome, in: American Journal of Political Science 37, 965–989. Beck, Ulrich/Grande, Edgar, 2004: Das kosmopolitische Europa, Frankfurt a.M.: Campus. 278 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Behnke, Joachim, 2003: Überhangmandate – ein (behebbarer) Mängel am institutionellen Design des Wahlsystems, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 13, 1235–1269. Behrens, Martin, 2005: Mitgliederrekrutierung und institutionelle Grundlagen der Gewerkschaften: Deutschland im internationalen Vergleich, in: Berliner Debatte Initial 16, Nr. 5, 30–37. Benhabib, Seyla, 2002: The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global Era, Princeton: Princeton University Press. Bennett, W. Lance Bennett/Entman, Robert M. (Hrsg.), 2001: Mediated Politics, Cambridge: Cambridge University Press. Benoit, Kenneth, 2004: Models of Electoral System Change, in: Electoral Studies 23, 363–389. Benz, Arthur, 1998: Postparlamentarische Demokratie? Demokratische Legitimation im kooperativen Staat, in: Michael Th. Greven (Hrsg.), Demokratie – eine Kultur des Westens ?, Opladen: Leske & Budrich, 201–222. —, 2002: Themen, Probleme und Perspektiven der vergleichenden Föderalismusforschung, in: Arthur Benz/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Föderalismus (Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 32), Opladen: Westdeutscher Verlag, 9– 50. —, 2003a: Demokratiereform durch Föderalisierung, in: Claus Offe (Hrsg.), Demokratisierung der Demokratie, Frankfurt a.M./New York: Campus, 169–192. —, 2003b: Konstruktive Vetospieler in Mehrebenensystemen, in: Renate Mayntz/Wolfgang Streeck (Hrsg.), Die Reformierbarkeit der Demokratie. Innovationen und Blockaden, Frankfurt a.M./New York: Campus, 205–236. —, 2004: Einleitung: Governance – Modebegiff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept?, in: Arthur Benz (Hrsg.), Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 11–28. Bernecker, Walter L, 1998: Monarchy and Democracy: The Political Role of King Juan Carlos in the Spanish Transición, in: Journal of Contemporary History 33, 65–84. Berthold, Lutz, 1997: Das konstruktive Mißtrauensvotum und seine Ursprünge in der Weimarer Staatsrechtslehre, in: Der Staat 36, 81–94. Betz, Hans-Georg, 1998: The New Politics of the Right: Right-Wing Populist Parties and Movements in Established Democracies, New York: Macmillan. Beyer, Jürgen, 2005: Pfadabhängigkeit ist nicht gleich Pfadabhängigkeit! Wider den impliziten Konservatismus eines gängigen Konzepts, in: Zeitschrift für Soziologie 34, 5–21. Beyme, Klaus von, 1968: Föderalismus, in: C. D. Kernig (Hrsg.), Sowjetsystem und Demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie. Bd. II, Freiburg u.a.: Herder, 551–575. —, 1970: Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, München: Piper. —, 1974a: Interessengruppen in der Demokratie, 4. Aufl., München: Piper. —, 1974b: Die Funktionen des Bundesrates. Ein Vergleich mit Zweikammersystemen im Ausland, in: Bundesrat (Hrsg.), Der Bundesrat als Verfassungsorgan LITERATUR 279 und politische Kraft, Bad Honnef/Darmstadt: Neue Darmstädter Verlags-Anstalt, 365–393. —, 1978: Partei, Fraktion, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Kosellek (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 4, Stuttgart: Klett-Cotta, 677–733. —, 1984: Parteien in westlichen Demokratien, 2. Aufl., München: Piper. —, 1988: The Genesis of Constitutional Review in Parliamentary Systems, in: Christine Landfried (Hrsg.), Constitutional Review and Legislation. An International Comparison, Baden-Baden: Nomos, 21–38. —, 1994: Systemwechsel in Osteuropa, 2. Aufl. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. —, 1996: Deutsche Identität zwischen Nationalismus und Verfassungspatriotismus, in: Manfred Hettling/Paul Nolte (Hrsg.), Nation und Gesellschaft in Deutschland. Historische Essays, München: Beck, 88–99. —, 1997: Der Gesetzgeber. Der Bundestag als Entscheidungszentrum, Opladen: Westdeutscher Verlag. —, 1999a: Die parlamentarische Demokratie. Entstehung und Funktionsweise. 1789–1999, 3. Aufl., Opladen/Wiesbaden. —, 1999b: Institutionelle Grundlagen der deutschen Demokratie, in: Max Kaase/Günther Schmid (Hrsg.), Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Edition Sigma, 19–39. —, 2000a: Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. —, 2000b: The Bundestag – Still the Centre of Decision-Making?, in: Ludger Helms (Hrsg.), Institutions and Institutional Change in the Federal Republic of Germany, London: Macmillan, 32–47. —, 2001a: Institutional Engineering and Transition to Democracy, in: Jan Zielonka (Hrsg.), Democratic Consolidation in Eastern Europe, Oxford: Oxford University Press, 3–24. —, 2001b: Das Bundesverfassungsgericht aus der Sicht der Politik- und Gesellschaftswissenschaften, in: Peter Badura/Horst Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht. Erster Band: Verfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungsprozeß, Tübingen: Mohr Siebeck, 493–505. —, 2002: 30 Jahre Parteiengesetz – zum Stand der Parteienforschung, in: Dimitris Th. Tsatsos (Hrsg), 30 Jahre Parteiengesetz in Deutschland. Die Parteiinstitution im internationalen Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 44–52. —, 2003a: Demokratiereform als Reform der parlamentarischen Parteiendemokratie, in: Claus Offe (Hrsg.), Demokratisierung der Demokratie. Diagnosen und Reformvorschläge, Frankfurt a.M./New York: Campus, 27–42. —, 2003b: Die Asymmetrierung des postmodernen Föderalismus, in: Renate Mayntz/Wolfgang Streeck (Hrsg.), Die Reformierbarkeit der Demokratie. Innovationen und Blockaden, Frankfurt a.M./New York: Campus, 239–258. —, 2004: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 10. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Beyme, Klaus von/Weßler, Hartmut, 1998: Politische Kommunikation als Entscheidungskommunikation, in: Otfried Jarren/Ulrich Sarcinelli/Ulrich Saxer 280 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE (Hrsg.), Politische Kommunikation in der demokratischen Gesellschaft, Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 312–323. Biehl, Heiko, 2006: Wie viel Bodenhaftung haben die Parteien? Zum Zusammenhang von Parteimitgliedschaft und Herkunftsmilieu, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 37, 277–292. Biehler, Gerhard, 1990: Sozialliberale Reformgesetzgebung und Bundesverfassungsgericht. Der Einfluß des Bundesverfassungsgerichts auf die Reformpolitik – zugleich eine reformgesetzliche und -programmatische Bestandsaufnahme, Baden-Baden: Nomos. Bitterman, Mary G. F., 2006: How to Save Public Broadcasting, in: Television Quarterly 36, No. 2, 14–20. Blachèr, Philippe, 2003: Le Conseil constitutionnel en fait-il trop?, in: Pouvoirs, No. 105, 17–28. Blair, Philip/Cullen, Peter, 1999: Federalism, Legalism and Political Reality: The Record of the Federal Constitutional Court, in: Charlie Jeffery (Hrsg.), Recasting German Federalism. The Legacies of German Unification, London: Pinter, 119–154. Blais, André/Massicotte, Louis, 1997: Electoral Formulas: A Macroscopic Perspective, in: European Journal of Political Research 32, 107–129. Blais, André/Massicote, Louis/Yoshinaka, Antoine, 2001: Deciding Who Has the Right to Vote: A Comparative Analysis of Election Laws, in: Electoral Studies 20, 41–62. Blankenburg, Erhard, 1996: Changes in Political Regimes and Continuity of the Rule of Law in Germany, in: Herbert Jacob u.a. (Hrsg.), Courts, Law and Politics in Comparative Perspective, New Haven/London: Little, Brown, 249–314. Blondel, Jean/Cotta, Maurizio (Hrsg.), 1996: Party and Government: An Inquiry into the Relationship between Governments and Supporting Parties in Liberal Democracies, London: Macmillan. —, 2000: The Nature of Party Government: A Comparative European Perspective, London: Macmillan. Blumenthal, Julia von, 2002: Auswanderung der Politik aus den Institutionen, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 12, 3–26. —, 2005: Governance – eine kritische Zwischenbilanz, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 15, 1149–1180. Böckenförde, Ernst-Wolfgang, 1988: Der Zusammenbruch der Monarchie und die Entstehung der Weimarer Republik, in: Karl-Dietrich Bracher/Manfred Funke/Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.), Die Weimarer Republik 1918–1933, 2. Aufl., Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 17–43. —, 1992: Geschichtliche Entwicklung und Bedeutungswandel der Verfassung, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde (Hrsg.), Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, 2. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 29–52. Bösch, Frank, 2002: Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU, Stuttgart/München: Deutsche Verlags-Anstalt. LITERATUR 281 Bogdanor, Vernon, 1983: Introduction, in: Vernon Bogdanor/David Butler (Hrsg.), Democracy and Elections. Electoral Systems and their Political Consequences, Cambridge: Cambridge University Press, 1–19. —, 2004: The Constitution and the Party System in the Twentieth Century, in: Parliamentary Affairs 57, 717–733. Bogdanor, Vernon/Butler, David (Hrsg.) 1983: Democracy and Elections. Electoral Systems and their Political Consequences, Cambridge: Cambridge University Press. Boix, Carles, 1999: Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies, in: American Political Science Review 93, 609–624. Boldt, Hans, 1990: Deutsche Verfassungsgeschichte. Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, München: Deutscher Taschenbuch-Verlag. Bos, Ellen, 2004: Verfassungsgebung und Systemwechsel: Die Institutionalisierung von Demokratie im postsozialistischen Osteuropa, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Boventer, Paul V., 1985: Grenzen politischer Freiheit im demokratischen Staat. Das Konzept der streitbaren Demokratie im internationalen Vergleich, Berlin: Duncker & Humblot. Brady, David/Beckfield, Jason/Seeleib-Kaiser, Martin, 2004: Economic Globalization and the Welfare State in Affluent Democracies, 1975–1998, ZeS-Arbeitspapier Nr. 12/2004, Bremen. Braun, Dietmar (Hrsg.), 2000: Public Policy and Federalism, Aldershot: Ashgate. —, 2003: Decentralised and Unitary Federalism: Switzerland and Germany Compared, in: Swiss Journal of Political Science 9, 57–89. Braunias, Karl, 1932: Das parlamentarische Wahlrecht. Ein Handbuch über die Bildung der gesetzgebenden Körperschaften in Europa, 2 Bde, Berlin/Leipzig: de Gruyter. Brazier, Rodney, 1999: Constitutional Practice, 3. Aufl., Oxford: Oxford University Press. Brettschneider, Frank/Gabriel Oscar W., 2002: The Nonpersonalisation of Voting Behavior in Germany, in: Anthony King (Hrsg.), Leaders’ Personalities and the Outcomes of Democratic Elections, Oxford: Oxford University Press, 127– 157. Briggs, Susan, 1995: Television in the Home and Family, in: Anthony R. Smith (Hrsg.), Television: An International History, Oxford: Oxford University Press, 191–214. Brünneck, Alexander von, 1992: Verfassungsgerichtsbarkeit in den westlichen Demokratien. Ein systematischer Verfassungsvergleich, Baden-Baden: Nomos. Brunner, Georg, 1993: Die neue Verfassungsgerichtsbarkeit in Osteuropa, in: Zeitschrift für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht 53, 819–826. Bryde, Brun-Otto, 1999: Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in Umbruchsituationen, in: Joachim Jens Hesse/Gunnar Folke Schuppert/Katharina Harms (Hrsg.), Verfassungsrecht und Verfassungspolitik in Umbruchsituationen. Zur 282 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Rolle des Rechts in staatlichen Transformationsprozessen in Europa, BadenBaden: Nomos, 197–210. —, 2002: Integration durch Verfassungsgerichtsbarkeit und ihre Grenzen, in: Hans Vorländer (Hrsg.), Integration durch Verfassung, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 329–341. Buchstein, Hubertus, 2000: Öffentliche und geheime Stimmabgabe. Eine wahlrechtshistorische und ideengeschichtliche Perspektive, Nomos: Baden-Baden: Nomos. Buchstein, Hubertus/Kühn, Rainer, 1999: Vorwort zu diesem Band, in: Hubertus Buchstein unter Mitarbeit von Rainer Kühn (Hrsg.), Ernst Fraenkel. Gesammelte Schriften. Bd. 1: Recht und Politik in der Weimarer Republik, Baden-Baden: Nomos, 15–54. Büdenbender, Martin, 2005: Das Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum Bundesverfassungsgericht: zugleich eine Betrachtung des Verhältnisses des Europäischen Gerichtshofs zu den Verfassungsgerichten ausgewählter Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Köln: Heymann. Bull, Martin J./Newell, James L., 2006: Italian Politics: Adjustment Under Duress, Cambridge: Polity Press. Burchell, Jon, 2002: The Evolution of Green Politics: Development and Change within European Green Parties, London: Earthscan. Burke, John P., 2000: The Institutional Presidency, 2. Aufl., Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Busch, Andreas, 2006: Verfassungspolitik: Stabilität und permanentes Austarieren, in: Manfred G. Schmidt/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 33–56. Bußjäger, Peter, 2003: Föderalismus durch Macht im Schatten? – Österreich und die Landeshauptmännerkonferenz, in: Jahrbuch des Föderalismus 2003, Baden-Baden: Nomos, 79–99. Capoccia, Giovanni, 2002: The Political Consequences of Electoral Laws: The German System at Fifty, in: West European Politics 25, No. 3, 171–202. Cappelletti, Mauro/Ritterspach, Theodor, 1971: Die gerichtliche Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze in rechtsvergleichender Betrachtung, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 20, 65–109. Carstairs, Andrew, 1980: A Short History of Electoral Systems in Western Europe, London: Allen and Unwin. Castles, Francis G./Obinger, Herbert/Leibfried, Stephan, 2005: Bremst der Föderalismus den Leviathan? Bundesstaat und Sozialstaat im internationalen Vergleich, 1880–2005, in: Politische Vierteljahresschrift 46, 218–240. Chapman, Jane, 2005: Comparative Media History. An Introduction, Cambridge: Polity Press. Clinton, Robert Lowry, 1989: Marbury v. Madison and Judicial Review, Lawrence, KS: University Press of Kansas. Cohen, Richard E./Victor, Kirk/Bauman, David, 2004: The State of Congress, in: National Journal 36, 10 January, 82–105. LITERATUR 283 Cole, Alistair, 2003: Stress, Strain and Stability in the French Party System, in: Jocelyn Evans (Hrsg.), The French Party System, Manchester: Manchester University Press, 11–26. Colomer, Joseph M., 2005: It’s Parties That Choose Electoral Systems (or, Duverger’s Laws Upside Down), in: Political Studies 53, 1–21. Corner, John/Robinson, Piers, 2006: Politics and Mass Media: A Response to John Street, in: Political Studies Review 4, 48–54. Craig, P., 2003: National Courts and Community Law, in: Jack Hayward/Anand Menon (Hrsg.), Governing Europe, Oxford: Oxford University Press, 15–35. Crouch, Colin, 2003: Comparing Economic Interest Organizations, in: Jack Hayward/Anand Menon (Hrsg.), Governing Europe, Oxford: Oxford University Press, 197–207. —, 2004: Post-Democracy, Cambridge: Polity Press. Crouch, Colin/Menon, Anand, 1997: Organised Interests and the State, in: Martin Rhodes/Paul Heywood/Vincent Wright (Hrsg.), Developments in West European Politics, London: Macmillan, 151–168. Czada, Roland, 1993: Wer hat Macht in Schweden? Strategien der Verbände und Strukturen der Interessenvermittlung, in: Ralf Kleinfeld/Wolfgang Luthardt (Hrsg.), Westliche Demokratien und Interessenvermittlung. Zur aktuellen Entwicklung nationaler Parteien- und Verbändesysteme, Marburg: Schüren, 205–222. —, 1998: Vereinigungskrise und Standortdebatte. Der Beitrag der Wiedervereinigung zu Krise des westdeutschen Modells, in: Leviathan 26, 24–59. —, 1999: Kommentar: Amt ohne Zukunft? Anmerkungen zum Staatsoberhaupt in parlamentarischen Demokratien, in: Eberhard Jäckel/Horst Möller/Hermann Rudolph (Hrsg.), Von Heuss bis Herzog. Die Bundespräsidenten im politischen System der Bundesrepublik, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 129– 142. —, 2003: Privatisierungspolitik, in: Dieter Nohlen (Hrsg.), Kleines Lexikon der Politik, 3. Aufl., München: Beck, 417–422. Dahl, Robert A., 1997: Thinking About Democratic Constitutions: Conclusions from Democratic Expericence, in: Robert A. Dahl, Toward Democracy. A Journey, Berkeley: Berkeley Institute of Governmental Studies Press, 479–507. Dahrendorf, Ralf, 2002: Regierungen ohne Opposition, in: Süddeutsche Zeitung, 14 November 2002, 2. Dalton, Russell J., 2002: Political Cleavages, Issues, and Electoral Change, in: Lawrence LeDuc/Richard G. Niemi/Pippa Norris (Hrsg.), Comparing Democracies 2. New Challenges in the Study of Elections and Voting, London: Sage, 189–209. Dalton, Russell J./McAllister, Ian/Wattenberg, Martin P., 2000: The Consequences of Partisan Dealignment, in: Russell J. Dalton/Martin P. Wattenberg (Hrsg.), Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford: Oxford University Press, 19–63. Damgaard, Erik/Mattson, Ingvar, 2004: Conflict and Consensus in Committees, in: Herbert Döring/Mark Hallerberg (Hrsg.), Patterns of Parliamentary Be- 284 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE haviour. Passage of Legislation Across Western Europe, Aldershot: Ashgate, 113–139. Dann, Philipp, 2006: The Gubernative in Presidential and Parliamentary Systems, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 66, 1–40. Dardanelli, Paolo, 2005: The Parliamentary and Executive Elections in Switzerland, 2003, in: Electoral Studies 24, 123–129. Decker, Frank, 2000: Parteien unter Druck: Der neue Rechtspopulismus in den westlichen Demokratien, Opladen: Leske & Budrich. Delwit, Pascal (Hrsg), 2002: Libéralismes et parties libéral en Europe, Bruxelles: Édition de l’Université de Bruxelles. —, 2003: Démocraties chrétiennes et conservatisme en Europe: une nouvelle convergence?, Bruxelles: Édition de l’Université de Bruxelles. —, 2005: Social Democracy in Europe, Bruxelles: Édition de l’Université de Bruxelles. Derlien, Hans-Ulrich, 1996: The Politicization of Bureaucracies in Historical and Comparative Perspective, in: B. Guy Peters/Bert A. Rockman (Hrsg.), Agenda for Excellence 2: Administering the State, Chatham, NJ: Chatham House, 149– 162. —, 2001: Personalpolitik nach Regierungswechseln, in: Hans-Ulrich Derlien/Axel Murswieck (Hrsg.), Regieren nach Wahlen, Opladen: Leske & Budrich, 39–57. Detterbeck, Klaus/Renzsch, Wolfgang 2002: Politischer Wettbewerb im deutschen Föderalismus, in: Jahrbuch des Föderalismus 2002, Baden-Baden: Nomos, 69– 81. Dittberner, Jürgen, 2005: Die FDP: Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven, Wiesbaden: Verlag für Sozialforschung. Dittgen, Herbert, 1999: Politische Führung in Bonn und in Washington: Formelle und informelle Bedingungen des Regierens im parlamentarischen und präsidentiellen Regierungssystem, in: Tobias Dürr/Franz Walter (Hrsg.), Solidargemeinschaft und fragmentierte Gesellschaft. Parteien, Milieus und Verbände im Vergleich. Festschrift zum 60. Geburtstag von Peter Lösche, Opladen: Leske & Budrich, 249–264. Doering-Manteuffel, 1999: Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Döring, Herbert (Hrsg.), 1995a: Time as Scarce Resource: Government Control of the Agenda, in: Herbert Döring (Hrsg.), Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Frankfurt a.M./New York: Campus, 223–247. — (Hrsg.), 1995b: Parliaments and Majority Rule in Western Europe, Frankfurt a.M./New York: Campus. Dreier, Horst, 2002: Das Europa der Administrationen. Wie die Exekutive dank Integration und Privatisierung ihre Macht erweitert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. Juni, 7. Drummond, Andrew, 2002: Electoral Volatility and Party Decline in Western Democracies: 1970–1995, Center for the Study of Democracy, Paper 02-02, Irvine, California. LITERATUR 285 Dunning, Bruce, 2004: Japanese Television: How Different It Is, in: Television Quarterly 35, No. 1, 37–44. Duverger, Maurice, 1959: Die politischen Parteien, Tübingen: Mohr. —, 1980: A New Political System Model: Semi-Presidential Government, in: European Journal of Political Research 8, 165–187. Dyson, Kenneth, 2001: The German Model Revisited: From Schmidt to Schröder, in: German Politics 10, No. 2, 135–154. Ebbinghaus, Bernhard, 2003: Die Mitgliederentwicklung deutscher Gewerkschaften im historischen und internationalen Vergleich, in: Wolfgang Schroeder/Bernhard Weßels (Hrsg.), Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 176–203. Edinger, Lewis E., 1986: West German Politics, New York: Columbia University Press. Elgie, Robert, 1999: The Politics of Semi-Presidentialism, in: Robert Elgie (Hrsg.), Semi-Presdientialism in Europe, Oxford: Oxford University Press, 1–21. —, 2003: Political Institutions in Contemporary France, Oxford: Oxford University Press. —, 2004: Semi-Presidentialism: Concepts, Consequences and Contesting Explanations, in: Political Studies Review 2, 314–330. Ellwein, Thomas/Hesse, Joachim Jens, 2004: Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, 9. Aufl., Berlin/New York: de Gruyter. Elvert, Jürgen, 2001: Irland: Korporativismus aus Tradition, in: Werner Reutter/Peter Rütters (Hrsg.), Verbände und Verbändesysteme in Westeuropa, Opladen: Leske & Budrich, 198–220. Epstein, Lee/Walker, Thomas G., 2001: Constitutional Law for a Changing America. Institutional Powers and Constraints, 4. Aufl., Washington, DC: Congressional Quarterly Press. Epstein, Leon, 1986: Political Parties in the American Mold, Madison: University of Wisconsin Press. Esterbauer, Fried, 2004: Für eine neue Typologie demokratischer Regierungssysteme: »parlamentarische« als monistische und »präsidentielle« als dualistische Regierungssysteme, in: Stefan Brink/Heinrich Amadeus Wolff (Hrsg.), Gemeinwohl und Verantwortung. Festschrift für Hans Herbert von Arnim zum 65. Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblot, 555–575. Evans, C. Lawrence, 2002: How Senators Decide: An Exploration, in: Bruce I. Oppenheimer (Hrsg.), U.S. Senate Exceptionalism, Columbus, OH: Ohio State University Press, 262–282. Fagagnini, Hans Peter, 1991: Föderalistischer Aufgabenverbund in der Schweiz, Bern: Haupt. Falter, Jürgen W., 1981: Kontinuität und Neubeginn. Die Bundestagswahl 1949 zwischen Weimar und Bonn, in: Politische Vierteljahresschrift 22, 236–263. Farrell, Henry/Knight, Jack, 2003: Trust, Institutions, and Institutional Change, in: Politics & Society 31, 537–566. 286 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Farrell, Henry/Héritier, Adrienne, 2003: Formal and Informal Institutions under Codecision: Continious Constitution-Buildung in Europe, in: Governance 16, 577–600. Fassa, Raimondo, 1996: Eine Antwort auf die Frage: »Was ist Föderalismus?« , in: Günther Ammon et al. (Hrsg.), Föderalismus und Zentralismus: Europas Zukunft zwischen dem deutschen und dem französischen Modell, Baden-Baden: Nomos, 99–113. Faul, Erwin, 1964: Verfemung, Duldung und Anerkennung des Parteiwesens in der Geschichte des politischen Denkens, in: Politische Vierteljahresschrift 5, 61– 80. Featherstone, Kevin, 2003: Introduction: In the Name of ›Europe‹, in: Kevin Featherstone/Radaelli, Claudio M. (Hg.): The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press, 3–26. Fenske, Hans, 1994: Deutsche Parteiengeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Paderborn u.a.: Schöningh. Fickinger, Nico, 2005: Der verschenkte Konsens: das Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit 1998–2002, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Finer, Samuel E., 1997: The History of Government from the Earliest Times. Vol. III: Empires, Monarchies, and the Modern State, Oxford: Oxford University Press. Fish, Steven A., 2006: Stronger Legislatures, Stronger Democracies, in: Journal of Democracy 17, 5–20. Follesdal, Andreas/Hix, Simon, 2006: Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik, in: Journal of Common Market Studies 44, 533–562. Foord, Archibald S., 1964: His Majesty’s Opposition 1714–1830, Oxford: Clarendon Press. Forkmann, Daniela/Schlieben, Michael (Hrsg.), 2005: Die Parteivorsitzenden der Bundesrepublik Deutschland 1949–2005, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Fosh, Patricia/Heery, Edmund (Hrsg.), 1990: Trade Unions and Their Members: Studies in Union Democracy and Organization, Houndmills: Macmillan. Fossedahl, Gregory A., 2002: Direct Democracy in Switzerland, New Brunswick/London: Transaction Publishers. Foundethakis, Penelope, 2002: Die Parteiinstitution in Griechenland, in: Dimitris Th. Tsatsos (Hrsg), 30 Jahre Parteiengesetz in Deutschland. Die Parteiinstitution im internationalen Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 159–166. Fraenkel, Ernst, 1932: Um die Verfassung, in: Die Gesellschaft. Internationale Revue für Sozialismus und Politik 9, 297–312. —, 1964: Der Pluralismus als Strukturelement der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, München/Berlin: Beck. —, 1973: Deutschland und die westlichen Demokratien, 5. Aufl., Stuttgart u.a.: Kohlhammer. LITERATUR 287 Franklin, Daniel P./Baun, Michael J. (Hrsg.), Political Culture and Constitutionalism: A Comparative Approach, Armonk/London: Sharpe. Franklin, Mark N., 2004: Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies since 1945, Cambridge: Cambridge University Press. Franks, C. E. S., 1999: Not Dead Yet, But Should It Be Ressurected? The Canadian Senate, in: Samuel C. Patterson/Anthony Mughan (Hrsg.), Senates: Bicameralism in the Contemporary World, Columbus, OH, 120–161. Frenkel, Max, 1984: Föderalismus und Bundesstaat. Band 1: Föderalismus, Bern u.a.: Lang. Friedrich, Carl J., 1953: Der Verfassungsstaat der Neuzeit, Berlin u.a.: Springer. Fromme, Karl Friedrich, 1960: Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz: die verfassungspolitischen Folgerungen des Parlamentarischen Rates aus Weimarer Republik und nationalsozialistischer Diktatur, Tübingen: Mohr. Fromont, Michel, 1999: Das Bundesverfassungsgericht aus französischer Sicht, in: Die Öffentliche Verwaltung, 493–499. Fuchs, Dieter, 1997: Wohin geht der Wandel der demokratischen Institutionen in Deutschland? Die Entwicklung der Demokratievorstellungen der Deutschen seit ihrer Vereinigung, in: Gerhard Göhler (Hrsg), Institutionenwandel (Leviathan, Sonderheft 16), Opladen: Westdeutscher Verlag, 253–284. Fukaya, Mitsuo, 2001: Amerikanische Besatzungspolitik in Japan 1945–1950 im Vergleich zu Deutschland, in: Andrea Gourd/Thomas Noetzel (Hrsg.), Die Zukunft der Demokratie in Deutschland, Opladen: Leske & Budrich, 323–335. Funk, Lothar, 2006: Rolle und Zukunft der Arbeitgeberverbände in Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 15–16, 24–32. Furuta, Yoshifumi, 2001: Die US-Besatzung und die Entstehung der japanischen Nachkriegsverfassung. Ein Vergleichsmodell zum deutschen Grundgesetz, in: Andrea Gourd/Thomas Noetzel (Hrsg.), Die Zukunft der Demokratie in Deutschland, Opladen: Leske & Budrich, 336–352. Gabriel, Oscar W./Falter, Jürgen W./Rattinger, Hans (Hrsg.), 2005: Wächst zusammen, was zusammen gehört?, Baden-Baden: Nomos. Gallagher, Michael, 2005: Conclusion, in: Michael Gallagher/Paul Mitchell (Hrsg.), The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press, 535–578. Gallagher, Michael/Mitchell, Paul (Hrsg.), 2005: The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press. Gallagher, Michael/Uleri, Pier Vincenzo (Hrsg.), 1996: The Referendum Experience in Europe, London: Macmillan. Gebhardt, Jürgen (Hrsg.), 1999a: Verfassung und politische Kultur, Baden-Baden: Nomos. —, 1999b: Verfassung und politische Kultur in Deutschland, in: Jürgen Gebhardt (Hrsg.), Verfassung und politische Kultur, Baden-Baden: Nomos, 15–30. Gerlich, Peter, 1973: The Institutionalization of European Parliaments, in: Allan Kornberg (Hrsg.), Legislatures in Comparative Perspective, New York: McKay, 94–113. 288 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Gerstlé, Jacques, 2002: Les campagnes présidentielles depuis 1965, in: Pierre Bréchon (Hrsg.), Les élections présidentielles en France, Paris: La documentation française. Glaeßner, Gert-Joachim, 2003: Sicherheit in Freiheit. Die Schutzfunktion des Staates und die Freiheit der Bürger, Opladen: Leske & Budrich. Glatzer, Miguel/Rueschemeyer, Dietrich (Hrsg.), 2005: Globalization and the Future of the Welfare State, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. Glauben, Paul J./Lars Brocker, 2005: Das Recht der parlamentarischen Untersuchungssausschüsse in Bund und Ländern, Köln: Heymann. Göhler, Gerhard, 1987: Institutionenlehre und Institutionentheorie in der deutschen Politikwissenschaft, in: Gerhard Göhler (Hrsg.), Grundfragen der Theorie politischer Institutionen, Opladen: Westdeutscher Verlag, 15–47. Göhler, Gerhard/Iser, Matthias/Kerner, Ina (Hrsg.), 2004: Politische Theorie. 22 umkämpfte Begriffe zur Einführung, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Goldstein, Robert, 1983: Political Repression in 19th Century Europe, London: Croom Helm. Goldwin, Robert A./Kaufman, Art (Hrsg.), 1986: Separation of Powers – Does it Still Work?, Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research. Gorman, Lyn/McLean, David, 2003: Media and Society in the Twentieth Century. A Historical Introduction, Oxford: Blackwell. Graber, Mark A., 1999: The Problematic Establishment of Judicial Review, in: Howard Gillman/Cornell Clayton (Hrsg.), The Supreme Court in American Politics. New Institutionalist Interpretations, Lawrence, KS: University Press of Kansas, 28–42. Grande, Edgar, 2002: Parteiensystem und Föderalismus. Institutionelle Strukturmuster und politische Dynamiken im internationalen Vergleich, in: Arthur Benz/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Föderalismus (Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 32), Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Grant, Wyn, 2002: Civil Society and the Internal Democracy of Interest Groups. Paper Prepared for the annual conference of the Political Studies Association of the UK, Aberdeen, April 2002. Grasmück, Damian, 2005: Die Forza Italia Silvio Berlusconis: Geburt, Entwicklung, Regierungstätigkeit und Strukturen einer charismatischen Partei, Frankfurt a.M. u.a.: Lang. Green, Simon, 2006: Zwischen Kontinuität und Wandel: Migrations- und Staatsangehörigkeitspolitik, in: Manfred G. Schmidt/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 113–134. Greener, Ian, 2005: The Potential of Path Dependence in Political Studies, in: Politics 25, 62–72. Greven, Michael Th., 2000: Die Beteiligung von Nicht-Regierungs-Organisationen als System wachsender Informalisierung des Regierens, in: Vorgänge 39, Nr. 3, 3–12. LITERATUR 289 —, 2002: Charismatische Herrschaft und Vertrauen in Neuen Sozialen Bewegungen. Demokratietheoretische Probleme – lebensweltliche Erfahrungen, in: Vorgänge 41, Nr. 4, 4–16. Grimm, Dieter, 1991: Die Grundrechte im Entstehungszusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft, in: Dieter Grimm, Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 67–100. —, 2003: Läßt sich die Verhandlungsdemokratie konstitutionalisieren?, in: Claus Offe (Hrsg.), Demokratisierung der Demokratie, Frankfurt a.M./New York: Campus, 193–210. Grosser, Dieter, 1975: Die Sehnsucht nach Harmonie: Historische und verfassungsstrukturelle Vorbelastungen der Opposition in Deutschland, in: Heinrich Oberreuter (Hrsg.), Parlamentarische Opposition. Ein internationaler Vergleich, Hamburg: Hoffmann & Campe, 206–229. Guggenberger, Bernd, 1998: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und die institutionelle Balance des demokratischen Verfassungsstaates, in: Bernd Guggenberger/Thomas Würtenberger (Hrsg.), Hüter der Verfassung oder Lenker der Politik? Das Bundesverfassungsgericht im Widerstreit, BadenBaden: Nomos, 202–232. Guigni, Marco, 2004: Social Protest and Policy Change: Ecology, Antinuclear, and Peace Movements in Comparative Perspective, Lanham: Rowman & Littlefield. Guiraudon, Virginie/Jileva, Elena, 2006: Immigration and Asylum, in: Paul M. Heywood/Erik Jones/Martin Rhodes and Ulrich Sedelmeier (Hrsg.), Developments in European Politics, London: Palgrave Macmillan, 280–298. Gunther, Richard/Diamond, Larry, 2003: Species of Political Parties: A New Typology, in: Journal of Democracy 9, No. 2, 167–199. Gusy, Christoph, 1997: Die Weimarer Reichsverfassung, Tübingen: Mohr Siebeck. Haas, Marcus, 2006: Kostenlose Pendlerzeitungen in Europa, in: Media Perspektiven, 510–520. Häberle, Peter, 1998: Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot. Hagelstein, Bilfried, 1992: Die Rechtsstellung der Fraktionen im deutschen Parlamentswesen, Frankfurt a.M.: Fischer. Hallin, Daniel C./Mancini, Paolo, 2004: Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge: Cambridge University Press. Hanf, Dominik, 1999: Bundesstaat ohne Bundesrat? Die Mitwirkung der Glieder und die Rolle zweiter Kammern in evolutiven und devolutiven Bundesstaaten. Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Baden-Baden: Nomos. Hartmann, Jürgen, 1992: Interessenverbände, in: Oscar W. Gabriel (Hrsg.), Die EG-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte, Opladen: Westdeutscher Verlag, 256–274. —, 2004: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland im Kontext, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Hassel, Anke/Williamson, Hugh, 2004: The Evolution of the German Model: How to Judge Reforms in Europe’s Largest Econoncy, Paper prepared for the Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, Berlin. 290 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Hauenschild, Wolf-Dieter, 1968: Wesen und Rechtsnatur der parlamentarischen Fraktionen, Berlin: Dunker & Humblot. Haungs, Peter, 1968: Reichspräsident und parlamentarische Kabinettsregierung. Eine Studie zum Regierungssystem der Weimarer Republik in den Jahren 1924 bis 1929, Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag. Hefty, Julia, 2005: Die parlamentarischen Staatssekretäre im Bund: eine Entwicklungsgeschichte seit 1967, Düsseldorf: Droste. Heidar, Knut/Koole, Ruud (Hrsg.), 2000: Parliamentary Party Groups in European Democracies: Political Parties Behind Closed Doors, London/New York: Routledge. Heinze, Rolf G., 1992: Verbandspolitik zwischen Partikularinteressen und Gemeinwohl – Der Deutsche Bauernverband, Gütersloh: Verlag der Bertelsmann-Stiftung. Heitmeyer, Wilhelm, 2001: Autoritärer Kapitalismus, Demokratieentleerung und Rechtspopulismus. Eine Analyse von Entwicklungstendenzen, in: Dietmar Loch/Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Schattenseiten der Globalisierung. Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und separatistischer Regionalismus in westlichen Demokratien, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 497–534. Held, David/McGrew, Anthony (Hrsg.), 2003: Governing Globalization: Power, Authority and Global Goverance, Cambridge: Polity Press. Helmke, Gretchen/Levitsky, Steven, 2004: Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda, in: Perspectives on Politics 2, 725–739. —, (Hrsg), 2006: Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America, Baltimore: Johns Hopkins University Press. Helms, Ludger, 1994: Strukturwandel im italienischen Parteiensystem, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 34, 28–37. —, 1996: Das Amt des deutschen Bundeskanzlers in historisch und international vergleichender Perspektive, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 27, 697–711. —, 1998: Keeping Weimar at Bay: The German Federal Presidency since 1949, in: German Politics and Society 16, No. 3, 50–68. —, (Hrsg.), 1999a: Parteien und Fraktionen. Ein internationaler Vergleich, Opladen: Leske & Budrich. —, 1999b: Einleitung: Parteien und Fraktionen in westlichen Demokratien, in: Ludger Helms (Hrsg.), Parteien und Fraktionen. Ein internationaler Vergleich, Opladen: Leske & Budrich, 8–39. —, 1999c: Die historische Entwicklung und politische Bedeutung des Kabinetts im Regierungssystem der USA, in: Politische Vierteljahresschrift 40, 65–92. —, 1999d: Entwicklungslinien der Verfassungsgerichtsbarkeit in der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, in: Eckhard Jesse/Konrad Löw (Hrsg.), 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Berlin, 141–164. —, 2000: Parliamentary Party Groups and Their Parties: A Comparative Assessment, in: The Journal of Legislative Studies 6, 104–120. —, 2001a: Die »Kartellparteien«-These und ihre Kritiker, in: Politische Vierteljahresschrift 42, 698–708. LITERATUR 291 —, 2001b: Der parlamentarische Gesetzgebungsprozeß in Großbritannien. Ein Vergleich mit den Verfahrensregeln im Deutschen Bundestag und Bundesrat, in: Der Staat 40, 405–419. —, 2002a: Politische Opposition. Theorie und Praxis in westlichen Regierungssystemen, Opladen: Leske & Budrich. —, 2002b: »Chief Executives« and their Parties: The Case of Germany, in: German Politics 11, No. 3, 145–164. —, 2003a: Verfassung, in: Eckhard Jesse/Roland Sturm (Hrsg.), Demokratien des 21. Jahrhunderts im Vergleich. Historische Zugänge, Gegenwartsprobleme, Reformperspektiven, Opladen: Leske & Budrich, 137–159. —, 2003b: Executive Leadership and the Role of »Veto Players« in the United States and Germany, Working Paper No. 03.02, Program for the Study of Germany and Europe, Center for European Studies, Harvard University, Cambridge, MA. —, 2004: Einleitung: Politikwissenschaftliche Institutionenforschung am Schnittpunkt von Politischer Theorie und Regierungslehre, in: Ludger Helms/Uwe Jun (Hrsg.), Politische Theorie und Regierungslehre. Eine Einführung in die politikwissenschaftliche Institutionenforschung, Frankfurt a.M./New York: Campus, 13–44. —, 2005a: Regierungsorganisation und politische Führung in Deutschland, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. —, 2005b: The Presidentialisation of Political Leadership: British Notions and German Observations, in: The Political Quarterly 76, 430–438. —, 2005c: Presidents, Prime Ministers and Chancellors: Executive Leadership in Western Democracies, London: Palgrave Macmillan. —, 2005d: Die Informalisierung des Regierungshandelns in der Bundesrepublik: Ein Vergleich der Regierungen Kohl und Schröder, in: Zeitschrift für Staatsund Europawissenschaften / Journal of Comparative Government and European Policy 3, 70–96. —, 2005e: Der Wandel politischer Kontrolle in den parlamentarischen Demokratien Westeuropas, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 35, 390–410. —, 2006a: The Grand Coalition: Precedents and Prospects, in: German Politics and Society 24, No. 1, 47–66. —, 2006b: Amerikanisierung, Britannisierung, Italienisierung? Das Parteiensystem im internationalen Vergleich, in: Eckhard Jesse/Roland Sturm (Hrsg.), Bilanz der Bundestagswahl 2005: Voraussetzungen, Ergebnisse, Folgen, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 281–294. —, 2006c: The Changing Parameters of Political Control in Western Europe, in: Parliamentary Affairs 59, 78–97. Hennis, Wilhelm, 1968: Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Ein deutsches Problem, Tübingen: Mohr. —, 1973: Die missverstandene Demokratie. Demokratie – Verfassung – Parlament. Studien zu deutschen Problemen, Freiburg: Herder. —, 1998: Auf dem Weg in den Parteienstaat. Aufsätze aus vier Jahrzehnten, Ditzingen: Reclam. 292 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Hennis, Wilhelm/Kielmansegg, Peter Graf/Matz, Ulrich (Hrsg.), 1977: Regierbarkeit: Studien zu ihrer Problematisierung, Bd. 1, Stuttgart: Klett-Cotta. — (Hrsg.), 1979: Regierbarkeit: Studien zu ihrer Problematisierung, Bd. 2, Stuttgart: Klett-Cotta. Hermens, Ferdinand, 1951: Demokratie oder Anarchie?, Frankfurt a.M.: Metzner. Herzog, Dietrich, 1997: Die Führungsgremien der Parteien: Funktionswandel und Strukturentwicklungen, in: Oscar W. Gabriel/Oskar Niedermayer/Richard Stöss (Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 301–322. Hesse, Joachim Jens/Benz, Arthur, 1990: Die Modernisierung der Staatsorganisation. Institutionspolitik im internationalen Vergleich: USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden: Nomos. Hesse, Joachim Jens/Rentzsch, Wolfgang, 1990: Zehn Thesen zur Entwicklung und Lage des deutschen Föderalismus, in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 1, 562–578. Heun, Werner, 2004: Wahl der Richter des Verfassungsgerichts, in: Christian Starck (Hrsg.), Fortschritte der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt – Teil I. Deutsch-Japanisches Kolloquium vom 20. bis 24. September in Tokio und Kioto, Baden-Baden, 209–223. Heywood, Paul/Wright, Vincent, 1997: Executives, Bureaucracies and DecisionMaking, in: Martin Rhodes/Paul Heywood/Vincent Wright (Hrsg.), Developments in West European Politics, London: Macmillan, 75–94. Hickethier, Knut, 1998: Geschichte des deutschen Fernsehens, Stuttgart/Weimar: Metzler. Hildebrand, Klaus, 1984: Von Erhard zu Großen Koalition 1963–1969, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. Hirczy de Miño, Wolfgang P., Compulsory Voting, in: Richard Rose (Hrsg.), International Encyclopedia of Elections, Washington, DC: Congressional Quarterly Press, S. 44–47. Hirose, Katsuya, 1994: Government and Administration under Liberal Democrat Rule, in: Helen Margetts/Gareth Smith (Hrsg.), Turning Japanese? Britain with a Permament Party of Government, London: Lawrence & Wishart, 56–68. Holden, Barry, 1993: Understanding Liberal Democracy, 2. Aufl., New York u.a.: Harvester Wheatsheaf. Horowitz, Donald L., 2003: Electoral Systems: A Primer for Decision Makers, in: Journal of Democracy 14, No. 3, 117–127. Huber, John/Inglehart, Ronald, 1995: Expert Interpretations of Party Space and Party Locations in 42 Societies, in: Party Politics 1, 73–111. Hufen, Friedhelm, 2000: »Entfundamentalisierung« als Konstitutionsprinzip der modernen Demokratie, in: Joseph Marko/Günther R. Burkert-Dottolo (Hrsg.), Multikulturelle Gesellschaft und Demokratie, Baden-Baden: Nomos, 21–29. Humphreys, Peter J., 1986: Mass Media and Media Policy in Western Europe, Manchester/New York: Manchester University Press. —, 1990: Media and Media Policy in West Germany. The Press and Broadcasting since 1945, New York: Berg. LITERATUR 293 Huntington, Samuel P., 1968: Political Order in Changing Societies, New Haven/London: Yale University Press. Ignazi, Piero (Hrsg.), 2003: Extreme Right Parties in Western Europe, Oxford: Oxford University Press. Immergut, Ellen, 1998: The Theoretical Core of the New Institutionalism, in: Politics and Society 26, 5–34. Inglehart, Ronald, 1989: Kultureller Umbruch: Wertewandel in der westlichen Welt, Frankfurt a.M./New York: Campus. Inoue, Noriyuki, 2004: Die Verfassung und die Grundrechte für die japanischen Bürger: eine Eigentümlichkeit der Verfassungskultur in der japanischen Gesellschaft, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 52, 103–113. Ismayr, Wolfgang, 2000: Der Deutsche Bundestag im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske & Budrich. —, 2001: Parteien in Bundestag und Bundesregierung, in: Oscar W. Gabriel/Oskar Niedermayer/Richard Stöss (Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland, 2. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag, 360–384. Jachtenfuchs, Markus, 2006: Das Gewaltmonopol: Denationalisierung oder Fortbestand?, in: Stephan Leibfried/Michael Zürn (Hrsg.), Transformationen des Staates, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 69–91. Jacob, Holger, 1998: Überhangmandat und Gleichheit der Wahl. Ein Beitrag zur aktuellen Wahlrechtsdiskussion, Frankfurt a.M. u.a.: Lang. Jacobs, F. G., 1999: Public Law – The Impact of Europe, in: Public Law, 232–245. Jäger, Wolfgang, 1971: Politische Partei und parlamentarische Opposition. Eine Studie zum politischen Denken von Lord Bolingbroke und David Hume, Berlin: Duncker & Humblot. —, 1986: Die Innenpolitik der sozial-liberalen Koalition 1969–1974, in: Karl Dietrich Bracher/Wolfgang Jäger/Werner Link, Republik im Wandel 1969– 1974. Die Ära Brandt, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 15–160. —, 1994: Wer regiert die Deutschen? Innenansichten der Parteiendemokratie, Osnabrück: Fromm. Jarren, Otfried, 2001: »Mediengesellschaft« – Risiken für die politische Kommunikation, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 41–42, 10–19. Jarren, Otfried/Donges, Patrick, 2006: Medienpolitik zwischen Politikverzicht, parteipolitischer Interessenwahrnehmung und transnationalen Einflüssen, in: Manfred G. Schmidt/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Regieren in der Bundesrepublik. Innen- und Außenpolitik seit 1949, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 385–403. Jaschke, Hans-Gerd, 1992: Streitbare Demokratie und innere Sicherheit. Grundlagen, Praxis und Kritik, Opladen: Westdeutscher Verlag. Jesse, Eckhard, 1980: Streitbare Demokratie. Theorie, Praxis und Herausforderungen in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Colloquium-Verlag. —, 1985: Wahlrecht zwischen Kontinuität und Reform. Eine Analyse der Wahlsystemdiskussion und der Wahlrechtsänderungen in der Bundesrepublik Deutschland, Düsseldorf: Droste. 294 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE —, 1992: Wahlsysteme und Wahlrecht, in: Oscar W. Gabriel (Hrsg.), Die EGStaaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte, Opladen: Westdeutscher Verlag, 172–191. —, 1997: Die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland, 8. Aufl., Baden-Baden: Nomos. —, 2003: Reformvorschläge zur Änderung des Wahlrechts, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52, 3–11. —, 2006: Parteiensystem im Wandel? Das deutsche Parteiensystem vor und nach der Bundestagswahl 2005, in: Eckhard Jesse/Roland Sturm (Hrsg.), Bilanz der Bundestagswahl 2005. Voraussetzungen, Ergebnisse, Folgen, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 21–41. Jesse/Roland Sturm (Hrsg.), Demokratien des 21. Jahrhunderts im Vergleich. Historische Zugänge, Gegenwartsprobleme, Reformperspektiven, Opladen: Leske & Budrich. Jochem, Sven/Siegel, Nico A. (Hrsg.), 2002: Konzertierung, Verhandlungsdemokratie und Reformpolitk im Wohlfahrtsstaat: Das Modell Deutschland im Vergleich, Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Johnson, Nevil, 1992: ›Party Government‹ und Parteienstaat: Vergleichende Überlegungen zur Rolle der politischen Parteien in Deutschland und Großbritannien, in: Karl Rohe/Gustav Schmidt/Hartmut Pogge von Strandmann (Hrsg.), Deutschland – Großbritannien – Europa, Bochum: Brockmeyer, 323–346. —, 1994: The Federal Constitutional Court: Facing up to the Strains of Law and Politics in the New Germany, in: German Politics 3, 131–148. Judge, David, 2003: Legislative Institutionalization: A Bent Analytical Arrow, in: Government and Opposition 39, 497–516. —, 2005: Political Institutions in the United Kingdom, Oxford: Oxford University Press. Jun, Uwe, 2004: Parteien und Parteiensystem, in: Ludger Helms/Uwe Jun (Hrsg.), Politische Theorie und Regierungslehre: Eine Einführung in die politikwissenschaftlichen Institutionenforschung, Frankfurt a.M./New York: Campus, 163– 193. Kaase, Max, 1994: Is there a Personalization in Politics? Candidates and Voting Behaviour in Germany, in: International Political Science Review 15, 211–230. Kady II, Martin, 2006: Learning to Stick Together, in: Congressional Quarterly Weekly Report 64, 92–95. Kahl, Martin, 2006: Die EU und der Kampf gegen den Terrorismus – die schwierige Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, in: Sicherheit + Frieden 24, 123–128. Kaiser, André, 2002: Gemischte Wahlsysteme. Ein Vorschlag zur typologischen Einordnung, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 12, 1545–1571. Kaltefleiter, Werner, 1991: Parlamentsauflösung in parlamentarischen Demokratien, in: Jahrbuch für Politik 1, 247–268. Kassim, Hussein, 2005: The Europeanization of Member State Institutions, in: Simon Bulmer/Christian Lequesne (Hrsg.), The Member States of the European Union, Oxford: Oxford University Press, 285–316. LITERATUR 295 Katz, Richard (Hrsg.), 1987: Party Government: European and American Experiences, Berlin/New York: de Gruyter. —, 2005: Why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?, in: Michael Gallagher/Paul Mitchell (Hrsg.), The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press, 57–76. Katz, Richard S./Mair, Peter, 1995: Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, in: Party Politics 1, 5– 28. Katzenstein, Peter, 1987: Policy and Politics in West-Germany: The Growth of a Semisovereign State, Philadelphia: Temple University Press. Kawata, Junichi (Hrsg.), 2006: Comparing Political Corruption and Clientilism, Aldershot: Ashgate. Kenyon, Daphne A./Kincaid, John, 1996: Fiscal Federalism in the United States: The Reluctance to Equalize Jurisdiction, in: Werner W. Pommerehne/Georg Ress (Hrsg.), Finanzverfassung im Spannungsfeld zwischen Zentralstaat und Gliedstaaten, Baden-Baden: Nomos, 34–56. Kersting, Norbert, 2004: Briefwahl im internationalen Vergleich?, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 33, 341–351. Kießling, Andreas, 2001: Von der Krise zur Erneuerung? Parteireform in Deutschland, in: Rissener Rundbrief, Oktober/November, 31–46. Kimmel, Adolf, 1996: Nation, Republik, Verfassung in der französischen politischen Kultur, in: Theo Stammen u.a. (Hrsg.), Politik – Bildung – Religion. Hans Maier zum 65. Geburtstag, Paderborn u.a.: Schöningh, 423–432. —, 1998: La cohabitation à l’allemande, in: Pouvoirs, No. 84, 177–189. Kincaid, John, 2001: Devolution in the United States: Rhetorik and Reality, in: Kalypso Nicholaidis/Robert Howse (Hrsg.), The Federal Vision: Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the European Union, Oxford University Press, 144–160. King, Anthony, 1994: »Chief Executives« in Western Europe, in: Ian Budge/David McKay (Hrsg.), Developing Democracy. Comparative Research in Honour of J.F.P. Blondel, London: Macmillan, 150–163. —, 2001: Parliaments in the Modern World: What are they for?, in: Christiane Eisenberg, (Hrsg.), Parliamentary Cultures: British and German Perspectives, Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 90–97. — (Hrsg.), 2002: Leaders’ Personalities and the Outcomes of Democratic Elections, Oxford: Oxford University Press. Kirchheimer, Otto, 1965: Der Wandel des westeuropäischen Parteiensystems, in: Politische Vierteljahresschrift 6, 20–41. Kirchner, Emil J. (Hrsg.), 1988: Liberal Parties in Western Europe, Cambridge: Cambridge University Press. Kitschelt, Herbert, 1994: The Transformation of European Social Democracy, Cambridge: Cambridge University Press. Kjær, Anne Mette, 2004: Governance, Cambridge: Polity Press, 2004. Kleger, Heinz, 1999: Was heißt: »Die Idee der Demokratie ist reflexiv geworden?«, in: Studia philosophica 58, 167–195. 296 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Klein, Hans Hugo, 2004: Austritt, Ausschluss, Rechte: Der fraktionslose Abgeordnete, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 35, 627–632. Klein, Markus, 2004: Wahlen und Wahlsystem, in: Ludger Helms/Uwe Jun (Hrsg.), Politische Theorie und Regierungslehre. Eine Einführung in die politikwissenschaftliche Institutionenforschung, Frankfurt a.M./New York: Campus, 219– 238. Kleinfeld, Ralf, 2001: Niederlande: Verbände, Konkordanzdemokratie und Versäulung, in: Werner Reutter/Peter Rütters (Hrsg.), Verbände und Verbandssysteme in Westeuropa, Opladen: Leske & Budrich, 287–312. Kleinheyer, Gerd, 1975: Grundrechte, Menschen- und Bürgerrechte, Volksrechte, in: Otto Brunner/Werner Conze/Rainer Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2, Stuttgart: Ernst Klett, 1047–1081. Kleinsteuber, Hans J., 1982: Rundfunkpolitik in der Bundesrepublik, Opladen: Leske & Budrich. —, 2003: Mediensysteme im internationalen Vergleich, in: Günter Bentele/HansBernd Brosius/Otfried Jarren (Hrsg.), Öffentliche Kommunikation. Handbuch Kommunikations- und Medienwissenschaft, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 382–396. —, 2004: Germany, in: Mary Kelly/Gianpietro Mazzoleni/Denis McQuail (Hrsg.), The Media in Europe. The Euromedia Handbook, London: Sage, 78–87. Klingemann, Hans-Dieter/Fuchs, Dieter/Zielonka, Jan (Hrsg.), 2006: Democracy and Political Culture in Eastern Europe, London/New York: Routledge. Kluxen, Kurt, 1991: Geschichte Englands, 4. Aufl., Stuttgart u.a.: Kröner. Knaak, Thomas Peter, 1995: Der Einfluß der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit auf das System der Verfassungsgerichtsbarkeit in Spanien, Diss., Hamburg. Kneip, Sascha/Petring, Alexander, 2006: Die Reformvorschläge der Verfassung für Europa und das Demokratiedefizit der EU, in: Jens Alber/Wolfgang Merkel (Hrsg.), Europas Osterweitung: Das Ende der Vertiefung, Berlin: Edition Sigma, 207–229. Knight, Barbara B. (Hrsg.), 1989: Separation of Powers in the American Political System, Fairfax, Virginia: George Mason University Press. Knoll, Thomas, 2004: Das Bonner Bundeskanzleramt. Organisation und Funktionen von 1949–1999, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Knorr, Heribert, 1975: Der parlamentarische Entscheidungsprozeß während der Großen Koalition 1966 bis 1969, Meisenheim am Glan: Hain. Knutsen, Oddbjørn, 1998: Expert Judgement of the Left-Right Location of Political Parties, in: West European Politics 21, No.2, 63–94. Kocka, Jürgen, 1999: Asymmetrical Historical Comparison: The Case of the German Sonderweg, in: History and Theory 38, No. 1, 40–50. Kohl, Jürgen, 1982: Zur langfristigen Entwicklung der politischen Partizipation in Westeuropa, in: Peter Steinbach (Hrsg.), Probleme politischer Partizipation im Modernisierungsprozeß, Stuttgart: Klett-Cotta, 473–503. Kolinsky, Eva, 1993: Das Parteiensystem der Bundesrepublik: Forschungsthemen und Entwicklungslinien, in: Oskar Niedermayer/Richard Stöss (Hrsg.), Stand LITERATUR 297 und Perspektiven der Parteienforschung, Opladen: Westdeutscher Verlag, 35– 56. Köllner, Patrick, 2005: 50 Jahre LDP: Aufstieg, Erfolgsquellen und Perspektiven der dominanten Partei Japans, in: Japan aktuell 13, Nr. 4, 23–32. —, 2006: Die Machtposition des japanischen Regierungschefs. Grundlegende institutionelle Parameter und jüngere Entwicklungen, in: Japanstudien 18, 271– 301. Kommers, Donald P., 1997: The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 2. Aufl., Durham: Duke University Press. Korte, Karl-Rudolf/Hirscher, Gerhard (Hrsg.), 2000: Darstellungspolitik oder Entscheidungspolitik? Über den Wandel von Politikstilen in westlichen Demokratien, München: Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Koszyk, Kurt, 1986: Pressepolitik für Deutsche 1945–1949, Berlin: ColloquiumVerlag. Kotzor, Uta, 2002: Finanzverfassung vor und nach der Wiedervereinigung, Diss., Frankfurt a.M. Kranenpohl, Uwe, 2004: Funktionen des Bundesverfassungsgerichts. Eine politikwissenschaftliche Analyse, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 50–51, 39–46. Krammer, Josef/Hovorka, Gerhard, 2006: Interessenorganisation der Landwirtschaft: Landwirtschaftskammern, Präsidentenkonferenz und Raiffeisenverband, in: Herbert Dachs u.a. (Hrsg.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. Die Zweite Republik, Wien: Manz, 480–492. Krauss, Ellis S., 1996: The Mass Media and Japanese Politics: Effects and Consequences, in: Susan J. Pharr/Ellis S. Krauss (Hrsg.), Media and Politics in Japan, Honolulu: University of Hawai’i Press, 355–372. Kriesi, Hanspeter, 2003: Strategische politische Kommunikation: Bedingungen und Chancen der Mobilisierung öffentlicher Meinung im internationalen Vergleich, in: Frank Esser/Barbara Pfetsch (Hrsg.), Politische Kommunikation im internationalen Vergleich. Grundlagen, Anwendungen, Perspektiven, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 208–239. Kriesi, Hanspeter/Koopmans, Ruud/Cuyvendak, Jan Willem/Giugni, Marco G., 1995: New Social Movements in Western Europe. A Comparative Analysis, Minneapolis: University of Minnesota Press. Kronenberg, Volker, 2006: Patriotismus in Deutschland. Perspektiven für eine weltoffene Nation, 2. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Kropp, Sabine, 2003: Verbände und Interessenpolitik, in: Eckhard Jesse/Roland Sturm (Hrsg.), Demokratien im Vergleich. Historische Zugänge, Gegenwartsprobleme, Reformperspektiven, Opladen: Leske & Budrich, 233–259. Kselman, Thomas/Buttigieg, Joseph A. (Hrsg.), 2003: European Christian Democracy: Historical Legacies and Comparative Perspectives, Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press. Kudo, Tatsuro, 2004: Richter in der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Christian Starck (Hrsg.), Fortschritte der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt – Teil I. Deutsch-Japanisches Kolloquium vom 20. bis 24. September in Tokio und Kioto, Baden-Baden: Nomos, 225–233. 298 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Kwon, Hyeong-ki, 2002: The German Model Reconsidered, in: German Politics and Society 20, No. 4, 48–72. Laakso, Markku/Taagepera, Rein, 1979: »Effective« Number of Parties. A Measure with Application to West Europe, in: Comparative Political Studies 12, 3–27. Landfried, Christine, 1984: Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, BadenBaden: Nomos. — (Hrsg.), 1988: Constitutional Review and Legislation. An International Comparison, Baden-Baden: Nomos. —, 1994a: Parteifinanzen und politische Macht, Baden-Baden: Nomos. —, 1994b: The Judicialization of Politics in Germany, in: International Political Science Review 15, 113–124. Lane, Jan-Erik, 1996: Constitutions and Political Theory, Manchester: Manchester University Press. Lang, Jürgen P., 2003: Ist die PDS eine extremistische Partei? Eine extremismustheoretische Untersuchung, Baden-Baden: Nomos. Lange, Erhard H. M., 1975: Wahlrecht und Innenpolitik. Entstehungsgeschichte und Analyse der Wahlgesetzgebung und Wahlrechtsdiskussion im westlichen Nachkriegsdeutschland 1945–1956, Meisenheim am Glan: Hain. Lange, Hans-Jürgen, 2006: Innere Sicherheit und der Wandel von Staatlichkeit, in: Manfred G. Schmidt/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 88–112. LaPalombara, Joseph/Weiner, Myron, 1966: The Origin and Development of Political Parties, in: Joseph LaPalombara/Myron Weiner (Hrsg.), Political Parties and Political Development, Princeton: Princeton University Press, 3–42. Laski, Harold, 1925: A Grammar of Politics, London: Allen & Unwin. Laufer, Heinz, 1970: Der Bundesrat als Instrument der Opposition?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 1, 318–341. Laufer, Heinz/Münch, Ursula, 1998: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske & Budrich. Lauth, Hans-Joachim, 2000: Informal Institutions and Democracy, in: Democratization 7, 21–50. Laver, Michael/Schofield, Norman, 1990: Multiparty Government, Cambridge: Cambridge University Press. Laver, Michael/Shepsle, Kenneth A. (Hrsg.), 1994: Cabinet Ministers and Parliamentary Government, Cambridge: Cambridge University Press. Laver, Michael/W. Ben Hunt, 1992: Policy and Party Competition, London/New York: Routledge. Layman, Geoffrey C./Carsey, Thomas M./Horowitz, Juliana Menasce, 2006: Party Polarization in American Politics: Characteristics, Causes, and Consequences, in: Annual Review of Political Science 9, 83–110. LeDuc, Lawrence, 2002: Referendums and Initiatives: The Politics of Direct Democracy, in: Lawrence LeDuc/Richard G. Niemi/Pippa Norris (Hrsg.), Comparing Democracies 2. New Challenges in the Study of Elections and Voting, London: Sage, 70–87. LITERATUR 299 Leggewie, Claus, 1990: Bloß kein Streit. Über deutsche Sehnsucht nach Harmonie und die anhaltenden Schwierigkeiten demokratischer Streitkultur, in: Ulrich Sarcinelli (Hrsg.), Demokratische Streitkultur. Theoretische Grundpositionen und Handlungsalternativen in Politikfeldern, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 52–62. Leggewie, Claus/Meier, Horst, 1995: Republikschutz. Maßstäbe für die Verteidigung der Demokratie, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Lehmbruch, Gerhard, 1974: A Non-competitive Pattern of Conflict Management in Liberal Democracies: The Case of Switzerland, Austria and Lebanon, in: Kenneth McRae (Hrsg.), Consociational Democracy: Political Accomodation in Segmented Societies, Toronto: McClelland and Stewart, 90–97. —, 1976: Parteienwettbewerb im Bundesstaat, Stuttgart: Kohlhammer. —, 1977: Liberal Corporatism and Party Government, in: Comparative Political Studies 10, 91–126. —, 1982: Neo-corporatisms in Comparative Perspective, in: Gerhard Lehmbruch/ Philippe Schmitter (Hrsg.), Patterns of Corporatist Policy-making, London/ Beverly Hills: Sage, 1–28. —, 1987: Administrative Interessenvermittlung, in: Adrienne Windhoff-Héritier (Hrsg.), Verwaltung und ihre Umwelt. Festschrift für Thomas Ellwein, Opladen: Westdeutscher Verlag, 11–43. —, 1999a: Das Staatsoberhaupt in den parlamentarischen Demokratien Europas, in: Eberhard Jäckel/Horst Möller/Hermann Rudolph (Hrsg.), Von Heuss bis Herzog. Die Bundespräsidenten im politischen System der Bundesrepublik, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 108–128. —, 1999b: Die Große Koalition und die Institutionalisierung der Verhandlungsdemokratie, in: Max Kaase/Günther Schmid (Hrsg.), Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Edition Sigma, 41–61. —, 2000a: Bundesstaatsreform als Sozialtechnologie? Pfadabhängigkeit und Verteilungsspielräume im deutschen Föderalismus, in: Jahrbuch des Föderalismus 2000, Baden-Baden: Nomos, 71–93. —, 2000b: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme und Spannungslagen im Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag. —, 2002: Der unitarische Bundesstaat in Deutschland: Pfadabhängigkeit und Wandel, in: Arthur Benz/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Föderalismus. Analysen in entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Perspektive, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 53–110. —, 2003: Das deutsche Verbändesystem zwischen Unitarismus und Föderalismus, in: Renate Mayntz/Wolfgang Streeck (Hrsg.), Die Reformierbarkeit der Demokratie. Innovationen und Blockaden, Frankfurt a.M./New York: Campus, 259–288. Leibfried, Stephan/Zürn, Michael, 2006: Von der nationalen zur post-nationalen Konstellation, in: Stephan Leibfried/Michael Zürn (Hrsg.), Transformationen des Staates, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 19–65. Leicht, Robert, 1993: Wenn der Beton sich lockert, in: Die Zeit, 18. Juni 1993, 1. 300 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Leisner, Walter, 1998: Demokratie: Betrachtungen zur Entwicklung einer gefährdeten Staatsform, Berlin: Duncker & Humblot. Lemke-Müller, Sabine, 1999: Abgeordnete im Parlament. Zur Parlamentskultur des Deutschen Bundestages in den neunziger Jahren, Rheinbreitbach: Neue Darmstädter Verlagsanstalt. Lepsius, Rainer M., 1990: Die Prägung der politischen Kultur der Bundesrepublik durch institutionelle Ordnungen, in: Rainer M. Lepsius, Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen: Westdeutscher Verlag, 63–84. Leunig, Sven, 2004: Länder- versus Parteiinteressen im Bundesrat. Realer Dualismus oder fiktive Differenzierung?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 50–51, 33–38. Lhotta, Roland, 2000: Konsens und Konkurrenz in der konstitutionellen Ökonomie bikameraler Verhandlungsdemokratie. Der Vermittlungsausschuß als effiziente Institution politischer Deliberation, in: Everhard Holtmann/Helmut Voelzkow (Hrsg.), Zwischen Wettbewerbs- und Verhandlungsdemokratie. Analysen zum Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 79–103. Lietzmann, Hans, 1985: Das Bundesverfassungsgericht. Eine sozialwissenschaftliche Studie, Opladen: Westdeutscher Verlag. Lijphart, Arend, 1984: Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven/London: Yale University Press. —, 1985: The Field of Electoral Systems Research: A Critical Survey, in: Electoral Studies 4, 3–14. —, (Hrsg.), 1992: Parliamentary versus Presidential Government, Oxford: Oxford University Press. —, 1994: Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies 1945–1990, Oxford: Oxford University Press. —, 1999: Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in ThirtySix Countries, New Haven/London: Yale University Press. —, 2005: Foreword, in: Michael Gallagher/Paul Mitchell (Hrsg.), The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press, vii–x. Limbach, Jutta, 1999: Mißbrauch des Bundesverfassungsgerichts durch die Politik?, in: Gegenwartskunde 48, 11–18. Limmer, Christoph, 2005: Fernsehempfang und PC/Online-Ausstattung in Europa, in: Media Perspektiven, 478–485. Linder, Wolf, 1994: Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, London: Macmillan. Linder, Wolf/Vatter, Adrian, 2001: Institutions and Outcomes of Swiss Federalism: The Role of the Cantons in Swiss Politics, in: Jan-Erik Lane (Hrsg.), The Swiss Labyrinth. Institutions, Outcomes and Redesign, London: Cass, 95–122. Linz, Juan/Valenzuela, Arturo (Hrsg.), 1994: The Failure of Presidential Democracy. Volume 1: Comparative Perspectives, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. LITERATUR 301 Lipset, Seymour M., 1996: American Exceptionalism: A Double-Edged Sword, New York: Norton. Lipset, Seymour M./Rokkan, Stein, 1967: Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignements: An Introduction, in: Seymour M. Lipset/Stein Rokkan (Hrsg.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York: Free Press, 1–64. Loch, Dietmar/Heitmeyer (Hrsg.), 2001: Schattenseiten der Globalisierung. Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und separatistischer Regionalismus in westlichen Demokratien, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Loewenberg, Gerhard, 1997: Parliamentarism, Presidentialism and Semi-Presidentialism: The Search for a Mixed System in Twentieth Century Europe, paper delivered at the German Political Science Association Conference, 13–17 October 1997, Bamberg. Loewenstein, Karl, 1957: Political Power and the Governmental Process: Chicago: University of Chicago Press. —, 2000: Verfassungslehre, 4. Aufl., Tübingen: Mohr. Lösche, Peter, 1989: Amerika in Perspektive. Politik und Gesellschaft der Vereinigten Staaten, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. —, 1994: Kleine Geschichte der deutschen Parteien, 2. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer. —, 2000: Der Bundestag – kein ›trauriges‹, kein ›ohnmächtiges‹ Parlament, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 31, 926–936. —, 2002: Die Parteiinstitution in den USA, in: Dimitris Th. Tsatsos (Hrsg), 30 Jahre Parteiengesetz in Deutschland. Die Parteiinstitution im internationalen Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 262–270. —, 2005: »Politische Führung« und Parteivorsitzende. Einige systematische Überlegungen, in: Daniela Forkmann/Michael Schlieben (Hrsg.), Die Parteivorsitzenden in der Bundesrepublik Deutschland 1949–2005, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 349–368. Lowndes, Vivien, 1996: Varieties of New Institutionalism: A Critical Appraisal, in: Public Administration 74, 181–197. Lundell, Krister, 2005: Contextual Determinants of Electoral System Choice. A Macro-Comparative Study 1949–2003, Åbo: Åbo Akademi University Press. Lütjen, Torben/Walter, Franz, 2000: Die präsidiale Kanzlerschaft, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 45, 1308–1313. Macridis, Roy C., 1961: Interest Groups in Comparative Analysis, in: Journal of Politics 23, 25–46. Maier, Hans, 1990: Föderalismus – Ursprünge und Wandlungen, in: Archiv des öffentlichen Rechts 115, 213–230. Mair, Peter, 2002: Comparing Party Systems, in: Lawrence LeDuc/Richard G. Niemi/Pippa Norris (Hrsg.), Comparing Democracies 2: New Challenges in the Study of Election and Voting, London: Sage, 88–107. Mair, Peter/van Biezen, Ingrid, 2001: Party Membership in Twenty European Democracies, 1980–2000, in: Party Politics 7, 5–21. 302 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Majone, Giandomenico, 1998: Europe’s Democratic Deficit: The Question of Standards, in: European Law Journal 4, No. 1, 5–28. Malloy, Jonathan, 2004: The Executive and Parliament in Canada, in: The Journal of Legislative Studies, 10, No. 2/3, 206–217. Mancini, Paolo/Swanson, David L., 1996: Politics, Media, and Modern Democracy: Introduction, in: David L. Swanson/Paolo Mancini (Hrsg.), Politics, Media, and Modern Democracy, New York, Praeger, 1–26. Manow, Philip, 2006: Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation, in: Leviathan 34, 149–181. Marcus, Maeva, 1996: Judicial Review in the Early Republic, in: Ronald Hoffman/Peter J. Albert (Hrsg.), Launching the ›Extended Republic‹, Charlottesville: University Press of Virginia, 25–53. Martino, Antonio, 2004: Spanien zwischen Regionalismus und Föderalismus, Frankfurt a.M. u.a.: Lang. Masing, Johannes, 2005: Zwischen Kontinuität und Diskontinuität: Die Verfassungsänderung, in: Der Staat 44, 1–17. Masuyama, Mikitaka/Nyblade, Benjamin, 2004: Japan: The Prime Minister and the Japanese Diet, in: Nicholas D. J. Baldwin (Hrsg.), Legislatures and Executives: An Investigation into the Relationship at the Heart of Government, London: Cass, 250–262. Matsuda, Norita, 2003: Exceptionalism in Political Science: Japanese Politics, US Politics and Supposed International Norms, in: Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies (Discussion Paper 4). Mattila, Mikko/Raunio, Tapio, 2004: Does Winning Pay? Electoral Success and Government Formation in 15 West European Countries, in: European Journal of Political Research 43, 263–285. Maurer, Andreas, 2002: Parlamentarische Demokratie in der Europäischen Union. Der Beitrag des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, Baden-Baden: Nomos. Maurer, Hartmut, 1993: Die Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, in: Bernd Becker u.a. (Hrsg.), Festschrift für Werner Thieme zum 70. Geburtstag, Köln: Heymann, 123–140. Mayhew, David R., 1986: Placing Parties in American Politics, Princeton: Princeton University Press. Mayntz, Renate, 1990a: Organisierte Interessenvertretung und Föderalismus. Zur Verbändestruktur in der Bundesrepublik Deutschland, in: Jahrbuch zur Staatsund Verwaltungswissenschaft 4, 145–156. —, 1990b: Föderalismus und die Gesellschaft der Gegenwart, in: Archiv des öffentlichen Rechts 115, 232–247. —, 2004: Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie?, MPIfG Working Paper 04/1, Köln. Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W., 1975: Policy-Making in the West-German Federal Bureaucracy, Amsterdam: Elsevier. LITERATUR 303 —, 1995: Der Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus, in: Renate Mayntz/Fritz W. Scharpf (Hrsg.), Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung, Frankfurt a.M./New York: Campus, 39–72. Merkel, Wolfgang/Puhle, Hans-Jürgen/Croissant, Aurel/Eicher, Claudia/Thiery, Peter, 2003: Defekte Demokratie. Band 1: Theorie, Opladen: Leske & Budrich. Merkel, Wolfgang/Sandschneider, Eberhard/Segert, Dieter (Hrsg.), 1996a: Systemwechsel 2: Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen: Leske & Budrich. —, 1996b: Einleitung: Die Institutionalisierung der Demokratie, in: Wolfgang Merkel/Eberhard Sandschneider/Dieter Segert (Hrsg.), Systemwechsel 2: Die Institutionalisierung der Demokratie, Opladen: Leske & Budrich, 9–39. Meunier, Jacques, 2003: Les décisions du Conseil constitutionnel et le jeu politique, in: Pouvoirs, No. 105, 29–40. Meyer, Gerd (Hrsg.), 2006: Formal Institutions and Informal Politics in Central and Eastern Europe: Hungary, Poland, Russia and Ukraine, Opladen: Barbara Budrich Publishers. Meyer, Hans, 2001: Die Wiedervereinigung und ihre Folgen vor dem Forum des Bundesverfassungsgerichts, in: Peter Badura/Horst Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht. Erster Band: Verfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungsprozeß, Tübingen: Mohr Siebeck, 83–129. Meyer, Thomas, 2001: Mediokratie. Die Kolonisierung der Politik durch die Medien, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Meyn, Hermann, 2004: Massenmedien in Deutschland, Neuauflage 2004, Konstanz: UVK. Minkenberg, Michael/Willems, Ulrich (Hrsg.), 2003: Politik und Religion (Politische Vierteljahreschrift, Sonderheft 33), Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Mintzel, Alf, 1980: Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien in den Westzonen (1945-1949), in: Dietrich Staritz (Hrsg.), Das Parteiensystem der Bundesrepublik. Geschichte – Entstehung – Entwicklung, Opladen: Westdeutscher Verlag, 73–89. Mitchell, Paul, 2001: Coalition Membership in West European Democracies. Paper presented at the American Political Science Association, San Francisco, 30 August–2 September. Molina, Oscar/Rhodes, Martin, 2002: Corporatism: The Past, Present, and Future of a Concept, in: American Review of Political Science 5, 305–331. Moravcsik, Andrew, 1997: Warum die Europäische Union die Exekutive stärkt: Innenpolitik und internationale Kooperation, in: Klaus Dieter Wolf (Hrsg.), Projekt Europa im Übergang, Baden-Baden: Nomos, 211–269 —, 2002: In Defence of the ›Democratic Deficit‹: Reassessing the Legitimacy of the European Union’, in: Journal of Common Market Studies 40, 603–634. Morlok, Martin, 1990: Die innere Ordnung der politischen Parteien, in: Dimitris Th. Tsatsos/Dian Schefold/Hans-Peter Schneider (Hrsg.), Parteienrecht im europäischen Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 780–823. 304 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE —, 2003: Informalisierung und Entparlamentarisierung politischer Entscheidungen als Gefährdungen der Verfassung?, in: Veröffentlichtungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 62, 37–80. —, 2004: Austritt, Ausschluss, Rechte: Der fraktionslose Abgeordnete, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 35, 633–645. Mors, Wolff-Michael, 2002: Verfassungsgerichtsbarkeit in Dänemark, Baden-Baden: Nomos. Morsey, Rudolf, 1999: Die Debatte um das Staatsoberhaupt 1945-1949, in: Eberhard Jäckel/Horst Möller/Hermann Rudolph (Hrsg.), Von Heuss bis Herzog. Die Bundespräsidenten im politischen System der Bundesrepublik, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 45–58. Mudde, Cas, 2006: Anti-System Politics, in: Paul M. Heywood/Erik Jones/Martin Rhodes/Ulrich Sedelmeier (Hrsg.), Developments in European Politics, London: Palgrave Macmillan, 178–195. Mulgan, Aurelia George, 2003: Japan’s ›Un-Westminster‹ System: Impediments to Reform in a Crisis Economy, in: Government and Opposition 38, 73–91. Müller, Kai/Walter, Franz, 2004: Graue Eminenzen der Macht: Küchenkabinette in der deutschen Kanzlerdemokratie, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Müller, Wolfgang C., 2004: Koalitionstheorien, in: Ludger Helms/Uwe Jun (Hrsg.), Politische Theorie und Regierungslehre. Eine Einführung in die politische Institutionenforschung, Frankfurt a.M./New York: Campus, 267–301. —, 2006: Der Bundespräsident, in: Herbert Dachs u.a. (Hrsg.), Politik in Österreich. Das Handbuch, Wien: Manz, 188–200. Müller, Wolfgang C./Strøm, Kaare (Hrsg.), 2000a: Coalition Governments in Western Europe, Oxford: Oxford University Press. —, 2000b: Conclusion, in: Wolfgang C. Müller/Kaare Strøm (Hrsg.), Coalition Governments in Western Europe, Oxford: Oxford University Press, 559–592. —, 2000c: Coalition Governance in Western Europe. An Introduction, in: Wolfgang C. Müller/Kaare Strøm (Hrsg.), Coalition Governments in Western Europe, Oxford: Oxford University Press, 1–31. Müller-Rommel, Ferdinand, 1993: Ministers and the Role of the Prime Ministerial Staff, in: Jean Blondel/Ferdinand Müller-Rommel (Hrsg.), Governing Together. The Extent and Limits of Joint Decision-Making in Western European Cabinets, London, 131–152. —, 1994: The Chancellor and his Staff, in: Stephen Padgett (Hrsg.), Adenauer to Kohl. The Development of the German Chancellorship, London: Hurst, 106– 126. —, 2000: Management of Politics in the German Chancellor’s Office, in: B. Guy Peters/R. A. W. Rhodes/Vincent Wright (Hrsg.), Administering the Summit. Administration of the Core Executive in Developed Countries, London: Macmillan, 81–100. Müller-Rommel, Ferdinand/Poguntke, Thomas (Hrsg.), 2002: Green Parties in National Governments, London: Cass. LITERATUR 305 Naßmacher, Hiltrud, 2006: Parteiensysteme und Parteienfinanzierung in Westeuropa, in: Oskar Niedermayer/Richard Stöss/Melanie Haas (Hrsg.), Die Parteiensysteme Westeuropas, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 507–519. Naßmacher, Karl-Heinz (Hrsg.), 2001: Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance, Baden-Baden: Nomos. Nedelmann, Birgitta, 1996: Gegensätze und Dynamik politischer Institutionen, in: Birgitta Nedelmann (Hrsg.), Politische Institutionen im Wandel (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 35), Opladen: Westdeutscher Verlag, 15–40. Neidhart, Leonhard, 1970: Plebiszit und pluralitäre Demokratie, Bern: Haupt. Nelson, Helen, 2000: Verfassungsanomalien in föderalen Mehrheitsdemokratien: Der australische Fall, in: André Kaiser (Hrsg), Regieren in Westminster-Demokratien, Baden-Baden: Nomos, 121–142. Neu, Viola, 2004: Das Janusgesicht der PDS: Wähler und Partei zwischen Demokratie und Extremismus, Baden-Baden: Nomos. Neumann, Sigmund (Hrsg.), 1956: Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics, Chicago: University of Chicago Press. Neustadt, Richard E., 2001: The Weakening White House, in: British Journal of Political Science 31, 1–11. Newell, James L., 2005: Americanization and the Judicialization of Italian Politics, in: Journal of Modern Italian Studies 10, No. 1, 27–42. Niclauß, Karlheinz, 1987: Repräsentative und plebiszitäre Elemente der Kanzlerdemokratie, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 35, 217–45. —, 1997: Vier Wege zur unmittelbaren Bürgerbeteiligung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 14, 3–12. —, 1998: Der Weg zum Grundgesetz. Demokratiegründung in Westdeutschland 1945–1949, Paderborn u.a.: Schöningh. —, 1999: Bestätigung der Kanzlerdemokratie? Kanzler und Regierungen zwischen Verfassung und politischen Konventionen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 20, 27–38. —, 2002: Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Paderborn u.a.: Schöningh. Niedermayer, Oskar, 1996a: Zur systematischen Analyse der Entwicklung von Parteiensystemen, in: Oscar W. Gabriel/Jürgen W. Falter (Hrsg.), Wahlen und politische Einstellungen in westlichen Demokratien, Frankfurt u.a.: Lang, 19– 49. —, 1996b: Intermediäre Strukturen in Ostdeutschland, Opladen: Westdeutscher Verlag. —, 2006: Parteimitgliedschaften im Jahre 2005, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 37, 376–383. Nipperdey, Thomas, 1986: Der Föderalismus in der deutschen Geschichte, in: Thomas Nipperdey, Nachdenken über die deutsche Geschichte, 2. Aufl., München: Beck, 60–109. Nohlen, Dieter, 2000: Wahlrecht und Parteiensystem, 3. Aufl., Opladen: Leske & Budrich. 306 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE —, 2005: Internationale Trends der Wahlsystementwicklung, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 34, 11–26. Noll, Alfred J., 1992: Internationale Verfassungsgerichtsbarkeit. Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Großbritannien, der USA, Frankreich, Italien und Japan, Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei. Norris, Pippa, 2004: Electoral Engineering. Voting Rules and Political Behavior, Cambridge: Cambridge University Press. Norton, Philip, 1998a: Conclusion: Do Parliaments Make a Difference, in: Philip Norton (Hrsg.), Parliaments and Governments in Western Europe, London: Cass, 190–207. — (Hrsg.), 1998b: Parliaments and Governments in Western Europe, London: Cass. —, 2000: Barons in a Shrinking Kingdom: Senior Ministers in British Government, in: R. A. W. Rhodes (Hrsg.), Transforming British Government. Vol. 2: Changing Roles and Relationships, London: Macmillan, 101–124. —, 2002: Introduction: Linking Parliaments and Citizens, in: Philip Norton (Hrsg.), Parliaments and Citizens in Western Europe, London: Cass, 1–18. Nousiainen, Jaakko, 2001: From Semi-presidentialism to Parliamentary Government: Political and Constitutional Developments in Finland, in: Scandinavian Political Studies 24, 95–109. Oberreuter, Heinrich, 1986: Föderalismus, in: Staatslexikon, hrsg. von der GörresGesellschaft, Bd. 2, 7. Aufl., Freiburg: Herder, 632–638. —, 1990a: Politische Parteien: Stellung und Funktion im Verfassungssystem der Bundesrepublik, in: Alf Mintzel (Hrsg.), Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 15–39. —, 1990b: Führungsschwäche in der Kanzlerdemokratie: Ludwig Erhard, in: Manfred Mols/Hans-Otto Mühleisen/Theo Stammen/Bernhard Vogel (Hrsg.), Normative und institutionelle Ordnungsprobleme des modernen Staates. Festschrift zum 65. Geburtstag von Manfred Hättich am 12. Oktober 1990, Paderborn u.a.: Schöningh, 215–234. —, 2002: Der Machtwechsel. Regierung und Opposition in den neunziger Jahren, in: Werner Süß (Hrsg.), Deutschland in den neunziger Jahren. Politik und Gesellschaft zwischen Wiedervereinigung und Globalisierung, Opladen: Leske & Budrich, 53–70. Offe, Claus (Hrsg.), 2003: Demokratisierung der Demokratie, Frankfurt a.M./New York: Campus. Olson, Mancur, 1965: The Logic of Collective Action, Cambridge, MA: Harvard University Press. Oppelland, Torsten, 2001: (Über-)Parteilich? Parteipolitische Konstellationen bei der Wahl des Bundespräsidenten und ihr Einfluß auf die Amtsführung, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 11, 551–572. Österlund-Karinkanta, Marina, 2004: Finland, in: Mary Kelly/Gianpietro Mazzoleni/Denis McQuail (Hrsg.), The Media in Europe. The Euromedia Handbook, London: Sage, 54–64. LITERATUR 307 Owens, John E./Loomis, Burdett A., 2006: Qualified Exceptionalism: The US Congress in Comparative Perspective, in: Journal of Legislative Studies 12, 258–290. Padgett, Stephen, 2000a: The German Volkspartei and the Career of the Catch-all Concept, in: Stephen Padgett/Thomas Poguntke (Hrsg.), Continuity and Change in German Politics. Beyond the Politics of Centrality? A Festschrift for Gordon Smith, London: Cass, 51–72. —, 2000b: Organizing Democracy in Eastern Germany Interest Groups in PostCommunist Society, Cambridge: Cambridge University Press. Page, Edward C./Wright, Vincent (Hrsg.), 1999: Bureaucratic Elites in Western European States. A Comparative Analysis of Top Officials, Oxford: Oxford University Press. Paloheimo, Heikki, 2003: The Rising Power of the Prime Minister in Finland, in: Skandinavian Political Studies 26, 219–243. Panebianco, Angelo, 1988: Political Parties: Organization and Power, Cambridge: Cambridge University Press. Papadopoulos, Yannis, 2001: How Does Direct Democracy Matter? The Impact of Referendum Votes on Politics and Policy-Making, in: Jan-Erik Lane (Hrsg.), The Swiss Labyrinth. Institutions, Outcomes and Redesign, London: Cass, S. 35–57. Pasquino, Gianfranco, 2003: The Government, the Opposition and the President of the Republic under Berlusconi, in: Journal of Modern Italian Studies 8, 485– 499. Paterson, William E./Green, Simon (Hrsg.), 2005: The Semi-sovereign State Revisited, Cambridge: Cambridge University Press. Patterson Jr., Bradley H., 2000: The White House Staff, Washington, DC: Brookings Institution Press. Patzelt, Werner J., 1998a: Wider das Gerede vom »Fraktionszwang«! Funktionslogische Zusammenhänge, populäre Vermutungen und die Sicht der Abgeordneten, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 29, 323–347. —, 1998b: Ein latenter Verfassungskonflikt? Die Deutschen und ihr parlamentarisches Regierungssystem, in: Politische Vierteljahresschrift 39, 725–757. —, 2003: Parlamente und ihre Funktionen, in: Werner J. Patzelt (Hrsg.), Parlamente und ihre Funktionen. Institutionelle Mechanismen und institutionelles Lernen im Vergleich, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 13–49. —, 2006: Parlamentsauflösung im internationalen Vergleich, in: Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften 4, 120–141. Pelinka, Anton, 2003: Demokratie – Weg und Ziel. Zwischen Gleichheit und Differenz, in: Wiener Hefte zu Migration in Theorie und Praxis 1, Heft 1, 45– 53. Peters, B. Guy/Pierre, Jon (Hrsg.), 2004a: The Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control, London/New York: Routledge. — (Hrsg.), 2004b: Conclusion: Political Control in a Managerialist World, in: B. Guy Peters/Jon Pierre (Hrsg.), The Politicization of the Civil Service in Com- 308 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE parative Perspective: The Quest for Control, London/New York: Routledge, 283–290. Pfetsch, Barbara, 2003: Politische Kommunikationskultur. Politische Sprecher und Journalisten in der Bundesrepublik und in den USA im Vergleich, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. Pharr, Susan J. Pharr/Putnam, Robert D. (Hrsg.), 2000: Disaffected Democracies. What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton: Princeton University Press, 74–98. Pickel, Gert/Pollack, Detlef/Müller, Olaf/Jacobs, Jörg (Hrsg.), 2006: Osteuropas Bevölkerung auf dem Weg in die Demokratie. Repräsentative Untersuchungen in Deutschland und zehn osteuropäischen Transformationsstaaten, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Pieroth, Bodo/Schlink, Bernhard, 2004: Grundrechte – Staatsrecht II, 20. Aufl., Heidelberg: Müller. Pierson, Paul, 2004: Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton: Princeton University Press. Plitsch-Kußmaul, Kirsten, 1995: Die Entstehung und Ausprägung der Mediensystem in Japan und Deutschland. Ein Strukturvergleich, München: ars una. Poguntke, Thomas, 2002: Parteiorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland: Einheit in der Vielfalt?, in: Oskar W. Gabriel/Oskar Niedermayer/ Richard Stöss (Hrsg.), Parteiendemokratie in Deutschland, 2. Aufl., Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 253–273. —, 2005: A Presidentializing Party State? The Federal Republic of Germany, in: Thomas Poguntke/Paul Webb (Hrsg.), The Presidentialization of Politics, Oxford: Oxford University Press, 63–87. Poguntke, Thomas/Paul Webb (Hrsg.), 2005: The Presidentialization of Politics, Oxford: Oxford University Press. Poli, Emanuela, 2002: Forza Italia: strutture, leadership e radicamento territoriale, Bologna: Il Mulino. Pollack, Detlef/Jacobs, Jörg/Müller, Olaf/Pickel, Gert (Hrsg.), 2004: Political Culture in Post-communist Europe: Attitudes in New Democracies, Aldershot: Ashgate. Pollitt, Christopher/Bouckaert, Geert, 2000: Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press. Polsby, Nelson W., 1968: The Institutionalization of the U.S. House of Representatives, in: American Political Science Review 62, 144–168. Powell, G. Bingham, 2004: Liberal Democracies, in: Mary Hawkesworth/Maurice Kogan (Hrsg.), Encyclopedia of Government and Politics, 2. Aufl., London/New York: Routledge, 205–222. Pradetto, August (Hrsg.), 2004: Sicherheit und Verteidigung nach dem 11. September 2001: Akteure – Strategien – Handlungsmuster, Frankfurt a.M. u.a.: Lang. Prittwitz, Volker von, 2003: Vollständig personalisierte Verhältniswahl. Reformüberlegungen auf der Grundlage eines Leistungsvergleichs der Wahlsysteme Deutschlands und Finnlands, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52, 12–20. LITERATUR 309 Przeworski, Adam, 1991: Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge: Cambridge University Press. —, 2004: Institutions Matter?, in: Government & Opposition 39, 527–540. Pulzer, Peter, 1983: Germany, in: Vernon Bogdanor/David Butler (Hrsg.), Democracy and Elections. Electoral Systems and their Political Consequences, Cambridge: Cambridge University Press, 84–109. Qvortrup, Matt, 2005: First past the Postman: Voting by Mail in Comparative Perspective, in: Political Quarterly 76, 414–419. Rack, Reinhard, 1996: Austria: Has the Federation Become Obsolete, in: Joachim Jens Hesse/Vincent Wright (Hrsg.), Federalizing Europe? The Costs, Benefits, and Preconditions of Federal Political Systems, Oxford: Oxford University Press, 204–218. Rau, Christian, 1996: Selbst entwickelte Grenzen in der Rechtsprechung des United States Supreme Court und des Bundesverfassungsgerichts, Berlin: Duncker & Humblot. Reed, Steven R., 2001: Duverger’s Law is Working in Italy, in: Comparative Political Studies 34, 312–327. Reinhard, Wolfgang, 2000: Geschichte der Staatsgewalt: eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Sonderausgabe, München: Beck. Renzsch, Wolfgang, 1991: Finanzverfassung und Finanzausgleich. Die Auseinandersetzungen um ihre politische Gestaltung in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Währungsreform und deutscher Vereinigung (1948 bis 1990), Bonn: Dietz. —, 2000: Föderale Finanzverfassungen: Ein Vergleich Australiens, Deutschlands, Kanadas, der Schweiz und der USA aus institutioneller Perspektive, in: Jahrbuch des Föderalismus 2000, Baden-Baden: Nomos, 42–54. —, 2001: Bundesstaat und Parteiensystem. Die Beispiele Deutschland und Kanada, in: Jahrbuch des Föderalismus 2001, Baden-Baden: Nomos, 56–86. Reutter, Werner, 2001: Deutschland: Verbände zwischen Pluralismus, Korporatismus und Lobbyismus, in: Werner Reutter/Peter Rütters (Hrsg.), Verbände und Verbändesysteme in Westeuropa, Opladen: Leske & Budrich, 75–101. — (Hrsg.), 2004: Germany – Finally on the Road to ›Normalcy‹?, London: Palgrave/Macmillan. Rhodes, R. A. W./Binder, Sarah/Rockman, Bert A. (Hrsg.), 2006: The Oxford Handbook of Political Institutions, Oxford: Oxford University Press. Ridley, F. F., 1966: Chancellor Government as a Political System and the German Constitution, in: Parliamentary Affairs 19, 446–461. Riescher, Gisela/Ruß, Sabine/Haas, Christoph M. (Hrsg.), 2000: Zweite Kammern, München/Wien: Oldenbourg. Riggs, Fred W., 1997: Presidentialism versus Parliamentarism: Implications for Representativeness and Legitimacy, in: International Political Science Review 18, 253–278. 310 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Riker, William H., 1975: Fred I. Greenstein/Nelson W. Polsby (Hrsg.), Handbook of Political Science, Vol. 5: Governmental Institutions and Processes, Reading, MA: Addison-Wesley, 93–172. Ritter, Gerhard A., 2005: Föderalismus und Parlamentarismus in Deutschland in Geschichte und Gegenwart, München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Rödder, Andreas, 2006: Das »Modell Deutschland« zwischen Erfolgsgeschichte und Verfallsdiagnose, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 54, 345–363 Rokkan, Stein, 1970: Citizens, Elections, Parties. Approaches to the Comparative Study of Processes of Development, Oslo: Universitetsforlaget. Roll, Evelyn, 2006: Der Baukasten der Macht, in: Süddeutsche Zeitung vom 11./12. November, 3. Röper, Horst, 2006: Gratiszeitungen und etablierte Zeitungsverlage, in: MediaPerspektiven, 521–528. Rose, Richard, 1968: Party Government vs. Administrative Government. A Theoretical and Empirical Critique, in: Otto Stammer (Hrsg.), Party Systems, Party Organisations, and the Politics of New Masses, Berlin: Freie Universität, Institut für Politische Wissenschaft, 209–233. —, 1991: Comparing Forms of Comparative Analysis, in: Political Studies 39, 446– 462. —, 1993: Lesson-Drawing in Public Policy: A Guide to Learning across Time and Space, Chatham, NJ: Chatham House. —, 1996: Politics in England, in: Gabriel A. Almond/G. Bingham Powell (Hrsg.), Comparative Politics Today, New York: Harper Collins, 155–209. Rößler, Matthias (Hrsg.), 2006: Einigkeit und Recht und Freiheit. Deutscher Patriotismus in Europa, Freiburg: Herder. Royo, Sebastián, 2002: ›A New Century of Corporatism?‹ Corporatism in Spain and Portugal, in: West European Politics 25, No. 3, 77–104. Rucht, Dieter, 1993: Parteien, Verbände und Bewegungen als Systeme politischer Interessenvermittlung, in: Oskar Niedermayer/Richard Stöss (Hrsg.), Stand und Perspektiven der Parteienforschung in Deutschland, Opladen: Westdeutscher Verlag, 251–275. —, 2002: Anstöße für den Wandel – Soziale Bewegungen im 21. Jahrhundert, Vortrag im Rahmen der Gründungsversammlung für »Die Bewegungsstiftung – Anstöße für soziale Bewegungen«, Haus der Demokratie, Berlin, 2. März 2002. Rudzio, Wolfgang, 2000: The Federal Presidency: Parameters of Presidential Power in a Parliamentary Democracy, in: Ludger Helms (Hrsg.), Institutions and Institutional Change in the Federal Republic of Germany, London: Macmillan, 48–64. —, 2002: Koalitionen in Deutschland: Flexibilität informellen Regierens, in: Sabine Kropp/Suzanne S. Schüttemeyer/Roland Sturm (Hrsg.), Koalitionen in Westund Osteuropa, Opladen: Leske & Budrich, 43–67. —, 2006: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 7. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. LITERATUR 311 Ruffert, Martin, 2002: Entformalisierung und Entparlamentarisierung politischer Entscheidungen als Gefährdungen der Verfassung?, in: Deutsches Verwaltungsblatt 117, 1145–1154. Saalfeld, Thomas, 1995: Parteisoldaten und Rebellen: Eine Untersuchung zur Geschlossenheit der Fraktionen im Deutschen Bundestag (1949–1990), Opladen: Leske & Budrich. —, 1997: Deutschland: Auswanderung der Politik aus der Verfassung, in: Wolfgang C. Müller/Kaare Strøm (Hrsg.), Koalitionsregierungen in Westeuropa, Wien: Signum-Verlag, 47–108. —, 2000: Germany: Stable Parties, Chancellor Democracy, and the Art of Informal Settlement, in: Wolfgang C. Müller/Kaare Strøm (Hrsg.), Coalitions Governments in Western Europe, Oxford: Oxford University Press, 32–85. —, 2003: The Bundestag: Institutional Incrementalism and Behavioural Reticence, in: Kenneth Dyson/Klaus H. Goetz (Hrsg.), Germany and the Politics of Constraint, Oxford: Oxford University Press, 73–96. —, 2005: Germany: Stability and Strategy in a Mixed-Member Proportional System, in: Michael Gallagher/Paul Mitchell (Hrsg.), The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press, 209–229. Sadurski, Wojciech, 2005: Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central and Eastern Europe, Dordrecht u.a.: Springer. Salisbury, Robert H., 1969: An Exchange Theory of Interest Groups, in: Midwest Journal of Political Science 13, 1–32. Sarcinelli, Ulrich, 2005: Politische Kommunikation in Deutschland. Zur Politikvermittlung im demokratischen System, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Sartori, Giovanni, 1976: Parties and Party Systems, Cambridge: Cambridge University Press. —, 1992: Demokratietheorie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. —, 1994: Comparative Constitutional Engineering, London: Macmillan. Sattar, Majid, 2001: Formale und informale Politik: Wandlungen des LegislativExekutiv-Verhältnisses am Beispiel der parlamentarischen Kontrollfunktion im amerikanischen Regierungssystem, Berlin: Duncker & Humblot. Scannell, Paddy/Cardiff, David, 1991: A Social History of British Broadcasting. Volume One 1922–1939: Serving the Nation, Oxford: Blackwell. Scarrow, Susan E., 2001: Germany: The Mixed-Member System as a Political Compromise, in: Matthew Søberg Shugart/Martin P. Wattenberg (Hrsg.), Mixed-Member Systems: The Best of Both Worlds?, Oxford: Oxford University Press, 55–69. —, 2006: The Nineteenth-Century Origins of Modern Political Parties: The Unwanted Emergence of Party-Based Politics, in: Richard S. Katz/William Crotty (Hrsg.), Handbook of Party Politics, London: Sage, 16–24. Scharf, Norbert Markus, 2006: Das Kooperationsverhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof, Diss., Jena. 312 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Scharpf, Fritz W., 1999: Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford: Oxford University Press. —, 2000: Interaktionsformen: Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikforschung, Opladen: Leske & Budrich. Scharpf, Fritz W./Reissert, Bernd/Schnabel, Fritz, 1976: Politikverflechtung: Theorie und Empirie des kooperativen Föderalismus in der Bundesrepublik, Kronberg/Ts: Scriptor-Verlag. Scheeck, Laurent, 2005: The Relationship between the European Courts and Integration through Human Rights, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 65, 837–885. Schenke, Wolf-Rüdiger, 2006: Das »gefühlte« Misstrauen. Zur Verfassungsrechtslage nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25.8.2005 zur Vertrauensfrage nach Art. 68 GG, in: Zeitschrift für Politik 53, 26–49. Scherb, Armin, 1987: Präventiver Demokratieschutz als Problem der Verfassungsgebung nach 1945, Frankfurt a.M.: Lang. Schieren, Stefan, 1999: Der Human Rights Act 1998 und seine Bedeutung für Großbritanniens Verfassung, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 30, 999– 1013. Schindler, Peter, 1999: Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages 1949 bis 1999. Gesamtausgabe in drei Bänden, Baden-Baden: Nomos. Schmid, Josef, 1990: Die CDU. Organisationsstrukturen, Politiken und Funktionsweisen einer Partei im Föderalismus, Opladen: Leske & Budrich. Schmidt, Manfred G., 1985: Allerweltsparteien in Westeuropa?, in: Leviathan 13, 376–397. —, 1988: Sozialpolitik: Historische Entwicklung und internationaler Vergleich, Opladen: Leske & Budrich. —, 1992: Regieren in der Bundesrepublik Deutschland, Opladen: Leske & Budrich. —, 1996: Germany: The Grand Coalition State, in: Josep M. Colomer (Hrsg.), Political Institutions in Europe, London/New York: Routledge, 62–98. —, 2002: The Impact of Political Parties, Constitutional Structures and Veto Players on Public Policy, in: Hans Keman (Hrsg.), Comparative Democratic Politics, London: Sage, 166–184. —, 2003: Political Institutions in the Federal Republic of Germany, Oxford: Oxford University Press. —, 2006: Wenn zwei Sozialstaatsparteien konkurrieren: Sozialpolitik in Deutschland, in: Manfred G. Schmidt/Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.), Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 137–157. Schmitt Glaeser, Walter, 2002: Die Macht der Medien in der Gewaltenteilung, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 50, 169–190. Schmitt-Beck, Rüdiger, 1993: Denn sie wissen nicht, was sie tun … Zum Verständnis des Verfahrens der Bundestagswahl bei westdeutschen und ostdeutschen Wählern, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 24, 393–415. LITERATUR 313 Schmitter, Philippe, 1974: Still the Century of Corporatism?, in: Review of Politics 36, No.1, 85–131. —, 1977: Modes of Interest Intermediation and Models of Societal Change in Western Europe, in: Comparative Political Studies 10, 7–38. Schmollinger, Horst W./Staritz, Dietrich, 1980: Zur Entwicklung der Arbeiterparteien in den Westzonen (1945–1949), in: Dietrich Staritz (Hrsg.), Das Parteiensystem der Bundesrepublik. Geschichte – Entstehung – Entwicklung, Opladen: Westdeutscher Verlag, 109–127. Schnabel, Claus, 2005: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände: Organisationsgrade, Tarifbindung und Einflüsse auf Löhne und Beschäftigung, in: Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung 38, 181–196. Schnapp, Kai-Uwe, 2001: Polisches Einflusspotenzial von Regierungsbürokratien in OECD-Ländern, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 5, 14–24. Schnapp, Kai-Uwe/Harfst, Philipp, 2005: Parlamentarische Informations- und Kontrollressourcen in 22 westlichen Demokratien, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 36, 348–370. Schneider, Andrea H., 1999: Die Kunst des Kompromisses: Helmut Schmidt und die Große Koalition 1966–1969, Paderborn u.a.: Schöningh. Schneider, Beate/Stürzebecher, Dieter, 1998: Wenn das Blatt sich wendet. Die Tagespresse in den neuen Bundesländern, Baden-Baden: Nomos. Schneider, Hans-Peter, 2006a: Der Kotau von Karlsruhe. Zur Kapitulation des Bundesverfassungsgerichts vor der Politik, in: Zeitschrift für Politik 53, 123– 142. —, 2006b: Finanzautonomie von föderalen Gliedstaaten und Kommunen. Ein internationaler Vergleich, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Schneider, Herbert, 2001: Ministerpräsidenten: Profil eines politischen Amtes im Föderalismus, Opladen: Leske & Budrich. Schneider, Michael, 2000: Kleine Geschichte der Gewerkschaften: ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute, 2. Aufl., Bonn: Diez. Schneider, Steffen/Nullmeier, Frank/Lhotta, Roland/Krell-Laluhová, Zuzana/ Hurrelmann, Achim, 2006: Legitimationskrise nationalstaatlicher Demokratien?, in: Stephan Leibfried/Michael Zürn (Hrsg.), Transformationen des Staates?, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 197–229. Schöne, Siegfried, 1968: Von der Reichskanzlei zum Bundeskanzleramt. Eine Untersuchung zum Problem der Führung und Koordination in der jüngeren deutschen Geschichte, Berlin: Duncker & Humblot. Schönhoven, Klaus, 2004: Wendejahre. Die Sozialdemokratie in der Zeit der Großen Koalition. 1966–1969, Bonn: Dietz. Schreckenberger, Waldemar, 1994: Informelle Verfahren der Entscheidungsvorbereitung zwischen der Bundesregierung und den Mehrheitsfraktionen. Koalitionsgespräche und Koalitionsrunden, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 25, 329–346. Schroeder, Wolfgang, 1997: Loyalty and Exit – Austritte aus regionalen Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie im Vergleich, in: Ulrich von 314 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Alemann/Bernhard Weßels (Hrsg.), Verbände in vergleichender Perspektive: Beiträge zu einem vernachlässigten Feld, Berlin: Edition Sigma, 225–251. —, 2005: Sozialdemokratie und Gewerkschaften, in: Berliner Debatte Initial 15, No. 5, 12–21. Schubert, Klaus, 1995: Pluralismus versus Korporatismus, in: Dieter Nohlen/Rainer-Olaf Schultze (Hrsg.), Politische Theorien (Lexikon der Politik, Bd. 1), München: Beck, 407–423. Schuett-Wetschky, Eberhard, 1997: Interessenverbände und Staat, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. —, 2000: Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 28, 3–11. —, 2003: Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, demokratische Führung und Parteiendemokratie. Teil I: Richtlinienkompetenz als Fremdkörper in der Parteiendemokratie, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 13, 1897–1932. —, 2004: Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers, demokratische Führung und Parteiendemokratie, Teil II: Fehlinformationen des Publikums, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 14, 5–30. —, 2005: Parlamentarismuskritik ohne Ende? Parteidissens und Repräsentationskonzepte, am Beispiel der Entparlamentarisierungs- und der Gewaltenteilungskritik, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 15, 3–33. Schultze, Rainer-Olaf, 1992: Föderalismus, in: Manfred G. Schmidt (Hrsg.), Die westlichen Länder (Lexikon der Politik, Bd. 3), München: Beck, 95–110. —, 2004: Demokratie, in: Dieter Nohlen/Rainer-Olaf Schultze (Hrsg.), Lexikon der Politikwissenschaft. Band 1, aktualisierte und erweiterte Auflage, München: Beck, 124–127. Schultze-Fielitz, Helmuth, 1984: Der informale Verfassungsstaat, Berlin: Duncker & Humblot. Schulz, Gerhard, 1969: Das Zeitalter der Gesellschaft, München: Piper. Schüttemeyer, Suzanne S., 1992: Der Bundestag als Fraktionenparlament, in: Jürgen Hartmann/Uwe Thaysen (Hrsg.), Pluralismus und Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Winfried Steffani zum 65. Geburtstag, Opladen: Westdeutscher Verlag, 113–136. —, 1994: Hierarchy and Efficiency in the Bundestag: The German Answer for Institutionalizing Parliament, in: Gary W. Copeland/Samuel C. Patterson (Hrsg.), Parliaments in the Modern World: Changing Institutions, New York: Michigan University Press, 29–58. —, 1998: Fraktionen im Deutschen Bundestag. Empirische Befunde und theoretische Folgerungen, Opladen: Westdeutscher Verlag. —, 1999: Parteien und ihre Fraktionen in der Bundesrepublik Deutschland: Veränderte Beziehungen im Zeichen professioneller Politik, in: Ludger Helms (Hrsg.), Parteien und Fraktionen. Ein internationaler Vergleich, Opladen: Leske & Budrich, 39–66. Schüttemeyer, Suzanne S./Sturm, Roland, 1992: Wozu zweite Kammern? Zur Repräsentation und Funktionalität zweiter Kammern in westlichen Demokratien, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 23, 517–536. LITERATUR 315 Schwartz, Herman, 1998: Eastern Europe’s Constitutional Courts, in: Journal of Democracy 9, 100–114. Sebaldt, Martin, 2004: Die »Stille Revolution« organisierter Interessenvertretung: Entwicklungs- und Transformationsmuster westlicher Verbandssysteme in komparativer Perspektive, in: Zeitschrift für Politik 51, 1 – 28. Sebaldt, Martin/Straßner, Alexander, 2004: Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 277–308. Seeleib-Kaiser, Martin, 2002: Neubeginn oder Ende der Sozialdemokratie?, in: Politische Vierteljahresschrift 43, 478–496. Seibel, Wolfgang, 1997: Historische Analyse und politikwissenschaftliche Institutionenforschung, in: Arthur Benz/Wolfgang Seibel (Hrsg.), Theorieentwicklung in der Politikwissenschaft – eine Zwischenbilanz, Baden-Baden: Nomos, 357– 376. Seißelberg, Jörg, 1994: Berlusconis Forza Italia. Wahlerfolg einer Persönlichkeitspartei, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Sonderband zum 25jährigen Bestehen, Opladen: Westdeutscher Verlag, 204–231. Seyd, Patrick, 1998: Tony Blair und New Labour, in: Anthony King (Hrsg.), New Labour Triumphs: Britain at the Polls, Chatham, NJ: Chatham House, 49–73. Shade, William G., 1981: Political Pluralism and Party Development: The Creation of a Modern Party System, 1815–1852, in: Paul Kleppner/Walter Dean Burnham/Ronald P. Formisano/Samuel P. Hays/Richard Jensen/William G. Shade, The Evolution of American Electoral Systems, Westport, CN: Greenwood Press, 77–111. Shafer, Byron E., 1991: Is America Different?, Oxford: Oxford University Press. —, 1999: American Exceptionalism, in: Annual Review of Political Science 2, 445– 463. Shaiko, Ronald G., 1998: Reverse Lobbying: Interest Group Mobilization from the White House and the Hill, in: Allan J. Cigler/Burdett A. Loomis (Hrsg.), Interest Group Politics, 5. Aufl., Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 255–282. Shapiro, Martin, 2002: The Success of Judicial Review and Democracy, in: Martin Shapiro/Alec Stone Sweet (Hrsg.), On Law, Politics, and Judicialization, Oxford: Oxford University Press, 149–183. Sheingate, Adam D., 2001: The Rise of the Agricultural Welfare State: Institutions and Interest Group Power in the United States, France, and Japan, Princeton: Princeton University Press. Shell, Kurt L., 1981: Liberal-demokratische Systeme: eine politisch-soziologische Analyse, Stuttgart: Kohlhammer. Shugart, Matthew Søberg, 2005: Comparative Electoral Systems Research: The Maturation of a Field and New Challenges Ahead, in: Michael Gallagher/Paul Mitchell (Hrsg.), The Politics of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press, 25–55. Siaroff, Alan, 2003: Comparative Presidencies: The Inadequacy of the Presidential, Semi-presidential and Parliamentary Distinction, in: European Journal of Political Research 42, 287–312. 316 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Sinclair, Barbara, 2000: Individualism, Partisanship, and Cooperation in the Senate, in: Burdett A. Loomis (Hrsg.), Esteemed Colleagues. Civility and Deliberation in the U.S. Senate, Washington, DC: Brookings Institution Press, 59–77. Smith, Carsten, 2000: Judicial Review of Parliamentary Legislation: Norway as a European Pioneer, in: Public Law, 595–606. Smith, Gordon, 1982: The German Volkspartei and the Career of the Catch-All Concept, in: Herbert Döring/Gordon Smith (Hrsg.), Party Government and Political Culture in Western Germany, London: Macmillan, 59–76. —, 1987: Pluralism, in: Michael A. Rift (Hrsg.), Dictionary of Modern Political Ideologies, Manchester: Manchester University Press, 107–109. —, 1989a: A System Perspective on Party System Change, in: Journal of Theoretical Politics 1, 349–363. —, 1989b: Core Persistence: Change and the »People’s Party«, in: West European Politics 12, 157–168. Smith, Jennifer, 2002: Informal Constitutional Development: Change by Other Means, in: Herman Bakvis/Grace Skogstad (Hrsg.), Canadian Federalism: Performance, Effectiveness, and Legitimacy, Ontario: Oxford University Press, 40–58. Söllner, Alfons, 1999: Normative Verwestlichung. Der Einfluß der Remigranten auf die politische Kultur der frühen Bundesrepublik, in: Heinz Bude/Bernd Greiner (Hrsg.), Westbindungen. Amerika in der Bundesrepublik, Hamburg: Hamburger Edition, 72–92. Sontheimer, Kurt/Bleek, Wilhelm, 2005: Grundzüge des politischen Systems Deutschlands, 12. Aufl., München: Piper. Spevack, Edmund, 1999: Amerikanische Einflüsse auf das Grundgesetz. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates und ihre Beziehungen zu den USA, in: Heinz Bude/Bernd Greiner (Hrsg.), Westbindungen. Amerika in der Bundesrepublik, Hamburg: Hamburger Edition, 55–70. Starck, Christian, 1990: Generalbericht, in: Christian Starck (Hrsg.), Grundgesetz und deutsche Verfassungsrechtsprechung im Spiegel ausländischer Verfassungsentwicklung, Baden-Baden: Nomos, 16–39. —, 2003: Legitimation politischer Entscheidungen durch Verfahren. Das Zuwanderungsgesetz im Bundesrat und vor dem Bundesverfassungsgericht, in: Zeitschrift für Gesetzgebung 18, 81–91. —, 2004: Fortschritte der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Christian Starck (Hrsg.), Fortschritte der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt – Teil I. Deutsch-Japanisches Kolloquium vom 20. bis 24. September in Tokio und Kioto, BadenBaden: Nomos, 11–13. —, (Hrsg.), 2007: Die Föderalismusreform 2006: eine Einführung, München: Vahlen. Steffani, Winfried, 1983: Zur Unterscheidung parlamentarischer und präsidentieller Regierungssysteme, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 14, 390–401. —, 1988: Parteien (Fraktionen) und Ausschüsse im Deutschen Bundestag, in: Uwe Thaysen/Roger H. Davidson/Robert G. Livingstone (Hrsg.), US-Kongreß und deutscher Bundestag, Opladen: Westdeutscher Verlag, 260–280. LITERATUR 317 —, 1997: Die Republik der Landesfürsten, in: Winfried Steffani, Gewaltenteilung und Parteien im Wandel, Opladen: Westdeutscher Verlag, 56–88. Steinbach, Peter, 1997: Vom Kaiserreich zur Bundesrepublik: Kontinuität und Wandel der politischen Institutionen in Deutschland, in: Gerhard Göhler (Hrsg), Institutionenwandel (Leviathan, Sonderheft 16), Opladen: Westdeutscher Verlag, 227–252. Steinsdorff, Silvia von, 2005: Gute und schlechte Informalität? Informelle Politik in West und Ost, in: Osteuropa 55, Nr. 10, 5–15. Stepan, Alfred, 2001: Toward a New Comparative Politics of Federalism, (Multi)Nationalism, and Democracy: Beyond Rikerian Federalism, in: Alfred Stepan (Hrsg.), Arguing Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 315–361. Stone Sweet, Alec, 2000: Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe, Oxford: Oxford University Press. —, 2002: Constitutional Courts and Parliamentary Democracy, in: Mark Thatcher/Alec Stone (Hrsg.), The Politics of Delegation: Non-Majoritarian Institutions in Europe, London: Cass, 77–100. Stöss, Richard, 2006: Rechtsextreme Parteien in Westeuropa, in: Oskar Niedermayer/Richard Stöss/Melanie Haas (Hrsg.), Die Parteiensysteme in Westeuropa, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 521–563. Stöss, Richard/Haas, Melanie/Niedermayer, Oskar, 2006: Parteiensysteme in Westeuropa: Stabilität und Wandel, in: Oskar Niedermayer/Richard Stöss/Melanie Haas (Hrsg.), Die Parteiensysteme in Westeuropa, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 7–37. Streeck, Wolfgang, 1998: Einleitung: Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie?, in: Wolfgang Streeck (Hrsg.), Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie: Herausforderungen für die Demokratietheorie, Frankfurt a.M./New York: Campus, 11–58. —, 2005: Nach dem Korporatismus: Neue Eliten, neue Konflikte, MPIfG Working Paper 05/4, Mai 2005. Streeck, Wolfgang/Visser, Jelle, 2006: Organized Business Facing Internationalization, in: Wolfgang Streeck/Jürgen R. Grote/Volker Schneider/Jelle Visser (Hrsg.), Governing Interests. Business Associations Facing Internationalisation, London/New York: Routledge, 242–272. Street, John, 2005: Politics Lost, Politics Transformed, Politics Colonised? Theories of the Impact of Mass Media, in: Political Studies Review, 3, 17–33. Strohmeier, Gerd, 2004a: Politik und Massenmedien. Eine Einführung, BadenBaden: Nomos. —, 2004b: Der Bundesrat: Vertretung der Länder oder Instrument der Parteien?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 35, 717–731. Strøm, Kaare, 1998: Parliamentary Committees in European Democracies, in: Journal of Legislative Studies 4, No. 1, 21–59. Sturm, Roland, 1999: Party Competition and the Federal System: The Lehmbruch Hypothesis Revisited, in: Charlie Jeffery (Hrsg.), Recasting German Federalism. The Legacies of Unification, London: Pinter, 197–215. 318 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE —, 2001: Divided Government in Germany: The Case of the Bundesrat, in: Robert Elgie (Hrsg.), Divided Government in Comparative Perspective, Oxford: Oxford University Press, 167–181. —, 2002: Vorbilder für eine Bundesstaatsreform? Lehren aus den Erfahrungen der Verfassungspraxis Zweiter Kammern, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 33, 167–179. —, 2003: Zur Reform des Bundesrates. Lehren eines internationalen Vergleichs der Zweiten Kammern, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 29–30, 24–31. Sturm, Roland/Pehle, Heinrich, 2005: Das neue deutsche Regierungssystem. Die Europäisierung von Institutionen, Entscheidungsprozessen und Politikfeldern in der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Stüwe, Klaus, 1997: Die Opposition im Bundestag und das Bundesverfassungsgericht. Das verfassungsgerichtliche Verfahren als Kontrollinstrument der parlamentarischen Minderheit, Baden-Baden: Nomos. —, 2004: Konflikt und Konsens im Bundesrat. Eine Bilanz (1949–2004), in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 50–51, 25–32. Swenden, Wilfried, 2004: Federalism and Second Chambers. Regional Representation in Parliamentary Federations: the Australian Senate and German Bundesrat Compared, Brüssel u.a.: Lang. Syvertsen, Trine, 2003: Challenges to Public Television in the Era of Convergence and Commercialization, in: Television & New Media 4, 155–157. Talós, Emmerich, 2006: Politik Schwarz-Blau/Orange. Eine Bilanz, in: Emmerich Talós (Hrsg.), Schwarz-Blau. Eine Bilanz des »Neu-Regierens«, Wien: Lit, 226– 243. Talshir, Gayil, 2002: The Political Ideology of Green Parties: From the Politics of Nature to Redefining the Nature of Politics, London: Palgrave Macmillan. Thaysen, Uwe/Davidson, Roger H./Livingston, Roger Gerald (Hrsg.), 1988: USKongreß und deutscher Bundestag, Opladen: Westdeutscher Verlag. Thelen, Kathleen, 2001: Variaties of Labor Politics in the Developed Countries, in: Peter A. Hall/David Soskice (Hrsg.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford: Oxford University Press, 71–103. Thiébault, Jean-Louis, 2000: France: Forming and Maintaining Government Coalitions in the Fifth Republic, in: Wolfgang C. Müller/Kaare Strøm (Hrsg.), Coalition Governments in Western Europe, Oxford: Oxford University Press, 498–528. Thiel, Markus (Hrsg.), 2003: Wehrhafte Demokratie. Beiträge über die Regelungen zum Schutze der demokratischen Grundordnung, Tübingen: Mohr Siebeck. Thomas, Clive S., 2001: Studying the Political Party–Interest Group Relationship, in: Clive S. Thomas (Hrsg.), Political Parties and Interest Groups. Shaping Democratic Governance, Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 1–23. Tomuschat, Christian, 2001: Das Bundesverfassungsgericht im Kreise anderer nationaler Verfassungsgerichte, in: Peter Badura/Horst Dreier (Hrsg.), Fest- LITERATUR 319 schrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht. Erster Band: Verfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungsprozeß, Tübingen: Mohr Siebeck, 245–288. Thunert, Martin, 2000: Das Westminstermodell in Kanada: Besonderheiten, Leistungen und Zukunftschancen, in: André Kaiser (Hrsg.), Regieren in Westminster-Demokratien, Baden-Baden: Nomos, 95–119. Tömmel, Ingeborg, 2006: Das politische System der EU, 2. Aufl., München/Wien: Oldenbourg. Torbjörn, Bergman/Müller, Wolfgang C./Strøm, Kaare/Blomgren, Magnus, 2003: Democratic Delegation and Accountability: Cross-national Patterns, in: Kaare Strøm/Wolfgang C. Müller/Torbjörn (Hrsg.), Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, Oxford: Oxford University Press, 109–220. Traxler, Franz, 2001: Die Metamorphosen des Korporatismus: Vom klassischen zum schlanken Muster, in: Politische Vierteljahresschrift 42, 590–623. —, 2003: Die Struktur der nationalen Gewerkschaftssysteme im Vergleich, in: Wolfgang Schroeder/Bernhard Weßels (Hrsg.), Die Gewerkschaften in Politik und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 543–564. Trechsel, Alexander H./Sciarini, Pascal, 1998: Direct Democracy in Switzerland: Do Elites Matter?, in: European Journal of Political Research 33, 99–124. Triepel, Heinrich, 1907: Unitarismus und Föderalismus im Deutschen Reiche, Tübingen: Mohr. Truman, David B., 1951: The Governmental Process, New York: Knopf. —, 1955: Federalism and the Party System, in: Arthur W. Macmahon (Hrsg.), Federalism: Mature and Emergent, Garden City, NY: Doubleday, 115–136. Tsatsos, Dimitris Th., 1990: Die Stellung der politische Partei im Verfassungsgefüge, in: Dimitris Th. Tsatsos/Dian Schefold/Hans-Peter Schneider (Hrsg.), Parteienrecht im europäischen Vergleich, Baden-Baden: Nomos, 743–757. — (Hrsg.), 1992: Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich, Baden-Baden: Nomos. Tsebelis, George, 2002: Veto Players. How Political Institutions Work, Princeton: Princeton University Press. Tsebelis, George/Money, Jeannette, 1997: Bicameralism, Cambridge: Cambridge University Press. Ullmann, Hans-Peter, 1988: Interessenverbände in Deutschland, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. van Biezen, Ingrid, 2004: Political Parties as Public Utilities, in: Party Politics 10, 701–722. van Eimeren, Birgit/Ridder, Christa-Maria Ridder, 2005: Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien 1970 bis 2005, Media Perspektiven, 490–504. van Kersbergen, Kers/van Waarden, Frans, 2004: ›Governance‹ as a bridge between disciplines: Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and legitimacy, in: European Journal of Political Research 43, 143–171. Vandendriessche, Xavier, 2001: Le parlement entre déclin et modernité, in: Pouvoirs, No. 99, 59–70. 320 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE Varain, Heinz Josef, 1973: Einleitung, in: Heinz Josef Varain (Hrsg.), Interessenverbände in Deutschland, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 11–24. Veen, Hans-Joachim, 1976: Opposition im Bundestag. Ihre Funktionen, institutionellen Handlungsbedingungen und das Verhalten der CDU/CSU-Fraktion in der 6. Wahlperiode 1969–1972, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. Verney, Douglas V., 1995: Federalism, Federative Systems, and Federations: the United States, Canada and India, in: Publius 25, 81–97. Vink, Maarten, 2003: What is Europeanisation? and Other Questions on a New Research Agenda, in: European Political Science, 3, No. 1, 63–74. Voltmer, Katrin, 2000: Structures and Diversity of Press and Broadcasting Systems: The Institutional Context of Public Communication in Western Democracies, Discussion Paper FS III 00-201, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. — (Hrsg.), 2005: Mass Media and Political Communication in New Democracies, London/New York: Routledge. Vorländer, Hans/Schaal, Gary S., 2002: Integration durch Institutionenvertrauen? Das Bundesverfassungsgericht und die Akzeptanz seiner Rechtsprechung, in: Hans Vorländer (Hrsg.), Integration durch Verfassung, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 343–374. Wachendorfer-Schmidt, Ute (Hrsg.), 2000: Federalism and Political Performance, London: Routledge. Wagner, Jochen W., 2005: Deutsche Wahlwerbekampagner made in USA? Amerikanisierung oder Modernisierung bundesrepublikanischer Wahlkampagnen, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Wagschal, Uwe/Grasl, Maximilian, 2004: Die modifizierte Senatslösung. Ein Vorschlag zur Verringerung von Reformblockaden im deutschen Föderalismus, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 35, 732–752. Wahl, Rainer, 2001: Das Bundesverfassungsgericht im europäischen und internationalen Umfeld, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 37–38, 45–54. Waldrauch, Harald, 2003: Wahlrechte ausländischer Staatsangehöriger in europäischen und klassischen Einwanderungsstaaten: Ein Überblick, in: Wiener Hefte zu Migration in Theorie und Praxis 1, Heft 1, 55–75. Walker, David B., 1995: The Rebirth of Federalism: Slouching Toward Washington, Chatham: Chatham House. Wallerath, M., 2003: Diskussionsbeitrag im Rahmen der Aussprache zum Thema »Informalisierung und Entparlamentarisierung politischer Entscheidungen als Gefährdung der Verfassung«, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 62, Berlin/New York: de Gruyter, 99–100. Walter, Franz, 1999: Katholisches Milieu und politischer Katholizismus in säkularisierten Gesellschaften: Deutschland, Österreich und die Niederlande im Vergleich, in: Tobias Dürr/Franz Walter (Hrsg.), Solidargemeinschaft und fragmentierte Gesellschaft. Parteien, Milieus und Verbände im Vergleich. Festschrift zum 60. Geburtstag von Peter Lösche, Opladen: Leske & Budrich, 43– 71. —, 2002: Die SPD. Vom Proletariat zur Neuen Mitte, Berlin: Fest. LITERATUR 321 Ware, Alan, 1996: Political Parties and Party Systems, Oxford: Oxford University Press. Watts, Ronald L., 1999: Comparing Federal Systems, 2. Aufl., Montreal/Kingston: McGill–Queen’s University Press. —, 2002: Federal Evolution: The Canadian Experience, in: Arthur Benz/Gerhard Lehmbruch (Hrsg.), Föderalismus (Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 32), Opladen: Westdeutscher Verlag, 157–176. Wayne, Stephen J., 1978: The Legislative Presidency, New York u.a.: Harper & Row. Weber, Albrecht, 1986: Generalbericht: Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, in: Christian Starck/Albrecht Weber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Westeuropa, Baden-Baden: Nomos, 41–120. —, 2004: Typen der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Christian Starck (Hrsg.), Fortschritte der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Welt – Teil I. Deutsch-Japanisches Kolloquium vom 20. bis 24. September in Tokio und Kioto, Baden-Baden: Nomos, 35–48. Weber, Karl, 1980: Kriterien des Bundesstaates. Eine systematische, historische und rechtsvergleichende Untersuchung der Bundesstaatlichkeit der Schweiz, der Bundesrepublik und Österreichs, Wien: Braumüller. —, 1987: Die mittelbare Bundesverwaltung, Wien: Braumüller. Wehler, Wolfgang, 1979: Der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich. Die politische Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Zeit der Weimarer Republik, Diss. Bonn. Weixner, Bärbel Martina, 2002: Direkte Demokratie in den Bundesländern: verfassungsrechtlicher und empirischer Befund aus politikwissenschaftlicher Sicht, Opladen: Leske & Budrich. Weller, Patrick, 1997: Political Parties and the Core Executive, in: Patrick Weller/Herman Bakvis/R. A. W. Rhodes (Hrsg.), The Hollow Crown. Countervailing Trends in Core Executives, London: Macmillan, 37–57. —, 2003: Cabinet Government: An Elusive Ideal?, in: Public Administration 81, 701–722. Wengst, Udo, 1999: Die Prägung des präsidialen Selbstverständnisses durch Theodor Heuss 1949–1959, in: Eberhard Jäckel/Horst Möller/Hermann Rudolph (Hrsg.), Von Herzog bis Heuss. Die Bundespräsidenten im politischen System der Bundesrepublik, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 65–76. Werner, Camilla, 1993: Das Dilemma parlamentarischer Opposition, in: Dietrich Herzog/Hilke Rebenstorf/Bernhard Weßels (Hrsg.), Parlament und Gesellschaft. Eine Funktionsanalyse der repräsentativen Demokratie, Opladen: Westdeutscher Verlag, 184–217. Weßels, Bernhard, 1999: Die deutsche Variante des Korporatismus, in: Max Kaase/Günter Schmid (Hrsg.), Eine lernende Demokratie – 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Berlin: Edition Sigma, 87–113. —, 2004: Contestation Potential of Interest Groups in the EU: Emergence, Structure, and Political Alliances, in: Gary Marks/Marco Steenbergen (Hrsg.), Euro- 322 DIE INSTITUTIONALISIERUNG DER LIBERALEN DEMOKRATIE pean Integration and Political Conflict, Cambridge: Cambridge University Press, 195–215. —, 2006: Das bundesdeutsche Verbandsystem in vergleichender Perspektive, in: Thomas von Winter/Ulrich Willems (Hrsg.), Interessenverbände in Deutschland, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften (i.E.). Westle, Bettina, 2006: »Wahlrecht von Geburt an« – Rettung der Demokratie oder Irrweg?, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 37, 96–114. Wewer, Göttrik, 1991: Das Bundesverfassungsgericht – eine Gegenregierung? Argumente zur Revision einer überkommenen Denkfigur, in: Bernhard Blanke/Hellmut Wollmann (Hrsg.), Die alte Bundesrepublik. Kontinuität und Wandel (Leviathan, Sonderheft 12), Opladen: Westdeutscher Verlag, 310–335. Wiesendahl, Elmar, 2006: Mitgliederparteien am Ende? Eine Kritik der Niedergangsdiskussion, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesenthal, Helmut, 1981: Die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen: ein Beispiel für Theorie und Politik des modernen Korporatismus, Frankfurt a.M./New York: Campus. Wildenmann, Rudolf, 1954: Partei und Fraktion. Ein Beitrag zur Analyse der politischen Willensbildung und des Parteiensystems in der Bundesrepublik, Meisenheim am Glan: Westkulturverlag. Wilkinson, Paul, 2005: International Terrorism: The Changing Threat and the EU`s Response, Paris: Institute for Security Studies, European Union (ISS). —, 2006: Terrorism versus Democracy: The Liberal State Response, 2. Aufl., London/New York: Routledge. Wilson, Graham K./Barker, Anthony, 2003: Bureaucrats and Politicians in Britain, in: Governance, 16, 349–372. Winkler, Heinrich August, 2000: Der lange Weg nach Westen, 2 Bände, München: Beck. Winter, Thomas von, 1995: Interessenverbände im gesellschaftlichen Wandel, in: Thomas Jäger/Dieter Hoffmann (Hrsg.), Demokratie in der Krise? Zukunft der Demokratie, Opladen: Leske & Budrich, 145–167. —, 2004: Vom Korporatismus zum Lobbyismus. Paradigmenwechsel in Theorie und Analyse der Interessenvermittlung, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 34, 761–776. World Association of Newspapers, 2006: World Press Trends 2006, Paris: World Association of Newspapers. Zakaira, Fareed, 1997: The Rise of Illiberal Democracy, in: Foreign Affairs 76, No. 6, 22–43. Zangl, Bernhard, 2006: Das Entstehen internationaler Rechtsstaatlichkeit?, in: Stephan Leibfried/Michael Zürn (Hrsg.), Transformationen des Staates, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 123–150. Zoll, Rainer, 1997: Politikverständnis im Wandel. Die Abkehr der Studierenden von der Parteiendemokratie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 32, 27–35. Zubayr, Camille/Gerhard, Heinz, 2006: Tendenzen im Zuschauerverhalten, in: Media Perspektiven, 125–137. LITERATUR 323 Zuck, Rüdiger, 1998: Verfassungswandel durch Vertrag?, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 31, 457–459.