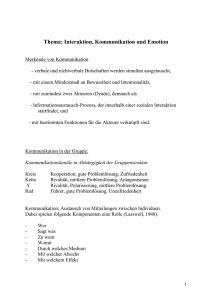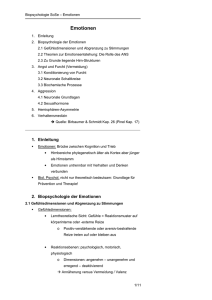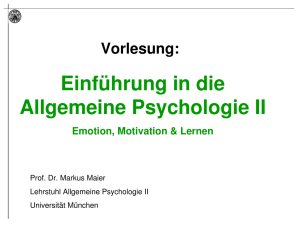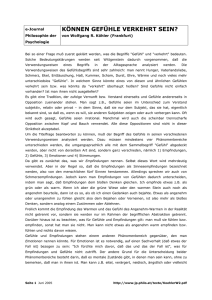Allgemeine Psychologie II
Werbung

Weder die Autorin noch der Fachschaftsrat Psychologie übernimmt Irgendwelche Verantwortung für dieses Skript. Das Skript soll nicht die Lektüre der Prüfungsliteratur ersetzen. Verbesserungen und Korrekturen bitte an [email protected] mailen. Die Fachschaft dankt der Autorin im Namen aller Studierenden! Version 1.0 (2011) Skript zur Vorlesung „Allgemeine Psychologie 2“ (Prof. Dr. Christian Unkelbach) Sommersemester 2010 verfasst von Kim K. 2 1. Vorlesung: Einführung Evaluatives Konditionieren - unterschiedlicher Valenzerwerb - Objekt in Verbindung mit einem positiven sozialen Erleben, das nicht mal mit dem Objekt selbst zusammenhängt - Quellenpräferenz kann verloren gehen („Ich weiß nicht warum ich dieses Lied mag…“) Evaluatives Priming - Automatische Verarbeitung von positiven & negativen Aspekten - Wie schnell können wir Valenz erkennen? Motivation: - Thomae (1965): „Motivation als Phasen des Aktivitätskontinuums, die unter dem Aspekt ihres Einflusses auf eine ... Veränderung der Intensität, Richtung und Form jeder Aktivität gesehen werden.“ - Graumann (1969): „Motivation als Wechselwirkung zwischen motiviertem Subjekt und motivierender Situation.“ - Motivation führt zu Emotion - Motivationspsychologie beschäftigt sich mit der Zielgerichtetheit von Verhalten - Wie viele Ziele entstehen überhaupt? Richten diese Ziele das Verhalten mit oder ohne Bewusstheit aus? - Wenn ein Ziel generiert wird, muss die Zielerreichung vorbereitet sein; dies leisten motivationale Faktoren, indem sie die Infoverarbeitungsvorgänge, physiologische Prozesse und das Verhalten darauf hin konfigurieren Emotionen: - Davidson, Scherer & Goldsmith (2003): „Der Begriff Emotion bezieht sich auf eine relativ kurze Episode von koordinierten Veränderungen im autonomen und zentralen Nervensystem, sowie im Verhalten. Diese Veränderungen erleichtern Reaktionen auf äußere Veränderungen die für den Organismus von Bedeutung sind.“ - Heckhausen, 1989: Emotionen können als rudimentäre Motivationssyteme verstanden werden - Frijda, 1986: Emotionen führen zu Handlungsbereitschaft (readiness to act) und legen Handlungspläne nahe (prompting) - Weiner, 2006: Emotionen als Folge von motiviertem Verhalten (z.B. Stolz und Scham) - Emotionen motivieren Verhalten (Bsp.: Angst motiviert Flucht) - „Elixiere des Lebens“ - In ihrem Ausgangspunkt bewertende Stellungnahmen zu inneren oder äußeren Ereignissen - Charakteristisch: automatische Entstehung - Es gibt aber auch Möglichkeiten, sie zu beeinflussen Ohne Motivation keine Emotion und ohne Emotion keine Motivation! 2. Vorlesung: Überblick Motivation Warum Motivation? - Ziele: Erfolg, Lob, Entspannung, Nähe, Wissen, Aufregung, … Ziele motivieren Verhalten - Motivationale Zustände… - … führen zu Verhalten - … führen zu spezifischem Verhalten - … führen zu persistentem Verhalten (bis zur Zielerreichung) - … variieren in ihrer Stärke - 3 Arten von Zielen nach Platon: Glück durch Erlangung… - irdischer Güter (Kleidung, Nahrung, Geld,…) - von Erfolg & Ehre - von Erkenntnis - Vielzahl unserer Aktivitäten sind auf Zielzustände oder Ziele ausgerichtet - Ein übergeordneter Zielzustand ist Wohlbefinden (siehe Wohlbefinden… unten) Abgrenzung „Handlung“ vs. „Verhalten“ (nach Werbik, 1978) - Verhalten kann unwillkürlich, automatisch, unbewusst sein (kein empirischer Wert) - Handlung ist absichtlich, zielgerichtet, sinnvoll - Reflexe sind nicht motiviert (als einzige Handlungen) 3 Prädikat „sich verhalten“ kann niemals abgesprochen werden, ist daher empirisch ohne jeden Gehalt (Watzlawick: man kann sich nicht nicht verhalten!) - Handlung - normalerweise die Veränderung eines Sachverhalts, aber auch Verhinderung (produktives Handeln vs. präventives Handeln) - nicht nur Tun, denn „nichts tun“ ist nicht gleichbedeutend mit „nicht handeln" - Konstitutiv für Handlung: - Feststellen mehrerer Alternativen (Entscheidungsfreiheit) - Abwägen - Entschluss (nicht unbedingt notwendig) - Implikationen: - nimmt Rationalität der Handelnden an - Verantwortlichkeit - Tiere: Verhalten, keine Handlung (keine Rationalität, keine Verantwortung) Motivationspsychologie: - Young: “We may define the study of motivation broadly as a search for determinants of human & animal activity.” - Mook: “The study of motivation is the search for principles that will help us understand why people & animals initiate, choose, or persist in, specific actions in specific circumstances.” Wohlbefinden als allgemeines Ziel - Menschen & Tiere streben danach, ihr Wohlbefinden durch eine Optimierung der Affektbilanz zu maximieren, indem sie Ereignisse, die positive Affekte anregen, herbeiführen & Ereignisse, die negative Affekte anregen, verhindern (Affektoptimierung) - Bsp.: Stolz auf eigene Leistung eher unbewusster Zielzustand; Sieg bzw. Nicht‐Versagen als bewusst repräsentiertes Ziel, das in diesem Fall der Erreichung des Zielzustandes dient - 2 Strategien zur Optimierung der Affektbilanz: - Positive Zustände aufsuchen (BAS) - Negative Zustände vermeiden (BIS) - Basis: aversives & appetitives Motivationssystem - Werden durch Mechanismus namens Affektantizipation aktiviert - Reize, die negative Affekte hervorrufen oder erwarten lassen (z.B. Buh‐Rufe, Pfiffe), aktivieren das aversive Motivationssystem Verhalten, das geeignet ist, negative Affekte zu minimieren oder zu verhindern - Können nicht nur durch aktuell vorhandene Reize, sondern auch durch vorgestellte zukünftige Ereignisse & mögliche Zielzustände (z.B. Niederlage) hervorgerufen werden - Reize, die positive Affekte hervorrufen (z.B. Beifall), oder vorgestellte zukünftige Ereignisse & Zielzustände, die positive Affekte erwarten lassen (z.B. Sieg, Freibier), aktivieren das appetitive Motivationssystem Verhalten zur Aufrechterhaltung oder Erreichung der positiven Reize und Ereignisse - Reize, Ereignisse & Tätigkeiten erhalten durch die Affekte, die sie anregen oder ankündigen, Anreizcharakter - Welche Reize & Ereignisse wir mit welchen Affekten verbinden, kann angeboren oder erlernt sein - Schmerz‐ & Nahrungsreize können z.B. ungelernt Affekte hervorrufen & entsprechendes Meiden‐ bzw. Aufsuchenverhalten in Gang setzen - Wenn solche Reize in Vergangenheit mit neutralen Reizen gekoppelt waren, können auch die neutralen Reize Anreizcharakter erhalten (Bsp.: Pawlow’scher Hund) Anreizcharakter: - Heckhausen (1977) unterscheidet Tätigkeitsanreiz & Ergebnisanreiz - Interaktion von Stimuli in der Umwelt & Zustand des Organismus (Bsp.: Hunger vs. kein Hunger & Burger vs. Knäckebrot) - Ob & wie stark Reize oder Ereignisse Affekte hervorrufen bzw. erwarten lassen, hängt nicht nur von Reizen selbst, sondern auch von Zustand bzw. Merkmalen des Organismus ab - Bsp.: Nahrungsreize aktivieren appetitives System stärker, wenn Organismus hungrig ist (satter Mensch wird kaum Anstrengungen unternehmen, Knäcke zu kriegen, da es kaum Anreizcharakter für ihn hat) - Anreize können aber auch unabhängig von Merkmalen des Organismus variieren - Bsp.: Burger hat höheren Anreizcharakter als Knäcke, unabhängig vom Hunger - 4 - Motive = Variablen auf der Organismusseite (s.u.) Motivation ist dann das Zusammenspiel von Person & Situation: Ein Hinweisreiz (Klausur) signalisiert, dass… - … ein Ziel erreicht werden kann (Erfolg) - … welches das entsprechende Motiv aktiviert (z.B., Leistungsmotiv) - … und zielgerichtetes (motiviertes) Verhalten in Gang setzt (Lernen) Auf Personenseite: Motive! - Motive = Bewertungsdispositionen, die bestimmen, ob & in welchem Maße ein Stimulus, Ereignis, oder Tätigkeit Anreizcharakter erhält (im positiven wie im negativen!) - Motive = Eigenschaften von Personen, auf Ziele einer bestimmten Thematik (z.B., Leistung, Macht) emotional anzusprechen - Indem sie beeinflussen, welche Umweltreize zu Anreizen werden, haben Motive einen Einfluss darauf, welche Zielzustände Menschen anstreben - Bestimmen, welche Aspekte der Umwelt wir bevorzugt wahrnehmen, worauf wir emotional reagieren und wodurch Verhalten aktiviert werden kann - In Motivationspsychologie werden Motive verschiedenen Zielen und Zielzuständen zugeordnet - Thematisch ähnliche Ziele werden zu Inhaltsklassen zusammengefasst - Motive können sich nicht nur auf unterschiedliche Inhalte (z.B. Leistung vs. Anschluss) beziehen, sondern auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein (s. 2 Arten von Motiven) - Motive & Anreize haben nicht nur einen Einfluss darauf, welche Ziele und Zustände bevorzugt verfolgt oder gemieden werden, sondern auch darauf, mit welcher Intensität & Dauer dies geschieht - Motive & Anreize sind eng aufeinander bezogen & rufen gemeinsam eine Motivation hervor, die dann Richtung, Intensität & Dauer des Verhaltens reguliert 2 Klassen von Motiven - Biogene Motive - Motive, die eher mit Reizen zusammenwirken, die ungelernt emotionale Qualität besitzen und eine starke genetische Basis haben - Bsp.: Hunger, Durst, Sexualität - besitzen angeborene emotionale Qualität genetische Komponente - variieren eher intraindividuell - Bsp.: Man kann je nach Tageszeit unterschiedlich stark Hunger haben - Soziogene Motive - Motive, die stark durch Lern‐ & Sozialisationsprozesse geformt sind - Bsp.: Anschluss, Intimität, Macht und Leistung - erwerben emotionale Qualität durch Lern‐ & Sozialisationsprozesse starke Lernkomponente - basieren nicht auf aktuellen biologischen Bedürfnissen wie biogene Motive, sondern auf Persönlichkeitseigenschaften, die im Laufe der Sozialisation entstehen; überdauernde Dispositionen - variieren interindividuell - Bsp.: Erfolg kann für Person X wichtiger sein als für Person Y - aber: aktuelle Forschung zeigt, dass auch soziogene Motive genetische Anteile haben & biogene Motive gelernte Anteile Bedürfnisse & Triebe: - Bedürfnis Trieb Verhalten - Bsp: Nährstoffe Hunger Essen - Ursprung? - McDougall: Instinkte - Nahrungssuche, Ekelimpuls, Sexualtrieb, Angst/Furcht, Neugier, Elterninstinkt, Geselligkeitsstreben, Selbstbehauptungsstreben, Unterordnungsbereitschaft, Ärger/Zorn, Hilfesuchen, Herstellungsbedürfnis, Besitzstreben, Drang zu lachen, Komfortbedürfnis, Ruhe‐ und Schlafbedürfnis, Migrationsbedürfnis, einfache körperliche Verhaltensäußerungen (husten, niesen, atmen, ausscheiden) - Kritik an Instinkttheorie: - Problem der Zirkularität: Aus Verhalten wird auf Instinkt / Trieb geschlossen, der eben dieses Verhalten wieder erklärt! - Keine Lösungsvorschläge für Konflikte zwischen verschiedenen Instinkten! - 5 Maslows Bedürfnis‐Pyramide: A Hierachy of Needs - Lösungsvorschläge für Konflikte: je weiter unten in Pyramide, umso eher wird Bedürfnis befriedigt (“gewinnt”; z.B. physiologische Bedürfnisse vor Selbstverwirklichung) - Probleme: - Hierarchie wird nicht eingehalten („Arbeiten bis zur Erschöpfung“, übergreifendes Diätverhalten, Hungerstreiks) - Empirisch schwer zu überprüfen - Aber: deskriptiv sehr nützlich - manche Bedürfnisse sind mächtiger als andere - basalere Bedürfnisse führen zu stärkeren Motivationen Zusammenfassung: - Organismus‐ & situationsseitige Bestimmungsstücke des motivierten, d.h. zielgerichteten, Verhaltens - Organismusseitig: Motive - Situationsseitige: tatsächlich vorhandene oder vorgestellte Reize/Ereignisse/Tätigkeiten, die entweder ungelernt emotionale Qualität besitzen oder diese Qualität im Laufe der individuellen Lerngeschichte erhalten haben - Anreize = Aspekte des Reizes/Ereignisses, die sie begehrenswert machen oder Furcht anregen; gemeinsames Produkt der situationsseitigen objektiven Eigenschaften eines Reizes & der personenseitigen Motive - Graumann: Motivation als Wechselwirkung zwischen motiviertem Subjekt & motivierender Situation - Ziel: Affektoptimierung - Person: Motive ↔ Situation: Anreize - Resultat: Motivation, welche die Richtung, Intensität & Dauer eines Verhaltens determiniert - Reize & Ereignisse werden durch Motive zuerst zu Anreizen - Motive werden durch Anreize verhaltenswirksam - 3 große Motive: Bindung, Macht, Leistung Problem: Differentialpsychologie! - Mechanismen vermutlich bei allen Menschen & Tieren - Dennoch muss man Motivation auch differentialpsychologisch betrachten! - Soziogene Motive als Persönlichkeitseigenschaften, in denen sich Menschen unterscheiden - Menschen unterscheiden sich dispositionell darin, welche Art von Zielzuständen sie zur Affektoptimierung anstreben (machtmotiviert, leistungsmotiviert, furchtmotiviert, etc.) - Bsp. experimentelle Psychologie: Lernen - Anzahl Verstärkungen bestimmt die Intensität des Verhaltens (Futterkugeln Labyrinthdurchquerung) - nun aber: Wirksamkeit der Verstärkung hängt von interindividuell unterschiedlich ausgeprägten Motiven ab (nicht nur Futter, sondern auch Deprivation der Ratte) Messmethoden - Fragebogen - Annahme: Bewusster Zugang zu internen Prozessen möglich - aber: Nisbett & Wilson: „Telling more than we can know“ - Thematischer Auffassungstest (TAT) (Murray, 1938) - Bild wird gezeigt, VP soll Geschichte dazu erzählen - Je nach Geschichte: Rückschluss auf Bindungs‐, Macht‐ oder Leistungsmotiv (indirektes Verfahren) - Probleme: - Kein Test im eigentlichen Sinne - Validitätsproblematik; Bsp.: Atkinson & McClelland (1948): Feldstudie: Matrosen fasteten zwischen 1 & 16 h; im Fragebogen hatten Bezüge zu Hunger einen umgekehrt U‐förmigen Verlauf; TAT zeigte lineare Zunahme nahrungsbezogener Inhalte - Durchführung, Auswertung, Interpretation - Multi‐Motive‐Grid (MMG) - 14 Bilder mit keiner, mittlerer oder hoher Ambiguität (Mehrdeutigkeit) - 12 Aussagen TAT zum Ankreuzen (168 Items) 6 Validierung des MMG: Leistungsmotiv Puca & Schmalt: gemessenes Leistungsmotiv sagt Performanz in einer Reaktionszeitaufgabe vorher & wie angenehm diese Aufgabe erlebt wurde - Machtmotiv - Sokolowski & Kehr: gemessenes Machtmotiv sagt erlebtes Lernen in einem Kurs für Manager vorher - Bindungsmotiv - Schmalt & Langens: gemessenes Bindungsmotiv sagt die Häufigkeit von Beziehungsthemen in einer Tagebuchstudie bei Studierenden vorher - Wichtig: Interindividuelle Unterschiede sagen vorher, welche Stimuli für eine Person Anreizcharakter haben - Leistung: sich kompetent fühlen; über fehlende Fähigkeiten nachdenken - Bindung: gerne andere Leute treffen; Angst davor, zurückgewiesen zu werden - Macht: Einfluss auf andere ausüben; Furcht, von anderen überstimmt zu werden Historischer Abriss - Verhaltensbiologie: Instinkte & Triebe - Psychoanalytische Ansätze: Lebenstrieb & Todestrieb - Lerntheoretische Ansätze: Gelernte Anreize - Feldtheorie: Entfernung & Valenz Verhaltensbiologie: Instinkte & Triebe - Annahme, dass Verhalten von Menschen & Tieren Energiequelle zugrunde liegt - Sicht vor Darwin: Tiere sind von Instinkten & Trieben geleitet, Menschen von Wille & Rationalität - Sicht nach Darwin: da Menschen & Tiere einen evolutionär gemeinsamen Hintergrund haben, kann man auch menschliches Verhalten mit Trieben & Instinkten erklären - Instinkte = angeboren; keine Lernerfahrung nötig; innere (Schmerz) oder äußere Reize lösen automatisch Verhalten aus - Spencer (1899): direkte Anwendung Darwinistischer Ideen - Verhalten, das Überleben fördert, wird als angenehm erlebt - Verhalten, das Überleben gefährdet, wird als unangenehm erlebt - James (1890): Instinkte als Grundlage allen Verhaltens; aber inflationäre Verwendung des Instinktbegriffs - McDougall (1908): 18 Instinkte/Neigungen (2. VL) - Trieb (Freud, Woodworth) ersetzte Instinkt - Instinkt war in Misskredit geraten, da „Instinktlisten“ immer länger wurden & man hinter jedem beobachtbaren Verhalten sofort Instinkt vermutete - Triebkonzept war universeller: Trieb als Kraft mit physiologischer Grundlage (z.B. durch physiologischen Mangelzustand) Verhalten, das Mangelzustand behebt, wird energetisiert - Triebe für behaviouristische Forscher von Vorteil, da willkürlich variierbar bzw. manipulierbar; konnten an objektiven Maßen (z.B. Dauer des Nahrungsentzugs) festgemacht werden - Thorndike (1911): Lernpsychologe; Bedeutung von physiologischen Defiziten für das Verhalten - Nahrungsdeprivierte Tiere lernten schneller den Weg zu einer Futterquelle als gerade gefütterte Psychoanalytische Ansätze: Lebenstrieb & Todestrieb - Triebe als Reize, die aus dem Körper stammen & mental repräsentiert werden (Bsp.: Durst als mentale Repräsentation der trockenen Mundschleimhaut) - Triebreiz führt zu Unlust („Lust‐Prinzip“) - Triebreduktion als Motor des Verhaltens - 2 grundsätzliche Triebe: Lebenstrieb („Eros“) & Todestrieb („Thanatos“) (nicht nachweisbar!) Lerntheoretische Ansätze: Gelernte Anreize - Behaviorismus: Wissenschaftliches Arbeiten kann sich nur auf beobachtbaren Fakten beziehen - Thorndikes „law of effect“ (1911): Reaktionen, denen eine Befriedigung folgt, sind enger an die situativen Gegebenheiten gebunden, in denen sie aufgetreten sind - Kontrast zum „Lust‐Prinzip“: Verhalten wird nicht ausgeführt, um positive Zustände zu erreichen, sondern GELERNT! Hulls Triebreduktionstheorie: - E = D x H (Verhaltensstärke = Trieb x Habit) - 7 Beim Lernen von Reiz‐Reaktions‐Verbindungen wirkt eine Triebreduktion, die der Reaktion folgt, belohnend & verstärkt somit die Reiz‐Reaktions‐Verbindungen - Verhaltensstärke E (evocation potential) wird beeinflusst von: - Habit (H, Gewohnheiten) - gelernte Reiz‐Reaktions‐Verbindungen - Habitstärke steigt mit Anzahl der vorangegangenen belohnten Lerndurchgänge - Durch Habit wird bestimmte, welches Verhalten in einer bestimmten Situation ausgeführt wird - Drive (D, Trieb) - unspezifischer Energielieferant für Verhalten (motivationale Komponente) - In unspezifischen Trieb fließen alle Bedürfnisse (Hunger, Durst, Schmerzvermeidung) ein - Später fügte Hull noch einen 3. Faktor hinzu: Anreiz (Incentive) E = D x H x I - Nicht nur Kräfte innerhalb des Organismus können das Verhalten beeinflussen, sondern auch situative Faktoren (z.B. Qualität der Belohnung) Lewins Feldtheorie: Entfernung & Valenz - Verhalten ist eine Funktion des psychologischen Kräfte‐Feldes - Kräfte‐Feld besteht aus der Person & ihrer Umwelt: zieht Person zu positiven Zielen hin & stößt sie von negativen Zielen ab - Anziehung & Abstoßung hängen ab von: - Entfernung der Person zum Ziel (psychologische Entfernung!) - Valenz des Ziels (wie wertvoll ist das Ziel?) - Bild: „Positive central force field corresponding to a positive valence (Va>0)” - G: Bereich positiver Valenz (Va (G) > 0; liegt in C - P: Person - F: Kräfte (fA,C, fH,C, fL,C) beziehen sich auf Va (G), wenn die Person sich bei A, H oder L befindet - 3. Vorlesung: Theorien der Motivation I Menschenbilder - Humanistisch: Menschen als Einheit („gott‐gleich“ mit Kognitionen ausgestattet) - Attributionstheorien - Erwartung x Wert ‐ Modelle - Funktionalistisch: Menschen als Maschinen - Biologische Theorien - Triebtheorien - Psychoanalytische Theorien Freuds Psycho‐Dynamischer Ansatz - Hintergrund: Beobachtungen formen die gemachten Theorien - v.a. neurotische bzw. klinische Patienten (berühmtes Beispiel: Anna O.) - Ansatz der Triebreduktion - 2 grundlegende Prinzipien: - Homöostase - Bestreben des Organismus, ein internes Gleichgewicht aufrecht zu erhalten - Tendenz zur Erhaltung eines relative stabilen inneren Milieus (Organismus ist bestrebt, in einem inneren Gleichgewichtszustand zu verbleiben) - Bsp.: Wärme Schwitzen; Kälte Zittern; Hunger nahrungsbezogene Aktivität - Hedonismus - oft Bentham zugeschrieben - Lustgewinn & Glück als Hauptziele im Leben (s.a. positive Affektbilanz) - Homöostase als übergeordnetes Prinzip & Lustgewinn als Nebenprodukt eines mentalen & physiologischen Equilibriums/Gleichgewichtszustands - Folgerungen: - Zufriedene Individuen zeigen keine Aktivität - Aktivität & Suche nach Stimulation zeigen Unzufriedenheit an - „Rückkehr in den Mutterleib“ alle Bedürfnisse sind gestillt - Im Tod gibt es keine unbefriedigten Bedürfnisse (Nirwana) 8 Zentrale Elemente von Freuds Ansatz - Struktur: Es, Ich, Über‐Ich - Dynamik (Triebe): Lebenstrieb („Eros“), Todestrieb („Thanatos“) - Ebenen der Persönlichkeit: Bewusstes, Vorbewusstes, Unbewusstes Struktur: - Es - Sitz der gesamten psychischen Energie - kann ein gestörtes Equilibrium nicht ertragen & reagiert nach dem Lustprinzip (Hedonismus: Lust wird angestrebt & durch homöostatische Prozesse & Spannungsreduktion erreicht) - Verfügbare Optionen: Reflexapparat; „Primärprozess‐Denken“ (unlogisch, zeitlos, Reales & Irreales wird nicht unterschieden) - Probleme: - Kein Befriedigungsaufschub möglich - Unterscheidung von Realität & Vorstellung (d.h. reale & vorgestellte Milch) - Ich - Entwickelt sich aus Randbereichen des ES - Agiert nach Realitätsprinzip (Ziel immer noch Lustgewinn, aber angepasst an Realität) - Verfügbare Optionen: „Sekundärprozess‐Denken“ (Logik, Gedächtnis, Wille & Konzentration, Willkürmotorik) - Über‐Ich - entwickelt sich als letzte Instanz durch Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil - kann moralisches Verhalten mit Stolz belohnen („Ich‐Ideal“) - kann unmoralisches Verhalten mit Schuldgefühlen bestrafen („Gewissen“) Empirische Beobachtungen: - Bei Säuglingen: Ruhelosigkeit Saugen Ruhe - Theoretisch: Trieb Triebhandlung Triebbefriedigung - Alternativ: Unlust Verhalten Lust Aufschub der Triebbefriedigung - Nicht möglich, was nun? (Bsp.: Nahrung, Sex, Aggression, Ruhe) - ES verlangt Befriedigung - Aber: Unmittelbare Befriedigung führt zu mehr Unlust als Lust - ICH schaltet sich ein - Befriedigungsaufschub - Umweghandlungen - Sublimierung - Verdrängung - Projektion Zusammenfassung der Positionen - Triebe energetisieren das Verhalten - Sitz der Triebe ist das ES (daraus folgt: Menschen sind sich der „wahren“ Gründe für ihr Verhalten nicht bewusst!) - Primär‐ & Sekundärdenken haben letztendlich Trieb‐Befriedigung zum Ziel - Maschinen‐Eigenschaften: - Annahme der psychischen Energie - Fixe Input‐Output‐Schema - Struktur der Maschine bestimmt ihre Funktion - keine volitionale Kontrolle / kein bewusster Zugriff Empirische Tests: - Problem: Psychodynamischer Ansatz kann post‐hoc jedes empirische Ergebnis erklären - Bsp.: Ödipus‐Komplex - Hypothese: Sohn liebt die Mutter & möchte den Vater töten - Empirischer Befund: Sohn hasst die Mutter & liebt den Vater - Erklärung: Verdrängung/Sublimierung des ursprünglichen Triebes - Katharsis 9 - Klare Aussage der Theorie: Vorgestellte Handlungen sollten Triebe genauso befriedigen wie tatsächliche Handlungen Aristoteles: Erleben der Tragödie im Theater „reinigt“ den Menschen von seinen Leidenschaften Katharsis Folgerungen: Sex vorstellen sollte Sexualbedürfnisse befriedigen Leistung beobachten sollte Leistungsmotivation reduzieren Macht beobachten sollte Machtmotivation reduzieren Katharsis & Aggression Meisten Studien zeigen das Gegenteil (Aggressives Verhalten zeigen führt zu mehr aggressivem Verhalten) Priming Verfügbarkeit Normen‐Modelle („Was ist angemessenes Verhalten?“) Bushman, Baumeister, & Stack (1999): auf einen Sandsack einprügeln; in einem fiktiven Spiel die Lautstärke einstellen, mit der ein Mitspieler bestraft wird Kritische Würdigung - Keine Theorie im eigentlichen Sinne (nicht zu testen) - basiert v.a. auf klinischen Beobachtungen - hoher heuristischer Wert - Basis für viele folgende Theorien Verhaltensforschung - Zentrales Konzept: Instinkt (s. aber Probleme des Instinktbegriffs) - Instinktives Verhalten = Verhaltensmuster, die nach einem fixen Schema ablaufen - Netze von Spinnen / Paarungsrituale - das Muster wird vollständig ausgeführt - oft irrational (Vögel versuchen, kaputte Eier ins Nest zurück zu rollen) - Instinkt = spezifische motivationale Tendenz - Handlungspotenziale, deren Ziel fix ist, das Verhalten um das Ziel zu erreichen kann jedoch vielfältig sein (s. Freud & aggressives Verhalten) - Schlüssel‐Schloss‐Metapher - instinktives Verhalten: feste Verhaltensmuster - Bsp.: Stichlinge & die Farbe Rot (greifen alle roten Gegenstände an, weil männliche Konkurrenten zur Paarungszeit rot sind) - bestimmte Stimuli in der Umwelt lösen instinktives Verhalten aus Lorenz: hydraulisches Instinktmodell - Je stärker Reize sind, umso stärker fallen die Reaktionen aus Zeit, seit das Verhalten zuletzt gezeigt wurde - Sehr starke Reize können auch bei fehlender Motivation Reaktionen auslösen - Sehr hohe Motivationen können auch bei fehlenden Reizen Reaktionen auslösen - Bsp.: Kindchen‐Schema als starker Reiz Empirische Belege Reaktionen - Vakuum‐Verhalten: wenn Reaktionen lange nicht ausgeführt werden, werden Verhaltensmuster dennoch ausgeführt - Übersprungshandlungen: wenn Reaktionsmuster im Konflikt Reiz stehen, „läuft das Energiereservoir über“ & unangemessene Verhaltensweisen werden gezeigt Kritische Würdigung des Modells - postuliertes „Energiereservoir“ lässt sich physiologisch & psychologisch nicht nachweisen - erklärt v.a. reaktives Verhalten bei Tieren - „willkürliches“ Verhalten kann nicht erklärt werden - Phänomene der Übersprungshandlung & der Leerlaufhandlung sind schwer anders zu erklären (z.B. lerntheoretisch) - 10 Soziobiologische Ansätze - Verhaltensforschung: proximale Determinanten von Verhalten (hormonelle Zustände, Signale in der Umwelt) - Sozio‐Biologie: distale oder ultimate Determinanten von Verhalten (Funktion des Verhaltens in einem evolutionären Kontext) - Grundlegende Annahmen: - Verhalten wird von Genen bestimmt - Gene sind selektiert, um Fitness zu maximieren - Alle Organismen sind Überlebensmaschinen & Genom‐Produzenten - Folgerungen: - Menschen sind sich der „ultimativen“ Ziele ihres Verhaltens nicht bewusst - Verhalten kann flexibel sein, solange es das Überleben des genetischen Pools sichert (kein mechanisches Bild des Verhaltens) - Kontrast zu Darwin: Nicht das Überleben des Organismus oder der Spezies, sondern des Gen‐Pools ist entscheidend (löst Problem des Altruismus) Beispiele für empirische Tests - Man kann nur ein Kind retten: 5‐ oder 1‐Jähriges (richtig: 1‐Jähriges) - Welche Großeltern sind liebevoller: Eltern der Mutter oder Eltern des Vaters (Eltern der Mutter) - Wer betrauert den Tod eines Kindes mehr: Mutter oder Vater (Mutter); junge oder alte Eltern (alte) Kritische Würdigung - hoher heuristischer Wert - schwer empirisch zu testen (viele Alternativ‐Erklärungen) - stark unterschiedliche Analyse‐Ebene (wenig an Individuen orientiert) - rein mechanistisches Menschenbild, bis dahin, dass sich nur einzelne Gene reproduzieren 4. Vorlesung: Theorien der Motivation II Themen: - Hulls Triebtheorie - Lewins Feldtheorie - wissenschaftliches Erbe von Kurt Lewin (Festinger et al.) Clark L. Hull (1884‐1952) - B.Sc. in Maschinenbau; wichtigste akademische Zeit: Yale University - 3 psychologische Themen - Diagnostik (Leistungsdiagnostik) & Statistik - Hypnose & Beeinflussbarkeit - Lernen & Motivation - Erste „große“ Figur der Motivationspsychologie - Stark an Ideen des Behaviorismus angelehnt - „Trieb“ (wie Freud) statt „Instinkt“ empirisch nachweisbar bzw. manipulierbar Gemeinsamkeiten Freud & Hull - Verhalten hat Ursachen & die Forschung kann diese Ursachen identifizieren - Homöostase & Hedonismus steuern das Verhalten (Organismen streben ein Equilibrium an) - Spannungsreduktion (Befriedigung) ist Ziel des Verhaltens Unterschiede Freud & Hull - Freud: Mediziner; Mensch als geschlossenes Energiesystem; ES; Beispiel Dampfkessel - Hull: Forscher/Experimente – Behaviorist, alles was ich nicht beobachten kann ist nicht von Relevanz; Konstrukt/Idee wird durch Trieb ersetzt - Instinkt: Erklärungen/Konstrukt des Instinkts noch unbefriedigend für Behavioristen (Instinkt zu Essen ist nicht beobachtbar) - Trieb: als physiologischer Parameter manipulierbar; Trieb zu Essen wird messbar (wie lange hat jemand nicht mehr gegessen) Freud Hull 11 Geschlossenes Energiesystem (im ES verankert) Daten aus Therapien (freie Assoziationen, Träume, …) Psychologische Konstrukte als Erklärung (ES, Ich, …) Energie kann beliebig ansteigen (Triebstärke nicht beschr Daten aus hoch kontrollierten Labor‐Experimenten nur beobachtbare Bedürfnisse als Erklärungen (keine psychologischen Konstrukte) Behaviorismus: Thorndike - eine der 3 bedeutendsten Gesetzmäßigkeiten der Lerntheorie - The Law of Effect (1911) - Wenn eine Situation/Stimulus‐Reaktionsverbindung zu Belohnung führt, wird diese Verbindung verstärkt (reinforcement) - Kommt Organismus erneut in diese oder eine ähnliche Reizsituation, wird er die Reaktion mit einer größeren WS als zuvor zeigen - Umkehrschluss: Negative Law of Effect - Wenn eine Situation/Stimuus‐Reaktionsverbindung zu negativen Konsequenzen fürht, sinkt die Auftretens‐WS dieser Reaktion - Prinzip des trial & errors; zufälliges Verhalten Belohnung Effekt - Bsp.: hungrige Katzen in Käfig können einen Mechanismus bedienen, der die Klappe zu Futter öffnet - am Anfang: zufälliges Verhalten - nach erfolgter Lösung: Verhalten wird immer schneller gezeigt - keine Intelligenzleistung, sondern Lernprozess - Thorndikes Puzzle‐Box: - Kleine verschlossene Kammer, deren Tür sich durch einen simplen Mechanismus öffnen ließ - Versuchstier sollte diesen Mechanismus entdecken - Nach erfolgreicher Öffnung der Tür: Belohnung mit Futter - Tiere erkundeten zunächst scheinbar planlos den unbekannten Käfig - Zeigten meist erst nach langer Zeit jenes Verhalten, das die Tür öffnete - erste richtige Reaktion rein zufällig - Thorndike fertigte „Lernkurven“ an (Verweildauer der Tiere x Anzahl der wiederholten Übungen) - Art „Aha‐Erlebnis“: können Problem plötzlich lösen; Einsicht? (Lernkurve müsste sich sprunghaft ändern) ODER - Lernen durch trial & error (Lernkurve müsste sich allmählich ändern)? - Ergebnis: Katzen lernen durch trial & error - bei Wiederholung der Versuchsdurchgänge wurde die Latenzzeit bis zum Auftreten der „richtigen“ Reaktion von Durchgang zu Durchgang immer kürzer - Grundlage: Assoziationslernen - Stärke der S‐R‐Verbindung musste im Laufe der Untersuchungen zugenommen haben (S = Käfig‐ Innenraum; R = Verhalten, das Tür öffnet - Grund für die zunehmende Stärke der Verbindung: darauf folgende positive Konsequenzen - Futter hat die für das Entkommen nötigen Verhaltensweisen im Käfig „verstärkt“ Gestaltpsychologie: - Köhlers Forschung zur „guten Gestalt“: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile Trieb anstelle von Instinkt - Konstrukt des Instinkts problematisch - neues Konstrukt: Trieb (wahrscheinlich Woodworth, 1918) - Trieb besser zur Erklärung von Verhalten als Instinkte: - lässt sich empirisch auf physiologische Parameter zurückführen, Instinkt nicht - kann manipuliert werden, Instinkt nicht (z.B. Stunden seit letzter Fütterung/letztem Geschlechtsverkehr) Columbia Obstruction Box - Triebkonstrukt wird messbar gemacht - Start‐Box Elektrisches Gitter Zielbox (Futter) - Operationalisierung & Messung eines Triebes - UVs: - 1) „drive to action“ = Stunden seit der letzten Fütterung - 2) „strength of resistance“ = Stärke des angelegten Stroms 12 - AV: Überquert die Ratte das Gitter oder nicht? Triebkonzept nach Hull - Trieb ist die unspezifische Kraft, die Verhalten motiviert, z.B. durch - Deprivation (Hunger oder Durst) - Temperaturabweichungen vom Optimum - Verletzungen - Hormonelle Veränderungen (Sex) - Deprivation, Schmerz, usw. Bedürfnis nach Equilibrium Trieb (motivationale Kraft) - Bsp.: Körpertemperatur als klassisches Beispiel für Homöostase, weil sie nicht gesteuert wird - 15° im Raum, 2 Stunden kein Essen, viel Hunger - 20° im Raum, 2 Stunden kein Essen, weniger Hunger als zuvor „Drive“ & „Habit“ - Trieb als unspezifischer Motivator: Woher kommt die Richtung? - S. Thorndike: satte Katzen zeigen keine Aktivität im Käfig; „gelernte“ Verhaltensweisen werden aktiviert - Trieb kann auch zu „nicht“‐Verhalten führen (wenn dies die gelernte Assoziation in einer gegebenen Situation ist, z.B. Starre statt Flucht) - Behavior = Drive x Habit (E = D x H) - Drive = stellt unspezifische Energie bereit; messbar, aber unspezifisch; kann auch zu Nicht‐Verhalten führen - Habit = bestimmt die Richtung des Verhaltens; wenn noch kein Verhalten verstärkt wurde, hat unspezifische Aktivität die höchste Habit‐Stärke; Häufigkeit der gelernten Verhaltensweise - Neue Situation Verhalten zufällig Reaktionen werden beobachtet Lernen Verhalten Habit Trieb‐Antezedenz Bedürfnis Trieb x Verhalten Lernen Habit Richtung - Trieb motiviert Verhalten (d.h. Energiequelle) - Trieb & Habit sind multiplikativ verknüpft - Trieb ist eine unspezifische Motivationsquelle (d.h. Energiequelle) Test der multiplikativen Funktion - Perin (1942) & Williams (1938): multiplikative Verknüpfung von Drive & Habit (interagieren!) - Zeichnung: X‐Achse: Habit (Anzahl der Lerndurchgänge); Y‐Achse: Verhaltensstärke; untere Linie: niedriger Drive (3h; Perin); obere Linie: hoher Drive (22h; Williams) - Ratten bekommen 23 h nichts zu fressen - können einen Hebel drücken, um Futter zu bekommen - UVs - Drive (beim Testen: 22 h oder 3 h nichts zu fressen) - Habit (beim Lernen: 5 verstärkte Trials oder 90 verstärkte Trials) - AVs - Anzahl gelernter Reaktionen bis das Verhalten wieder „gelöscht“ ist (Extinktion) - Ergebnisse: - Bei geringer Triebstärke (Drive) wächst die Verhaltensstärke mit der Anzahl der Lerndurchgänge langsamer als bei hoher Triebstärke (Drive) - (additiv wäre es gewesen, wenn die beiden Linien parallel verlaufen wären) Trieb als allgemeine Energiequelle 13 - Webb (1949): Ratten lernen eine Reaktion nach 22 h Futter‐Deprivation - UV: Dauer der Wasserdeprivation - AV: Reaktionen bis zur Löschung des Verhaltens Probleme - Stärkere Reaktionen für das spezifische Verhalten - Hunger & Durst nicht unabhängig - durstige Ratten fressen weniger - darum: durstige Ratten hungriger als wasser‐gesättigte Ratten - Klarer Widerspruch zu Maslow (1943)! Problem für Hull: Miller‐Experimente - Ratten werden in weiße Box gesetzt, die durch Tür von einer schwarzen Box getrennt ist - Gitter wird unter Strom gesetzt Ratten fliehen in schwarze Box - Nach einigen Durchgängen fliehen Ratten in schwarze Box, bevor sie geschockt werden - die Tür lässt sich nun nur durch eine Radbewegung öffnen Ratten lernen diese Reaktion - Ratten vermeiden den Schock, anstatt ihm zu entkommen! - Thorndike würde in diesem Fall vermuten: Ratte dreht nur dann den Hebel, wenn das Equilibrium gestört ist, also Strom da ist, damit kein Drive - Stimmt so aber nicht: Ratte öffnet die Tür auch ohne Schock, Klassische Konditionierung: die weiße Box als negativer Stimuli, weil eine konditionierte Assoziation zu Strom besteht Probleme für E = D x H - Drive = 0 für Vermeidungsverhalten (es hat noch kein Schmerz eingesetzt) - Was aber motiviert dann das Verhalten? - Lösung: Stimuli können Trieb‐Eigenschaften über Konditionieren erwerben weiße Box erwirbt die Charakteristika des Elektro‐Schocks - Konzept des sekundären Triebs - Primärer Trieb (Hunger, Durst, etc.) - Sekundärer Trieb (alle Stimuli, die mit primären Trieben assoziiert werden) Größeres Problem: Crespi (1942) - hungrige Ratten durchlaufen ein einfaches Labyrinth - UVs: Upward/Downward‐Shifts der Verstärkung am Ende (Futterkugeln) - 1 zu 4 und 1 zu 16 - 256 zu 16 und 64 zu 16 - Kontrollgruppe: 16 konstant - Ergebnisse: - Relative Ab‐ & Zunahme der Futterkugeln (Kontrast zur vorangegangenen Menge) bestimmt die Laufgeschwindigkeit (Verhaltensstärke)! - Ratte von 256 auf 16 Futterkugeln wird langsamer als die Ratten der KG, die konstant 16 bekommt - Warum langsamer obwohl beide Bedingungen 16 Futterkugeln? - Rolle des Anreizes aus der Umwelt! Probleme für Hull - Abrupte Verhaltens‐Änderungen nach oben können nicht durch Habit‐Änderungen erklärt werden - Abfall des Verhaltens kann nicht erklärt werden (H bleibt gleich & D bleibt gleich) - Lösung: Konzept der Incentives (Anreiz, I) Update der Theorie - Motivation = Trieb x Habit x Anreiz (E = D x H x I) - Unterschied Trieb & Anreize? - Trieb/Drive = motivationaler Zustand innerhalb des Organismus - Anreiz = situativer Anreiz in der Umwelt - sehr nah an modernen Theorien: Motivation als Interaktion von Umwelt‐Reizen & motiviertem Subjekt Kritische Würdigung - hoch mechanistisches Menschenbild (Hull als studierter Maschinenbauer) - stark behavioristisch geprägt 14 - Vorläufer moderner Theorien - sehr starke Vorhersagen, die rigoros getestet wurden (klarer Kontrast zu Freud) - aber: Rattenpsychologie! (Problem der Erweiterung/Übertragung auf den Menschen) Kurt Lewin (1890 ‐ 1945) - geboren in einem Teil Polens, der damals zu Preußen gehörte - sehr breites Forschungsinteresse - „Vater“ der amerikanischen Sozialpsychologie - Motivationspsychologie: Feld‐Theorie Grundlegende Annahme Lewins - Verhalten = Funktion von (Person, Umwelt) - B = f(P, E) - Person & Umwelt bilden „life space“, der Verhalten an einem gegebenen Punkt bestimmt - Wichtigste Unterscheidung: psychologische Realität vs. physikalische Realität (Bsp.: bei Schneesturm über dünnes Eis laufen, ohne es zu merken; visual cliff) - psychologische Realität entscheidend, nicht physikalische! (≠ Behaviourismus!) - Person in einem Kräftefeld - Richtung des Verhaltens - 1. „toward“ - 2. „away from“ - Motivationale Kraft: „Tension“ innerhalb eines Feldes Regionen „Life Space“ Motivationale Kräfte 4 Arten von Verhalten - Anzahl Regionen & Richtung des Verhaltens „toward“ „away from“ 1 Region Konsumverhalten (A, A) Fluchtverhalten (A, ‐A) 2 Regionen Instrumentelles Verhalten (A, B) Vermeidungsverhalten (B, ‐A) Valenz als zentrales Konstrukt - Valenz eines Ziels = Funktion von (Spannung innerhalb der Person, Eigenschaften des Ziels) - Va(G) = f(t, G) - Bsp.: Hungrig vs. nicht‐hungrig; Knäckebrot vs. Sandwich - aber: Valenz ≠ Kra - Kraft (force) = Funktion von (Valenz eines Ziels / Entfernung zum Ziel) - Force = f (Va(G)) / e) = (t, G) / e - in allgemeiner Sprache: Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach - Je näher Ziel ist, desto mehr Kraft; Je weiter entfernt, desto weniger Kraft Beispiele für empirische Überprüfung - Annäherungs‐ und Vermeidungskonflikte (z.B. Arkoff, 1957) - Bsp.: Prüfungsangst & Hoffnung auf Bestehen der Klausur - Equilibrium kann in einem „frozen state“ bestehen - Gedächtnis‐Effekte (z.B. Zeigarnik, 1927) - Bsp.: Unerledigte Aufgaben/unerreichte Ziele haben Gedächtnisvorteil gegenüber erledigten Aufgaben Zusammenfassung - Spannung motiviert Verhalten & wird aus Bedürfnissen gespeist 15 - Das Kräftefeld strebt nach einem Equilibrium - Psychologische Umwelt wichtiger als physikalische Umwelt - Spannung erzeugt Valenz um Objekte - Valenz erzeugt zusammen mit psychologischer Entfernung Anziehung oder Abstoßung (Kräfte) - Die Kräfte bewegen die Person durch den Life Space - Zielerreichung führt zu Spannungsabbau, Abbau von Valenz & damit Abbau der Kräfte Kritische Würdigung - Sehr generelle Theorie - Grundannahmen schwer zu testen - Empirische Belege im Einzelnen immer alternativ zu erklären - Größter Beitrag: „Menschliche“ Psychologie, aber immer noch mechanistisches Weltbild - Komplexe Situationen - Hohe Anwendbarkeit (Feld‐Theorie & Management) - Hoher heuristischer Wert für gesamte Psychologie 5. Vorlesung: Theorien der Motivation III Themen - Erwartung x Wert – Modelle - Theorie der Leistungsmotivation - Rotters soziale Lerntheorie Mechanistisches vs. Gott‐gleiches Menschenbild - Mechanistisch - Freud, Hull, Lewin - Verhaltensforschung - Sozio‐biologische Ansätze - Gott‐gleich: Menschen sind - voll informiert über alle Verhaltensoptionen - komplett rational - in der Lage, die optimale Affektbilanz zu berechnen Kritik am mechanistischen Prinzip - lässt sich experimentell v.a. an Tieren untersuchen & hat wenig Bezug zum Menschen - Erwartungen & Anreize spielen für Menschen große Rolle, finden sich aber in mechanistischen Theorien kaum (Tolmans Kritik an Hull) - Konstrukt des Triebes lässt sich empirisch & physiologisch nicht nachweisen - Wechsel von „Was löst Verhalten aus“ zu „Was bestimmt die Richtung des Verhaltens“ (unter der Annahme, dass Organismen sich immer „verhalten“) Erwartungs x Wert ‐ Theorien - Konzeptueller Wechsel - Organismen müssen motiviert werden, um Verhalten zu zeigen („drive“) vs. - Organismen verhalten sich immer; die Richtung des Verhaltens ist interessant (SEU) - Richtung des Verhalten wird bestimmt durch - Erwartung, dass ein Ziel erreicht wird - der Wert dieses Ziels - instrumentelles Verhalten, das subjektiv zum höchsten Nutzen (SEU = „subjective expected utility“) führt, wird gezeigt Hauptanwendung: Leistung - Murray postulierte einen „need for achievement“ (1938; gemessen über TAT) - Erfolg & Versagen lassen sich experimentell sehr leicht manipulieren - Leistung hat eine zentrale Rolle in der westlichen Werte‐Hierarchie Theorie der Leistungsmotivation - Atkinson (1957): - Tendenz für Leistungsverhalten = Leistungsmotiv x WS für Erfolg x Anreiz - T = M x P x I - T = Tendenz, ein Verhalten für ein Leistungsziel zu zeigen - M = Leistungsmotiv (Personenfaktor) 16 - P = Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein (Erfolgserwartung) Situationsfaktoren - I = subjektiver Wert des Erfolges Leistungsmotiv (M) - v.a. gemessen durch TAT - eine stabile Disposition, nach Erfolg zu streben - „a capacity to experience pride in accomplishment“ (Atkinson, 1964) Erfolgserwartung (P) - Lerntheoretisch: relative Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Verhalten zu Erfolg geführt hat - mit Menschen… kognitive Manipulationen: - „Sie müssen besser sein als 20 andere“ vs. „Sie müssen besser sein als 1 anderer“ - daraus folgt: fast alle Facetten einer Situation können die Erfolgserwartung beeinflussen Incentive / Wert / Anreiz (I) - Währung in der gezahlt wird: affektiv: Stolz („pride in accomplishment“) - Anreiz & WS sind inverslinear zu einander bezogen: - I = 1 – P - schwere Aufgaben führen zu mehr Stolz als leichte Aufgaben - Je größer die Erfolgserwartung („einfach“), umso geringer der Anreiz Hoffnung auf Erfolg & Furcht vor Misserfolg - Hope for Success: - TS = MS x PS x IS - Fear of Failure: - TAF = MAF x PF x (‐IF) - TAF = Tendenz, Verhalten zu meiden - MAF = Misserfolgsmotiv (Motiv, Versagen zu vermeiden) - PF = Wahrscheinlichkeit, zu versagen - ‐IF = negativer Anreiz, zu versagen („Scham“) - Beziehung der Determinanten - Versagen bei leichten Aufgaben führt zu mehr Scham als bei schweren Aufgaben: If = ‐ (1 ‐ Pf) - weiter: PS + Pf = 1 Pf = 1‐ PS - weiter: IS = 1 – PS IS = Pf - Anreiz Erfolg zu haben entspricht WS zu versagen (WS zu versagen hoch Wert des Anreizes Erfolg zu haben hoch, da man mehr Stolz zeigt, wenn die Aufgabe schwierig ist) Resultierende Leistungsmotivation - Tendenz, eine leistungsbezogene Aktivität aufzusuchen bzw. zu meiden - TA = TS – TAF = (MS x PS x IS) – (MAF x PF x (‐IF)) - da IS = 1 ‐ PS , PF = 1 ‐ PS und ‐IF = PS folgt: - TA = (MS ‐ MAF) x (PS x (1 ‐ PS)) - 2 Freiheitsgrade auf Personenseite (MS & MAF) & nur 1 Freiheitsgrad auf Situationsseite! Resultierende Motivation 0,25 Ms > Maf Ms = Maf 0 Ms < Maf -0,25 Lösungswahrscheinlichkeit 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 - MS > MAF bevorzugen mittlere WS - MS < MAF bevorzugen Extreme (leicht oder schwer) - Verhalten ist abhängig von MS, MAF & Schwierigkeit der Aufgabe bzw. WS für Aufgabenerfolg (PS) Problem - fast alle Menschen suchen Leistungssituation auf 17 - Lösung: additive Konstante über extrinsische Motivation, kulturelle Normen etc. - überdeterminiertes Verhalten - Post hoc kann (fast) alles erklärt werden, aber trotzdem gute Vorhersagen Messung - MS gemessen über TAT - MAF gemessen über TAQ („Test‐Anxiety Questionnaire“) - Lösung: z‐Standardisierung & Differenzbildung Klassische Befunde Moulton (1965): Anspruchsniveau („Level of Aspiration“) - 3 Aufgabenschwierigkeiten (Anagramme lösen); VP beginnen mit .50 - danach Auswahl: entweder .25 (schwer) oder .75 (leicht)‐ Aufgabe Lösungswahrscheinlichkeit objektiv .25 .50 .75 Nach Erfolg .35 .85 Nach Misserfolg .15 .65 - Vorhersagen - Für Demo - MS hoch = 2, MS niedrig = 1 - MAF hoch = 2, MAF niedrig = 1 - MS > MAF nach Erfolg (symmetrisch für Misserfolg): - schwer: (2 x .35 x .65) – (1 x .65 x .35) = 0.2275 - leicht: (2 x .85 x .15) – (1 x .15 x .85) = 0.1275 - anders gesagt: „schwere“ Aufgabe liegt nun subjektiv näher an der .50 Schwelle AUFSUCHEN! - MAF > MAS nach Erfolg (symmetrisch für Misserfolg): - schwer: (1 x .35 x .65) – (2 x .65 x .35) = ‐ 0.2275 - leicht: (1 x .85 x .15) – (2 x .15 x .85) = ‐ 0.1275 - anders gesagt: „schwere“ Aufgabe liegt nun subjektiv näher an der .50 Schwelle VERMEIDEN! - Ergebnisse - MS > MAF („typisch“) - nach Erfolg schwere Aufgabe - nach Misserfolg leichte Aufgabe - MAF > MS („atypisch“) - nach Erfolg leichte Aufgabe - nach Misserfolg schwere Aufgabe Feather (1961): Ausdauer (Persistenz) - Nicht‐lösbare Puzzle‐Aufgabe immer Versagen als Rückmeldung - 2 Normative Schwierigkeiten - „In Ihrem Alter lösen 5% diese Aufgabe“ vs. „In Ihrem Alter lösen 70% diese Aufgabe“ - Messung von MS & MAF - Vorhersagen: Trial PS MS > MAF MAF > MS PS = .70 1 .70 (2 x .7 x .3)–(1 x .3 x .7) + .50 = .71 (1 x .7 x .3)–(2 x .3 x .7) + .50 = .29 PS = .70 2 .60 (2 x .6 x .4)–(1 x .4 x .6) + .50 = .74 (1 x .6 x .4)–(2 x .4 x .6) + .50 = .26 PS = .70 3 .50 (2 x .5 x .5)–(1 x .5 x .5) + .50 = .75 (1 x .5 x .5)–(2 x .5 x .5) + .50 = .25 PS = .05 1 .05 (2 x .05 x .95)–(1 x .95 x .05) + .50 = .55 (2 x .05 x .95)–(1 x .95 x .05) + .50 = .45 PS = .05 2 .04 (2 x .04 x .96)–(1 x .96 x .04) + .50 = .54 (2 x .04 x .96)–(1 x .96 x .04) + .50 = .46 PS = .05 3 .03 (2 x .03 x .97)–(1 x .97 x .03) + .50 = .53 (2 x .03 x .97)–(1 x .97 x .03) + .50 = .47 - Ergebnisse: 18 Leichte Aufgabe (PS = .70) - MS > MAF arbeiten länger (Wert steigt von Trial 1 nach Trial 3) - MAF > MS arbeiten weniger lang (Wert sinkt von Trial 1 nach Trial 3) - Schwere Aufgabe (PS = .05) - MS > MAF arbeiten weniger lang - MAF > MS arbeiten länger - Klare Interaktion in der Aufgaben‐Persistenz - Maximierung der Effektbilanz hedonistisches Prinzip Atkinson & Litwin (1960): Aufgabenwahl - VP sollten Ring über Pflock werfen - Konnten in unterschiedlichen Entfernungen vom Pflock stehen (nach jedem Wurf konnten sie Position ändern) - Entfernung vom Pflock als Verhaltensindikator der Aufgabenwahl & der Aufgabenschwierigkeit - TAT‐ & TAQ‐Werte der VP unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlicher Leistungsmotivation - Linien (von oben nach unten bei peak): - 1) MS hoch, MAF niedrig - 2) MS hoch, MAF hoch - 3) MS niedrig, MAF niedrig - 4) MS niedrig, MAF hoch - Ergebnisse: - Aufgaben mittlerer Schwierigkeit am stärksten von VP der Gruppe 1 & am wenigsten von VP der Gruppe 4 - Folgerungen: - Personen mit hohem MS bevorzugen Aufgaben mittlerer Schwierigkeit - Personen mit niedrigem MS bevorzugen Aufgaben hoher oder niedriger Schwierigkeit definitiv nicht - Personen mit hohem MS zeigen höchstwahrscheinlich eine größere Bevorzugung Aufgaben mittlerer Schwierigkeit als Personen mit niedrigem MS - Interaktion: guter Beleg für Theorie - Kritische Würdigung - Wechsel zu menschlicher Motivation, weg von der Rattenforschung - basiert auf Murrays TAT und der Idee des „Bedürfnisses“ - mathematisch ausformuliert mit klaren Vorhersagen - Probleme: - Menschen hoch in MAF vermeiden Leistungsaufgaben nicht völlig - hohe Konfundierung mit Informationsgehalt der Aufgage ( Attribution auf eigene Fähigkeiten vs. Attribution auf Aufgaben‐Schwierigkeit) Rotters soziale Lerntheorie - Verhalten wird determiniert durch: - behavior potential = f(expectancy of reward and reward value of the goal) - Klassische Erwartung x Wert ‐ Theorie - 4 zentrale Konzepte - Behavior Potential = WS, dass ein best. Verhalten auftritt (als Funktion der antizipierten Verstärkung) - Expectancy = subjektive WS, dass ein Verhalten zu einer best. Verstärkung führt (wird gelernt) 19 Reinforcement Value = relativer Wert einer Verstärkung (hängt von persönlichen Bedürfnissen ab) Psychological Situation = Erwartung & Wert variieren in Abhängigkeit von der Situation (basierend auf persönlichen Lernerfahrungen) Locus of Control - Wird Verstärkung durch eigene Handlungen erreicht oder externe Mechanismen? - Interne Kontrollüberzeugung: Fähigkeit, Anstrengung - Externe Kontrollüberzeugung: Aufgabenschwierigkeit, Glück Übertrag auf Attribution - Fritz Heider: - Menschen als Wissenschaftler - Versuch, Kausal‐Zusammenhänge in der Umwelt zu erkennen - Menschen schreiben Ereignissen Ursachen zu - Attributionsschema: Internal External Bestimmt Erwartungsänderung Stabil Fähigkeit Aufgabenschwierigkeit Variabel Anstrengung Zufall Bestimmt Emotion Dimensionen der Attribution - Personenabhängigkeit: internal vs. external - Stabilität: stabil vs. variabel - Kontrollierbarkeit: kontrollierbar vs. unkontrollierbar - Globalität: global vs. spezifisch Zusammenfassung - Erwartungs x Wert – Theorien basieren auch auf einem hedonistischen Prinzip - Im Vergleich zu mechanistischen Ansätzen: hohes Gewicht auf interindividuellen Unterschiede - Starker Fokus auf menschlicher Motivation (Hull et al.: Rattenpsychologie) - 6. Vorlesung: Leistung und Macht Themen: ‐ Machtmotivation nach McClelland ‐ Theoretische Annahmen ‐ Empirische Befunde Wiederholung Leistungsmotiv ‐ Leistungsmotiv ‐ Hoffnung auf Erfolg ‐ Furcht vor Misserfolg ‐ Antizipierte Affektbilanz: ‐ Stolz bei Erfolg ‐ Scham bei Versagen ‐ Motiv: „a capacity to experience pride in accomplishment“ (Atkinson) Machtmotiv ‐ Hoffnung auf Kontrolle anderer ‐ Furcht vor Kontrollverlust ‐ Antizipierte Affektbilanz: ‐ sich stark fühlen ‐ sich schwach fühlen ‐ angenommenes Maß: TAT & MMG ‐ „ein stabiles Bedürfnis nach Einfluss & Überlegenheit, nach Stärke, Visibilität & Dominanz“ (McClelland, 1985) Phylogenetische Entwicklung des Machtmotives ‐ alle Tierarten mit ‐ sozialer Struktur ‐ Identifikation von Individuen möglich 20 ‐ zeigen ‐ Dominanz ‐ Submission ‐ grundlegende Motivausstattung Rosvold et al. (1954): Machtmotiv im Mandelkern? ‐ Getestet an Schimpansen ‐ Bestimmte Machtstrukturen waren vorherrschend (eher Anführer, eher unterwürfig, etc.) ‐ Entfernung der Mandelkerne bei einigen Affen ‐ einige wurden hyperaggressiv (vorher unterwürfig), einige verloren soziale Dominanz (vorher Anführer) Ziel der Machtmotivation ‐ Kontrolle des Erlebens & Verhaltens anderer Personen gegen den Widerstand dieser Personen! ‐ Andere Personen zu Verhalten bringen, das sie ohne den Machteinfluss nicht gezeigt hätten Machtmittel & Beispiele ‐ Belohnungsmacht (z.B. Eltern – Kinder) ‐ Zwangs‐ oder Bestrafungsmacht (z.B. Wärter – Insassen) ‐ Legitimierte Macht (z.B. Ordnungsbeamte – Falschparker) ‐ Vorbildmacht (z.B. Gandhi – Britisches Königreich) ‐ Expertenmacht (z.B. Mediziner – Klienten) ‐ Informationsmacht (z.B. Meister – Geselle) Verhaltenskorrelate der Macht ‐ Winter: Hoch Macht‐Motivierte ‐ haben mehr Ämter inne ‐ bevorzugen Sportarten mit Wettkampfcharakter ‐ haben eher unscheinbare Freunde ‐ üben Einfluss in Diskussionen aus ‐ werden als weniger hilfreich erlebt ‐ besitzen mehr Prestigegüter (z.B. schnelle Autos) ‐ konsumieren mehr Alkohol und andere Drogen ‐ haben früher und mehr Geschlechtsverkehr (Achtung: Selbstbericht!) ‐ achten mehr auf die Attraktivität ihrer Sozialpartner ‐ McClelland: Machtmotivierte tendieren dazu ‐ Aufmerksamkeit zu suchen ‐ Schwächere an sich zu binden ‐ Einflussreiche Positionen zu besetzen ‐ Informationen zu kontrollieren ‐ Kontrolle anderer ‐ Alkohol‐ und Drogen exzessiv zu konsumieren ‐ Ersatzbefriedigungen zu suchen (Prestige‐Güter) ‐ Kompensation von erlebtem Kontroll‐Verlust Biologische Grundlage: Testosteron ‐ basierend auf Übersicht von Mazur & Booth: ‐ systematische interindividuelle Variationen von T (Booth & Dabbs) ‐ T korreliert mit Aggression & dominantem Verhalten ‐ T & Partnerschaft: hoch in T hohe Scheidungsraten, mehr Fremdgehen, häufiger unverheiratet Deskriptives Modell des Machthandelns ‐ 1) Machtmotivation: Angeregte Bedürfniszustände nur zu befriedigen durch entsprechendes Verhalten anderer ‐ 2) Widerstand von Seiten der Zielperson ‐ 3) Machtquellen: Persönliche (Intelligenz, körperliche Kraft, Charisma, Schönheit, etc.) & Institutionelle (Wirtschaftliche, Rechtliche, Waffen, Legitimität der Rolle) 21 ‐ 4) Hemmungen: Furcht vor Gegenmacht, Werte, Kosten, schwaches Selbstvertrauen, institutionelle Normen, Kultur ‐ 5) Einflussmittel: Überredungen, Drohungen, Versprechungen, Belohnungen, Gewalt, Zwang, Umweltänderung ‐ 6) Reaktion der Zielperson: Nachgeben, gefügig sein, innerliche Zustimmung, Verlust der Selbstachtung, Respekt vor Machthaber (auch beeinflusst durch Motive & Machtquellen der Zielperson) ‐ 7) Folgen für den Machtausübenden: Änderung im Bedürfniszustand, sich mächtig fühlen, neues Bild von Zielperson, Änderung von Werten Leistung und Macht: McClelland & Watson (1973) ‐ Motivmessung über TAT („Big 3“) ‐ n Achievement ‐ n Power ‐ s Power (Soziale Macht) ‐ p Power (Persönliche Macht) ‐ n Affiliation ‐ Aufgaben: ‐ Leistungsaufgaben: arithmetische Aufgaben, Puzzle‐Probleme ‐ AV: Welches Schwierigkeitsniveau wird gewählt? ‐ Risikoaufgaben: Roulette privat, Roulette öffentlich ‐ AV: Wo werden die Chips gesetzt? ‐ Vorhersagen: ‐ ad Leistung Atkinson‐Modell ‐ ad Power „stand out“ Extreme Risiken eingehen („big winners/losers“) ‐ Ergebnisse: ‐ Motive sind unkorreliert (Leistung, Macht, Bindung) ‐ Machtmotiv: gehen hohes Risiko ein ‐ Leistungsmotiv: gehen mittleres bis hohes Risiko ein ‐ Bindungsmotiv: gehen nur niedriges Risiko ein Zusammenfassung ‐ Macht als zentrales Konstrukt in Gesellschaften ‐ Machtmotiv lässt sich phylogenetisch belegen ‐ Deskriptives Modell ‐ Testosteron als unmittelbare biologische Operationalisierung ‐ Vorhersagen aus hohem Machtmotiv in vielen sozialen Situationen 7. Vorlesung: Verletzen & Helfen Truismus 1: Menschen haben hohes Potenzial für destruktives, aggressives, anti‐ & unsoziales Verhalten Truismus 2: Menschen haben hohes Potenzial für hilfsbereites, prosoziales & altruistisches Verhalten Problemstellung - Was ist Aggression & prosoziales Verhalten bzw. Altruismus? - Wie können wir motivationspsychologisch diese Verhaltensweisen erklären? - Bsp. Freud: Eros vs. Thanatos Definition Aggression - Verhalten mit der Absicht, andere zu schädigen. - a) Verhalten - b) Absicht - c) Schaden - passt aber nicht zu allen Beispielen - Menschen erkennen Aggression, wenn sie welche sehen (aber: zirkuläre Definition!) Arten von aggressivem Verhalten 22 - Feindselige Aggression - „hostile“ oder „emotional“ Aggression - emotionsbasiert - schädigen & verletzen - Instrumentelle Aggression - Aggression als Mittel zum Zweck - Schaden kein Selbstzweck - Mittel der Aggression: Direkt („Faustschlag“) oder indirekt („böse Gerüchte“) Warum sind Menschen aggressiv? - Warum? - um zu verletzen - um sich oder die Gruppe zu schützen - um sozialen Status zu erhalten / zu gewinnen - um materielle / soziale Gewinne zu erlangen - um mit Emotionen umzugehen - Motivationale Ursachen: - Lernen / Soziales Lernen - Phylogenetisches Lernen / Evolutionäre Notwendigkeit - Todestrieb - Positive Affektbilanz - Erwartung x Wert ‐ Modelle Theorien der Aggression - Freuds Todestrieb - Dollard et al.s Frustrations‐Aggressions‐Hypothese - Berkowitz‘ Reformulierte FA‐Hypothese - Andersons General Affective Aggression Model Klassiker: Thanatos - Freud postulierte „Eros“ als die fundamentale Motivation des Menschen - nach den Erlebnissen im 1. WK postulierte er einen Todes‐ bzw. Selbstzerstörungstrieb „Thanatos“ - Ähnlich zu Lorenz: Aggressives Verhalten als Instinkt - Katharsis‐Idee: Triebabfuhr führt zu weniger Aggression („Dampf ablassen“) Klassiker: Frustrations‐Aggressions‐Hypothese - Frustration and Aggression (1939) by Dollard, Miller, Doob, Mowrer, & Sears - “…the occurrence of aggression always presupposes the existence of frustration… frustration always leads to some form of aggression.” - “Frustration produces instigations to a number of different types of responses, one of which is some form of aggression.” Reformulated Theory von Berkowitz (1969) - Schmerz/Frustration/jede unangenehme Erfahrung negative Emotion Aggression Moderne Ansätze - moderne Theorien nehmen keine singulären Faktoren als Ursache von Aggression an - multi‐faktoriell determiniertes Phänomen - Bsp.: General Affective Aggression Model (Anderson) Anderson: General Affective Aggression Model 23 Sozialer Input - Frustration: z.B. Schulversagen, Fettleibigkeit, sozialer Ausschluss - Provokation: z.B. Minoritäten, Stereotypisierung - Gewalt in den Medien: ca. 50 % der TV‐Programme beinhalten Gewalt; in ca. 70 % hat Gewalt keine negativen Konsequenzen, wird nicht bedauert oder negativ bewertet - Erregung: z.B. sexuelle Erregung, Hitze Person / Persönlichkeit - Persönlichkeitstyp: z.B. Narzissmus (s. Adorno), feindseliges Attributionsschema - Geschlecht: Männer aggressiver als Frauen (s. Macht) - Alter: höhere Aggression während Adoleszenz, weniger Aggression im höhern Alter - Hormonelle Einflüsse: z.B. Testosteron/Adrenalin steigert aggressives Verhalten; Oxytocin mindert aggressives Verhalten („Love Hormon“) Situationen - Hohe Temperaturen - Alkohol - Enge / „Crowding“ - Normen: z.B. Culture of Honor; Gesetzliche Rechtfertigung von Aggression - Cues in der Situation: z.B. Waffen, aggressives Verhalten anderer Aggression verhindern - „Schuld & Sühne“ bzw. „Verbrechen & Strafe“ - hilft nur, wenn schnell & verlässlich (Bower & Hildegard) - Schwere der Strafe hilft nicht - Katharsis - hilft nicht, sondern verstärkt Aggressionen (s. theoretische Überlegungen) - aber: Katharsis ist wieder im kommen (z.B. Verona & Sullivan, 2008) - Nicht‐aggressives Verhalten vorgeben - Martin Luther King (z.B. Baron), Gandhi - Attributionsmuster ändern - Empathie (z.B. Baron, 1976 Honking‐Studien) - Entschuldigungen für Provokationen Prosoziales Verhalten - Verhalten mit der Absicht, anderen zu helfen - Verhalten, das auf das Wohlwollen anderer abzielt - Positives & konstruktives Verhalten Altruismus - Verhalten mit der alleinigen Absicht, anderen zu helfen - Prosoziales Verhalten ohne jegliches Eigeninteressen oder sogar entgegen eigenen Interessen Warum zeigen Menschen prosoziales Verhalten? - Lernprozesse: z.B. Materielle Gewinne, Reziprozität - Evolutionäres Lernen: z.B. eigene Kinder, Mitglieder der eigenen Gruppe - Sozialer Status: z.B. Stifter sind hoch angesehen; Soziale Stellung steigt mit prosozialem Verhalten - Stimmungen & Emotionen managen: z.B. schlechte Stimmung verhindern, negative Emotionen verarbeiten Theorien des prosozialen Verhaltens - Lern‐Theorie - Belohnung & Bestrafung - Beobachtungslernen 24 - Evolutionsbiologie - Hilfe‐Verhalten führt zu mehr Überleben aller - Inklusive genetische Fitness - Soziale Normen - Norm der sozialen Verantwortung („Hilf denen, die von Dir abhängen“) - Norm der Reziprozität („Hilf dem, der Dir hilft“) - Soziale Gerechtigkeit („Gib denen, die weniger haben“) - Erfüllung von Normen führt zu positivem Affekt Die Rolle von Emotionen - Warum helfen wir hier? - Weil wir uns schlecht fühlen! - Leid in anderen löst Leid in uns selbst aus (Weiss et al., 1973) - Prosoziales Verhalten reduziert dieses Leid - „negative‐state relief“ – Hypothese „negative‐state relief“ - Cialdini et al. (1973) - Studie findet angeblich im Labor eines Doktoranden statt - VP sollen sich setzen, der Stuhl ist jedoch präpariert, sodass 3 Schachteln mit Lochkarten herunterfallen („Tom‘s Master Thesis!“) - VP nimmt den Stuhl - VL nimmt den Stuhl - Teilnehmer bekommen - Geld - Lob - nichts - AV: - Wie viele helfen danach einem anderen VL (andere Teilnehmer anrufen)? - Wie viele Personen werden angerufen? - Ergebnisse: siehe Folien!!! Wahrer Altruismus? - Cialdini - Menschen helfen, um sich selbst zu helfen - „Help to reduce own distress“ - Batson - Menschen helfen auch, wenn es ihnen selbst nichts nützt - kein Lob - kein Ansehen - kein „negative‐state relief“ - Mechanismus: Empathie - „Help to reduce other‘s distress“ Empathie als Ursache 25 Klassische Studie - Batson et al. (1981) - „Elaine“ bekommt elektrische Schocks (10 Stück) - Teilnehmer müssen - nur die ersten beiden Schocks mit ansehen („easy escape“) - alle Schocks mit ansehen („difficult escape“) - Teilnehmer sind Elaine - sehr ähnlich - sehr unähnlich - (basiert auf einem Fragebogen, den die Teilnehmer 4 Wochen vorher ausgefüllt haben) - AV: Wie viele tauschen den Platz mit Elaine nach den ersten beiden Schocks? - Ergebnisse: - Wenn ähnlich: sehr viele tauschen Platz, nehmen mehr Schocks in Kauf (5‐7) - Wenn unähnlich: bei easy escape tauschen nur sehr wenige Platz & akzeptieren nur sehr wenige Schocks (1), bei difficult escape tauscht über die Hälfte, akzeptieren ca. 4 Schocks Hilfeleistung im Notfall: Notwendige Schritte - Vorkommnis bemerken („Notice the event“) - Vorkommnis als Notfall interpretieren (“Interpret the event as an emergency”) - Verantwortung annehmen (“Assume responsibility”) - Angemessene Hilfeleistung kennen (“Know appropriate form of assistance”) - Entscheidung treffen (“Implement decision”) - Einschreiten und Hilfe anbieten (“Intervene and offer assistance“) Wie kann man Hilfeleistung fördern? - Klarheit schaffen: Ist Hilfe in dieser Situation nötig? - Hilfe‐Normen lehren: Normen und Werte beeinflussen Verhalten - Hilfe‐Normen aktivieren: Modelle, positive Beispiele, etc. - Verantwortung fokussieren: DU kannst etwas tun! (und egal was, es hilft!) - Identifikation fördern: Ähnlichkeit mit Opfern steigert Empathie mehr Hilfeleistung 8. Vorlesung: Überblick Emotionen Abgrenzung – Emotionen, Affekte, Stimmungen & Gefühle ‐ Affekte ‐ kurze & sehr intensive Erlebniszustände ‐ hohe Verhaltensnähe ‐ Affekthandlung ‐ Emotionen ‐ Längere, aber weniger intensive Erlebniszustände ‐ Verhaltensnähe ‐ Zuneigung Umarmen / Küssen ‐ Ablehnung Wegdrücken / Zuschlagen ‐ Stimmungen ‐ lang anhaltender Hintergrundszustand ‐ nicht immer bewusst erlebt ‐ wenig verhaltensnah, aber immer noch verhaltensvorbereitend ‐ Gefühl ‐ Subjektiver Erlebniszustand aller 3 Konstrukte ‐ Bewusst verfügbar ‐ Man erlebt die Konstrukte (Affekte, Emotionen, Stimmungen) als Gefühl ‐ Beschreibende Funktion, im Experiment zu schwammig, um sie zu testen Funktionen von Emotion ‐ Kommunikation: Was fühlt der Organismus (wichtig für andere)? ‐ Evaluation: Ist etwas gut oder schlecht? ‐ Vorbereitung: Welche Handlung soll folgen? Adaptiv? ‐ Affekthandlungen 26 ‐ Emotionen als Störung des homöostatischen Equilibriums? ‐ „Emotionslos“ an die Sache herangehen = gut? ‐ Emotionen haben hohen adaptiven Wert! Funktion von Emotionen ‐ Emotionen stellen genetisch verankerte Stellungnahmen zur Situation eines Lebewesens in einer gegebenen Umwelt dar (Schneider): ‐ Emotionen ermöglichen bedürfnis‐ & situationsgerechte Auswahl von Verhaltensweisen ‐ Emotionen regulieren Intensität & Ausdauer der verschiedenen Verhaltensweisen ‐ Emotionen bewirken das Lernen solcher Verhaltensweisen ‐ Merke: Bezug zu Motivation & antizipierter Affektbilanz! ‐ Emotionen als Evaluation (Mag ich: Gemüse? Kino? Bücher? Oder nicht?) Lazarus: 3 Komponenten von Emotionen ‐ Experientieller Aspekt (Gefühle, Stimmungen, Kognitionen) ‐ Behavioraler Aspekt (Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Verhalten) ‐ Physiologischer Aspekt (Kardiovaskuläre, Endokrinologische & Neuronale Veränderungen) Definitorisches zu Emotionen ‐ aktuelle Zustände von Personen (im Gegensatz zu Persönlichkeitsmerkmalen & Dispositionen: Angst vs. Ängstlichkeit) ‐ stimulus‐bezogen (Angst vor etwas haben), wobei der Stimulus nicht real existieren muss (s. Lewin & die psychologische Realität) ‐ führen zu einem bestimmten Erleben, zu bestimmen physiologischen Veränderungen & zu bestimmten Verhaltensweisen ‐ eher Arbeitsdefinition als wissenschaftlich exakte Definition (ermöglicht konzeptuelle Zusammenarbeit Handlungsvorbereitung (nach Plutchik, 1984): Einteilung von Emotionen ‐ Warum? ‐ lässt theoretische Rückschlüsse zu ‐ Genese & Klassifizierung ‐ Verhaltensvorhersage ‐ Wie? ‐ dimensionale Modelle ‐ kategoriale Modelle Dimensional: Wundt ‐ Emotionen haben 3 Dimensionen: ‐ Unlust/Lust ‐ Erregung/Beruhigung ‐ Lösung/Spannung ‐ Problem: reine Introspektion, Selbstbericht 27 Kategorial: Ekman & Friesen ‐ Annahme von Basisemotionen, aus denen sich alle anderen Emotionen zusammen setzen ‐ Problem der Sprachlichkeit ‐ „Ich freue mich“ bedeutet je nach Person, Situation & Kultur hoch unterschiedliche Dinge ‐ Lösung: Emotionsausdruck Theorien der Emotion ‐ Wie entstehen Emotionen? ‐ Psycho‐Physiologische Ansätze ‐ James & Lange ‐ Cannon & Bard ‐ Kognitivistische Ansätze ‐ Schachter & Singer ‐ Valins ‐ Appraisal‐Ansätze & Attributionstheorien ‐ Lazarus (primary & secondary appraisal) ‐ Ortony, Clore & Collins ‐ Weiner 9. Vorlesung: Frühe Emotionstheorie Übersicht - Behavioristische Ansätze - Watson & der kleine Albert - Physiologische Ansätze - James & Langes Theorie - Kritik von Cannon & Bard - mögliche Lösung - kognitivistische Ansätze nach Schachter & Singer (1962) Behaviorismus - Nach Watson (1913; „Psychology as the behaviourist views it.”) - Bewusstsein als Gegenstand der wissenschaftlichen Psychologie - Methode der Introspektion wird abgelehnt - Bestreben nach größere Genauigkeit & Objektivität der Messungen in der Psychologie - Reiz (US) – Reaktionsverknüpfungen (UR) als Grundlage des Verhaltens Emotionen im Behaviorismus - „Gefühle“ als erlebte Emotionen spielen keine Rolle! - Intersubjektiv beobachtbares Reaktionsmuster, das durch bestimmte Umweltgegebenheiten verlässlich ausgelöst wird - chaotischer Zustand des Organismus, der nur wenige Anpassungen an die Objekte der Umgebung erlaubt - Fokus auf Angst, Trauer, Furcht (negative Emotionen), weil schwer zu begründen warum positive Emotionen, die den negativen Zustand stören, geändert werden sollten Emotionstheorie von Watson - 3 angeborene „Reaktionsmuster“ - Furcht - US (z.B. lautes Geräusch) - UR (z.B. Schreien, Urinieren) - Wut - US (z.B. körperliche Einschränkungen) - UR (z.B. Rotwerden, Versteifen des Körpers) 28 - Liebe - US (z.B. Stimulation der erogenen Zonen) - UR (z.B. Glucksen, zustimmende Geräusche) Konditionierte Emotionale Reaktion - 2 Fragen: - Wie kommt es zur Vielfalt der emotionalen Reaktionen? - Wie kommt es dazu, dass so viele Stimuli so viele Emotionen auslösen? - Konditionierte emotionale Reaktion - Freie Kombination der angeborenen Reaktionsmuster führt zur Vielfalt der Emotionen - US wird durch andere Reize (CS) ersetzt: klassisches Konditionieren Klassiker: Der kleine Albert - Watson & Rayner (1920) - der 9 Monate alte Albert wird mit verschiedenen neutralen Objekten konfrontiert (weiße Ratte, Kaninchen, Baumwolle) keine Anzeichen von Furcht - aber: sehr lautes Geräusch (US: Hammerschlag auf Eisenstange) führt zu Furchtreaktion (UR: weinen) - wiederholte Paarung von weißer Ratte (CS) mit Hammerschlag (US) - Darbietung von Ratte alleine löst Furcht aus - Generalisierung auf andere weiße Stimuli mit Fell Kritik an behavioristischen Emotionstheorien - sehr verarmtes Konzept, bildet nicht die Reichhaltigkeit der Emotionen ab - Konditionieren lässt sich v.a. für Furcht zeigen (Liebe & Wut wurden nicht untersucht) - „chaotische“ Reaktionsmuster lassen die Frage offen, ob dies überhaupt Emotionen sind - aber: Konzepte des „Lernens“ von Furchtreaktionen haben hohen Nutzen in Psychotherapie (Verhaltenstherapie) Theorie von William James (1884, 1894) - Zentrale Annahme: Körperliche Veränderungen führen zu emotionalem Erleben - „ich bin traurig, weil ich weine“ - „ich habe Angst, weil ich weglaufe“ - 3 Annahmen - 1) bloße Wahrnehmung einer erregenden Tatsache ist hinreichende Bedingung für Auftreten körperlicher Veränderungen - 2) körperliche Veränderungen sind emotionsspezifisch - 3) bewusstes Erleben körperlicher Veränderungen ist die Emotion - Gegenintuitiv? Passt aber zur adaptiven Funktion von Emotionen! - erst weglaufen, dann Angst vor dem Bären empfinden James‐Lange‐Theorie der Emotion - Carl Lange (1885): Physiologische Spezifikation der körperlichen Veränderung - viszerale Änderungen werden als Emotionen erlebt (d.h. Reaktionen des autonomen NS) - Bsp.: Furcht (Schwitzen, Herzfrequenz, „Bauchschmerzen“) Kritik von Walter Cannon (1927) - Prägte das „fight or flight“ – Syndrom - Beforschte das Problem der Homöostase - 1) Warum haben Querschnittsgelähmte noch Emotionen? - Trennung des ZNS vom autonomen NS - s.a. Tierstudien von Sherrington (1900) an Hunden - 2) Gleiche viszerale Muster für verschiedene Emotionen (d.h. mangelnde Spezifität) - Schwitzen vor Furcht & Schwitzen vor Wut - aber: Punkt heute nicht mehr gültig - 3) viele viszerale Effekte sind nicht bewusst zugänglich („Eingeweide sind unempfindliche Organe“) - 4) Reaktionen der Viszera sind zu langsam (gilt v.a. für hormonelle Änderungen, Blutdruck etc.) - 5) künstliche Stimulation der Viszera führt nicht zu emotionalem Erleben - Studie von Maranon (1924): Adrenalin‐Injektion führt zu „als‐ob“ Gefühlen Cannon & Bard ‐ Theorie - Erleben & physiologische Reaktionen sind simultan 29 Erleben finden zentral‐nervös statt, das autonome NS ist nur für die Intensität zuständig „Ich sehe einen Bären. Ich fürchte mich. Ich fange an zu schwitzen.“ Aber: 30% von Maranons VP berichteten „echte“ Emotionen Adaptiver Wert des Erlebens? Ist veraltet und kann vernachlässigt werden! Reichhaltigkeit der Emotionen wird nicht eingeschränkt durch Viszera etc. sondern sind so vielfältig wie die eigenen Kognitionen Zusammenführung: Kognitiv‐Physiologische Theorien - Schachter & Singer (1962): - Physiologische Erregung (Autonomes NS) muss erklärt werden - Reize in der Situation führen zur Erklärung der Erregung - daraus folgt: Emotionserleben Darauf aufbauend: - Valins, Lazarus, Weiner - zentrale Rolle der Attribution (woher kommt die Erregung?) & Situationseinschätzung („appraisal“ „fight or flight“) - 10. Vorlesung: Kognitive Emotionstheorie Übersicht - Schachter & Singer ‐ nochmal - Valins‐Effekt - Einschub: Zajoncs Kritik - Kognitive Theorien - Weiners Attributionales Modell - Modell von Ortony et al. Schachter & Singer (1962) - eine kognitiv‐physiologische Emotionstheorie - Erregung als notwendige Bedingung - kognitive Erklärung dieser Erregung Würdigung - löst Probleme der Cannon‐Bard vs. James‐Lange‐Debatte - erklärt die Vielzahl von Emotionen & kulturelle Unterschiede bezüglich Emotionen - aber: schwaches Design, schwache Daten, fehlgeschlagene Replikationsversuche (Marshal & Zimbardo, 1979) Großer Einfluss: Erregungstransfer - Studie von Valins (1966) - männliche VP bewerten 10 Photos von halbnackten Frauen - EG: VP bekommen falsches Feedback über ihre Herzfrequenz (Zunahme & Abnahme) - KG: VP hören die gleichen Töne, werden aber als technisches Hintergrundgeräusch erklärt („Bell‐ Laboratories“) - Effekt: Wechsel der Herzfrequenz höheres Attraktivitätsrating & häufigere Wahl der entsprechenden Bilder - neue Sicht: nicht Erregung per se, sondern die Wahrnehmung & Erklärung dieser Erregung! Kritik durch Zajonc (1980) - Aussage: „preferences need no inferences“ - Emotionale Reaktionen finden auch ohne das statt, was im allgemeinen als „Kognition“ bezeichnet wird - 3 Hauptpunkte: - Emotionale Reaktionen sind schneller als Kognitionen - Tiere erleben offensichtlich auch Emotionen - Kognitive Diskrimination keine Voraussetzung für evaluative Diskrimination („mere exposure“) Eine Lösung: Lazarus (1984) - schnelle 1. Bewertung auf einer gut‐schlecht Dimension („primary appraisal“) - langsamere 2. Bewertung auf anderen Dimensionen, welche höhere Kognitionen erfordern („secondary appraisal“) 30 Bsp.: Stressbewältigung Primary Appraisal: Ist eine Situation wichtig (bspw. Bedrohlich oder angenehm für das Selbstbewusstsein)? Secondary Appraisal: Welche Ressourcen stehen für die Person zur Verfügung (Konfrontation, Ausweichen, Situation ändern/akzeptieren) Bewertungstheorien = Kognitive Emotionstheorien - Art & Intensität einer Emotion bezüglich eines Ereignisses oder Objektes hängen von der Einschätzung („appraisal“) durch die Person ab (Emotion = objektbezogen) - Wünsche & Ziele; eigene Ressourcen; Erwartungen, … Modell 1: Weiners Attributionstheorie - Wiederholung: Kausal‐Dimensionen nach Weiner - internal vs. external - stabil vs. variabel - kontrollierbar vs. unkontrollierbar - Auf Grundlage dieser Dimensionen erleben Menschen unterschiedliche Emotionen - Bsp.: Klausur bestehen / nicht bestehen Prozess - Schritt 1: Erste Bewertung - Ereignis wird als positiv oder negativ bewertet („Erfolg“ vs. „Misserfolg“) - „Freude“ oder „Trauer“ - Schritt 2: Ursachensuche - Attributionen finden nur statt, wenn Ereignis negativ, unerwartet, wichtig(?) - attributionsabhängige Emotionen („Überraschung“) - Schritt 3: weitere Kausalanalyse - kontrollierbar? - Verantwortlichkeit - differenzierte Emotionen („Schuld“, „Ärger“) - Allgemein: Ablauf muss nicht bewusst oder willkürlich sein! Einordnung - Theorie gilt v.a. für den Leistungskontext - keine Theorie für alle Dimensionen - Emotionen ohne Kognitionen werden zugelassen (z.B. hormonell bedingte Depression) - Kognitionen sind kein Bestandteil der Emotion, sondern Emotionen haben klar den Gefühlsstatus - empirisch gut belegt & weit anwendbar Modell 2: Ortony, Clore & Collins (1988) - Emotionen setzen Wertüberzeugungen & Wünsche/Ziele voraus - Erwartung - Erwünschtheit - Wahrscheinlichkeit - Fokus auf sich selbst oder auf andere Beziehung Einschätzungen & Emotionen - 3 Positionen - 1) Appraisals sind notwendige bzw. hinreichende Ursachen von Emotionen; Emotionen selbst sind gefühlte Zustände (Lust‐Unlust) oder Handlungsimpulse (Affekte) - 2) Appraisals sind Bestandteil der Emotionen bspw. als Synthese von Erregung & Einschätzung (Schachter; Lazarus) - 3) Appraisals & Emotionen sind identisch; Emotionen sind bewertende Urteile & damit Kognitionen Bewertung von Appraisal‐Theorien: PRO - empirisch gut belegt - erklären den hohen Differenzierungsgrad von Emotionen - geschätzt zwischen 300 & 2000 Emotionswörter! (in Russell, 1991) - gleiche Ereignisse lösen unterschiedliche Emotionen bei unterschiedlichen Personen aus (Sieg & Niederlage für Fans: Zajoncs Preferanda) - Einschätzung ist entscheidend! (Lazarus, 1991) - 31 gleiche Emotionen entstehen durch unterschiedlichste Ereignisse - Freude über gute Note und Freude über Lottegewinn: beides unerwartet & erwünscht - gleiche Emotionen durch direktes Erleben oder reine Vorstellung / Erzählung - wichtig sind Werte/Überzeugungen & Wünsche/Ziele - wie Information erworben wird, ist egal Bewertung von Appraisal‐Theorien: CONTRA - „nicht‐kognitive“ Emotionen - Lust/Unlust basierend auf sensorischem Input (süßer Duft, bitterer Geschmack) - Phobien (Spinnen, Höhen) - irrationale Ängste, die kognitiven Überzeugungen widersprechen - aber: Unterscheidung was schätzen Phobiker wirklich als bedrohlich ein? - Subliminale Darbietungen - phobische Reize lösen physiologische Reaktionen aus (z.B. Hautleitwert) - Affektives/Evaluatives Priming Wiederum: Lösung - Primitive gut – schlecht Einschätzungen - über Individuen hinweg - schnell und robust - unabhängig von Kultur, Werten, Zielen, etc. - über Situationen hinweg stabil - Differenzierte Einschätzungen resultieren in differenzierten Emotionen - interindividuell variabel - brauchen mehr Zeit - abhängig von Kultur, Werten, Zielen, etc. - über Situationen hinweg variabel Beispiel: Evaluatives Priming - 11. Vorlesung: Dimensionale & Kategoriale Modelle Überblick - Wiederholung: Erstes dimensionales Modell von Wundt - Kategoriales Modell von Ekman & Friesen - Kritik & dimensionales Modell von Ortony & Turner - Funktion von Emotionen: - Handlungsvorbereitung - Kommunikation (Strack & Stepper facial feedback Hypothese s. mein Uniordner) Wiederholung: Wundts (1910) Modell Weiteres dimensionales Modell - Osgood, Suci & Tannenbaum (1957): 3 Dimensionen 32 - 1) Evaluation (angenehm ‐ unangenehm) - 2) Erregung (beruhigend ‐ erregend) - 3) Potenz (stark ‐ schwach) - ursprünglich nur für semantische Differentiale (Bewertung über Adjektive) in der sprachlichen Bewertung von Stimuli (z.B. Marktforschung)! Ein deutsches Modell - Traxel & Heide (1961): 2 Dimensionen - 1) angenehm – unangenehm - 2) Submission – Dominanz - allg. Kritik wie bei Wundt: - basieren auf Ähnlichkeitsratings (Wie ähnlich sind Ärger & Wut, Wut & Freude, Angst & Wut…) & MDS‐Skalierungen bzw. Clusteranalyen von VP - Introspektion bzw. Annahmen der VP können falsch sein - dadurch werden mentale Repräsentationen von Emotionen untersucht, nicht die Emotionen selbst Ableitung aus kognitiven Emotionstheorien - Jenseits einer rein gut‐schlecht Unterscheidung: Kognitionen bestimmen welche Emotion erlebt wird - z.B. Weiners Attributionsidee: - negatives Ergebnis internal erklärt Scham - negatives Ergebnis external erklärt Ärger - Kognitionen sind kultur‐spezifisch - individualistische Kulturen (Europa, USA) - kollektivistische Kulturen (China, Japan) - ergo: Emotionen sind kulturspezifisch! - z.B. beschreibt Klineberg (1938), dass sich Beschreibungen von emotionale Ausdrücke in der chinesischen Literatur sich von Beschreibungen in amerikanischer Literatur unterscheiden (starker Punkt für kognitive Emotionstheorien) - Generelle Frage: Was sind die notwendigen/hinreichenden Dimensionen um Gefühle zu beschreiben? Annahmen von Ekman & Friesen (1971) - grundlegende Emotionen sind unabhängig von Kultur - kein soziales Lernen - genetisch vererbte Muster mit adaptivem Wert (s. später) - Vorhersage: Basis‐Emotionen sollten sich kulturunabhängig zeigen lassen - Methode: Gesichtsausdruck, da enge Verknüpfung von Ausdruck & Emotion Einschub: Facial‐Feedback‐Hypothese - Erinnerung: Kritik an der James‐Lange‐Theorie war die Undifferenziertheit der Viszera, um die Breite der Emotionen zu erklären (zu unspezifisch) - Aber: Gesichtsmuskeln: schnell, hoch sensibel, sehr differenziert - Annahme: Emotionen können durch Feedback von den Gesichtsmuskeln entstehen - Kein guter Versuch, wenn man VP erklärt, wie sie ihr Gesicht verziehen sollen, um sie dann zu fragen, wie sie sich fühlen Deshalb folgender Versuch: Strack, Martin & Stepper (1988) - Cartoons bewerten mit Stift zwischen Zähnen ( „lächeln“), zwischen Lippen ( „gucken böse“) oder in Hand - VP verziehen das Gesicht, ohne die Anweisung dazu zu bekommen - Ergebnisse: - Stift zwischen den Lippen Cartoons weniger lustig - Stift zwischen den Zähnen Cartoon lustiger - Schlussfolgerung: Beleg für Facial‐Feedback; Gesichtsausdruck lässt die Untersuchung von Emotionen über Kulturunterschiede hinweg zu Hier: 6 Emotionen - Freude - Ärger - Trauer 33 - Furcht - Überraschung - Ekel - Anzahl variiert je nach Autor (Tomkins, Plutchik, Ekman, Izard) Ekman, Sorenson, & Friesen (1969) - „Schrift‐Kulturen“ (USA, Argentinien, Chile, Brasilien, Japan) vs. „schrift‐freie Kulturen“ (Sandog aus Borneo, Fore & Pidgin aus Neu‐Guinea) - VP sehen Foto & müssen aus 6 Emotionen die entsprechende benennen - Fotos: 30 Bilder mit kaukasischen Personen, welche die 6 angenommenen Basis‐Emotionen zeigen - die häufigste Antwort wird in der folgenden Tabelle als Prozentzahl angegeben Diskussion: gute Rekognition über Kulturen hinweg aber: deutlich schwächere Effekte bei den schrift‐freien Kulturen Erklärung: Sprach‐Barrieren - Lesen der Emotionen nicht möglich - Vorlesen: Problem des Arbeitsgedächtnisses, Primacy & Recency‐Effekte - Kritik Methode: Basis‐Emotionen vorgegeben Ekman & Friesen (1971) - VP: Fore aus Neu‐Guinea; bis 1959 völlig isoliert, sprachen kein Englisch oder Pidgin; haben nie in einer westlichen Siedlung gelebt oder mit einem Nicht‐Einheimischen zusammengearbeitet - Urteilsaufgabe: Methode nach Dashiell, entwickelt für kleine Kinder - Geschichte vorlesen & parallel mehrere Fotos von Gesichtsausdrücken zeigen - VP müssen Gesicht auswählen - löst Probleme der 69er Studie - Emotionen & Geschichten - Freude: „Freunde kommen vorbei und er/sie ist fröhlich.“ - Trauer: „Seine/Ihre Mutter/Kind ist gestorben und er/sie ist traurig.“ - Wut: „Er/Sie ist wütend und wird gleich zuschlagen.“ - Überraschung: „Er/Sie sieht gerade etwas Neues und Unerwartetes.“ - Ekel: „Er/Sie richt etwas Verdorbenes.“ - Folgerungen: - Basale, kategoriale Emotionen, die sich in distinkten Gesichtsausdrücken wiederfindet - werden über Kulturen hinweg erkannt - Kognitionen spielen nach diesem Modell für die Basis‐Emotionen keine Rolle - 3 Erklärungen (nicht exklusiv) - 1) Evolutionäre Gründe - 2) Angeborene Programme - 3) kulturunabhängiges Lernen - Einschränkung: - Spielt Kultur & soziales Lernen nun keine Rolle? - Nein! Kultur bestimmt, - welche Umstände eine bestimme Emotion auslösen - 34 - welche Handlungen auf eine bestimmte Emotion folgen können/dürfen/müssen - wann und wie welche Emotionen gezeigt werden - Kultur bestimmt also nicht die Existenz von Emotionen, sondern den Umgang mit denselben 6 Basisemotionen überall auf der Welt - Würdigung: - Grundlage eines basalen Emotionsmodells - Umfassende Studie mit hohem Aufwand - Basale Emotionen wurden von E & F erst 1986 postuliert - s. folgende Kritik von Ortony & Turner (1990) „Basic Emotions“ - Basale Emotionen als biologisches Primat; daraus folgt: - evolutionärer Ursprung - biologische festgelegt - universal zu finden (über Tiere, Menschen & Kulturen hinweg) - Basale Emotionen als psychologisches Primat; daraus folgt: - nicht weiter in andere Emotionen aufzuteilen - treten früh in der ontogenetischen Entwicklung auf - ebenfalls universal zu finden Warum basale Emotionen als theoretisches Konstrukt? - Manche Emotionen scheinen in allen Kulturen & Situationen aufzutreten - Es scheint eine fast unüberschaubare Anzahl von „erlebten“ Emotionen zu geben - wenn sich basale Emotionen finden lassen, kann man über Notwendigkeiten argumentieren - evolutionäre, biologische, soziale Primär‐ & Sekundäremotionen - Ähnlich zu Primärfarben (Plutchik, 1962) - Sekundäremotionen mischen sich aus Primärfarben Kritik von Ortony & Turner - Empirisch: große Varianz in der angenommenen Anzahl von basalen Emotionen - Theoretisch: Kein klares Kriterium, ab wann eine Emotion als „basic“ zu sehen ist – keine theoretische Abgrenzung von Primär‐ zu Sekundäremotionen 35 Konklusion von Ortony & Turner (1990) - Basics sind sinnvoll in Chemie & Farben (Elemente, Primärfarben), aber nicht in der Emotionsforschung - Empirisch lässt sich nicht widerlegen, ob eine Emotion basal ist oder nicht, daher kein Erklärungswert - Emotionen sind wie Sprachen zu sehen; es gibt auch keine Ursprache & Linguisten versuchen nicht, Sprache auf ihre Grundlagen zu reduzieren Alternative von Ortony & Turner (1990) - basale Einschätzungen: vermeidbare oder unvermeidbare Bedrohung - führen zu Aktivationsmustern: Physiologie, Kognition, Verhalten, Erleben - das Syndrom dieser Komponenten ist dann eine Emotion 12. Vorlesung: Emotion & Kognition Überblick - Wiederholung: Emotion als Unterart von Kognition - Einflüsse von Emotionen auf Kognitionen - Stimmungskongruenz (Netzwerkmodell von Bower) - Urteilseffekte - Denkstile Grundlegendes - basierend auf kognitiven Emotionstheorien folgen Emotionen auf Kognitionen (Bewertung, Attribution,...) - wie können dann Emotionen Denken & Handeln beeinflussen? - Position 1: Emotionen als Unterart von Kognitionen (kann getestet werden) - Position 2: Rekursive Beeinflussung, d.h. völlig unterschiedlich, aber Beeinflussung (3 Freiheitsgrade (Pfeile) – nicht überprüfbar) Prominentes Beispiel: „Flashbulb‐Memories“ - Starkes emotionales Erleben führt zu sehr starken Erinnerungen (z.B. auf Herdplatte fassen) - Bsp.: Bambi wurde im Time Magazine als Nr. 20 der 25 besten Horror‐Movies gelistet - definiert als distinkte, sehr lebhafte Erinnerung an dramatische Ereignisse & währenddessen stattfindender persönlicher Aktivität - Bsp.: Wo warst Du als die Berliner Mauer gefallen ist? Das WTC eingestürzt ist? 3 Klassen von Effekten - Werden getestet auf einer groben Dimension: gut ‐ schlecht - 1) Kongruenz‐Effekte (Isen et al.; Bower) - Kognitionen bzgl. Inhalten, die mit der Valenz der Emotion kongruent sind, haben einen Vorteil - Gedächtnis („Stimmungskongruenz“: In positiver Stimmung ist Erinnern von positiven Ereignissen einfacher & umgekehrt); Priming (Erkennen & Klassifizieren) - 2) Urteils‐Effekte (Schwarz et al.) - Emotionen & Stimmungen werden für Urteile genutzt & im Sinne von Schachter fehlattribuiert (Pos. Stimmung positivere Urteile) - Lebenszufriedenheit; Produktbewertungen - 3) Denkstil‐Effekte (Bless & Fiedler) - Positive Emotionen bewirken einen anderen Denkstil als negative Emotionen 36 - Kreativität (Pos. Emotion kreativer); Aufmerksamkeit (Neg. Emotion aufmerksamer) Kongruenz‐Effekte: Klassiker 1 - Isen et al. (1978): - VP werden über Gewinne oder Verluste in negative oder positive Stimmung versetzt - VP hören 36 Wörter (je 6 positive, negative & neutrale Charaktereigenschaften, 18 neutrale Kontrollwörter) - Spielen (Spaceship Spiel, schwer vs. leicht) – Wörter hören – Spielen – Wörter abfragen - AV: Wie viele Wörter jeder Valenz werden erinnert? - Design: 2 (Gewinn/Verlust bei t1) x 2 (Gewinn/Verlust bei t2) - Zeile „positiv“: starker Effekt - Zeile „Kontroll‐Wörter“: schwacher Effekt - Diskussion: - Stimmungskongruente Effekte im Gedächtnis - Interaktion von Wort‐Valenz & Stimmung (allerdings v.a. für positive Wörter nach Sieg) - Kein „State‐Dependent‐Learning“ (Niederlage/Sieg bei t1 hatte keinen Einfluss) - schwacher Effekt & kein Manipulations‐Check - trotzdem: der Klassiker für Emotion & Gedächtnis Erklärung (Bower, 1981) - Emotionen als Knoten im Netzwerk - Wissen heute, dass unser Netzwerk nicht wirklich so gestrickt ist, aber hoher heuristischer Wert - symbolisches Netzwerk: die Knoten & Verbindungen haben eine Bedeutung - „Gedächtnisketten“ organisieren symbolisches Gedächtnisnetzwerk - erklärt Erinnern von Stimmungskongruenten Ereignissen Wenn Emotion 1, kann der Kontext 1 schneller & leichter abgerufen werden Zusammenfassung - Bower: Emotionen sind als „Units“ / Knoten in mentalen Netzwerken repräsentiert - Aktivierung dieser Knoten führt zu „spreading activation“; d.h. verbundene Units werden voraktiviert & sind damit leichter zugänglich (heute: nur noch gute Heuristik) - Aktivierung eines Knotennetzwerkes macht Abruf zusammenhängender Knoten einfacher 37 erklärt sowohl stimmungskongruente Erinnerung als auch zustandsabhängige Erinnerung (Kontextabhängiges Lernen) (Drogen, Alkohol, Tauchen) Eine Kritik: Response Bias - Erinnerung: Isen et al. (1978) fanden den Effekt v.a. für positive Wörter - Personen in guter Stimmung haben möglicherweise eine Tendenz zu stimmungskongruentem Material „ja“ zu sagen - daraus folgt: kein Gedächtniseffekt, sondern eine Antwort‐Tendenz Antwort: Signal‐Endeckungsanalyse (Fiedler et al., 2001) - Stimmungskongruenz ist ein echter Gedächtnis‐Effekt! - Gestrichelte Linie: negative Information - Durchgezogene Linie: positive Information - Sensitivity: „alt“ & „neu“ trennen können - Linkes Bild, obere Linien: erhöhte Sensitivität für positive Wörter - Urteilseffekte: Klassiker 2 (Schwarz & Clore, 1983) - Annahme: Menschen nutzen Emotionen, Affekte & Stimmungen, um Urteile zu bilden - sinnvoll, wenn Stimuli diese direkt auslösen (z.B. emotionales Empfinden beim Essen von Schokolade) - problematisch, wenn Emotionen, Affekte & Stimmungen von etwas völlig anderem beeinflusst werden (z.B. nerviger Ton während man Schokolade isst Schokolade wird schlechter bewertet) - Vorhersage: An sonnigen Tagen beurteilen Menschen ihre Lebenszufriedenheit besser als an regnerischen - UV1: Wetter (sonnig vs. regnerisch) - UV2: Attribution (Wetter als Ursache?) - Wetter wird nicht erwähnt - Wetter wird beiläufig erwähnt - Wetter wird als zentraler Punkt genannt - AVs: Happy & Satisfied? - Warum kein Kongruenz‐Effekt? - VP werden nach Lebenszufriedenheit gefragt: Theoretisch: - Gute Stimmung („sonnig“): VP erinnern mehr Positives VP beurteilen ihr Leben besser - Schlechte Stimmung („regnerisch“): VP erinnern mehr Negatives VP beurteilen ihr Leben schlechter - aber: Attributionen sollten auf diesen Prozess keinen Einfluss haben! - Diskussion: - Stimmung als Grundlage von Urteilen - Regnerischer Tag: Schlechte Stimmung Schlechte Beurteilung - Sonniger Tag: Gute Stimmung Gute Beurteilung - Rolle der Attribution/Interpretation: Erlebt eine Person ein positives Gefühl, kann das Gefühl als Information… - über die Aufgabe erlebt werden („Das macht ja Spass“) - als auf sich selbst bezogene Information („Ich bin gut bei dieser Aufgabe“) - als Information über die eigene Strategie („Ich mache das richtig“) - Erklärungen für positives Gefühl - Problem: 38 Warum keine Korrektur an sonnigen Tagen? Erklärung von S & C: „…that people are more motivated to seek explanations for negative than for positive moods, and we suggested that this might be primarily due to the fact that most people experience negative moods as deviating from their usually positive feelings.“ - Motivationale Erklärung: negative Dinge werden erklärt, damit man etwas ändern kann; aber: keine motivierte Kognition positive Dinge weg zu erklären (Warum auch?) Denkstile – eine kognitive Erklärung - Signalfunktion von Emotionen - positives Gefühl - alles ist in Ordnung - die verwendeten Strategien, Mechanismen, Verhaltensweisen funktionieren - explorieren & ausprobieren - negatives Gefühl - Probleme! - die verwendeten Strategien, Mechanismen, Verhaltensweisen funktionieren nicht! - sichern & starker Aufmerksamkeit auf die Umwelt Beispiel 1: Bewertung von Argumenten - Bless et al. (1990) - UV1: Gute vs. Schlechte Stimmung - UV2: Starke vs. schwache Argumente - AV: Persuasion - Ergebnis: - VP in schlechter Stimmung lassen sich nur von starken Argumenten überzeugen (achten aus Details, selektieren, enkodieren: bottom‐up) - VP in guter Stimmung lassen sich von starken & schwachen Argumenten überzeugen (egal, kreativer, top‐down) Beispiel 2: Verwendung von Skripten - Bless et al. (1996): VP hören eine Geschichte über einen Restaurant‐Besuch gute vs. schlechte Stimmung - Ergebnis: - VP in guter Stimmung nutzen das „Restaurant‐Skript“ - VP in schlechter Stimmung achten mehr auf die Details Assimilation & Akkomodation - Assimilation: - stärkere „top‐down“ – Verarbeitung („alles okay“) - Anpassung von externem Input an bestehende mentale Strukturen (Heuristiken, Stereotype, Skripte…) - holistischere & kreativere Verarbeitung - Akkomodation: - stärkere „bottom‐up“ – Verarbeitung („Veränderung nötig“) - Anpassung von bestehenden Strukturen an neuen Input - detailgenaue & präzise Verarbeitung - Stimmung & Emotionen triggern diese Verarbeitungsstile (Bless & Fiedler, 2006) als Folge evolutionärer Notwendigkeiten - Diskussion - erklärt die Effekte von Isen et al. (1978) - gute Stimmung stärkere Einfluss der top‐down Komponente - stärkere Stimmungskongruenz - erklärt die Effekte von Schwarz & Clore - schlechte Stimmung stärkerer Einfluss der bottom‐ up Komponente - nur Korrektur in der negativen Stimmungsbedingung Direkter Test: Aufmerksamkeit & Gedächtnis - Forgas, Goldenberg, & Unkelbach (2009) - Ungewöhnliche Objekte in einem Kiosk platziert - 39 - AV: Mittlere Anzahl Items, die in aus Kiosk erinnert wurden 13. Vorlesung: Emotionale Zufriedenheit Überblick - Diener et al: Why most people are happy - Wegner: Immune Neglect - Set‐Point Theorie der Stimmung Positive Affektbilanz - Zur Erinnerung: Emotionen als Anreiz für Verhalten Motivation - Streben nach positiver Affektbilanz - Menschen zeigen das Verhalten, das relativ mehr positiven Affekt als negativen Affekt verspricht Subjektives Wohlbefinden - Diener & Diener (1996): “Most people are happy“ - Subjektives Wohlbefinden gemessen (Diener et al., 1985): - „Im Großen und Ganzen ist mein Leben so, wie es sein sollte.“ - „Meine Lebenssituation ist hervorragend.“ - „Ich bin mit meinem Leben zufrieden.“ - „Bis jetzt habe ich die wichtigen Dinge im Leben, die ich wollte, erreicht.“ - „Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich fast nichts ändern.“ - jeweils: stimme nicht zu 1‐2‐3‐4‐5‐6‐7 stimme zu - 86% von 43 Ländern haben Zufriedenheitswerte über dem Mittelpunkt - Positiv: hohe Korrelation der Items untereinander & Korrelation mit objektiven Maßen (Ernährung, Zugang zu Technik, etc.) Geld macht nur begrenzt glücklich - Bruttoinlandsprodukt, umgelegt auf 1 Person; „Satisfaction with Life“‐Skala - Kein linearer Zusammenhang zwischen Geld & Zufriedenheit - Zufriedenheit wird auch durch andere wichtige Faktoren beeinflusst Zufriedenheit über die Jahre - Diener, Lucas, & Scollon (2006) - Affektbalance = Positiver Affekt (PA) – Negativer Affekt (NA) - Affektbalance verglichen mit Life satisfaction relativ gesehen: stimmen einigermaßen überein (hohe Affektbalance, hohe Life satisfaction & umgekehrt) Problemstellung - Sind Menschen in der Lage, ihre emotionalen Reaktionen korrekt vorherzusagen? - Valenz: gute Vorhersagen (Schokolade vs. Blinddarm‐OP) - Intensität: weniger gute Vorhersagen (Gedächtnis variiert; „peak‐and‐end“) - Dauer: völlig unklar Zu „Peak and end“: - Studie: Darmuntersuchung; währenddessen: „Wie schmerzhaft?“ - Danach: „Wie schlimm wars?“ - Ergebnis: man gibt entweder den höchsten Schmerz an („peak“) oder den Schmerz gegen Ende („end“) Gilbert et al. (1998): „Immune Neglect“ - Wie würden Sie sich fühlen… - …wenn Ihr Partner stirbt? - …wenn Ihr Kind stirbt? - …wenn bei Ihnen eine unheilbare Krankheit diagnostiziert würde? - Berühmtes Beispiel: Tony Meehan (Produzent bei Decca Records) lehnte die Beatles ab („Gitarren‐Bands sind out“) wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung der Musikgeschichte; aber: „immerhin war er der erste Produzent, der sie überhaupt angehört hatte“ 40 Getestete Entscheidungen (Studies 1 & 2) - „…we asked forecasters to predict their affective reactions both to negative and to positive events.“ - Liebesbeziehungen - Tenure‐Entscheidungen (Entscheidung über Professurstelle oder Kündigung nach einigen Jahren Arbeit für Lehrstuhl) Liebesbeziehungen - Luckies: sind im Moment in einer Beziehung & sollen vorhersagen, wie glücklich/zufrieden sie nach einer Trennung wären - Leftovers: haben sich getrennt (wurden verlassen) und sollen ihre Zufriedenheit/Glück berichten - Loners: sind in keiner Beziehung & sollen vorhersagen, wie glücklich sie in einer Beziehung wären - Lovers: sind seit sechs Monaten in einer Beziehung & sollen ihre Zufriedenheit/Glück berichten - Luckies & Leftovers: - In Zufriedenheit ungefähr gleich (5,42, 5,46, 5,27) - Luckies sagen vorher, dass sie nach Trennung weniger zufrieden wären (3,89) dem ist nicht so (sieht man an Leftovers) - Luckies überschätzen fiktives Leid bei Trennung - man denkt man wäre unglücklicher bei Trennung als man tatsächlich ist - Loners & Lovers - (Young) Lovers zufriedener als Loners (5,91 bzw. 5,71 im Vergleich zu 5,17) - Loners machen gute Vorhersage (wie würde es Ihnen in Beziehung gehen: 5,79) - positive Dinge kann man besser vorhersagen als negative - Kritik: Vergleich über Personen hinweg (Lovers mit Loners vergleichen ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen) Tenure‐Entscheidungen - Assistenz‐Professoren schätzen ein, wie zufrieden sie sind/wären… - nach vorgestellter positiver Tenure‐Entscheidung - nach vorgestellter negativer Tenure‐Entscheidung - nach tatsächlicher positiver Tenure‐Entscheidung - nach tatsächlicher negativer Tenure‐Entscheidung - Vorhersager: 33 - positive Entscheidungen: 47 - negative Entscheidungen: 20 - Messung mit Satisfaction with Life – Scale - Ergebnisse: - Vorgestellte negative Entscheidung schlimmer eingestuft (3,42) als sie dann tatsächlich ist (4,71) - Vorgestellte positive Entscheidung sogar etwas höher (5,90) als sie dann tatsächlich ist (5,24) - Tatsächliche negative Entscheidung: erholen sich gut (nach 5 Jahren: 5,23; kein großer Unterschied zu Leuten mit positiver Entscheidung nach 5 Jahren: 5,82) - Nach 5 Jahren: Vorhersagen (sowohl positiv als auch negativ) eher zutreffend als bei „recent happiness“ - auf kurze Sicht sind Vorhersagen eher schlecht - auf lange Sicht sind Vorhersagen eher gut - „Emotionales Immunsystem“ hilft uns dabei, negative Ereignisse zu überwinden - Menschen unterschätzen dieses Immunsystem (Immune neglect) sagen, sie würden die wieder glücklich werden, obwohl dem keineswegs so ist (auch wenn einem etwas schlimmes widerfährt, wird man irgendwann wieder glücklich) Diskussion - Vorhersage für den kurzen Zeitraum inkorrekt, aber eher korrekt für den längeren Zeitraum - Vorgeschlagener Mechanismus: Emotionales Immunsystem 41 - „wegerklären“ von negativen Ereignissen - Attributionen, Fokusierungen, etc. - Alternativen: - Fehleinschätzung der positiven und negativen Ereignisse - falsche Theorien über die Stärke der emotionalen Reaktion - motivierte Verzerrungen - positive Vorhersagen sind per se angenehm - negative Vorhersagen als defensiver Pessimismus Abschluss - Allgemein: - Schlechte Einschätzung der Dauer & der Intensität - Gute Einschätzung der Valenz - Implikationen für Motivation & antizipierte Affektbilanz? - Menschen geht es emotional oft besser, als die Realität es erwarten lässt - Anpassung an gute und schlechte Ereignisse