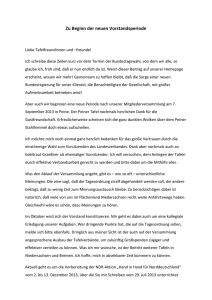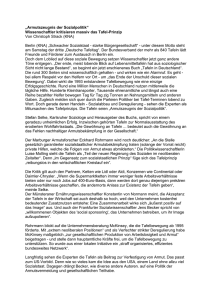Professor Dr. Stefan Selke Soziologe Hochschule Furtwangen im
Werbung

Sendung vom 19.3.2014, 21.00 Uhr Professor Dr. Stefan Selke Soziologe Hochschule Furtwangen im Gespräch mit Rigobert Kaiser Kaiser: Herzlich willkommen zum alpha-Forum. Die Bundesrepublik ist durch die Schuldenkrise eigentlich recht glimpflich durchgekommen, denn man muss ganz klar feststellen: Die Wirtschaft in Deutschland ist gewachsen, während sie in anderen Ländern deutlich nach unten ging; die Arbeitslosenzahl in Deutschland fiel in diesem Zeitraum unter drei Millionen, während sie in anderen Ländern nach oben geschnellt ist. Man könnte eigentlich zufrieden sein, doch es ist nicht alles eitel Sonnenschein. Denn man muss ebenso klar feststellen: In Deutschland gibt es ein wachsendes Armutsproblem. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Studiogast, mit Professor Stefan Selke von der Hochschule Furtwangen im schönen Schwarzwald. Herr Professor Selke, zuerst einmal vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Selke: Ich bin gerne gekommen. Kaiser: Herr Selke, Sie beschäftigen sich mit Forschung über Armut und ihren Folgen für die Gesellschaft. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, dass aufseiten der Konjunkturzahlen, der Arbeitslosenzahlen bei uns in der Bundesrepublik eigentlich alles in schönster Ordnung ist – und die Politiker sonnen sich ja darin –, dass es aber gleichzeitig ein Auseinanderklaffen unserer Gesellschaft gibt, da wir ein wachsendes Armutsproblem haben? Selke: Nun ja, das ist eben genau das Problem: Zahlen sind nicht alles. Und die "Sonnenbank" der Politiker, die sich vielleicht zu sehr auf die Zahlen fokussiert, blendet andere Anteile der Lebenswirklichkeit von Menschen aus. Wenn wir unseren Armuts- und Reichtumsbericht nehmen, der nun zum vierten Mal wiederholt worden ist, dann stellen wir fest, dass es da Lücken, blinde Flecken gibt. "Blinde Flecken" meint, dass darin bestimmte Teile der Lebenswirklichkeit von armutsbetroffenen Menschen gar nicht vorkommen, nämlich das, was ich armutsökonomische Angebote nenne, wie Tafeln, Suppenküchen, Kleiderkammern usw. Wir wissen darüber nämlich nur sehr wenig. Der zweite Grund, warum es da eine Lücke gibt zwischen den Zahlen und dem Armutsproblem, wie Sie das nennen, ist folgender: Wir haben natürlich in bestimmten Bereichen ein Wachstum, aber davon profitieren eben nicht alle. Der Blick richtet sich aber immer noch zu sehr auf diejenigen, die davon profitieren, und zu wenig auf die, die letztlich nichts davon haben und die dann dauerhaft in Armutssituationen landen. Kaiser: Für die Bewältigung der Krise, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, wird ja immer ein ganz bestimmtes Positivargument genannt: Die Bundesrepublik sei durch viele soziale Reformen – hier wird auch immer die Hartz-IV-Gesetzgebung genannt – wettbewerbsfähiger geworden, sei stabiler geworden. Auf der anderen Seite sagen Sie jedoch in Ihren Büchern, dass gerade Hartz IV der Auslöser für diese Spaltung sei. Wie passt das zusammen? Selke: Das sind eben die zwei Seiten einer Medaille. Es ist ganz klar, dass sich in den letzten 10, 20 Jahren das politische Denken verändert hat, und zwar in Richtung einer Effizienzgestaltung: Die Menschen sollen aktiviert werden! Damit geht aber auch einher – und das kritisiere ich – eine Veränderung des Menschenbilds. Wir haben unser Menschenbild von einem wohlwollenden, positiven und optimistischen Menschenbild verändert zu einem negativen, misstrauischen Menschenbild, das davon ausgeht, dass man Menschen kontrollieren muss, dass man sie aktivieren muss, dass sie freiwillig nichts tun, weil sie nämlich eher faul sind. Das ist sehr deutlich geworden in den Hartz-IV-Reformen. Kaiser: "Fordern und fördern" heißt es dort. Selke: Ja, das ist eine Formel, die aus dem anglo-amerikanischen Raum kommt und in unsere Kultur übersetzt wurde. Sie passt aber nicht so ganz rein in die Kultur des Sozial- oder Wohlfahrtsstaates, der sich sorgt um seine Bürger und eben nicht fordert. Das ist letztlich auch der Punkt: Das ist der krasseste kulturelle Wandel, an dem man beobachten kann, dass sich diese Politik verändert hat. Das bildet sich eben ab in ganz vielen Details, z. B. im Aufkommen von bestimmten Angeboten, in der sozialen Kategorisierung von Menschen z. B. mit dem Wort "Hartzer". Das Verb "hartzen" ist ja sogar in den Duden eingegangen. Aber es gibt auch diese "Parasiten"-Diskussion usw. Kaiser: Das ist alles sehr negativ besetzt. Selke: Ja, das sind alles sehr negative soziale Kategorien, durch die Menschen in eine Schublade gesteckt werden und wodurch ein Problem sprachlich etikettiert und vielleicht auch ein Stück weit entsorgt wird. Kaiser: Die Verbindung, die heute hergestellt wird, lautet: "Hartz IV ist gleich Alkoholproblem, faul, selbstverschuldet." Damit werden diese Menschen in eine Ecke abgeschoben und haben eigentlich keine Chance mehr. Selke: Ich glaube, wir erleben da gerade die Renaissance eines Denkens, das letztlich aus dem Mittelalter kommt: Würdige und unwürdige Arme werden unterschieden. Das ist genau diese zweite Seite der Medaille, die wir gerade angesprochen haben. Auf der einen Seite soll Deutschland volkswirtschaftlich wettbewerbsfähig sein durch Niedriglöhne usw. Auf der anderen Seite bleibt den Menschen dann aber nur noch so eine Restabsicherung. Und das, was dann zu einem menschenwürdigen Leben fehlt, müssen sie sich woanders holen. Die "würdigen Armen", die sich gemäß den Regeln, der Kontrolle, der Aktivierungslogik verhalten, bekommen noch diese Unterstützung. Und die "unwürdigen Armen" müssen gucken, wo sie bleiben. Das ist ein Stück weit ein Rückfall in die Vormoderne, wie man kritisch sagen kann. Kaiser: Denn die Zahlen sind ja schon eklatant. Man feiert auf der einen Seite, dass man inzwischen in der Bundesrepublik 42 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs hat. Das sind so viele wie noch nie. Auf der anderen Seite haben wir aber auch über sieben Millionen Menschen, die unterstützt werden müssen vom Staat. Selke: Nun, bei diesen Jobs muss man eben genau hinschauen: Was sind das für Jobs? Weggebrochen ist jedenfalls generell so etwas wie eine Normalbiografie, bei der Menschen ihr ganzes Leben lang vollzeitbeschäftigt sind. Wir sprechen ja sogar von perforierten Biografien, also von Biografien, die immer wieder Löcher haben. Das führt dann in der Summe dazu, dass die Momentaufnahme durchaus positiv aussehen kann, dass aber die Längsschnittbetrachtung über 20, 30 Jahre zu einem ganz anderen Ergebnis kommt. Das Stichwort lautet hier z. B. "Altersarmut": Wie sehr können denn Menschen im Alter abgesichert sein, wenn sie nur dieses niedrige Erwerbseinkommen und/oder dieses unterbrochene Erwerbseinkommen haben? Das ist einfach eine andere Perspektive. Kaiser: Das Problem besteht meiner Meinung nach darin, dass diese Menschen damit die Fähigkeit und die Chance verlieren, sich selbst zu versorgen, und auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Selke: Na, ich würde den Punkt doch woanders ansetzen, denn das klingt doch wieder sehr stark nach der Sündenbocktheorie: Die Menschen müssen sich selbst versorgen und sie müssen die Leistung ... Kaiser: Aber es wäre doch wünschenswert, dass sie sich selbst versorgen können. Selke: Natürlich muss jeder ein Stück Verantwortung für sich selbst übernehmen. Aber wir, also sie und ich, sind doch eigentlich in einer Kultur aufgewachsen, die folgendermaßen ausgesehen hat: Wenn man in irgendeiner Art und Weise ein Problem hat, wenn man z. B. krank wird – das Krankwerden ist ja etwas, was niemand steuern kann und für das es auch keine Schuld gibt –, dann wird man in einem Solidarsystem aufgefangen, bei dem die Gemeinschaft insgesamt für die einzelnen Menschen sorgt: im Alter, im Krankheitsfall, bei Arbeitsunfähigkeit usw. Das alles aber haben wir nach und nach geopfert, und zwar der Logik "Hilf dir selbst!" bzw. "Schau selbst, wo du bleibst!". Das ist eine sehr minimalistische Logik und mit dieser Logik kommen in der Tat viele Menschen nicht klar. Ich würde aber davor warnen, einen solchen Missstand diesen Menschen anzulasten. Denn man muss immer zuerst einmal schauen, was es wirklich bedeutet, in solchen Lebenssituationen zu leben. Ich persönlich habe großen Respekt vor den Menschen, die genau das schaffen, die sich in dieser Lebenssituation noch ein Stück Würde bewahren, klarkommen mit dieser Situation und vielleicht sogar wieder rauskommen aus ihr. Es kritisiert sich nämlich leicht aus einer komfortablen Position, aber letztendlich ist es eine wahnsinnige Leistung, die viele Menschen in Deutschland vollbringen müssen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Kaiser: Hier hat sich in den letzten 20 Jahren ein ganz bestimmtes Phänomen massiv entwickelt. 1993 wurde in Berlin die sogenannte erste "Tafel" gegründet, und zwar von Frau Sabine Werth. Diese Tafel war die erste, eben vor 20 Jahren, und mittlerweile gibt es in Deutschland über 900 Tafeln. Die Zahlen sind oft ein bisschen geschätzt, aber man geht davon aus, dass zwischen einer und 1,5 Millionen Menschen darauf angewiesen sind, sich bei einer Tafel das zu holen, was sie für ihr Leben benötigen. Vielleicht könnten Sie für diejenigen, die das Wort "Tafel" immer nur in der Zeitung lesen – es gibt eine Münchner Tafel, es gibt eigentlich in fast jeder Stadt eine Tafel –, ein wenig erklären, was hinter diesem Begriff eigentlich genau steckt. Selke: Tafeln sind Organisationen, die von engagierten Menschen betrieben werden, zum Teil in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden wie Diakonie oder Caritas, teils aber auch als Projekte oder Vereine organisiert sind. Diese Tafeln versuchen, Lebensmittel umzuverteilen: Sie sammeln überflüssige Lebensmittel aus dem Konsummarkt wie den Supermärkten ein – teilweise kaufen sie auch Lebensmittel dazu, aber das wäre ein anderes Thema – und geben dann diese Lebensmittel an bedürftige Menschen bei diesen Tafeln oder Tafel-Läden weiter. Man muss hier dazu sagen, dass es in Deutschland auch Lebensmittelvergabestellen gibt, die sich nicht "Tafel" nennen. Es gibt einen Bundesverband "Deutsche Tafel e. V." mit Sitz in Berlin, und der Name "Tafel" ist mittlerweile ein geschütztes Markenzeichen wie "Lego" oder "Tempo". Die Tafeln, die in diesem Bundsverband organisiert sind, dürfen sich eben auch "Tafel" nennen. Es gibt aber auch andere Organisationen, die exakt das Gleiche machen, nämlich Lebensmittel einsammeln und dann an bedürftige Menschen verteilen, die sich anders nennen, die sich nicht "Tafel" nennen dürfen. Es ist mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch diese aus der Sicht des Bundesverbandes "wilden Tafeln" gibt und dass das Engagement zweigeteilt ist. Da gibt es einerseits die Tafeln, die in dieser großen Lobbyvereinigung, in diesem Bundesverband organisiert sind und von mir "Bundes-Tafeln" genannt werden, und da gibt es andererseits noch diesen anderen Markt, auf dem die Organisationen einen anderen Namen tragen. Kaiser: Damit deuten Sie den Umstand an, dass diese Tafeln, die vor 20 Jahren noch den Zweck hatten, lokal und möglicherweise auch nur vorübergehend Menschen zu helfen, die in Not geraten sind, mittlerweile organisiert sind. Das heißt, sie sind angekommen in unserem organisierten, festgefügten Staatsgefüge. Selke: Ja, sie sind mitten in der Gesellschaft angekommen, so wie auch Armut mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Armut ist ja mittlerweile auch ein Mittelschichtproblem, d. h. es gibt eine Art Demokratisierung von Armut: Heute kann man durch die politischen Veränderungen – Stichwort Hartz IV – viel leichter in Armut geraten. Die Bundes-Tafeln sind vom Umfang her jedenfalls eine riesige Organisation geworden. Ich vergleiche sie durchaus mit Unternehmen oder auch mit Organisationen, die sich in der Fläche ausgebreitet haben, die sich in Bezug auf ihre Produkte diversifiziert haben und die sich immer neue Zielgruppen erschließen. Sie haben vorhin Sabine Werth angesprochen, die Gründerin der ersten Tafel in Berlin. Wenn man mit ihr spricht, und das mache ich hie und da, dann erfährt man, dass sie selbst sehr verwundert ist, was aus ihrer Idee aus dem Jahr 1993 geworden ist. Damals sollte das Obdachlosen in Berlin helfen, inzwischen ist daraus aber ein richtiges Netzwerk geworden, ein armutsökonomisches Netzwerk, das immer weiter wächst und weiter auf Expansionskurs ist. Das erschreckt mittlerweile doch auch einige innerhalb der Tafel-Bewegung, denn die Rhetorik in dieser TafelBewegung lautet eigentlich immer: "Am liebsten wären wir überflüssig." Wenn also eine Tafel ihren fünfjährigen oder gar zehnjährigen Bestand feiert, dann hört man in den Festreden immer: "Uns gibt es, uns muss es geben, aber am liebsten wären wir überflüssig." Aber 20 Jahre TafelBewegung ist eben ein Beweis dafür, dass dieses Überflüssig-Werden nicht geklappt hat bisher. Das Gegenteil ist stattdessen der Fall: Es gibt eine weitere Expansion. Kaiser: Damit verbindet sich doch die Frage: Warum sind diese Tafeln nicht überflüssig geworden? Liegt das nur an den Tafeln, die, wie Sie sagen, ihre Geschäftsmodelle ausgeweitet haben? Oder liegt das möglicherweise auch an unserer Gesellschaft, die sich an Tafeln gewöhnt hat, und an unserer Politik, die sich ebenfalls an die Tafeln gewöhnt nach dem Motto: "Wir helfen den Menschen zwar, aber wenn unsere Hilfe nicht mehr ganz reicht, dann gibt es ja immer noch die Tafeln." Selke: Die Buhmann-Frage ist wirklich nur sehr schwer zu beantworten, weil es, wie ich das nenne, hier eine Dauersynchronisation von Interessen gibt. Es gibt da auf der einen Seite die Tafeln, die natürlich ab einer gewissen Größe ein Eigeninteresse haben: Als Organisation sorgt man sich um sein Image, um seinen Auftritt, um seine Existenz. Das ist bei den Tafeln ganz gewiss so. Aber da gibt es auch noch das Interesse von anderen Akteuren wie z. B. von der Wirtschaft. Die Tafeln werden ja massiv unterstützt von der Lebensmittelindustrie ... Kaiser: Diese Betriebe können damit sagen: "Ich tu was Gutes!" Selke: ... und auch von anderen Sponsoren, die ihr Engagement für die Tafeln als gesellschaftliche Verantwortung ausweisen in ihren Jahresberichten. Die Hauptsponsoren von Tafeln wie z. B. "Rewe" sind sehr stolz auf ihr Engagement für die Tafeln und vermarkten das auch ein Stück weit. Nebenbei haben sie auch noch ein wirtschaftliches Interesse daran, weil sie damit ein wenig Müllentsorgungskosten sparen können und weil sie einen Imagegewinn erzielen. Der dritte Akteur in diesem Bund ist die Politik, die natürlich in den Tafeln ein Vorzeigemodell sieht für zivilgesellschaftliches Engagement. Sie sieht auch, dass die Privatisierung von Verantwortung in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen hervorragend funktioniert. Das Problem ist nur, dass das, was funktioniert, nicht zwangsläufig auch das Richtige ist. Das ist der Grund, warum die Tafeln seit 20 Jahren "erfolgreich" existieren: weil es mindestens diese drei sich überlagernden Interessenssphären gibt, nämlich die Wirtschaft, die Politik und die Tafeln selbst. Kaiser: Und für den Wahlkampf, sei es auf Landesebene oder auf lokaler Ebene, gibt das auch noch das eine oder andere schöne Bild, wenn man als rühriger Politiker mal bei einer Tafel vorspricht und seine verbale und sonstige Unterstützung zusichert. Selke: Das ist überhaupt eine interessante Perspektive, die Sie da aufmachen, denn ich habe mich schon oft gefragt, warum gerade die Tafeln so populär geworden sind und nicht irgendwelche anderen Projekte. Ich glaube, das liegt schon auch an der medialen Darstellbarkeit der Tafeln: Die Tafeln bringen gute Bilder. Man kann da sehr konkret etwas zeigen: Menschen helfen anderen Menschen, und zwar an konkreten Orten mit konkreten Dingen. Im Mittelpunkt steht sogar etwas sehr Konkretes, was wir alle kennen, nämlich Lebensmittel. Auch deswegen sind meiner Meinung nach die Tafeln in den letzten 20 Jahren als Projektionsfläche für die Medien, für Politiker usw. so sehr interessant geworden. Kaiser: Das gebe ich durchaus zu: Man geht dorthin, man trifft dort Leute, man sieht lange Tische, man sieht eine Essensausgabe, das Ganze ist in einer gewissen Form öffentlich und nicht versteckt. Selke: Und es scheint eine sehr einfache Problemlösung zu sein: indem man Lebensmittel rettet und transportiert ... Kaiser: Alles außen herum ist gut. Selke: ... und sie weitergibt, ist doch das Problem gelöst, oder? Kaiser: Sie kritisieren ja in Ihrem Buch diese Tafeln sehr stark. Ihr Buch, das Sie im Jahr 2013 herausgegeben haben, trägt den Titel "Schamland. Die Armut mitten unter uns". Warum dieser Titel "Schamland"? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Tafeln durchaus Positives im Sinne haben: Wer schämt sich da und warum? Selke: Dieser Titel hat zwei Bedeutungen und die erste davon hat mit den Tafeln gar nichts zu tun, sondern mit unserer Gesellschaft, mit unserer Politik. Es ist ein Schamland – und deswegen bin ich auch auf diesen Titel gekommen –, weil wir so viel Reichtum haben und es einfach nicht schaffen, diesen besser umzuverteilen; weil wir Wachstum haben, noch recht gut durch die Krise gekommen sind, aber gerade nicht alle Menschen an diesem Wohlstand partizipieren können; weil wir so langsam ein Altersarmutsproblem bekommen usw. Das ist beschämend für Politiker, die in kurzfristigen Logiken denken und eben keine nachhaltige Politik machen, die über eine Legislaturperiode hinausgeht. Das ist die eine Erklärung für den Titel "Schamland". Die andere Erklärung ist, dass es in Deutschland Orte gibt, an denen man beschämt wird als Mensch, der durch das normale Raster gefallen ist. Da sind diese Orte wie die Tafeln. Ich war aber auch bei Suppenküchen und ich war auch in Sammellagen für Asylbewerber, denn auch dort sind Menschen gelandet, die aufgrund von geopolitischem Kalkül oder von wirtschaftlichem oder politischem Kalkül an einem bestimmten Ort systematisch beschämt werden. Die Frage, die ich in meinem Buch anhand von vielen Fallbeispielen und Interviews aufmache, lautet, ob diese Beschämung bereits so etwas ist wie ein systematisches politisches Steuerungsinstrument, um den Unwillen derjenigen zu dämpfen, die durch das Raster durchgefallen sind. Es gibt für mich Anzeichen dafür, dass Beschämung zwar nicht bewusst eingesetzt wird, aber doch innerhalb der Maschinerie und Bürokratie, die wir mit der Agenda 2010 und Hartz IV aufgebaut haben, als ein Element eingebaut ist und Menschen damit mutlos und kraftlos gemacht werden, indem sie beschämt werden. Ich habe sehr genau hingehört, was mir die Menschen dort gesagt haben. Ich habe sie z. B. ihre je eigene Geschichte nacherzählen lassen, wie das war, als sie krank wurden, als sie den Job verloren haben, wie dass war, als sie dann zur Tafel gingen. Das war immer eine Geschichte, die zeigt, dass das so ein langsames Absinken des Selbstwertgefühls war, verbunden mit einer Weigerung der Anerkennung dieser Situation. Kaiser: Weil man sich geschämt hat. Selke: Ja, weil man sich geschämt hat, nicht mehr den normalen Normen zu entsprechen, weil man diese Differenz, diesen Riss ja genau spürt. Man umkreist dann quasi wie ein Satellit diese Orte, diese Tafeln, bis irgendwann die Not so groß ist, dass die Menschen dorthin gehen. Aber sie schämen sich eben. Das ist die zweite Erklärung für diesen Titel "Schamland". Das ist, um damit noch einmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, auch dieser blinde Fleck: Da gibt es auf der einen Seite diese Indikatoren und Zahlen, die sehr positiv aussehen. Aber der blinde Fleck ist dort, wo es um die subjektive Empfindung von Armut geht und um das Gefühl, aus der Mitte der Gesellschaft herausgefallen zu sein und dann auch nicht mehr wieder hineinzukommen. Das ist für diese Menschen extrem bedrohlich und belastend. Kaiser: In Ihrem Buch beschreiben Sie auch eine Frau, die auf einer Diskussionsveranstaltung zu den Tafeln gewesen ist, bei der Sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch selbst mit auf dem Podium gesessen sind. Ich fand den Kommentar dieser Frau sehr eindringlich. Denn diese Frau war ja durchaus dankbar dafür, dass es diese Institution wie die Tafeln gibt, weil das in ihrer schwierigen Lebenssituation die einzige Möglichkeit war, an Lebensmittel zu kommen, die sie auch bezahlen kann. Diese Frau scheint dann in Tränen ausgebrochen zu sein, als sie kritisierte, dass man sich da öffentlich anstellen muss, um an diese Lebensmittel zu kommen: "Warum wird mit uns diese öffentliche Zurschaustellung gemacht? Wir sind doch auch Menschen." Ist das die typische Gefühlslage vieler Menschen, die zur Tafel gehen, gehen müssen? Selke: Ich glaube, man muss das an dieser Stelle wirklich etwas differenzierter betrachten. Ich habe gerade das Forschungsprojekt mit dem Titel "TafelMonitor" beendet, bei dem wir untersucht haben, welche Typen von Nutzern der Tafeln es gibt. Es gibt im Prinzip wohl drei Typen, und ein Typ davon würde wohl genau die gegenteilige Reaktion zur Reaktion dieser Frau zeigen. Das ist der Typus, der sich nicht schämt, zur Tafel zu gehen. Sie gehen dorthin, nutzen diese Angebote wie Suppenküchen, Kleiderkammern usw. und schämen sich eben nicht. Das ist für sie Normalität geworden. Die Frage, die sich daran anschließt, lautet, ob das nicht der eigentliche Skandal ist: wenn ein Zustand, der eigentlich nicht normal ist, nämlich Almosensysteme in einem so reichen Land, von den Beteiligten in diesen Milieus für normal gehalten wird. Die beiden anderen Typen bzw. Gruppen schämen sich und spüren diese Scham und diese Differenz sehr genau. Das führt dazu, dass sich eben nicht alle Menschen so verhalten, wie das manche Politiker gerne sehen möchten: Die Politiker stellen sich nämlich die Tafel als eine soziale Utopie vor, an der man gemeinsam unter seinesgleichen ist. Nein, es gibt durchaus die Nutzertypen, die nur mit einem gewissen Widerwillen dorthin gehen, schnell ihre Sachen holen und wieder weggehen. Es gibt also einerseits eine bewusste Distanzierung von Tafelnutzern und es gibt diejenigen, die in den Tafeln in der Tat so etwas wie eine Art Ersatzwelt oder Ersatzraum sehen. Kaiser: Die dort auch soziale Kontakte suchen. Selke: Ja, auch das. Wobei ich aber darauf hinweisen möchte, dass das eben gerade keine soziale Teilhabe ist. Denn der Auftrag in unserem Grundgesetz lautet ja, dass unsere Gesellschaft für materielle Daseinsvorsorge und für kulturelle Teilhabe aller zu sorgen habe. Ist aber das gemeinsame Ausgegrenztsein an solchen Orten bzw., ganz neutral ausgesprochen, ist das Zusammensein an solchen Orten bereits soziale Teilhabe? Ich bezweifle das in der Tat und glaube nicht, dass das soziale Teilhabe ist. Die Reaktion dieser Frau, die Sie erwähnt haben, zeigt eben, dass es ganz unterschiedliche Reaktionen auf Tafeln gibt. Die dominante Sicht auf die Tafeln ist diejenige aus der Sicht der Helfer, der Anbieter, die sagen: "Wir engagieren uns hier, wir machen das freiwillig in unserer Freizeit und mit" – zugegebenermaßen – "viel Aufwand und auch mit viel Liebe." Teilweise geschieht das aus religiösen Motiven, teilweise aus anderen Motiven. Aber das Ganze wird eben auch organisiert, und aus der Sicht der Helfer heißt es, das Ganze muss in einer bestimmten Weise organisiert werden. Das führt dazu, dass es Bedürftigkeitsprüfungen gibt, dass es Schlangestehen gibt, dass es all diese Dinge gibt. Die andere Perspektive aber, nämlich die Perspektive, wie sich das denn anfühlt, wenn man in dieser Schlange steht, wie sich das anfühlt, wenn man bei der Bedürftigkeitsprüfung die Hosen runterlassen muss, wie es sich anfühlt, wenn man Ware nicht anfassen und auch nicht mehr zurücklegen darf, wenn man sich die Waren nicht selbst auswählen darf, diese andere Perspektive der Nutzer von Tafeln bzw. deren "Kunden", wie sie von den Tafelbetreibern genannt werden, ist systematisch unterbelichtet. Das war auch der Grund dafür, warum ich mein Buch "Schamland" geschrieben habe. Grundsätzlich ist das wirklich eine Perspektive der Scham oder der Unterlegenheit, weil das eben kein wirkliches Konsumverhältnis ist, keine wirkliche Autonomie, keine Selbstversorgung in dem Sinne, dass man in den Supermarkt geht und die Lebensmittel dort selbst bezahlt. Stattdessen ist das ein gespieltes Kaufverhältnis, die Simulation einer Normalität. Kaiser: Aber das wird ja auch als positiv dargestellt: Man will bei den Tafeln die Lebensmittel nicht verschenken, sondern man will dem "Kunden", der da kommt, schon das Gefühl geben, er bezahlt etwas dafür. Selke: Ich bezeichne das nach wie vor als eine Fassade: Man weiß sehr wohl, dass das nicht normal ist, aber mit diesem symbolischen Euro versucht man, Normalität zu suggerieren. Was man damit aber auch versucht, ist, dem Missbrauch wieder einmal vorzubeugen, dem Missbrauch, dass Menschen mehrfach zu den Tafeln gehen. Bei den meisten Tafeln funktioniert das Ganze ja so, dass die Kunden nach Postleitzahlengebieten zugeordnet werden. In der Anfangszeit der Tafeln hatte es nämlich durchaus auch trickreiche Menschen gegeben, die zu mehreren Tafeln gegangen sind. Das versucht man heute auszuschalten. Hier trifft man wieder auf dieses negative Menschenbild, von dem ich gesprochen habe, denn bei den Tafeln wird das nämlich ein Stück weit reproduziert, wenn gesagt wird, dass man die Menschen kontrollieren müsse, dass man aufpassen müsse usw. Das ist z. B. auch eine Kritik, die nie gehört wird in der Öffentlichkeit: Es gibt nämlich z. B. auch Vesperkirchen oder andere Organisationen, die ganz anders funktionieren, denn zu denen darf man einfach so hingehen. Der Missbrauch, den einige Menschen betreiben, wird dort einfach in Kauf genommen und es wird auch auf diese Zugangsregelung, auf diese Bedürftigkeitsprüfung verzichtet. Damit fällt aber ein großes Stück dieser Beschämung und Stigmatisierung schon mal weg. Kaiser: Sie üben ja, wenn man das zusammenfasst, doch eine sehr scharfe Kritik an den Tafeln. Wenn uns nun jemand zuschaut, der sich bei einer Tafel engagiert, der viel Freizeit, Liebe und Hingabe aufwendet, um diesen Menschen zu helfen, dann sagt so jemand u. U. ganz entsetzt: "Was sagt denn der Selke da? Der hat doch gar nicht verstanden, was wir wollen." Selke: Ich glaube schon, dass ich das verstanden habe, denn ich habe ja selbst auch mal ein Jahr lang bei einer Tafel mitgearbeitet. So begann für mich dieses Thema eigentlich auch. Ich kann die Motive der Helfer sehr wohl verstehen. Meine Mutter arbeitet z. B. bis heute bei einer Tafel und ich spreche regelmäßig mit ihr darüber, was sie dort macht. Die Motive der Helfer sind aber nur eine Seite der Medaille und ich versuche eben erstens, die Seite der Nutzer ein Stück weit zu vertreten. Und zweitens habe ich eine Perspektive auf Tafeln insgesamt, als Tafel-System, als Tafel-Bewegung in Deutschland. Ich habe auch eine Perspektive über mittlerweile mehrere Jahrzehnte dieser Bewegung. Das bedeutet, dass ich doch etwas anderes betreibe, als mir nur hin und wieder eine Tafel anzuschauen: an einem Ort, an einem Samstag mit konkreten Personen, die konkrete Dinge machen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen. Diese beiden Ebenen kann man aber sehr wohl auch zusammenbringen, denn sie widersprechen sich ja nicht. Man bekommt sie an der Stelle zusammen, an der man sagt: Es ist sicherlich sinnvoll, dass Menschen sich in dieser Art und Weise engagieren, aber sie müssen über die Grenzen ihres Engagements schon auch ein Stück weit reflektieren, weil es eben in Deutschland nicht nur eine Tafel gibt, sondern 1000 Tafeln, weil das ein System geworden ist, das nicht intendierte Effekte hat. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen in der Debatte über Tafeln, über deren Sinn oder Unsinn und darüber, ob sie eine Lösung oder selbst ein Problem darstellen. Diese beiden Perspektiven widersprechen sich also nicht völlig. Kaiser: Sie sprechen in Ihrem Buch von einer Armutsökonomie, die sich entwickelt hat, und sagen: Wenn man sich auf dieses Tafelsystem verlässt, dann verteilt man Almosen, während man als Bürger gegenüber dem Staat eigentlich einen sozialen Anspruch hat. Almosen zu geben bedeutet demgegenüber eine Entwürdigung, bedeutet den Verlust der eigenen Bürgerrechte. Das heißt, damit kritisieren Sie auch den Staat, wenn er sich auf diesem Gebiet zurückzieht und diesem sozialen Anspruch, den die Bürger ihm gegenüber eigentlich haben, nicht mehr gerecht wird, indem er darauf hinweist, dass die Bürger ja zur Tafel gehen können. Denn genau das wird ja teilweise gemacht von den staatlichen Stellen. Selke: Es ist gut, dass Sie darauf hinweisen, denn ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich eben nicht nur der große Tafelkritiker bin, sondern dass ich versuche, Gesellschaftskritik am Beispiel der Tafeln zu üben. Man kann an folgendem Beispiel sehr gut erkennen, dass sich etwas verändert hat: Bei den Arbeitsagenturen, den Jobagenturen wird man mittlerweile direkt auf die Tafeln hingewiesen. Bei Hartz-IVSanktionen und -kürzungen um 30 oder gar 60 Prozent werden die Menschen direkt auf die Tafeln verwiesen mit dem Hinweis: "Das, was wir Ihnen jetzt kürzen, das holen Sie sich bei der Tafel." Kaiser: Das hat schon etwas Zynisches an sich. Selke: Das ist selbstverständlich zynisch, aber das ist eben auch Praxis, denn das sind keine Einzelfälle mehr. Vor drei, vier Jahren, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, waren das noch Einzelfälle: Ich wurde dann kritisiert dafür, dass ich das kritisiere. Aber mittlerweile haben einige Leiter von Jobcentern in Presseerklärungen bereits zugegeben, dass sie auf die Tafeln verweisen. Der neue Imperativ in unserem Land lautet also: "Wenn du ein Problem hast, dann geh doch zur Tafel." Hier gibt es eine Durchlässigkeit von Staat und Zivilgesellschaft, die zu kritisieren ist: Das ist der eigentliche Punkt, diese Selbstverständlichkeit, mit der die Tafeln auch in Anspruch genommen werden, indem sie eine Platzhalterfunktion übernehmen. Man könnte fast sagen, dass das ein ADACPannendienst-Effekt ist, wie ich das nenne: Man verlässt sich darauf und die Menschen werden von staatlichen Stellen dorthin geschickt. Letztlich ist das aber nichts anderes als eine schleichende Überforderung der bei diesen Tafeln engagierten Menschen. Deswegen ist die Kritik, die ich übe, ein Stück weit auch ein Schutz dieser Leute. Ich plädiere nämlich dafür, dass die Tafeln nicht so sehr in Anspruch genommen werden und dass es eine Grenzziehung gibt. Kaiser: Was sind denn Ihre konkreten Forderungen? Wir könnten diesbezüglich auch ein riesengroßes Fass aufmachen, was ich jedoch nicht möchte. Ich würde Sie lediglich bitten, kurz zu formulieren, was die Politik tun muss, damit die Tafeln nicht diese breite Funktion, diese verlässliche Funktion einnehmen, sondern dass die Politik selbst bei diesen Menschen vor Ort wieder ankommt und ihnen hilft, wie das im Sozialstaat eigentlich vorgesehen ist. Selke: Ich habe ja das "Kritische Aktionsbündnis 20 Jahre Tafeln" gegründet, und zwar als eine Art Gegenbewegung zur Tafelbewegung. Die Forderungen, die wir in diesem Aktionsbündnis stellen, sind ganz einfache Dinge. Ich plädiere z. B. seit Jahren dafür, dass es für Tafeln keine Schirmherrschaften von Politikern oder Ministerien mehr geben darf. In Deutschland ist es so, dass die Bundes-Tafeln alle vom obersten Ministerium, also vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschirmherrschaftet werden. Dies sendet an die Bevölkerung und an die Aktiven der Tafel-Bewegung ein Signal aus, das ich für fatal halte. Auf kommunaler Ebene und auf Landesebene funktionieren diese Schirmherrschaften natürlich ganz genauso. Die Tafeln sollten sich also ein Stück weit davon emanzipieren und sagen: "Wir als Tafel brauchen diese Schirmherrschaften gar nicht für unser Engagement." Denn mittlerweile brauchen sie diese Art von "Unterstützung" tatsächlich nicht mehr. Das wäre das Signal an die Politik: "Wir wollen uns nicht permanent instrumentalisieren lassen, reinziehen lassen!" Die Politik wiederum sollte endlich ernsthaft über wirklich diskriminierungsfreie und auch auskömmliche Mindestsätze nachdenken, denn das, was den betroffenen Menschen zum Leben, zu ihrem Glück fehlt, ist nicht viel. Das ist nicht der Griff nach den Sternen. Die Menschen sind nämlich nicht maßlos – jedenfalls nicht in dieser Schicht –, sondern sie brauchen nur ein bisschen mehr Geld. Ich glaube, das kann sich unser Staat wirklich leisten. Kaiser: Sie fordern also eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze? Selke: Genau. Und die Diskussion, dass hier jede Erhöhung nur dazu führt, dass damit die Ansprüche immer noch weiter steigen, halte ich für ein Stück weit zynisch. Diese Menschen wären sehr froh, wenn sie wenigstens ein bisschen mehr Geld in der Tasche hätten. Kaiser: Das kann mit einem Mindestlohn erreicht werden, der nicht immer ständig aufgestockt werden muss von staatlichen Stellen. Selke: Ja, es gibt ja schon die ersten vorsichtigen Tastversuche in dieser Richtung. Im Hinblick auf den dritten Akteur, nämlich auf die Wirtschaft, würde ich dafür plädieren, das Engagement für die Tafeln nicht immer so maßlos – denn ich halte das in der Tat für maßlos – und spektakulär als riesengroßes gesellschaftliches Engagement auszuweisen, um davon abzulenken, wie und nach welchen Regeln das eigentliche Kerngeschäft abläuft. Kaiser: Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen? Wenn man sich nämlich Ihre Biografie anschaut, dann müssten Sie jetzt eigentlich im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum oder gar bei der NASA sitzen, denn Sie sind erst in einem zweiten Studiengang Soziologe geworden. Davor haben Sie nämlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ganz objektiv gesehen sind das eigentlich zwei Studiengänge, die überhaupt nicht zueinanderpassen. Selke: Nun ja, vielleicht hilft einem der Überblick, den man hat, ja doch, dieser Überblick, den man bekommt, wenn man die Fliegerei liebt. Denn so geschah mein Einstieg in die Luft- und Raumfahrttechnik. Der Abstand zu den Dingen und die Distanz helfen also sehr wohl. Die Sozialwissenschaften und speziell die Soziologie haben ja eine sehr wichtige Methode, und die lautet ganz schlicht: Abstand zu den Dingen gewinnen und halten! Es braucht in der Soziologie eben diese richtige Mischung aus Distanz und Engagement. Das ist auch beim Thema "Tafeln" sicherlich sehr wichtig. An dieser Mischung muss man immerzu arbeiten. Ich habe mich einfach aus biografischen Gründen noch einmal umentschieden und habe das auch nie bereut. Ich fand die Fliegerei immer toll, aber Luft- und Raumfahrttechnik hat mit der Fliegerei so viel zu tun wie die Meeresbiologie mit der Fliegerei, nämlich gar nichts. In der Luft- und Raumfahrttechnik konstruiert man sehr arbeitsteilig einen Airbus oder so – das war damals gerade "in" –, aber das wollte ich nicht. Mich haben dann die Themen Gesellschaft und Menschen doch mehr interessiert und deswegen habe ich dann noch Soziologie studiert, die dann auch wirklich meine große Leidenschaft geworden ist. Aber die Distanz aus der Fliegerei hilft einem schon auch immer ein bisschen. Kaiser: Sie haben mir vor der Sendung erzählt, dass Sie auch immer wieder einmal mit Ihrem Segelflieger in die Luft gehen, um sich die Welt auch mal von oben anzuschauen. Sie sind seit 30 Jahren begeisterter Segelflieger. Selke: Genau, als ich Punkt 18 Jahre alt wurde, habe ich mein ganzes Geld zusammengekratzt und den Segelfliegerschein gemacht. Ab da durfte ich das nämlich, davor hatten mir meine Eltern das Fliegen verboten. Ich ging also in eine Flugschule und habe Fliegen gelernt. Das mache ich auch bis heute, soweit das möglich ist, denn die Zeit dafür wird immer noch ein bisschen knapper. Das Segelfliegen ist erstens ein sehr schöner, sehr ästhetischer und auch sehr umweltfreundlicher Sport, und es verschafft mir zweitens auch einen ganz klaren Blick. Kaiser: Sie sind auch sehr erdverbunden, sehr schollenverbunden, denn Sie sind im Südwesten der Bundesrepublik geboren, nämlich in Rheinfelden, und leben heute in Furtwangen; Sie sind im Prinzip der Region treu geblieben. Aber Sie haben auch mal einen weiten Ausflug gemacht, nämlich nach Brasilien, wo Sie ein oder zwei Jahre gelebt haben. Warum das? Selke: Ich sollte davor vielleicht ganz kurz sagen, dass zwischen der Geburt in Rheinfelden und Furtwangen noch ungefähr zehn andere Orte lagen, in denen ich gelebt habe. Es war vielmehr ein großes Zurückkehren in diese Region. Aber es stimmt schon, letztlich bin ich dort wieder gelandet. Zu Brasilien: Ich hatte während des Flugzeugbaustudiums einen Brasilianer kennengelernt, der mir eines Tages eine Postkarte geschrieben hat. Das war alles lange vor Facebook und Internet usw. Er schrieb mir, dass er mit seinem Studium jetzt fertig sei und ob ich nicht Lust hätte, nach Brasilien zu kommen. Ich reiste nach Brasilien und wollte dort eigentlich nur vier Wochen bleiben, blieb aber letztlich ein ganzes Jahr in dieser Familie und freundete mich in der Zeit ein bisschen mit der brasilianischen Kultur an. Das war also überhaupt nicht geplant und ich vermute mal, heute kann man es in unserer so effizienzverliebten Kultur nicht mehr bringen, dass man vier Wochen einfach mal auf ein Jahr ausdehnt. Kaiser: Sie sind verheiratet und Sie haben etwas gemacht, was Männer nur selten machen, obwohl man es vom Namensrecht her schon relativ lange machen kann: Sie haben den Namen Ihrer Frau angenommen. Das kommt bis heute nur sehr selten vor, in der Regel nimmt die Frau den Namen des Mannes an. Bei Ihnen jedoch ist es umgekehrt gewesen, Ihr Geburtsname lautet Guschker. Warum haben Sie diesen Wechsel gemacht? Selke: Zunächst einmal war das eine Sache von gerade mal drei, vier Minuten. Ich habe mich sehr spontan und ziemlich schnell dazu entschieden. Ich fand erstens die Kombination mit meinem Vornamen sehr schön: Stefan Selke. Aber der eigentliche Grund war, dass die Familienhistorie meiner Frau sehr interessant ist: Sie ist in Kabul in Afghanistan geboren. Sie ist Deutsche, denn ihre Eltern waren damals dort Entwicklungshelfer und ihr Vater ist dann unter ganz dramatischen Umständen in Kabul gestorben. Die Mutter lebte mit ihren beiden kleinen Töchtern zunächst noch weiter in Kabul und kam dann nach Deutschland zurück. Ich habe mich sehr stark mit dieser Familiengeschichte identifiziert und vielleicht war das auf meiner Seite auch der Versuch, da noch etwas am Leben zu halten. Ich fand diese Familiengeschichte jedenfalls sehr toll und ein Stück weit hat mich die sehr außergewöhnliche Geschichte so fasziniert, dass ich dann sofort gesagt habe: "Diesen Namen will ich auch tragen!" Kaiser: Haben Sie es irgendwann einmal bereut? Selke: Nein, ich habe das nicht bereut. Es gab allerdings immer Probleme mit meinem Vater, der einfach aus einer ganz anderen Generation stammte und der es nie verstanden hat, dass ich als sein Erstgeborener den Familiennamen nicht weitertrage. Aber ich gehöre definitiv einer anderen Generation an und bin vielleicht auch durch mein Studium auf diesem Gebiet ein bisschen freier im Denken geworden, was Lebensformen und das Zusammenleben und eben auch solche Dinge wie den Familiennamen betrifft. Ich habe darin also weniger einen Tabubruch gesehen, sondern eher die Symbolik, wie ich sie gerade beschrieben habe. Kaiser: Die Hochschule Furtwangen, an der Sie lehren und forschen, ist ja eine kleine Hochschule und nicht so bekannt wie andere Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Aber diese Hochschule scheint Ihnen viele Freiheiten zu geben: Das Thema "Tafel" haben Sie ja im Rahmen Ihrer Professur an der Hochschule zusammen mit Ihren Studenten entwickelt und erforscht. Und Sie bearbeiten noch ein weiteres Thema, das in Deutschland relatives Neuland darstellt, obwohl das jeder nun langsam irgendwie kennt: Wer Facebook kennt, weiß, dass es dort immer mehr Menschen gibt, die darin wirklich ihr komplettes Leben ausbreiten. Ich kann mir vorstellen, dass das aus soziologischer Sicht höchst interessant ist. Ihr Forschungsprojekt dazu nennt sich "Lifelogging" und "SelfTracking". Können Sie in wenigen Worten erklären, was das jeweils bedeutet? Selke: Vielleicht darf ich davor noch kurz sagen, dass die Hochschule Furtwangen einst aus einer Uhrmacherschule entstanden ist. In Furtwangen wurde u. a. die Kuckucksuhr erfunden! Aus dieser Uhrmacherschule und ihrer 150-jährigen Tradition hat sich die heutige Hochschule entwickelt. Sie ist tatsächlich sehr, sehr open minded, wie man auf Neudeutsch sagt, und fördert eben auch so verrückte Themen wie meine Themen und die meiner Kollegen, wie es nur möglich ist. Kleine Hochschulen haben da wirklich einen Vorteil, denn sie müssen innovativ sein, um zu überleben, und deswegen fördern sie dann eben auch innovative Dinge. Lifelogging, wie ich das nenne, ist die Idee, sein eigenes Leben digital zu protokollieren. Im analogen Zeitalter kannten wir das ja in ähnlicher Form auch schon: Die Menschen schrieben Tagebücher, stellten sich auf die Waage, maßen ihr Gewicht und trugen es in langen Tabellen ein usw. So etwas kann man ja nun mit den neuen digitalen Medien intensiv betreiben. Kaiser: Das ist viel einfacher geworden. Selke: Ja, viel einfacher. Man kann das heute viel intensiver, automatischer und unbewusster machen. Mittlerweile gibt es ja sehr viele Technologien dazu, mit denen man sich umgeben kann, die smartphonebasiert sind und die alles Mögliche messen, tracken, loggen, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist eben auch ein Aspekt des gesellschaftlichen Wandels, den ich untersuche. Mein Thema ist also der gesellschaftliche Wandel. Die Tafeln stehen dabei für den sozialen und politischen Wandel, und das Lifelogging ist für mich ein Synonym für den technologischen und medialen Wandel, den wir im Moment durchlaufen. Kaiser: Viele unserer Zuschauer sind ja auch auf Facebook vertreten und posten dort verschiedenste Dinge. Es ist aber nur ein Teil der Wahrheit, dass sich da jemand quasi exponiert darstellt und auch keine Scheu hat, jeden Tag z. B. die eigenen Urlaubsbilder dort einzustellen. Denn das, was Sie mit Lifelogging untersuchen, ist, dass da jemand im Prinzip mit einer Kamera drei Bilder pro Minute macht: Auf diese Weise dokumentiert er sein Leben mit Hunderttausenden von Bildern. Ich kann da nur ganz naiv fragen: Was ist dabei der Sinn? Selke: Eine dieser Kameras ist z. B. von Microsoft entwickelt worden, und zwar in Großbritannien. Der Entwickler Gordon Bell hat diese Kamera in ein Gesamtkonzept integriert, das er "Total Recall" nennt, also "totale, umfassende Erinnerung". Die Grundidee bei diesem Lifelogging ist: Man weiß ja nie, was wichtig wird. Und nur dann, wenn man alles aufnimmt, hat man die Sicherheit, das eigene Leben irgendwann einmal sozusagen wie früher bei einem Videorekorder zurückspulen zu können, um sich die Szene herauszusuchen, die sich erst viel später als die entscheidende erwiesen hat. Ein sehr schönes Beispiel, das diese Idee deutlich macht, ist Folgendes: Einer dieser Entwickler hat tatsächlich mehrere Fotos von seinem ersten Date mit seiner heutigen Frau gemacht. Das ist ja ein nicht so ganz unwichtiger Moment im Leben von uns Menschen: "Wo waren wir, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Wo haben wir uns ineinander verliebt?" Normalerweise macht man in so einer Situation nicht mal eben schnell ein Foto auf Verdacht. Er aber hatte diese Lifelogging-Kamera und so können sich beide diesen damaligen Moment in einem 30-Sekunden-Takt heute jederzeit erneut anschauen. Ob man das braucht, ist eine ganz andere Frage, aber die Argumentation der Entwickler dieser Kamera lautet eben, dass man eine private Datenvorratsspeicherung betreiben kann – in der Hoffnung, irgendwann einmal darauf zurückgreifen zu können, wenn man dann weiß, was wichtig gewesen ist. Kaiser: Vielleicht bin ich da auch nur hoffnungslos altmodisch, aber ich habe in der Schule noch "1984" von George Orwell gelesen – alleine schon der Titel zeugt davon, dass dieses Buch sehr, sehr alt ist. In diesem Buch wird jedenfalls die schreckliche Fiktion von komplett kontrollierten Menschen beschrieben. Das Lifelogging und das Self-Tracking – das sind Apps, die z. B. zu jeder Sekunde den eigenen Puls messen und aufzeichnen – ist ja für mich etwas, das weit über George Orwells schreckliche Vision hinausgeht. Selke: Ja, aber da gibt es nicht mehr diesen "großen Bruder" wie bei Orwell, sondern diese vielen "kleinen Schwestern". Das Interessante daran ist ja, dass wir uns über NSA und solche Dinge wahnsinnig aufregen, dass wir uns also darüber aufregen, dass wir überwacht werden von etwas, was wir nicht so genau fassen können – auf jeden Fall müssen das Jungs sein, die ziemlich gutes Spielzeug haben. Und gleichzeitig machen das immer mehr Leute von sich aus: Sie liefern freiwillig ihre Daten! Wir nennen das dann "flüssige Überwachung". Wobei man aber sagen muss, dass nicht jeder, der Lifelogging oder Self-Tracking macht, diese Daten auch veröffentlicht. Viele machen das nur für sich und diese Daten verbleiben nur bei ihnen auf der Festplatte. Nur sie selbst können dann später diese Daten auf irgendwas hin untersuchen. Kaiser: Außer die NSA "besucht" den Computer daheim. Selke: Ja, außer die NSA schaut da so ein bisschen mit. Aber es gibt eben schon auch diesen exhibitionistischen Aspekt, der darin besteht, dass man alle möglichen privaten Daten auf Portalen mitteilt und mit andern darüber kommuniziert. Die Frage ist also, wohin dieser Trend geht: Machen das immer mehr Menschen öffentlich, teilen – auf Neudeutsch heißt das "sharen" – immer mehr Menschen ihre Daten mit anderen oder wird das nur für sich als so eine Art von digitalem Tagebuch betrieben? Ich glaube, man kann bereits sagen, dass der Trend in Richtung dieser Transparenz, in Richtung öffentlicher Einsehbarkeit dieser Daten geht. Damit sind wir dann in der Situation, in der wir freiwillig selbst Daten rausrücken. Und das ergibt eben doch eine gewisse Diskrepanz zu der Aufregung in Sachen Ausforschung durch die NSA vor einigen Wochen. Kaiser: Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Generationenfrage ist. Man muss sich ja nur einmal die heutigen Kinder und Jugendlichen anschauen, mit welcher Selbstverständlichkeit sie mit all diesen Smartphones, iPads usw. aufwachsen. Wir beide mit plus/minus 50 sind da doch noch ganz anders aufgewachsen, nämlich noch analog und nicht digital. Selke: Ja, hier spielt der biografische Einfluss natürlich auch eine sehr starke Rolle. Ich bin noch jemand, der z. B. Bücher aus Papier mag und keine E-Books liest. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn die Generation der Digital Natives, wenn also die "digitalen Eingeborenen" viel selbstverständlicher mit all diesen Dingen umgehen. Trotzdem besteht meiner Meinung nach immer noch unsere Aufgabe darin, davor zu warnen und zu fragen, welchen Preis wir dafür bezahlen, was wir dafür aufgeben müssen. Wir geben dafür z. B. ein Stück weit auf, dass wir ein normales, gesundes Körpergefühl haben: Wir verlassen uns auf Daten, die uns sagen, dass man sich jetzt gerade schlecht fühlt. Wir verlassen uns auch nicht mehr auf unser räumliches Orientierungsvermögen, sondern wir verlassen uns auf unser Navi: Dieses Beispiel kennt wirklich jeder. Das heißt, es geht immer auch etwas verloren, wenn man solche Technologien zu umfänglich einbaut in die Lebensführung. Das ist der Punkt, den ich versuche zu untersuchen. Es ist nicht alles schlecht, was sich hier an Entwicklung abspielt, aber wir müssen doch wissen, was wir dafür alles aufgeben. Kaiser: Diese Entwicklung fing ja schon ganz früh an. Ein ganz banales Beispiel dafür waren diese ersten Taschenrechner in den 70er Jahren. Bis dahin hat man noch im Kopf gerechnet oder höchstens den Rechenschieber verwendet. Je mehr technischen Ersatz man hat, umso schwererfällt es einem dann, Dinge zu machen, die früher völlig normal waren. Ein anderes Beispiel ist das Schreibprogramm am Computer: Mir geht es ja auch so, dass ich mich darauf verlasse, dass mir mein Schreibprogramm sagt, was richtig ist. Selke: Das ist auch in der Tat das Argument der Entwickler von solchen Dingen. Sie sagen nämlich: Je mehr wir aus unserem Kopf rausbekommen und in die Maschine, in die Blackbox auslagern können, desto kreativer können wir sein. Das ist aber nur eine Behauptung. Und ich glaube, dass das so nicht funktionieren wird: Wenn der Kopf leer ist, wird nicht mehr viel gehen. Stellen Sie sich vor, wir verlagern unsere Erinnerungen komplett in die Maschine: Was bleibt dann eigentlich noch von uns? Kaiser: Vielleicht wird es eines Tages auch mal eine Generation geben, die eine ganz bewusste Rückbesinnung betreiben wird, die wieder Abstand nimmt von diesen vielen technischen "Helferlein". Selke: Es gibt heute schon Gegenmodelle, es gibt heute schon Menschen, die sehr bewusst z. B. analog fotografieren und daher sehr bewusst nur wenige Fotos machen; Menschen, die malen, statt überhaupt zu fotografieren; die wieder mit der Hand schreiben usw. Das zeigt ja, dass es doch ein Bedürfnis nach diesen grundlegenden nicht digitalen, sondern analogen Technologien und Techniken gibt. Denn das trägt eben auch ein Stück weit zur Persönlichkeitsbildung bei bzw. trägt auf eine andere Art und Weise dazu bei. Kaiser: Herr Professor Selke, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich würde Sie bitten, im Hinblick auf das Thema "Tafel" noch einmal ganz kurz zu sagen, was Sie sich von einer verantwortungsvollen Politik wünschen, damit die Tafeln tatsächlich eher ein vorübergehendes als ein dauerndes Phänomen sind. Selke: Ich würde mir wünschen, diese Zahlenfixiertheit aufzugeben und eine Lebensweltorientierung zu implementieren. Und das heißt eben, dass man verstärkt mit den betroffenen Menschen spricht, auch darüber, wie es sich anfühlt, mitten im Reichtum arm zu sein. Armut ist eben keine Schuld einzelner Personen, sondern ein strukturelles Problem und auch ein politisch verursachtes Problem. Diese Einsicht würde ich mir wünschen. Kaiser: Dann sagen ich vielen Dank für diese informativen 45 Minuten, die wir miteinander verbracht haben. Vielen Dank, dass Sie zu uns nach München ins Studio gekommen sind. Das war heute Professor Stefan Selke, Soziologe an der Hochschule Furtwangen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. © Bayerischer Rundfunk