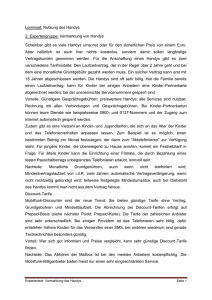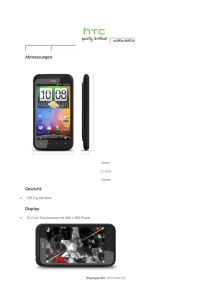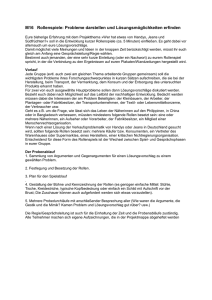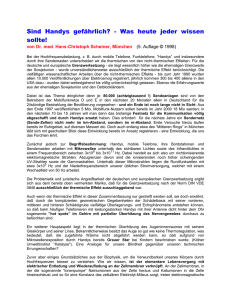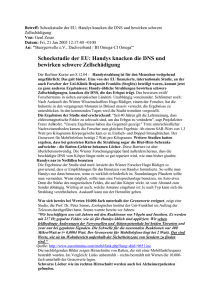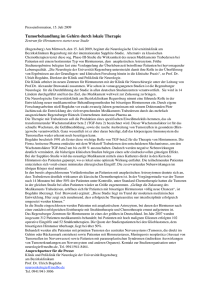Hirntumoren – gesundheitliches Risiko durch Nutzung von Handys?
Werbung

Hirntumoren – gesundheitliches Risiko durch Nutzung von Handys? PD Dr. Joachim Schüz Institut für M edizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IM BEI) der Johannes Gutenberg-Universität M ainz Einleitung Die Epidemiologie befasst sich mit der regionalen und zeitlichen Verteilung und Verbreitung von Krankheiten in der Bevölkerung und mit denjenigen Faktoren, die diese Verteilung ursächlich beeinflussen. Epidemiologie umfasst somit sowohl die reine Beschreibung von Krankheitsverteilungen (deskriptive Epidemiologie) als auch gezielte Ursachenforschung, meist im Rahmen von Beobachtungsstudien (analytische Epidemiologie). Epidemiologische Studien belegen in erster Linie eine statistische Assoziation. Sie sind damit ein Bestandteil des Nachweises einer Ursache-Wirkungs-Beziehung, als alleiniger Bestandteil sind sie allerdings meist nicht ausreichend. Beobachtungen aus epidemiologischen Studien werden gestärkt, wenn Ergebnisse kontrollierter experimenteller Forschung in die gleiche Richtung deuten und/oder eine biologisch plausible Erklärung für die Beobachtung bekannt ist. Epidemiologische Studien bilden reale Situationen ab, d.h. eine Exposition wird unter Alltagsbedingungen an denjenigen M enschen untersucht, die dieser Exposition auch tatsächlich aus gesetzt sind. Einige Studien am M enschen sind im Labor garnicht möglich und die Übertragbarkeit der Beobachtungen von Tier auf M ensch ist nicht immer gesichert. Epidemiologische Forschung hat zudem den Vorteil, dass die Bedeutung eines Effektes auf Bevölkerungsebene abgeschätzt werden kann. Eine Bewertung der epidemiologischen Evidenz wird nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen. Zu diesen gehören die Stärke der Assoziation, die Konsistenz innerhalb einer Studie und über verschiedene Studien hinweg, die Beschreibung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung sowie die inhaltliche Plausibilität der Ergebnisse, insbesondere nach Ausschluss alternativer Erklärungen für empirische Zusammenhänge, die meist methodischer Natur sind (Kriterien formuliert von Hill, 1965). Ein besonderes Problem bei der Interpretation von Zusammenhängen stellt sich dann dar, wenn epidemiologische Zusammenhänge nicht durch experimentelle Studien gestützt werden. Dann kann es sein, dass die Epidemiologie ein früher Indikator für einen Zusammenhang ist, der im Labor deshalb nicht repliziert werden konnte, weil die Wirkmechanismen unbekannt sind. Es kann aber gleichfalls sein, dass der empirisch beobachtete Zusammenhang nicht kausaler Natur ist, weil er zum Beispiel durch einen Drittfaktor vorgetäuscht wurde. Bei der Bewertung des Hirntumorrisikos durch die Nutzung von Handys stehen epidemiologische Studien im Vordergrund. Gleichzeitig werden im experimentellen Bereich Zellstudien und Tierstudien durchgeführt, die Kenntnisse über mögliche M echanismen erbringen sollen, sofern sich ein Zusammenhang zwischen Handynutzung und Tumorrisiko zeigt. Nur im Zusammenspiel der Forschungsdisziplinen kann, falls vorhanden, der Nachweis erbracht werden, dass die hochfrequenten elektromagnetischen Felder der Handys bei der Tumorentstehung eine Rolle spielen. Neuerkrankungsraten an Hirntumoren Die Entwicklung der Neuerkrankungsrate des Akustikusneurinoms in Schweden zwischen 1960 und 1998 zeigt auf der Basis von mehr als 2.000 Fällen einen jährlichen Anstieg an Neuerkrankungen von 2.5% (1). Dieser Tumor ist hinsichtlich des M obilfunks von besonderem Interesse, da er in demjenigen Gehirnareal entsteht, in welchem ein Großteil der vom Handy emittierten Strahlung absorbiert wird. Eine genauere Betrachtung der Neuerkrankungsraten zeigt jedoch weniger einen kontinuierlichen Anstieg der Inzidenz als vielmehr einen „Sprung“ zwischen 1982 und 1984. M ögliche Ursache hierfür ist eine verbesserte 1 Diagnostik durch die Einführung der Kernspintomografie (M RT). Bei der Evaluation der Neuerkrankungsraten von Gliomen und M eningeomen in Dänemark zwischen 1943 und 1997 zeigt sich eine erhebliche Zunahme dieser Hirntumoren, die vermutlich ebenfalls auf verbesserte Diagnostik zurückzuführen ist (2). Während bei den Gliomen Anfang der 90er ein Plateau erreicht wurde, nimmt die Anzahl der M eningeomfälle weiter zu. Hinsichtlich des M obilfunks ist eine weitere Beobachtung der Raten angezeigt. Weil in den Anfangsjahren des M obilfunks viel mehr M änner als Frauen mobil telefonierten und die meiste Strahlung von temporal gelegenen Gehirnarealen absorbiert wird, sind (unter der Annahme eines Risikos) auch Verschiebungen beim Geschlechter-Verhältnis oder der Verteilung der Tumorlokalisationen denkbar. Für Deutschland wird geschätzt, dass jährlich etwa 14.000 Personen neu an einem Hirntumor erkranken. Die Aussage ist jedoch mit einer hohen Unsicherheit behaftet, da in den wenigen vollzähligen Krebsregistern gutartige Hirntumoren gar nicht oder nicht systematisch erfasst werden (3). Hirntumoren sind der häufigste solide Tumor im Kindesalter. Von 100.000 Kindern unter 15 Jahren erkranken in Deutschland jährlich etwa 2,9 Kinder an einem Hirntumor (4). Wissenschaftliche S tudien zur Fragestellung Eine dänische, retrospektive Kohortenstudie ist auf Grund der großen Studienpopulation und ihrer Repräsentativität für die Bevölkerung besonders aussagekräftig (5). Die Studie umfasste alle Dänen, die zwischen 1982 und 1995 ein Handy auf ihren Namen angemeldet hatten. Aus der von den M obilfunkbetreibern zur Verfügung gestellten Namensliste mit mehr als 723.000 Personen wurden aus dem Abgleich mit dem dänischen Bevölkerungsregister Anmeldungen von Firmenhandys gestrichen (etwa 200.000) sowie die Kohorte um Duplikate, Fehler und ähnliches bereinigt. Letztendlich bestand die Kohorte, die mit dem dänischen Krebsregister abgeglichen wurde, aus etwa 420.000 Teilnehmern. In der Kohorte hatten 7% der Teilnehmer ihr Handy drei Jahre oder länger angemeldet. Bezüglich der Hirntumoren ergab sich weder eine Assoziation mit digitalen noch mit analogen Handys. Die Studie ergab ferner in der Kohorte der Handy-Besitzer erniedrigte Raten von solchen Krebserkrankungen, die bekannterweise mit Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum und ungesunder Ernährung assoziiert sind, z.B. Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs oder M agenkrebs. Insofern belegt diese Studie, dass die Gruppe der frühen Handy-Besitzer in Charakteristika wie Bildungsstand, sozioökonomischem Status und den gewählten beruflichen Tätigkeitsfeldern von der Allgemeinbevölkerung abweicht. Die leicht erhöhten Raten für Hodentumoren und Brustkrebs bei Frauen sind mit Vorsicht zu interpretieren. Da diese Krebserkrankungen in Dänemark in höheren sozialen Schichten häufiger auftreten, liegt dieser Anstieg vermutlich in dem umgekehrten Effekt wie die Risikoreduktion für die Lebensstil-assoziierten Tumoren begründet. Eine Limitierung dieser großen Kohortenstudie ist der Aufbau der Kohorte auf Netzbetreiber-Daten zu Handy-Vertragsnehmern. Zum einen muss der Vertragsnehmer nicht mit dem tatsächlichen Nutzer des Handys übereinstimmen, was zu einer Vermischung der exponierten Kohorte mit der nicht-exponierten Allgemeinbevölkerung geführt haben kann. Andererseits mussten Firmen als Vertragsnehmer aus geschlossen werden, was somit gerade zu einem Ausschluss intensiv exponierter Personen geführt haben kann. Die Aussagekraft der dänischen Kohortenstudie ist ebenfalls vor allem durch die vorwiegend eher kurze Nutzungszeit, vor allem was die digitale M obilfunk-Technik betrifft, begrenzt. M ehr als zwei Drittel der Teilnehmer hatten einen Beobachtungszeitraum von weniger als 2 Jahren. Und obwohl die Studie alle Handy-Nutzer der dänischen Bevölkerung umfasste, waren die Fallzahlen für Risikoberechnungen für seltene Tumorerkrankungen oder morphologische Subgruppen relativ klein. Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass für eine amerikanische Kohortenstudie aus Handy-Nutzern, die auf Grund eines Rechtsverfahrens unterbrochen werden musste, die Sterberaten an Hirntumoren als Auswertungsschwerpunkt 2 vorgesehen waren (6). Im kurzen Beobachtungszeitraum von nur einem Jahr traten jedoch lediglich vier Sterbefälle an einem Hirntumor unter den Nutzern der „nonhandheld“ M obiltelefone und 2 Sterbefälle unter Nutzern der „handheld“ M obiltelefone auf, was keine Interpretation der Ergebnisse zulässt. Bislang wurden ins gesamt fünf Fallkontrollstudien zu Handys und dem assoziierten Hirntumorrisiko durchgeführt, davon zwei in den U SA, eine in F innland und zwei in Schweden (von der gleichen Forschergruppe). Bei den Fallkontrollstudien wurden die früheren Expositionen von Hirntumorpatienten (=Fälle) denen einer repräsentativen Zufallsauswahl nicht an einem Hirntumor erkrankter Personen aus der Allgemeinbevölkerung (=Kontrollen) gegenübergestellt. Die erste epidemiologische Studie zu einem möglichen Zusammenhang zwischen der Benutzung von Handys und dem Auftreten von Hirntumoren in Schweden umfasste 209 Fälle und 425 Kontrollen (7). Die Benutzung der Handys wurde per selbstauszufüllendem Fragebogen erhoben. Es zeigte sich keinerlei Assoziation zwischen der Dauer oder Intensität der Handynutzung und dem Hirntumorrisiko. Bei einer Unterteilung nach analogen Handys und digitalen Handys zeigten sich praktisch keine Unterschiede in den Risikoschätzern. Bei der Interpretation der Ergebnisse wird die Übereinstimmung zwischen der Lateralität des Tumors und der Kopfseite, an die das Handy vorwiegend gehalten wurde, hervorgehoben. Da ins gesamt gesehen kein Risiko vorlag, bedeutet die Beobachtung der Seitenübereinstimmung auch, dass unter Handy-Nutzern Tumoren seltener als erwartet in der Kopfmitte oder auf der der Handy-Nutzung gegenüberliegenden Kopfseite auftraten. Dies könnte eher ein Hinweis auf ein Artefakt des Befragungsinstrumentes sein. Da die Ergebnisse auf sehr kleinen Fallzahlen beruhen, kann schon die M issklassifikation der Seitenangabe der Handy-Nutzung von sehr wenigen Teilnehmern einen Effekt auf die Ergebnisse gehabt haben. In der nach gleicher M ethodik durchgeführten Nachfolgestudie wurden Daten zu 1.303 FallKontroll-Paaren aus gewertet (8). Es wurde ein auf die analogen (nicht-pulsmodulierten) Handys beschränktes erhöhtes Risiko beobachtet, das vor allem die Akustikusneurinome betraf. Ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko zeigte sich hierbei nach einer mehr als zehnjährigen Handy-Nutzung. Ein derart langer Expositionszeitraum konnte in allen anderen Studien nicht analysiert werden. Die schwedische Studie steht allerdings methodisch in der Kritik. Weil sie sich auf prävalente Krebsfälle bezog, waren viele der Patienten vor Studiendurchführung bereits verstorben. Ferner war die Durchführung der Befragung wie in der ersten Studie nicht optimal und eine Risikoüberschätzung als Artefakt durch das Antwortverhalten der Probanden ist zu befürchten. Dennoch muss die schwedische Studie als Hinweis gewertet werden, dass die Latenzzeit bei der Fragestellung eine sehr wichtige Rolle spielt. In den amerikanischen Studien zeigte sich keinerlei Zusammenhang zwischen Handynutzung und Hirntumorrisiko (9-11). Die erste Studie umfasste 469 Fälle und 422 Kontrollen. In einer Erweiterung zu Akustikusneurinomen konnten weitere Daten zu 90 Fällen und 86 Kontrollen ausgewertet werden. Bei der Seitenübereinstimmung trat der Tumor tendenziell häufiger auf der der Handy-Nutzung gegenüberliegenden Kopfseite auf. Die Autoren vermuteten dabei ein Befragungsartefakt. Die zweite US-Fallkontrollstudie umfasste letztendlich 782 Patienten und 799 Kontrollpersonen. Als Exposition wurde die durchschnittliche tägliche Telefonierdauer, die Anzahl Jahre regulärer Handy-Nutzung, die kumulative Handy-Nutzung und das Jahr der ersten Handy-Nutzung betrachtet. Für die jeweiligen höchsten Expositionsklassen ergaben sich für alle Hirntumoren gemeinsam sowie Gliome und M eningeome getrennt durchgängig keine erhöhten Risikoschätzer. Die Tumoren traten auf der Seite des Kopfes, an die das Telefon vorwiegend gehalten wurde, nicht unverhältnismäßig häufiger auf. Nur 3% der Fälle und 4% der Kontrollen nutzten ihr Handy länger als fünf Jahre. Bei der finnischen Studie wurde das Konzept der Expositionsschätzung der dänischen Kohortenstudie auf eine Fallkontrollstudie übertragen, d.h. exponiert waren Vertragspartner der Netzbetreiber, sofern es sich beim Vertragspartner um eine Einzelperson handelte (12). 3 Die Expositionserhebung erfolgte über die Netzbetreiber ohne Kontakt zu den Studienteilnehmern. Die Fälle, ingesamt 398 im Diagnosejahr 1996, wurden aus dem finnischen bevölkerungsbezogenen Krebsregister selektiert. Über Populationsregister wurden pro Fall fünf alters- und geschlechtsgleiche Kontrollen gezogen. Für die meisten Tumortypen zeigte sich kein Zusammenhang des Erkrankungsrisikos mit dem Handybesitz. In der Untergruppe der Gliome zeigte sich bereits nach 1-2 Jahren Nutzung eines Handys eine Risikoverdopplung, ein Ergebnis, das jedoch im internationalen Vergleich isoliert dasteht. Die bisher eher vagen Erkenntnisse aus den abgeschlossenen Studien kommen nicht unerwartet. Da bereits früher vermutet wurde, dass Einzelstudien besonders für ausgewählte Tumortopographien oder –morphologien zum Nachweis eines (falls vorhandenen) eher kleinen Risikos nicht ausreichend wären, initiierte die WHO frühzeitig eine internationale Fallkontrollstudie mit einem einheitlichen Studienprotokoll. Für diese bis 2005 laufende, sogenannte Interphone-Studie wird angestrebt, 6000 Fälle mit Gliom, M eningeom oder Akustikusneurinom zu rekrutieren (13). Die große Studienpopulation erlaubt es, eine Charakterisierung des Tumors nach seiner spezifischen Lokalisation in unterschiedlich exponierten Gehirnarealen vorzunehmen. Als erster Bericht aus der Interphone-Studie wurden die Daten der dänischen Akustikusneurinom-Patienten veröffentlicht (14). M it 106 Fällen und 212 Kontrollen umfasst der dänische Studienteil etwa 10% der Studienpopulation der InterphoneStudie für das Akustikusneurinom. Das Erkrankungsrisiko war in diesem Studienteil nicht mit der Handy-Nutzung assoziiert. Tendenziell waren unter den Patienten sogar weniger intensive Handy-Nutzer, was sich jedoch durch die Symptomatik der Akustikusneurinom-Patienten erklären könnte, die teils schon Jahre vor der Diagnosestellung über Hörprobleme oder Ohrgeräusche klagten und deshalb vielleicht auf das Handy weit gehend verzichteten. Der Anteil von Langzeitnutzern mit Nutzungsperioden von 10 Jahren oder mehr war in der dänischen Studie jedoch zu gering, um belastbare Aussagen zu erzielen. Ergänzend soll darauf hingewiesen werden, dass in einer deutschen Fallkontrollstudie unter Handy-Nutzern ein erhöhtes Risiko für Uveamelanome (einen Augentumor) ermittelt wurde (15). Die Exposition wurde allerdings nur indirekt erhoben. Eine Folgestudie läuft. Die Auswertung der Daten der dänischen Kohortenstudie, bei der unter Handy-Besitzern weniger Augentumoren beobachtet wurden als erwartet, sowie eine Analyse zeitlicher Trends der Neuerkrankungsraten des Augenmelanoms in Dänemark konnten die Beobachtung aus der deutschen Fallkontrollstudie nicht stützen (16). Fazit Die Aussagekraft der bisherigen Studien ist nicht ausreichend, um das Risiko bei Langzeitanwendern mit sehr häufigem Handy-Gebrauch und potenziell langen Latenzzeiten zwischen Exposition und Erkrankung beurteilen zu können. Die meisten Fallkontrollstudien sowie die dänische Kohortenstudie lassen nur statistisch abgesicherte Aussagen für Nutzungszeiträume von unter fünf Jahren zu. Das Gesamtbild der Studien gibt für diesen relativ kurzen Zeitraum keine Hinweise auf eine Erhöhung des Hirntumorrisikos durch die Nutzung eines Handys. Zwar ergab sich in der finnischen Studie eine Verdopplung des Gliomrisikos nach bereits einbis zweijähriger Handy-Nutzung, dieser Befund wird aber durch die anderen Studien nicht unterstützt. Da das Ergebnis zudem nur auf etwa 20 exponierten Gliompatienten beruht, handelt es sich möglicherweise um einen Zufallsbefund. Bezüglich des Augenmelanoms gibt es derzeit zwei Studien mit ebenfalls kurzen Latenzzeiten und widersprüchlichen Ergebnissen. In einer deutschen Studie wurde ein dreifach erhöhtes Risiko festgestellt bei Personen, die beruflich ein Handy nutzten. In der dänischen Kohorte vorwiegend privater Handy-Nutzer traten nicht mehr Fälle mit Augentumoren auf als erwartet. Bei einer Gegenüberstellung des zeitlichen Trends der Verbreitung von Handys in Dänemark und der Neuerkrankungsraten an Augenmelanomen zeigte sich keine Korrelation. Zwar wurde die Neuerkrankungsrate nur für eine sehr kurze Zeitperiode nach der starken Ausbreitung der Handys weiterverfolgt (bis 4 1996), so dass auch hier keine Langzeitprognose möglich ist, die Expositionszeiten sind aber mit denen der deutschen Fallkontrollstudie vergleichbar. Da alle drei Studien die Thematik eher indirekt aufgegriffen haben, erscheint eine Abklärung eines möglichen Zusammenhangs mit einer gezielt für die Fragestellung konzipierten Studie angebracht. In der einzigen Studie, in der ein Nutzungszeitraum von zehn Jahren und länger verfolgt werden konnte, zeigte sich jetzt ein erhöhtes Risiko für temporal gelegene Tumoren, was vor allem auf Akustikusneurinome zurückzuführen war. Die Assoziation bestand nur mit der Nutzung von Handys nach analogem (nicht-pulsmodulierten) Standard, allerdings lag die Einführung digitaler Handys auch noch keine zehn Jahre zurück. Ob bei der beobachteten Assoziation auch die höhere Strahlung der analogen Handys in den weiter zurückliegenden Zeiträumen bedeutsam ist, kann noch nicht entschieden werden. Eine Aussage zu einem möglichen Krebsrisiko durch von M obilfunk-Basisstationen emittierten hochfrequenten elektromagnetischen Feldern kann auf Basis epidemiologischer Studien bisher nicht getroffen werden. Eine epidemiologische Studie zu chronischen Erkrankungen ist auf Grund der schwierigen Dosimetrie bei M obilfunk-Basisstationen zur Zeit nicht erfolgsversprechend. Eine retrospektive Studie ist nur machbar, wenn eine Expostionsmetrik definiert werden kann, die für große Studienpopulationen anwendbar ist (vor allem unter den Gesichtspunkten Kosten und Aufwand), die auch für lange zurückliegende Zeiträume historisch valide geschätzt werden kann, die das gesamte Spektrum hochfrequenter elektromagnetischer Felder umfasst und die für die Bildung von Expositionsgruppen genügend trennscharf ist. Eine Expositionsschätzung auf Basis der Distanz zur nächsten Basisstation erfüllt diese Kriterien eindeutig nicht. M essungen sind bei der schnellen Expansion des M obilfunks im Gegensatz zum Niederfrequenz-Bereich ebenfalls nicht für retrospektive Untersuchungen geeignet, für Studien zu akuten Erkrankungen oder Symptomen aber als M öglichkeit in Betracht zu ziehen (17). Obwohl der M obilfunk eine neue Technologie ist, gibt es in verschiedenen Umfeldern schon seit Jahrzehnten Expositionen mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Ein Hintergrundfeld ist durch Radio, TV und andere Funkanwendungen vorhanden, gerade im privaten Bereich kommen immer mehr Feldquellen hinzu (Schnurlostelefone, WLAN, im PKW). In beruflichen Anwendungen können Expositionsstärken auftreten, die die des Handys deutlich überschreiten (z.B. Hochfrequenz-Erhitzung). Solch exponierte Berufs gruppen waren ebenfalls bereits im Fokus epidemiologischer Studien, ohne dass sich bisher ein klarer Zusammenhang mit irgendeiner Krebserkrankung ergeben hätte. Bei Studien zu großen Sendeanlagen gibt es vereinzelte Hinweise auf eine erhöhte Neuerkrankungsrate an Kinderleukämie im direkten Umkreis der Sender, es fehlen bislang aber die systematischen Studien, um diese Hinweise zu erhärten oder zu entkräften. Eine aktuelle Übersicht u.a. auch zu diesen Forschungsschwerpunkten wurde vor kurzem veröffentlicht (18). Auf Grund ihres Vorteils, dass in epidemiologischen Studien meist ein breites Bevölkerungsspektrum unter Alltagsexpositionen beobachtet wird, sind epidemiologische Studien bei der wissenschaftlichen Beurteilung adverser Effekte vermeintlicher Risikofaktoren unverzichtbar. Die Schlussfolgerungen aus epidemiologischen Studien sind allerdings stets im Kontext der Erkenntnisse aus der experimentellen Forschung zu ziehen. Literatur: 1. Hardell L, Hansson Mild K, Sandström M, Carlberg M, Hallquist A, Pahlson A. Vestibular schwannoma, tinnitus and cellular telephones. Neuroepidemiology 2003; 22: 124-9 2. Christensen HC, Kosteljanetz M, Johansen C. Incidences of gliomas and meningiomas in Denmark, 1943 to 1997. Neurosurgery 2003; 52: 1327-33 3. Schüz J, Schön D, Batzler WU, Baumgardt-Elms C, Eisinger B, Lehnert M, Stegmaier C. Cancer registration in Germany: current status, perspectives and trends in cancer incidence 1973-93. J Epidemiol Biostat 2000; 5: 99-107 5 4. Kaatsch P, Rickert C, Kühl J, Schüz J, M ichaelis J. Population-based epidemiologic data on brain tumors in children. Cancer 2001; 92: 3155-64 5. Johansen C, Boice JD, McLaughlin JK, Olsen JH. Cellular telephones and cancer – a nationwide cohort study in Denmark. J Natl Cancer Inst 2001; 93: 203-7 6. Dreyer NA, Loughlin JE, Rothman KJ. Cause-specific mortality in cellular telephone users. JAMA 1999; 282: 1814-6 7. Hardell L, Nasman A, Pahlson A, Hallquist A, Mild KH. Use of cellular telephones and the risk for brain tumours: A case-control study. Int J Oncol 1999; 15: 113-6 8. Hardell L, Hallquist A, Mild KH, Carlberg M, Pahlson A, Lilja A. Cellular and cordless telephones and the risk for brain tumours. Eur J Cancer Prev 2002; 11: 1-10 9. Muscat JE, Malkin MG, T hompson S, Shore RE, Stellman SD, McRee D, Neugut AI, Wynder EL. Handheld cellular telephone use and risk of brain cancer. JAMA 2000; 284: 3001-7 10. Muscat JE, Malkin MG, Shore RE, Neugut AI, Stellman SD, Bruce J. Handheld cellular telephones and risk of acoustic neuroma. Neurology 2002; 58: 1304-6 11. Inskip PD, Tarone RE, Hatch EE, Wilcosky T C, Shapiro WR, Selker RG, Fine HA, Black PM, Loeffler JS, Linet MS. Cellular-telephone use and brain tumors. N Engl J Med 2001; 344: 79-86 12. Auvinen A, Hietanen M, Luukkonen R, Koskela RS. Brain tumors and salivary gland cancers among cellular telephone users. Epidemiology 2002; 13: 356-9 13. Cardis E, Kilkenny M. International case-control study of adult brain, head and neck tumours: results of the feasibility study. Radiat Protect Dosimetry 1999; 83:179-83 14. Christensen HC, Schüz J, Kosteljanetz M, Poulsen HS, Thomsen J, Johansen C. Cellular telephone use and risk of acoustic neuroma. Am J Epidemiol 2004; 159: 277-83 15. Stang A, Anastassiou G, Ahrens W, Bromen K, Bornfeld N, Jöckel KH. The possible role of radiofrequency radiation in the development of uveal melanoma. Epidemiology 2001; 12: 7-12 16. Johansen C, Boice JD Jr, McLaughlin JK, Christensen HC, Olsen JH. Mobile phones and malignant melanoma of the eye. Br J Cancer 2002; 86: 348-9 17. Schüz J, Mann S. A discussion of potential exposure metrics for use in epidemiological studies on human exposure to radiowaves from mobile phone base stations. J Expo Anal Environ Epidemiol 2000; 10: 600-5 18. Schüz J. Elektromagnetische Felder. Verbreitung, biologische Wirkungen und mögliche Assoziationen mit Erkrankungsrisiken. internist prax 2004; 44: 439-62 Anschrift des Verfassers: PD Dr. Joachim Schüz, Institut für Med. Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI) der Universität Mainz, 55101 Mainz; e-mail: [email protected] 6