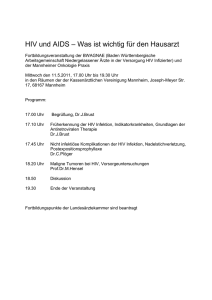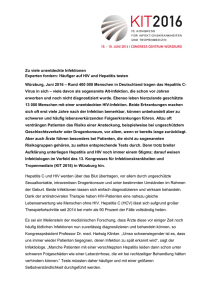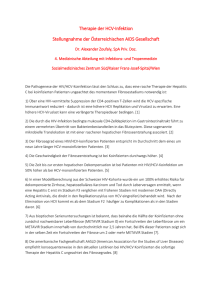Klinische Infektiologie von A wie AIDS bis Z wie Zirrhose
Werbung
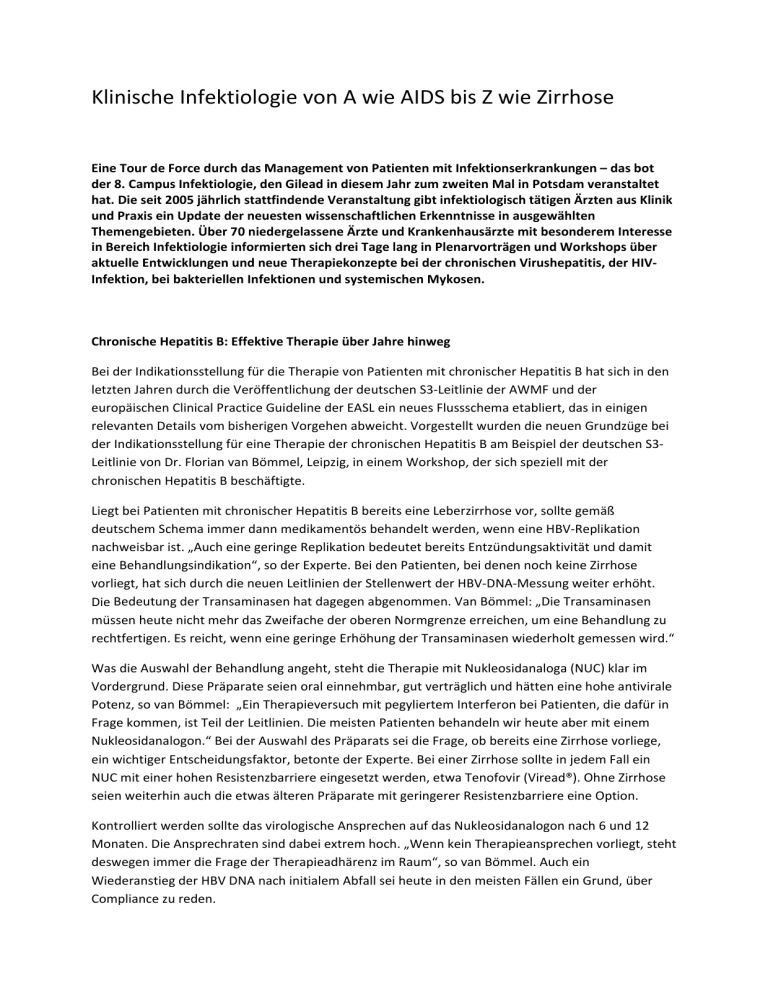
Klinische Infektiologie von A wie AIDS bis Z wie Zirrhose Eine Tour de Force durch das Management von Patienten mit Infektionserkrankungen – das bot der 8. Campus Infektiologie, den Gilead in diesem Jahr zum zweiten Mal in Potsdam veranstaltet hat. Die seit 2005 jährlich stattfindende Veranstaltung gibt infektiologisch tätigen Ärzten aus Klinik und Praxis ein Update der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in ausgewählten Themengebieten. Über 70 niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte mit besonderem Interesse in Bereich Infektiologie informierten sich drei Tage lang in Plenarvorträgen und Workshops über aktuelle Entwicklungen und neue Therapiekonzepte bei der chronischen Virushepatitis, der HIV‐ Infektion, bei bakteriellen Infektionen und systemischen Mykosen. Chronische Hepatitis B: Effektive Therapie über Jahre hinweg Bei der Indikationsstellung für die Therapie von Patienten mit chronischer Hepatitis B hat sich in den letzten Jahren durch die Veröffentlichung der deutschen S3‐Leitlinie der AWMF und der europäischen Clinical Practice Guideline der EASL ein neues Flussschema etabliert, das in einigen relevanten Details vom bisherigen Vorgehen abweicht. Vorgestellt wurden die neuen Grundzüge bei der Indikationsstellung für eine Therapie der chronischen Hepatitis B am Beispiel der deutschen S3‐ Leitlinie von Dr. Florian van Bömmel, Leipzig, in einem Workshop, der sich speziell mit der chronischen Hepatitis B beschäftigte. Liegt bei Patienten mit chronischer Hepatitis B bereits eine Leberzirrhose vor, sollte gemäß deutschem Schema immer dann medikamentös behandelt werden, wenn eine HBV‐Replikation nachweisbar ist. „Auch eine geringe Replikation bedeutet bereits Entzündungsaktivität und damit eine Behandlungsindikation“, so der Experte. Bei den Patienten, bei denen noch keine Zirrhose vorliegt, hat sich durch die neuen Leitlinien der Stellenwert der HBV‐DNA‐Messung weiter erhöht. Die Bedeutung der Transaminasen hat dagegen abgenommen. Van Bömmel: „Die Transaminasen müssen heute nicht mehr das Zweifache der oberen Normgrenze erreichen, um eine Behandlung zu rechtfertigen. Es reicht, wenn eine geringe Erhöhung der Transaminasen wiederholt gemessen wird.“ Was die Auswahl der Behandlung angeht, steht die Therapie mit Nukleosidanaloga (NUC) klar im Vordergrund. Diese Präparate seien oral einnehmbar, gut verträglich und hätten eine hohe antivirale Potenz, so van Bömmel: „Ein Therapieversuch mit pegyliertem Interferon bei Patienten, die dafür in Frage kommen, ist Teil der Leitlinien. Die meisten Patienten behandeln wir heute aber mit einem Nukleosidanalogon.“ Bei der Auswahl des Präparats sei die Frage, ob bereits eine Zirrhose vorliege, ein wichtiger Entscheidungsfaktor, betonte der Experte. Bei einer Zirrhose sollte in jedem Fall ein NUC mit einer hohen Resistenzbarriere eingesetzt werden, etwa Tenofovir (Viread®). Ohne Zirrhose seien weiterhin auch die etwas älteren Präparate mit geringerer Resistenzbarriere eine Option. Kontrolliert werden sollte das virologische Ansprechen auf das Nukleosidanalogon nach 6 und 12 Monaten. Die Ansprechraten sind dabei extrem hoch. „Wenn kein Therapieansprechen vorliegt, steht deswegen immer die Frage der Therapieadhärenz im Raum“, so van Bömmel. Auch ein Wiederanstieg der HBV DNA nach initialem Abfall sei heute in den meisten Fällen ein Grund, über Compliance zu reden. Wie hoch die Ansprechraten bei Einsatz moderner NUCs sind, machte van Bömmel am Beispiel von Tenofovir deutlich. Bei initial HBeAg‐negativen Patienten gebe es mittlerweile Langzeitdaten über 240 Wochen. In On‐treatment‐Analysen liegt die HBV‐DNA in der Langzeittherapie bei 99% der Patienten unter der Nachweisgrenze. Und selbst in Intention‐to‐treat‐Analysen werde zur Woche 240 eine Rate von 83% erreicht. Van Bömmel konnte hier eigene Daten einer europäischen Feldstudie ergänzen, an der 28 Zentren teilgenommen haben. Auch hier zeige sich unter den Bedingungen des medizinischen Alltags, dass es mit Tenofovir in der Langzeittherapie gelingt, die HBV‐DNA bei fast 100% der Patienten effektiv zu supprimieren. Dies spiegele sich auch in einer teilweisen Umkehrung fibrotischer Veränderungen in der Leber wider. In Tenofovir‐Studien, in denen anfangs 38% der Patienten eine hochgradige Fibrose aufwiesen, waren es nach fünf Jahren nur noch 12%. „Mit dieser Therapie können wir bei der Leberhistologie also eindeutig etwas erreichen“, so van Bömmels Fazit. Chronische Hepatitis C am Wendepunkt Der Siegeszug der oralen antiviralen Therapien, der bei der chronischen Hepatitis B schon in vollem Gange ist, dürfte auch bei der chronischen Hepatitis C nicht aufzuhalten sein. Von 180 bis 200 Millionen Erkrankten gehen Experten weltweit aus. Und es werden mehr: Der Gipfel der Krankheitslast wird erst um das Jahr 2020 herum erwartet. Professor Dr. Darius Moradpour, Lausanne, fasste in einem faszinierenden Plenarvortrag knapp 25 Jahre HCV‐Forschung zusammen und machte deutlich, welch breites Spektrum an Zielstrukturen für neue Medikamente sich durch die Aufklärung der molekularen Details der Hepatitis C‐Infektion aufgetan hat. Die derzeit im Fokus stehende NS3‐4A‐Protease ist dabei nur ein Ansatzpunkt von mehreren. Auch das Nicht‐Strukturprotein NS‐4B sowie jene Strukturen, die für die Ausschleusung von HCV aus der infizierten Zelle verantwortlich sind, könnten vielversprechende Angriffspunkte für Pharmakotherapien sein. Ein ganz neuer therapeutischer Ansatzpunkt ist möglicherweise auch der Vitamin D‐Metabolismus. Moradpour berichtete über Daten aus der Swiss Hepatitis C Cohort Study, wonach chronische Hepatitis C‐Patienten häufig einen Vitamin D‐Mangel aufweisen. Zudem gebe es Hinweise auf eine Assoziation zwischen Vitamin D‐Mangel und hepatozellulärem Karzinom sowie auf einen Zusammenhang zwischen genetischen Polymorphismen im Bereich des Vitamin D‐ Stoffwechsels und dem Ansprechen auf antivirale Therapien HIV‐Infektion: Der Weg zur Eradikation ist noch weit Während die Erfolgsgeschichte der spezifischen antiviralen Therapien bei der chronischen Hepatitis C gerade erst beginnt, ist die effektive Unterdrückung der Viruslast bei der HIV‐Infektion schon seit Jahren klinische Realität. In den letzten Jahren wurden die antiretroviralen Therapien nicht nur immer facettenreicher und damit besser individualisierbar. Sie wurden auch patientenfreundlicher, weil gut verträgliche Kombinationspräparate wie Truvada (Emtricitabin, Tenofovir), Atripla (Efavirenz, Tenofovir, Emtricitabin) oder Eviplera (Rilpivirin, Tenofovir, Emtricitabin) die Zahl der einzunehmenden Tabletten pro Tag stark reduziert haben. „Wir können heute sagen, dass wir für jeden Patienten eine passende, wirksame, verträgliche und bequeme Therapie verfügbar haben“, betonte Professor Dr. Frank‐D. Goebel, München. Standard sei weiterhin die initiale Dreifachtherapie, bei der in der Regel zwei Nukleosidanaloga (NUC) und ein nicht‐nukleosidischer Reverse Transkriptase‐Inhibitor oder ein geboosterter Proteaseinhibitor kombiniert werden. Kontrolliert werde standardmäßig alle drei bis vier Monate, so Goebel. Die Erfolge der HIV‐Therapie speziell in Deutschland seien gut, könnten aber auch noch besser sein, betonte der Experte. Daten der ClinSurv‐Surveillance des Robert Koch‐Instituts zeigten, dass bei circa 80% der älteren HIV‐Patienten, aber nur bei etwa 60% der 30‐ bis 40jährigen, die HIV‐Viruslast unter der Nachweisgrenze liege. Schwierig bleibe in vielen Fällen weiterhin die möglichst frühe Erstdiagnose. Noch immer habe etwa jeder vierte HIV‐Infizierte bei der Erstdiagnose eine CD4‐ Zellzahl von unter 200 pro Mikroliter Blut. „Das ist für eine in letzter Zeit auf Kongressen immer häufiger diskutierte mögliche Eradikation von HIV natürlich ein gravierendes Problem“, so Goebel. Er selbst ist deswegen überzeugt davon, dass der Weg zur Eradikation noch sehr weit ist. Antiretrovirale Therapie: „Test & Treat“ statt „Wait & See“ Bei der Frage nach dem optimalen Zeitpunkt für den Beginn einer antiretroviralen Therapie wies Goebel darauf hin, dass nach einigen „Pendelbewegungen“ bei den Therapieempfehlungen der Trend seit etwa 2008 wieder eindeutig hin zu einer möglichst frühen Behandlung gehe. „Test and Treat“ laute das derzeit gültige Behandlungsparadigma. Begründet werde es vor allem epidemiologisch, so Goebel. Weil mittlerweile klar sei, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit eine Funktion der Virusmenge im Blut des Überträgers ist, sei ein möglichst rasches Absenken der Viruslast aus epidemiologischer Sicht unabdingbar. Das hat auch Eingang in offizielle Therapieempfehlungen gefunden. So empfiehlt das US‐amerikanische Department of Health & Human Services (DHHS) in seiner Leitlinie Goebel zufolge die ART pauschal für alle HIV‐infizierten Individuen, also auch für symptomlose HIV‐Infizierte mit hoher CD4‐Zellzahl. Dass sich durch eine frühe Therapie HIV‐Infektionen verhindern lassen, hat unter anderem die HPTN 052‐Studie gezeigt, an der heterosexuelle serodiskordante Paare in stabiler Beziehung teilnahmen. Der HIV‐infizierte Partner wurde entweder sofort, also bereits bei einer CD4‐Zellzahl von unter 550 pro Mikroliter oder verzögert, bei einer CD4‐Zellzahl unter 250 pro Mikroliter, behandelt. „Es zeigte sich, dass die frühe Behandlung das Übertragungsrisiko innerhalb der Partnerschaften um 96% verringerte. Die Frühtherapie ist also eine hoch wirksame Prophylaxe“, so Goebel. Auf Seiten der HIV‐ infizierten Partner gab es immerhin 41% weniger HIV1‐assoziierte klinische Ereignisse. Einen Schritt weiter gehen Präventionskonzepte, bei denen durch den Einsatz einer antiretroviralen Therapie bei noch nicht infizierten Individuen das Übertragungsrisiko verringert werden soll. Auch hierzu nimmt die DHHS‐Leitlinie vom März 2012 Stellung. Eine ART sollte demnach Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko zumindest angeboten werden, wobei der Evidenzlevel dieser Empfehlung für rein heterosexuelle Partner mit A‐I, für alle anderen mit A‐III angegeben wird. Konkret zugelassen ist seit Juli 2012 in den USA die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) mit dem Medikament Truvada. Basis der Zulassung war unter anderem die iPrEx‐Studie, über die Goebel berichtete. Die iPrEx‐Studie hat gezeigt, dass eine antiretrovirale Behandlung mit Truvada im Vergleich zu Placebo die kumulative Wahrscheinlichkeit einer HIV‐Infektion bei den prophylaktisch behandelten Individuen hoch signifikant verringert. Dabei gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Effektivität der Prophylaxe und Arzneimittelplasmaspiegeln. Bei der Bewertung der in Europa nicht zugelassenen pharmakologischen PrEP war Goebel dennoch zurückhaltend: „Es gab auch zwei Studien, in denen kein relevanter Effekt der PrEP gezeigt werden konnte. Und die beiden positiven Studien iPrEX und CAPRISA zeigen eindeutig, dass nur bei hoher Adhärenz ein Schutz erreicht wird.“ Das spiegelte sich in der iPrEx‐Studie unter anderem darin wider, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen Effektivität der Prophylaxe und Arzneimittelplasmaspiegeln gab. HIV/HCV‐Koinfektion: CD4‐Zellen diktieren therapeutisches Vorgehen Professor Dr. Hartwig Klinker, Würzburg, ging in einem Workshop im Detail auf die zunehmende Problematik der HIV/HCV‐Koinfektionen ein. Die Inzidenz einer HCV‐Koinfektion bei HIV‐Infizierten liege in Mitteleuropa gemäß Daten der EuroSIDA‐Kohorte aus dem Jahr 2005 bei etwa 15%, so Klinker. In Süd‐ und Südosteuropa ist sie teilweise mehr als doppelt so hoch. Der behandelnde Arzt müsse sich in dieser Konstellation darüber im Klaren sein, dass die HCV‐Infektion den Verlauf der HIV‐Infektion praktisch nicht beeinflusse, während umgekehrt die HIV‐Infektion einen enormen Einfluss auf den Verlauf der HCV‐Infektion habe. Manifest werde das vor allem dadurch, dass die Leberzirrhose bei HIV/HCV‐koinfizierten Patienten deutlich häufiger sei und im Mittel 10 bis 15 Jahre früher auftrete als bei nicht mit HIV infizierten HCV‐Patienten, betonte Klinker. Die entscheidende Praxisfrage in dieser Konstellation ist die nach der sinnvollen Therapiereihenfolge. Hier gebe es relativ klare Empfehlungen, so Klinker. Grundsätzlich gelte, dass die Heilungsrate der HCV‐Infektion mit steigender CD4‐Zellzahl steige. Bei einer CD4‐Zellzahl von über 500 pro Mikroliter sollte die HCV‐Infektion deswegen prioritär behandelt werden. Bei einer CD4‐Zellzahl von unter 350 pro Mikroliter sollte zunächst eine antiretrovirale Therapie initiiert werden, um die immunologische Situation zu verbessern, bevor nach einem Anstieg der CD4‐Zellen dann die chronische Hepatitis C behandelt wird. Bei CD4‐Zellzahlen zwischen 350 und 500 Mikrolitern wird empfohlen, sowohl die Hepatitis C‐Therapie als auch die antiretrovirale Therapie frühzeitig zu beginnen. Sepsis: Rückbesinnung auf antiinfektiöse Therapie Keine geradlinige Erfolgsgeschichte, sondern eher ein Auf und Ab, so lässt sich die jüngere Historie der Behandlung von Sepsis‐Patienten beschreiben. Anfang des Jahrtausend machten gleich mehrere große Sepsis‐Studien Schlagzeilen: Early Goal‐Directed Therapy, aktiviertes Protein C, Low‐Dose‐ Hydrocortison und aggressive Blutzuckersenkung galten als Waffen, mit denen die Sepsis ihren Schrecken verlieren sollte. „Letztlich konnten all diese damals positiven Studien in Folgestudien nicht oder nur sehr eingeschränkt bestätigt werden“, betonte Professor Dr. Tobias Welte, Hannover. Der Einsatz von Hydroxyethylstärke im Rahmen der Early Goal Directed Therapy habe sich als Risiko für die Niere erwiesen. Das Dogma, wonach niedrig dosiertes Dopamin die Nierenfunktion verbessert, ließ sich so pauschal nicht halten. Aktiviertes Protein C wurde vom Markt genommen. Und niedrig dosiertes Hydrocortison war in Folgestudien dann doch nicht besser als Placebo. Die Quintessenz des vergangenen Jahrzehnts der klinischen Sepsis‐Forschung ist für Welte ein „zurück zur Basis“. Nicht supportive und adjunktive Therapien seien offenbar entscheidend, sondern die Frage, ob es gelingt, den Erreger in den Griff zu bekommen oder nicht: „Die Sepsis ist eine Infektionserkrankung, und die primäre Therapie einer Infektionserkrankung ist die antiinfektiöse Therapie. Die Hoffnung, dass wir eine suboptimale antiinfektiöse Therapie durch Fortschritte in anderen Bereichen kompensieren können, war trügerisch.“ Auf dem Gebiet der spezifischen antiinfektiösen Therapie bestehe leider immer noch ein erheblicher Bedarf an neuen Medikamenten. So seien effektive Antibiotika gegen methicillinresistente Staphylokokken (MRSA) weiterhin Mangelware. Und die stark zunehmende Häufigkeit resistenter oder multiresistenter grammnegativer Keime könnte sich zu einem der dominanten Probleme der stationären Antibiotikatherapie der nächsten Jahre entwickeln. Laut Professor Dr. Markus Dettenkofer, Freiburg, haben vor allem Klebsiellen, die gegen Cephalosporine der III. Generation resistent sind („ESBL“), mit einer auf Labordaten basierenden Prävalenz von 10% bis 25% in Deutschland mittlerweile ein problematisch hohes Niveau erreicht. Auch Carbapenemase‐ produzierende Enterobakterien sind in einigen Ländern Europa stark auf dem Vormarsch. Die Datenlage zur optimalen Antibiotikatherapie bei schwerer Sepsis ist dünn. Generell ließen Metaanalysen den Schluss zu, dass bei schwerkranken Patienten Kombinationstherapien mit Antibiotika eher günstiger seien als Monotherapien, so Welte. Wichtig zu berücksichtigen sei auch, dass Sepsispatienten wegen eines erhöhten Herzzeitvolumens, eines größeren Verteilungsvolumens und Veränderungen bei der Plasmaeiweißbindung fast immer höhere Antibiotikadosierungen benötigten als vergleichbare Menschen mit nicht septischen, infektiösen Krankheitsbildern. „Wenn bei Sepsispatienten nur die Standarddosis eingesetzt wird, dann finden wir teilweise überhaupt keine Wirkspiegel“, so Welte. „Wahrscheinlich haben wir Antibiotika bei Sepsis jahrelang dramatisch unterdosiert.“ Systemische Mykosen: Gezielte Prophylaxe und frühe Diagnose als Erfolgsfaktoren Neben bakteriellen, septisch verlaufenden Infektionen sind auf Intensivstationen auch systemische Mykosen gefürchtet. Professor Dr. Georg Maschmeyer, Potsdam, gab in seinem Plenarvortrag einen Überblick über die Epidemiologie sowie über aktuelle Strategien zu Prävention und Behandlung. Maschmeyer betonte, dass invasive Mykosen im Prinzip oft gut behandelbare Erkrankungen seien, die allerdings viel zu häufig übersehen würden: „Etwa 75% der invasiven Mykosen werden ante mortem nicht diagnostiziert.“ Zur Häufigkeit von Candida‐Fungämien in Europa gibt es relativ zuverlässige Daten aus Blutkulturstudien der Paul Ehrlich‐Gesellschaft. In den Zeiträumen 1983‐1985, 1991‐1992 und 2000‐ 2001 lag der Anteil der Candidämien in diesen Untersuchungen stets bei 2% und darunter. In der aktuellsten Studie für den Zeitraum 2006‐2007 wurden dann bereits 5,9% beschrieben. „Risikofaktoren für Candidämien sind vor allem akutes Nierenversagen, parenterale Ernährung und das Vorliegen eines dreilumigen ZVK“, so Maschmeyer. Entsprechend wichtig seien die Prophylaxe bei gefährdeten Patienten und die effektive Therapie, wenn eine Candidämie auftritt. Bei der „Pilzprophylaxe“ von Patienten, die länger als sieben Tage eine Neutropenie < 500/µl aufweisen, stehen gemäß AGIHO‐Empfehlungen aus dem Jahr 2009 Posaconazol und liposomales Amphotericin B im Vordergrund. Bei der Primärbehandlung von Patienten mit Candidämie gehört liposomales Amphotericin B (AmBisome) zu den Substanzen mit der höchsten Empfehlungsstufe. Zur Behandlung von Patienten mit invasiver pulmonaler Aspergillose präsentierte Maschmeyer die Leitlinie der European Conference on Infections in Leucemia (ECIL). Die beiden Therapien mit der stärksten Empfehlung sind Voriconazol und liposomales Amphotericin B. Durch eine präemptive Therapie mit einem Aspergillus‐wirksamen Antimykotikum kann der Verlauf invasiver Aspergillosen abgemildert werden. Gemäß einer internen Leitlinie in Potsdam werden beispielsweise alle Patienten, die in der Neutropenie Fieber entwickeln und im CT ein so genanntes Halo‐Zeichen zeigen, präemptiv therapiert. Durch derartige Maßnahmen sei es im Einklang mit internationalen Erfahrungen auch in Deutschland in den letzten Jahren gelungen, die Überlebensraten bei der invasiven Aspergillose zu verbessern, betonte Maschmeyer. Gilead Sciences – etablierter Partner in der Infektiologie Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, mit Firmenhauptsitz in Foster City, Kalifornien, und Niederlassungen in den USA, Europa und Australien. Der deutsche Firmensitz befindet sich in Martinsried bei München. Gilead Schiences fokussiert sich in Forschung und Entwicklung auf den Bereich Infektiologie und sieht dabei den medizinischen Fortschritt für die Patienten und die behandelnden Ärzte im Vordergrund seines Handelns. Neben der Erforschung und Weiterentwicklung besser verträglicherer und wirksamerer Arzneimittel engagiert sich Gilead Sciences in Deutschland seit vielen Jahren insbesondere auch für die medizinische Fortbildung im Bereich Infektiologie. Mit dem Campus Infektiologie möchte Gilead Sciences den interdisziplinären Dialog zwischen den unterschiedlichsten infektiologischen Fachbereichen fördern und somit zu einer Verbesserung der Versorgung von Patienten mit lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen beitragen.