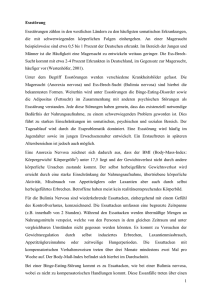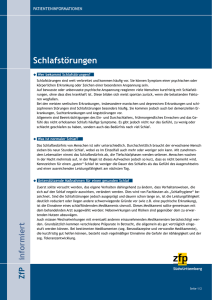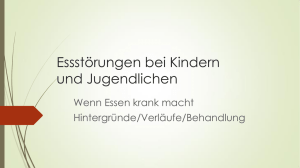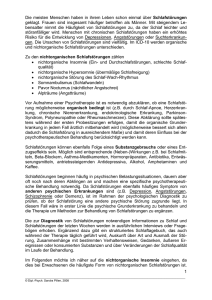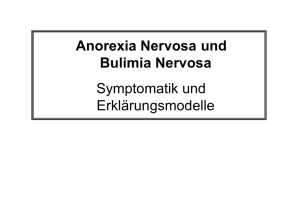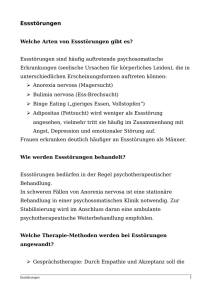Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES
Werbung

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Zusammenfassung für den Lizpool Perrez & Baumann (1998) von Sam Leuzinger Sam Leuzinger Route de Marly 31 1700 Fribourg Tel: 026 / 422 24 13 e - mail: [email protected] Kapitel 32 Schlafstörungen Klassifikation und Diagnostik (S. 730 - 733). Schlafbeschwerden werden beschreibend in Einschlafstörungen, Schlafunterbrechungen und frühes Aufwachen am Morgen. Aber auch der exzessive Schlaf wird als Symptom gewertet. Die Taxonomie geht von pathophysiologischen Kriterien aus und ist in vier Hauptgruppen eingeteilt: Dyssomnien, Parasomnien, Schlafstörungen in Verbindung mit medizinisch / psychiatrischen Erkrankungen und "vorgeschlagene", d. h. noch nicht eindeutig bestimmte Schlafstörungen. Hauptgruppen im DSM - IV und ICD - 10 (S. 731): Dyssomnien: - Primäre Dyssomnie - Primäre Hypersomnie - Narkolepsie - Atmungsgebundene Schlafstörung - Schlafstörung mit Störung des zirkadianen Rhythmus - nicht näher bezeichnete Dyssomnie Parasomnien (abnorme Ereignisse während des Schlafs): - Schlafstörungen mit Angstträumen - Pavor nocturnus - Schlafstörung mit Schlafwandeln - nicht näher bezeichnete Parasomnien Schlafstörungen in Zusammenhang mit einer anderen psychischen Störung - Insomnie in Zusammenhang mit einer anderen psychischen Störung - Hypersomnie in Zusammenhang mit einer anderen psychischen Störung andere Schlafstörungen - Schlafstörung aufgrund eines medizinischen Kranikheitfaktors - Substanzinduzierte Schlafstörung Die DSM - IV - Kriterien für eine primäre Insomnie (DSM - IV, S. 634) sind: A: Die im Vordergrund stehende Beschwerde besteht in Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten oder in nicht erholsamem Schlaf seit mindestens einem Monat. B: Die Schlafstörung (oder die damit verbundene Tagesmüdigkeit) verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. C: Das Störungsbild tritt nicht ausschliesslich im Verlauf einer anderen psychischen Störung auf (z. B. Major Depression, Generalisierte Angststörung, Delir). D: Das Störungsbild geht nicht auf die körperliche Wirkung einer Substanz (z. B. Droge, Medikament) oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurück. Die umfassende multivariate Diagnostik von Schlafproblemen stellt schwerpunktsmässig folgende Fragen: 1) Ist eine Schlafstörung als vorübergehend oder als chronisch zu definieren? 2) Tritt die Schlafstörung im Kontext von somatischen Symptomen und psychiatrischen Erkrankungen auf oder ist sie als primäre Störung anzusehen? 3) Stellt sich eine Schlafstörung nur im Erleben des Betroffenen dar oder wird sie durch physiologische Messungen bestätigt? Die Klienten werden dabei aufgefordert, am Morgen ein Schlaftagebuch über die vergangene Nacht zu schreiben. Parallel dazu können Ruhe- und Aktivitätsphasen mittels eines Monitors am Handgelenk gemessen werden. Sie kann mit Einschätzungen über Ruhezeiten, Schlafqualität und Schlafgewohnheiten verglichen werden. Die Labormessung des Schlafs stellt den letzten Schritt der Abklärung mit Tests dar. Diagnostische Abklärungsschritte von Insomnien sind: - Halbstrukturiertes Interview - Informationen über Emotion, Kognition und Verhalten in bezug auf die Störung und ihre Folgen, Schlafanamnese, Einstellung zum Schlaf und Lebenssituation. Die auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen werden analysiert. - Schlaftagebuch: Die im Bett verbrachte Zeit, Einschlaf- und Aufwachzeiten, Schlafunterbrechungen, Schlafqualität und Erholungsgefühl, Medikamente werden erfasst, um generalisierte Aussagen über den Schlaf zu differenzieren. - Messung der Motorik: Kontinuierliche Aufzeichnung der Armbewegung (summierte Werte jeweils über 7.5 min), um die Ruhe- und Aktivitätsphasen mit den subjektiven Angaben zu vergleichen. - Polygraphische Messungen: EEG, EOG, EMG, Atmung, Puls, 2 - 3 Labornächte, um die Schlafstruktur und den Schlafverlauf zu diagnostizieren. 32.2 Schlafstörungen: Ätiologie / Bedingungsanalyse (S. 734 - 743) Verlängerte Einschlafzeiten, häufiges Erwachen mit verzögertem Wiedereinschlafen und eine daraus resultierende herabgesetzte Schlafeffizienz (= prozentualer Anteil des Schlafs von der im Bett verbrachten Zeit) gelten als Hauptmerkmale eines gestörten Schlafs. Schlafinterne Indikatoren, wie vermehrter Wechsel der Schlafstadien, geringe Schlafvertiefung oder motorische Unruhe müssen auch berücksichtigt werden, auch durch Selbsteinschätzungen des Schläfers (Schlafqualität, Erholungsgefühl, etc.). Engel und Knab (1985) haben ein deskriptives Modell (Zwei - Komponenten Modell) zur Einordnung von Schlafstörungen vorgeschlagen, das die subjektiven und objektiven Merkmale von Schlafstörungen berücksichtigt. Das klinische Bild des chronischen schlechten Schlafes kommt zustande, wenn eine somatische Dysregulation des Schlaf - Wach - Rhythmus mit einer erhöhten neurotischen Klagsamkeit zusammenfällt. Die klinische Bedeutsamkeit einer Schlafstörung kann am grösseren Abstand vom Achsenschnittpunkt abgelesen werden. Das Modell nimmt auch eine dynamische Wechselwirkung der beiden Komponenten an. Eine organisch bedingte Schlaf - Wach - Dysregulation kann eine verstärkte Selbstbeobachtung mit erhöhter Klagsamkeit hervorrufen, die bestehen bleibt, auch wenn sich der Schlafrhythmus wieder normalisiert hat. Ein externer oder psychischer Konflikt kann aber auch Anspannung und Erregung hervorrufen, die sich auf den Schlaf negativ auswirkt (negative Rückwirkung des Schlafs auf das psychische Wohlbefinden). Die Struktur des Schlafs entwickelt sich in der frühen Kindheit von polyphasisch zu zweiphasicher Schlafstruktur mit geringerer Schlafdauer, der in einen monophasischen Schlaf übergeht. In der Adoleszenz findet eine Schlafreduktion statt. Im Alter vermindern sich Schlaftiefe und Stabilität des Schlafverlaufs, tagsüber treten vermehrt Schlafperioden auf. Veränderungen im Schlaf - Wachrhythmus können mit Anpassungsproblemen verbunden sein, welche Schlafstörungen hervorrufen. Die meisten frühkindlichen Schlafstörungen werden nicht chronisch. Auch in der Adoleszenz verfestigen sich die Schlafprobleme nur in sehr wenigen Fällen. Doch neben biologischen Ursachen können auch psychodynamische Bedingungen den Schlaf behindern. Belastende Lebensereignisse können Schlafstörungen hervorrufen - i Zusammenhang mit Identitätsproblemen, bei Alten mit Lebensunzufriedenheit, Todesangst und einer negativen Einstellung zum Alter. Schafgestörte Menschen zeigen sich v. a. durch ängstliches Grübeln und Anspannung aus. Kognitive und verhaltensorientierte Erklärungen von Schlafstörungen gehen davon aus, dass grüblerische Gedanken im Umfeld des Schlafes schlaflindernd wirkt. Die Fixierung der Gedanken auf den ausbleibenden Schlaf wirkt problemverstärkend (mit überbesorgter Einstellung zum Schlaf). Wenn sich in der Schlafsituation schlafinkompatible Gewohnheiten (fern sehen, etc.) einschleifen, verliert die Umwelt ihre schlaffördernde Funktion. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die subjektive Bewertung von Stress und ein Defizit an Bewältigungsstrategien für die Aufrechterhaltung von Schlafstörungen wichtig sein können. Schlechte Schläfer sind in ihren Gedanken mehr mit sich selbst oder der unpersönlichen Umwelt beschäftigt und schätzen sich häufig als ruhig, entspannt und unbeteiligt ein. Die Wechselwirkung zwischen auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren wurde am besten für die psychophysiologische Schlafstörung beschrieben. Eine chronisch ängstliche Anspannung, die als Unruhe und Verkrampfung somatisiert wird interagiert mit der Schlaflosigkeit, welche durch interne und externe Faktoren verstärkt wird - Wunsch, den Schlaf willkürlich herbeizuführen. Oft gehen die Patienten von falschen Annahmen aus, z. B. dass Schlaf mit zunehmendem Alter störungsanfälliger wird. Durch den chronischen Schlafmittelgebrauch verändern sich Schlafstruktur und Schlafqualität. Ein Absetzen des Medikaments gelingt deshalb nicht, weil danach vorerst heftiger Schlafstörungen auftreten. Dadurch wird das Bedürfnis verstärkt, die Schlafmittel weiterhin zu nehmen. In den neueren Klassifikationssystemen werden Schlafstörungen v. a. in den Gruppen der affektiven Störungen und der Angstsyndrome als wichtiges Symptom hervorgehoben. Bei depressiv Erkrankten zeigen Befunde, dass ihr Schlaf massiv gestört sein kann, anderseits kann ein totaler oder partieller Schlafentzug zu einer markanten Besserung der depressiven Symptomatik führen. Der gestörte Schlaf äussert sich bei einer Mehrzahl Depressiver folgendermassen (Reynolds & Kupfer, 1987): - Einschlaf- und Durchschlafstörungen mit zu frühem Erwachen - Veränderung des Tiefschlafs (langsame Wellen, Stadien 3 / 4), v. a. im ersten Schlafzyklus. - Verkürzung der ersten Nicht - REM Schlafperiode (Stadien 2 bis 4), die zu einem vorzeitigen Einsetzen der ersten REM - Phase (verkürzte REM - Latenz) führt. - Gleichmässigere Verteilung des REM - Schlafs innerhalb des gesamten Schlafs. Diese Merkmale treten aber auch bei anderen psychischen Störungen (z. B. Angstneurosen, Schizophrenien), bei gesunden alten Menschen und tagsüber aktive Junge auf. Eine antidepressive Wirkung ist auch nach Schlafentzug in der zweiten Nachthälfte und nach selektivem REM - Schlafentzug beobachtet worden. Das Zwei - Prozess Modell der Schlafregulation von Borbély und Wirz - Justice (1987). Das Modell postuliert Prozess S, der die Schlafbereitschaft und die Schlafintensität in Abhängigkeit vom Schlaf- Wach- Rhythmus, v. a. im Wachzustand aktiv ist (gemessen durch EEG). Prozess C wird unabhängig vom Schlaf- Wachverhalten durch die übergreifende zirkadiane Tagesperiodik bestimmt und die Schlafbereitschaft bestimmt. Bei depressiver Erkrankung ist der Prozess C (Schlaffähigkeit) defizient, diese Beeinträchtigung bewirkt depressives Befinden. Das verlängerte Wachsein in der Deprivationsphase bewirkt eine Stärkung des Prozess S, die Wirkung kann nur kurzfristig sein. Biologische Faktoren werden in diesem Modell nicht berücksichtigt. Die chronologische "Phase - advance" Hypothese geht von zirkadianen Rhythmen aus, welche durch Umweltfaktoren (Licht, etc. beeinflusst werden Störungen des gewohnten Schlaf - Wachrhythmus (z. B. Jet lag) führen zu einer Desynchronisation der biologischen Rhythmen, welche bis zu einer Anpassung zu psychophysischen Beschwerden führen kann. Bei depressiven Störungen werden Tagesschwankungen im Befinden festgestellt. Die Hypothese geht davon aus, dass der Schlaf von 2 zirkadianen Oszillatoren reguliert wird: der stärkere Oszillator reguliert den REM - Schlaf, die Körpertemperatur und die Cortisolausschüttung, der andere den Schlaf - Wach - Rhythmus. Der REM Schlaf ist bei depressiven Erkrankungen vorverschoben (deshalb Morgen kritisch für Depressive). Die Forschung zeigt, dass Depression nicht aus einem biologischen Faktor resultiert, sondern komplex ist. Fazit: Eine Wechselwirkung zwischen internalisierten Konflikten, psychosomatisierter Anspannung, unangemessenen Kognitionen und abträglichen Schlafgewohnheiten bestimmen Schlafstörungen. In der Diagnostik sind daher folgende Leitlinien zu betrachten: -Schlafstörung individuell im physiologischen und psychologischen Bezugssystem analysieren - das Schlafproblem sollte nicht unabhängig vom Tagesgeschehen und der Lebenssituation betrachtet werden Der Schlaf ist nur ein Aspekt im übergreifenden Schlaf - Wach - Rhythmus (vgl. psychische Störungen). 32.3 Schlafstörungen: Intervention (S. 745 752) Schlafstörungen sind in der Bevölkerung weit verbreitet und werden v. a. von Hausärzten behandelt. Dabei besteht aber ein breites psychologisches Angebot verschiedener Therapien. Medikamente (Schlafmittel) zeigen immer Nebenwirkungen und bergen die Gefahr einer Überdosierung und einer psychischen Abhängigkeit. Nebenwirkungen sind: Veränderungen der Schlafstruktur, Verwirrtheitszustände bei nächtlichem Aufstehen und Benommenheit am Nächsten Tag. Bei chronischer Einnahme ist eine verstärkte Insomnie nach Absetzen des Medikaments zu beobachten, die eine Entwöhnung erschwert. Kurzfristig haben gelegentlich eingenommene Schlafmittel den Vorteil, den ungestörten Schlaf einzuleiten und damit die Frustration der Schlaflosigkeit zu hemmen. Unter Entspannungsverfahren werden Progressive Entspannung, Autogenes Training, Hypnose und Meditation verstanden. Die Verfahren gehen davon aus, dass eine Schlafstörung durch erhöhte psychophysiologische Aktivierung hervorgerufen wird und durch positive Beeinflussung zum Entspannungszustand gebracht werden kann (je nach Therapie mehr physiologisch oder kognitiv orientiert). Die Klienten werden therapeutisch instruiert, machen danach die Übungen zu Hause. Auch Biofeedback Methoden wurden eingesetzt. - Entspannungsmethoden können subjektive Einschlafstörungen erheblich verbessern. - Die progressive Relaxation ist gegenüber einfacher Entspannung besser, u. a. Verkürzung der Einschlaflatenz bei psychophysiologischen Insomnien. - Es ist nicht nachgewiesen, dass eine Verbesserung der Beschwerden mit einer messbaren Reduktion körperlicher Anspannung verbunden ist. Stimulus - und Bettzeitkontrolle (Bootzin, 1980) sind Verhaltensregeln, die schlafinkompatible Gewohnheiten und Gedanken , die sich im Umfeld der Schlafumgebung verfestigt haben, zu unterbinden, eine zeitliche Abfolge des Schlaf - Wach - Rhythmus zu stabilisieren (nur zu Bett gehen bei Müdigkeit, Bett nur zum Schlafen benützen, nach 10 Minuten Schlaflosigkeit aufstehen und in ein anderes Zimmer gehen, diesen Vorgang wiederholen, jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen, tagsüber nicht schlafen). Die paradoxe Intervention, eine kognitive Intervention, die von Frankl 1960 entwickelt wurde, ist eine Selbstkontrolltechnik. Dabei wird der Patient instruiert, das Einschlafen zu unterlassen und mit offenen Augen die Körperreaktionen zu beobachten. Dieser Intervention liegt der Gedanke zugrunde, dass der Leistungsdruck einschlafen zu wollen Angst auslöst, das Grübeln wird damit unterbrochen. Dabei kann auch ein Imaginationstraining durchgeführt werden. Die bisher genannten Interventionen sind symptomorientiert, demgegenüber sind psychodynamische und kognitiv - verhaltensorientierte Interventionen persönlichkeitsorientiert. Psychodynamisch orientierte Interventionen sehen Schlafstörungen im Kontext neurotischer Erkrankungen an und behandeln sie in der Therapie, wobei es kein funktionsspezifisches therapeutisches Vorgehen gibt. Es wird davon ausgegangen, dass die Verarbeitung psychischer Konflikte das sekundäre Problem der Schlafstörung löst. Systematische Wirksamkeitsstudien liegen allerdings in diesen Interventionen nicht vor. Problematisch kann die Intervention sein, wenn die Patienten nicht motiviert sind, obwohl der Störung ein Konflikt zugrundeliegt, sind sie oft symptomorientiert (sie wollen ihre Schlafstörung weg). Das Erwachen aus angstbesetzten Träumen (physiologische Aktivität) ist durch konflikt - orientierte Therapien behandelbar, kann aber auch durch systematische Desensibilisierung behandelt werden. Kognitiv - verhaltensorientierte Interventionen sind strukturiert Ein Beispiel dafür ist das Breitbandverfahren von Hohenberger & Schindler (1984). In 11 halbstandardisierten Sitzungen wird die Problemanalyse (Erstgespräch, Schlafverhalten, Lebenssituation), die Therapiephase A (Entspannungstraining, Tagesstrukturierung, kognitive Kontrolle, Imaginationstraining) und der Therapiephase B (Training in sozialer Kompetenz, Ausbau von Freizeitaktivitäten, Umgang mit Belastung, Fading - weitere SK - Programme) durchgeführt. Dabei wird der Schlaf und das Wachen in einer wechselseitigen Beziehung gesehen, wobei der Schlaf und der Lebensstil (→ Umgang mit Belastungssituationen) verändert werden. In der Verhaltensanalyse wird individuell auf den Klienten eingegangen, um funktionale Zusammenhänge zwischen Tages- und Abendsituationen detailliert zu erarbeiten. Neben therapeutischen Interventionen ist das Geben von Interventionen über den Schlaf und eine schlafhygienische Beratung wichtig, da sich schlafgestörte Menschen oft an falschen Normen orientieren. Ihnen ist meist nicht bewusst, dass regelmässige Schlafgewohnheiten die Schlafqualität fördern können. Mit dieser Methode wird auch die Depressivität behandelt. Fazit: Die Wirksamkeit der symptomorientierten psychologischen Verfahren kann als bescheiden bezeichnet werden. Misserfolge von Behandlungen werden v. a. auf unzureichende Differntialdiagnostik (auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen nicht spezifisch berücksichtigt) werden. Schlafstörungen können auf vielfältige Ursachen zurückgehen, deshalb gibt es kein Patentrezept. Individuell muss eine adaptive Indikation gefunden werden, der psychophysiologischen Ausprägung des Beschwerdegrads als auch der psychischen Situation in der Wachsituation Rechnung trägt. Informationen über Schlaf und Schlafhygieneregeln können zur Prophylaxe von Schlafstörungen beitragen. Doch Skepsis ist angezeigt, ob diese Informationen effiziente Selbsthilfe aktivieren. Für viele chronisch schwer schlafgestörte Menschen ist deshalb eine fachspezifische Abklärung und Behandlung erforderlich und wünschenswert. Kapitel 33: Essstörungen 33.1 Klassifikation und Diagnostik (S. 754 - 758) DSM - IV (APA, 1994) enthält für die Klassifikation von Essstörungen im Erwachsenenalter die Kategorien Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa und als Restgruppe die nicht näher bezeichneten Essstörungen (Eating disorders not otherwise specified). Übergewicht stellt danach kein Krankheitswert dar. Unter der Restkategorie wird die Binge - Eating - Störung angesehen. Die Annorexia Nervosa äussert sich im Streben danach, extrem dünn zu sein, und einer krankhaften Angst vor Gewichtszunahme, obwohl sie untergewichtig sind. Der Richtwert zur Bestimmung von Normal- bzw. Untergewicht ist der Body Mass Index (BMI), bei dem das Körpergewicht (in kg) durch das Quadrat der Körpergrösse (in m) dividiert wird. AB BMI = 17.5 wird von Untergewicht gesprochen. Trotz ihres kritischen Gesundheitszustandes leugnen viele Anorektikerinnen (meist Frauen) über lange Zeit die Schwere ihrer Störung und stehen einer Therapie ablehnend gegenüber. Nach DSM - IV - Richtlinien müssen zur Diagnose von Anorexia Nervosa folgende Kriterien erfüllt sein: -A: Weigerung, das Minimum des für das Alter und Körpergrösse normalen Körpergewichts zu halten. - B: Ausgeprägte Ängste vor einer Gewichtszunahme oder davor, dick zu werden, trotz bestehenden Untergewichts. - C: Störung in der Wahrnehmung der eigenen Figur und des Körpergewichts, übertriebener Einfluss des Körpergewichts oder der Figur auf die Selbstbewertung oder Leugnen des Schweregrades des gegenwärtigen geringen Körpergewichts. - D: Bei postmenarchalen Frauen das Vorliegen einer Amenorrhoe, d. h. Ausbleiben von mindestens drei aufeinanderfolgenden Menstruationszyklen. - Restriktiver Typus (F50.00): Während der aktuellen Episode der Anorexie Nervosa hat die Person keine regelmässigen Fressanfälle gehabt oder hat kein Purging - Verhalten (z. B. selbstinduziertes Erbrechen). - Binge - Eating / Purging - Typus (F50.01):Während der aktuellen Episode der Anorexia Nervosa hat die Person regelmässig Fressanfälle gehabt und hat Purging - Verhalten gezeigt. Das ICD - 10 unterscheidet die beiden letztgenannten Untergruppen nicht, berücksichtigt aber als weiteres Diagnostikkriterium, dass es zu Entwicklungsverzögerungen (Wachstumsstopp, fehlende Brustentwicklung) kommt, wenn die Erkrankung vor der Pubertät beginnt. Differentialdiagnostisch sind körperliche Erkrankungen (z. B. Hirntumore) und Gewichtsverlust in Zusammenhang mit anderen psychischen Störungen (z. B. psychische Störungen) von der Anorexia Nervosa, bei welcher Körperschemastörungen und Ängste vor einer Gewichtszunahme bestehen, abzugrenzen. Untergewicht und Mangelernährung können viele medizinische Folgen haben (hormonelle Veränderungen und Veränderungen des Blutbildes). Beim Binge - Eating / Purge - Typus kann es zu Störungen des Elektrolythaushalts kommen, welche mit negativen Folgen der Herz- und Nierenfunktion kommen. Die Bulimia Nervosa wird in DSM - IV nach folgenden Kriterien diagnostiziert: - A: Wiederholte Episoden von Fressattacken (Verzehr einer Nahrungsmenge in einem bestimmten Zeitraum, Gefühl, während der Episode die Kontrolle über das Essverhalten zu verlieren). - B: Wiederholte Anwendung von unangemessenen, einer Gewichtszunahme gegensteuernden Massnahmen (selbstinduziertes Erbrechen, Missbrauch von Arzneimitteln, Fasten oder übermässige körperliche Betätigung). - C: Die Fressattacken und das unangemessene Kompensationsverhalten kommen drei Monate lang im Durchschnitt mindestens zweimal pro Woche vor. - D: Figur und Körpergewicht haben einen übermässigen Einfluss auf die Selbstbewertung. - W: Die Störung tritt nicht ausschliesslich im Verlauf von Episoden einer Anorexia Nervosa auf. - Purging - Typus: Selbstinduziertes Erbrechen oder Missbrauch von Klisterinen, etc. während Episode der Bulimia Nervosa. - Nicht - Purging - Typus: Während Episode unangemessene, einer Gewichtszunahme gegensteuernde Massnahmen (Fasten, übermässige körperliche Betätigung, ohne regelmässig zu erbrechen oder Einnahme von Klisterinen, etc. Das ICD - 10 kennt keine operationalen Kriterien (Häufigkeit, Zeitdauer) bei Essanfällen, auch das Kriterium des Kontrollverlusts fehlt zur Diagnose der Bulimia Nervosa, auch die beiden oben genannten Untergruppen fehlen. Personen, die an einer Binge - Eating - Störung leiden, haben immer wiederkehrende Essanfälle, ohne dass sie die übrigen Kriterien der Bulimia Nervosa erfüllen wurde auch als non - purging bulimia oder compulsing overeating beschrieben. Bis zu einem Drittel der Personen, die an Gewichtsreduktionsprogrammen teilnehmen, finden Essanfälle dieser Kategorie statt. Die Binge - Eating - Störung kommt um so häufiger vor, je stärker das Übergewicht bei der betreffenden Person ausgeprägt ist. Die DSM - IV Kriterien (1996) für diese Störung sind folgende: - Wiederholt auftretende Essanfälle mit dem Erleben von Kontrollverlust. - Essanfälle erfüllen mindestens 3 der folgenden Kriterien: wesentlich schnelleres Essen als normalerweise, bis zu unangenehmen Sättigungsgefühl essen, essen grosser Nahrungsmengen ohne Hungergefühl, allein essen wegen Verlegenheit / Scham, Ekelgefühle, Depressionen oder schlechtes Gewissen wegen Essanfällen. - Ausgeprägter Leidensdruck wegen der Essanfälle. - Die Essanfälle treten durchschnittlich seit 6 Monaten mindestens 2 Tage pro Woche auf. - Auf Essanfälle folgen nicht regelmässig kompensatorische Massnahmen (→ erbrechen) und die Essanfälle treten nicht ausschliesslich während einer Episode Anorexie oder einer Bulimia Nervosa auf. Es gibt verschiedene Verfahren zur Erfassung von Essstörungen: - EDI (Eating Disorder Inventory (Garner, Olimstedt & Polivy, 1873), erfasst z. B. Schlankheitsideal, Körperzufriedenheit, Perfektionismus. - FFI (Fragebogen zum Figurbewusstsein) ((Cooper, Taylor, Cooper & Fairburn, 1987), erfasst negative Kognitionen und Gefühle im Umgang mit der eigenen Figur. - DBQ (Dutch Eating Behavior Questionnaire) (van Strien, Frijters, Bergers & Defares, 1989), erfasst extern bestimmtes, gezügeltes Essverhalten und gefühlsinduziertes Essverhalten. - FEV (Fragebogen zum Essverhalten (Pudel & Westenhöfer, 1989), erfasst gezügeltes Essverhalten, Störbarkeit des Essverhaltens erlebte Hungergefühle, flexible und rigide Kontrolle des Essverhaltens. - EDE (Eating Disorder Examination (Fairburn & Cooper, 1993), Interviewleitfaden zur Diagnosestellung der Anorexia und der Bulimia Nervosa. - Essanfallstagebuch Hamburger Essanfallstagebuch (Tuschen & Florin), Tagebuch zu Erfassung von Ereignissen, Stimmungen und Gedanken, die dem Essanfall vorausgehen / folgen. - Ernährungstagebuch (Marburger Ernährungstagebuch (Tuschen & Florin), Tagebuch zur Erfassung der täglich gegessenen Nahrungsmittel, der erlebten Ängste wegen Gewichtszunahme, eingesetzte kompensatorische Massnahmen. 33.2 Essstörungen: Ätiologie / Bedingungsanalyse (S. 760 - 765) Essstörungen (Anorexia und Bulimia Nervosa treten v. a. in industrialisierten Ländern in höheren sozioökonomischen Schichten auf, v. a. bei Frauen. Die Schätzungen dieser beider Störungen liegen bei jungen Frauen zwischen 0.4 und 4%, wobei die Bulimia Nervosa häufiger auftritt. Soziokulturelle und / oder behaviorale Faktoren spielen bei der Ausbildung von Essstörungen eine Rolle (Essstörungen treten selten vor der Pubertät auf. Bei der Anorexie liegt der Beginn durchschnittlich bei 17 Jahren, bei der Bulimia Nervosa bei 22 Jahren. Eine genetische Prädisposition der Anfälligkeit für Anorexia und Bulimia Nervosa ist möglich (Zwillingsstudien), wobei die Ergebnisse bei Bulimikerinnen weniger einheitlich sind. Vermutlich prädisponieren genetische Faktoren nicht direkt für eine bestimmte Essstörung, sind aber für eine bestimmte körperliche Bedingung (z. B. Bildung bei Körperfett bei Mädchen in der Pubertät) verantwortlich. Frauen mit Essstörungen waren häufig pummelige Kinder. Physiologische und behaviorale Faktoren: Essstörungen treten bei jungen Frauen nach längerer Fastenzeit oder Diät auf. Das Diäthalten steht in korrelativem Zusammenhang mit Essanfällen und bedingt Essanfälle auch mit. Der Körper verlangt nach Kohlenhydraten und Fetten, die Gedanken kreisen sich um's Essen. Die kognitive Kontrolle geht bei gezügeltem Essen, welches durch Stressbelastungen und pos. / neg. Stimmungen verursacht wird, leicht verloren. Frauen, die an Anorexie leiden (restriktiver Typus, nahrungsdepriviert sind) reagieren auf Essens - Stimuli mit einer deutlich geringeren Speichelsekretion als Frauen mit Bulimia Nervosa, deren Diätverhalten starken Schwankungen unterworfen ist. Das klassische Konditionierungsmodell von Jansen (1995) kann diese Befunde erklären: Die aufgenommene Nahrung (US) löst unkonditioniert Stoffwechselprozesse aus. Wenn auf den Anblick oder Geruch von Speisen oft reichliche Nahrungsaufnahme folgt, können sie zu unkonditionierten Stimuli werden und ihrerseits die geschilderten physiologischen Reaktionen auslösen, ohne dass zuvor eine Nahrungsaufnahme erfolgt. Anorektikerinnen etablieren ein Extinktionsprogramm für ihre antizipatorischen, physiologischen Reaktionen, schaffen damit günstige Voraussetzungen, um die Diät weiterhin durchzuhalten. Dagegen Menschen mit Bulimia Nervosa oder Binge - Eating - Störung zwischen Diät- oder Fastenphasen und Phasen, in denen sie reichlich essen. Das Überessen geschieht oft am Abend allein zu Hause unter Stress. Die externen und internen Bedingungen können leicht die Funktion konditionierter Stimuli für die antizipatorischen, physiologischen Reaktionen erlangen. Sie unterscheiden sich zur Anorexie auch, indem ihre Gedanken in der Fastenzeit sich um die Konfrontation mit Nahrung kreisen. Sozialisation: Interaktionsmuster in Familien anorektischer Patientinnen zeigen sich durch Rigidität, geringe Konfliktbewältigung, Übervorsorglichkeit, etc. Mütter von Töchtern mit einer Essstörung klagen oft über eine geringe Familienkohäsion. Ungünstige innerfamiliäre Beziehungen können zu einer starken Belastung werden und zu einer Aufrechterhaltung der Störung beitragen. Möglicherweise spielt aber auch das essensbezogene Verhalten der Mütter und ihre Einstellung gegenüber Figur und Gewicht eine wichtige Rolle. Sie ihrerseits zeigen oft gestörtes Essverhalten und haben eine problematische Einstellung gegenüber der Figur und dem Gewicht ihrer Töchter. Die Töchter gezügelt essender Mütter zeigen grössere Angst dick zu werden. Soziokulturelle Aspekte: In der westlichen Welt steht eine grosse Nahrungsauswahl einem extremen Schlankheitsideal gegenüber. Auf Frauen lastet ein normativer Druck des Schlankheitideals, den sie bereits als junge Mädchen als positiv zu bewerten lernen. Das Selbstgefühl ist abhängig von ihrer Figur. Das Problem verschärft sich in der Pubertät, wenn der Fettanteil genetisch bedingt vervielfacht wird, Diäten sind dann häufig. Die übermässige Beschäftigung mit der Figur, Sorge um Gewicht und Aussehen und das Bemühen um Nahrungsrestriktion sind auch kennzeichnend für die genannten Essstörungen. Belastungsfaktoren: Entgegen der These unterscheiden sich Frauen mit Essstörungen bezüglich der Häufigkeit sexueller Traumata (ablehnende Einstellung zum eigenen Körper, ablehnende Haltung gegenüber der Sexualität, etc.) vor Krankheitsbeginn nicht von Frauen ohne Essstörungen. Sexuelle Traumata erhöhen das Risiko der Entwicklung psychischer Störungen generell(auch Essstörung, aber nicht spezifisch)! Essstörungen zeigen sich auch häufiger im Zusammenhang mit komorbiden psychischen Störungen. Fazit: Genetische Faktoren können beteiligt sein, gesellschaftlicher Normendruck in Richtung Schlankheit und biobehavioralen Faktoren (wie Fasten) haben eine wichtige Bedeutung. 33.3 Essstörungen: Intervention (S. 767 - 775) Die Psychotherapie setzt bei Ernährungsumstellung, Veränderung von Körperschemastörungen, negative Gefühle gegenüber der Figur und Veränderung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Belastungen und Essverhalten an Es werden meist kognitive Strategien eingesetzt, um Sichtweisen zu überprüfen und evtl. Denkweisen und Gefühlsmuster zu ändern. Neben den symptomorientierten kognitiven Therapieansätze wird bei der Bulimia Nervosa und bei der Binge - Eating - Störung auch die interpersonelle Therapie erfolgreich eingesetzt. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Veränderung aktueller interpersoneller Probleme und Konflikte, Verbesserung der Beziehungsfähigkeit. Essstörungen werden auch pharmakologisch behandelt, v. a. durch Antidepressiva. Kognitiv - behaviorale Behandlungskonzepte: Ernährungsumstellung - Um der Mangelernährung und den damit verbundenen psychologischen Folgeerscheinungen (z. depressive Verstimmungen) entgegenzuwirken, werden essgestörte Patientinnen angeleitet, täglich drei Hauptmahlzeiten, zu 50% aus Kohlenhydraten, 30% aus Fett, 12% Eiweiss. Bei der Anorexia Nervosa ist zu Beginn die Gewichtssteigerung ein Hauptziel, dies können sie nur durch ein gutes Aktivitätsniveau erreichen. Um die Compliance (Bettruhe, etc.) einzuhalten, sind spezielle Strategien der Gesprächsführung empfehlenswert. Im Gegensatz zu Bulimikerinnen werden Anorektikerinnen oft zunächst stationär behandelt, bis ein BMI von > 13 erreicht ist, wenn schwere körperliche Komplikationen auftreten und bei akuter Suizidgefahr. Bei der Binge - Eating Störung wird v. a. der chaotische Essstil ambulant behandelt. Therapie von Körperschemastörungen: Zur Veränderung der negativen emotionalen Reaktionen gegenüber dem Körper und zur Erweiterung der Beurteilungskriterien gegenüber der äusseren Erscheinung und Attraktivität werden Expositionsübungen anhand von Videoaufnahmen oder Spiegeln sowie Bewegungsübungen eingesetzt, dass sich die Patientinnen mit ihrem Körpererleben auseinandersetzen. Am Ende der Therapie haben die Patientinnen gelernt, ihren Körper zu akzeptieren und haben ihre Bewertungskriterien erweitert. Therapie von Belastungsreaktionen: Patientinnen mit Essstörungen sind oft Belastungen ausgesetzt. Die Art der Intervention hängt davon ab, ob die Patientinnen Fertigkeitsdefizite haben oder ob sie übermässig starke emotionale Reaktionen auf Belastungen zeigen. Bei Fertigkeitsdefiziten sind Trainings zur Verbesserung der Kompetenzen im Umgang mit Problemen / Bewältigung von Stresssituationen angezeigt. Beim Problemlösetraining wird das Problem von Patientinnen definiert und Lösungen gesucht, evaluiert und eingesetzt. Im Stressbewältigungstraining wird den Patientinnen das SORK Modell angewandt auf ihre Situation vermittelt und Stressbewältigungsstrategien werden erarbeitet und erprobt. Die Expositionstherapie ist angezeigt, wenn die Patientinnen übermässig starke emotionale Reaktionen auf Belastungen zeigen oder eine zu geringe Toleranzschwelle gegenüber aversiven Situationen und Gefühlslagen haben. Sie werden dabei diesen Situationen und Gefühlslagen ausgesetzt, ohne dass sie ihr problematisches Essverhalten zeigen können. Die meisten verhaltensorientierten Programme werden durch spezielle kognitive Strategien ergänzt, in denen neue Denk- und Interpretationsmuster angeregt werden. Im Behandlungskonzept (kognitive Intervention) von Tausche und Florin versetzt sich der Therapeut in die Situation der Patientinnen und nimmt zentrale Befürchtungen, etc. der Patientinnen vorweg (systemimmananente Strategien der Gesprächsführung). Ziel dieser Intervention ist es, den Patientinnen zu helfen, um ihnen Vor- und Nachteile ihrer Zielvorstellungen bzw. Verhaltensweisen bewusst zu werden und sich unter Abwägung aller Aspekte selbstbewusst für eine Alternative zu entscheiden. Interpersonelle Therapie: Bei der Bulimia Nervosa konzentriert sich diese Therapie auf die interpersonellen Belastungen, welche diese Störung aufrechterhalten. Das Konzept der Therapie wurde von dem zur Behandlung von Depressionen adaptiert: Anfangs werden die interpersonellen Probleme genau diagnostiziert. Während der Therapie werden Sichtweisen, Erwartungen und Gefühle der Patientinnen bzgl. betreffender Problembereiche detailliert herausgearbeitet und Ansätze zur Veränderung der Probleme erarbeitet, welche von den Patientinnen in ihrem sozialen Umfeld umgesetzt werden sollen. Wirksamkeit der Psychotherapie: Als Behandlungsmethoden werden meist psychotherapeutische Methoden, selten medizinisch - internistische oder pharmakotherapeutische Massnahmen eingesetzt. Die psychotherapeutischen Methoden setzen sich oft aus mehreren theoretischen Richtungen (psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Interventionen) zusammen. Die Interventionen führen bei der Bulimia Nervosa zur Normalisierung des Essstils, zur Veränderung dysfunktionaler Einstellungen gegenüber der Figur und dem Gewicht und zum Aufbau von Coping - Skills, um Essanfällen zu widerstehen. Eine Expositionstherapie kann den funktionalen Zusammenhang zwischen Belastungsreaktionen und Essanfällen reduzieren. Eine kognitiv behaviorale Therapie scheint der interpersonellen Therapie und einem Ernährungstraining überlegen zu sein. Bei den meisten Bulimikerinnen können durch kognitiv - behaviorale Interventionsmehoden (Ernährungstraining, kognitive Therapie zur Veränderung dysfunktionaler Einstellungen, Expositionstherapie, Stressreduktionstraining, etc.( deutliche Verbesserungen in der Symptomatik erreicht werden. Bei der Hälfte wird eine völlige Symptomfreiheit erzielt. Auch die interpersonelle Therapie hat langfristig betrachtet gute Effekte, sie setzen zeitlich aber später ein als bei der kognitiv behavioralen Therapie. Wirksamkeit der Pharmakotherapie: Heute werden bei Essstörungen v. a. Antidepressiva eingesetzt, um die häufig bestehende komorbide Depression zu behandeln und damit dieses Begleitsymptom auszuschalten (ohne Ätiologieverständnis von Essstörungen). Bei der Anorexia Nervosa konnten weder kurz- noch langfristige Effekte gefunden werden. Bei der Bulimia Nervosa werden v. a. trizyklische Antidepressiva, MAO - Hemmer und selektive Serotonin - Wiederaufnahmehemmer eingesetzt. Im Vergleich zur Effizienz von psychologischen Therapien schneiden medikamentöse Behandlungen deutlich schlechter ab. In Kombinationsstudien erzielte die medikamentöse Therapie keine zusätzlichen Steigerung der Besserungsrate. Fazit: Es wurden plausible Konzepte zur Behandlung von Essstörungen entwickelt und evaluiert, die zu einer Heilung / Besserung der Essstörung und den Begleit- und Folgeproblemen führen. Ein gewisser Anteil essgestörter Patientinnen hat aber bis jetzt von keinem der Behandlungsansätze profitiert. Störungen von Funktionsmustern 34. Störungen durch psychotrope Substanzen 34.1 Klassifikation und Diagnostik Missbrauch und Abhängigkeit Substanzen, die eine direkte Wirkung auf die Funktion des ZNS sind die entscheidenden Definitionskriterien. Substanzmissbrauch liegt nach DSM - IV vor, sofern Abhängigkeit ausgeschlossen ist, wenn eines oder mehrere der vorliegenden Merkmale innerhalb der letzten 12 Monate vorliegt: (1) Der wiederholte Substanzgebrauch führt zur Beeinträchtigung der Verpflichtungen am Arbeitsplatz, in der Schule oder zu Hause. (2) Wiederholter Gebrauch der Substanzen in Situationen, in denen der Gebrauch eine körperliche Gefährdung darstellt. (3) Wiederholte substanzbedingte Rechtsverstösse. (4) Obwohl durchgehende oder wiederholt auftretende soziale oder interpersonelle Probleme durch die verursacht oder verstärkt werden, wird diese fortdauernd eingenommen. Substanzabhängigkeit wird nach den DSM gestellt, wenn mindestens 3 der folgenden Kriterien in demselben 12 - Monate - Zeitraum auftreten. (1) Toleranzentwicklung durch: Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung (um Intoxikationszustand oder erwünschten Effekt herbeizuführen) oder deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetzter Einnahme derselben Dosis. (2) Entzugssymptome (3) Die Substanz wird in grösseren Mengen oder länger als beabsichtigt eingenommen. (4) Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren. (5) Viel Zeit für Aktivitäten, um die Substanz zu beschaffen, sie zu sich zu nehmen oder sich von ihren Wirkungen zu erholen. (6) Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des Substanzmissbrauchs aufgegeben oder eingeschränkt. (7) Fortgesetzter Substanzmissbrauch trotz Kenntnis eines anhaltenden oder wiederkehrenden sozialen, psychischen oder körperlichen Problems, das wahrscheinlich durch den Substanzmissbrauch verursacht oder verstärkt wurde. Ausgenommen wird von dieser Einteilung die Coffeinabhängigkeit, da der Kaffeekonsum im allgemeinen keine psychischen Beschwerden hervorruft. Polytoxikomane Patienten (Abhängigkeit mehrerer Substanzen: Alkohol, Amphetamine, Cannabis, Halluzinogene, Inhalantien, Kokain, Opiate, Phencyclidin, Sedativa Hypnotika anxolytikaähnl. Substanz, Polytoxikomanie, Nikotin) werden mit entsprechenden Achse 1 - Diagnosen beschrieben. Hirnorganische Begleiterscheinungen der Intoxikation oder des Entzugs von einer der Substanzen werden im DSM - IV als organisch bedingte Störungen beschrieben und auf Achse 1 als zusätzliche Diagnose gestellt. Im DSM - IV werden für die einzelnen Substanzklassen keine spezifizierten Diagnosekriterien für den Fall der Abhängigkeit oder des Missbrauchs angegeben. Diagnostik: Die wichtigsten Daten betreffen die Dauer des Substanzmissbrauchs, das Alter zu Beginn des Missbrauchs, bisherige Behandlung(en), Suizidversuche, sowie eine möglichst genaue Erhebung der menge und der örtlichen und zeitlichen Konsumgewohnheiten einschliesslich der kognitiven Bedingungen wie Einstellungen bzgl. des Substanzkonsums. Durch Fremdbeurteilungen sollten Informationen eingeholt und validiert werden, ob die Anforderungen am Arbeitsplatz gewachsen sind oder nicht, auch die soziale Anamnese (Familie, Sozialkontakte, Kommunikationsschwierigkeiten) sollten einbezogen werden. Der Münchner Alkoholismustest MALT (Feuerstein et al., 1979) dient der Statusdiagnostik und besteht aus getrennten Selbst- und Fremdbeurteilung. Dabei werden Items zum Alkoholkonsum erfasst. Bei den Beschwerden und Problemen werden folgende Bereiche erfasst: (1) Trinkverhalten und Einstellung zum Trinken (2) Alkoholbedingte psychische und soziale Beeinträchtigung (3) Somatische Störungen Der Test enthält keine differentielle Indikationsstellung bzgl. Therapie, dafür sind Anamnesegespräche notwendig. 34.2 Störungen durch psychotrope Substanzen: Ätiologie / Bedingungsanalyse Die WHO definiert Abhängigkeit als ein Cluster von physiologischen, Verhaltens-. und kognitiven Phänomenen, in dem die Einnahme einer oder mehrerer Substanzen gegenüber anderen Verhaltensweisen, die früher hohen Wert für die Person besassen, eine höhere Priorität einnimmt, ein unüberwindbares Verlangen nach Drogen, Alkohol oder Nikotin (psychische Abhängigkeit). Die physische Abhängigkeit ist durch körperliche Entzugssymptome gekennzeichnet. Meistens führt den Weg in die Abhängigkeit von einer Substanz über den Missbrauch derselben. Das DSM - IV gibt 10 Substanzklassen, die sich in ihrer Wirkung auf das ZNS in 3 Kategorien einteilen lassen: - Substanzen, die eine sedierende Wirkung auf die ZNS - Aktivität ausüben (Alkohol, Opiate und Sedativa). - Drogen, die die ZNS - Aktivität stimulieren (Koffein, Kokain, Amphetamine, Inhalantien und Nikotin). - Halluzinogene wie LSD, Meskalin, Psilocybrin, MMDA = Ecstasy), DOM, DMT und PCP = angel dust). Die Cannabis - Drogen nehmen eine Zwischenstellung ein, da sie halluzinogene wie sedierende und stimulierende Wirkungen haben. Die drei Wirkungsweisen sind nicht in einfache Genesemodelle (sedierende Substanzen für Gestresste, stimulierende Substanzen als Aufputschmittel, Halluzinogene für sensation seeking Menschen)darzustellen. Man geht heute von einem multifaktoriellen Geschehen oder ein polykausales Bedingungsgefüge aus. Genetische Bedingungen der Entstehung von Süchten: Das Diathese - Stress Modell (Comer, 1995) wurde auch auf Süchte angewandt: Dabei wird als Diathese der durch eine genetisch bedingte Veranlagung begründete Vulnerabilitätsfaktor definiert (Mutation eines oder mehrere Genorte als kausale bzw. risikomodifizierende Grösse). Biologisch - psychologische Konzepte: Bei Süchten handelt es sich um Stoffe, die das Gehirn- und Körperfunktionen, das Befinden und das Verhalten verändern. Die Wirksamkeit und die Dosis von Drogen hängen ab: (1) von der Art der Einnahme (2) von der Leichtigkeit, mit der sie das Gehirn erreichen (3) wie gut sie mit Rezeptoren des ZNS interagieren (4) wie schnell sie im Körper wieder abgegeben werdenDie Wirkungsgeschwindigkeit ist vom Delay abhängig, in der die Substanzen über den Blutkreislauf dorthin gelangen. Intravenös geht schneller als schnupfen oder oral. Die Substanz muss aber auch die Blut - Hirnschranke passieren. Neurophysiologische Wirkungen von Drogen: Vom ZNS können die verschiedenen Drogen auf verschiedene Weise in die synaptischen Nervensysteme eingreifen: - Drogen können zur Entleerung von Vesikeln innerhalb der präsynaptischen Endigung führen. - Die Transmitterkonzentration kann vor der präsynaptischen Membran erhöht werden. - Drogen können den Transmitterausstoss in den synaptischen Spalt blockieren. - Drogen können Enzyme inhibieren, die Transmitter synthetisieren. - Sie können den Reuptake von Neurotransmittern hemmen. - Sie können Enzyme blockieren, die Neurotransmitter im synaptischen Spalt abbauen. - Drogen können aufgrund ihrer chemischen Ähnlichkeit an postsynaptische Rezeptoren binden und dadurch die natürlichen Transmitter ersetzen oder deren Wirkung blockieren. Beim wiederholten Gebrauch von Substanzen kommt es zur Neuroadaptation (Toleranzentwicklung, wobei die Reaktion auf die Droge bei wiederholtem Gebrauch reduziert wird. Es treten Entzugssymptome auf, die durch die erneute Zufuhr der Substanz beendet werden. Neurophysiologische Verstärkungswirkungen von Drogen: Nahezu alle psychoaktiven Substanzen haben positive Verstärkungseigenschaften. IN molekularen und zellulären Mechanismen bestehen Abhängigkeiten - mehrere Hirnareale weisen eine Funktion von operanten Verstärkungsmechanismen auf, die auch an der Vermittlung von Verstärkungseffekten von Drogen beteiligt sind (Opoide, Alkohol, Psychostimulatien). Zentral für die den Dopamin produzierenden nucleus accumbens im Hirnstamm mit seinen dopaminergen Verbindungen zum Limbischen System und das mittlere Vorderhirn mit dopaminergen, noradrenergen und serotonergen neuronalen Projektionen. Belohnende Drogenwirkungen werden mit externen und internen Hinweisreizen gekoppelt und lösen beim Drogengebrauch Lernprozesse aus Einnahme, Entzugsphase)- Die Drogenwirkung und die Löschungsresistenz sind individuell unterschiedlich. Da Opponenten - Prozess - Modell (Solomon & Orbit, 1974) Es basiert auf folgenden Suchtphänomenen: - auf dem hedonistischen Zustand, der durch die ersten Substanzeinnahmen erzeugt wird und als positiver Primäraffekt beschrieben werden kann, - auf der mit dem wiederholten Gebrauch der Substanz eintretenden affektiven Toleranz (Wirkung flacht bei gleicher Dosis ab) - Das affektive Entzugssymptom tritt als negative hedonistische Folge eines einzelnen Drogengebrauchs auf. In der 2. Phase, parallel zum metabolischen Abbau der Substanz, tritt sie während des Entzugs statt. Die Autoren unterscheiden 2 Phasen: Als Prozess A wird die im Substanzgebrauch anfangs auftretende positive emotionale Drogenwirkung bezeichnet (hängt von der Dosis, der Dauer einer Gebrauchsperiode und der Art der Einnahme ab. Der Prozess A hat als Nacheffekt den Prozess B zur Folge. Eine solche kompensatorische Reaktion kann in mehrmaligem Drogenbrauch bestehen, dass postsynaptische Rezeptoren in ihrer Anzahl vermehrt oder sensitiviert werden. Beim Absetzen der Droge oder bei der durch die metabolische Aktivität eintretende Konzentrationsabnahme hält die hohe Feuerungsrate der Nervenzellen an und erzeugt Nachwirkungen der Substanzeinnahme. Da der Prozess B bei wiederholter Drogeneinnahme früher einsetzt, stärker ist und länger anhält, kann er bereits bei der Abfolge A-B auftreten, oder an konditionierte Hinweisreize gekoppelt werden. Diese konditionierten diskriminativen Reize können dann den Primär- und / oder den Nacheffekt auslösen. Lerntheoretische Konzepte der Entwicklung und Aufrechterhaltung substanzinduzierter Abhängigkeiten: Neben theoretischen Erklärungen bzgl, sozialen Gruppen, gehen diese Konzepte v. a. auf Mechanismen ein, welche die Substanzabhängigkeit aufrechterhalten. Neugierde, sozialer Druck etc. werden als Bedingungen gesehen, die zum ersten Konsum verleiten. Im ZweiFaktoren - Lerngeschehen wirken die euphorisierende Drogenwirkung, das verbesserte soziale und emotionale Reaktionsvermögen, etc. als positive Verstärker. Als negative Verstärker wirken Entzugserscheinungen, Reduktion von Hemmungen, Angst, etc. gesehen, welche diesen Prozess aufrechterhalten. Die Spannungsreduktionshypothese sieht mangelnde Angstund Stressbewältigung indirekt für viele Abhängigkeiten verantwortlich, die eine spannungsreduzierende Wirkung haben. Doch kann diese Stressreduktionshypothese nur bedingt in Zusammenhang mit dem Risikofaktor mangelnde Stressbewältigung als vermittelnde Grösse bei der Entstehung von Abhängigkeiten gesehen werden. Sozialisationseinflüsse: Unabhängig von ihrem theoretischen Hintergrund gehen diese Modelle davon aus, dass Einflüsse der sozialen Umwelt (durch Familienmitglieder oder das weitere soziale Umfeld) die Risikofaktoren zur Entwicklung einer Abhängigkeit fördern. Im Vordergrund stehen Untersuchungen zu prä- und komorbiden psychischen Störungen und entwicklungspsychologische Analysen des Familieneinflusses. Milieu- vs. familienbedingter Alkoholismus: Cloninger (1987) unterscheidet 2 Typen von Alkohoolikern - Typ I (milieubeeinflusster Typ) und den auf Männer eingeschränkten Typ II - Alkoholissmus. Unter Milieu wird das weitere soziale Umfeld gesehen. Kinder von Typ - I - Alkoholikern ein doppelt so grosses Risiko selbst Alkoholismus zu entwickeln (vgl. mit Kontrollgruppe). Adoptierte Söhne von Typ - II - Alkoholikern haben ein neunfaches Risiko, adoptierte Töchter kaum ein Risiko selbst Alkoholismus zu entwickeln. Die Abhängigkeit bei Typ - I - Alkoholikern entwickelt sich nach dem 25. Lebensjahr, zeigen kaum ein spontan auftretendes Bedürfnis nach Alkohol , sind selten delinquent, zeigen häufig psychische Abhängigkeit von Alkohol und zeigen Kontrollverlust, ziehen sich zurück. Typ - II - Alkoholiker zeigen selten körperliche Symptome, doch sind häufig delinquent. Die Abhängigkeit entwickelt sich vor dem 25. Lebensjahr, haben häufig kein Verlangen nach Alkohol, haben kein Schuldbewusstsein und sind aktiv. Cloninger schreibt den beiden Typen verschiedene Verhaltensregulationssysteme im Gehirn zu. Die Persönlichkeitseigenschaften des Typ - I werden durch serotonerg noradronerg und arbeitende Hirnregionen des Verhaltensinhibitionssystems und des verhaltensaufrechterhaltenden Belohnungssystems bestimmt. Die Verhaltenseigenschaften des Typ - II - Alkoholikers werden v. a. durch das dopaminerg arbeitende Verhaltensaktivierungssystem gesteuert- Die jüngste (familiäre) Forschung geht von Diathese - Stress - Modellen aus. Vermittelnde Persönlichkeitsfaktoren zum Alkohol-/ Drogenmissbrauch kommen vermehrt bei Diagnosen von Angst und Depression vor. Risikofaktoren sind auch Abhängigkeit oder psychopathologische Auffälligkeiten der Eltern. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität sind vulnerabilisierende Persönlichkeitseigenschaften. Wärme und Zuwendung in der Familie kann Jugendliche von der Sucht bewahren. Soziologische Bedingungsfaktoren liegen darin, dass es ohne die jeweilige Substanz auch keine Abhängigkeit gibt. Der Rest sind historische Erklärungen. Sozial protektive Bedingungsfaktoren: Der am besten dokumentierte psychologisch protektiv wirksame Faktor liegt in der Vermittlung und Förderung sozialer Kompetenzen, der schwache Widerstand gegen negative peerGruppeneinflüsse besteht v. a. aus mangelnden sozialen Fertigkeiten und Problemlösefähigkeiten, Gut entwickelte soziale Fertigkeiten sind der beste Schutz gegen den Alkohol- und den Tabakkonsum, aber auch gegen das Probieren von Cannabis oder anderen Drogen. Es gibt also biologische und psychologische Aspekte der Substanzabhängigkeit, welche zusammen eine Theorie ergeben. Unklar ist, wie Störungsmodelle der Alkoholforschung sich auf andere Abhängigkeiten übertragen lassen. Kognitions-, entwicklungs. und sozialpsychologische Ansätze, sowie Persönlichkeits-, lern- und motivationspsychologische Überlegungen dürfen in einer gesamten Theorie nicht fehlen. 34.3 Störungen durch psychotrope Substanzen: Intervention (S. 799 816). Gemeinsame Merkmale der Symptomatik und Behandlung aller Klassen der Substanzabhängigkeit: DSM-IV und ICD-10 berücksichtigen neben körperlichen und psychischen Folgen von Intoxikationen v. a. Abhängigkeit nur das Auftreten weniger Kriterien von 7 bis 8 Symptomen. Die Symptome sind für Klassifikationszwecke ausreichend, müssen aber für die Behandlungsplanung auf 3 Ebenen differenziert werden: (1) Behandlung der körperlichen Auswirkungen: Körperliche Abhängigkeit einer Hauptsubstanz, zusätzlicher Missbrauch anderer psychoaktiver Substanzen, körperliche Begleit- und Folgeerkrankungen. (2) Behandlung der psychischen Funktionsstörungen Wahrnehmungsstörungen Gedächtnisstörungen, Denk-/ Problemlösungsstörungen Sprachstörungen, emotionale Störungen, Motivationsstörungen. (3) Behandlung der Entwicklungsstörungen im Bereich der Lebensführung (Zeitpunkt des Beginns des Drogenkonsums, etc.). Abhängige zeigen oft wenig Motivation zur Behandlung. Motivation ist dabei der Grad der Veränderungsbereitschaft, bzgl.: - den Beginn einer Behandlung - die kognitive Mitwirkung an der Erreichung der Therapieziele während der Behandlung bis zum planmässigen Abschluss - die Vermeidung von Rückfällen nach Ende der Behandlung. Die körperliche Abhängigkeit und das Verlangen, die benötigte Dosis einzunehmen, führen dazu, dass die Motivation zur Veränderung gering ist. Erst nach Jahren, wenn die negativen Konsequenzen des Konsums stärker als die positiver werden, sind Abhängige zur Behandlung bereit. Die Motivation zur Fortführung und planmässiger Behandlung ist instabil. Der Abhängige wird normalerweise immer wieder rückfällig, die Rückfallzeiten werden kürzer und die erfolgreichen Phasen länger. Doch der Zyklus von Contemplation - Action - Addiction - Free Life of Terminators - Maintenance Relapse - Addicted Life of Precontemplation bleibt bestehen. Die jeweilige Phase muss im Einzelfall erfasst werden. 1.Precontemplation: fehlendes Problembewusstsein, keine Änderungsbereitschaft, geringe therapeutische Einflussmöglichkeiten (Umweltveränderungen) 2. Contemplation: Aufbau eines Problembewusstseins, Selbstbeobachtung, Abwagen von Vor- und Nachteilen. Therapie: Förderung der Selbstbeobachtung und der Entscheidungsbildung. 3. Action: Beginn einer Behandlung, Bereitschaft zu Veränderung. Therapie: Kompetenzförderung und Zukunftsplanung. 4. Maintenance: Aufrechterhaltung der Behandlungsziele - Bereitschaft zu diesen. Therapie: Kompetenzen zur Verminderung des Rückfallrisikos, Bewältigung von Rückfällen. Die Rückfallsquote ist wegen kognitiven, emotionalen und motivationalen Vorläufern hoch. Ein Modell zur Rückfallprävention findet sich auf S. 803. Es geht von einer geringen Selbst - Effektivität und sich selbsterfüllenden Prophezeiungen aus, v. a. verhaltenstherapeutisches Methodeninventar. Therapeutische Versorgungsstruktur: Notschlafstellen (u. a. Gespräche), qualifizierter Entzug (Entgiftungseinrichungen), Methadon - Substitution. Therapeutische Konzepte und Massnahmen liegen in professionellen Therapien, Selbsthilfegruppen ehemaliger Abhängiger, etc. Medikamentöse Behandlung: Man unterscheidet nach der Entgiftung zur Reduzierung des Rückfallrisikos alkoholsensibilisierende Medikamente, die den Klienten mit Abstinenz motivieren, da es in Kombination mit Übelkeit assoziiert wird, und Opiatantagonisten, die Opiatrezeptoren im Körper blockieren. Die euphorische Wirkung fällt dann aus und wird negativ, was zu einer Löschung führt. Diese Behandlung ist für motivierte und sozial integrierte Abhängige sinnvoll. Die Methadon - Substitution hat Vorteil, dass Methadon oral eingenommen werden kann (keine Infiszierung), hat keine euphorisierende Wirkung, macht kontakt- und arbeitsfähig. Nachteil ist, dass es nach in 24h wirkt vs. Heroin nach 8h. Probleme liegen darin, dass Kriminalität nach der Substitution häufig ist, wenn neben Methadon andere Drogen konsumiert werden, kann dies gesundheitliche Risiken haben. Im Vordergrund der therapeutischen Versorgungen stehen eklektische Ansätze, ohne dass es eine theoretische oder empirische Grundlage gibt gruppenanalytische Verfahren (PA ist kontrainduziert, GT bei Urteilsbildung nützlich Am differenziertesten sind verhaltenstherapeutische Verfahren (siehe S. 807). Soziotherapeutische Behandlungen gehen v. a. von Selbsthilfe aus (fehlen professioneller Mitarbeiter), als Unterstützung des Alltags. Behandlung von Alkoholabhängigen: Therapieziele in Programmen sind: - Einsicht in die Notwendigkeit einer langfristigen Abstinenz. - Vermeidung von Rückfällen in kritischen Situationen - Adäquates Verhalten nach Rückfällen. - Verbesserungen in belastenden Lebensbereichen. - Beseitigung / Reduzierung individueller Störungen. Aus Kostengründen werden in Kliniken auch gruppentherapeutische Massnahmen, welche durch Einzeltherapie unterstützt werden können. Standardmassnahmen bestehen in funktionaler Verhaltensanalyse Entspannungstraining - Selbstkontrolltechniken - Einübung von Selbstsicherheit - Kognitive Umstrukturierung - Anleitung zur sinnvollen Freizeitgestaltung Selbstorganisation - Individuelle Massnahmen. Es wurden Verschiedene Modelle für Alkoholprobleme entworfen (Moral, Abstinenz, Erziehung, systemischer Ansatz, kognitive Abläufe, biologische Prozesse, etc.), die von zentralen persönlichen Faktoren (persönliche Verantwortung, Alkohol, Mangel an Wissen und Motivation, familiäre Dysfunktion, Erwartungen / Überzeugungen, Vererbung, etc.) und Interventionen (moralisierendes Gespräch, Ermahnung, Erziehung, Familientherapie, kognitive Therapie, medizinische Behandlung) postulieren. Behandlung von Drogenabhängigen: Die (ambulante) Methadon - (bzw. Codeinprodukte)Substitution und die stationäre therapeutische Wohngemeinschaft stehen im Vordergrund. Ergebnisse zeigen, dass bei Drogenabhängigen auch bei Langzeitkatamnesen 20 - 30% gute therapeutische Ergebnisse erreicht werden. 35. Schizophrenie 35.1 Klassifikation und Diagnostik (S. 819 - 825) Unter Schizophrenie wird eine psychopathologisch und vermutlich auch ätiologisch heterogene Gruppe von Störungen zusammengefasst. Die Gemeinsamkeiten dieser Patienten mit dieser Diagnose liegt in einem drastischen Abfall des psychosozialen Funktionsniveaus im früheren oder mittleren Erwachsenenalter ohne dass gravierende Ursachen (vgl. PTSD) erkennbar wären. Die häufigste Positiv - Symptomatik (Wahngedanken) tritt bei 75% auf, auch die Negativ - Symptome treten nicht bei allen dieser Patienten auf. DSM - IV verlangt ein 6 - monatige Bestehen dieser Störung, währenddem ICD - 10 eine einmonatige akut - psychotische Phase zur Diagnose vorschreibt (vgl. S. 820 / 821). Auch Entscheidungsregeln zu Mischbildern mit psychotischer und affektiver Symptomatik unterscheiden sich. Probleme zur Differentialdiagnose der Reliabilität und Stabilität ergeben sich bzgl. Störungen mit ähnlichen Symptomen (z. B. paranoide, schizotypische Störung), v. a. inkonsistenten Klasifikationsregeln, z. B. Doppeldiagnosen von Achse I und Achse II - Störungen. Hirnorganische Störungen und Substanzmissbrauch sind Ausschlusskriterien für die Schizophrenie. Die verschiedenen Störungen unterscheiden sich bzgl. Symptomatik und Krankheitsverlauf. Die Untergruppen von DSM - IV und ICD - 10 beziehen sich weitgehend auf Kraepelin: (1) Hepephrene Schizophrenie bzw. Desorganisierter Typus mit ausgeprägter Denkzerfahrenheit, flachem oder nicht adäquatem Affekt und desorganisiertem Verhalten, schwere psychosoziale Beeinträchtigungen, ungünstiger Verlauf (2) Katatone Schizophrenie mit eindrucksvollen Störungen der Psychomotorik (in Industriestaaten selten) (*) Paranoide Schizophrenie mit dominierenden Wahngedanken oder akkustischen Halluzinationen. Symptome werden in Positiv-, Negativ Symptomatik und nicht adäquatem Affekt eingeteilt Antriebsmangel, Anhedonie, Affektverflachung, nicht adäquater Affekt, Denkstörungen, bizarres Verhalten, Wahn, Halluzinationen. Diagnostik: Selbstbeurteilungsfragebögen sind in akut - psychotischen Phasen ungeeignet, da keine verlässliche Antworten erwartet werden können. Die Veränderungen sind sprachlich schwer beschreibbar, es mangelt den Patienten an Einsicht in ihre Erkrankung und ihre Beeinträchtigungen. Fragebogendaten erfordern eine Berücksichtigung der jeweiligen Krankheitsphase, eine Einschätzung der Krankheitsverleugnung (z. B. PDS von Zerssen). Daher sind Fremdbeurteilungsverfahren wichtiger. Es sind oft zusätzliche Beurteilungsverfahren wie die DAS der WHO oder die GAF der DSM erforderlich. Die Erhebungen sollten standardisiert durchgeführt werden. 36.2 Schizophrenie: Ätiologie / Bedingungsanalyse (S. 826 - 836) Epidemiologische Befunde: Die Inzidenzrate liegt etwa bei 10 / 100'000. Das Geschlecht hat keinen Einfluss auf die Inzidenz. Männer und Frauen haben das gleiche Lebenszeitrisiko, wobei die Krankheit bei Frauen später einsetzt. Weder ökonomische, kulturelle noch ethnische Faktoren scheinen Einfluss auf das Krankheitsrisiko zu haben. Dies weist auf biologische, v. a. genetische Faktoren in der Entstehung der Schizophrenie hin. Genetik: Die Beteiligung genetischer Faktoren an der Entstehung schizophrener Erkrankungen gehört zu den am besten abgesicherten Aussagen der Ätiologieforschung (v. a. Studien nach Verwandtschaftsgrad, Adoptivuntersuchungen und Zwillingsstudien. Bei biologischen Verwandten von Schizophrenen wurde ein erhöhtes und nach dem Verwandtschaftsgrad abgestuftes Morbiditätsrisiko gefunden. Eineiige Zwillingspartner eines schizophrenen Patienten und die Kinder zweier schizophrener Eltern haben das grösste Lebenszeitrisiko (48% bzw. 46%), die Kinder eines schizophrenen Elternteils 13% auch an Schizophrenie zu erkranken. Bei Adoptivstudien sind Vergleiche zwischen genetisch belasteten und unbelasteten Adoptierten umso aussagekräftiger, je länger diese Kinder über die Lebenszeit beobachtet werden. Bei wegadoptierten Kindern schizophrener Mütter zeigt sich eine erhöhte Häufigkeit schizophrener Störungen. In psychisch gesunden Familien entwickeln diese Adoptivkinder seltener eine schizophrene Störung als in psychisch gestörten Familien. Die genetischen Ansätze gehen also von einer genetisch übertragenen Disposition aus. Doch auch bei eineiigen Zwillingen ist das Risiko für den anderen nicht mehr als 50% (Umweltfaktoren sind auch wichtig). Biologische Faktoren: biochemische Faktoren - Befunde zeigen, dass mit den Akutsymptomen wie Halluzinationen und Wahnideen eine gesteigerte Aktivität dopaminerger Neurone einhergeht. Deshalb sind auch antipsychotische neuroleptische Medikament, die postsynaptische Dopaminrezeptoren blockieren (Rate der Neurotransmission senken) und das Abklingen akuter Symptome bewirkten. Umgekehrt können Substanzen wie Amphetamin, die die dopaminerge Aktivität erhöhten, zu Akutsymptomen führen. Es wird angenommen, dass eine dopaminerge Unterfunktion im mesokortico präfrontalen System mit negativen Symptomen einhergeht. Diese Hemmung efferenter Neurone im präfrontalen Cortex steigert die dopaminerge Aktivität im mesolimbischen System, die für die Entwicklung positiver Symptome verantwortlich ist. Bei Schizophrenen sind die Seitenventrikel vergrössert, der 3. und 4. Ventrikel ist auch vergrössert. Es wurden auch Volumenverringerungen im Temporallappen berichtet. Es finden sich atrophische Veränderungen unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Ausmass ca. bei 1/3 dieser Patienten. Patienten mit hirnorganischen Veränderungen unterscheiden sich von den diesbezüglich unauffälligen schizophrenen Patienten durch mehr Negativsymptomatik und einen ungünstigeren Verlauf. Die organischen Veränderungen sind nicht progressiv und bestehen schon vor dem Ausbruch der Krankheit. Die ersten Anzeichen einer Störung treten 4.5 Jahre vor der Erstaufnahme (bei Männern früher als bei Frauen). Die Verzögerung des Krankheitausbruchs geht vermutlich auf die antidopaminerge Wirkung von Östrogen zurückgeht (nicht auf Unterschiede in der Reaktion der sozialen Umwelt oder symptomatisch unterschiedliche Verläufe für die spätere Erstaufnahme der Frauen). Frauen scheinen demnach einen Schutz gegen die Umsetzung eines genetischen Risikos in eine manifeste Krankheit zu haben Östrogen bewirkt eine Anhebung der Vulnerabilitätsschwelle. Psychophysiologische gehen von Veränderungen psychophysiologischer Reaktionsmuster und Funktionsmuster aus. Die Aufmerksamkeit Schizophrener teilt sich gleich stark auf relevante und irrelevante Reize auf (vgl. Fokussierung auf relevante Reize bei Gesunden): Das Fehlen von Orientierungsreaktionen und die verminderte Kovariation hirnelektrischer Signale mit der Reizbedeutung verweisen auf umfassende Störungen der Informationsverarbeitung. Neurokognitive Defizite: Eine Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnis (Filter, der in einem frühen Stadium der Informationsverarbeitung irrelevante Reize zurückweist) kann dazu führen, dass nachfolgende Stadien der Informationsverarbeitung zuviel an Informationen zu bewältigen haben. Üblicherweise fehlerfrei ablaufende Prozesse des Denkens und der Verhaltenssteuerung würden zusammenbrechen (Halluzinationen und Denkstörungen). Die Annahmen dieses Modells wurden aber widerlegt. Es handelt sich evtl. um Störungen der dopaminergen Modulation naher Netzwerke im Frontallappen. Zur Organisation zielgerichteter Verhaltensweisen ist die Hemmung nicht zielführender Reaktionen nötig. Nach der Dopaminhypothese (s. o.) findet eine verminderte Dopaminfreisetzung im frontalen Cortex statt Cohen & Servan - Schreiber, 1992).. Dabei ist Dopamin Neuromodulator, der die Funktionsweise gesamter neuronaler Netzwerke beeinflusst. Eine verminderte dopaminerge Aktivität im Frontallappen kann die Befunde der verminderten Kontextabhängigkeit und der vermehrten semantischen Bahnung erklären. Psychosoziale Faktoren: Prämorbide Sozialisationsbedingungen: Retrospektive Befragungen eignen sich nicht (sind verzerrt), besser sind Berichte vor dem Erkrankungszeitpunkt. Die prämorbide Persönlichkeit der späteren schizophrenen Patienten wird sozialer Rückzug, geringe Impulskontrolle und eine Tendenz zu bizarren Verhaltensweisen gesehen (Bostoner Studie). Die Mütter später an Schizophrenie Erkrankter wurden als weniger verantwortungsbewusst und weniger emotional stabil eingeschätzt. Das "Double bind" - Konzept (Bateson et al., 1956) geht davon aus, dass eine besonders ungünstige Form der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern besteht (Übermittlung entgegengesetzter Botschaften). Die Annahmen konnten aber empirisch zu ungenau getestet werden und zeigten keinen Zusammenhang zur Schizophrenie. Die Kombination aus Kommunikationsstörung und ablehnendem affektivem Stil scheint als Besonderheit von Eltern, deren Kinder als Erwachsene eine schizophrene Störung entwickeln, zu bestehen. Psychosoziale Belastungen: Der Zusammenhang zwischen Schicht und Erkrankungsraten ist nur bei Grossstadtbewohnern deutlich, in mittleren Städten schwächer und in ländlichen Gebieten nicht nachzuweisen. Die "social stress" oder "social causation" Hypothese besagt, dass das Leben unter psychosozial schwierigen Bedingungen für die erhöhte Schizophrenierate verantwortlich ist. Die "social drift" oder "social seloection" Hypothese besagt, dass bereits im Vorfeld der Erkrankung Schizophrene wegen der Beeinträchtigungen ihrer Fähigkeiten in unteren Sozialschichten absinken können (social drift), sie können am üblichen Aufstieg in bessere Lebensumstände nicht teilhaben (selection). Der Vergleich eingewanderter, aber unterprivilegierter ethnischer Gruppen in Israel zeigte, dass entgegen der social selection Hypothese (besser ausgebildete, aufstiegsorientierte europäische Juden erreichen höhere Schichten, Schizophrene verbleiben in unteren Schichten), dass die Prävalenz schizophrener Störungen in der Unterschied höher war als bei einer Vergleichsgruppe aus Nordafrika eingewanderter unterprivilegierter Juden (Levav & Shrout, 1992). Anhand klinischer Beobachtungen wurde die Hypothese formuliert, dass lebensverändernde Ereignisse als psychosoziale Stressoren an der Ätiologie schizophrener Erkrankungen beteiligt sein können. Ihr Einfluss scheint aber deutlich geringer als bei affektiven Störungen. Dagegen gibt es einen Zusammenhang Zwischen dem Rückfallrisiko und psychosozialen Belastungen. Bei Patienten, die bei ihren Angehörigen leben, ist der Einfluss des emotionalen Klimas auf das Rückfallrisiko nachgewiesen. Arbeiten über "expressed emotion" zeigen ein geringeres Rückfallrisiko bei Patienten, deren Angehörige eine tolerante und akzeptierende Einstellung haben, nicht überfürsorglich sind. Fazit: Zum Risiko schizophrener Erkrankungen scheinen genetische Faktoren, Hirnschädigungen und psychosoziale Belastungen beizutragen. Die genetischen Modelle des Risikos sind weit entwickelt, können aber die Entstehung einer Schizophrenie nur teilweise aufklären. (Diskordanz bei eineiigen Zwillingen bzgl. uneinheitlichen Veränderungen des Gehirns , treffen nur bei einem Teil schizophrener Patienten zu). Umweltfaktoren (Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen mit hirnpathologischen Veränderungen können Verhaltensauffälligkeiten bewirken). Die Untersuchung schizophrener Untergruppen ist noch unklar. Wenig systematische Erkenntnisse liegen zum Einfluss psychosozialer Belastungsfaktoren bzgl. der Entstehung einer Schizophrenie vor. Dagegen ist bei Schizophrenen das Rückfallrisiko in einem Zusammenhang mit lebensverändernden Ereignissen und der akzeptierenden / ablehnenden Haltung von Angehörigen zu sehen. Mehrere Risikofaktoren wirken bei der Entstehung einer schizophrenen Störung zusammen. Die verschiedenen Formen dieser Störung sind nicht durch die Dominanz von Risikofaktoren aus jeweils einem dieser Bereiche zu erklären. Die Vielfalt möglicher Interaktionen Zwischen den Risikofaktoren bestimmen unterschiedliche Krankheitsbilder, paranoide Auffälligkeiten und längerfristige Verläufe. 35.3 Schizophrenie: Intervention (S. 837 - 852) Behandlungsansätze im Verlauf schizophrener Erkrankungen: Die Symptome, Behinderungen und Probleme der einzelnen Betroffenen sind sehr unterschiedlich. Sowohl biologisch - somatische wie auch psychosoziale Faktoren beeinflussen Symptomatik und Verlauf in Interaktionen. In Abhängigkeit von den sich zeitlich wandelnden und interindividuell unterschiedlichem Zustandbild bestehen verschiedene Ansatzpunkte für notwendige oder mögliche Therapiemassnahmen. Die Positiv - Symptomatik ist charakterisiert durch Halluzinationen, Wahnerlebnisse und Ich - Störungen. Sie tritt v. a. in akuten Krankheitsphasen auf. Die Negativ - Symptome entwickeln sich zeitlich oft vor den ersten Positiv - Symptomen und bleiben nach deren Abklingen teilweise lange bestehen. Sie sind von schlechter prämorbider Anpassung oder den Folgen längerer Hospitalisierung nicht zu unterscheiden. Desorganisiertes Verhalten, Denkstörungen und nicht adäquater Affekt trägt zu sozialen Anpassungsproblemen Betroffener bei. Es besteht eine häufige Komorbidität von Schizophrenie und Substanzmissbrauch: - Substanzmissbrauch kann generell oder nur bei vulnerablen Personen schizophrene Störungen auslösen. - Substanzmissbrauch entsteht aus dem Versuch der Selbstmedikation oder Bewältigung schizophrener Störungen. - Es handelt sich um eine Koinzidenz ätiologisch völlig unabhängiger Störungen. Zwischen den Akutphasen sind häufig depressive Phasen zu beobachten, welche (pharmakologisch und wegen institutioneller Behandlung bedingt). Behandlung akut psychotischer Episoden: Das erstmalige Auftreten führt zu einer Aufnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus. Als Behandlungsverfahren werden dabei die Pharmakotherapie und die soziale Betreuung eingesetzt sich wechselweise ergänzende Vorgehensweisen). Antipsychotische Medikamente: Die antipsychotische der Neuroleptika muss abgewogen werden gegen unerwünschte und schädliche Nebenwirkungen. Medizinische Komplikationen sind in der Akut - Behandlung mit internistischen und neurologischen Kontrollen selten. Einige der Nebenwirkungen (Ruhelosigkeit, Tremor, Rigor) werden auch bei medikamentenfreien Patienten beobachtet, unter antipsychotischer Medikation sind die Symptome aber ausgeprägter. Spätdyskinesien treten bei Langzeitbehandlung mit Neuroleptika auf. Bei der Abwägung von Nutzen und Schaden der neuroleptischen Behandlung akuter schizophrener Störungen über wiegen in der Regel die Vorteile, wobei der Verkürzung der stationären Behandlung und der rascheren Zugänglichkeit für psychosoziale und psychotherapeutische Massnahmen besonderes Gewicht zukommt. Psychosoziale Massnahmen: Es geht darum, belastende Bedingungen, die auf den Patienten einwirken, und für übersichtliche Strukturen zu sorgen. Neben den auslösenden Bedingungen sollten behandlungsbedingte Belastungen nicht übersehen werden. Die Soteria (Bern) versucht die Priorität auf psychosoziale Bedingungen (wenig antipsychotische Medikation) zu legen (vgl. S. 841). Eine Studie zeigt aber, dass: - eine völlig medikamentenfreie Behandlung auch unter günstigen psychosozialen Bedingungen in der Regel nicht zu verwirklichen ist - deutlich niedrigere Neuroleptikadosen häufig ausreichen - die Vorteile einer geringeren Medikation gegen die Nachteile einer längeren Hospitalisierung abzuwägen sind. Wurden Therapieverfahren in einer Studie getrennt betrachtet, so erzielten Familienbetreuung, Kognitive Therapie und körperorientierte Therapie die günstigsten, nahezu identische Effektgrössen. Die geringsten Effekte wurden bei psychoanalytisch orientierter Behandlung sowie Lebens- und Berufsberatung festgestellt. Längerfristige Behandlungsmassnahmen für schizophrene Patienten: Schizophrene Störungen klingen bei ca. einem Viertel der Betroffenen relativ rasch ab, ohne schwere psychische oder soziale Beeinträchtigungen zu hinterlassen. In etwa gleicher Häufigkeit führt die Erkrankung zu dauerhaften, gravierenden Folgen (chronisch produktive oder ausgeprägte Negativ Symptomatik) mit Tendenz zur Verbesserung. Bei gut der Hälfte der Patienten ist der Langzeitverlauf instabil und durch Rezidive akut psychotischer Zustände gekennzeichnet. Die therapeutischen Massnahmen bestehen in der Rückfallprävention und in der Behandlung persistierender Defizite und Störungen. Pharmakotherapie: Spätdyskinesien erschweren die soziale Integration ausserhalb der Institutionen. Die Rückfallhäufigkeit war bei Intervallbehandlungen doppelt so hoch als bei Dauermedikation. Die Ersparnis an Medikamenten gegenüber der Dauermedikation war geringer als erhofft. Psychosoziale Massnamen: Stationäre Behandlung chronisch schizophrener Patienten: Schizophrene bilden einen erheblichen Anteil chronischer Patienten in psychiatrischen Institutionen (Mangel geeigneter Lebensräume ausserhalb der Anstalten, Symptomatik). - Auf Abteilungen mit wenig sozialen Anregungen oder Anforderungen ist die Negativ - Symptomatik ausgeprägter - das Ausmass dieser Symptomatik korreliert mit der Aufenthaltsdauer - Besserungen der äusseren Bedingungen (u. a. Sozialkontakte) werden mit geringerer Negativ - Symptomatik und Besserung in Sozialverhalten assoziiert (Brown, 1970). Massnahmen gegen Rückfälle und Chronifizierung: Je länger die stationäre Behandlung, um so grösser die Gefahr zunehmender Negativ - Symptomatik. Doch die Ziele (Verbesserung der Sozialkontakte, etc. brauchen Zeit. Eine Lösung besteht in der möglichst raschen Entlastung bei Abnahme der Akutsymptomatik und der Fortsetzung der Behandlung auf ausserklinischer Basis (Vulnerabilitäts- Stress- Modell) - ein soziales Netz aufbauen und zwischenmenschlichen Stress vermindern (Social Skills Trainings) (vgl. S. 848 / 849). Fazit: Die wichtigsten Behandlungsmethoden für Schizophrenie sind: Pharmakotherapie, Förderung von Krankheitsverständnis, Bewältigungsbemühungen und Medikamenten - Compliance in Einzel- und Gruppentherapie, Einbindung der therapeutischen Massnahmen (Sozialtraining oder kognitives Training in Lebensraum der Patienten, ein längerfristiges Behandlungskonzept mit langsam wachsenden Anforderungen, Stützung der Angehörigen und Förderung realistischer Erwartungen. Parallel dazu ist ein weiterer Ausbau von rehabilitativen Hilfsangeboten in den Bereichen Wohnen, Freizeigestaltung, soziale Integration, berufliche Eingliederung und Tagesstrukturierung (individuelle Behandlung!) angebracht.