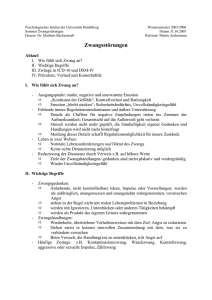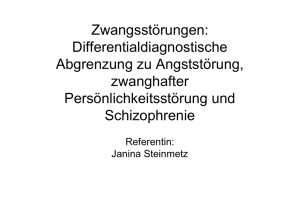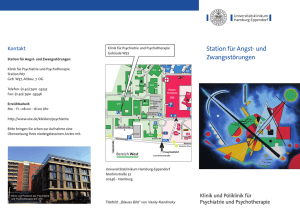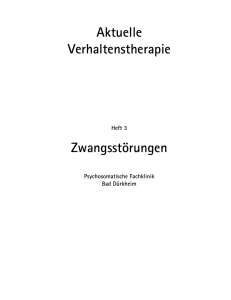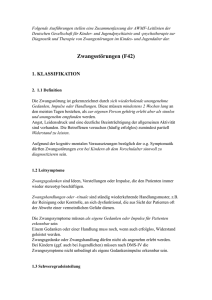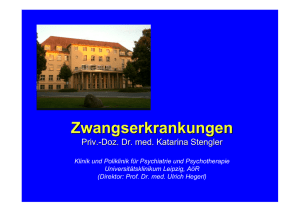newsletter
Werbung

01·14 newsletter 2 Bericht des Präsidenten Zürich, Mai 2014 3Selbsthilfegruppe für Zwangserkrankungen – welche Erwartungen und Befürchtungen haben Betroffene? 5 Die Behandlung der Angsterkrankungen 13 Freundschaft mit Gedanken und Gefühlen schliessen? – Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie («Mindfulness-based Cognitive Therapy», MBCT) bei Zwangsstörungen 18 Ich: ein Prototyp – 10 Jahre Tiefenhirnstimulation Edit or ial Liebe Leserinnen und Leser Es ist soweit wir feiern Geburtstag! Die Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen wird 20 Jahre alt. Möchten Sie im Jubiläumsjahr einen Beitrag schreiben? Ich freue mich von Ihnen zu lesen! Meinem letzten Aufruf sind die Autoren des jetzt vor Ihnen liegenden Newsletters gefolgt wofür ich mich im Namen der Leserschaft sehr herzlich bedanke. Mit Hilfe der Autoren ist es wieder gelungenen eine spannende Lektüre für Sie zusammenzustellen. Selbsthilfe kann helfen. Doch wie muss eine Selbsthilfegruppe aufgebaut sein und welche Schwerpunkte sollte sie setzen damit sie die Erwartungen der Betroffenen erfüllt? Dieser Frage sind die Autoren des ersten Beitrags nachgegangen. Letztes Jahr hat die SGZ gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD), der Schweizerischen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie (SGBP) und in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) neue Behandlungsempfehlungen erstellt. Mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift Schweizerisches Medizin-Forums finden Sie diese Empfehlungen als 2. Beitrag im Newsletter. In den letzten Jahren haben achtsamkeitsbasierte Techniken zunehmend Einzug in die Psychotherapie gehalten. Die Ergebnisse einer ersten Pilotstudie sind vielversprechend. Es besteht die Hoffnung, dass auch Patienten mit einer Zwangsstörung von dieser einige hundert Jahre alten Technik profitieren können. Frau Külz stellt Ihnen das Programm und die Studie im 3. Beitrag ausführlich vor. Obwohl die Psychotherapie und auch die medikamentösen Therapien vielen Patienten mit Zwangsstörungen helfen, gibt es doch auch Patienten deren Zwänge nicht verbessert werden können. Bei einigen dieser Patienten könnte die tiefe Hirnstimulation eine hilfreiche Therapiemethode sein. Herr N. wurde 2004 operiert und berichtet im letzten Beitrag des Newsletters über seine Erfahrungen mit dieser Therapie. Bei der Deutschen Gesellschaft für Zwangsstörungen möchte ich mich recht herzlich, für die sehr gute Zusammenarbeit und die Genehmigung Artikel aus der aus «Z aktuell» in unseren Newsletter zu übernehmen, bedanken! Nun wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre und verbleibe mit herzlichen Grüssen Steffi Weidt Dr. med. Steffi Weidt Newsletter Redakteurin SGZ [email protected] N e w s l e t t er 01 ·14 Bericht des Präsidenten Liebe Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen «Melanie, warum sind deine Hände so rot?» – so lautet der Titel des ausführlichen Berichts einer Betroffenen über ihre Zwangserkrankung im Migros Magazin vom 28. April 2014. Es werden dort auch Adressen genannt, wo Betroffene und Angehörige Rat und Hilfe bekommen können. Die SGZ hat sich für diesen Beitrag engagiert, ohne sie wäre er nicht zustande gekommen. Ein solches Engagement von Betroffenen und der SGZ ist enorm wichtig, um das Thema Zwangserkrankung in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Fast immer melden sich nach solchen Beiträgen Betroffene und berichten, dass Ihnen die Beschreibung den Mut gegeben hat, für sich selbst fachlichen Rat zu suchen. Oder sie entdecken erst durch die Beschreibungen in einem solchen Bericht, dass ihre eigenen «merkwürdigen» und belastenden Gedanken und Handlungen Teil einer Zwangsstörung sind und gut behandelt werden können. Bis dahin dachten sie, sie wären die einzigen mit solchen «verrückten» Verhaltensweisen und trauten sich nicht, anderen davon zu erzählen. sches über Behandlungsmöglichkeiten und Forschungsergebnisse zwischen Betroffenen mit Zwangsstörungen und Fachleuten.» (Artikel 2 der Vereinsstatuten). Auch dieser Newsletter trägt wieder ein Stück weit dazu bei, Fachleute, Betroffene und Angehörige zu informieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine interessante Lektüre. Und falls Sie der Bericht im Migros-Magazin interessiert: Sie können ihn auf der SGZ-Homepage in der Rubrik «Medien/Presseberichte» herunterladen. So wie auch viele weitere Pressebeiträge der letzten Monate. Unter anderem finden Sie dort folgende Berichte: Einen Zeitungsartikel zur Hypochondrie (Aargauer Zeitung vom 10. April 2014). Eine Sendung des Schweizer Radio und Fernsehens vom 13. Oktober 2013 zum Thema «Wenn die Marotte zum Zwang wird». Einen Bericht in der Schweizer Familie 35/2013 mit dem Titel «Wenn Gedanken zur Qual werden», wo wiederum eine Betroffene (benannt als Clara Neumann) und Fachexperten der SGZ gemeinsam Auskunft geben. Herzliche Grüsse, Ebenfalls ganz aktuell hat die SGZ in einer Schweizer Fachzeitschrift (Leading Opinions 14/2014) ein Schwerpunktthema zu Perspektiven in der Therapie von Zwangserkrankungen gestaltet, mit mehreren Fachartikeln zur Diagnostik und Therapie. Durch solche Beiträge gelingt es, Fachleute für das Thema zu sensibilisieren und sie über bewährte und neu entwickelte Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Dies kommt letztlich den Betroffenen und Angehörigen zugute, sie können von diesen dann kompetenter beraten und behandelt bzw. zu spezialisierten Behandlungen weitergewiesen werden. In beiden Artikeln wird auch das 20-jährige Bestehen der SGZ erwähnt. Das dient wiederum der Gesellschaft, da sie hierdurch bekannter wird. Vielleicht besuchen dann noch mehr Betroffene, Angehörige und Experten die SGZ-Jahrestagungen, wodurch die SGZ sie ganz grundlegend über die Zwangserkrankung und verwandte Themen informieren kann. Oder ein paar Leser werden sogar Mitglied in der SGZ, was ebenfalls dazu beiträgt, dass die Gesellschaft ihr Hauptziel weiterverfolgen kann: «(…) die Förderung des Informationsaustau- Michael Rufer Prof. Dr. med. Michael Rufer Präsident der SGZ [email protected] 2 N e w s l e t t er 01 ·14 Selbsthilfegruppe für Zwangserkrankungen – welche Erwartungen und Befürchtungen haben Betroffene? Patrick Axt, Judith Siegl und Hans Reinecker Warum stellt sich die Frage? Die Bedeutung von Selbsthilfegruppen ist gerade in der heutigen psychosozialen Versorgungslage nicht mehr wegzudenken. Seit 1935 (Gründungsjahr der ersten Gruppe der Anonymen Alkoholiker) entstehen Selbsthilfegruppen in allen möglichen Bereichen gesundheitlicher, seelischer und sozialer Probleme. Dennoch ist über Selbsthilfegruppen allgemein und Zwangsselbsthilfegruppen im speziellen recht wenig bekannt. Viele Gruppen entstehen im Verborgenen, entwickeln sich und weiten sich aus oder lösen sich, von der breiten Öffentlichkeit fast unbemerkt, wieder auf. Bei Betroffenen der Zwangsstörung gestaltet sich die Etablierung und Aufrechterhaltung von Selbsthilfegruppen besonders schwierig. Welche Gründe könnte das haben? Einerseits spielt die spezifische Symptomatik und die allgemein schwierige therapeutische Behandlung der Zwangsstörung sowie die damit verbundenen negativen Folgen eine entscheidende Rolle. Andererseits können die Schwierigkeiten durch einen Mangel an Informationen bezüglich der Hoffnungen, Wünsche, Befürchtungen und Erwartungen der Betroffenen bedingt sein. Welches Ziel verfolgt diese Studie? Am Lehrstuhl für Klinische Psychologie der Universität Bamberg haben wir uns die Frage gestellt, welche Erwartungen oder Befürchtungen, die ­ Zwangspatienten bezüglich der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppen haben könnten, die meiste Zustimmung oder die stärkste Ablehnung erfahren. Ausserdem war von Interesse, ob mögliche Bereiche von Erwartungen, wie sie beispielsweise im Therapieprozess vorkommen, auch bei Selbsthilfegruppen relevant bzw. nicht relevant sind. Letztlich wurde auch nach Erwartungen und Befürchtungen geforscht, die bislang bei der Konzeption von Selbsthilfegruppen unberücksichtigt blieben. Die Studie ist somit ein erster Schritt, um Informationen zu gewinnen. Wie wurde vorgegangen? Zur Erfassung der Erwartungen und Befürchtungen wurde ein Screeningfragebogen entwickelt. Die ­ ragen hierzu wurden auf den Grundlagen bisheriger F Kenntnisse über das Störungsbild, sowie auf allgemeinen Informationen aus Psychotherapie-, Selbsthilfeliteratur, Erfahrungs- und Expertenberichten gewonnen. Nach einer Voruntersuchung an der Ambulanz für Psychotherapie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurden 825 Exemplare des Fragebogens mittels freundlicher Unterstützung der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen e.V. an derzeitig und ehemalig Betroffene versandt. Nach fast viermonatiger Laufzeit wurde die Datenerhebung mit insgesamt 171 Rückantworten (105 Frauen und 66 Männer) abgeschlossen. weiblich 61% männlich 39% Ausgewählte Ergebnisse Bei der sich anschliessenden Auswertung fiel neben der geringen Anzahl an Rückantworten besonders deutlich auf, dass viele Erwartungen von den Befragten angegeben wurden. Im Vergleich dazu wurden Befürchtungen eher zurückgewiesen. 1. Die Erwartung(en) mit dem stärksten Zuspruch §D ie Erwartung, die die meiste Zustimmung von den Befragten erhielt, betraf den Erfahrungsaustausch mit bzw. Erfahrungsberichte von anderen Teilnehmern in der Selbsthilfegruppe. § Relativ starker Zuspruch (mehr als 90% der Teilnehmer stimmten jeweils der Erwartung zu) wurde dem Finden von Gesprächspartnern allgemein und dem Finden von Menschen, die Verständnis für die Symptomatik haben, zuteil. § Gleiches galt für den Erwerb neuer Erkenntnisse und Erklärungen sowie für den Erhalt von Empfehlungen und Ratschlägen für den Umgang mit Zwängen. § Auch dem gegenseitigen Motivieren, Ermutigen und Verstärken, der Hoffnung auf ein positives Gefühl, irgendetwas gegen die Zwänge zu unternehmen und der Erwartung, anderen durch 3 N e w s l e t t er 01 ·14 eigene Erfahrungen helfen zu können, wurde von den Teilnehmern geschlossen stark zugestimmt. 2. Die Erwartung mit der größten Ablehnung Die am stärksten zurückgewiesene Erwartung hingegen betraf die Thematik, in einer Selbsthilfegruppe zwangsrelevante Situationen gemeinsam zu üben (auch ausserhalb der Gruppe, z.B. zu Hause). Hierbei ist aber bislang ungeklärt, ob sich die relativ starke Ablehnung auf das Üben allgemein, auf das gemeinsame Üben oder aber auf das Üben ausserhalb der Gruppe (z.B. zu Hause) bezieht. 3. Die an stärksten zurückgewiesene Befürchtung Die Befürchtung, die – auch absolut gesehen – am stärksten abgelehnt wurde, zielte auf Enttäuschung oder gar Entmutigung der Befragten durch die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe ab. Eine derartige Befürchtung liegt nach bisherigem Erkenntnisstand somit relativ selten bei den Betroffenen vor. 4. Andere Erwartungen Diverse Erwartungen, wie u.a. die gemeinsame Interessen- und Freizeitgestaltung ausserhalb der Gruppe, das Finden von Freunden oder das Kennenlernen anderer Menschen, um soziale Fähigkeiten zu verbessern, Kontakte zu knüpfen bzw. die Kommunikation zu verbessern, wurden von den Befragten sehr unterschiedlich eingeschätzt. Sie geben aber somit wichtige Hinweise für verschiedene Konzeptionsmöglichkeiten einer Zwangsselbsthilfegruppe. Auch bei den Erwartungen bezüglich der möglichen Auswirkung einer Selbsthilfegruppe, d.h. ob gleiche oder ähnliche Effekte wie bei einer Psychotherapie oder medikamentösen Behandlung erzielt werden können oder ob eine Entlastung erfahren werden kann, um die Zeit bis zu einer Therapie leichter zu überbrücken, bestand unter den Teilnehmern Uneinigkeit. 5. Zur Struktur der Selbsthilfegruppe Des Weiteren stellte sich die erwartete Struktur einer Selbsthilfegruppe als wichtig heraus. Obgleich von den meisten Befragten eine Regelmässigkeit und Verbindlichkeit der Treffen befürwortet wurde, gingen die Erwartungen hinsichtlich fester Rahmenbedingungen, d.h. strukturierter Ablauf der Gruppe oder zumindest gewisser «Arbeitscharakter» gegenüber einer lockeren Gesprächsatmosphäre ohne starre Regeln, auseinander. 6. Bereiche von Erwartungen In der Studie wurde versucht, mögliche Bereiche von Erwartungen, wie sie im therapeutischen Prozess vorkommen, auch für Zwangsselbsthilfegruppen abzuleiten. Hierbei konnte folgende Rangfolge für die Erwartungsbereiche ermittelt werden (beginnend mit dem Bereich, der die grösste mittlere Zustimmung erhielt): 1. «Inhaltliche Erwartungen» 2.«Rollenerwartungen» 3. «Prognostische Erwartungen» 4. «Ablauf- und Prozesserwartungen» Diese Studie ist mit den obig kurz skizzierten Ergebnissen nur ein erster, kleiner Schritt auf dem langen Weg der Forschung und Suche nach Anhaltspunkten für die erfolgreiche Konzeption, Organisation und Durchführung einer Selbsthilfegruppe zu Zwängen. Und selbst dieser kleine Schritt folgt der Weisheit Friedrich Rückerts: «Am Abend wird man klug für den vergangenen Tag, doch niemals klug für den, der kommen mag». Und da der Weise sich bekanntlich nicht schämt, weiter zu fragen, sollte in dieser Richtung weitere Forschung betrieben werden, um die Versorgung der Betroffenen der Zwangsstörung weiter verbessern zu können. Autoren: Patrick Axt Dipl.-Psych. Judith Siegl Prof. Dr. Hans Reinecker [email protected] Lehrstuhl Klinische Psychologie der Universität Bamberg Markusplatz 3 – 96045 Bamberg 4 empfehlungen Die Behandlung der Angsterkrankungen Teil 2: Zwangsstörungen und posttraumatische Belastungsstörung1 Martin E. Kecka, Axel Ropohla, Guido Bondolfia, Corinna Constantin Brennib, Josef Hättenschwilera, Martin Hatzingerc, Ulrich Michael Hemmetera, Edith Holsboer-Trachslera, Wolfram Kawohlb, Christine Poppeb, Martin Preisiga, Stefan Rennharda, Erich Seifritza, Steffi Weidtb, Susanne Walitzaa, b, Michael Ruferb Einleitung Die Erstellung dieser schweizerischen Behandlungsempfehlung der SGAD, SGZ, SGBP und SGPP wurde von keiner kommerziellen Organisation finanziell unterstützt. Diese Behandlungsempfehlungen basieren auf der internationalen Leitlinie der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) [1]. In die Empfehlungen sind zudem Aspekte weiterer relevanter Leitlinien mit eingeflossen (National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN). Diese Empfehlungen fassen die evidenzbasierten Therapiestrategien (bester Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin) zur Behandlung der Zwangsstörung und der posttraumatischen Belastungsstörung nach den Kriterien der «International Classification of Diseases» (ICD-10, WHO-Version 2010) zusammen (Tab. 1 p). Die Definitionen zu den Evidenz-Kategorien der WFSBP (Level A–E) sowie die Einführung zu den verschiedenen psychopharmakologischen Substanzklassen, die zur Behandlung von Angsterkrankungen zur Verfügung stehen, finden sich in Tabelle 2 p bzw. im Teil 1 dieses Artikels [2].1 Die Behandlungsempfehlungen beschränken sich auf die eigentlichen Zwangsstörungen (ICD-10: F42) und die posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10: F43.1). Andere Störungen aus dem Zwangsspektrum, wie TicStörungen, Trichotillomanie und autoimmune, durch Streptokokken-Infektionen ausgelöste, neuropsychiatrische Störungen bei Kindern (PANDAS), werden nicht behandelt. Im Gegensatz zur ICD-10 wurden Zwangsstörungen und die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) nach der Klassifikation des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV, APA 1994) der Gruppe der Angsterkrankungen zugeordnet. Im neuen DSM-V (Mai 2013) werden Zwangsstörungen als eigenständige diagnostische Gruppe eingeordnet («Obsessive-Compulsive and Related Disorders»), ebenso die PTSD («Traumaand-stressor-related disorders»). Methodische Kriterien bestimmen die Evidenz; das heisst, die Bewertung der Wirksamkeit einer Intervention basiert in der Regel auf randomisierten kontrollierten Studien (RCT). Aus dem Fehlen von RCT für einzelne Behandlungen kann jedoch nicht der Rückschluss gezogen werden, dass diese Verfahren nicht wirksam sind. Methodisch bedingt können RCT den Nutzen spezifischer psycho- oder pharmakotherapeutischer Verfahren unter den real existierenden Versorgungsbedingungen (effectiveness) nur eingeschränkt abbilden. Insbesondere für komplexe, therapieresistente oder kombinierte Erkrankungen existiert derzeit nur unzureichende empirische Evidenz. Hier sind daher häufig individualisierte Behandlungsstrategien mit beispielsweise unterschiedlichen Psychotherapieverfahren erforderlich, die erfahrungsgeleitet und wirkungsorientiert eingesetzt werden. Die Behandlungsempfehlung setzt eine gründliche diagnostische Abklärung durch einen Arzt voraus, wobei andere psychische und somatische Erkrankungen ausgeschlossen und symptomauslösende Faktoren (u.a. psychotische Erkrankungen, psychosoziale Stressfaktoren, Medikamente wie beispielsweise Schilddrüsenhormone) berücksichtigt werden müssen. Die Indikationen für die Grundelemente der psychiatrischen Behandlung (aktiv abwartende Begleitung, Psychoedukation, Klärung psychosozialer Einflussfaktoren, Einbezug von Angehörigen, medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung, Kombinationstherapie) sollten während der gesamten Behandlung unter Berücksichtigung von klinischen Faktoren wie Symptomschwere, Erkrankungsverlauf und Patientenpräferenz geprüft werden. Es wird empfohlen, die Pharmakotherapie immer in eine multimodale Therapie einzubetten. Für jeden Patienten sollte ein individueller Therapieplan erstellt werden, der unter anderem Begleiterkrankungen, frühere Behandlungsversuche und den Schweregrad der Erkrankung berücksichtigt. Der Gesamtbehandlungsplan sollte zudem die psychosoziale Wiedereingliederung und den Einbezug der Angehörigen beinhalten. Wir weisen darauf hin, dass zahlreiche der in diesen Behandlungsempfehlungen aufgeführten Medikamente in der Schweiz nicht für die Therapie von Zwangserkrankungen und posttraumatischen Belastungsstörungen zugelassen sind. Behandlungsempfehlungen und Leitlinien definieren generell einen Mindeststandard, der sich aus den Ergebnissen von qualitativ hochwertigen Studien mit idealtypischen 1 Teil 1 dieser Empfehlungen («Die Behandlung der Angsterkrankungen: Panikstörungen, Agoraphobie, generalisierte Angststörung, soziale Phobie, spezifische Phobien») ist erschienen in SMF 2011;11(34):558–66. Gemeinsame Behandlungsempfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Angst und Depression (SGAD)a, der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen (SGZ)b,*, der Schweizerischen Gesellschaft für Biologische Psychiatrie (SGBP)c, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) unter Mitarbeit der SGPP-Repräsentanten Yvette Attinger-Andreoli, Christian Bernath, Daniel Bielinski, Anouk Gehret, Julius Kurmann * Für den Teil Zwangsstörungen. Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 337 empfehlungen Tabelle 1 Kurzbeschreibung von Zwangsstörungen und posttraumatischer Belastungsstörung nach ICD-10-Definition (WHO 2010). Zwangsstörungen Wesentliche Kennzeichen sind wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind Ideen, Vorstellungen oder Impulse, die den Patienten immer wieder stereotyp beschäftigen. Sie sind fast immer quälend, der Patient versucht häufig erfolglos, Widerstand zu leisten. Die Gedanken werden als zur eigenen Person gehörig erlebt, selbst wenn sie als unwillkürlich sowie häufig als abstossend und beschämend empfunden werden. Zwangshandlungen oder -rituale sind Stereotypien, die ständig wiederholt werden. Sie werden weder als angenehm empfunden, noch dienen sie dazu, an sich nützliche Aufgaben zu erfüllen. Der Patient erlebt sie oft als Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das ihm Schaden bringen oder bei dem er selbst Unheil anrichten könnte. Im Allgemeinen wird dieses Verhalten als sinnlos und ineffektiv erlebt, es wird immer wieder versucht, dagegen anzugehen. Werden Zwangshandlungen unterdrückt, verstärken sich unangenehme Gefühle (z.B. Angst, Ekel) deutlich. Lebenszeitprävalenz: 2,5%. Posttraumatische Belastungsstörung Diese entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmass, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, z.B. zwanghafte oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische Krankheiten in der Vorgeschichte können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf erschweren. Die letztgenannten Faktoren sind aber weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären. Pathognomonische und für die Diagnosestellung unabdingbare Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Alpträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermässigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert, und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung oder Besserung erwartet werden. Die Störung kann nach Jahren des chronischen Verlaufs in eine andauernde Persönlichkeitsänderung übergehen (F62.0). In Abhängigkeit von der Art des Traumas und weiteren prä-, peri- und posttraumatischen Variablen entwickeln ca. 10% (Verkehrsunfall) bis 50% (Vergewaltigung, Folter, Kriegserlebnisse) der Betroffenen eine posttraumatische Belastungsstörung. Lebenszeitprävalenz in Europa: 1,5–2%. Es besteht ein hohes Chronifizierungsrisiko. Patienten ohne Komorbiditäten ableitet. Jeder Arzt hat nach den bewährten Grundsätzen der ärztlichen Sorgfalt die Pflicht, im Rahmen seiner Einzelfallbeurteilung in medizinisch begründeten Fällen zum Wohle des Patienten von den Empfehlungen abzuweichen. Es wäre keinesfalls statthaft, aus den Behandlungsempfehlungen voreilige ökonomische Schlussfolgerungen abzuleiten. Die Behandlung von Zwangsstörungen Psychotherapie Die Psychotherapie ist Behandlung der ersten Wahl. Die SGPP anerkennt grundsätzlich folgende wissenschaftlich begründeten Psychotherapiemethoden: psychoanalytisch orientierte Therapie, kognitive Verhaltenstherapie sowie die systemische Therapie. Die Entscheidung für eine spezifische psychotherapeutische Behandlung hängt auch von Faktoren wie der Präferenz des Patienten oder der Verfügbarkeit ab. Die kognitive Verhaltenstherapie mit Reizkonfrontation und Reaktionsmanagement gilt Tabelle 2 Evidenz-Kategorien. Die Kategorien (WFSBP) basieren auf der Wirksamkeit der Psychotherapieverfahren und Medikamente, ohne Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile im Hinblick auf allfällige Nebenwirkungen und Wechselwirkungen [1, 2]. A. Positive Evidenz Basiert auf: 2 oder mehr randomisierten Doppelblind-Studien, die eine Überlegenheit gegenüber Plazebo zeigen, und 1 oder mehr positive Doppelblind-Studien zeigen Überlegenheit bzw. Gleichwirksamkeit gegenüber einer Referenzsubstanz. Wenn negative Studien vorliegen (Studien, die keine bessere Wirksamkeit als Plazebo oder schlechtere Wirksamkeit als eine Referenzsubstanz zeigen), müssen diese durch mindestens 2 zusätzliche positive Studien ausgeglichen werden. Die Studien müssen bestimmte methodologische Standards erfüllen (standardisierte diagnostische Kriterien, optimale Stichprobengrösse, adäquate psychometrische Skalen, adäquate statistische Methoden, adäquate Vergleichssubstanzen usw.). B. Vorläufige positive Evidenz Basiert auf: B1. 1 oder mehr randomisierte Doppelblind-Studien, die Überlegenheit gegenüber Plazebo zeigen, oder B2. 1 oder mehr positive naturalistische offene Studien mit mehreren Patienten oder B3. 1 oder mehr positive Fallberichte und keine negativen Studien existieren C. Widersprüchliche Ergebnisse Kontrollierte positive Studien stehen einer ungefähr gleichen Anzahl negativer Studien gegenüber D. Negative Evidenz Die Mehrheit der kontrollierten Studien zeigt keine Überlegenheit gegenüber Plazebo oder Unterlegenheit gegenüber einer Vergleichssubstanz E. Fehlende Evidenz Adäquate Studien, die Wirksamkeit bzw. Nichtwirksamkeit zeigen, fehlen bei der Behandlung von Zwangsstörungen als Therapieverfahren der ersten Wahl, ihre Wirksamkeit wurde in zahlreichen RCT belegt, die Mehrzahl der so behandelten Patienten erfuhr eine deutliche Besserung der Zwangssymptome (Level A). Es existiert bis heute keine empirische Evidenz für die Wirksamkeit anderer Psychotherapieverfahren. Kernelement der kognitiven Verhaltenstherapie ist die therapeutenbegleitete Exposition mit Reaktionsmanagement [1, 3]. Diese sollte vor allem in vivo durchgeführt werden, das heisst in den relevanten Alltagssituationen des Patienten. Tabelle 3 p gibt einen Überblick über die relevanten Komponenten evidenzbasierter Psychotherapie. Ein wesentlicher klinischer Einflussfaktor ist das häufige Vorliegen einer oder mehrerer komorbider psychischer Erkrankungen, beispielsweise schwergradige Depressionen, die ebenfalls eine pharmakologische Behandlung notwendig machen können. Diese Patienten sind derzeit nicht ausreichend in RCT repräsentiert. Bei schwergradiger Symptomatik oder Komorbidität werden viele Patienten erst durch die pharmakologische Behandlung in die Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 338 empfehlungen Tabelle 3 Wichtige Bestandteile der evidenzbasierten Psychotherapie von Zwangsstörungen. Bedingungs- und Funktionsanalysen Wegen der meist hohen Komplexität der Zwangsstörungen werden in der Regel multimodale kognitiv-verhaltenstherapeutische Konzepte angewandt. In Ergänzung zur Symptomtherapie mittels Expositions-Reaktionsmanagement und kognitiver Therapie werden weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden und häufig auch systemische, psychodynamische und achtsamkeitsbasierte Elemente genutzt. Die Auswahl der Bausteine erfolgt individuell auf der Basis einer sorgfältigen Verhaltensanalyse. Entscheidend ist hierbei eine genaue biographische Analyse zur Identifizierung ursächlicher, auslösender und aufrechterhaltender Bedingungen für die Zwangssymptomatik und allenfalls die Komorbiditäten. Eine wichtige Rolle spielen oft auch intrapsychische und/oder interpersonelle Funktionalitäten der Symptomatik: Intrapsychische Funktion: Beispielsweise die Kompensation starker Selbstzweifel oder das Überdecken eines Gefühls innerer Leere bei fehlenden sinngebenden Aktivitäten. Interpersonelle Funktion: Betrifft häufig die Beziehungsregulation zu nahen Bezugspersonen durch Zwangssymptome. Werden bestehende funktionale Zusammenhänge nicht erkannt und bearbeitet, können sich Probleme hinsichtlich Therapiemotivation und -verlauf ergeben und/oder es treten nach Therapieende Rückfälle auf [3]. Exposition mit Reaktionsmanagement Bei der Exposition mit Reaktionsmanagement, welche Kernbestandteil der kognitiven Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen ist, werden zwei Formen unterschieden: Exposition in sensu (imaginäre Exposition): Vorstellungsübungen bzgl. der angstauslösenden Zwangsgedanken bzw. Situationen. Dabei werden möglichst alle Sinnesmodalitäten mit einbezogen. Bei der Therapie der Zwangsstörungen spielt diese Form im Vergleich zur Exposition in vivo eine untergeordnete Rolle, sie kommt am ehesten bei reinen Zwangsgedanken zur Anwendung. Exposition in vivo (reale Exposition): Konfrontation mit einer realen, Angst (oder andere unangenehme Gefühle wie Ekel) auslösenden Situation. Die Exposition sollte vor allem anfangs therapeutenbegleitet in den Alltagssituationen des Patienten durchgeführt werden, zum Beispiel bei ihm zu Hause. Die einzelne Expositionsübung wird erst beendet, wenn die unangenehme emotionale Reaktion nachgelassen hat. Die neuen Erfahrungen während der Exposition helfen dem Patienten, seine bisherigen Zwangsbefürchtungen zu korrigieren und die Situationen anders als bisher einzuschätzen. Kognitive Interventionen Das kognitive Modell besagt, dass die Gedanken eines Menschen seine Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen. Entsprechend früherer (Lern-)Erfahrungen werden bestimmte Grundannahmen entwickelt, auf deren Basis in der Folge aktuelle Ereignisse interpretiert werden. Bei der Therapie von Zwangserkrankungen geht es um die Identifikation, Überprüfung (Logik, Gültigkeit, Angemessenheit) und Korrektur von aufdringlichen (Zwangs-)Gedanken und deren Bewertung. Hinzu kommt die Modifikation von dahinter stehenden Grundannahmen (Metakognitionen, z.B. «Meine negativen Gedanken zeigen, dass ich ein schlechter Mensch bin»). Lage versetzt, eine psychotherapeutische Behandlung durchzuführen. Durch eine Kombination der kognitiven Verhaltenstherapie mit einer SSRI-Medikation lassen sich in bestimmten Fällen (z.B. ausgeprägte Zwangsgedanken, komorbide Depression) bessere Therapieergebnisse erzielen [4, 5]. Für die Psychotherapie gilt, dass eine Neubeurteilung erfolgen sollte, wenn innerhalb von 4–6 Wochen alleiniger Therapie keinerlei Ansprechen zu verzeichnen ist. Pharmakologische Behandlung Die pharmakologische Behandlung von Zwangsstörungen mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) und dem trizyklischen Antidepressivum (TZA) Clomipramin zeigt gute Ansprechraten von 60–80% [1]. Die durchschnittliche Symptomreduktion beträgt 40–50%. Die Wirkung kann mit mehr als 4–6 Wochen Verzögerung einsetzen, bis zum Eintritt des Wirkungsmaximums müs- sen im Einzelfall 8–12 Wochen gerechnet werden. Die Erhaltungstherapie nach Besserung resp. Remission sollte im Vergleich zur Behandlung anderer Angsterkrankungen deutlich länger sein (mindestens 12–24 Monate). Die Behandlungsdauer hängt jedoch im Einzelfall stets von individuellen Faktoren ab und kann deutlich kürzer (z.B. bei erfolgreich angewandten verhaltenstherapeutischen Zwangsbewältigungsstrategien) oder länger (z.B. bei weiterbestehenden erheblichen psychosozialen Belastungen) notwendig sein. Die erforderliche Medikamentendosis ist oftmals höher als bei der Behandlung von Depressionen und anderen Angsterkrankungen, wichtig ist die stufenweise Auftitrierung nach individueller Verträglichkeit unter regelmässigen EKG- und Laborkontrollen [1]. Die Serotonin-Wiederaufnahmehemmung ist zentraler pharmakodynamischer Ansatzpunkt. Im direkten Vergleich waren Substanzen, die hauptsächlich die Wiederaufnahme von Noradrenalin hemmen (z.B. Desipramin, Nortriptylin), weniger wirksam als SSRI. Die SSRI Escitalopram, Fluvoxamin, Fluoxetin, Paroxetin und Sertralin sind Medikamente der ersten Wahl (Level A), allerdings ist Fluoxetin für diese Indikation in der Schweiz nicht zugelassen. Das TZA Clomipramin zeigt eine mit den SSRI vergleichbare Wirksamkeit (Level A), ist jedoch weniger gut verträglich (anticholinerge Nebenwirkungen). Sowohl das SSRI Citalopram als auch das noradrenerge und spezifisch serotonerge Antidepressivum (NaSSA) Mirtazapin können als Medikamente zweiter Wahl angesehen werden; ihre Wirksamkeit ist durch Studien belegt (Level B1), aber auch für Mirtazapin besteht in der Schweiz bezüglich der Zwangserkrankungen keine Zulassung. Die Resultate zur Wirksamkeit des irreversiblen Monoaminoxidase-(MAO-)Hemmers Phenelzin und des selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmers (SSNRI) Venlafaxin sind inkonsistent (Level C). Venlafaxin wurde bislang nicht in plazebokontrollierten Studien bei Zwangserkrankungen untersucht, Vergleichsstudien sprechen aber für eine vergleichbare Wirksamkeit wie unter Paroxetin oder Clomipramin. Phenelzin kann im Einzelfall zur Behandlung von Patienten, die nicht auf eine Behandlung mit SSRI oder TZA angesprochen haben, indiziert sein. Bei unzureichendem Ansprechen auf ein SSRI trotz ausreichend langer Einnahme und hoher Dosierung wird primär die Augmentation mit einem (niedrig dosierten) atypischen Antipsychotikum empfohlen. Tabelle 4 p gibt eine Übersicht über die pharmakologische Behandlung von Zwangsstörungen. Im klinischen Alltag können im Einzelfall höhere Dosierungen als angegeben notwendig werden. Abbildung 1 x zeigt den empfohlenen Behandlungsalgorithmus. Weitere Therapieoptionen Andere nichtpharmakologische Therapieoptionen für die Behandlung von Zwangsstörungen sind wenig erprobt und zum Teil umstritten. Für die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) finden sich in der Literatur zwar einige randomisierte, kontrollierte Studien, allerdings sind diese Studien unter anderem wegen unterschiedlicher Stimulationsparameter nur bedingt miteinander vergleichbar, so dass letztlich keine ausreichende Evidenz für eine Wirksamkeit der rTMS bei der Zwangsstörung vorliegt [4]. Bezüglich der Elektrokonvulsionstherapie (EKT) leitet sich die Evidenz vor allem aus Einzelfallbeobachtungen Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 339 empfehlungen Tabelle 4 Pharmakologische Behandlung von Zwangsstörungen (Level A–C), basierend auf den WFSBP-Guidelines [1]. Diagnose Behandlung Zwangsstörungen SSRI Escitalopram (z.B. Cipralex®) Evidenz-Kategorie Empfohlene Dosis für Erwachsene A 10–20 mg Fluoxetin (z.B. Fluctine ), n.z. A 40–60 mg Fluvoxamin (z.B. Floxyfral®) A 100–300 mg Sertralin (z.B. Zoloft®) A 50–200 mg ® Paroxetin (z.B. Deroxat ) A 40–60 mg Citalopram (z.B. Seropram®) B1 20–60 mg ® TZA Clomipramin (z.B. Anafranil®) A 75–300 mg SSNRI Venlafaxin (z.B. Efexor®), n.z. C 75–300 mg NaSSA Mirtazapin (z.B. Remeron ), n.z. B1 30–60 mg C 45–90 mg Quetiapin (z.B. Seroquel®), n.z. B1 150–750 mg Olanzapin (z.B. Zyprexa®), n.z. B1 5–20 mg ® Wenn andere Behandlungsmöglichkeiten nicht wirksam waren oder nicht toleriert wurden MAO-Hemmer Phenelzin, n.z. Augmentierende Substanzen bei nur partiellem Ansprechen auf Antidepressiva Antipsychotika Risperidon (z.B. Risperdal ), n.z. B1 0,5–4 mg Haloperidol (z.B. Haldol®), n.z. B1 bis 3 mg Pindolol (z.B. Visken®), n.z. B1 7,5–10 mg ® Beta-Blocker n.z.: in der Schweiz für die Indikation Zwangsstörung nicht zugelassen. Dosierung teilweise abweichend von den Empfehlungen im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz (www.compendium.ch). Prinzipiell ist immer eine Kombinationstherapie aus pharmakologischer Behandlung und kognitiver Verhaltenstherapie sinnvoll, da im Vergleich zur alleinigen Pharmakotherapie günstigere Langzeiteffekte nach Beendigung der Kombinationsbehandlung zu beobachten sind. Die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) Abbildung 1 Pharmakotherapie bei Zwangsstörungen (nach www.zwaenge.ch). ab (Level B3), zuverlässige Wirksamkeitsnachweise zur Begründung einer Indikation für die EKT bei therapierefraktärer Zwangsstörung fehlen aber [4]. Neurochirurgische Eingriffe wie die tiefe Hirnstimulation (THS) oder neuroläsionelle Methoden können bei schweren und therapieresistenten, die Lebensführung stark behindernden Zwangsstörungen als ultima ratio in Frage kommen [4]. Auch bei der THS gilt, Nebenwirkungen der Stimulation wie affektive Symptome oder Sedierung sowie die allgemeinen Risiken eines neurochirurgischen Eingriffs zu beachten. Psychotherapie Die Psychotherapie ist Behandlung der ersten Wahl. Für die Therapie der PTBS eignet sich eine traumafokussierte, psychotherapeutische Behandlung (z.B. traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie, Prolonged Exposure Therapy, Eye-Movement Desensitization and Reprocessing [EMDR], allenfalls Stressbewältigungsstrategien). Diese ist einer medikamentösen Behandlung vorzuziehen (Level A). Eine pharmakologische Behandlung kann in Abhängigkeit von Ausprägung, Schwere und komorbiden Störungen (z.B. Depressionen, weitere Angsterkrankungen, dissoziative Störungen, somatoforme Störungen, Suchterkrankungen) adjuvant verabreicht werden [7]. Das psychotherapeutische Konzept zur Behandlung der PTBS beinhaltet drei Phasen: Stabilisierung, Traumabearbeitung und psychosoziale Reintegration. Regressionsfördernde Verfahren sollten nicht zur Anwendung kommen [7]. In einer Metaanalyse verschiedener traumaadaptierter Psychotherapieverfahren zeigten sich gleichermassen die expositionsbasierten Therapieverfahren traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie und EMDR (Tab. 5 p), in geringerem Ausmass auch Stressbewältigungsansätze und die verhaltenstherapeutische Gruppentherapie, wirksam [8]. Die Prolonged Exposure Therapy gilt aufgrund zahlreicher Wirksamkeitsnachweise als evidenzbasierter Goldstandard, zeigte in einer Metaanalyse in ihrer Wirksamkeit jedoch keine signifikante Überlegenheit zu anderen traumaspezifischen, aktiven psychotherapeutischen Behandlungsverfahren wie beispielsweise EMDR, Cognitive Processing Therapy (CPT) oder Imaginery Rescripting Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 340 empfehlungen Tabelle 5 Definitionen der expositionsbasierten Psychotherapiebestandteile, die evidenzbasiert zur Behandlung von PTBS eingesetzt werden können. Eye-Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Das der EMDR zugrundeliegende Krankheitsmodell besagt, dass schwerwiegende, traumatische Erfahrungen zu einer Störung der normalen Informationsverarbeitung führen und es somit zu einer falschen Speicherung des traumatischen Erlebnisses im impliziten Gedächtnis kommt. Während einer EMDR-Behandlung wird der Patient dazu aufgefordert, sich in die traumatische Situation zurückzuversetzen und die negativen Assoziationen, die mit dem Trauma zusammenhängen, zu erleben. Dabei wird gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Patienten durch eine physische, bilaterale Stimulation in Form von Augenbewegungen, Berührungen oder Geräuschen in Anspruch genommen. Hierdurch soll ein assoziativer Verarbeitungsprozess zustande kommen und das traumatische Erlebnis in das adaptive kontextuelle Gedächtnis überführt werden bzw. die Erinnerung daran verblasst mit der Folge einer affektiven Entlastung der Betroffenen. Kognitive Verhaltenstherapie mit Expositions-Reaktionsmanagement vgl. auch Tabelle 3 Mit der Prolonged Exposure Therapy wurde ein strukturiertes Behandlungsprogramm entwickelt, das aus den Elementen Psychoedukation, imaginäre Exposition und In-vivo-Exposition besteht und sich für die Anwendung bei verschiedenen Arten traumatischer Ereignisse eignet. Die imaginative Konfrontation mit dem Trauma wird in allen Sinnesmodalitäten über ca. vier bis acht Sitzungen wiederholt, bis die Angst während der Exposition deutlich zurückgeht. Die Therapiesitzung wird auf Tonträger aufgenommen; die Patienten erhalten die Aufgabe, sich die Aufzeichnungen zuhause täglich anzuhören. Bei der Cognitive Processing Therapy (CPT) wird die Konfrontation mit dem Trauma auf die schlimmsten Momente (hot spots) und auf wenige Wiederholungen begrenzt. Während der Konfrontation werden Methoden der kognitiven Umstrukturierung (z.B. sokratischer Dialog) angewendet. Neben der Habituation an die Angst ist die Korrektur irrationaler Bewertungen des Traumas, wie z.B. Schuld- und Schamgefühle, therapeutisches Ziel. Das Imaginery Rescripting und Antialptraumtraining verfolgt die Konfrontation mit der Traumasequenz oder dem Alptraum, deren Veränderung durch eine imaginäre Konfrontation mit komplementären Verhaltens- und Gefühlsinhalten bzw. einem alternativen Traum mit günstigem Ausgang. (Tab. 5) [9].Für eine mögliche Überlegenheit einer Kombination aus Psycho- und Pharmakotherapie gegenüber den jeweiligen Massnahmen allein gibt es keine ausreichende Evidenz [7, 10]. Die Leitlinien des National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) empfehlen in Abhängigkeit vom Schweregrad und vom Verlauf der Symptomatik ein mehrstufiges Vorgehen mit Überwachung und Begleitung nach Trauma, Kurzzeittherapie, traumafokussierter kognitiver Verhaltenstherapie oder EMDR [6]. Pharmakologische Behandlung Eine pharmakologische Therapie bei PTBS ist dann indiziert, wenn Patienten auf eine psychotherapeutische Behandlung nicht ansprechen oder wenn die sehr häufigen komorbiden Erkrankungen (z.B. Depressionen, weitere Angsterkrankungen, dissoziative Störungen, somatoforme Störungen, Suchterkrankungen) behandelt werden müssen [1]. Erste Wahl sind die SSRI Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin oder das SSNRI Venlafaxin (Level A). Dabei ist zu beachten, dass derzeit in der Schweiz ausschliesslich Paroxetin und Sertralin für diese Indikation zugelassen sind. Die Wirksamkeit von Amitriptylin, Imipramin, Mirtazapin, Risperidon und Lamotrigin ist durch verschiedene plazebokontrollierte Studien belegt (Level B1). Ein gutes Therapieansprechen kann auch mit den folgenden Wirkstoffen oder Wirkstoff-Kombinationen erreicht werden: Citalopram, Escitalopram, Fluvoxamin, Moclobemid, Tianeptin, Quetiapin, Olanzapin, Phenytoin, Carbamazepin, Gabapentin, Lamotrigin, Topiramat, Memantin, die Zugabe von Triiodothyronin zu einem SSRI, Imipramin in Kombination mit Clonidin (Level B2), Kombination von Quetiapin mit Venlafaxin oder Zugabe von Gabapentin zu einem SSRI (Level B3) [1]. PTBS sind oft chronisch und erfordern eine Langzeitbehandlung von mindestens 12–24 Monaten, dazu sind die SSRI Fluoxetin und Sertralin sowie das SSNRI Venlafaxin besonders geeignet. Die Frequenz von Alpträumen, die im Zusammenhang mit dem traumatischen Erlebnis stehen, kann durch eine Behandlung mit dem a1-Antagonisten Prazosin verringert werden (Level B1). In Tabelle 6 p ist die pharmakologische Behandlung der PTBS zusammenfassend dargestellt. Im klinischen Alltag können im Einzelfall höhere Dosierungen als angegeben notwendig werden. Weitere Therapieoptionen Die Datenlage zu anderen, nichtpharmakologischen Behandlungsmethoden ist schwach, lediglich für die transkranielle Magnetstimulation (rTMS) konnte in Studien eine gewisse Wirksamkeit belegt werden. Medikamentöse Behandlung von Zwangsstörungen und posttraumatischer Belastungsstörung in speziellen Situationen Ältere Patienten Es müssen folgende Faktoren beachtet werden: Erhöhte Sensibilität im Hinblick auf anticholinerge Eigenschaften (z.B. bei TZA oder bestimmten SSRI, z.B. Paroxetin), extrapyramidale Symptome, erhöhtes Risiko für eine orthostatische Hypotonie und EKG-Veränderungen und mögliche paradoxe Reaktionen auf Benzodiazepine. Daher ist die Behandlung mit TZA oder Benzodiazepinen weniger günstig, während SSRI und SSNRI sicher erscheinen. Altersbedingte physiologische Veränderungen können zu Veränderungen in der Metabolisierung und Pharmakokinetik der Medikamente führen. Insgesamt existieren nur wenige Studien zur Behandlung von Angsterkrankungen bei älteren Patienten: Escitalopram, Citalopram und Venlafaxin waren sicher und wirksam [1]. Bei Verordnung von SSRI und SSNRI ist an das seltene Risiko eines SIADH mit Hyponatriämie zu denken bzw. bei SSRI an das geringe Risiko einer erhöhten gastrointestinalen Blutungsneigung bei Risikopatienten. Obwohl sich dies grundsätzlich in jedem Fall empfiehlt, wird gemäss den S3-Leitlinien der DGPPN beim Auftreten von Zwangsstörungen bei Patienten über 50 Jahre explizit eine neurologische Diagnostik empfohlen, um eine organische Genese auszuschliessen. Zu berücksichtigen ist, dass das für eine PTBS ursächliche Trauma lange zurückliegen kann: In Deutschland leiden kriegsbedingt 3–4% der über 65-Jährigen am Vollbild einer PTBS, in der Schweiz sind es 0,7%. Kinder und Jugendliche Zwangsstörungen Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter äussern sich oft ähnlich wie bei Erwachsenen. Nach den Kriterien des DSM-IV sind jedoch die Einsichtsfähigkeit und der Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 341 empfehlungen Tabelle 6 Pharmakologische Behandlung der PTBS (Level A–D), basierend auf den WFSBP-Guidelines [1]. Diagnose Behandlung Posttraumatische Belastungsstörung SSRI Evidenz-Kategorie Empfohlene Dosis für Erwachsene Fluoxetin (z.B. Fluctine®), n.z. A 20–40 mg Sertralin (z.B. Zoloft ) A 50–100 mg Paroxetin (z.B. Deroxat®) A 20–40 mg SSNRI Venlafaxin (z.B. Efexor®), n.z. A 75–300 mg TZA Amitriptylin (z.B. Saroten ), n.z. B1 75–200 mg Imipramin (z.B. Tofranil®), n.z. B1 75–200 mg ® ® Wenn andere Behandlungsmöglichkeiten nicht wirksam waren oder nicht toleriert wurden NaSSA Mirtazapin (Remeron®), n.z. B1 30–60 mg Antipsychotika Risperidon (z.B. Risperdal ), n.z. B1 0,5–2,0 mg Olanzapin (z.B. Zyprexa®), nur als Zusatz, n.z. B1 5–15 mg ® a1-Antagonist Prazosin, nur bei Alpträumen, n.z. B1 1–5 mg Antiepileptikum Lamotrigin (z.B. Lamictal®) n.z. B1 25–500 mg MAO-Hemmer Phenelzin, n.z. C 45–90 mg n.z.: in der Schweiz für die Indikation Posttraumatische Belastungsstörung nicht zugelassen. Dosierungen teilweise abweichend von den Empfehlungen im Arzneimittel-Kompendium (www.compendium.ch). Widerstand gegen mindestens eine Zwangshandlung oder einen Zwangsgedanken nicht gefordert. Damit wird dem Entwicklungsprozess (auch von kognitiven Prozessen), in dem sich Kinder und Jugendliche befinden, Rechnung getragen. Wie im Erwachsenenalter werden auch die Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen oft durch das zusätzliche Vorliegen anderer psychischer Beeinträchtigungen erschwert. Die Abhängigkeit des Kindes vom familiären Umfeld oder einer betreuenden Person muss mit bedacht und andere Familienmitglieder sollten aktiv an der Therapie beteiligt werden. Vor einer pharmakologischen Behandlung sollten psychotherapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsverhinderung ist die Therapie der ersten Wahl und zeigt eine gute Wirksamkeit (mittlere Effektstärke: 1,45; Level A). Die Wirksamkeit der Behandlung konnte durch den Einbezug der Familie noch erhöht werden. Dazu passend ist, dass die Einbindung der Eltern und Familie in die Zwangssymptomatik (das Aufrechterhalten der Zwänge z.B. durch Einkaufen der Waschmittel) ein wesentlicher prädiktiver Faktor bezüglich der Wirksamkeit der Therapie ist. Bei mangelnder Wirksamkeit der Psychotherapie, bei Ablehnung oder sehr schwerer Ausprägung der Symptomatik werden SSRI als Medikamente der ersten Wahl eingesetzt. In der Schweiz sind Sertralin ab einem Alter von 6 Jahren (Level A) und Fluvoxamin ab einem Alter von 8 Jahren für die Behandlung von Zwangsstörungen zugelassen. Nach einer Cochrane-Analyse schneiden SSRI im Vergleich zu Plazebo signifikant besser ab und können aufgrund der Wirksamkeit auch als erste Wahl in der Behandlung eingesetzt werden [11]. Die Abbruchrate war jedoch unter alleiniger Medikation deutlich höher als unter kombinierter Psychotherapie. Bei Nichtansprechen auf ein SSRI sollte auf ein anderes SSRI umgestellt werden. Bei weiterer Nonresponse, hohem Schweregrad oder zusätzlichen Ticstörungen kann eine Augmentation mit Antipsychotika eingesetzt werden. Die Datenlage für Kinder und Jugend- liche ist noch eingeschränkter als für das Erwachsenenalter und ist am besten für Risperidon (Level B3). Clomipramin ist trotz guter Wirksamkeit Medikament zweiter Wahl aufgrund der anticholinergen und kardiologischen Nebenwirkungen, es kann jedoch ebenfalls als Augmentation zu SSRI bei Nonresponse in Erwägung gezogen werden. MAO-Hemmer, SSNRI und NaSSA werden in der Behandlung von Zwängen im Kindes- und Jugendalter nicht eingesetzt [12]. Das Ziel bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen sollte sein, die Symptome und die Beeinträchtigung im Alltag und in der Familie zu minimieren. Zusätzlich sollten die Fähigkeiten des Kindes zur Problembewältigung gestärkt und Strategien erarbeitet werden, die die Rückfallgefahr verringern. Dabei ist wichtig, dass die Behandlungsmethoden dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden. Zusammenfassend ist die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsverhinderung die Behandlung der ersten Wahl, gefolgt von einer kombinierten Pharmakotherapie und einer Monotherapie mit SSRI [12, 13]. Neurochirurgische Eingriffe sind bei Kindern und Jugendlichen nicht indiziert. Posttraumatische Belastungsstörung Die Symptome einer PTBS bei Kindern und Jugendlichen sind mit denen bei erwachsenen Patienten vergleichbar, hängen jedoch vom Alter des Patienten ab. Als Reaktion auf ein traumatisches Erlebnis zeigen jüngere Kinder häufig auch aggressives oder destruktives Verhalten. Oft werden die traumatischen Erlebnisse nachgespielt oder gezeichnet. Die Reaktionen von Kindern und Jugendlichen werden stark durch die Reaktionen der Eltern während oder nach dem Trauma beeinflusst. Kinder wollen das traumatische Erlebnis meist nicht besprechen, um die Eltern nicht weiter zu belasten. Dies kann dazu führen, dass Eltern die psychische Verfassung des Kindes falsch einschätzen. Auch bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit PTBS ist der Einsatz von Psychopharmaka nicht die erste Wahl. Eine Behandlung mit SSRI ist Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 342 empfehlungen nicht ausgeschlossen, es kann jedoch vermehrt zu Suizidgedanken und suizidalem Verhalten kommen. Die Patienten sollten daher insbesondere während einer Behandlung mit SSRI genau beobachtet werden. Kognitiv-behaviorale Methoden (kognitive Bearbeitung des Traumas, Expositionstechniken, Vermittlung von Techniken zur Stressbewältigung) haben sich bei der Therapie einer PTBS bei Kindern und Jugendlichen als wirksam erwiesen. Die meisten Studiendaten beziehen sich allerdings auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen, die wiederholte sexuelle Gewalt erfahren haben. Die daraus resultierenden Behandlungsempfehlungen sind nur begrenzt auf andere Traumata übertragbar. Die gewählte Behandlungsmethode sollte an den Entwicklungsstand und das kindliche Weltbild angepasst werden. Die beste Evidenz (Level A) liegt für die kognitiv-verhaltenstherapeutische Therapie vor. Dabei wurde vor allem die traumafokussierte Therapie TF-CBT eingesetzt und untersucht. Die TF-CBT kombiniert verschiedene Eltern- und Kind-Interventionen. Diese Komponenten enthalten Psychoedukation, Skills, die die Eltern einsetzen können, um die Kinder zu unterstützen, Entspannungsverfahren sowie Möglichkeiten zur affektiven und kognitive Regulation im Hinblick auf das Trauma. Es gibt dabei separate Kindund Elternsitzungen sowie gemeinsame Therapiestunden. TF-CBT kann bei verschiedenen Altersgruppen vom Kindergarten bis zur Oberschule eingesetzt werden. EMDR führt teilweise zu guten Resultaten, es liegen jedoch nicht genügend Daten vor, um eine eindeutige Empfehlung abzugeben. Für andere Verfahren, wie etwa die Narrative Exposure Therapy for Children and Adolescents (KIDNET), gibt es derzeit ebenfalls nur vergleichsweise wenig Evidenz. Spiel- und Maltherapien können bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen hilfreich sein, ihre Wirksamkeit ist jedoch nicht abschliessend belegt. Schwangerschaft und Stillzeit Für die Arzneimitteltherapiesicherheit in der Schwangerschaft und während der Stillzeit empfiehlt sich stets die Konsultation einer aktualisierten Online-Datenbank, zum Beispiel www.swisstis.ch oder www.embryotox.de. In der Schwangerschaft haben immer eine besonders strenge Indikationsstellung sowie eine sorgfältige NutzenRisiko-Abwägung unter Einbezug der betreuenden Gynäkologen und intensivierter Vorsorge in der Schwangerschaft zu erfolgen. Der Mehrzahl der Übersichtsarbeiten zufolge stellt die Behandlung mit SSRI und TZA in der Schwangerschaft kein erhöhtes Risiko für das Kind dar, obwohl über geringfügige Anomalien, Frühgeburten und neonatale Komplikationen berichtet wurde. SSRI und TZA gehen in der Regel nur in geringer Konzentration in die Muttermilch über; im Serum von Säuglingen wurden niedrige Konzentrationen gefunden. Wenn höhere Dosen über einen längeren Zeitraum verwendet wurden oder eine weitere Behandlung notwendig ist, sollte möglicherweise ein Abstillen empfohlen werden. Prävention der posttraumatischen Belastungsstörung Die PTBS nimmt eine Sonderstellung unter den psychischen Störungen ein: Sie beginnt definiert vor dem Hintergrund eines auslösenden Ereignisses. Wegen dieser zeitlichen Eingrenzbarkeit, zusammen mit der Neigung zur Chronifizierung und der hohen Vergesellschaftung mit Folgeerkrankungen, lassen sich Massnahmen zur Sekun- därprävention sinnvoll einsetzen [15]. Je nach Art des Traumas entwickeln 10–50% der Personen aufgrund des Erlebten eine PTBS. Es gibt verschiedene Präventionsmethoden, die nach einem Trauma indiziert sein können. Professionelle Hilfe sollte aber weder aufgedrängt werden, noch ist sie als Routine empfehlenswert [15]. Eine früher favorisierte einzelne, isolierte therapeutische Sitzung unmittelbar nach dem Ereignis («debriefing») ist zu vermeiden, da dies den natürlichen Heilungsverlauf negativ beeinflussen kann. Statt dessen sollten unter Beachtung individueller Risikofaktoren (beispielsweise weibliches Geschlecht, geringe soziale Unterstützung, interpersonelle Traumata, externale Schuldzuschreibung, peritraumatische Dissoziation, früh einsetzende Wiedererlebenssymptome oder akute Belastungsreaktion) gezielte psychotherapeutische Interventionen veranlasst werden [15]. Nutzen und Risiko der Gabe von Benzodiazepinen in der posttraumatischen Frühphase sind sorgfältig abzuwägen, atypische Antipsychotika (Quetiapin, Olanzapin) oder antikonvulsive bzw. anxiolytische Substanzen (Pregabalin) können hier eine Alternative darstellen [15]. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf die Wirksamkeit des Betablockers Propranolol, die jedoch einer genaueren Überprüfung bedürfen [16]. Therapieresistenz Es gibt keine allgemein verbindliche Definition des Begriffs «Therapieresistenz». Bevor ein Patient als «therapieresistent» eingestuft wird, sollten folgende Faktoren sichergestellt werden: eine korrekte Diagnose, eine adäquate Psychotherapie, die zuverlässige Einnahme der Medikamente, eine Dosis im therapeutischen Bereich sowie eine ausreichende Behandlungsdauer. Gleichzeitig gegebene andere Medikamente (z.B. Induktoren oder Inhibitoren des Cytochrom-P450-Systems) können die Wirkung einer Substanz stark beeinflussen (www.mediq.ch). Auch psychosoziale Faktoren und Komorbiditäten können die Behandlung erschweren; insbesondere beeinflussen Persönlichkeitsstörungen, Substanzmissbrauch und Depressionen die Prognose ungünstig. Zwangserkrankungen Etwa 30–40% der Patienten mit Zwangsstörungen sprechen nicht auf eine Medikation mit SSRI oder Clomipramin an [4]. Bei der Behandlung von therapieresistenten Zwangsstörungen war intravenös verabreichtes Clomipramin allerdings wirksamer als die oral eingenommene Substanz (Level B1). Gemäss der meisten Expertenmeinungen und der gängigen Leitlinien sollte eine Behandlung mit einem SSRI mindestens 12 Wochen andauern [4]. Bei einer unzureichenden Wirksamkeit der SSRI-Therapie ist eine Erhöhung der Dosis bis zur individuell maximal verträglichen Menge, ein Wechsel auf ein anderes SSRI oder Venlafaxin oder auch eine Augmentation mit den Antipsychotika Quetiapin, Olanzapin oder Risperidon zu erwägen (Abb. 1) [4]. Die Augmentation einer SSRI-Behandlung durch Quetiapin, Olanzapin oder Risperidon ist wirksamer als eine SSRI-Monotherapie (Level B1). Einige Studien bestätigen auch die Wirksamkeit des Antipsychotikums Aripiprazol (Level B2) sowie verschiedener experimenteller Behandlungsmethoden (Cyproteronacetat, Psilocybin, D-Cycloserin) (Level B2). Eine verbesserte Ansprechrate kann auch durch die Kombination von einem SSRI mit anderen Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 343 empfehlungen Die SGPP entwickelt zur Hilfestellung für ihre Mitglieder und im Rahmen ihrer Bemühungen um Qualitätssicherung in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung Behandlungs- und andere Empfehlungen zu praktisch wichtigen Fragestellungen. Diese beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Verfahren. Im Einzelfall können auch andere Behandlungsarten und -vorgehen zum Ziel führen. Die Empfehlungen der SGPP werden regelmässig auf ihre Gültigkeit überprüft. Die SGPP publiziert die Empfehlungen mit grösster Sorgfalt in der für die Mitglieder und allenfalls andere Interessierte geeigneten Form. Die Befolgung oder Nichtbefolgung dieser Empfehlungen hat für den Arzt oder die Ärztin weder haftungsbefreiende noch haftungsbegründende Wirkung. Wirkstoffen erreicht werden. Die Kombination des 5HT1ARezeptorantagonisten/Betablockers Pindolol (7,5–10 mg, off-label) mit Paroxetin (Level B1) ist wirksam, jene mit Fluvoxamin jedoch nicht (Level D). Ausserdem liessen sich für folgende Wirkstoff-Kombinationen Hinweise auf eine Wirksamkeit finden: Citalopram plus Reboxetin (selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer, NRI), Zugabe von Lithium oder L-Tryptophan zu Clomipramin und die Augmentation eines SSRI mit Buspiron, Pindolol, Topiramat oder L-Tryptophan (Level B2). Posttraumatische Belastungsstörung Bei SSRI-resistenten PTBS-Patienten kann eine Behandlung mit Olanzapin oder die Zugabe von Risperidon zur bestehenden Therapie indiziert sein (Level B1). Aktualisierung der Behandlungsempfehlungen Diese Behandlungsempfehlungen werden in Abstimmung mit den WFSBP-Leitlinien aktualisiert und auf den Websites der SGAD (www.sgad.ch), der SGZ (www.zwaenge.ch), der SGBP (www.ssbp.ch) und der SGPP (www.psychiatrie. ch) publiziert. Literatur 1 Bandelow B, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Möller HJ and WFSBP task force on treatment guidelines for anxiety obsessive-compulsive post-traumatic stress disorders. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Pharmacological treatment of Anxiety, Obsessive-Compulsive and Post-Traumatic Stress Disorders – First Revision. The World Journal of Biological Psychiatry. 2008;9:248–312. 2 Keck ME, Ropohl A, Rufer M, Hemmeter UM, Bondolfi G, Preisig M, et al. Die Behandlung der Angsterkrankungen, Teil 1: Panikstörung, Agoraphobie, generalisierte Angststörung, soziale Phobie, spezifische Phobien. Schweiz Med Forum. 2011;11(34): 558–66. 3 Rufer M. State of the art der Therapie von Zwangsstörungen. Info Neurologie&Psychiatrie.2012;10(1):12–5. 4 Kordon A, Zurowski B, Wahl K, Hohagen F: Evidenzbasierte Pharmakotherapie und andere somatische Therapieverfahren bei Zwangsstörungen. Der Nervenarzt. 2011;82:319–24. 5 Külz AK, Voderholzer U: Psychotherapie der Zwangsstörung. Der Nervenarzt. 2011;82:308–18. 6 National Institute for Health and Clinical Excellence: Post-traumatic stress disorder – The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. CG 26. London: National Institute for Health and Clinical Excellence; 2005. 7 Flatten G, Gast U, Hofmann A, Knaevelsrud C, Lampe A, Liebermann P, et al. S3 – Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Trauma & Gewalt. 2011;3:202–10. AWMF-Register-Nr.: 051/010. 8 Bisson JI, Ehlers A, Matthews R, Pilling S, Richards D, Turner S: Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder. The British Journal of Psychiatry. 2007;190:97–104. 9 Powers MB, Halpern JM, Freneschk MP Gillihan SJ, Foa EB: A metaanalytic review of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder. Clin Psychol Rev. 2010;30(6):635–41. 10 Hetrick SE, Purcell R, Garner B, Parslow R: Combined pharmacotherapy and psychological therapies for post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev. 2010;7:CD007316. 11 O’Kearney RT, Anstey KJ, von Sanden C, Hunt A: Behavioural and cognitive behavioural therapy for obsessive compulsive disorder in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4: Art. No.: CD004856, DOI:10.1002/14651858. CD004856.pub2. The Cochrane Library 2010. 12 Walitza S, Melfsen S, Jans T, Zellmann H, Wewetzer C, Warnke A: Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. Dtsch Arztebl Int. 2011;108:173–9. 13 Piacentini J, Bergman RL, Chang S, Langley A, Peris T, Wood JJ, McCracken J: Controlled comparison of family cognitive behavioral therapy and psychoeducation/relaxation training for child obsessivecompulsive disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011; 50:1149–61. 14 Hellmann J, Heuser I, Kronenberg G: Prophylaxe der posttraumatischen Belastungsstörung. Der Nervenarzt. 2011;82:834–42. 15 Cukor J, Spitalnick J, Difede J, Rizzo A, Rothbaum BO: Emerging treatments for PTSD. Clin Psychol Rev. 2009;29:715–26. Korrespondenz: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Martin E. Keck Clienia Privatklinik Schlössli Zentrum für Neurowissenschaften Zürich (ZNZ) der Universität und ETH Schlösslistrasse CH-8618 Oetwil am See martin.keck[at]clienia.ch Schweiz Med Forum 2013;13(17):337–344 344 N e w s l e t t er 01 ·14 Freundschaft mit Gedanken und Gefühlen schliessen? – Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie («Mindfulness-­ based Cognitive Therapy», MBCT) bei Zwangsstörungen Anne Katrin Külz «Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Hier haben wir die Freiheit und die Macht unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit!» Viktor Frankl Herr S. hat bereits mehrere ambulante und stationäre Verhaltenstherapien zur Behandlung seiner Kontrollzwänge hinter sich. Er weiss, wie man sich den Zwangsimpulsen im Alltag widersetzt, was ihm manchmal gut und manchmal weniger gut gelingt. Seit dem frühen Erwachsenenalter empfindet er sein Leben als ständigen «Kampf gegen den Zwang». Warum Achtsamkeit bei Zwangsstörungen? Vielen Menschen, die an Zwängen leiden, kann kognitive Verhaltenstherapie mit Konfrontationsübungen deutlich helfen: Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich bei etwa zwei Drittel der Betroffenen die Symptomatik zumindest um ein Drittel bessert. Gleichzeitig belegen die Zahlen auch, dass nicht wenige Patienten ebenso wie Herr S. auch nach Behandlung noch unter Zwangssymptomen in mehr oder weniger starker Ausprägung leiden. Daher erscheint es notwendig, nach ergänzenden Therapiemöglichkeiten zu suchen, um Zwängen wirksam begegnen zu können. In den letzten Jahren haben zunehmend achtsamkeits- und akzeptanzbasierte Verfahren Einzug in die psychotherapeutische Landschaft gehalten (Heidenreich und Michalak, 2006). Während einige Menschen begeistert von der heilenden Wirkung der Achtsamkeit schwärmen, stehen andere dem Achtsamkeitskonzept als «Modetrend» eher kritisch gegenüber. Tatsächlich hat die Praxis der Achtsamkeit eine über 2500 Jahre alte Tradition, kann jedoch auch ohne spezielle religiöse oder spirituelle Orientierung angeeignet werden. Achtsamkeit bedeutet zunächst, auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein: Die Aufmerksam- keit wird bewusst auf den gegenwärtigen Augenblick, d.h. die Sinnes- und Körperempfindungen, Gefühle oder auch Gedanken gerichtet, ohne dass ich bewerte, was ich wahrnehme. Ich verurteile mich nicht für manche Empfindungen, innere Bilder oder Gedanken, sondern nehme sie an als das, was eben nun gerade passiert. Sowohl die Aufmerksamkeitslenkung auf den Augenblick als auch eine nicht wertende Haltung fallen bei Zwängen oft besonders schwer: Wie gelingt es, genau wahrzunehmen, was um mich herum wirklich geschieht, wenn ich in Gedankenspiralen und Ängsten gefangen bin? Wie kann ich negative Gedanken einfach wahrnehmen und vorbeiziehen lassen, wenn sie meinen eigenen Wertvorstellungen zutiefst widersprechen? Wie soll es möglich sein, unangenehme Gefühle von starker Furcht oder Ekel offen zur Kenntnis zu nehmen, ohne alles daran zu setzen, sie so schnell wie möglich zu beseitigen? Untersuchungen bei einer Vielzahl von Menschen haben gezeigt, dass die Haltung der Achtsamkeit (Pali: «sati») durch regelmässige Übungen erlernbar ist: Während der Geist anfangs immer wieder durch Gedanken, Assoziationen, Planen oder (Ver-)Urteilen «entführt» wird, gelingt es mit der Zeit immer besser, sich mit dem Augenblick zu verbinden, z.B. auch bewusst den Atem wahrzunehmen, die Aufregung zu registrieren, das Bedürfnis nach einer Ruhepause oder einfach nur die Sonne auf der Haut zu spüren. Dabei ist natürlich nichts Schlechtes daran, Pläne zu schmieden oder über Dinge nachzudenken: Wir tun es mit Hilfe der Achtsamkeit vielleicht nur weniger in festgefahrenen Mustern, werden wacher für das, was um uns herum wirklich abläuft, können gelassener zu Gedanken und Gefühlen stehen, auch wenn sie unangenehm sein mögen. Gerade bei Zwangsstörungen könnte die wertfreie Wahrnehmung der momentanen Erfahrung eine unterstützende Wirkung haben. So weiss man, dass die Aufmerksamkeit bei Zwangserkrankungen sehr stark durch Reize gefangengenommen ist, die den Zwang interessieren, wie z.B. spitze Gegenstände bei Angst vor aggressiven Impulsen. Viele Menschen mit Zwängen berichten ausserdem häufig davon, ständig «im Kopf» zu sein, die Aussenwelt gar nicht vollständig wahrzunehmen, während sich das Gedankenkarussell immer weiter dreht. Ausserdem dienen viele 13 N e w s l e t t er 01 ·14 Zwänge dazu, unangenehme Gefühle «in Schach» zu halten, so dass der Zwang an Bedeutung verliert, wenn wir es wagen, diese unbefangen als vorübergehende innere Prozesse wahrzunehmen. Gegenwärtig überprüfen wir mit einem Gruppenprogramm zu Achtsamkeit bei Zwängen, inwiefern das Achtsamkeitskonzept für Menschen hilfreich sein kann, die auch nach verhaltenstherapeutischer Behandlung noch unter Zwängen leiden. Eine Studie zu achtsamkeitsbasierter Therapie Am Universitätsklinikum Freiburg wird seit einiger Zeit ein achtsamkeitsbasiertes Gruppenprogramm (englisch: MBCT, Mindfulness-based Cognitive Therapy) für Menschen mit Zwangsstörungen angeboten und auf seine Wirksamkeit bei Zwangsstörungen überprüft. MBCT ist ein achtwöchiges Therapieprogramm, welches aus der achtsamkeitsbasierten Stressbewältigung nach Kabat-Zinn (MBSR: Mindfulness-based Stress Reduction) abgeleitet wurde und neben Achtsamkeitsübungen für alltägliche Handlungen auch Meditations- und Yogaübungen vermittelt sowie Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie enthält (Segal et al., 2008). Bislang wurde seine Wirksamkeit insbesondere zur Rückfallvorsorge bei Depressionen nachgewiesen, aber erste Untersuchungen belegen auch seine Wirksamkeit bei anderen Erkrankungen wie beispielsweise Angststörungen (vgl. zur Übersicht Chiesa & Serretti, 2011). In einer Untersuchung, bei der MBCT zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt wurde, verringerten sich auch zusätzlich erfasste Zwangssymptome deutlich (Kim et al., 2009). Bei Zwangsstörungen wurde die Effektivität achtsamkeitsbasierter Therapiemassnahmen allerdings noch wenig überprüft. Das MBCT-Konzept wurde bislang bei Zwängen noch nicht angewendet. Gruppenprogramm und Teilnehmer Das für Zwangsstörungen konzipierte MBCT-Manual wurde in enger Anlehnung an das klassische MBCT erstellt, wobei die verhaltenstherapeutischen Elemente für Zwangsstörungen angepasst wurden (Külz und Rose, 2013). Das Therapieprogramm umfasst acht Sitzungen à zwei Stunden in wöchentlichem Abstand. Zwischen den Sitzungen erhalten die Teil- nehmer Anregungen, um das Erlernte selbständig weiterüben zu können. Ein Kernelement stellt z.B. der «3-Minuten-Atemraum» dar, der dazu einlädt, kurzzeitig mitten im Alltagsgeschehen innezuhalten und die Aufmerksamkeit auf gegenwärtige Erfahrungen sowie den eigenen Atem zu lenken. Neben Yogaübungen und einer Übung zur Schulung des Körpergewahrseins, dem Bodyscan, erhalten die Teilnehmer Anregungen, Achtsamkeit bei alltäglichen Handlungen, insbesondere auch auftretenden Zwangsimpulsen auszuprobieren und in den eigenen Alltag zu integrieren. Die kognitiv verhaltenstherapeutischen Elemente des Therapieprogramms umfassen Informationen über das Wesen von Gedanken und Umgangsmöglichkeiten mit diesen. Schliesslich werden auch Strategien zur Selbstfürsorge sowie zur Rückfallprophylaxe vermittelt. Einen Überblick über die Inhalte des Therapieprogramms gibt Tabelle 1. Tabelle 1: Inhalte des MBCT-Programms für Zwangsstörungen (Siehe Tabelle auf Seite 15) Die bislang 20 teilnehmenden Patienten (12 Männer und 8 Frauen) hatten bis maximal 2 Jahre vor Beginn des Gruppenprogramms eine Verhaltenstherapie abgeschlossen. Vier Teilnehmer brachen die Behandlung wegen Terminschwierigkeiten, familiären Konflikten oder kurzfristiger Verfügbarkeit eines ambulanten Therapieplatzes vorzeitig ab. Etwa die Hälfte der Teilnehmer nahm seit mindestens drei Monaten vor Behandlungsbeginn Medikamente zur Behandlung der Zwangsstörung ein. Ergebnisse a) Schwere der Zwänge Vor und nach der Behandlung wurden die Teilnehmer mit der Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale), einem bewährten Interview zur Erfassung der Zwangssymptomatik befragt. Da eine Normal- und Gleichverteilung der Daten vorlag, konnte eine Varianzanalyse mit Messwiederholung zur Datenanalyse eingesetzt werden. Demnach fanden wir eine hochsignifikante Verbesserung für den Gesamtwert der Y-BOCS von 17,9 auf 13,9 Punkte; auch deren Unterskalen für die Schwere der Zwangsgedanken und Zwangshandlungen besserten sich signifikant. 14 N e w s l e t t er 01 ·14 Thema der Stunde Kursinhalte Hintergrund Sitzung 1: Der Autopilot und die Brille des Zwangs § Einführung: Die Rolle der Achtsamkeit bei Zwängen § «Rosinenübung» (Übung zu Achtsamkeit im Alltag) §Body-Scan § Kurze Atembetrachtung Aufmerksamkeit immer wieder auf den Augenblick richten Sitzung 2: Umgang mit Hindernissen §Body-Scan § Kurze Sitzmeditation § Vorstellungsübung zum Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Körper­ empfindungen § Einführung des Zwangsmodells von Salkovskis Die permanente Tätigkeit des Verstandes (Denken, Bewerten etc.) erkunden Sitzung 3: Achtsamkeit des Atems § Übung zum «Sehen» oder zum «Hören» §Sitzmeditation §3-Minuten-Atemraum §Yoga Strategien üben, um im ­Augenblick anzukommen Sitzung 4: Gegenwärtig sein § Übung zum «Sehen» oder zum «Hören» §Sitzmeditation §3-Minuten-Atemraum § Vorstellung des neurobiologischen Modells der Zwangsstörung § Ausfüllen und Besprechen eines Fragebogens zu typischen Überzeugungen bei Zwängen Tendenzen von Anhaften und Aversion gegenüber Erfahrungen erkennen, ebenso die Identifikation mit Zwangsinhalten e ­ rkunden Sitzung 5: Akzeptanz – Gedanken sind keine Feinde §Sitzmeditation § Atemraum zur Bewältigung § Exploration des Konzepts der Akzeptanz und dessen Zugang über den Körper § Geschichte zum Thema Akzeptanz akzeptierende Haltung gegenüber der eigenen Erfahrung einschliesslich der Zwangsgedanken und – impulse ausprobieren Sitzung 6: Gedanken sind keine Tatsachen §Sitzmeditation § Atemraum als erster Schritt vor einer hilfreichen Perspektive auf Zwangsgedanken und -impulse § Vorstellungsübung zur Verdeutlichung des Zusammenhangs zwischen Befindlichkeit und Zwangsgedanken § Besprechung hilfreicher Umgangsmöglichkeiten mit Zwangsgedanken die Abhängigkeit der Zwangs­ symptome von der eigenen ­«Ressourcenlage» erkennen Sitzung 7: Selbstfürsorge §Sitzmeditation § Atemraum als erster Schritt vor einer achtsamen Handlung § Achtsames Gehen § Übungen zu nährenden und Energie verbrauchenden Elementen im Alltag §Reflexion hilfreicher Verhaltensweisen bei Zwangsimpulsen § Das «Anti-Zwangs-Haus» zur Veranschaulichung individueller Expositionsziele für die Zukunft Künftige Strategien im Umgang mit Zwangssymptomen ent­ wickeln und eine «nährende» ­Alltagsgestaltung planen Sitzung 8: Umgang mit künftigen Zwangssymptomen §Bodyscan § Geführte Abschlussmeditation § Fragebögen zur Reflektion des Kurses § Besprechung von möglichen Strategien zur Aufrechterhaltung der Übungspraxis Eine selbstfürsorgliche Haltung stärken, um die individuelle ­Praxis fortzusetzen Freiraum entdecken, der durch Achtsamkeit entsteht Neue Perspektive gegenüber der Zwangssymptomatik einnehmen Erforschen von Funktionalitäten der Zwangssymptome und Wege zum Umgang mit diesen entdecken 15 N e w s l e t t er 01 ·14 b) Ergebnisse von Patienteninterviews Die ersten zwölf Teilnehmer wurden in etwa halbstündigen Interviews ausführlich nach ihren Erfahrungen mit dem MBCT-Kurs gefragt (Hertenstein et al., 2012). Neben ihrem subjektiven Erleben wurden sie auch darum gebeten, eventuelle Schwierigkeiten und Änderungswünsche für künftige Kurse zu schildern. Die Erhebung erfolgte durch eine Mitarbeiterin, die nicht an der Durchführung des Kurses beteiligt war. Die Antworten wurden mithilfe der Technik der induktiven Kategorienbildung (Mayring, 2003) bearbeitet. tigung ihrer Zwangssymptomatik gehofft und mussten dann feststellen, dass Achtsamkeit viel Übung bedarf und eher auf längere Sicht Veränderungen mit sich bringt. Von vielen Teilnehmern wurde der 3-Minuten-Atemraum als besonders hilfreich und gut anwendbar im Alltag erlebt. Positiv fanden die Teilnehmer auch, dass bei den Achtsamkeitsübungen kein Druck bestand, etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern immer wieder dazu ermutigt wurde, sich ganz auf die Erfahrung des Augenblicks einzulassen. Als besonders wichtig erlebten die Teilnehmer den Austausch über die Umsetzung von Achtsamkeit im Alltag. Diskussion Die meisten Studienteilnehmer berichteten eine positive Auswirkung des Kurses auf die Zwangserkrankung. So beschrieb beispielsweise Herr H. seine Erfahrungen mit der Achtsamkeit gegenüber seinem Zwang: «Und sagen wir es so, den Wasch- und Reinigungszwang den ich habe, den habe ich in den letzten acht Wochen durch die Achtsamkeit durch dieses Innehalten – das ist vielleicht das entscheidende Wort für mich – ja messbar, wenn ich das messen würde in Zeiteinheiten die ich am Waschbecken verbringe, auf jeden Fall beeinflusst. Und das sage ich nicht weil es schön klingt, sondern weil es wirklich so war. Wenn der Impuls kommt, meinetwegen jetzt möchte ich grade mal rausgehen und die Hände waschen, dass ich dann zunächst mal innehalte und mich dann besinne auch achtsam mit mir zu sein, dass ich dann sage – früher wäre ich sofort losgerannt sonst – und jetzt wenn ich erstmal innehalte, dann kann ich sagen jetzt mach ich erstmal das hier fertig, und nach ner halben Stunde kommt dann vielleicht gar nicht mehr dieser Anreiz zu gehen, und wenn dann hab ich trotzdem was erreicht, so empfinde ich das jedenfalls.» Einige Teilnehmer schilderten jedoch auch, dass es ihnen anfangs nicht leicht gefallen sei, die nötige Geduld für die Achtsamkeitsübungen aufzubringen. Sie hatten auf rasch wirksame Strategien zur Besei- Als allgemeine positive Auswirkungen nannten die Teilnehmer einen veränderten Umgang mit eigenen Gedanken und Gefühlen, ein aktiveres Leben im Hier und Jetzt, verbesserte Stimmung, besserer Schlaf, sowie eine ruhigere und gelassenere Grundhaltung. Die vorläufigen Ergebnisse zu achtsamkeitsbasierter kognitiver Therapie (MBCT) bei Zwängen zeigen, dass das Programm von den Teilnehmern gut angenommen und als hilfreich erlebt wurde. Die Verminderung der Zwangssymptome ist insbesondere ermutigend, da alle Patienten innerhalb von zwei Jahren vor der ersten Messung bereits an einer Verhaltenstherapie teilgenommen hatten, also trotz vorheriger Therapie eine weitere Besserung erreichten. Gleichzeitig waren die Zwänge nach MBCT zwar deutlich gebessert, blieben allerdings bei den meisten Teilnehmern in geringerem Ausmass weiter bestehen. In einer zukünftigen Untersuchung möchten wir überprüfen, ob sich die von den Teilnehmern geschilderten positiven Effekte auch in anderen Massen, wie z.B. Fragebögen zur Lebensqualität oder zum Umgang mit unangenehmen Gedanken abbilden lassen. Möglicherweise kann der Achtsamkeitsansatz eine gute Ergänzung der bisherigen störungsspezifischen Behandlung von Zwängen darstellen, indem er eine hilfreiche Einstellung gegenüber (Zwangs-)Gedanken und Gefühlen vermittelt und zu einem freundlicheren Umgang mit sich selbst und gegenwärtigen Erfahrungen anregt. Gleichzeitig ist es angesichts der kleinen Teilnehmerzahl momentan noch zu früh, eindeutige Aussagen zu treffen; die Ergebnisse sind daher mit Vorsicht zu beurteilen. Die Rückmeldungen der ersten Teilnehmer in MBCT bei Zwangsstörungen haben uns insgesamt ermutigt, das Gruppenprogramm nun mit einer grösseren Anzahl von Betroffenen durchzuführen. Im Sommer 2014 werden wir daher eine wissenschaftliche Studie mit über 100 Teilnehmern umsetzen, bei der wir die 16 N e w s l e t t er 01 ·14 Wirksamkeit von MBCT mit der Wirksamkeit eines Informationsprogramms zur Zwangsbewältigung in der Gruppe gemeinsam mit Prof. Steffen Moritz in den Universitätskliniken in Freiburg und Hamburg vergleichen werden. Literatur Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research 187, 441–453. Autor: Dr. Anne Katrin Külz Dipl. Psychologin Heidenreich, T., & Michalak, J. (2006). Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie. Dgvt-Verlag. Psychologische Psychotherapeutin UNIVERSITAETSKLINIKUM FREIBURG Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie Hertenstein, E., Rose, N., Voderholzer, U., Heidenreich, T., Nissen, C., Thiel, N., Herbst, N., & Külz A.K. (2012). Mindfulness Based Cognitive Therapy in Obsessive-Compulsive Disorder – A qualitative study on patients’ experiences. BMC Psychiatry 12, 185. [email protected] Külz, A.K. und Rose, N. (2013). Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie bei Zwangsstörungen – eine Adaptation des Originalkonzepts. Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie 45, 327. Kim, Y. W., Lee, S.-H., Choi, T. K., Suh, S. Y., Kim, B., Kim, C. M., Cho, S. J., u. a. (2009). Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy as an adjuvant to pharmacotherapy in patients with panic disorder or generalized anxiety disorder. Depression and Anxiety, 26, 601–606. Mayring, P. (2003). Qualitative Inhaltsanalyse [Qualitative content analysis]. Weinheim: Beltz. Segal Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D. (2008). Die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie der Depression. Ein neuer Ansatz zur Rückfallprävention. DGVT-Verlag, Tübingen 17 N e w s l e t t er 01 ·14 Ich: ein Prototyp 10 Jahre Tiefenhirnstimulation von Herrn N. Heute bin ich 50 Jahre alt, habe seit 35 Jahren Zwangsgedanken und Zwangshandlungen gemischt und lebe seit 10 Jahren mit einer Sonde im Gehirn gegen meine Zwänge. So um das 14. Lebensjahr traten die Zwänge in mein Leben. Es begann mit ausgeprägten Waschzwängen, später änderten sich die Symptome immer wieder, mal hatte ich unter Kontrollzwängen, Zwangsgedanken und fast immer unter Wiederholungszwängen zu leiden. Der Verlauf war immer stark schwankend, irgendwann in den 90-Jahren suchte ich erstmals Therapeuten auf, was aber wenig erfolgversprechende Ergebnisse mit sich brachte. Schliesslich, ab etwa 1999 «explodierten» meine Zwänge regelrecht und drangen in immer mehr Bereiche meines Lebens ein: ich konnte nicht mehr joggen, brauchte morgens über 1 Stunde zum Anziehen, weil alles ohne «falsche Gedanken» erfolgen musste. Es folgte der übliche Weg: Hausarzt, Antidepressiva, 10 verschiedene SSRI, 6 Wochen Kur (sehr ernüchternd), unmittelbar anschliessend 2 Jahre ambulante Therapie vor Ort (die wirklich allen Regeln der Kunst folgte) dennoch ging es stetig bergab. Im Jahr 2002 sahen meine Zwänge so aus: § jeden Tag 18 bis 20 Stunden Zwänge § maximal 5 Minuten Pause zwischen einzelnen Zwängen § ich konnte nur noch einen TV-Sender ertragen § irgendwann gab es auch fast nur noch «verbotene» Lebensmittel. §a uf 200 Metern Strecke «kniete» ich bis zu 50 mal oder ging zurück §S chlafen war nur noch ohne Auskleiden möglich, da zu anstrengend § Ankleiden morgens vor der Arbeit mit bis zu 20 Wiederholungen pro Kleidungsstück, insgesamt 2 Stunden. §A utofahren im Schnitt für 15 km 2 Stunden und im Rekord 6 Stunden. Als Konsequenz konnte ich die nächsten 5 bis 6 Jahre gar nicht mehr Auto fahren. §E s gab eigentlich keinen Bereich mehr (etwa eine einfache CD zu brennen), der noch zwangsfrei funktionierte. Irgendwann kam dann der totale Systemumschlag: §S tatt 2 Stunden zu Duschen, duschte ich 8 Wochen nicht mehr, ich rasierte mich nicht mehr und hatte einen 20 cm langen Vollbart. Etwas vorher hatte ich zu trinken begonnen, um überhaupt einmal 10 Minuten zur Ruhe zu kommen. In meiner schlimmsten Zeit war es eine halbe Flasche Cognac am Tag. Ende des Jahres 2002 sah ich im Fernsehen einen Bericht über die erste Tiefenhirnstimulation (THS) in Europa und las kurze Zeit später, dass die Universitätsklinik Köln die THS erstmalig für geeignete Patienten im Rahmen einer Studie anbot. 4 Monate später war es dann soweit: ich rief in der Stereotaxie in Köln bei Professor Sturm an und bekam innerhalb 14 Tagen einen Termin für ein Vorgespräch. Professor Sturm erklärte mir die Operation, dass die Erfolgschancen bei 60 bis 70 % liegen und ich vorher eine Reihe von Testungen in der Psychiatrie durchlaufen müsse. Meine Entscheidung, mit diesem Verfahren einen Ausweg aus den Zwängen zu wagen, fiel schon an diesem Tag. Zum einen war die THS für mich relativ alternativlos, weil ich alle anderen Verfahren schon erfolglos hinter mich gebracht hatte. Zum anderen war Prof. Sturm eine Persönlichkeit, die bei mir grösstes Vertrauen erweckte, fachlich sehr kompetent ist und auch noch Verständnis für Zwänge aufbrachte. Hierbei muss man wissen, dass ich wirklich keine Person bin, die sofort kritiklos übernimmt, was gesagt wird. Alsdann folgte leider noch eine einjährige Wartezeit: zum einen dauerte es, bis ich einen Termin in der Psychiatrie zur Testung bekam, zum anderen, weil die Operation noch vom Ethikrat abgesegnet werde musste. Nach einer Testbatterie von 1 Woche im Sommer 2003 kam im Februar 2004 der Anruf: nach weiteren Testungen und entsprechender Eignung könne ich operiert werden. Die wesentlichen Voraussetzungen für eine Zulassung zur Operation: §D er Patient muss austherapiert sein, alle anderen therapeutischen Möglichkeiten müssen ausgeschöpft sein. §E s muss mindestens ein, besser zwei, stationäre Heilversuche gegeben haben. 18 N e w s l e t t er 01 ·14 § Es muss eine ambulante Therapie versucht worden sein. §E s müssen ausreichend medikamentöse Versuche erfolgt sein, was bedeutet 2 bis 3 verschiedene Medikamente über einen ausreichend langen Zeitraum (Minimum 3 Monate) und eine Kombination von zwei Medikamenten. §D ie Erkrankung muss schwerwiegend sein, entsprechend einem YBOCS-Wert von etwa 30. §E s dürfen keine suizidalen Gedanken vorliegen. Die Vorteile der Tiefenhirnstimulation: genaue Regulation Sehr überzeugt hat mich bei meiner Entscheidung für die THS auch die Tatsache, dass es sich um einen reversiblen Eingriff, der keine Gewebeschädigung verursacht handelt. Zudem gibt es diverse Einstellungsmöglichkeiten, mit denen die Wirkung und auch Nebenwirkungen reguliert werden können. Nach der Grundeinstellung im Anschluss an die Operation haben die Mediziner die Möglichkeit, die Wirkungsweise der Sonde von aussen mit einem Programmiergerät (telemetrisch) zu verändern: So können die vier Pole je Sonde unterschiedlich gesteuert werden und das Ergebnis optimiert werden. Die Stromstärke kann unterschiedlich stark eingestellt werden. Der Patient erhält ein Handgerät, mit dem man selbst (innerhalb festgelegter Grenzen) die Stromstärke nach Bedarf regulieren oder das Gerät sogar an und ausschalten kann (Bild 1). Besonders dieser Punkt ist für mich wichtig, weil ich selbst entscheiden kann, was für mich momentan «richtig» ist. Das Gefühl, selbst die Wirkung beeinflussen zu können, gibt mir grosse Sicherheit. Der Tag der Operation Es wurde eine Sonde über eine kleine Bohrung in das Tiefenhirn implantiert, bei mir in der Nähe des Nucleus Accumbens, etwa in einer Tiefe von 15 cm. Die Sonde wird über eine Batterie mit kontinuierlichen Stromimpulsen versorgt, wobei die Batterie oberhalb des Brustmuskels liegt und mit einem Kabel unter der Haut mit der Sonde verbunden wird (Bild 2). Die OP dauerte insgesamt knapp 8 Stunden, bei mir noch bei vollem Bewusstsein, heute auf Wunsch auch unter Narkose. Tatsächlich hören sich die 8 Stunden weitaus schlimmer an, als es tatsächlich ist, denn der grösste Teil geht für die Auswertung der bildgebenden Verfahren drauf, sowie die OP – Vorbereitung und den Anschluss der Batterie, dieser immer unter Vollnarkose. In jedem Fall war ich 2 Stunden nach der Operation wieder auf den Beinen, ohne jegliche Schmerzen. Die Wirkung der Operation Jeder Patient wünscht sich, dass unmittelbar eine Wirkung eintritt. Dies war jedoch nicht der Fall, konnte auch kaum der Fall sein, da aus Studiengründen in den ersten 6 Monaten, niemand wusste, wann das Gerät ein- oder ausgeschaltet war. Bei mir kamen weitere psychische Belastungen hinzu: von der Krankenkasse war ich unmittelbar vor der OP gezwungen 19 N e w s l e t t er 01 ·14 worden, die Berentung zu beantragen (die auch erfolgte), was dazu führte, das sich der gesamte Lebensablauf von 60 Wochenstunden Berufstätigkeit auf Null reduzierte, was wiederum Raum für die Zwänge schaffte. Auch in den folgenden 2 Jahren zeigte sich keine Besserung, während ich von Mitpatienten erfuhr, dass sie 3 Monate nach der OP erstmalig nach 15 Jahren wieder in Urlaub fahren konnten. Mein Therapeut stellte unmittelbar nach der Operation, gegen das Anraten der Klinik, seine Therapie ein, da er, nach seinen Worten «sich nicht von der Klinik instrumentalisieren lassen» wollte. Dies war besonders bemerkenswert, da ihm die Klinik gar keine Vorgaben gemacht hatte. Natürlich hatte ich nach dieser Erfahrung erst Mal überhaupt kein Bestreben nach therapeutischer Behandlung. Die Revolution im Gehirn beginnt Etwa 3 Jahre nach der OP nahm ich einen ersten Anlauf wieder selbst etwas zu versuchen, und nach 5 Jahren des «nicht-Auto-Fahren-könnens», absolvierte ich eine Strecke von 120 Kilometern im Alleingang. Es war der Erste, aber gewaltige Erfolg, auch wenn ich am folgenden Tag einen furchtbaren Muskelkater in den Händen hatte. Von da an fiel mir das Autofahren wesentlich leichter, was ich so erklären kann, dass ich gar kein « Zwangsdruck» mehr spürte. Das nächste was eintrat, war, das ich Speisen ohne Zwangsgedanken essen konnte, etwas später konnte ich auch wieder TV-Sendungen anschauen, die vorher sofort einen Zwangsreiz ausgelöst hätten. Am längsten benötigte ich, die Wiederholungen auf offener Straße unter Kontrolle zu bekommen. Das seltsamste an dieser Art der Besserung war, dass sich jeweils einzelne Bereiche in relativ kurzer Zeit vom Zwang befreiten, andere daneben voll weiter existierten, bis eine weitere Bastion fiel. Häufig bekomme ich die Frage gestellt, ob sich meine «Persönlichkeit» verändert habe, dies kann ich voll und ganz verneinen. Ausserhalb des Hauses oder, wenn ich unter vielen Leuten bin, verspüre ich nach zwei Stunden wieder einen gewissen Zwangsdrang. Die Erfolgsquote liegt nach meinen Recherchen zwischen 60 und 75 % auf eine Besserung, was eine veritable Chance ist, wenn man bedenkt, dass es sich ausschliesslich um Patienten handelt, bei denen nichts anderes Besserung gebracht hat. Besserung wird im übrigens sowohl bei der THS als auch in der Therapie mit einer Verminderung der Zwänge von mindestens 35 % definiert. Und wer 35 % nicht schon als Erfolg wertet, der ist noch nicht ausreichend zwangskrank gewesen, um das schätzen zu können. Der technische und wissenschaftliche Stand der THS heute Geht man von der operationstechnischen Erfahrung aus, so sind bis heute mehr als 80.000 THS erfolgt (Quelle: Firma Medtronic ) vornehmlich auf dem Ursprungsgebiet der THS, der Parkinson Erkrankung. Nach eigenen Angaben der Universität Köln gehört diese mit rund 1200 THS Operationen, zu den erfahrensten Kliniken auf diesem Gebiet. Im psychochirurgischen Bereich arbeiten zahlreiche Universitäten weltweit mit diesem Verfahren, jedoch mit kleineren Fallzahlen, die auf rund 200 bis 300 Fälle geschätzt werden. Die Erfolgsquoten dort liegen auch bei 65 bis 75 %. Mittlerweile werden im Forschungsstadium auch Depressionen, Alkoholismus und Drogenabhängigkeit mit ersten Erfolgen behandelt. Erste Studien über Alzheimerbehandlung sind geplant und in Toronto konnten Erfolge bei der Behandlung von Magersucht erzielt werden. Wichtig zu wissen Tiefenhirnstimulation und die klassischen Therapien oder die medikamentöse Behandlung konkurrieren nicht: erst wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind kommt die THS als Option in Frage. Auch nach der Operation ist eine weitere therapeutische Begleitung und sogar zunächst eine Beibehaltung einer eventuellen Medikation wünschenswert, da die OP nicht einfach den «Zwangsschalter» umlegen kann. 20 N e w s l e t t er 01 ·14 Dass ich heute die Entscheidung zur THS sehr positiv beurteile ist klar, dennoch macht es mir immer wieder zu schaffen, wenn ich höre, wie diese Möglichkeit den meisten schwerstkranken Patienten ausgeredet wird. Die meisten «Profis» kennen die Chancen der THS gar nicht und lehnen sie grundlos ab und schlimmer noch: reden es den Patienten ohne Kenntnis der Ergebnisse oder auch trotz gegenteiliger Forschungsergebnisse aus. Die tragische Komponente liegt für mich darin, dass laut einer Studie jeder sechste schwer Zwangskranke sich umbringt (Nuttin 1999) und ich genau diese Erfahrung zwei Mal vor der OP gemacht habe und heute wohl nicht mehr da wäre, wäre keine Besserung erfolgt. Ich möchte dafür werben, dass jeder schwer Zwangserkrankte das Recht haben sollte, neutral informiert zu werden, um selbst die Entscheidung für oder gegen die THS zu treffen zu können. Für weitere Informationen stehe ich jedem Interessierten gerne zur Verfügung und bin unter der Emailadresse «[email protected]» erreichbar. Autor: Herr N. Kontakt: [email protected] http://www.tiefehirnstimulation.jimdo.com/ 21 N e w s l e t t er 01 ·14 Die tiefe Hirnstimulation bei schwerer Zwangsstörung am UniversitätsSpital Zürich Die tiefe Hirnstimulation (THS) ist ein Verfahren zur Neuromodulation durch Einbringen von Elektroden in bestimmte Hirngebiete, die dort gezielt elektrische Impulse abgeben. Die Impulse wirken hemmend oder erregend auf Nervenstrukturen in fehlgeschalteten Nervenschaltkreisen. Die Behandlungsmethode ist prinzipiell reversibel (Elektroden können wieder entfernt werden) und von aussen telemetrisch anpassbar. Sie wird seit den 1990er Jahren erfolgreich bei bestimmten Bewegungsstörungen angewendet. Mittlerweile wurden weltweit beispielsweise mehr als 100 000 Parkinson-Patienten mit dieser Methode operiert. Seit über 10 Jahren wird die THS auch bei psychiatrischen Erkrankungen durchgeführt. In der Schweiz ist diese Behandlungsmethode seit 2010 für die schwere, therapieresistente Zwangsstörung zugelassen. In einem interdisziplinären Team des UniversitätsSpitals Zürich können Patienten mit schwerer therapierefraktärer Zwangsstörung sowie mit therapieresistenter Depression mit der tiefen Hirnstimulation behandelt werden. Für interessierte Patientinnen, Patienten und behandelnde Ärzte und Ärztinnen oder bei Informationswunsch stehen wir gerne zur Verfügung. Kontakt: Dr. med. Heide Baumann-Vogel Klinik für Neurologie UniversitätsSpital Zürich Frauenklinikstrasse 26 8091 Zürich Tel. +41 44 255 18 48 oder +41 44 255 55 11 [email protected] 22 N e w s l e t t er 01 ·14 Anmeldeformular Anmeldeformular Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen ℅ Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie UniversitätsSpital Schweizerische Zürich Gesellschaft für Zwangsstörungen Culmannstrasse 8 ℅ Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 8091 Zürich UniversitätsSpital Zürich Tel. 044 255 98 03 Culmannstrasse 8 Fax 255 98 04 8091044 Zürich Email: [email protected] Tel. 044 255 98 03 Internet: www.zwaenge.ch Fax 044 255 98 04 Email: [email protected] Internet: www.zwaenge.ch Wir freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben, die Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen durch Ihre Mitgliedschaft zu unterstützen. Wir freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben, die Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen durch Ihre Mitgliedschaft zu unterstützen. Ihre Anschrift Name Ihre Anschrift Vorname Name / Nr. Strasse Vorname PLZ/Ort Strasse / Telefon Nr. Vorwahl, PLZ/Ort Vorwahl, Telefax Vorwahl, Telefon Email-Adresse Vorwahl, Telefax Email-Adresse Beitrittserklärung Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Beitrittserklärung Zwangsstörungen (SGZ). Darin enthalten ist das Abonnement für den «Newsletter» der SGZ. Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Zwangsstörungen (SGZ). Darin enthalten ist das Abonnement für den «Newsletter» der SGZ. Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 75.00 pro Kalenderjahr für Private/Betroffene Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 100.00 pro Kalenderjahr für Therapeuten/Experten Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 75.00 pro Kalenderjahr für Private/Betroffene Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 100.00 pro Kalenderjahr für Therapeuten/Experten Datum Unterschrift Datum Unterschrift 23