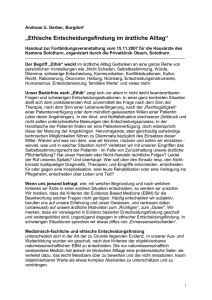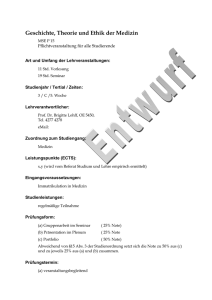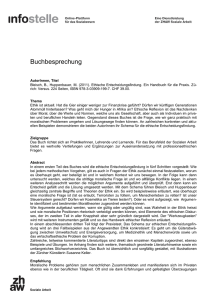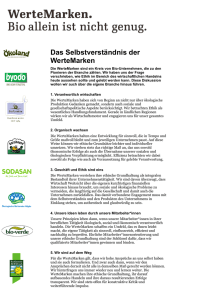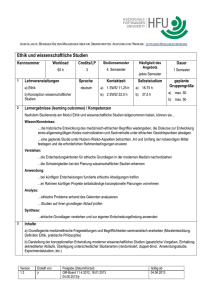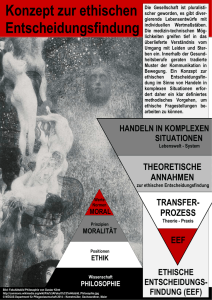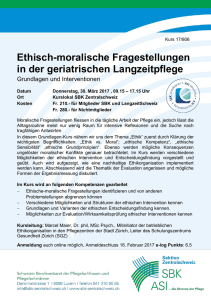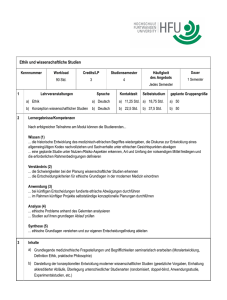Integration des Patienten in die medizinethische Diskussion
Werbung

T H E M E N D E R Z E I T BERICHTE mittlung durchaus auch Nebenwirkungen auftreten können, was im Gespräch mit den anwesenden Patienten deutlich wurde. Dies kann daran liegen, daß trotz medizinisch korrekter Aufklärung die für den Patienten existentielle Dimension der veränderten Beziehung zu seiner Lebenswelt nicht berücksichtigt wird. Die Diagnose stört die Selbstvergessenheit in der Gesundheit, es stellen sich Fragen wie zum Beispiel „wer bin ich (eigentlich)?“, „was soll jetzt werden?“ oder „warum gerade ich?“. Nach der Diagnosevermittlung kommt es oft zu einer Neuorientierung der Lebensperspektiven. Abschließend gab Stella ReiterTheil zu bedenken, daß in der Medizin als empirischer Wissenschaft und deren Anwendung nicht nur Fehler, sondern auch „ethische Irrtümer“ unvermeidlich sind. Es könne daher nicht darum gehen, sich in „ethischem Perfektionismus“ zu versuchen. Anzustreben sei vielmehr eine kontinu- ierliche Reflexion und Offenheit, die es gestattet, Fehler und Irrtümer möglichst früh zu erkennen und Strategien zu entwickeln, mit denen auch im ethischen Bereich die Patientenversorgung in geduldiger Annäherung an das Wünschenswerte optimiert werden kann. Anschrift des Verfassers: Dr. med. Christian Hick, M. A. Ebernburgweg 9–11 50739 Köln Integration des Patienten in die medizinethische Diskussion D er Akzeptanzverfall allgemeingültiger Regeln und die Überforderung der moralischen Intuitionen durch grundsätzlich neue Handlungsmöglichkeiten in der Medizin sind ein Grund dafür, daß der Bedarf an neuen Formen ethischen Argumentierens in den letzten Jahren zunehmend gewachsen ist (4). Als vielversprechender, diskussionswürdiger Ansatz einer zwar begründenden und normativen, doch nicht dogmatischen Ethik kann die sogenannte Diskursethik angesehen werden (2, 3). Dabei geht man davon aus, daß eine Entscheidung oder Bewertung dann moralisch richtig ist, wenn alle von ihr Betroffenen in freiem und echtem Austausch (Diskurs) dieser zustimmen können. Für die Medizinethik ergibt sich aus dieser Konzeption die zwingende Forderung, sowohl den Patienten als auch alle anderen an der Behandlung beteiligten Personenkreise (Pflegepersonal, Angehörige) in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Unter diesem Aspekt wurde das Modell des Patientenforums Medizinische Ethik konzipiert, das sich primär um eine Einbeziehung der Patientenperspektive bemüht (5, 6). Die Beteiligung der Patienten ist jedoch außerhalb solcher Pilotprojekte noch auf Einzelfälle begrenzt. Kommt es dennoch dazu, werden in aller Regel neue Perspektiven sichtbar: So trägt zum Beispiel eine betroffene Mutter bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen ei- ner Psychiatrietagung ihre Einwände gegen ätiopathogenetische Konzepte der Schizophrenie vor, die ihrerseits pathologisierend sind und schädliche Wirkungen auf die ganze Familie des Patienten nach sich ziehen können. Durch diese perspektivische Belebung, durch die Einführung eines authentischen Momentes von der „anderen Seite“ entsteht Spannung. Die Experten reagieren, der Dialog enthält eine neue Dimension. Vor allem aber steigt die Wahrscheinlichkeit, im Diskurs in der Erarbeitung von Normen „mittlerer Reichweite“ Lösungen der konkreten Problemsituationen zu finden, die tatsächlich von allen Beteiligten frei mitgetragen werden können. Fragen einer „Strebensethik“ Gleichzeitig kann im Rahmen dieser primären Einbeziehung der Patientenperspektive in die ethische Güterabwägung und Entscheidungsfindung die Kommunikation über ethische Fragen eingeübt werden, eine Kompetenz, die nach Einschätzung der überwiegenden Mehrzahl (70 Prozent) einer Gruppe von mehr als 400 Ärztinnen und Ärzten im Praktikum in der Praxis benötigt wird, aber nie erlernt werden konnte (7). Neben der Verbesserung der medizinethischen Entscheidungsfindung werden durch die Einbeziehung des Patienten in die Bewertungsdiskurse aber auch Fragen einer „Strebensethik“ wieder in die Medizin eingeführt. Fragen, die sich etwa auf den Sinnzusammenhang von Erkrankung und Leben, die Stellung bestimmter Therapieoptionen zum Lebensentwurf des Patienten oder die Vorstellungen von Lebensqualität und Sterbekultur erstrecken können. Schon die explizite Thematisierung solcher Fragen stärkt im Patienten die Zuversicht, sich in einer verständlichen, deutbaren und beherrschbaren Wirklichkeit zu bewegen. Dieses Gefühl geht nicht nur mit einer subjektiv verbesserten Lebensqualität einher, sondern hat, wie die Salutogenese-Forschung empirisch nachweisen konnte, auch eine bessere Krankheitsresistenz zur Folge (1). Von einer Einführung der Patientenperspektive in die medizinethische Bewertung darf daher nicht zuletzt auch ein besseres Therapieergebnis erhofft werden. Literatur bei den Verfassern Anschrift der Verfasser: Dr. med. Christian Hick, M. A. Philosophisches Seminar Universität Mainz Prof. Dr. med. Wolfgang Hiddemann Abt. Hämatologie und Onkologie Universität Göttingen Dr. rer. soc. Stella Reiter-Theil Dipl.-Psych. Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin Universitätsklinikum Freiburg Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 4, 24. Januar 1997 (31) A-155