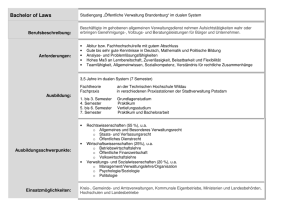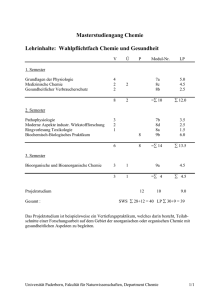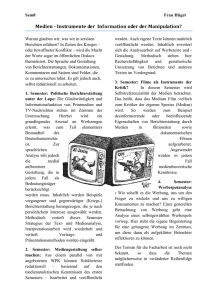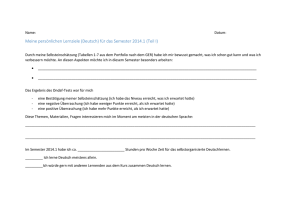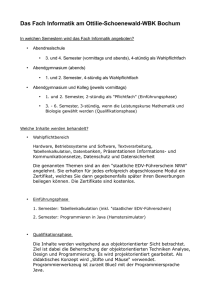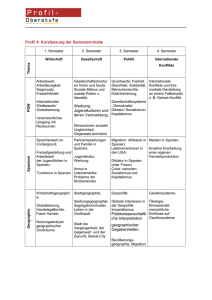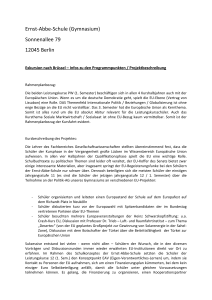Beruf: Physiotherapeut – die richtige Entscheidung
Werbung

Beruf: Physiotherapeut – die richtige Entscheidung Eine Entscheidungshilfe von Kathrin Krämer, Darmstadt Abi, und nun? Studium oder Ausbildung? BWL, Medizin, Pädagogik…? Die Zeitungen sind mal wieder voll mit Entscheidungshilfen für den neuen Lebensabschnitt, der dem Abitur folgt, wie „Unirankings“ , Berufschancen der Fachbereiche, Gehaltsaussichten usw. Ich hatte „damals“ – 2005 – extrem gründlich überlegt, Pro- und Kontratabellen erstellt, Bekannte gefragt, und mich letzten Endes dazu entschieden, „International Business“ zu studieren. Ein Fehler? Vielleicht, denn es war nicht das Richtige für mich und ich habe es wieder abgebrochen. Vielleicht aber auch nicht, denn sonst hätte ich das so nicht rausbekommen. Denn ob man sich bei einem Studium wohl und „am richtigen Ort“ fühlt, das sagen einem die Rankings nicht. Ich wollte mehr mit Menschen arbeiten und ihnen helfen. Als ich meinen Bruder nach einem Sportunfall zur Physiotherapie begleitet hatte, imponierte mir die Arbeit der Physiotherapeutin und ihr Umgang mit den Patienten. Und die Dankbarkeit Letzterer, die sie im Gegenzug für ihre Tätigkeit erhielt, schien mir viel mehr wert als ein erfolgreich abgeschlossener Vertrag mit einem Geschäftspartner. Also bewarb ich mich – sowie ca. 300 Mitbewerber - an der Physiotherapieschule der Orthopädischen Uniklinik Friedrichsheim in Frankfurt am Main. Aus den schriftlichen Bewerbungen wurden 60 in einem Auswahlverfahren herausgesucht, wobei beispielsweise ein absolviertes Pflegepraktikum, Erfahrungen im Umgang mit Menschen/Gruppen und Spaß an Bewegung von Vorteil waren. Außerdem befanden sich unter den 60 Bewerbern, die dann eine Einladung zu einem motorischen und psychologischen Test erhielten, fast ausschließlich Abiturienten, auch wenn dies keine zwingende Voraussetzung für den Beruf ist. Der motorische Test bestand aus kurzen Bewegungsabfolgen oder Bildern, die es nachzumachen bzw. nachzustellen galt, Übungseinschulung an einem Partner und Erfinden von Bewegungen zu Musik. Dazu musste man nicht besonders sportlich sein; es genügte, dass man kein Bewegungslegastheniker war und seiner Kreativität freien Lauf ließ. Im psychologischen Test hingegen war vor allem logisches Denken, Rechnen und Konzentration gefragt. Die meisten Teilnehmer hatten sich an mehreren Schulen beworben, so dass ich mich umso mehr freute, ein paar Wochen nach dem Aufnahmetest eine Zusage erhalten zu haben. Ich war also vom Status her nun wieder „Schülerin“, da es sich um eine schulische Ausbildung handelt. Man bekommt keinen Gehalt, sondern muss sogar 125 Euro Schulgeld pro Monat bezahlen (staatliche PT-Schulen sind kostenfrei, private kosten meistens 300400€/Monat, insofern ist die Stiftung Friedrichsheim ein „Mittelding“). Nebenbei zu arbeiten ist aufgrund des Zeitaufwandes nur eingeschränkt möglich, ein Studententicket zum beispielsweise kostenlos Bahnfahren gibt es nicht, Bücher/Fahrtkosten/Skelettteile etc. müssen selbst finanziert werden. Die Reaktionen meiner Freunde und Bekannten darauf waren skeptisch: „Physiotherapie, also Massage oder wie?“, „So ein bisschen Gymnastik, Bein beugen und strecken?“, „Warum studierst du denn nicht Medizin, da verdienst du später wenigstens mal was!“ Dass Physiotherapie nicht nur aus Massage und gymnastischen Übungen besteht, wurde sehr schnell ersichtlich: Meine 23 Klassenkameraden (darunter 8 Jungs) und ich hatten im ersten Semester 18 Fächer, von Anatomie und Physiologie, über Atemtherapie, Physik, Bewegungslehre bis hin zu Elektro- und Balneotherapie. Erst einmal war das Aneignen von Grundwissen angesagt. Also Muskeln, Bänder, Knochen, Gefäße, Nerven… pauken. Anfangs fiel es schwer, sich die Fachwörter – meist auf Latein – einzuprägen geschweige denn auszusprechen (z.B. Musculus sternocleidomastoideus); wenige Wochen später jedoch bestand das Problem eher darin, einem Laien etwas auf „deutsch“ zu erklären! Neben dem vielen Lernen konnte man aber immer wieder mal entspannen, nämlich wenn man von seinem Übungspartner massiert wurde, einen Kneipp-Guss oder eine Unterwasserdruckstrahlmassage erhielt, in der Fangopackung lag…*g*. Nach 13 zu bestehenden Prüfungen durften wir dann im 2. Semester das Gelernte umsetzten. Leider nur noch zu 21, da ein Mitschüler in 2 Prüfungen durchfiel und deshalb das Semester wiederholen muss, eine Schülerin mehr als 10 Fehltage hatte und einer doch lieber Rettungssanitäter werden wollte. Unsere erste Kontaktaufnahme mit den „echten Patienten“ bestand also aus Gangschulung, Massage, Atemgymnastik, Elektrotherapie, Wärme- und Wasseranwendungen und Unterwassergymnastik. Die therapeutischen Tätigkeiten waren zwar noch nicht so umfangreich oder kompliziert, dennoch konnte man dabei bereits feststellen, dass nicht immer alles so abläuft, wie es im Lehrbuch steht – schließlich arbeitet man ja nicht an Maschinen, sondern mit Menschen, die mal schlecht gelaunt, mal gut drauf und motiviert sind, manchmal Anweisungen nicht verstehen oder ausführen können… Aber eigentlich macht genau das Spaß an dem Beruf. Neben der ca. 2-stündigen Praktikumsphase pro Tag läuft der Unterricht weiter. Ein normaler Schultag geht also durchaus von 7:30Uhr bis 16:00Uhr, was einem aber durch den ständigen Wechsel von Praxis- und Theoriefächern meist nicht so lange vorkommt. Mittlerweile bin ich im 3. Semester. Konnte man es vorher kaum erwarten, endlich richtige Behandlungen (mit Manueller Therapie, PNF, Brunkow, Brügger, Funktioneller Bewegungslehre, Schlingentisch etc.) an den Patienten durchzuführen, macht einem die plötzliche große Verantwortung doch ein mulmiges Gefühl. „Darf ich über 90° flektieren? Was waren noch mal die Kontraindikationen?“ Ich bin als erstes in der Chirurgie eingeteilt. Dort habe ich bereits nach wenigen Tagen aufgegeben zu „planen“, denn der Stationszeitplan, die Verbands- und Wundverhältnisse und der aktuelle Gemütszustand des Patienten bestimmen den Ablauf. Eine Mitschülerin verbrachte sogar 2,5h bei ihrem polytraumatisierten Patienten, da dieser alle 2 Minuten einen Heulkrampf bekam. Jeder PT-Schüler muss in der Chirurgie eine Woche auf der Intensivstation verbringen. Dort ist die Priorität, die Vitalfunktionen der Patienten zu erhalten und Kontrakturprophylaxe durch einfaches „Durchbewegen“ zu betreiben. Ich hatte zuvor noch nie mit Menschen zu tun gehabt, die sich irgendwo zwischen Leben und Tod befanden. Entsprechend geschockt war ich, Letztere so hilflos zwischen einem riesen Kabelsalat daliegend zu sehen - wie sie teilweise ihren Mund auf- und zubewegten, und man aber oft nicht verstand, was sie einem mitteilen wollten. Deshalb habe ich es auf der dieser Station bevorzugt, die Bewusstlosen zu behandeln, so kam man nicht in die Verlegenheit, etwas Aufbauendes à la „das wird schon wieder“ zusagen, wenn man nämlich gar nicht sicher sein kann, ob wirklich „alles wieder gut wird“… . Meinem Schülerinnenstatus bin ich wohl im vollen Ausmaß gerecht geworden, z.B. als ich mit dem Gehwagen einen Infusionsständer umgefahren, die Anamnese bei einer Witwe mit der Frage nach ihrem Familienstand gestartet oder bei einem Patienten den falschen Fuß behandelt habe. Dennoch ist es immer wieder erfreulich zu erfahren, welch hohen Stellenwert die „Götter in weiß“ der Physiotherapie einräumen. So fragte mich letztens der Chefarzt, welche RehaMaßnahmen ich seiner Ehefrau empfehlen würde. Auch die Visite brach ihren Rundgang ab und meinte, ich soll ruhig erstmal fertig behandeln. Als Nächstes komme ich auf eine gynäkologische Station zu den Wöchnerinnen und Brustkrebspatientinnen. Bevor ich die Ausbildung angefangen hatte, war mir gar nicht bewusst, wie viele medizinische Bereiche in der Physiotherapie abgedeckt werden. So ist es dann auch verständlich, dass man nach dem Examen noch viele Fortbildungen machen muss, denn je nach dem auf welchem Gebiet man sich später spezialisiert, gibt es über die Ausbildung hinaus noch Weiteres zu lernen. Außerdem sind – wie auch in der Politik – verschiedene Lehrmeinungen anzutreffen. In der Schule kam es daher auch des Öfteren zu Konflikten zwischen den Lehrern, die wir Schüler dann auszubaden hatten (denn was bei dem einen Lehrer richtig war, war bei dem anderen falsch…). In einem Punkt waren sich zum Glück bislang alle Lehrkräfte einig: Wir sollen nicht nach „Kochrezept“ behandeln. Jeder Patient ist anders und braucht demnach auch eine individuelle Behandlung. Was dem einen hilft, bringt dem nächsten trotz gleicher Problematik vielleicht nichts. Wenn man sich also immer weiter fortbildet, hat man mehr „Zutaten“, die man dem Patienten anbieten kann. Gerade wegen dieser Vielfalt gefällt mir die Ausbildung von Semester zu Semester besser und ich bin froh, mich dafür entschieden zu haben! Kat (21 Jahre, Januar 2007)