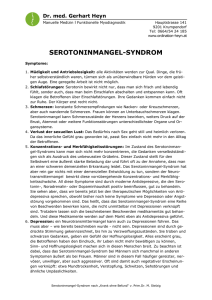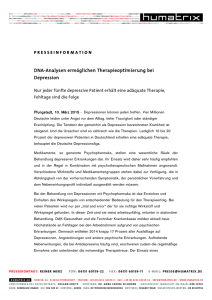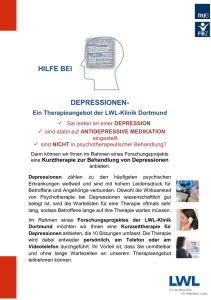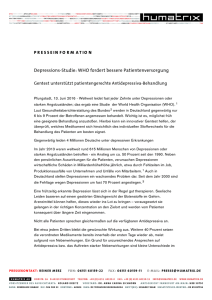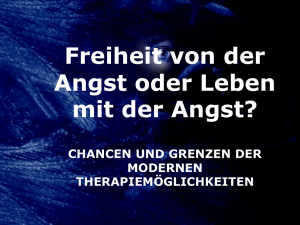15311513344750169b25eec
Werbung
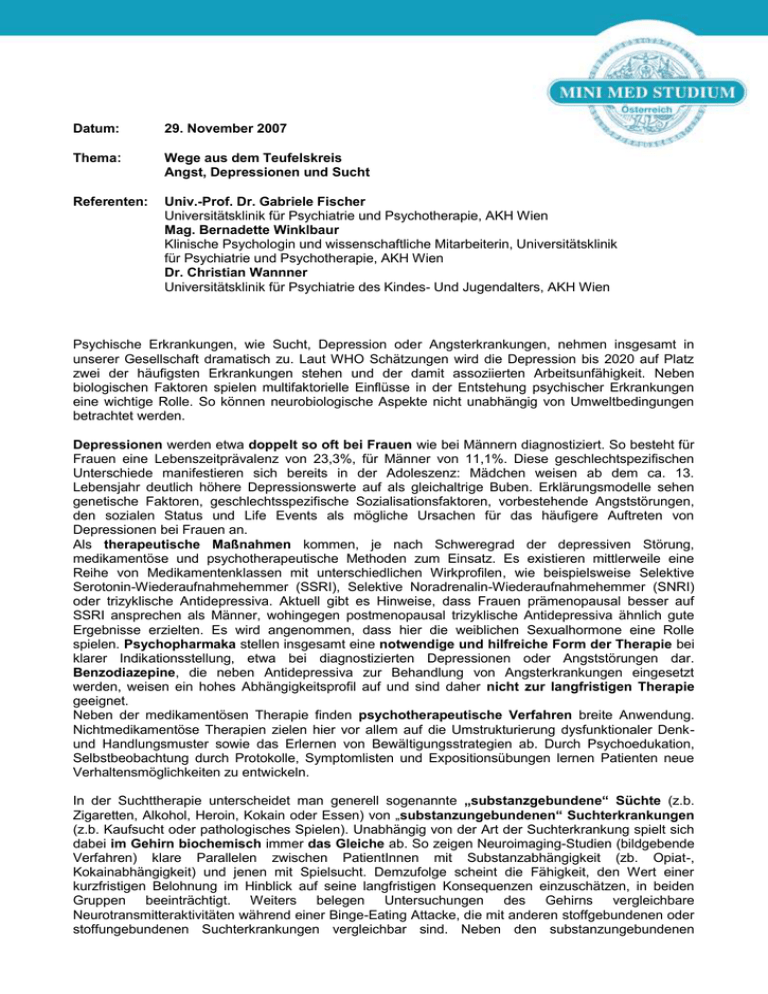
Datum: 29. November 2007 Thema: Wege aus dem Teufelskreis Angst, Depressionen und Sucht Referenten: Univ.-Prof. Dr. Gabriele Fischer Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, AKH Wien Mag. Bernadette Winklbaur Klinische Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, AKH Wien Dr. Christian Wannner Universitätsklinik für Psychiatrie des Kindes- Und Jugendalters, AKH Wien Psychische Erkrankungen, wie Sucht, Depression oder Angsterkrankungen, nehmen insgesamt in unserer Gesellschaft dramatisch zu. Laut WHO Schätzungen wird die Depression bis 2020 auf Platz zwei der häufigsten Erkrankungen stehen und der damit assoziierten Arbeitsunfähigkeit. Neben biologischen Faktoren spielen multifaktorielle Einflüsse in der Entstehung psychischer Erkrankungen eine wichtige Rolle. So können neurobiologische Aspekte nicht unabhängig von Umweltbedingungen betrachtet werden. Depressionen werden etwa doppelt so oft bei Frauen wie bei Männern diagnostiziert. So besteht für Frauen eine Lebenszeitprävalenz von 23,3%, für Männer von 11,1%. Diese geschlechtspezifischen Unterschiede manifestieren sich bereits in der Adoleszenz: Mädchen weisen ab dem ca. 13. Lebensjahr deutlich höhere Depressionswerte auf als gleichaltrige Buben. Erklärungsmodelle sehen genetische Faktoren, geschlechtsspezifische Sozialisationsfaktoren, vorbestehende Angststörungen, den sozialen Status und Life Events als mögliche Ursachen für das häufigere Auftreten von Depressionen bei Frauen an. Als therapeutische Maßnahmen kommen, je nach Schweregrad der depressiven Störung, medikamentöse und psychotherapeutische Methoden zum Einsatz. Es existieren mittlerweile eine Reihe von Medikamentenklassen mit unterschiedlichen Wirkprofilen, wie beispielsweise Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI), Selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) oder trizyklische Antidepressiva. Aktuell gibt es Hinweise, dass Frauen prämenopausal besser auf SSRI ansprechen als Männer, wohingegen postmenopausal trizyklische Antidepressiva ähnlich gute Ergebnisse erzielten. Es wird angenommen, dass hier die weiblichen Sexualhormone eine Rolle spielen. Psychopharmaka stellen insgesamt eine notwendige und hilfreiche Form der Therapie bei klarer Indikationsstellung, etwa bei diagnostizierten Depressionen oder Angststörungen dar. Benzodiazepine, die neben Antidepressiva zur Behandlung von Angsterkrankungen eingesetzt werden, weisen ein hohes Abhängigkeitsprofil auf und sind daher nicht zur langfristigen Therapie geeignet. Neben der medikamentösen Therapie finden psychotherapeutische Verfahren breite Anwendung. Nichtmedikamentöse Therapien zielen hier vor allem auf die Umstrukturierung dysfunktionaler Denkund Handlungsmuster sowie das Erlernen von Bewältigungsstrategien ab. Durch Psychoedukation, Selbstbeobachtung durch Protokolle, Symptomlisten und Expositionsübungen lernen Patienten neue Verhaltensmöglichkeiten zu entwickeln. In der Suchttherapie unterscheidet man generell sogenannte „substanzgebundene“ Süchte (z.b. Zigaretten, Alkohol, Heroin, Kokain oder Essen) von „substanzungebundenen“ Suchterkrankungen (z.b. Kaufsucht oder pathologisches Spielen). Unabhängig von der Art der Suchterkrankung spielt sich dabei im Gehirn biochemisch immer das Gleiche ab. So zeigen Neuroimaging-Studien (bildgebende Verfahren) klare Parallelen zwischen PatientInnen mit Substanzabhängigkeit (zb. Opiat-, Kokainabhängigkeit) und jenen mit Spielsucht. Demzufolge scheint die Fähigkeit, den Wert einer kurzfristigen Belohnung im Hinblick auf seine langfristigen Konsequenzen einzuschätzen, in beiden Gruppen beeinträchtigt. Weiters belegen Untersuchungen des Gehirns vergleichbare Neurotransmitteraktivitäten während einer Binge-Eating Attacke, die mit anderen stoffgebundenen oder stoffungebundenen Suchterkrankungen vergleichbar sind. Neben den substanzungebundenen Süchten, wie Internet oder Spielsucht, wird die Esssucht insofern die Herausforderung der Zukunft sein, als die Prävalenz für Adipositas in Österreich in der Zeit von 1999 bis 2006, von 14% auf 22% gestiegen ist. Darüber hinaus zeigt sich eine hohe Korrelation mit Angststörungen und Depressionen. Als signifikanter Faktor für Alkoholkonsum und Substanzmissbrauch unter Jugendlichen werden neben Adoleszenzkrisen auch Depressionen und Angststörungen angesehen – so kann die Zuwendung zu Drogen im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Krankheit verstanden werden, die bereits in der Pubertät auftritt. Demzufolge muss in der Behandlung natürlich das gesamte Erkrankungsbild berücksichtigt werden. Der Krankheitsverlauf selbst wird umso maligner, je früher die Substanzabhängigkeit auftritt. Breitere Zugänge zur Suchterkrankung und ihrer Behandlung werden auch im Bereich der ADHS (Aufmerksamkeits–Defizit–Hyperaktivitätstörung, „Zappelphilipp“ Syndrom) benötigt. So kann eine frühzeitige Behandlung der ADHS im Jugendhalter, das Risiko einer späteren Suchterkrankung wesentlich reduzieren. Insgesamt sind die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten der Sucht verglichen mit anderen Bereichen der Medizin noch immer limitiert. In der Behandlung der Kokainabhängigkeit existieren neue Behandlungsstrategien, die die Anzahl rückfallsfreier Tage erhöhen und Intensität der Rückfälle vermindern, zB. durch immunologische Interaktionen bei der „Kokainimpfung“. Untersuchungen aus den USA berichteten von sechsmonatigen Abstinenzraten bei Kokainabhängigkeit und auch klinische Studien zur „Nikotinimpfung“ zeigen erste vielversprechende Fortschritte. Kontakt: Suchtforschung und –therapie Medizinische Universität Wien Universitätsklinik für Psychiatrie & Psychotherapie Währinger Gürtel 18-20 1090 Wien www.sucht-addiction.info E-Mail:[email protected] Tel: 0043 01 40400-2117