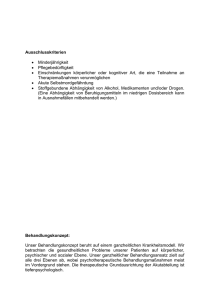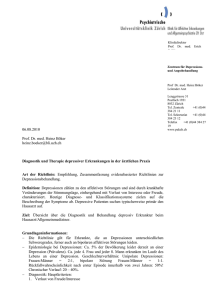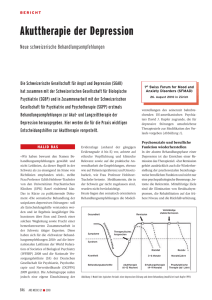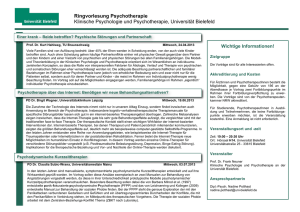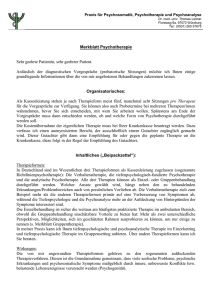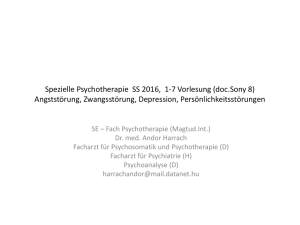DEPRESSION-Leitlinie
Werbung

Leitlinie zur Diagnostik und Therapie depressiver Erkrankungen Zusammengestellt und ergänzt von Dipl.-Psych. Thomas Kind, Psychotherapeut Medizinisches Qualitätsnetz Ärzteinitiative Kinzigtal e.V. "...statt früh, ambulant und kostengünstig werden psychische Störungen spät, stationär und teuer behandelt. (J. Margraf, 2009) Diese Zusammenstellung basiert auf: - de Jong-Meyer, R., Hautzinger, M., Kühner, C., Schramm, E. (2007). Evidenzbasierte Leitlinie zur Psychotherapie Affektiver Störungen der Fachgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie in der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) - Hautzinger, M., Kischkel, E. (1999). Kompetenznetz Depression, Behandlungsmanual - Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie,(2007). Die Therapie der Depression - Margraf,J. (2009). "Kosten und Nutzen der Psychotherapie" - Leitlinie "Affektive Erkrankungen" der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), (2000). - Leitlinie "Psychotherapie der Depression" der Deutschen Gesellschaft für psychotherapeutische Medizin (DGPM), der Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT), dem Deutschen Kollegium Psychosomatische Medizin (DKPM) und Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie (AÄGP), (2002). - Leitlinie des Praxisnetz Nürnberg Nord zur Erkennung und Behandlung der Depression,(2005). In diese Zusammenstellung sind, wenn immer möglich nur Aussagen und Angaben aus Metaanalysen von randomisierten und kontrollierten Studien mit den Evidenzgraden 1a und 1b bzw. mindestens mit den Evidenzgraden 2a und 2b übernommen worden. (Eine Übersicht über die Evidenzkriterien befindet sich in der Anlage 5 im Anhang). Die Zielgruppe für diese Leitlinie sind Allgemein- und Gebietsärzte, Psychiater und Nervenärzte, Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten. Als Vorbemerkung sei darauf hingewiesen, dass eine Leitlinie zur Behandlung von Depressionserkrankungen idealtypisch ist, da in der Praxis psychotherapeutische Behandlungen nach der regionalen Verfügbarkeit und den vorhandenen Ressourcen und nicht nach dem Bedarf durchgeführt werden. Sehr eindrücklich belegt dies die aktuelle GEK-Studie (2008). Auch wenn sich die Inanspruchnahme von Psychotherapie innerhalb von 5 Jahren mehr als verdoppelt hat, liegt dieser Anteil noch knapp unter 1 einem Prozent der Bevölkerung, während die Prävalenzraten von Depressionserkrankungen um ein Vielfaches höher sind. Depressive Störungen haben eine hohe epidemiologische und versorgungspolitische Relevanz erlangt, da sie in der Bevölkerung häufiger auftreten als die so genannten Volkskrankheiten KHK und Diabetes. Die Einstufung der Depressionserkrankungen auf einem Spitzenplatz in den hierarchisierten Morbiditätsgruppen (HMG) innerhalb des neu eingeführten morbiditätsbezogenen Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) macht ebenfalls deren Stellenwert deutlich. Auch haben die psychisch-psychosomatischen Erkrankungen, von denen die affektiven Störungen eine der wichtigsten Gruppen ist, entgegen dem allgemeinen Trend z.B. bei den Fehltagen deutliche Zuwachsraten von bis zu 32,6 % (siehe IKK-Branchenreport 2007). Der Schwerpunkt dieser Leitlinie liegt bei den psychotherapeutischen Aspekten der Behandlung: 1. da es sich bei depressiven Störungen um ein komplexes psychosomatisches Geschehen handelt, ist ein multimodales Vorgehen bei der Behandlung notwendig. Die Ergebnisse der klinischen Forschung belegen dabei eindeutig und unumstößlich, dass bestimmte psychotherapeutische Verfahren bei der Behandlung affektiver Störungen die Methoden der Wahl sind und die zentrale Rolle spielen sollten. Psychotherapie ist ein besonders wirksamer Behandlungsansatz, andere Methoden, einschließlich der Pharmakotherapie sind im Sinne eines multimodalen Vorgehens, Therapie begleitend und unterstützend einzusetzen. 2. Wie Katamnesestudien belegen, sind erfolgreich durchgeführte Psychotherapien bezüglich des Rückfallrisikos der Pharmakotherapie deutlich überlegen. (DeRubies,R., Fachjournal „Nature Reviews Neuroscience“). 3. Sowohl Psychotherapie als auch Pharmakotherapie sind geeignet, depressive Syndrome deutlich zu bessern. Nachgewiesenermaßen hat Psychotherapie dabei den größeren antidepressiven Effekt. Bis vor einiger Zeit ist man davon ausgegangen, dass Medikamente dann umso wirksamer seien, je ausgeprägter die körperlichen Symptome der depressiven Episode sind und umso schwerer die Depression ist. Metaanalysen zeigen auch bei schweren Depressionen ohne psychotische Symptome keinerlei Überlegenheit medikamentöser oder kombinierter Behandlungen gegenüber der Psychotherapie. Inzwischen gilt als erwiesen, dass die kognitive Verhaltenstherapie den Medikamenten bei schweren Depressionen ebenbürtig ist, wenngleich die Wirkung später eintritt als bei den Psychopharmaka (Report für die Nationale Gesundheitsbehörde NHS in Großbritanien). Es hat sich gezeigt, dass die Kombination von Antidepressiva und Psychotherapie, anders als vermutet, keinen eindeutig additiven, die Wirkung beider Behandlungen zusammenführenden Effekt hat. In schweren oder hartnäckigen Fällen depressiver Störungen wurde die Kombinationsbehandlung bisher dennoch zwingend empfohlen. Metaanalysen zeigen jedoch inzwischen eindeutig, dass bei leichten bis mittelschweren Depressionen ein sequenzielles Vorgehen (Beginn mit Psychotherapie und erst bei unzureichender Wirksamkeit nach 6 bis 8 Wochen ergänzende Pharmakotherapie) einer 2 sofortigen kombinierten Behandlung mit Psychotherapie und Medikamenten klar überlegen ist. 4. Die Sinnhaftigkeit der Pharmakotherapie als eigenständige Methode wird nicht nur hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sondern auch deren Kosten mehr und mehr in Frage gestellt. U.a. sind in der Vergangenheit die aus der Angst der Patienten vor Nebenwirkungen und Bewusstseinsveränderung resultierenden Complianceprobleme offenkundig unterschätzt worden, was die Abbrecherquoten in diesbezüglichen Studien gut belegen. Dies entspricht auch der Erfahrung aus dem Praxisalltag, da viele Patienten ihrem Psychotherapeuten gegenüber einräumen, dass sie die von ihrem Hausarzt verordneten Psychopharmaka gar nicht oder nicht entsprechend der Verordnung einnehmen. Des Weiteren hat der teils unkritische Umgang mit Psychopharmaka in der Vergangenheit auch zu einer immensen Steigerungsrate bei den Verordnungen und damit den Kosten geführt. Wobei auch ohne diese Steigerungen der implizit angenommene Kostenvorteil der Pharmakotherapie gegenüber der Psychotherapie nicht nachgewiesen werden kann (u.a. Otto et al (2000), in Margraf(2009) Seite 85). So war auch bei Partnerschaftsproblemen die Paartherapie einer medikamentösen Therapie der Depression bei gleichen Kosten deutlich überlegen (Evidenzgrad 1b, in Hautzinger). Insgesamt konnte Margraf in seiner Metaanalyse feststellen, dass in 95 % der einschlägigen Studien eine bedeutsame Kostenreduktion durch Psychotherapie gefunden wurde. In 76 % der diesbezüglichen Studien war Psychotherapie gegenüber medikamentösen Strategien überlegen bzw. erbrachte einen signifikanten Zusatznutzen. Für spezielle pharmakotherapeutische Aspekte bei der Behandlung affektiver Störungen wird auf die diesbezügliche umfangreiche Leitlinie der Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) verwiesen. In der vorliegenden Leitlinie findet sich lediglich eine knappe Zusammenfassung sowie eine Übersicht über Antidepressiva in Anlage 4. TEIL 1 Zur Epidemiologie der Depressionserkrankungen Epidemiologische Studien machen deutlich, dass Affektive Störungen zu den häufigsten Krankheitsbildern gehören. Aktuell findet dies beispielsweise auch seinen Niederschlag im morbiditätsbezogenen Risikostrukturausgleich. Es ist davon auszugehen, dass ca. 30 % der Patienten in den Allgemeinarztpraxen unter psychischen Erkrankungen leiden, wobei dabei die Depressionen am häufigsten vertreten sind. 3 Die Lebenszeitprävalenz für psychische Erkrankungen in der Bevölkerung liegt bei 49 %. Laut "Grünbuch" der EU-Kommission aus dem Jahre 2005 beträgt die Inzidenzrate für psychische Erkrankungen europaweit (jährlich) 21,5 Mio.. Für Depressionserkrankungen wird für die westliche Welt eine Lebenszeitprävalenz von 10 % in der Bevölkerung angegeben. Nach einer Studie der WHO aus dem Jahre 2006 liegen die Depressionserkrankungen bei den Todesursachen weltweit auf Platz vier nach den KHK. Hochgerechnet werden sie in 20 Jahren auf Rang zwei nach den KHK stehen. Zwei voneinander unabhängige Studien der BEK und der DAK von 2006 und 2007 Zeigen eine Steigerungsrate bei Depressionserkrankungen von jeweils 60 % innerhalb der letzten fünf Jahre. Die Lebenszeitprävalenz für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Depression wird mit 12 Prozent für Männer und 26 Prozent für Frauen angegeben. Es ist von einen Morbiditätsrisiko für Depressionen von insgesamt 17 % auszugehen. Auch die im Gesunden Kinzigtal ausgewerteten Daten aus der Region bestätigen diese Zahlenangaben. Die Bedeutung affektiver Erkrankungen Unbehandelt hat diese Erkrankungsgruppe sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft erhebliche Folgen. Sie beinhalten für den Betroffenen ein großes gesundheitliches Risiko u.a. durch hohe Komorbiditätsraten von 75 bis 90 % und eine daraus resultierende Gefahr der Exazerbation und Chronifizierung komplexer Beschwerdebilder. Auch findet sich bei Depressionserkrankungen ein erhöhtes Risiko für das Auftreten folgender somatischer Erkrankungen: - arteriosklerotische Herzerkrankungen - vaskuläre Läsionen des ZNS - Asthma bronchiale - Heuschnupfen (Allergien) - Ulcus pepticum - Diabetes mellitus - Infektionserkrankungen Bei Depressionserkrankungen kommt es zu einem Verlust von Lebensqualität und sie können zu sozialer Isolation, Arbeitsunfähigkeit, Frühberentung, Hilflosigkeit, Pflegebedürftigkeit und zu einem dramatisch gesteigerten Suizidrisiko führen. Depressionserkrankungen verschlechtern eindeutig den Verlauf und die Prognose organischer Erkrankungen wie KHK und Diabetes mellitus. Außerdem sind sie ein negativer Prädiktor für Behandlungs- und Rehabilitationserfolge bei körperlichen Erkrankungen. Depressionen führen häufig zu somatischen Fehlbehandlungen und diese zu weiteren gesundheitlichen und ökonomischen Schäden. 4 Defizite in der Diagnostik von Depressionserkrankungen Obwohl für diese Erkrankungsgruppe vergleichsweise gute Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten vorhanden sind, werden nur ca. 50 % der Erkrankungen diagnostiziert 25 % behandelt und lediglich 12,5 % ausreichend therapiert. Als Ursachen hierfür werden von Fachleuten genannt: - die Patienten nennen nur ihre somatischen Symptome - sowohl der Patient als auch der Arzt scheuen das Stigma psychiatrischer Diagnosen, - eine streng körperorientierte Ausbildung und Praxisführung der Ärzte - eine somatische Diagnostik ist leichter und objektivierbarer als eine psychopathologische. - die individuelle Erfahrung und die subjektive Beurteilung wird vorhandenen Diagnoseinstrumenten vorgezogen. Die Bedeutung des Hausarztes bei der Behandlung von Depressionen Der Hausarzt ist meist die erste Anlaufstelle für die Patienten. Bei einer angenommenen Lebenszeitprävalenz von Depressionserkrankungen von ca. 10 % in der Bevölkerung und einem Anteil von ca. 30 % dieser Erkrankungen im Patientenklientel einer Hausarztpraxis kommt dem Hausarzt die größte diagnostische Bedeutung zu. Zur Behebung der diagnostischen Defizite wird zu aller erst empfohlen angesichts der Erkrankungsrate stets an die Möglichkeit einer Depression zu denken (siehe Minor Depression). Minor Depression Inzwischen ist es eine akzeptierte Tatsache, dass leichte oder knapp unter der diagnostischen Schwelle liegende Depressionen in der Bevölkerung häufig und insbesondere in den Hausarztpraxen anzutreffen sind. Meist werden diese leichten Störungen nicht erkannt, obgleich das Risiko einer Chronifizierung und Entwicklung einer ernsthaften Depression groß ist. Der Algorithmus für das therapeutische Vorgehen in Anlage 3 zeigt einen Überblick über die möglichen Behandlungswege für Patienten mit Depressionen. Diagnostik in der Hausarztpraxis Folgende Diagnosekriterien bzw. -instrumente sollten zur Anwendung kommen: 1. Der klinische Eindruck zuzüglich Komorbiditäten wie Symptome einer Angst- oder Somatisierungsstörung. 2. Der Patientenfragebogen WHO-Index zum Wohlbefinden als Selbsteinschätzungs5 instrument (siehe Anlage 1) 3. Verdachtsdiagnose einer Depression wenn Hinweise aus dem klinischen Eindruck (Pkt. 1.) und ein Score kleiner 14 aus dem WHO-Fragebogen vorliegen. 4. Der Arztfragebogen nach ICD 10 (siehe Anlage 2) Für eine entsprechende Diagnose müssen bei diesem Instrument zwei Hauptsymptome und zwei andere behandlungsbedürftige Symptome vorliegen. Symptomatik und Diagnostik depressiver Zustände nach ICD-10: Im ICD-10, dem Klassifikationssystem der WHO werden für die Erfassung depressiver Zustände 3 Haupt- und 7 Zusatzsymptome aufgeführt: Hauptsymptome - depressive Herabgestimmtheit ungleich Trauer - Interessenverlust, Freudlosigkeit - Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit Zusatzsymptome - verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit - vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen - Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit - negative und pessimistische Zukunftsperspektiven - Suizidgedanken oder Handlungen - Schlafstörungen - Appetitsstörung Als somatisches Syndrom sind aufgeführt: - Interessenverlust, Verlust der Freude an angenehmen Tätigkeiten - mangelnde emotionale Reagibilität auf sonst freudige Ereignisse - frühmorgendliches Erwachen - morgendliches Stimmungstief - psychische oder körperliche Hemmung oder Agitiertheit - deutlicher Appetitverlust mit Gewichtsverlust - Libidoverlust Als weitere Begleitsymptome können auftreten: - Magendruck, Obstipation, Durchfälle - Gewichtsverlust, Gewichtszunahme - allgemeine körperliche Abgeschlagenheit, Infektanfälligkeit - Kopfschmerz, drückend, dumpf - Druckgefühl in Hals und Brust, Globus hystericus - (funktionelle) Störung, Herz-, Kreislauf, Atmung, gastrointestinal - Schwindelgefühl, Flimmern, Sehstörungen - muskuläre Verspannungen In der Praxis hat sich folgende Abfrageliste bewährt: - Schlafstörung (Ein-, Durchschlafstörung, Schlaffragmentierung) - Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Interessenverlust (evtl. Morgentief) - Innere Unruhe, Anspannung - Gedächtnis- Konzentrationsprobleme 6 - Appetitsprobleme (verringert oder gesteigert, Frustessen) - starke Grübelneigung (Gedankenzirkel, depressiogene Attribuierungsmuster) - Rückzugstendenz, Passivität - Libidoverlust (Appetenzverlust, Potenzstörung, Frigidität) - verstärkte körperliche Beschwerden (WS-, Kopf-, Glieder-, Magenschmerzen) - Suizidgedanken oder Handlungen Beschreibung depressiver Störungen im ICD-10 nach deren Verlauf: von einer depressiven Episode wird gesprochen bei einer Dauer > 2 Wochen - erste Episode, Kodierung F32, Einzelepisode - im Rahmen bipolarer Verlauf, Kodierung F31 - im Rahmen unipolarer Verlauf, Kodierung F33, Rezidivierend Kategorisierung im ICD-10 nach Schweregraden: - leicht: 2 Hauptsymptome + 2 Zusatzsymptome - mittelgradig: 2 Hauptsymptome + 3 bis 4 Zusatzsymptome - schwer: 3 Hauptsymptome + mehr als 4 Zusatzsymptome mit somatischem Syndrom: - Vorhandensein von mindestens 4 somatischen Symptomen schwer mit psychotischem Symptomen: - zusätzlich Wahnideen (Versündigung, Verarmung) und/oder - Halluzinationen (anklagende Stimmen, Verwesungsgeruch) und/oder - depressiver Stupor anhaltende affektive Störungen: Zyklothymia F34.0 anhaltende Stimmungsinstabilität mit zahlreichen Episoden leichter Depression und leicht gehobener Stimmung, die nicht die Schwerekriterien für manische F30 oder depressive F32 Episoden erfüllen Dysthymia F34.1 chronische gewöhnlich mehr als 2 Jahre anhaltende milde depressive Verstimmung, die nie oder nur selten (Double Depression) die Schwerekriterien der depressiven Episoden erfüllt. Mögliche organische, pharmakologische Ursachen einer Depressionserkrankung: Neben den psychosozialen Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, traumatische Lebensereignisse, berufliche oder familiäre Belastungen usw. sind folgende somatische Ursachen zu beachten: - beginnende Demenz (Alzheimer) - Hirntumor - traumatische Hirnschädigung - M. Parkinson - Epilepsie 7 - Lebererkrankungen - hormonelle Störungen (z.B. Schilddrüse) - Klimakterium - Viruserkrankungen - chronische Intoxikation (psychotrope Substanzen, Alkohol etc.) - Medikamente (Beta-Blocker, L-Dopa, Kortikosteroide u.a.) Somatische Basisdiagnostik - allgemeine körperliche und neurologische Untersuchung - Labordiagnostik (Leber, Niere, Schilddrüse, Elektrolyte, Entzündungsparameter) - EKG bei Antidepressiva-Einstellung ggfs. fachneurologische Abklärung Medikamentöse Therapie: Es stehen vier Typen von Medikamenten zur Behandlung zur Verfügung (siehe Tabelle Anlage 4) Sie wirken alle depressionshemmend und stimmungsaufhellend, haben aber unterschiedliche Wirkungen auf die Psychomotorik. a) psychomotorisch aktivierend (MAO-Hemmer) b) psychomotorisch neutral (SSRI, Imipramin, Tricyclische Antidepressiva) c) psychomotorisch eher dämpfend (Amitriptylin, Doxipin, Mirtazapin) Bei der Pharmakotherapie ist dringend auf die Wechselwirkung mit anderen Substanzen zu achten, wie z.B. zwischen SSRI und MAO-Inhibitoren, zwischen SSRI und blutverdünnenden Substanzen, SSRI und Nikotin, SSRI und Gingo-Präparaten usw.. Entscheidend bei der Pharmakotherapie scheint die Schaffung von Compliance zu sein (siehe Margraf). Während viele Patienten pflanzlichen Substanzen und Medikamenten aus der Alternativmedizin sehr unkritisch zugetan sind, zeigen sie eine große Skepsis und Unsicherheit gegenüber Psychopharmaka aus der Schulmedizin. Ein ausführliches Eingehen auf die Ängste bezüglich der Risiken und Nebenwirkungen von Psychopharmaka und eine Information der Patienten ist unerlässlich (z.B. die anfängliche Steigerung von Unruhe und Angst bei der Einnahme von SSRI). Beschreibung der hausärztlichen Basisbehandlung von Depressionen: Voraussetzung ist der Aufbau einer empathischen Beziehung, um den Patienten stützen und entlasten zu können. Es sollten dann die Themen Diagnose, Krankheitsmodell, Symptome, Behandlung, und Prognose erörtert werden. Der Primärarzt führt den Patienten im Sinne von Psychoedukation. Weiterhin entscheidend ist eine Ermutigung des Patienten, sowie eine Bestandsaufnahme möglicher Hilfen. Gemeinsam sollten realistische, erreichbare Ziele definiert werden. Initial wichtig ist dabei stets mögliche suizidale Tendenzen zu beachten. 8 Die Abschätzung von und der Umgang mit Suizidalität: Das Erkennen und die Abschätzung des Suizidrisikos gehört zu den vordringlichsten Aufgaben der Behandlung ist aber auch unabdingbar bei der initialen Diagnostik. Verschiedene Aspekte der Suizidalität können z.B. orientiert an den Fragebögen MADRS (Montgomery Asberg Depression Scale ) abgefragt werden (siehe Anlage 5). - Wird Suizidalität angegeben, die Konkretheit prüfen. - Protektives erfragen. - die Bündnisfähigkeit des Patienten eruieren, - Vereinbarung eines Lebenserhaltungsvertrages, Antisuizidvertrages - ggfs. Einweisung zu einer stationären Behandlung Für die Entlastung, den Beziehungsaufbau und die Schaffung von Hoffnung haben sich in der Psychotherapie folgende sogenannte "beruhigende Versicherungen" bewährt, die dem Patienten initial vermittelt werden: 1. Der Patient ist kein Einzelfall. 2. Die Genese und die aufrechterhaltenden und verstärkenden Mechanismen der Erkrankung sind bekannt. 3. Die Erkrankung ist unangenehm aber nicht gefährlich 4. Hilfen und Behandlungen sind verfügbar und erforderlich 5. Eventuelle Verschlechterungen werden in einer Therapie aufgefangen 6. dem Patienten Erfolge vermitteln 7. gestuftes Vorgehen 8. unkonditionale Verstärkung und Beruhigung 9. an frühere Erfahrungen (mit Depressionen) anknüpfen Typische Fehler im Umgang mit depressiven Patienten: Das zentrale Problem depressiver Erkrankungen ist das Nichterkennen! Weiterhin werden insbesondere in primärärztlichen und somatischen Bereich depressive Symptome oftmals bagatellisiert oder mit gut gemeinten Ratschlägen beantwortet ohne dass die Realisierbarkeit der Ratschläge verfolgt und detailliert geprüft wird. Der besonderen Hilflosigkeit, die der Kontakt mit depressiven Patienten auslösen kann, wird oftmals von Therapeuten und Ärzten mit folgenden problematischen Interaktionen begegnet: - Drängen auf rasche Besserung der depressiven Symptome (Folge: erhöhter Gewissensdruck beim Patienten und möglicherweise Verschweigen von Suizidalität ) - Suggestion positiver Sichtweisen ohne Berücksichtigung der subjektiven Möglichkeiten des Patienten. - Deutung und Spiegelung von Aggressivität (Folge: Mobilisierung von Autoaggresivität und Schuldgefühlen) 9 - Suche nach auslösenden Ereignissen und problematischen biographischen Konstellationen ohne Anpassung an das Befinden und die Möglichkeiten des Patienten. - Nichtverordnung einer antidepressiven oder sedierenden Medikation sofern dies indiziert ist Kriterien für eine Einweisung zu einer stationären Behandlung Im Rahmen der Diagnostik und der Behandlung depressiver Störungen ergibt sich häufig die Notwendigkeit einer stationären Klinikeinweisung. Indikationen hierfür sind sowohl in der Primärversorgung als auch in der Psychotherapie: - Das Vorliegen einer schweren suizidalen Krise - differentialdiagnostische Unklarheiten (somatische oder zusätzliche psychiatrische Erkrankungen) - deutliche Verschlechterung des Befindens bei ambulanter Behandlung - sehr ausgeprägte Schwere der Symptomatik (Antriebshemmung, psychotische Wahrnehmung) - weitgehende Unfähigkeit zur Alltagsbewältigung - plötzlicher Zusammenbruch des sozialen Netzwerkes - auch bei mittelschwerer Ausprägung, wenn im Umfeld besondere belastende Faktoren vorliegen. TEIL 2 Die psychotherapeutische Behandlung affektiver Störungen Auf die Möglichkeiten und Grenzen und den Stellenwert der Pharmakotherapie ist eingangs bereits eingegangen worden. Dass angesichts der wachsenden Bedeutung psychischer Erkrankungen der Primärversorgung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, ist unter Fachleuten angesichts der Datenlage und der Gegebenheiten unumstritten. Allerdings kann Margraf in seiner schon mehrfach zitierten Metaanalyse u.a. belegen, dass mit Abstand die besten Ergebnisse bei der Behandlung von Angst und affektiven Störungen in psychotherapeutischen Settings zu beobachten sind. Die Verbesserung der Primärversorgung zeige zwar immer noch in der Mehrzahl positive Wirkungen, allerdings in einem geringerem Maß (siehe Margraf Seite 93). Daraus kann gefolgert werden, dass dem Hausarzt eine zentrale Rolle bei der Diagnostik, der Unterstützung und der Steuerung des Patienten und der Initiierung einer Behandlung zukommt. (Die Minor Depression sei hier einmal ausgeklammert). Der eigentliche Behandlungsschwerpunkt müsste dann bei psychotherapeutischen Maßnahmen liegen, da allein schon der für derartige Interventionen benötigte Zeitaufwand und deren Spezifität den Rahmen einer hausärztlichen Praxis sprengt. Auf die Problematik der sehr eingeschränkten Ressourcen und der mangelnden Verfügbarkeit von Psychotherapie wurde aber auch bereits hingewiesen. 10 In die gleiche Richtung weisen Anzeichen, dass die bei modernen CasemanagmentKonzepten durch geschulte Helferinnen erzielten positiven Effekte sich auf die Patientenzufriedenheit beziehen, aber nicht als spezifische psychotherapeutische Wirkfaktoren betrachtet werden können, da keine "... nennenswerten zusätzlichen Therapieeffekte..." gefunden werden konnten (Richards et al. 2003 in Margraf Seite 91). Die folgenden Ausführungen zur Psychotherapie werden ebenfalls belegen, dass, anders als vielleicht in einigen Bereichen der somatischen Medizin, in der Psychotherapie nur ehr eingeschränkt einzelne Interventionen an geschultes Heilhilfspersonal delegiert werden können. Gerade bezogen auf die so genannten "symptomorientierten" Therapiemodelle Verhaltenstherapie und kognitive Verhaltenstherapie, wird immer wieder der Eindruck vermittelt, dass therapeutisch Tätige ganz nach ihrer subjektiven Einschätzung einzelne Interventionen losgelöst vom therapeutischen Gesamtkontext in ihrer Behandlung anwenden können. Eine solch eklektizistische Vorgehensweise, die sich bisher häufig in der stationären Behandlung psychischer Erkrankungen zeigt, vermehrt aber auch für den ambulanten Bereich und die Primärversorgung diskutiert wird, ist mit größter Skepsis zu begegnen. Auch wenn scheinbar sehr praktikabel und leicht anwendbar, so handelt es sich um teilweise hochwirksame Interventionen, die eingebettet sind in ein elaboriertes Erklärungsmodell der Genese, Aufrechterhaltung und Verstärkung von Krankheiten und aus diesem heraus als ein Teil eines komplexen aufeinander aufbauenden und sich ergänzenden Behandlungsansatzes entwickelt worden sind und dementsprechend auch nur in diesem Kontext ihre angestrebte und nachgewiesene Wirksamkeit entfalten können. Auch wenn der Psychotherapie als besonders wirksamen Behandlungsansatz bei der Behandlung depressiver Störungen die zentrale Rolle zukommt, ist eine differenzierte Betrachtung nicht nur der Krankheits- und Patienten-, sondern auch der Behandler- und Therapievariablen notwendig. Immer wieder wird auf die scheinbar unspezifische Wirksamkeit der Psychotherapie hingewiesen, indem beispielsweise behauptet wird, dass nicht eine Therapie helfe, sondern der Therapeut. Diese Einschätzung zeugt allenfalls von einem unkritischen, laienhaften und gänzlich unprofessionellen Verständnis von Psychotherapie. Selbstverständlich spielt die Therapeut-Klient-Beziehung als Grundlage bei der Behandlung eine zentrale Rolle, jedoch eben nicht so unspezifisch und subjektiv wie behauptet. Neben bestimmten, beschreibbaren Therapeutenvariablen lassen sich auch bei den verschiedenen Therapiemethoden deutliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nachweisen. Mit seiner umfangreichen Metaanalyse von 54 Studien mit über 13 000 Patienten aus den letzten 10 Jahren hat Margraf diese Unterschiede deutlich belegen können. Die nachfolgend aufgeführten Prinzipien der psychotherapeutischen Behandlung affektiver Erkrankungen machen deutlich, welche Anforderungen an einen Behandler und an eine Methode gestellt werden müssen, um eben nicht nur zufällige, unspezifische 11 Effekte, wie sie auch bei Spontanremissionen oder unter Placebobedingungen auftreten, sondern gezielte, geplante und quantifizierbare Wirkungen zu erzielen. Prinzipien der psychotherapeutischen Behandlung Anforderungen an die vertiefte Psychodiagnostik Eine genaue initiale Diagnostik ist wegen vieler Ursachen, unterschiedlicher, in der Regel komplexer und häufig multimorbider Verlaufsformen von besonderer Bedeutung. Zur Diagnostik gehört die Identifizierung von prädisponierenden, vorausgehenden und aufrechterhaltenden und verstärkenden Krankheitsfaktoren. Eine differentialdiagnostische Aufmerksamkeit ist während des gesamten Therapieprozesses notwendig, da oft im Verlauf weitere Faktoren deutlich werden: - verborgene Suchterkrankungen - andere psychische Störungen - neuauftretende körperliche Erkrankungen Bei älteren Patienten ist z.B. ein besonderes Augenmerk auf die Unterscheidung der Entwicklung einer Demenz oder einer depressiven Pseudodemenz zu legen. Allgemeine klinische Grundsätze Die psychotherapeutische Behandlung von depressiven Erkrankungen kann nur durch fachspezifisch ausgebildete Psychotherapeuten sachgerecht erfolgen. Diese sollten über eine Qualifikation entsprechend der Kriterien zur Erlangung der Approbation als Psychotherapeut (ärztlich oder psychologisch) auf der Basis des Psychotherapeutengesetzes verfügen. Diese beinhaltet u.a.: - ein umfassendes medizinisches Grundlagenwissen und ein weitreichendes und differenziertes psychologisches Fachwissen, - eine fundierte Ausbildung in den als therapeutisch relevant und wirksam anerkannten Therapieschulen und -verfahren, - Nachweis von supervidierten Behandlungen während der Ausbildung, - Durchlaufen von Selbsterfahrungsprozessen, - ein umfassendes Wissen über die ethischen, moralischen und rechtlichen Aspekte psychotherapeutischer Tätigkeit, - ein Bewusstsein der besonderen Verantwortung, die mit einer psychotherapeutischen Tätigkeit verbunden ist, - umfassende Kenntnisse des gesamten Spektrums affektiver Erkrankungen aus klinischer Erfahrung (Psychiatrie). - Psychotherapeuten sollten mögliche schädliche Auswirkung einer Behandlung kennen und bedenken - die Autonomie der Patienten respektieren - ihre Verpflichtung kennen, ggfs. Kollegen anderer Disziplinen hinzuzuziehen - ggfs. medikamentöse oder stationäre Behandlungen erwägen und initiieren. 12 Ethische und rechtliche Aspekte psychotherapeutischer Tätigkeit: Psychotherapeutische Tätigkeit unterliegt der Vertraulichkeit. Dieser Grundsatz wird nicht immer und von allen Beteiligten unhinterfragt respektiert (siehe Diskussion um Berichtspflicht, Erstzugangsrecht, freie Therapeutenwahl etc.), ist aber eine unverzichtbare Voraussetzung, damit Psychotherapie überhaupt möglich ist. Ein Patient muss im Vorfeld darüber informiert werden, wenn die Vertraulichkeit gebrochen werden muss. Dies ist der Fall bei: - Selbstgefährdung - Hinweisen auf Missbrauch oder Vernachlässigung eines Kindes - im Falle einer richterlichen Anordnung - Fremdgefährdung (bei Hinweisen auf Gefährdung anderer Personen durch Gewalt) Patienten müssen auf ihre Verantwortung im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz hingewiesen werden bei: - psychotroper Medikation und - bei emotionalem Ausnahmezustand Die psychotherapeutische Behandlung muss dokumentiert werden um klinische Entscheidungen im Nachhinein rechtfertigen zu können. Informationen über die Behandlung dürfen nur nach schriftlicher Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber spezifischen Personen oder Institutionen weitergegeben werden! Schriftliche Befundberichte sind in einer Weise zu verfassen, dass sie dem Patienten potentiell zugänglich gemacht werden können ohne ihn zu schädigen! Allgemeine Grundsätze der Psychotherapie Die Psychotherapie versteht sich als interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus (möglichst zwischen Klient, Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig gehalten werden. Die Beeinflussung der Störung erfolgt mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal, aber auch in Richtung auf ein definiertes Ziel (Symptombesserung und oder Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens. Psychotherapeutische Verfahren sollen hinsichtlich ihrer Krankheitstheorie und ihrer Behandlungstechniken wissenschaftlich und empirisch geprüft sein. Bei einer fachlich anerkannten professionellen Therapieform handelt es sich um ein eigenständiges und differenziertes Theoriesystem, dass eine spezifische Nosologie und Gesundheitslehre mit einer ätiologisch orientierten Behandlungstheorie verbindet. Eine weitgehende empirische Validierung solcher Hintergrundsannahmen ist anzustreben. Beispiele hierfür sind das behavioristische und das psychoanalytische Modell und die humanistische Psychologie (sensu Margraf). 13 Qualitätssichernde Maßnahmen sowie das Gebot der Wirtschaftlichkeit müssen unter der Wahrung ethischer Grundsätze und Normen zur Anwendung kommen! Bei der Behandlung insbesondere akut depressiver Patienten sind aufgrund klinischer und wissenschaftlicher Erfahrungen unterschiedlichster psychotherapeutischer Richtungen folgende allgemeine Grundsätze zu verwirklichen: 1. Therapeuten sollen problemorientiert, strukturiert, konkret, aktiv und bei klinischer Notwendigkeit auch direktiv sein. 2. Dem Patienten eine ausführliche Erklärung des Krankheitsbildes, der Einflussfaktoren und des Bedingungsgefüges vermitteln. 3. Ableitung des psychotherapeutischen Vorgehens aus dem gegebenen Erklärungsmodell 4. Erarbeitung einer klaren Zielsetzung und Formulierung von Teilzielen 5. Orientierung auf die Alltagsbewältigung und die Lösung aktueller Probleme 6. gestuftes, nicht überforderndes Vorgehen 7. Erarbeitung neuer Handlungsmöglichkeiten(z.T. durch ein vertieftes Problemverständnis) 8. Anleitung zu neuen Erfahrungen außerhalb des Therapierahmens Behandlungsprinzipien in der akuten Phase Einerseits wird eine Depression als häufig wiederkehrende, chronische oder fluktuierende Erkrankung angesehen, andererseits treten Episoden häufig akut mit großer Vehemenz auf. Bei einer Akutbehandlung gelten Grundsätze eines klinischen Umganges wie sie für psychiatrische und hausärztliche Behandlungen maßgeblich sind: - Im Vordergrund steht die Herstellung einer guten und tragfähigen Beziehung, die auf Vertrauen und Zusammenarbeit, sowie auf der klaren Rollendefinition für Therapeut und Klient beruhen. - Dem vordringlichen Ziel der Entlastung des Patienten dient nach einer genauen Erfassung der Symptomatik und der Lebensumstände die angemessene Information über das Krankheitsbild sowie die Strukturierung und die möglichst frühe Festlegung des Behandlungsrahmens. - Zur initialen Therapie gehört die Klärung des sozialen und therapeutischen Netzwerkes des Patienten sowie ggfs. die Einbeziehung mitbehandelnder Therapeuten oder Ärzte und die Klärung der Notwendigkeit der Einbeziehung von Angehörigen. - Wesentlicher Bestandteil der Anfangsphase ist auch die Festlegung möglichst umschriebener Therapieziele, die neben der Reduzierung der symptomatischen Belastung und der Verbesserung der Lebensqualität auch umfassende Veränderungen depressiogener Gedankenschleifen, Attribuierungs- und Beziehungsmuster und biographischer Bewertungen sein können. 14 Die "beruhigenden Versicherungen" für die Entlastung, den Beziehungsaufbau und die Schaffung von Hoffnung sind weiter oben für die Anwendung in der Primärversorgung bereits aufgeführt. Der Umgang mit Suizidalität in der initialen diagnostischen Phase im Rahmen der hausärztlichen Praxis ist ebenfalls weiter oben bereits dargestellt. Für die psychotherapeutische Tätigkeit ist dies zu ergänzen. Bei dem Vorliegen von Suizidgedanken ist deren Akutität und Eingebundenheit in die Persönlichkeit und die Biographie des Patienten genau zu ergründen. Bei psychotherapeutischen Interventionen muss von folgenden Grundüberlegungen ausgegangen werden: - Suizidalität basiert meist auf subjektiven Lebensbilanzen, die korrigierbar sind. - viele Suizidversuche enthalten einen Appell an menschliche Bindungen. - Ein zeitlicher Aufschub, eine Zurückschau auf die aktuelle Lebenssituation muss gemeinsam mit dem Patienten erreicht werden. - Therapeuten müssen stellvertretend für den Patienten Hoffnung darstellen können - jeder Suizidversuch muss ernst genommen werden - in diesem Sinne umfasst die psychotherapeutische Krisenintervention vor allem die Akzeptanz des ausgedrückten Notsignals sowie das Verständnis von dessen Bedeutung und subjektiver Notwendigkeit. - Gescheiterte Bewältigungsversuche sowie das Wiederherstellen wichtiger Beziehungen müssen thematisiert werden. - erst nach Aufbau einer tragfähigen Beziehung (z.B. Lebenserhaltungsvertrag) kann eine Entwicklung alternativer Problemlösungen für die aktuelle Situation und die Zukunft begonnen werden. - Soweit möglich sollten Angehörige in die Behandlungssituation einbezogen werden Andere Behandlungsgrundsätze außerhalb akuter Kriseninterventionen gelten für chronisch suizidale Patienten, deren Befinden meist mit Persönlichkeitsstörungen im Zusammenhang steht. Stationäre Einweisung Die Indikationen für eine stationäre Einweisung sind, da inhaltlich nicht verschieden, ebenfalls weiter oben für die Primärversorgung bereits aufgeführt und bedürfen für die Psychotherapie keiner Ergänzung. Die bipolare affektive Störung Die Psychotherapie ist bei bipolaren affektiven Störungen immer in Ergänzung und begleitend zur phasenprophylaktischen Medikation zu sehen. Die Datenlage zur Relevanz der Psychotherapie bei diesen depressiven, manischen bzw. hypomanischen Erkrankungen ist noch unzureichend. Als bewährte Komponenten einer psychotherapeutischen Zusatzbehandlung haben sich bisher erwiesen: - Psychoedukation bezüglich der Störung - Training der Wahrnehmung von Frühsymptomen und ersten Krankheitsanzeichen 15 - Umstellung und Anpassung des Lebensrhythmus (Schlaf-, Wachrhythmus, Alltagsstruktur) - kognitiv verhaltenstherapeutische Methoden - Einbezug der Lebenspartner und der Familie Minor Depression Wie oben ausgeführt, werden diese leichten, knapp unter der diagnostischen Schwelle liegenden Störungen, obwohl sie weit verbreitet sind, meist nicht erkannt, bilden aber ein hohes Risiko für die Entwicklung einer ausgeprägten Depression und einer Chronifizierung. Spezielle psychotherapeutische Interventionen zumeist aus dem kognitiv-behavioralen Behandlungsspektrum liegen für diese Erkrankungsgruppe vor. Im Rahmen der psychotherapeutischen Akutversorgung können z.B. drei Interventionsbereiche zu einer raschen Stabilisierung der Patienten führen. Nach den vorgeschalteten Phasen der Diagnostik, des Beziehungsaufbaues, der Entlastung der Patienten und der Schaffung von Therapiemotivation: - die meist vorhandene Schlafstörung mittels Schlafrestriktion, Stimuluskontrolle und imaginativen Techniken angehen - das meist grüblerisch eingeengte Denken durch Methoden aus der VT(Gedankenstopp, Grübelstuhl, etc.) beeinflussen. - die Passivität, Lust und Antriebslosigkeit durch eine Reaktivierung des Patienten durch ein Aktivitätsprogramm (siehe Bahavior Activation Therapy, N. Jacobson) behandeln. Letzteres hat sich als der entscheidende Prädiktor für eine rasche Besserung der Gesamtsymptomatik herausgestellt. Die Behandlung depressiver Störungen im höhren Lebensalter In der Vergangenheit sind Patienten die älter als 60 Jahre waren systematisch aus Psycho- oder Pharmakotherapiestudien ausgeschlossen worden. Seit dem Jahr 2000 liegen Wirksamkeitsstudien (Evidenzgrad 3) zur Kognitiven Verhaltenstherapie, zur IPT und zur psychodynamisch orientierten Psychotherapie vor, die zeigen das bei Patienten bis zum Alter von 75 Jahren die Behandlungen mit Erfolg und Akzeptanz anwendbar sind. PSYCHOTHERAPEUTISCHE VERFAHREN Indikationen, Differentialindikationen Eine Kontraindikation für psychotherapeutische Behandlungen besteht, wenn der Patient aufgrund der Schwere seiner Symptomatik durch psychotherapeutische Interventionen überfordert wäre (z.B. Verstärkung von Schuldgefühlen). Dies betrifft vor allem gruppen-, 16 paar- und familientherapeutische Ansätze weil eine Adaptierung des therapeutischen Vorgehens an die Möglichkeiten des Patienten nicht immer möglich ist. Das Vorliegen leichter bzw. beginnender dementieller und anderer hirnorganischer Erkrankungen ist hingegen keine obligatorische Gegenanzeige, schränkt aber die Wirksamkeit der Psychotherapie ein. Bei psychotischen Depressionen hängt die Indikation für eine Psychotherapie oder psychopharmakologische Behandlung stark von den persönlichen Präferenzen sowohl des Patienten als auch der einbezogenen Ärzte und des Psychotherapeuten ab. Bei diesen Krankheitsbildern kann keine sichere Differentialindikation weder zwischen medikamentöser und psychotherapeutischer Behandlung noch zwischen verschiedenen, als wirksam anerkannten Psychotherapie-Ansätzen gestellt werden, da die unzureichende Datenlage keine ausreichend validen Aussagen dazu möglich macht. Im Folgenden sind die wichtigsten Psychotherapiemethoden und deren Inhalte stichwortartig aufgeführt. Verhaltenstherapie (VT) - Psychoedukation - Modifikation von Problemverhaltensweisen - Einüben sozialer Fertigkeiten - Schaffung von Konfliktlösekompetenz - Aufbau angenehmer Aktivitäten, Hedonie - Bearbeitung negativer Denkschemata - Erlernen von Entspannungstechniken Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) - Identifizierung und Modifikation automatischer dysfunktionaler Kognitionen - Bearbeitung depressiogener unrealistischer Bewertungs-, Attribuierungsschemata - Risiko- und Rückfallprophylaxe, Eigentherapie - Erkennen und positive Bewertung von Erfolgserlebnissen Wirksamkeit Verhaltenstherapie und Kognitive Verhaltenstherapie - Wirksamkeit dieser Interventionen ist in vielen Metaanalysen randomisierter und kontrollierter Studien nachgewiesen. (Evidenzgrad 1a) - gleiches gilt für die KVT bei älteren Pat., (Evidenzgrad 1a) - gleiches gilt bei bipolaren affektiven Störungen (Evidenzgrad 1b) - ebenso für die Rückfallprophylaxe (Evidenzgrad 1b) - und für die Prävention (Evidenzgrad 1b) Diese Angaben von Hautzinger werden in der Metaanalyse von Margraf bestätigt. 17 Interpersonelle Psychotherapie (IPT) Konflikte, Defizite in interpersonellen Beziehungen: -Trennung, Trauer -interpersonelle Auseinandersetzungen -soziale Rollenkonflikte und Veränderungen -interpersonelle Defizite Wirksamkeit Interpersonelle Psychotherapie - Nach Hautzinger konnte die IPT in mehreren randomisierten und kontrollierten Studien ihre Wirksamkeit nachweisen (Evidenzgrad 1a). - Bei Katamnesestudien erreichten IPT-Patienten bessere Ergebnisse im Bereich sozialer Kompetenz und die IPT war der KVT bei schwerer Derpessionen überlegen. Dies konnte Margraf in seiner Metaanalyse nicht bestätigen, bei der sich zeigte, dass kognitiv-behaviorale Kurzzeittherapien der IPT überlegen waren. Tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie (TP) - intrapsychischer Konflikt der durch gegenwärtigen Auslöser reaktiviert wurde - Aufdeckung und Bewältigung unbewusster Konflikte durch Bearbeitung Übertragungsund Gegenübertragungsmechanismen Analytisch orientierte Psychotherapie (AP) - korrigierende emotionale Erfahrungen, - intensives und wiederholtes Durcharbeiten problematischer Interaktionsweisen und Selbstwahrnehmungen - bei lang andauernden dysthymen Störungen, subdepressiven Stimmungslagen und erheblichen maladaptiven Interpersonellen Beziehungen über mindestens 2 Jahre empfohlen. Wirksamkeit psychodynamischer Psychotherapieformen (TP und AP) - charakteristisch für diese Verfahren ist ein traditionell weniger strukturiertes und zeitlich weniger festgelegtes Vorgehen, weshalb nur eine geringe Anzahl an Wirksamkeitsstudien existiert. - die Ergebnisse aus diesen wenigen Studien sind schwer zu interpretieren, da all diese Untersuchungen methodisch problematisch sind (quasiexperimentelle bzw. naturalistische Studien) - während bei Kurzzeittherapien positive Effekte angenommen werden können, können für längere Therapiedauern keine positiven Effekte nachgewiesen werden (Margraf S. 112). Gruppentherapie - zu dieser Therapiemethode lässt die Datenlage keinerlei spezifische Aussagen zu Indikation und Wirksamkeit zu - interpretierbare Studien legen nahe, dass die Gruppentherapie, da wo wirksam der Einzeltherapie nicht überlegen ist 18 Paartherapie - ob beeinträchtigte Partnerschaften Ursache oder Folge einer Depression sind, lässt sich meist nicht feststellen, muss im Einzelfall vom Therapeuten entschieden werden - als gesichert gilt, dass Partnerschaftsprobleme ungünstige Einflussfaktoren für den Verlauf einer Depression sind - die Einbeziehung des Partners sollte grundsätzlich ein wichtiger Therapiebestandteil sein - eine randomisierte Studie zeigt, dass behaviorale Paartherapie der medikamentösen Therapie bei gleichen Kosten überlegen war (Evidenzgrad 1b) ______________________________________________________________________ Anlage 1 Patientenfragebogen WHO-Index zum Wohlbefinden Anlage 2 Arztfragebogen nach ICD 10 Anlage 3 Algorithmus für das therapeutische Vorgehen Anlage 4 Übersicht über Antidepressiva Anlage 5 Suizidalitätsfragebogen M A D R S (Montgomery Asberg Depression Scale) Anlage 6 Evidenzgrade 19