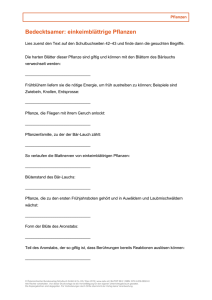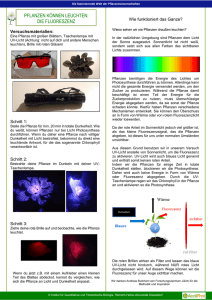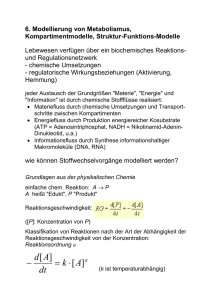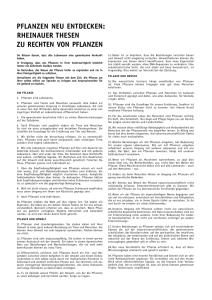Boden
Werbung
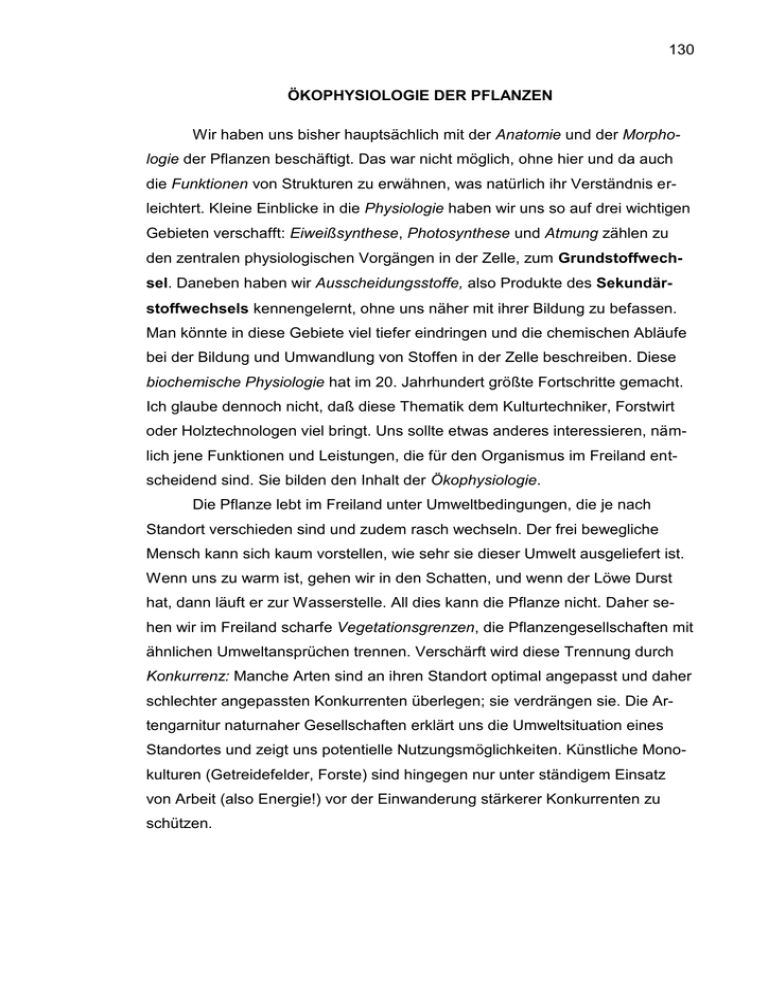
130 ÖKOPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN Wir haben uns bisher hauptsächlich mit der Anatomie und der Morphologie der Pflanzen beschäftigt. Das war nicht möglich, ohne hier und da auch die Funktionen von Strukturen zu erwähnen, was natürlich ihr Verständnis erleichtert. Kleine Einblicke in die Physiologie haben wir uns so auf drei wichtigen Gebieten verschafft: Eiweißsynthese, Photosynthese und Atmung zählen zu den zentralen physiologischen Vorgängen in der Zelle, zum Grundstoffwechsel. Daneben haben wir Ausscheidungsstoffe, also Produkte des Sekundärstoffwechsels kennengelernt, ohne uns näher mit ihrer Bildung zu befassen. Man könnte in diese Gebiete viel tiefer eindringen und die chemischen Abläufe bei der Bildung und Umwandlung von Stoffen in der Zelle beschreiben. Diese biochemische Physiologie hat im 20. Jahrhundert größte Fortschritte gemacht. Ich glaube dennoch nicht, daß diese Thematik dem Kulturtechniker, Forstwirt oder Holztechnologen viel bringt. Uns sollte etwas anderes interessieren, nämlich jene Funktionen und Leistungen, die für den Organismus im Freiland entscheidend sind. Sie bilden den Inhalt der Ökophysiologie. Die Pflanze lebt im Freiland unter Umweltbedingungen, die je nach Standort verschieden sind und zudem rasch wechseln. Der frei bewegliche Mensch kann sich kaum vorstellen, wie sehr sie dieser Umwelt ausgeliefert ist. Wenn uns zu warm ist, gehen wir in den Schatten, und wenn der Löwe Durst hat, dann läuft er zur Wasserstelle. All dies kann die Pflanze nicht. Daher sehen wir im Freiland scharfe Vegetationsgrenzen, die Pflanzengesellschaften mit ähnlichen Umweltansprüchen trennen. Verschärft wird diese Trennung durch Konkurrenz: Manche Arten sind an ihren Standort optimal angepasst und daher schlechter angepassten Konkurrenten überlegen; sie verdrängen sie. Die Artengarnitur naturnaher Gesellschaften erklärt uns die Umweltsituation eines Standortes und zeigt uns potentielle Nutzungsmöglichkeiten. Künstliche Monokulturen (Getreidefelder, Forste) sind hingegen nur unter ständigem Einsatz von Arbeit (also Energie!) vor der Einwanderung stärkerer Konkurrenten zu schützen. 131 Der Wasserhaushalt Wir beginnen mit den Grundzügen des Wasserhaushaltes der Pflanzen. Hier liefern alle Teile des pflanzlichen Organismus bedeutende Beträge; wir sehen also die Integration der Teile zum Gesamtorganismus. Biochemische Lebensvorgänge, also Stoffumsetzungen im Protoplasma, können nur in wäßriger Lösung ablaufen. Entscheidend ist aber nicht die Menge an H2O-Molekülen, sondern der Zustand, in dem sie sich befinden. Wasser ist nicht gleich Wasser. Das zeigen Beispiele: Der Pazifik enthält reichlich Wassermoleküle; das hat aber keinem Schiffbrüchigen je geholfen, der bei Samoa auf einem Floß dahintrieb. Er mußte verdursten, wenn er keine Destillationsanlage zur Reinigung des Wassers von gelösten Stoffen an Bord hatte. Ebenso gehen Kulturpflanzen ein, die man mit Seewasser gießt: Sie verwelken. H2O liegt eben im Meer in einem Zustand vor, der für die meisten höheren Landlebewesen unbrauchbar ist. Die niederen Wasserpflanzen, also die sehr formenreichen Algen, sind an den Zustand des Wassers in ihrem jeweiligen Milieu angepaßt. Sowohl im offenen Meer als auch im Süßwasser schwankt der Wasserzustand sehr wenig. Ganz wenige Arten aus beiden Bereichen können im Mündungsgebiet der Flüsse die periodischen Zustandsänderungen ertragen, die im Brackwasser bei Ebbe und Flut auftreten. Und ein noch viel kleinerer Teil der niederen Pflanzen lebt als Luftalgen an Land. Ebenso wie die Flechten und die immer noch recht einfach gebauten Moose ertragen sie die Änderungen des Wasserzustands Ihrer Umgebung rein passiv. Sie verfallen bei Trockenheit in einen erzwungenen Ruhezustand, eine Trockenstarre. Alle Lebenstätigkeiten werden dann auf ein Minimum herabgesetzt oder ganz eingestellt: Wir haben es mit latentem Leben zu tun. Organismen haben in diesem Zustand einen sehr geringen Wassergehalt. Höhere Pflanzen können nur selten völlig austrocknen und im Zustand des latenten Lebens überdauern („Auferstehungspflanzen“: einige Farne, ganz wenige Blütenpflanzen). Allerdings hat diese Regel eine wichtige Ausnahme: Samen, die Verbreitungseinheiten der Spermatophyten, sind oft sehr austrocknungsfähig und können in Trockenstarre viele Jahrzehnte überdauern. Stoffwechselvorgänge sind während dieser Samenruhe allerdings nur mehr in ganz geringem Maße nachzuweisen. 132 In allen bisher besprochenen Fällen von Austrocknungsfähigkeit, bei niederen Pflanzen, Auferstehungspflanzen und Samen, tritt physiologische Aktivität erst wieder ein, sobald Wasser von günstigem Zustand zur Verfügung steht. Man kann also trockene Moose wohl mit Regenwasser, nicht aber mit Meerwasser zu Photosynthese und Atmung veranlassen. In solchen Fällen möchte ich zwar von Reaktionen auf den Wasserzustand, nicht aber von Wasserhaushalt sprechen. Zum Haushalt gehört eine gewisse Eigenleistung, und die fehlt hier: Diese Pflanzen sind den Änderungen des Wasserzustandes ihrer Umgebung hilflos ausgeliefert. Die Entwicklung des echten Wasserhaushaltes ist die Grundlage des Landlebens der höheren Pflanzen. Er findet sich nur bei Farnpflanzen, Gymnospermen und Angiospermen, also den Kormophyten. Wie bei jeder guten Haushaltsführung mussten drei Teilprozesse optimiert werden: a) Reduktion der Ausgaben, also der Wasserabgabe an die Atmosphäre: Dazu wurden wasserundurchlässige Abschlussschichten entwickelt, die Cuticula und das Periderm. Sie bedecken vor allem oberirdische Pflanzenteile, da selbst feuchte Luft weit trockener ist als der trockenste Boden, in dem noch Pflanzen wachsen können. Jedoch konnten nicht völlig undurchlässige Abschlussschichten eingesetzt werden, da sonst keine Gasaustausch mit der Luft möglich wäre; CO2 für die Photosynthese und O2 für die Atmung sind aber unentbehrlich. Die Lösung war die "Erfindung" der Spaltöffnungen, die mit komplizierten Regelmechanismen optimale Verhältnisse zwischen Wasserabgabe und Gasaufnahme einstellen, und der Lentizellen. b) Steigerung der Einnahmen, also der Aufnahme von Wasser aus dem Boden: Dazu wurden die Wasservorräte des Bodens durch ein weit- und tiefreichendes Wurzelsystem erschlossen. Dies erkauft die Landpflanze mit einem hohen Aufwand an Photosyntheseprodukten, da ja die Wurzeln selbst nichts zur Photosynthese beitragen, aber organisches Material für Wachstum und Energiestoffwechsel benötigen. c) Einsatz des Kapitals dort, wo es dringend benötigt wird. Dazu braucht man ein Fernleitsystem, das die von der Wurzel erschlossenen Wasserreserven rasch zu den transpirierenden oberirdischen Teilen befördert. Dieses Fernleitsystem ist das Xylem. Seine Leitelemente müssen gegen Unterdruck versteift werden, was die hochpolymeren Lignine ermöglichen. 133 Ohne alle diese Maßnahmen sind Gewebe höherer Pflanzen an der Luft nicht lebensfähig. Man kann das leicht zeigen: Ein Zylinder aus Parenchymgewebe, etwa aus dem Fruchtfleisch des Apfels oder aus der Kartoffelknolle, wird von der Basis her mit Wasser versorgt. Dazu dichtet man ihn in ein Potometer ein, eine einfache Apparatur für Wasseraufnahme-Studien. Verhält sich dieser Gewebezylinder wie eine intakte Pflanze? Dann würde die Oberfläche Wasser abgeben, dieses würde von unten nachgesaugt werden und der Meniskus in der Kapillare würde sich verschieben. Schon der erste Beschreiber des kleinen Versuches staunte über das, was tatsächlich passiert. Der obere Teil des Zylinders ist nach 24 Stunden total verschrumpelt und abgestorben; der untere Teil bleibt turgeszent, er taucht ja direkt in Wasser ein. Der Meniskus hat sich kaum verschoben, es wurde also sehr wenig Wasser aus dem Gefäß entnommen. Wir sehen also folgendes: Freigelegte Parenchyme ohne Schutz durch Cuticula oder Periderm geben an die Luft unkontrolliert Wasser ab und vertrocknen nach kurzer Zeit. Die Nachleitung im Parenchymblock ist völlig ungenügend. Die Zellen, die ja nicht austrocknungsresistent sind, sterben ab. Selbst wenn eine unserer drei "Maßnahmen" für guten Wasserhaushalt, nämlich die Wasserversorgung, stimmt, kann das Gewebe doch nicht ohne die beiden anderen, nämlich Transpirationsschutz und effiziente Nachleitung, überleben. Hebt man Gewebeproben jedoch in einer "feuchten Kammer" mit 100% relativer Luftfeuchte auf, dann überdauern sie längere Zeit; die Wasserabgabe und damit die Notwendigkeit der Nachleitung fallen ja jetzt weg. Wie gehen aber Wasseraufnahme und Leitung im Normalfall vor sich? Und wie wird die Abgabe reguliert? Wir müssen das zuerst beantworten, weil wir erst dann den Wasserhaushalt der Zellen und Gewebe wirklich verstehen können. Das Wasser im Körper der Pflanze ist nicht isoliert zu behandeln, wir können es nur als Teil einer kontinuierlichen Wasserkette betrachten, die vom Boden über den Pflanzenkörper bis zur Atmosphäre reicht. Die angelsächsische Literatur spricht von einem "Soil-Plant-Atmosphere Continuum" ("SPAC"), einem Kontinuum aus Boden, Pflanze und Atmosphäre; der Begriff zeigt gut, wie innig Standortsfaktoren und Mikroklima mit dem Wasserhaushalt des Pflanzenkörpers zusammenhängen. Wir wollen daher zunächst dem Weg des Wassers durch das Kontinuum vom Boden in die Atmosphäre folgen; unsere anatomischen Kenntnisse sind dabei ganz besonders wichtig. 134 Das Wasser gelangt durch Niederschläge oder künstliche Bewässerung zunächst in den Boden. Oberirdische Teile der Pflanze spielen nur selten eine Rolle bei der Wasseraufnahme, so besonders bei Epiphyten. Der Boden ist ein sehr kompliziertes Gefüge aus anorganischen und organischen Bestandteilen. Böden entstehen unter Mitwirkung von Lebewesen in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen, sie sind ständigen Veränderungen unterworfen. Im weiteren Studium wird Gelegenheit sein, sich mit diesem komplizierten, aber lohnenden Gebiet zu beschäftigen. Hier interessiert nur der Wasserhaushalt des Bodens. Die Böden enthalten ein System von feineren und gröberen Hohlräumen und Kapillaren, die Luft oder Wasser führen können. Niederschlagswasser, das auf die Bodenoberfläche auftrifft, sickert allmählich durch diese Hohlräume tiefer bis zum Grundwasserspiegel. Die Versickerungsgeschwindigkeit ist abhängig vom Bodentyp: Sie kann in lockeren Böden einige Meter pro Jahr betragen und sinkt in sehr dichten Böden auf wenige Dezimeter pro Jahr. Ein Teil des Wassers wird jedoch in engen Kapillaren zurückgehalten; man bezeichnet diesen Anteil als Haftwasser. Seine Menge hängt von der Verteilung der Porendurchmesser ab. Als Faustregel kann man sagen, daß Poren bis etwa 10 µm (ein Hunderstel Millimeter) Durchmesser das Wasser sehr fest halten, aber schon ungefähr fünfmal weitere es sehr rasch versickern lassen. Je feiner die Kapillare, die mit Haftwasser gefüllt ist, desto schwerer kann sie auch von der Pflanzenwurzel entleert werden. Das Wasser wird aus dem Boden von der Wurzel aufgenommen, und zwar in der Differenzierungszone, 4 bis 10 mm hinter der Wurzelspitze. Hier trägt die noch intakte Rhizodermis lebende Wurzelhaare, die an die Bodenkapillaren heran und teilweise in sie hineinwachsen. Von hier muß nun der Weg des Wassers quer durch den Wurzelkörper gehen, bis das Fernleitsystem des Xylems erreicht wird. Bekanntlich liegt das radiäre Bündel ganz zentral in der Wurzel; das Wasser muß also eine lange Strecke durch Rhizodermis und Rindenparenchym zurücklegen, bis es schließlich über Endodermis und Perizykel die Gefäße erreicht. Für diese Strecke werden drei mögliche Wege des Wassers diskutiert. 1) Im ersten Fall würde das Wasser hauptsächlich durch jene Bereiche der Zelle strömen, die selbst am meisten Wasser enthalten. Das sind zweifellos der 135 Zellsaftraum und das Protoplasma. Der Weg führt dann also vom Boden quer durch die Zellwand und das Protoplasma der Wurzelhaare in deren Vakuole und von dort weg immer wieder durch Protoplasma, Zellwand und Protoplasma in die nächste Vakuole. Gerade die Grenzschichten, Plasmalemma und Tonoplast, stellen aber hohe Transportwiderstände dar, die sich hier natürlich addieren. 2) Daher hat man sich häufig gefragt, ob nicht das Kapillarensystem der Zellwand insgesamt ein günstigerer Transportweg wäre. Hier gibt es nur eine Unterbrechung, die den Wasserstrom zum Umweg durch das Protoplasma zwingt, nämlich den Casparyschen Streifen. Seine Funktion ist bekanntlich die "Passkontrolle" für Ionen, aber natürlich werden auch die H2O-Moleküle abgelenkt. 3) Später wurde bemerkt , daß das Wasser wohl auch innerhalb des dünnen Protoplasmaschlauches strömen und zwischen den Protoplasten durch die Plasmodesmen, also die Plasmabrücken in den Tüpfeln, gehen könnte. Dann fiele der Widerstand der Plasmagrenzschichten weg ("Symplastenweg "). Nun, die drei Wege stehen miteinander in leitender Verbindung und werden wohl alle benützt; noch unklar sind aber die quantitativen Ausmaße. Der Zellwand-Vakuolen-Weg, der alle Kompartimente quert, dürfte wegen seiner hohen Widerstände nur eine geringe Rolle spielen, der Zellwandweg und der Symplastenweg scheinen gleichberechtigt. Etliche Studien zeigen, daß Änderungen der Umweltbedingungen (etwa Sauerstoffmangel oder Wechsel zwischen hoher und geringer Flußgeschwindigkeit) die Anteile dieser beiden Wege verändern. Der Weg durch das Xylem ist uns von der Besprechung des Stammbaues her bekannt. Das Wasser strömt in toten Röhren, den Tracheen und Tracheiden. Wir sehen auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit technischen Rohrleitungen, wie etwa den Erdöl-Pipelines. Es gibt jedoch einen gewaltigen Unterschied: In den Xylemröhren herrscht Unterdruck! Das wieder ist eine Analogie zur technischen Saugpumpe; allerdings beträgt bei Saugpumpen der Unterdruck gegenüber dem Luftdruck maximal eine Atmosphäre (das ist in der SINomenklatur zum Glück ziemlich genau 1 bar oder 10 5 Pascal). Die Saughöhe ist daher mit rund 10 m begrenzt, der Höhe jener Wassersäule, die der äußere Luftdruck tragen kann. Im Xylem herrscht dagegen ein Unterdruck von vielen bar, und die Saughöhe des Wassers vom Boden bis in die Krone der höchsten 136 Bäume kann 100 m und mehr erreichen. Man hat lange nach physikalischen Grundlagen für diese Leistung des Pflanzenkörpers gesucht. Heute weiß man, daß die kapillaren Dimensionen der Leitgefäße, die mit Wasser ohne jede Luftblase gefüllt sind, das Abreißen sehr verzögern. In einer technischen Röhre, die millionenmal mehr Wasser enthält als ein mikroskopisch dünnes Leitelement, treten praktisch immer irgendwo kleine Luftbläschen auf. Wenn das Wasser unter Zug kommt, dehnen sich die Blasen aus und unterbrechen die Flüssigkeitssäule. Im Xylem der Kräuter und im Holz der Bäume liegen viele abgeschlossene Tracheen oder Tracheiden neben- und übereinander, durch deren Wände die Luft nicht treten kann. Selbst wenn also eines oder das andere Leitelement von einer Luftembolie lahmgelegt wird, ist der Transportweg nicht völlig unterbrochen, sondern die Embolie kann umgangen werden. Die Kohäsion reinen Wassers ohne jede Luftblase ist aber so groß, daß die Wassersäule mehrere hundert bar Zugspannung erträgt, also weit mehr, als in den Leitelementen der Pflanze je auftritt. - Das Wasser in den Gefäßen und Tracheen enthält allerdings gelöste Gase und ist daher keineswegs völlig stabil. Es kommt tatsächlich zu Embolien, vor allem bei starker Trockenheit oder bei Eisbildung im Stranggewebe. Dabei reißt die Wassersäule plötzlich ab, und es wird so viel Energie frei, daß messbare Ultraschallwellen abgegeben werden. Es spricht vieles dafür, daß entleerte Gefäße zum Teil wieder gefüllt werden können, doch ist der Mechanismus dieser Reparatur noch ganz ungeklärt. Die Gefahr einer Luftembolie nimmt offenbar mit dem Durchmesser der Leitelemente rasch zu. Sie dürfte die Hauptursache dafür sein, daß bei den ringporigen Laubhölzern (Eiche, Ulme, Esche u.a.) nur die alleräußersten Jahrringe mit Wasser gefüllt sind und leiten. Den Stammbau, die Leitbündelanordnung und das Holz haben wir bereits besprochen. Wir können uns also vorstellen, wie das Wasser vom Wurzelxylem in den Stamm und von dort in die Blattleitbündel, die Nerven, gelangt. Aus den letzten kleinen Nerven geht es schließlich wieder ins Parenchym über. Und dort, also im Blattinneren, endet der Transport in der flüssigen Phase. Das Blattgrundgewebe, das Mesophyll, ist von reich verzweigten Interzellularen durchzogen. Die Wassermoleküle in den Zellwänden des Parenchyms, die an solche Interzellularen grenzen, verdunsten: Sie verlieren den festen Zusammenhang durch die zwischenmolekularen Kräfte der flüssigen Phase und emp- 137 fehlen sich einzeln. Was passiert nun? Wir können uns zwei Möglichkeiten theoretisch vorstellen: a) an die Stelle der Wassermoleküle tritt Luft; b) von innen her rücken weitere Wassermoleküle nach und ersetzen die abdiffundierten Moleküle. Nun, der erste Fall würde rasch zum Austrocknen der Zellwand und dann zum Vertrocknen der Zellen führen. Er tritt nicht ein. Warum? Die Luft kann gar nicht in die kapillaren Hohlräume der Zellwand eindringen, weil das Wasser zu fest darin haftet. Um eine Kapillare von 5 - 10 nm Durchmesser, wie sie in der Zellwand vorkommt, vom Wasser zu entleeren, benötigt man eine Druckdifferenz von mehreren hundert bar; die Außenluft hat nie mehr als 1 bar Druck, das Wasser in den Gefäßen und den Kapillaren steht unter Zugspannung, aber mehr als 150 bar werden selbst auf trockensten Wüstenböden nicht erreicht, wenn dort noch Pflanzen wachsen können. Die Kapillare kann also nicht mit Luft gefüllt werden, da zu viel Energie nötig wäre, um das Wasser zu verdrängen; der Nachtransport ist energetisch billiger. Wir haben eine ganz analoge Situation vor uns, wenn wir ein nasses Stück Löschpapier oder Filterpapier mit dem unteren Ende in Wasser eintauchen lassen. Auch hier wird Wasser nachgesaugt, das Papier bleibt trotz Verdunstung ständig feucht, da die völlige Verdrängung des Wassers aus den engen Kapillaren mehr Energie erfordern würde als die Nachschaffung des Wassers aus dem Wasserreservoir. Das Verhalten lebender Zellen ist zum Verständnis dieser Vorgänge nicht nötig. Die Wasserabgabe der Pflanze an die Atmosphäre nennen wir Transpiration. Sie läuft freiwillig ab, weil Boden und Pflanzen im Durchschnitt weit feuchter sind als die Luft. Man kann dies einfach demonstrieren, indem man misst, welche relative Luftfeuchte sich über Bodenproben und Blättern in einem geschlossenen Raum einstellt. Über feuchten und trockenem Boden sind dies meist Werte zwischen 100% und 98,5%, über den Geweben der darauf wachsenden Pflanzen Werte zwischen 100% und 97,0%. Also ist im Durchschnitt die Luft über den Pflanzenproben nach Einstellung des Gleichgewichtes ein wenig trockener als über dem Boden. Beobachtet man aber die Luft über den Standorten, dann kann man mit einem Hygrometer im Tagesgang zwar kaum je 100%, aber öfter 40 oder 50% messen, an trockenen Tagen auch darunter. 138 Es besteht also im Kontinuum aus Boden, Pflanze und Atmosphäre ein Feuchtegradient, der nur ganz selten (etwa bei dichtem Nebel) aufgehoben wird. Die Interzellularen enthalten stets Luft von fast 100% Feuchte, die Außenluft ist meist weit trockener. Daher diffundiert H2O-Dampf aus dem Blatt in die freie Atmosphäre. Dieser Diffusion stellen sich aber Widerstände in den Weg; je größer diese sind, desto weniger Wasser tritt in der Zeiteinheit aus dem Blatt. Wie bei jeder Diffusion geht ferner der Konzentrationsunterschied zwischen Innenseite und Außenseite in die Gleichung ein. Wir haben damit eine perfekte Analogie zu einem wichtigen Gesetz der Elektrizitätslehre, dem Ohm'schen Gesetz. Dieses lautet bekanntlich U I = ---------R In Worten: Die Stromstärke ist proportional dem Spannungsunterschied zwischen zwei Punkten eines Leiters und umgekehrt proportional dem Widerstand. Für das Problem der Wasserdampfdiffusion aus dem Blatt können wir schreiben: dV p ---- = prop. --------dt R In Worten: Der Wasserdampffluss in g oder cm3 oder Mol H2O pro Sekunde ist proportional dem Dampfdruckgefälle (Δp) zwischen Blattinnerem und Atmosphäre und umgekehrt proportional dem dazwischen geschalteten Widerstand R. Die Kapazität der Atmosphäre für Wasserdampf steigt mit Erhöhung der Temperatur stark an. Der Dampfdruck (in Millibar) bei 100% Luftfeuchtigkeit wird also immer größer. Das Wasser in den lebenden Zellen befindet sich stets in einem solchen Zustand, daß die relative Luftfeuchtigkeit in den Interzellularen nahe an 100% liegt. Da nun aber der Dampfdruck bei 100% Luftfeuchtigkeit ansteigt, wenn die Temperatur steigt, wird auch der absolute Unterschied im 139 Dampfdruck gegenüber trockener Luft von gleichbleibender relativer Luftfeuchte größer. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. t°C rLf(%) p p(mb) (auf 100%) 15 25 100 17,0 0,0 75 12,8 4,2 50 8,5 8,5 100 31,7 0,0 75 23,9 7,8 50 15,85 15,85 Dies zeigt, dass höhere Temperaturen den Wasserhaushalt der Pflanze stärker belasten als niedrige, weil die Triebkraft für die Verdunstung steigt. Dabei muss berücksichtigt werden, daß die Temperatur des Blattes nicht immer gleich der Lufttemperatur sein muss; bei starker Einstrahlung kann sich das Blatt um mehrere Grad über die Umgebung erwärmen. Dann steigt der Dampfdruck im Inneren noch stärker, und das Gefälle gegenüber der kühleren Luft wird noch größer. Ein größeres Dampfdruckgefälle zwischen Blatt und Luft bedeutet stets mehr Transpiration. Sehen wir uns nun den Weg des Wassers aus dem Inneren des Blattes in die freie Atmosphäre an. Prinzipiell gibt es hier zwei Möglichkeiten: a) Das Wasser entweicht direkt aus den wassergefüllten Zellwänden der Epidermis. Dabei muß als Hindernis die wasserabstoßende Auflage der Epidermis, die Cuticula, überwunden werden. Daher heißt diese Komponente der Transpiration die cuticuläre Transpiration. b) Das Wasser entweicht aus den Atemhöhlen durch die Spaltöffnungen in die freie Atmosphäre. Hier liegt stomatäre Transpiration vor. In beiden Fällen stellen sich zwei Fragen: Wie groß ist die transpirierende Fläche und wie groß ist der Widerstand pro Flächeneinheit? Die Fläche, die sich an der cuticulären Transpiration beteiligt, beträgt bei geschlossenen Spaltöffnungen 100% der Blattfläche. Das wäre günstig für eine hohe Wasserabgabe. Zugleich ist aber der cuticuläre Widerstand sehr hoch, so dass die Transpiration im allgemeinen weniger als 3% der Wasserabgabe einer gleich großen 140 Wasserfläche beträgt, jedoch bei hartlaubigen Pflanzen oder Sukkulenten oft auch nur Bruchteile eines Prozents. Die cuticuläre Transpiration ist aber trotz der geringen Werte sehr wichtig: Sie entscheidet darüber, wie rasch die Pflanze bei ungünstigen Bedingungen im Kontinuum, also bei Mangel an Bodenwasser und bei trockener Luft, trotz geschlossener Stomata ihre Wasservorräte erschöpft, wie lange sie also die Trockenperiode überdauern kann. Daraus erklären sich auch Unterschiede in der Cuticuladicke, die auch durch die Umwelt modifiziert wird. Man darf daher Glashaus- oder Mistbeetpflanzen, die an hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt sind, nicht abrupt ins Freiland bringen, man muss sie vielmehr vorsichtig abhärten. Die stomatäre Transpiration benützt die Spaltöffnungen, deren Bau und Funktion wir bereits besprochen haben. Ich erinnere an die beiden Regelkreise: Der erste, der CO2-Regelkreis, spricht auf die Konzentration von Kohlendioxid im Inneren des Blattes an, und damit auch auf die Photosynthese: Erst wenn durch CO2-Verbrauch die Konzentration in den Interzellularen unter etwa 250 ppm sinkt, öffnen sich die Spalten. Der zweite, der H 2O-Regelkreis, sorgt dafür, daß die Spalten bei schlechtem Wasserzustand zugehen. Daneben werden noch andere Effekte diskutiert, wie etwa ein Blaulichteffekt, der die Spalten auch ohne Photosynthese zu öffnen vermag, und ein schließender Effekt niedriger Temperaturen. - Wir haben ferner gesehen, wie diese Einflüsse, die gewissermaßen einen zentralen Schalter umlegen, damit einen einheitlichen "Motor" starten: Es handelt sich um einen Turgormechanismus, den wir im einzelnen noch besser verstehen werden, wenn wir uns mit den osmotischen Erscheinungen beschäftigen werden. Im Prinzip werden jedenfalls Volumsänderungen der Schließzellen in Formänderungen umgesetzt, die die Spalte zwischen dem Schließzellenpaar vergrößern und verkleinern. Und zwar wird, was zunächst etwas paradox anmutet, eine Vergrößerung der Zellen in eine Erweiterung der Spalte umgesetzt. Wie groß kann nun die Querschnittsfläche aller Spaltöffnungen zusammen werden ? Nun, sie bleibt in allen Fällen sehr gering, meist unter 2 Prozent der Blattfläche. Wir würden daher logischerweise annehmen, daß auch die Gesamttranspiration durch diese Spaltöffnungen nicht mehr als höchstens 2% einer Wasserfläche von der Größe der Blattfläche betragen kann. Diese logische Annahme erweist sich verblüffender Weise als grundfalsch: Durch ihr winziges 141 Porenareal können die Blätter bis zu 70% der Wassermenge abgeben, die eine gleich große freie Wasserfläche an die Umgebungsluft verliert! Der Grund dafür liegt nicht in irgendwelchen geheimnisvollen Kräften der Pflanze, er ist rein physikalisch: In Modellversuchen hat man festgestellt, daß viele kleine voneinander entfernte Poren bei gleicher Gesamtfläche weit mehr Wasser durchtreten lassen als eine geschlossene Fläche. Treten Wassermoleküle aus einer isolierten Spalte oder Pore, so haben sie eine Halbkugel über der Pore für ihre Diffusion zur Verfügung. Denen, die aus einem gleich großen Areal der freien Wasserfläche austreten, tut sich nur eine Röhre senkrecht über der Oberfläche auf. In der Querrichtung fehlen ja Konzentrationsunterschiede, da hier in gleicher Dichte Wassermoleküle herumschwirren, die aus anderen Teilen der Oberfläche kommen. Man glaubt, daß dieser Effekt die Evolution des Blattbaues beeinflußte: Die Spaltöffnungen liegen mindestens um den zehnfachen Durchmesser der ganz geöffneten Spalten voneinander entfernt. Daher überlappen sich ihre Dampfhauben nicht. Für die CO2-Aufnahme (die ja durch die Stomaregulation optimiert wird) gilt spiegelbildlich das Gleiche: Durch eine isolierte Spaltöffnung treten mehr CO2-Moleküle ins Blatt als durch eine, die in einer Gruppe liegt. Wir sind also jetzt dem Wasser vom Boden durch den Pflanzenkörper bis in die Atmosphäre gefolgt und sehen, daß der Transport völlig freiwillig erfolgt, ohne dass dafür Stoffwechselenergie aufgewendet werden müßte. Woher stammt aber dann die nötige Energie für diesen Transport? Die Antwort ist einfach: aus dem Wasser! Wasserdampf in der trockenen Atmosphäre enthält weit weniger Energie als das Bodenwasser, und energiereicheres Wasser strömt von selbst zu energieärmeren Stellen. Unterwegs verbraucht es einen Teil des Energieüberschusses zur Überwindung von Widerständen. Sonnenstrahlung hält die Energiedifferenzen aufrecht, indem sie ein Dampfdruckgleichgewicht in der Atmosphäre verhindert. Für eine weitere sinnvolle Diskussion benötigen wir zunächst ein Maß für den Energieinhalt des Wassers. Im internationalen Einheitensystem SI ist die Einheit der Energie das Joule (J). Zweckmäßigerweise bezieht man den Energiegehalt des Wassers auf die Volumseinheit und bekommt damit J*m-3 als Dimension für den Energiegehalt des Wassers. Energie (= Arbeit) ist aber auch als "Kraft mal Weg" definiert. Einheit der Kraft ist das Newton. 1 Joule ist 1 Newtonmeter (Nm). "Joule pro Kubikmeter" 142 ergeben durch Kürzung "Newton pro Quadratmeter". Aus Energie pro Volumen wird also Kraft pro Fläche, die Dimension des Druckes. Nun wirkt dieser Energiegehalt des Wassers, das Wasserpotential, tatsächlich sehr oft als Druck: Änderungen der Spannung in der Xylemlösung oder des Turgordrucks der Zelle sind Energieänderungen, die man direkt als Druckänderungen misst. Man gibt daher den Energiegehalt des Wassers allgemein in Druckeinheiten an, also in bar oder MPa. Höherer Druck bedeutet dabei mehr Energieinhalt des Wassers. Der absolute Energieinhalt einer Substanz ist jedoch nicht messbar, das sind nur Unterschiede gegenüber einem Vergleichszustand. Für Flüssigkeiten und Lösungen ist der Vergleichszustand stets der der reinen Flüssigkeit bei 20 °C und Atmosphärendruck. Und diese Normung bedeutet, daß wir das Wasserpotential t von reinem, destilliertem Wasser bei 20 °C und Atmosphärendruck mit 0 bar festsetzen. Änderungen des Wasserzustandes im Kontinuum können zu positiven oder negativen Werten führen: t wird positiver, wenn Druck und Temperatur steigen; es wird negativer, wenn die Temperatur fällt, wenn das Wasser unter Zugspannung gerät, wenn es in engen Kapillaren adsorbiert wird oder wenn darin Fremdsubstanzen, wie Salzionen oder Zuckermoleküle, aufgelöst werden. Man kann das Wasserpotential der Pflanzen messen. Die nötigen Geräte kann man auch im Freiland einsetzen (was nicht für alle physiologische Verfahren gilt!). Wenn man also einen Tag unter einem Baum sitzt und immer wieder das t seiner Blätter mißt, gibt das bei Schönwetter eine charakteristische Kurve: Das Potential ist stets negativ; während es aber am frühen Morgen, vor Sonnenaufgang, oft nur wenig unter 0 bar liegt, erreicht es zu Mittag oder am frühen Nachmittag sehr negative Werte. Das Wasser wird also immer energieärmer, sein Zustand verschlechtert sich. Unterschiede von 10 oder 15 bar im Tagesgang sind keine Seltenheit! Nachmittags und in der Nacht steigen die Werte dann wieder an. Wir fragen jetzt, wieso es standörtliche Unterschiede gibt und wie die Tagesgangskurve entsteht. Da brauchen wir ein wenig Theorie. Wir können t an einem bestimmten Punkt im Pflanzenkörper, also etwa in einem Blatt, als Ergebnis mehrerer Faktoren im Kontinuum aus Boden, Pflanze und Atmosphäre auffassen. Sie liefern eine einfache Gleichung für die Ansprüche des Kontinuums: 143 (-)t = (-)B + (-)G + (-)R Auf der linken Seite steht das Gesamtwasserpotential, rechts die Teilpotentiale. Alle sind üblicherweise gleich 0 oder negativ, keines positiv. Das deuten die Vorzeichen in Klammer an. Das erste der drei Glieder beschreibt den Wasserzustand des Bodens. Er ist Grundwert für das, was sich auf dem weiteren Weg durch das Kontinuum abspielt. Ist der Boden wassergesättigt, so nähert sich sein Wasserpotential 0 bar. Nach einiger Zeit ohne Niederschläge sind aber größere Kapillaren leer, und die kleinen Kapillaren halten das Wasser umso fester, je enger sie sind. Auf tiefgründigen, landwirtschaftlich genutzten Böden wird das Wasserpotential in unserem Klima selten mehr als 5 oder 6 bar unter 0 liegen. Schon ab -1 bis 2 bar sinkt die Produktion. Hingegen haben wir auf den flachgründigen, mit Buschwald bestockten Steilhängen des Leopoldsberges Werte von bis zu -35 bar gemessen, und zwar in Trockenperioden. Die zweite Größe rechts ist das Gravitationspotential G. Das hat lange Zeit die Baumphysiologen sehr fasziniert. Die Wirkung der Schwerkraft war nämlich schon lange bekannt, bevor man t überhaupt messen konnte. Seit Jahrhunderten ist bekannt, daß eine Wassersäule durch Saugung nur so hoch gehoben wird, wie der Luftdruck ihr Gewicht kompensieren kann. Das sind rund 10 m, und der Druckunterschied beträgt fast genau ein bar: Auf die Basis der Säule wirkt der Luftdruck, über dem oberen Ende bildet sich ein Vakuum. Es ist nun ganz klar, daß kapillare Säulen von größerer Höhe, die durch Saugung gehalten werden können, durch ihr Gewicht innere Spannungen zeigen müssen: Wenn 1 bar Differenz 10 m ausmacht, sinkt also das Potential pro 10 m um 1 bar ab. Man bezeichnet diese Größe als Gravitationspotential, da sie durch die Wirkung der Schwerkraft auf die Wassersäule zustandekommt. Es entstehen auf diese Weise also bei den höchsten Bäumen (Mammutbäumen und Eukalypten von rund 100 m Höhe) Werte von -10 bar für die Teilkomponente G. Das ist nicht sehr viel, wenn wir uns erinnern, daß Potentialminima schon in ganz niederen Büschen unter -30 bar fallen können. Aber eines zeichnet G doch aus: Es wirkt ständig, es gibt keine Erholung. Das kann 144 physiologische Prozesse belasten, die durch niedrige Wasserpotentiale gehemmt werden, so dass sie in hohen Baumkronen ausfallen. Weit größere Werte zeigt freilich das Reibungspotential R. Das Wasser wird durch enge Kapillaren gesaugt, und zwar schon im Boden, wenn es zu den Wurzelhaaren strömt, dann aber auch beim Transport durch den Pflanzenkörper. Die Überwindung der Reibungswiderstände benötigt Energie aus dem Energieinhalt des transportierten Wassers. Je rascher sich das Wasser bewegt, desto mehr Reibung entsteht. Das Potential des Wassers sinkt also stärker ab, wenn es schnell transportiert wird. Wovon hängen nun diese reibungsbedingten Potentialverluste ab? Von der Menge an bewegtem Wasser und von der Größe der Widerstände, auf die das Wasser beim Transport trifft. Beides schwankt an verschiedenen Stellen im Pflanzenkörper beträchtlich. Wir können das wieder als Formel ausdrücken: Messpunkt R = - fi . ri Boden Die Wassermenge, die pro Zeiteinheit durch einen Abschnitt des Leitweges transportiert wird, der Teilfluß fi, hängt von der Aufzweigung des Leitweges ab: Durch eine dünne Seitenwurzel wird natürlich pro Zeiteinheit weniger Wasser befördert als durch einen Abschnitt der Hauptwurzel oder des Stammes. Beim Übergang vom Hauptstamm in die Äste verringert sich dann wieder die Stromstärke. Das größere Problem bilden aber die Teilwiderstände ri in diesem Leitweg. Wo sitzen sie? Sie sind bereits im Boden sehr variabel und hängen vom Bodentyp und vom Wassergehalt des Bodens ab. Wenn das Wasser in einem feuchten Boden durch ganz gefüllte, weite Hohlräume zur saugenden Wurzel strömt, dann erfährt es dabei weniger Widerstand, als wenn es im ausgetrockneten Boden nur mehr die engsten Kapillaren erfüllt und durch diese strömen muss. Im Pflanzenkörper hängen die Widerstände vom Querschnitt der Leitstrecken und ihrer Länge ab. Eine dünne Wurzel mit wenigen Xylemelementen wird daher einen höheren Widerstand haben als eine dicke Hauptwurzel. Dazu 145 kommt aber, daß die Widerstände auch in der Längsrichtung des Weges nicht gleichmäßig verteilt sind. Auf lange Strecken werden große Wassermassen mit geringem Widerstand geleitet, etwa im Hauptstamm. Dann wieder muss das Wasser dünne Leiter aus englumigen Elementen benützen, wo es sehr viel Energie verliert; das ist etwa am Übergang von den Ästen zu den Blättern der Fall. Durch die einzelnen Äste eines Baumes und die dort sitzenden Blätter werden sehr unterschiedliche Wassermengen transportiert. Im Tagesgang steigt der Wasserfluss vom Morgen zum Mittag hin an und sinkt dann wieder. Doch auch im selben Augenblick strömt verschieden viel Wasser durch gleich dicke Äste, etwa wenn sich Teile der Krone in der Sonne und andere im Schatten befinden. Daher können in einer Pflanze sehr verschiedene Werte für t gemessen werden, je nach dem Zeitpunkt der Untersuchung und der untersuchten Stelle. Man findet oft gleichzeitig Stellen mit gutem und mit schlechtem Wasserzustand, also mit höherem und mit niedrigerem Gesamtwasserpotential, nebeneinander. Unterschiede zwischen verschiedenen Pflanzenteilen zur selben Zeit sind größtenteils Unterschiede im Reibungspotential R; das Bodenwasserpotential B wirkt ja auf alle Teile der Pflanze gleich, und Unterschiede im Gravitationspotential G werden erst bei vielen Metern Höhendifferenz deutlich sichtbar. Wir wissen jetzt, warum sich im Körper der Pflanze die Energie des Wassers, also das Wasserpotential, ändern muß: Der schwankende Bodenwasserzustand, die Gravitation und die Reibung des strömenden Wassers in den Kapillaren erzwingen Wasserpotential-Änderungen. Es fehlen aber noch Angaben, wie der Pflanzenkörper reagiert. Das Wasser in seinen Kompartimenten muss auf den Energiezustand eingestellt werden, der vom Kontinuum vorgegeben wird. Aber wie? Temperatur, Druck, Kapillarität, Adsorption und gelöste Stoffe verändern, wie erwähnt, das Wasserpotential. Temperaturänderungen im Körper der Pflanze sind unwichtig, da ihre Effekte proportional zur Änderung der absoluten Temperatur wirken, also klein bleiben. Sie sind auch nicht gezielt einsetzbar, sondern die Pflanze befindet sich meist auf der Temperatur ihrer Umgebung, sie bildet mit dieser ein isothermes System. Hingegen unterscheiden sich der Druck, unter dem das Wasser steht, und die Menge der darin gelösten Stoffe von Punkt zu Punkt beträchtlich. Dazu kommen noch spezielle Kapillar- und 146 Adsorptionswirkungen in den Hohlräumen des Pflanzenkörpers, die sich auch wieder als Drücke und osmotische Effekte zeigen. Alle diese Faktoren, die das Wasserpotential im Körper der Pflanze auf den vom Kontinuum für einen bestimmten Punkt vorgegebenen Wert einstellen, ergeben wieder eine einfache Gleichung: (-) t = (-) o + (+) p Hierin bedeutet das Subskript o osmotische und das Subskript p Druckeinflüsse. Mit anderen Worten: Die freie Energie des Wassers kann an jedem Punkt des Pflanzenkörpers auf den vorgegebenen Wert herabgesetzt werden, indem osmotisch wirksame Substanzen darin gelöst werden, oder indem es irgendwie in einen Zustand des negativen Druckes oder der Spannung versetzt wird. Tritt hingegen ein Überdruck auf, so erhöht er das Wasserpotential. Was tatsächlich passiert, hängt ganz vom mikroskopischen Bereich der Pflanze ab, den wir gerade untersuchen. Es gibt ja auf engstem Raum sehr unterschiedliche wasserführende Kompartimente. Nehmen wir nur die wichtigsten: Lumen der Xylemelemente, Wände von Parenchymzellen, Protoplasma, Vakuole. Zahlenmäßig sind die beiden Komponenten auf der rechten Seite unserer Gleichung in jedem dieser Kompartimente verschieden. Betrachten wir zunächst die Xylemelemente: Die Nährstofflösung, die in ihnen transportiert wird, ist sehr verdünnt, ihr osmotisches Potential kann daher in erster Näherung vernachlässigt werden. Auch Adsorption und Kapillarität spielen in den relativ weiten Röhren keine Rolle. Es kann also nur mehr eine Druckänderung das vorgegebene Gesamtwasserpotential einstellen, und da dieses negativ ist, muß auch der Druck in den Xylemelementen mehr oder weniger negativ sein. Wir können daher schreiben: (-) t Xylem = (-) p Xylem Die negativen Drücke, die Spannungen in der Wassersäule, stellen also das gesamte negative Gesamtwasserpotential ein, das dem Xylem vom Kontinuum aufgezwungen wird. Diese Spannung im Xylem läßt sich mit geeigneten Apparaturen direkt messen. 147 Sobald das Wasser die Gefäße und Tracheiden verläßt, gelangt es in die Mikrokapillaren der Zellwände und von dort in das Protoplasma. In diesen beiden Kompartimenten kann man keine Messungen durchführen, und wir lassen sie daher für den Moment unbeachtet. Messbar wird erst wieder das Wasserpotential der Vakuolenflüssigkeit: (-) t Vakuole = (-) o Vakuole + (±) p Vakuole Das Gesamtwasserpotential der Vakuole setzt sich also aus dem osmotischen Potential der großen, messbaren Vakuole und einer Druckkomponente zusammen, die man hier meist Turgordruck nennt und die entweder positiv oder gleich 0 ist. Der Turgordruck entsteht dadurch, daß der Protoplast durch Wasseraufnahme sein Volumen vergrößert, bis der Gegendruck der Zellwand eine weitere Wasseraufnahme verhindert. Wie kommt es dazu? Die Vakuole enthält stets Substanzen, die nur sehr langsam permeieren, wie etwa Zucker, Farbstoffe und Mineralsalze. Wir machen nun ein Experiment: Wir isolieren eine solche Zelle aus dem Gewebe und bringen sie in reines destilliertes Wasser bei 20 °C und Atmosphärendruck, also in Wasser mit einem Wasserpotential von 0 bar. Was wird passieren? Die Außenlösung enthält in der Volumseinheit mehr Wassermoleküle als der Zellsaft; in diesem sind ja die Wassermoleküle durch die gelösten Moleküle verdünnt. Wie wir schon gesehen haben, dringen Stoffe, die außen in höherer Konzentration als innen vorliegen, durch Permeation in die Zelle ein. Daher wird Wasser, das ja leicht permeiert, in die Vakuole strömen. Wir können auch sagen: Das Wasser folgt dem Potentialgefälle; das Potential der Vakuole ist ja durch die osmotisch wirksamen Substanzen vermindert und daher negativ. Der Einstrom des Wassers vergrößert das Volumen des Protoplasten, presst das Protoplasma an die Wand und übt einen nach außen gerichteten Druck aus. Diesen Druck nennen wir bekanntlich Turgor. Die Zellwand dehnt sich elastisch, bis ihr Gegendruck eine weitere Ausdehnung verhindert. Der Druck erhöht das Gesamtwasserpotential des Protoplasten, so dass dort schließlich bei prall gespannter Wand trotz der gelösten Stoffe das Potential reinen destillierten Wassers, nämlich 0 bar, herrscht. Damit endet der Wassereinstrom. Genauer müssen wir sagen, dass dann pro Zeiteinheit gleich viele Moleküle durch das Plam- 148 alemma austreten und eintreten. In diesem dynamischen Gleichgewicht ist die Diffusion der Moleküle in beide Richtungen quantitativ gleich: Der erhöhte Druck im Zellinneren presst das Wasser gegen das Konzentrationsgefälle aus. Das ist also die Situation, wenn der Protoplast mit Wasser im Gleichgewicht steht, das ein Potential von 0 bar hat. Das passiert der Zelle freilich nur selten: Wasser im Boden hat üblicherweise ein negativeres Potential, und es wird im Pflanzenkörper durch Gravitation und Reibung noch negativer. Was bedeutet das für den Protoplasten? Er kann sich nicht so weit mit Wasser aufsättigen wie im Modellbeispiel, und der Druck bleibt im Gleichgewicht zwischen dem Wasser im Protoplasten und dem in der Wand geringer. Wenn der Boden sehr trocken ist, kann der Turgor sogar ganz verschwinden. Dann werden die Blätter der betroffenen Pflanzen schlaff. Der Druck der turgeszenten Protoplasten gegen die Wände ist ein wichtiges Festigungsprinzip, das aber natürlich versagen muß, wenn der Turgor aufhört. Gleichzeitig mit dem Turgorverlust wird auch der Wassergehalt der Vakuole geringer, da die Protoplasten nicht ihr maximales Volumen erreichen. Wir haben uns jetzt sehr lange mit dem Potential der Vakuole beschäftigt; zahlt sich das aus? Die Vakuole ist doch nur eine Art Lagerraum der Zelle für Reservestoffe und Ausscheidungsstoffe; der Stoffwechsel aber geht im Protoplasma vor sich. Das ist natürlich ganz richtig. Wir haben aber vorhin erwähnt, daß man die Verhältnisse im Protoplasma nicht direkt messen kann. Wir können aber die Vakuole als vereinfachtes Modell für das Plasma betrachten. Das läßt sich sogar wieder mit Gleichungen belegen. Zunächst ist der Turgordruck, wenn einer vorhanden ist, für die Vakuole und das Protoplasma gleich. Die Zellwand drückt ja auf beide Kompartimente mit der gleichen Kraft. Wir können also schreiben: p Vakuole = p Protoplasma Da aber auch das Gesamtwasserpotential gleich ist, muss das osmotische Potential der Vakuole gleich dem osmotischen Potential im Protoplasma sein: o Vakuole = o Protoplasma 149 In der Vakuole wird das osmotische Potential hauptsächlich durch niedermolekulare Verbindungen erzeugt, im Protoplasma durch niedermolekulare und hochmolekulare. Wenn wir also die Zustände der Vakuole messen, wissen wir auch einiges vom Protoplasma, vor allem den numerischen Wert für den Turgordruck p . Der Turgor ist für die Physiologie der Pflanzenzelle sehr wichtig Das betrifft vor allem das Streckungswachstum der Zelle. Seine Geschwindigkeit ist proportional dem Turgordruck über einem Schwellenwert: dV ------- = k ( p - p') dt Deshalb führt jede Verschlechterung von t sofort zu verringertem Wachstum. Der Turgor ist aber nicht nur während des Wachstums bedeutsam, er beeinflußt auch die physiologischen Vorgänge in ausgewachsenen Organen: a) Spaltöffnungen schließen sich meist dann, wenn das Blatt ein Gesamtwasserpotential nahe dem Turgorverlustpunkt erreicht. Eine solche Reaktion hat zwei Konsequenzen: Erstens sinkt die Wasserabgabe, und das Blatt kann sich erholen. Zweitens verhindern aber geschlossene Stomata die Photosynthese, die Pflanzen beginnen also zu "hungern". b) Biochemische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Proteinbiosynthese in welken Pflanzenteilen sinkt, während der Proteinabbau weitergeht. Enzyme werden desaktiviert und nicht mehr nachgeliefert, was zur Hemmung des Stoffwechsels führen muß. c) Während die Zellstreckung schon von mildem Streß gehemmt wird, ist die Zellteilung erst vom Turgorverlust betroffen. Die Teilung dauert sehr lange, daher ist hier die geringere Empfindlichkeit vorteilhaft. d) Es werden aber auch einige Substanzen vermehrt, besonders bei längerem Turgorverlust. So wird das Hormon Abscisinsäure (ABA) angereichert, was viele Konsequenzen hat. Erstens verstärkt es die Tendenz der Spaltöffnungen, geschlossen zu bleiben. Die Pflanze reagiert also auch bei verbesserter Wasserversorgung zunächst vorsichtig. Zweitens beschleunigt ABA die Alterung, etwa das Vergilben und den Abwurf älterer Blätter. Das aber entlastet den Wasserhaushalt der übrigen Blätter. Man kann Blattfall bei Trockenheit fast je- 150 den Sommer im Freiland beobachten. Selbst Alleebäume, etwa die Kugelahorne in der Feistmantelstraße, werfen während der ersten Trockenperioden im Juni oder Juli viele Blätter ab, vor allem weniger produktive Schattenblätter im Kroneninneren. Drittens hemmt ABA die Wirkung der anderen Phytohormone; vermindertes Wachstum ist die Folge. e) Bei vielen Pflanzen werden niedermolekulare Substanzen im Zellsaft und im Protoplasma vermehrt, die das osmotische Potential absenken. Wenn diese Kompartimente mehr Teilchen speichern, bleibt die Zelle länger turgeszent. Wir können diese Neusynthese, die osmotische Anpassung, als Reaktion ansehen, die den Wasserzustand der Zellen und Gewebe verbessert. Angereichert werden meist Zucker und organische Säuren im Zellsaft sowie die Aminosäure Prolin im Protoplasma. Wir sehen also, daß der Turgorverlust und der damit verbundene Wasserstress eine ganze Reihe von Reaktionen auslösen. Diese führen wieder zu komplexen Veränderungen am Organismus der Einzelpflanze und letztlich sogar zu Änderungen der Artenzusammensetzung am Standort, wenn durch eine dauerhafte Veränderung der Wasserverhältnisse die Konkurrenzkraft schlecht angepaßter Arten entscheidend geschwächt wird. HSIAO hat in einem instruktiven Schema eine Reaktionskette gezeigt, die schon auf milden Wasserstress folgen kann. Die reduzierte Zellstreckung führt zu geringerem Blattwachstum und damit zu einer Reduktion der Photosynthese pro Einheit der Landfläche. Die Assimilate aus aktiven Blättern werden nicht mehr von wachsenden Zellen bei der Synthese von Wandmaterial und Protoplasma verbraucht, sondern sie häufen sich an. Das hemmt die Photosynthese weiter. Andererseits können aber nicht verwendete Zucker aus dem Sproß in die Wurzeln geleitet werden und dort den Zellturgor verbessern; die Wurzel kann wieder wachsen und mehr Bodenvolumen erschließen, was in günstigen Fällen zur Verbesserung des Wasserzustandes der ganzen Pflanze und damit zum Ende der Stresssituation führt. In extremen Dürreperioden wird die Pflanze freilich mit allen Anpassungen und Einschränkungen ihrer Aktivitäten nicht zum Ziel kommen, das in diesem Fall Überleben heißt. Fällt der Wassergehalt der Zellen auf unter 50% des Wertes bei voller Sättigung, dann beobachtet man an höheren Pflanzen meist den Tod einzelner Zellen, ganzer Gewebepartien und schließlich Organe. Die 151 Zerstörung von Biomembranen ist daran anscheinend maßgeblich beteiligt. Schließlich stirbt so viel ab, daß das Überleben der Pflanze gefährdet ist. Wenn Regenfälle den Stress rechtzeitig beenden, kommt das unterschiedliche Regenerationsvermögen der Arten zum Tragen. Manche können die Verluste ersetzen, indem sie aus schlafenden Knospen austreiben und den Vegetationskörper regenerieren, während andere dazu kaum in der Lage sind. Wir können die verschiedenen Mechanismen, mit denen eine Pflanze Widerstandsfähigkeit (Resistenz) gegenüber einer Belastungssituation (Stress) entwickeln kann, ganz allgemein in drei Gruppen einteilen: Resistenz Stressvermeidung Stresstoleranz Restitution Für die Trockenheit gilt folgendes Schema: Trockenresistenz Trockenheitsvermeidung Trockenheitstoleranz Restitution (etwa durch ein tiefes (etwa durch negative (durch Wurzelsystem, osmotische Potentiale, Neuaustrieb) durch Transpirations- durch unempfindliches einschränkung,...) Protoplasma Der Mensch kann natürlich bis zu einem gewissen Grad die Auswirkungen von Dürre auf die Pflanzen bekämpfen, indem er künstlich bewässert. Diese Tätigkeit gehört, wenn sie größeren technischen Aufwand als eine Gießkanne oder einen Gartenschlauch braucht, bekanntlich zum Arbeitsfeld der Kulturtechniker; diese werden damit also noch öfter konfrontiert werden. Wasserüberschuß und seine negativen Folgen Historisch war wahrscheinlich die Entwässerung von Feuchtflächen in Mitteleuropa noch wichtiger als die Bewässerung. In Norddeutschland waren 152 Moore bis ins 19. Jahrhundert ein Verkehrshindernis! Heute sind durch emsiges Entwässern die Feuchtflächen so weit reduziert, daß sehr negative Auswirkungen auf die Kulturlandschaft sichtbar werden. Damit wir aber den Grund für Entwässerungsmaßnahmen besser begreifen, wollen wir uns kurz die Reaktion der Pflanze auf zu viel Wasser ansehen. Zentrales Problem ist dabei das Auftreten von Sauerstoffmangel. Wasserüberschuss kann natürlich in sehr verschiedenem Grad auftreten. Auf der einen Seite haben wir eine vorübergehende Füllung der Bodenporen, ohne dass die Oberfläche mit Wasser bedeckt wäre. Wir bezeichnen das als Wassersättigung des Bodens. Bei Überschwemmung und Überflutung sind der Boden oder sogar die ganze Pflanze mit Wasser bedeckt. - Außer der Höhe des Wasserstandes haben noch andere Faktoren Einfluß auf die Wirkung des Wasserüberschusses. Es sind dies: die Jahreszeit (Überschwemmungen während der Pflanzenruhe sind weniger gefährlich); die Wassertemperatur (kaltes Wasser löst mehr Sauerstoff und setzt O2-zehrende Prozesse herab); die Häufigkeit der Überschwemmungen (in der Au gibt es interessante Abfolgen von jährlich mehrmals bis zu in Jahrzehnten nur einmal überschwemmten Standorten, deren Artengarnitur ganz verschieden ist); die Dauer der einzelnen Überschwemmung (kurz ist sie natürlich harmloser). Zu viel Wasser behindert die Sauerstoffversorgung und damit die Atmung. Besonders extrem ist in dieser Hinsicht warmes, stagnierendes Wasser, doch ist auch in kühlem Fließwasser O2 weit knapper als in der Luft, und die Diffusionsgeschwindigkeit ist um Größenordnungen geringer. Es kommt zu Artendifferenzierungen: So kann etwa die Schwarzerle (Alnus glutinosa) stagnierende Nässe im Wurzelbereich ertragen, während die Grauerle (Alnus incana) zwar das bewegte Wasser im Uferbereich von Gebirgsbächen, nicht aber das stehende Wasser an Teichufern toleriert. Normale Atmung kann ohne Sauerstoff nicht ablaufen. Es gibt nun Arten, die den Mangel vermeiden, indem sie für zusätzliche Gaszufuhr sorgen, und andere, die Sauerstoffmangel ertragen. Solche Arten besitzen Resistenz, die sich wieder nach dem früher gezeigten Schema einteilen läßt. 153 Zur Vermeidung des O2-Mangels tragen besonders Aerenchyme mit großen Interzellularen bei. Viele Wasserpflanzen, etwa die Seerosen, bilden stets Aerenchyme. Andere Arten, wie etwa die nordamerikanische Pinus contorta, reagieren erst auf akuten Sauerstoffmangel durch Neuanlage von Wurzeln mit großen Hohlräumen, die der Spross mit Sauerstoff versorgt. Toleranz des Sauerstoffmangels braucht stoffwechselphysiologische Anpassungen. Sie umfassen eine Unterdrückung der Milchsäure- und Alkoholbildung im Protoplasma, eine Verringerung ATP-verbrauchender Prozesse und eine Ankurbelung von Gärungen unter Bildung ungiftiger Endprodukte. Pflanzen, die Wasserüberschuss nicht tolerieren, zeigen langfristig immer stärkere Veränderungen: Die Permeabilität der Wurzel nimmt ab, die Ionenaufnahme sinkt, Hormongleichgewichte ändern sich, die Stomata gehen zu (und zwar durch ABA-Überschuß trotz guter Wasserversorgung!), und daher nehmen auch Transpiration und Photosynthese ab. Blattalterung und Blattabwurf werden beschleunigt, und schließlich stirbt die Pflanze ab. Da zu den nicht resistenten Pflanzen wichtige Forstbäume und auch alle heimischen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen (Ausnahme ist Reis!) gehören, war die Entwässerung weiter Landstriche Vorbedingung für eine Ausdehnung der Landeskultur und hat vor allem in Nord- und Osteuropa größte Bedeutung gehabt. Heute muß man, wie gesagt, dieses Problem differenzierter betrachten. Der Mineralstoffhaushalt Wir wollen jetzt kurz den Mineralstoffhaushalt ansehen. Einige wichtige Aspekte wurden bereits besprochen: Die Aufnahme von Ionen aus dem Boden erfolgt in der Zone der Wurzelhaare, also der Differenzierungszone. Die sehr verdünnte Bodenlösung dringt in die Mikrokapillaren der Parenchymwände ein und wird dort auch weitergeleitet. Alle Zellen bis zur Endodermis nehmen durch aktiven Transport die Ionen auf, die der Körper braucht. Der Caspary'sche Streifen der Endodermis sperrt den Zellwandweg, so dass nicht aktiv aufgenommene Ionen nicht ins Xylem vordringen können. Nährionen, die einmal im Protoplasma sind, werden symplasmatisch zu den Gefäßen gebracht, im Xylemwasser in Stamm und Blätter befördert, durch die Zellwände oder den Symplasten bis zu den lebenden Zellen geleitet und dort verwertet. 154 Daneben gibt es auch eine Verlagerung von Mineralstoffen im Phloem, doch sind dort nicht alle Ionen gleich beweglich. So bewegen sich K +, Mg2+, NO3-, PO43-, SO42- leicht, Fe3+, Mn2+, Zn2+ und Cu2+ nur schwer und Ca2+ gar nicht im Phloem. Die Mobilität im Phloem erlaubt die Umverteilung von Mineralstoffen, wenn sich irgendwo im Körper der Bedarf plötzlich ändert. Sie erklärt auch, wie Kaliumsalze, Phosphate oder Stickstoffverbindungen aus alternden Blättern abtransportiert und im Stamm gespeichert werden. Die Ionenversorgung unterirdischer Seitensprosse wäre ohne Phloem gar nicht denkbar: Eine wachsende Kartoffelknolle nimmt selbst keine Ionen aus dem Boden auf, und der Transpirationsstrom kann sie auch nicht versorgen, da sie ja an den feuchten Boden durch ihr Periderm kein Wasser abgibt. Zweierlei bleibt noch offen: Welche Mineralstoffe sind für die Pflanze wichtig, und wie wirken sie im Körper? Die erste Frage hat man auf zwei Wegen experimentell geklärt: Man hat zunächst Pflanzenmaterial getrocknet und verbrannt, um das Wasser und die aus der Luft stammenden C-Atome der organischen Substanzen zu entfernen. Die Asche wurde dann analysiert. Dabei fand man regelmäßig bestimmte Elemente, die also wohl notwendig waren. Aus ihren Salzen mischte man Nährlösungen an, die alle nötigen Stoffe, aber nichts Unnötiges enthalten sollten. Man ließ also immer andere Einzelelemente weg und beobachtete, ob die Pflanze darauf negativ reagierte. War dies nicht der Fall, dann war das betreffende Element nicht lebenswichtig, sondern bloß mit dem Transpirationsstrom in den Pflanzenkörper eingeschleppt worden. Auf diese Weise unterschied man unentbehrliche und entbehrliche Mineralstoffe. Die unentbehrlichen teilt man nach den benötigten Mengen ein: a) Von den Hauptnährelementen N, P, S, K, Ca und Mg benötigt jede Pflanze große Mengen. b) In kleinen Mengen sind die Spurenelemente Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl und Ni ebenso lebenswichtig. Das letzte Element zeigt uns die kleinen Mengen an Spurenelementen, die die Pflanze benötigt. Erst ab 1983 wurde geklärt, daß die Pflanzen winzige Nickelspuren brauchen. Und zwar ist Nickel im allgemein verbreiteten Enzym Urease enthalten, das den Harnstoff spaltet. Zum strengen Nachweis der Unentbehrlichkeit wurde die Nährlösung extrem gereinigt, da schon 1 µg/l alle Symptome beseitigt. 155 Einige Spezialisten brauchen weitere Elemente. So können etwa Kieselalgen und Schachtelhalme nicht ohne Si wachsen (wohl aber Gräser und Riedgräser, obwohl sie im Freiland SiO2 als Rekret in die Zellwände einlagern). Leguminosen benötigen Kobaltspuren, aber nicht für sich selbst, sondern für ihre Knöllchenbakterien, also zur Bindung des Luftstickstoffs. Kulturpflanzen, die von Meerstrandarten abstammen, z. B. die Beta-Rüben (Futter-, Zucker- und rote Rübe), brauchen Spuren von Natrium, das aber im Boden stets vorhanden ist. Wir wollen uns noch kurz ansehen, wozu die Hauptnährelemente gebraucht werden und wo man sie im Körper der Pflanze findet. Stickstoff enthalten sehr viele bioorganische Verbindungen; die quantitativ wichtigsten sind die Proteine mit ihren Aminosäuren und die Nukleinsäuren mit den stickstoffhältigen Basen. Aus dem Boden wird Stickstoff als Ammoniumkation NH4+ oder als Nitratanion NO3- aufgenommen. Die Pflanze reduziert Nitratstickstoff zum Ammoniumstickstoff, und nur dieser wird in Verbindungen eingebaut. Den riesigen Vorrat an N2 in der Luft können nur Mikroorganismen direkt nutzen, nicht aber höhere Pflanzen. Diese sind auf die begrenzten Nitrat- und Ammoniumvorräte des Bodens angewiesen. Diese Vorräte werden einerseits leicht ausgewaschen, andererseits ergänzt: 1. Durch stickstofffixierende Mikroorganismen des Bodens und der Symbiosen. 2. Durch Abbau toter Pflanzen und Tiere, wobei die Saprophyten den Stickstoff teilweise in den Boden zurückführen. 3. Durch elektrische Entladungen in der Atmosphäre, die Stickoxide erzeugen. Dieser Vorgang wird technisch nachgeahmt; die dadurch verbesserte Stickstoffdüngung der Felder ist ein Hauptzug der modernen Landwirtschaft. 4. Daneben entsteht "unabsichtlich" Nitrat, wenn Verbrennungsprozesse bei hoher Temperatur ablaufen. Das verändert derzeit naturnahe Ökosysteme. Phosphor ist uns mehrfach begegnet: Er bildet Brücken zwischen den Nukleotiden, durch welche sie zu Nukleinsäuren zusammengefügt werden. Spuren sind auch im Energieübertragungssystem aus ATP und ADP vorhanden. Stets ist noch das Orthophosphation erkennbar, also die PO 4 -Gruppe, die im Pflanzenkörper nicht verändert wird. Im Boden liegen häufig Salze mit Ca, 156 Mg oder Al vor, die die Pflanzen nicht immer gut aufschließen können; auch mit P wird daher sehr intensiv gedüngt. Das schafft Probleme für Gewässer. Die Aminosäuren Cystin, Cystein und Methionin enthalten Schwefel. Er liegt im Boden als Sulfation SO42- vor, wird aber dann zur Stufe des Schwefelwasserstoffes reduziert. Proteine enthalten daher SH-Gruppen. Bei ihrer Zersetzung entsteht der Schwefelwasserstoffgeruch "nach faulen Eiern". Pflanzenasche enthält große Mengen an Kalium. Sein Entzug führt zu Mangelerscheinungen, also ist es ein essentieller Mineralstoff. Das Ion wird in der Zelle aber nie in stabile Verbindungen eingebaut. Als Gegenspieler des Kalziums sorgt es für den richtigen Quellungsgrad des Protoplasmas: Mehr Kalium läßt das Protoplasma stärker quellen, bei Kalziumzufuhr wird es entquollen. Spezialaufgaben kennen wir bereits: K+ wird von den Schließzellen bei der Öffnung aufgenommen und beim Schließen wieder abgegeben. Das Phloem kann nur mit Saccharose beladen werden, wenn zugleich K + aufgenommen wird ("Kotransport"). Bei manchen enzymatischen Prozessen wirkt Kalium als Kofaktor mit. Böden enthalten reichlich Kalzium als Karbonat, Sulfat und Phosphat. Wie gesagt, wirkt es entquellend auf das Protoplasma. Auch stabilisiert es Biomembranen und vernetzt Pektin in den Zellwänden. Kalzium ist Kofaktor von Enzymreaktionen. – Meist erhält die Pflanze so viele Ca-Ionen, dass ein Überschuss als unlösliches Oxalat festgelegt wird. Offen ist, ob die Entfernung der Kalziumionen oder die Entgiftung des Oxalats der Zweck dieser Salzbildung ist. Vielleicht ist beides wichtig. Magnesium ist das Zentralatom im Chlorophyllmolekül und vernetzt zusammen mit Kalzium das Protopektin. Mg2+ ist weiters Kofaktor bei vielen Enzymreaktionen, vor allem bei solchen, die ATP umsetzen. Unter den Spurenelementen ist das Eisen ein Sonderfall, da davon mehr als von den anderen benötigt wird. Es wird in wichtige Moleküle fest eingebaut, meist in Koenzyme und prosthetische Gruppen von Enzymen. Das sind fest (kovalent) mit dem Eiweißkörper des Enzyms verbundene Gruppen, die zur Funktion unbedingt nötig sind. Fe-hältige Moleküle übertragen zum Beispiel in der Atmungskette Elektronen. Auch Enzyme der Chlorophyll-Biosynthese sind eisenabhängig. Daher bleiben Pflanzen bei Eisenmangel chlorotisch, also bleich. 157 Die anderen Spurenelemente sind Kofaktoren bei jeweils ganz wenigen Enzymreaktionen. Fehlen sie, so können gewisse Biosynthesevorgänge nicht ausgeführt werden und es kommt zu Krankheitssymptomen. Dies wurde intensiv an Kulturpflanzen studiert, die sich ja den Standort nicht selbst wählen und daher auf ungenügend versorgten Böden gefährdet sind (Wildpflanzen, die von diesen Elementen abhängen, treten dort gar nicht auf). Heute werden Mangelerkrankungen durch gezielte Düngung mit Spurenelementen bekämpft. Ein wesentlicher Faktor bei der Mineralstoffernährung ist der pH, also die Bodenreaktion. Er kann zunächst Pflanzen direkt schädigen. Saure pH –Werte unter 3 und basische über 9 zerstören das Protoplasma der Wurzelzellen. Die Löslichkeit von Al3+ in stark sauren Böden (saurer Regen!) und von Boraten in stark basischen Böden kann zu Vergiftungen führen. Kormophyten sterben daher meist unter pH 3,5 und über pH 8,5 ab. Dazwischen liegt ein breites Optimum im schwächer sauren und alkalischen Bereich. Konkurrenzschwache Arten werden aber aus dem Optimalbereich an die Ränder abgedrängt, wo noch keine Giftwirkungen auftreten, aber der Boden-pH die Aufnahme einiger Ionen ungünstig beeinflußt. Das ist die Hauptwirkung des pH auf die Pflanze. Der pH verändert nämlich Bodenstruktur, Verwitterung und Humifizierung und vor allem Nährstoffmobilisierung und Ionenaustausch. Saure Böden setzen Al, Fe und Mn frei, stark basische fällen Fe, Mn, PO4 und einige Spurenelemente aus, so dass die Pflanze ungenügend versorgt wird. Blattdüngung umgeht den Boden: Die Cuticula ist beschränkt quellbar. Sie läßt Wasser und Ionen durch, wenn die Nährlösung nach Zugabe eines Netzmittels am Blatt haftet. Die Stoffproduktion Wir wollen jetzt ein wesentliches Thema der Ökophysiologie anreißen, die Stoffproduktion im Freiland. Die meßbare Produktion ergibt sich aus zwei gegenläufigen Prozessen, die wir bereits kennengelernt haben. Dies sind die Photosynthese, die in den Chloroplasten aus CO2 und H2O Zucker erzeugt, und die Atmung, die im Grundplasma und den Mitochondrien die chemische Energie des Zuckers als ATP freisetzt, wobei CO2 und H2O rückgebildet werden. Messgeräte erfassen am Standort direkt die Stoffbilanz von Blättern oder oberirdischen Sprossen. Tagsüber laufen Photosynthese und Atmung parallel 158 ab, und wir messen die Nettophotosynthese. Sie ist geringer als die Bruttophotosynthese in den Chloroplasten, da ein Teil des gewonnen Zuckers sofort veratmet wird. In der Nacht hingegen findet ausschließlich Atmung statt; die Pflanzen verlieren einen Teil der tagsüber gewonnenen Biomasse. Zum Einstieg sehen wir einige durchschnittliche Tagesleistungen der Nettophotosynthese. Es handelt sich um Zuckermengen, die an einem Schönwettertag pro m2 Blattfläche gebildet werden. Wir finden für: Weizen bis 11 g m-2 d-1 Zuckerrübe bis 15 g Soja bis 18 g Reis bis 20 g Laubbäume bis 10 g Nadelbäume bis 7 g Mais bis 33 g (C4), Zuckerrohr bis 35 g (C4) Das Verhältnis der Blattfläche zur Gesamtmasse der Pflanze ist sehr verschieden. Je größer die Gesamtblattfläche eines Individuums ist, desto mehr produziert es. Allerdings kann es dabei Komplikationen geben: Blätter sind verschieden produktiv, manchmal kann durch Umweltbedingungen oder im Verlaufe der Entwicklung sogar die Atmung überwiegen. Die Leistung des Einzelblattes ist im wechselnden Milieu höherer Kronen und geschlossener Bestände außerordentlich variabel. Zum Verständnis der Photosynthese im Freiland müssen wir die Wirkung der Umweltfaktoren auf das Blatt studieren. Dabei sollte man zunächst analysieren, wie jeder einzelne Faktor die Photosynthese beeinflußt. Bei solchen Untersuchungen müssen alle nicht untersuchten Faktoren optimal gehalten werden. Ein nicht optimierter Faktor hebt nämlich die positiven Wirkungen des untersuchten Faktors vorzeitig auf. So kann etwa ein Anstieg der Lichtintensität die Photosynthese nicht voll aktivieren, wenn die Temperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt liegt. Andererseits bleibt die optimale Temperatur bei Mineralstoffmangel oder schwacher 159 Beleuchtung ohne Wirkung. Es werden dann "falsche Maxima" vorgetäuscht, die zu tief liegen. Die Produktion wird wie alle physiologischen Vorgänge stets durch den Faktor begrenzt, der am weitesten von seinem Optimalwert entfernt ist. Wir sagen, daß sich dieser Faktor "im Minimum" befindet und sprechen mit LIEBIG von einem Gesetz des Minimums oder der begrenzenden Faktoren. Sehen wir uns nun die Wirkung einzelner Faktoren auf die Nettophotosynthese an, also auf die CO2-Aufnahme. 1. Licht. Die Lichtabhängigkeit der CO2-Aufnahme folgt einer Sättigungskurve. Wenn wir den CO2-Austausch in voller Dunkelheit messen, dann finden wir natürlich an Stelle einer Aufnahme eine Abgabe von CO 2, das aus der Atmung stammt (Dunkelatmung). Schwaches Licht reduziert zunächst diese Abgabe, bis bei einer bestimmten Intensität der meßbare CO 2-Austausch 0 wird. Hier halten sich also Atmung und Photosynthese die Waage. Das ist der Lichtkompensationspunkt der Photosynthese. Er ist von Art zu Art, aber auch je nach Vorkultur verschieden. Pflanzen, die an den Schatten genetisch oder durch Kultur angepaßt sind, haben einen Kompensationspunkt bei niedriger Intensität, sogenannte Lichtpflanzen, die freie Einstrahlung empfangen, bei höherer. Bei weiterer Intensitätssteigerung steigt die Kurve zunächst fast gerade an, krümmt sich aber dann in einem Übergangsbereich und endet in einem horizontalen Ast: Trotz Steigerung der Lichtintensität ist jetzt keine weitere CO2-Aufnahme zu erzielen: Der Photosyntheseapparat ist lichtgesättigt. Wieder sind die Sättigungswerte der Arten je nach genetischer Anpassung an die Standorte verschieden. Die Brunnenkresse hat als Lichtpflanze bei weitem höhere Sättigungswerte als der Sauerklee, eine Art des Waldschattens. Schattenarten und Lichtarten unterscheiden sich also ökologisch beträchtlich. Sehen wir uns das näher an. Der Kompensationspunkt von Schattenarten wird bereits bei etwa 1% des vollen Sonnenlichtes erreicht. Von da an ist die Bilanz positiv, die Photosynthese bindet mehr CO 2 als die Atmung freisetzt. Bringt man eine Lichtart in dieses Dämmerlicht, dann atmet sie sich zu Tode. Die Schattenpflanze ist also im Schatten konkurrenzüberlegen. Andererseits erreicht sie aber schon bei 10 - 15% des vollen Lichtes die Sättigung, mehr kann sie nicht zum Stoffgewinn nützen. Im vollen Licht produziert sie daher weniger als die Lichtpflanze. Es gibt hocheffiziente Licht- 160 arten, die C4-Arten, die auf Grund einer abweichenden CO2-Bindung die Reaktionszentren sehr wirksam mit CO2 versorgen. Hierher gehören einige Nutzpflanzen subtropischer Herkunft aus der Familie der Gräser, z.B. Mais, Zuckerrohr und Hirse. Sie werden im Freiland nie lichtgesättigt, können also beim Optimum der übrigen Faktoren Phantastisches leisten. Auch in unserer Tabelle haben sie ja Höchstwerte. Wachsen diese Supersportler am sonnigen Feld neben dem kümmerlichen Sauerklee, dann sprinten sie im Rekordtempo davon. Die Lichtart überwächst und beschattet den kleinen Genügsamen. Das allein wäre harmlos, er ist ja an den Schatten angepaßt. Meist verliert die Schattenart gegen dichtwachsende Lichtpflanzen aber auch den Kampf um Wasser und Nährstoffe, da die Konkurrenten mehr Material in das Wurzelsystem einbauen. In einer geschlossenen Krautgesellschaft, etwa einer Mähwiese, haben extreme Schattenkräuter daher nichts verloren. Wir finden sie im Wald, wo die lichtliebenden Bäume viel tiefer wurzeln. Unterschiede gleich denen zwischen Licht- und Schattenpflanzen finden sich auch zwischen Blättern derselben Pflanze, wenn sie unter extrem verschiedenen Lichtverhältnissen wachsen, etwa in der Unter- und der Oberkrone von Bäumen im Bestand. Viele Laub- und Nadelbaumarten entwickeln dann unterschiedlich gebaute Sonnenblätter und Schattenblätter. Sonnenblätter haben oft mehrere Reihen von Palisadenzellen und sind insgesamt dicker als die palisadenarmen Schattenblätter. Ihre Lichtsättigungskurven verhalten sich ganz analog wie die der Licht- und Schattenpflanzen. Das Lichtklima im Bestand ist oft für die unteren Blätter der Bäume und für die Bodenflora schlecht, Licht wird limitierend. Die Lichtverhältnisse in einem Bestand sind aber nicht konstant. Die Belaubung hängt von der Vegetationsentwicklung ab, und mit ihr ändert sich im Laufe der Jahreszeiten die Lichtverteilung. Das gilt für sommergrüne Wälder ebenso wie für Wiesen, in denen die Lichtstärke am Boden beim Wachstum der Sprosse ständig sinkt, nach der Mahd aber wieder abrupt steigt. In winterkahlen Laubwäldern gelangen bis zu 90% der Strahlung bis zum Boden, während der Laubentfaltung immer noch 20 - 40%, bei voller Belaubung dagegen weniger als 10%. Die Bodenflora unserer Laubwälder ist auf diesen Wechsel der Lichtverhältnisse eingestellt. In Laubwäldern finden sich typische Frühjahrsblüher wie Schneeglöckchen, Anemonen, Blaustern, Gelbstern, Milchstern, Salomonssiegel und 161 andere. Ihr Lebenszyklus läuft in der kurzen Zeit zwischen Schneeschmelze und voller Belaubung der Kronen ab. Sie sind keine Schattenpflanzen, sondern lichtliebende Kryptophyten mit kurzer Vegetationsperiode, die die Zeit des ungünstigen Lichtklimas ebenso wie den Winter mit unterirdischen Speicherorganen überleben. Im Sommer ist gerade unser dichtestbelaubter Wald, der Buchenwald, fast völlig leer von Unterwuchs. - Echte Schattenpflanzen, etwa der Sauerklee, haben eine viel längere Vegetationszeit als die Frühjahrsblüher. Besonders reichlich finden sie sich in Nadelwäldern, wo der Schatten nur durch vorbeiziehende Lichtflecken unterbrochen wird. Ein weiterer Faktor mit Wirkung auf die Photosynthese ist 2. die Temperatur. Die Temperaturkurve der Netto-Photosynthese ist eine typische Optimumkurve. Variiert man die Temperatur über den ganzen Lebensbereich, dann findet man zwei Punkte ohne Aufnahme oder Abgabe von CO2. Beide Male zeigt dies ein Gleichgewicht zwischen Bruttophotosynthese und Atmung an. Bevor die Photosynthese die weniger kälteempfindliche Atmung übertrifft, muß eine Minimaltemperatur erreicht werden. Das ist der Kältekompensationspunkt. Andererseits steigt die Atmung bei Hitze rasch an und erreicht schließlich wieder die Intensität der Bruttophotosynthese. Das ist der Hitzekompensationspunkt. Tragen wir die Nettophotosynthese gegen die Temperatur auf, sehen wir also ein Minimum, ein ziemlich breites Optimum und ein Maximum. Die Lage dieser "Kardinaltemperaturen" ist standortabhängig, da sich die Artengarnitur durch Konkurrenz und Auslese an die Temperaturverhältnisse angepaßt hat. Allgemein liegt das Optimum nur bei den besonders gut CO 2-fixierenden C4-Pflanzen über 30 °C. Krautige Sonnenpflanzen der heimischen Flora (C3Pflanzen) haben meist Werte zwischen 20 und 30 °C, Frühjahrsblüher und Gebirgsarten zwischen 10 und 20 °C. Das Optimum der Nadelbäume liegt etwas tiefer (ungefähr 15 oC) als das der Laubbäume (etwa 20 oC). Das Minimum liegt bei Tropenarten zwischen 5 und 10 °C, bei heimischen Pflanzen meist unter 0 °C, und zwar dort, wo die Zellen zu frieren beginnen. Das Maximum findet sich um 40 °C. Gemeint sind immer die Blatttemperaturen, die oft um einige Grad von den Lufttemperaturen abweichen. 3. CO2-Konzentration: Die CO2-Konzentration der freien Atmosphäre ist ziemlich konstant, wenn sie auch in den letzten 100 Jahren durch industrielle 162 Prozesse zugenommen hat. Sie beträgt derzeit etwa 0.036 Volumsprozent. Manche Lehrbücher erwecken den Eindruck, der Pflanze stünde stets genau diese Konzentration zur Verfügung. Das ist nicht der Fall: In Beständen, wie Wäldern, Wiesen oder Getreidefeldern, kommt es durch die Tätigkeit von Organismen zu beträchtlichen Konzentrationsänderungen im Tagesgang und im Jahresgang. Ich möchte nur ein Beispiel aus einem Fichtenwald zeigen, das von HAGER gemessen wurde. Die Konzentration war in Bodennähe stets ziemlich hoch, was auf die Atmung von Bodenorganismen hinweist. Die anderen Höhen im Bestand waren hauptsächlich durch Atmung und Photosynthese der Fichte beeinflußt; der Tagesgang weist ziemliche Schwankungen auf. Die Bäume machen also die Luft, die ihre Nadeln umgibt, durch Photosynthese tagsüber beträchtlich CO2-ärmer und reichern sie durch Atmung nachts mit CO2 an. Wie gesagt, soll man die Photosynthese bei Optimalbedingungen für alle nicht variierten Parameter studieren. Bei CO2 ist die natürliche Konzentration offenbar der beste verfügbare Wert, und die Photosynthese ist bei geringeren CO2-Konzentrationen niedriger. Es war nun interessant, die künstliche Erhöhung der CO2-Konzentration zu studieren. Kann sie die Photosynthese noch steigern? Sie kann es! Optimal (5 bis 10-fach) erhöhter Gehalt an CO2 läßt die Leistung auf das 3 bis 4-fache gegenüber den Werten bei 360 ppm ansteigen. Bei noch höherer Konzentration fällt die Photosynthese wieder. Ökophysiologische Maxima sind daher eigentlich keine physiologischen Maxima: Die suboptimale CO2-Konzentration verringert sie. Die Pflanzen könnten also CO2-Konzentrationen nutzen, die 5 bis 10 mal höher liegen als die heutige Konzentration. Hier stecken gewaltige Ertragsreserven, die man leider im Freiland nicht nutzen kann, weil jeder Windhauch die Konzentrationserhöhung völlig beseitigt. Hingegen wird CO2-Begasung im Glashaus eingesetzt; man verwendet Erdgasbrenner, die zugleich heizen und mit CO2 düngen, oder CO2 aus Flaschen. Wieso hat die Pflanze Kapazitäten für die CO2-Verwertung, die in der Natur nie genützt werden? Offenbar ist der Photosyntheseapparat an den CO2Gehalt einer primitiveren Erdatmosphäre angepasst. Ein Großteil des Kohlenstoffs dieser Atmosphäre wurde photosynthetisch gebunden und findet sich heute als Erdöl, Erdgas und Kohle, freilich nur zum geringen Teil in nutz- 163 baren Lagerstätten; auch Kalk (CaCO3) ist teilweise das Werk von Organismen (Algen, Korallen, Schwämmen usw.) An Grenzstandorten (Waldgrenze) wirkt die CO2-Erhöhung in der Atmosphäre bereits jetzt sichtbar zuwachsfördernd. Freilich hat der Treibhauseffekt des CO2 sehr negative Folgen! Blätter von etwa 1000 Arten aus verschiedenen Familien zeigen Abänderungen des Stoffwechsels, die eine bessere Ausnützung des geringen CO 2-Angebotes und eine bessere H2O-Ökonomie ermöglichen. Diese Anpassungen sind zum Teil auch an anatomischen Besonderheiten zu erkennen. Man unterscheidet heute zwischen dem C3-Weg, dem C4-Weg und dem CAM-Weg der Photosynthese. Der am längsten bekannte und im ganzen Pflanzenreich verbreitete Typ der Photosynthese ist der C3-Weg. Er ist auch der evolutionär älteste Weg. Hier erfolgt die Bindung von Kohlendioxid und seine Weiterverarbeitung zu Zuckern in der selben Zelle und in unmittelbarer zeitlicher Folge. CO2 wird an ein Akzeptormolekül (Ribulose-bisphosphat) angelagert, es entsteht eine organische Säure (3-Phosphoglyzerinsäure) mit 3 C-Atomen. Diese wird sofort im Chloroplasten weiter mit dem Reduktionsmittel, einem wasserstoffbeladenen Coenzym, umgesetzt, worauf der zunächst entstandene Zucker mit 3 C-Atomen (eine Triose) zu Glukose weiterverarbeitet wird. Die Blätter zeigen den bekannten Schichtenbau aus Palisaden- und Schwammparenchym. Es war jedoch auffällig, daß manche Angiospermen als erste Produkte nicht C3-Körper, sondern Äpfelsäure oder Asparaginsäure mit 4 C-Atomen bilden. Diese Art der CO2-Aufnahme wird C4-Weg genannt. Ihr entspricht ein eigenartiger Bau der Blattspreite, die "Kranzanatomie" der C4-Arten. Die Leitbündel sind von einer Bündelscheide aus großen, dünnwandigen Zellen umgeben. Die Scheidenzellen haben größere Chloroplasten als die Mesophyllzellen, meist ohne Grana. Das CO2 wird aus den Interzellularen in die Mesophyllzellen aufgenommen, die als Kranz um die Scheide liegen, und zum Aufbau der Säure mit 4 C-Atomen verwendet. Die Säure wird dann von den Mesophyllzellen in die Leitbündelscheide verlagert. Hier erfolgt die Glukosebildung. Aufnahme und Weiterverarbeitung sind also räumlich getrennt. Was ist da vorteihaft? Das Enzym PEP-Carboxylase in den Mesophyllzellen, das den Einbau des CO2 besorgt, ist bei ganz niedrigen CO2-Konzentrationen noch sehr 164 aktiv, es schöpft also die CO2-Vorräte der Interzellularen ganz aus. Schon eine sehr geringe CO2-Konzentration sättigt das Enzymsystem ab. Verbunden ist damit ein niedriger Schwellenwert für die Auslösung des CO2-Regelkreises. Die Stomata der C4-Pflanzen können wesentlich stärker geschlossen werden, ohne die CO2-Fixierung zu beeinträchtigen. Das ist vor allem in heißen, trockenen Gebieten sehr vorteilhaft: C3-Arten müssen etwa 800 g Wasser abgeben, um 1 g Trockensubstanz zu bilden, C4-Arten meist weniger als die Hälfte. Insgesamt ist auch das CO2-Aufnahmevermögen der C4-Pflanzen durch das effiziente Enzym höher und sie erzielen daher in der Regel eine höhere Netto-Photosynthese im Vergleich mit C3-Pflanzen, wenn die übrigen Bedingungen, vor allem das Licht, stimmen. Der CAM-Weg der Photosynthese zeigt Ähnlichkeiten mit dem C4-Weg, nur sind Fixierung und Endverarbeitung hier nicht räumlich getrennt, sondern zeitlich. Die Spaltöffnungen sind in der Nacht offen und lassen CO 2 ein. Die entstehende C4-Säure, die Apfelsäure, wird im Zellsaft gespeichert. Tagsüber schließen sich die Spalten, CO2 wird abgespalten und in der selben Zelle in Zucker verwandelt. Der Vorteil liegt ganz beim Wasserhaushalt: Die Nacht ist kühler und viel luftfeuchter als der Tag, die Pflanze verliert also weniger Wasser. CAM-Stoffwechsel findet sich nur bei Arten mit dickfleischigen Assimilationsorganen. Anatomisch erkennt man, daß die Mesophyllzellen riesige Zellsafträume und im dünnen protoplastischen Wandbelag Chloroplasten enthalten. Die großen Vakuolen sind wohl zweifach wichtig. Zunächst stellen sie ein großes Wasserreservoir dar. Ferner sind sie aber auch nötig, um die Säure so weit zu verdünnen, daß der pH nicht gefährlich absinkt. Die CAM-Arten produzieren nicht viel; ihre extreme Wasserökonomie macht sie aber auf jenen Trockenstandorten konkurrenzfähig, wo die inneren Wasserreserven nach seltenen, aber ausgiebigen Niederschlägen von Zeit zu Zeit ergänzt werden können. Wir sind damit schon bei einem weiteren Punkt unserer Analyse, dem 4. Wasserzustand. Seine Wirkung auf die Produktion ist enorm, weil bei C3- und C4-Pflanzen in der Nähe des Turgorverlustpunktes die Spaltenweite stark gedrosselt wird. Das wirkt sich durch CO2-Mangel unmittelbar auf die Photosynthese aus. Alles in allem ist in weltweiter Sicht die Wasserversorgung der Faktor, der den Ertrag der Landfläche am stärksten begrenzt. 165 Im Freiland wirken auf das Blatt wechselnde Kombinationen von Beleuchtungsstärke, Temperatur, Luft- und Bodenfeuchte sowie CO2-Konzentrationen. Die Photosynthese ist dann Resultierende in einem mehrdimensionalen Gefüge. Die Photosyntheseleistung ändert sich während der Entwicklung des Einzelblattes beträchtlich. Beim Austrieb funktionieren die Stomata noch nicht und die jungen Blätter müssen Stoffe aus älteren Blättern oder aus Speichern importieren. Junges Laub ist knapp nach der Entfaltung am produktivsten, bald folgt aber ein Abfall. Bei Gräsern sind einzelne Blätter überraschend kurz aktiv, die ältesten werden stets durch neue, leistungsfähigere ersetzt. Bei Laubbäumen ist das Einzelblatt die ganze Vegetationsperiode hindurch aktiv; bis zur vollen Leistungsfähigkeit dauert es vom Austrieb Mitte April bis ungefähr Mitte Juni. Ab Ende Juli sind bei Lichtblättern, ab Ende August auch bei Schattenblättern durch Alterungsvorgänge starke Abnahmen der Leistungsfähigkeit zu beobachten. Schon die Blätter der Einzelpflanze können um Licht konkurrieren. Manche, etwa die im Inneren von Baumkronen, erhalten nur gefiltertes Licht, das schon durch Blätter gegangen und daher in Intensität und Spektralverteilung verändert ist. Noch stärker ändert sich das Lichtklima im geschlossenen Bestand. Während die Photosynthese einer Pflanze im Bestand zurückgeht, ist die Gesamtproduktion der Fläche, auf der mehrere Pflanzen stehen, größer. Die entscheidende Größe ist hier der Blattflächenindex oder (englisch) leaf area index (LAI). Er gibt an, wieviele m2 Blattfläche bei senkrechter Projektion über einem m2 Bodenfläche stehen. Der LAI ist optimal für die Stofferzeugung, wenn die photosynthetisch aktive Strahlung beim Weg durch das Blätterdach möglichst vollständig ausgenützt wird, sodaß auch die untersten Blätter noch gerade positiv arbeiten. Das hängt vom Blattbau und der Blattstellung ab und ist in Nutzpflanzenbeständen bei einem Wert von 4 bis 8 der Fall. Wenn die Pflanzen weit auseinander stehen, leistet zwar die Einzelpflanze mehr, aber der lückige Bestand produziert insgesamt weniger. Wenn die Pflanzen zu nahe zusammenrücken und die Blätter einander zu oft überlappen, ist an den schattigsten Stellen das Licht zu knapp, um die CO 2 -Bilanz während der ganzen Zeit positiv zu halten. Der Flächenertrag sinkt dann ab. Der LAI ist selbst wieder stark abhängig von der Umwelt. Ich erinnere hier an 166 das Schema von HSIAO: Eine der ersten Wirkungen von mildem Wasserstress ist verringertes Streckungswachstum und damit eine Reduktion des Blattflächenindexes. Starker, langandauernder Streß, auch durch andere Faktoren, verringert den LAI stark. Nährstoffmangel, Kälte und Hitze, Luftverunreinigungen wirken stets unmittelbar auf die Ausbildung der Blattfläche und damit letzten Endes auf die Gesamtproduktion am Standort. Extreme Temperaturen Wir sahen, daß die Nettophotosynthese sehr temperaturabhängig ist. Das ergibt sich aus den Temperaturabhängigkeiten der Bruttophotosynthese und der Atmung, die im Bereich der physiologischen Temperaturen unterschiedlich verlaufen. Prinzipiell ähnliche Kurvenverläufe mit Minima, Optima und Maxima zeigen viele andere Stoffwechselprozesse, die komplexe Abfolgen unterschiedlicher Enzymreaktionen sind. Aus ihrer Überlagerung ergeben sich schließlich Unter- und Obergrenzen der Temperaturfestigkeit von Organismen. An einem Standort halten sich nur Arten, die dessen Temperaturextreme ertragen, also resistent sind. Die Grenzwerte sind aber sehr verschieden. Organismen kann man nach der tolerierten Temperatur einteilen, von den "kälteliebenden" Psychrophilen bis zu den extremem Thermophilen, durchwegs niederen Pflanzen in warmen Quellen und Geysiren. Auch deren Resistenzgrenze überschreiten noch viele lufttrockene Zellen, etwa Bakteriensporen (die daher nur durch Dampfsterilisation unter Druck vernichtet werden können) und Samen. Hitze Wir wenden uns zunächst der extremen Hitze zu. Akute, rasche Hitzeschäden beginnen auf der Ebene der Zelle. Wenn man die Temperatur im Experiment stark erhöht, sterben die Zellen rasch ab. Die Denaturierung von Proteinen im Plasma und den Membranen scheint hier die Hauptrolle zu spielen. Nähert man sich der Letalgrenze, dann werden verschiedene messbare Funktionen zunächst reversibel gestört, weil Enzyme rascher denaturiert als nachgebildet werden. Nach Absenken der Temperatur kann sich der Stoffwechsel aber wieder stabilisieren. Erst Überschreiten einer weiteren Schwelle macht die Störung irreversibel. Die einzelnen Grenzwerte sind sehr zeitab- 167 hängig: Wenn die Temperatur länger einwirkt, sinken sie ab. Die Behandlungsdauer muß daher im Experiment stets sorgfältig standardisiert werden. Wirkt Hitze als Auslesefaktor im Freiland? Das ist selten klar festzustellen, da hohe Temperaturen auch den Wasserhaushalt stören. Sie fördern ja die Verdunstung und damit den Verbrauch der Wasservorräte und die Reibung im Leitsystem. Im Freiland sieht man selten Schäden, die auf reine Hitzewirkung deuten. Das heißt aber nicht, daß alle Arten gleiche Resistenz haben. Die Arten eines Standortes sind vielmehr sehr gut an die wahrscheinlichen Höchsttemperaturen angepaßt. Die höchste Belastung für Pflanzen hängt nämlich kaum von der Lufttemperatur ab, die in unregelmäßigen Abständen von vielen Jahren Höchstwerte erreicht. Die Blätter werden vielmehr an klaren Tagen weit heißer als die Luft, sofern sie an offenen Standorten, also zum Beispiel an Süd- und Südosthängen, der Sonne exponiert sind. Da nun Strahlungstage sehr regelmäßig auftreten, sind Arten solcher Standorte Jahr für Jahr den typischen Hitzeextremen ausgesetzt. Es halten sich daher nur jene, die diese Temperaturen ertragen, also resistent sind. Für Landpflanzen der heimischen Flora liegt die Grenze des Hitzeschadens allgemein um 50 °C, bei Wasserpflanzen um 40 °C. Die Mechanismen der Hitzeresistenz zerfallen wieder in drei Gruppen: Hitzeresistenz Vermeidung Toleranz Restitution z.B durch Reflexion, durch Beständigkeit durch resistente Transmission, des Plasmas, besonders Knospen, Transpirationskühlung, der Enzyme Blattstellung Stockausschläge Tatsächlich zeigen Arten von Standorten mit starker Einstrahlung eine Kombination dieser Eigenschaften. Wenn man dagegen nicht angepasste Unterwuchsarten im Wald durch Schlägerung freistellt, kann man Schadsymptome sehen. Kälte Wenden wir uns nun der Kälteresistenz zu. Hier wird das Geschehen ziemlich komplex. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 168 Gefrierschädigung und Gefrierresistenz einerseits und negativen Folgen von tiefen Temperaturen, bei denen es nicht zur Eisbildung kommt, andererseits. Wir nennen das Verkühlungsschäden. Solche Effekte zwischen +10 °C und 0 °C kommen in der heimischen Flora nicht vor, finden sich aber bei Tropenpflanzen recht häufig. Bananen sollte man daher besser nicht in der Kühllade aufheben! Blühender Reis und blühendes Zuckerrohr werden sogar bei +15 °C geschädigt. Es handelt sich um Störungen im Enzymstoffwechsels und im Membranbau, die umso stärker werden, je länger die Pflanzen auf tiefer Temperatur bleiben. Alle heimischen Pflanzen sind gegen Verkühlung unempfindlich, man kann sie also längere Zeit knapp am Gefrierpunkt halten. Komplizierter wird es bei Temperaturen unter 0 °C. Zunächst sieht man, daß Minustemperaturen nur schädigen, wenn sich in den Geweben Eis bildet, wenn es also zum Gefrieren kommt. Wir können auf diesen Vorgang unser Resistenzschema anwenden: Gefrierresistenz 1. Vermeidung von Gefriervorgängen a) durch Gefrierpunkterniedrigung: fast überall b) durch Unterkühlung: im Holzparenchym bestimmter Bäume 2. Toleranz von Gefriervorgängen a) (intrazellulär): wird nicht toleriert b) extrazellulär: der wichtigste von allen Mechanismen 3. Restitution: wie immer durch Neuaustrieb Der physikalisch einfachste Fall von Vermeidung liegt dort vor, wo der Gefrierpunkt von Lösungen im Körperinneren unter den des reinen Wassers gesenkt wird. Diese Art der Gefriervermeidung haben selbst die empfindlichsten Arten. Eis ist stabil, wenn der Dampfdruck über der reinen, festen Phase gleich dem oder kleiner als der über der Lösung ist, also erstmals bei 0 °C. Gefrieren bei 0 °C gibt es theoretisch nur dann, wenn das Gesamt t gleich 0 ist. Wir wissen, daß das selten vorkommt. 169 Die Kompartimente des Pflanzenkörpers, wie Xylemsaft, Plasma und Vakuole, stehen im Dampfdruckgleichgewicht. Die Wasserpotentiale beginnen bei 0 bar und erreichen (wenn es der Pflanze sehr schlecht geht) die Werte für o am Turgorverlustpunkt. Dies ist ungefähr der Bereich der natürlich vorkommenden Potentiale, stärkere Austrocknung ist selten. Mit Ausnahme von Xerophyten und Halophyten (Salzpflanzen) bleiben die Werte meist über -50 bar, und t hängt über den Dampfdruck mit dem Gefrierpunkt zusammen. Und zwar entsprechen je 12 bar (= 1,2 MPa) negatives Potential einer Senkung des Gefrierpunktes um 1 °C. Ein Gesamtwasserpotential von -20 bar bedeutet also 1,7 °C Gefrierpunktsenkung, -50 bar = -4,2 °C. Eine hohe Zellsaftkonzentration kann also Schutz gegen leichte Bodenfröste bieten, aber sie ist keine Erklärung für die Winterfestigkeit ausdauernder Gewächse. Anders reagieren Samen, die nur wenig Wasser enthalten. Dieses wird fest gebunden und erreicht negative Potentiale von vielen hundert bar. Viele Samen können daher mit flüssigem Stickstoff lebend auf –196 oC tiefgekühlt werden. Der zweite Mechanismus der Gefriervermeidung heißt Unterkühlung. Keine Lösung beginnt bei Abkühlung genau am Gefrierpunkt zu frieren, es sei denn, man bringt von außen einen Eiskeim ein. Ohne diese „Impfung“ fällt die Temperatur viele Grad unter den Gefrierpunkt, bevor sich spontan Keime bilden und zu wachsen beginnen. LARCHER fand, daß die Blätter der Olive bei Eisbildung sofort absterben; im Freiland ertragen sie dennoch Temperaturen bis -10 °C, die es am Mittelmeer nur selten gibt, weil sich die kleinen Zellen sehr stark unterkühlen lassen. In der heimischen Flora ist die Unterkühlbarkeit im Körper mancher Bäume ganz lokal wichtig. Die kleinen Holzparenchymzellen dieser Arten kühlen sich bis rund -40 °C ohne spontane Eisbildung ab. Sobald freilich im Holzparenchym Eis entsteht, sind diese Bäume dem Tod geweiht. Nördlich der -40 °C-Isotherme wachsen nur Arten, bei denen die Resistenz im Holzparenchym auf andere Art erreicht wird, auf die gleiche, die bei den meisten lebenden Zellen eingesetzt wird. Diese andere Art ist ein Toleranzmechanismus, das extrazelluläre Gefrieren, bei dem in den Interzellularen Eis entsteht und die Zellen schrumpfen. Das Unterkühlen, das wir eben besprochen haben, kommt nur im Holz- 170 parenchym von Laubbäumen mit schwerem, hartem Holz vor (Eichen u.a.). Es scheint, daß steife Zellwände und fehlende Interzellularen hier den wichtigsten Toleranzmechanismus, das extrazelluläre Gefrieren, verhindern. Damit sind wir schon bei der Toleranz gegen Gefriervorgänge. Das Schema zeigt zwei theoretische Möglichkeiten, intrazelluläres und extrazelluläres Gefrieren. Eisbildung im Protoplasma oder der Vakuole ist nun absolut tödlich, die Zelle erträgt das nie. Toleranz bedeutet also, intrazelluläres Gefrieren zu vermeiden. Das Protoplasma ist so hoch organisiert und komplex strukturiert, daß Eisbildung ohne Zerstörung der Membranen, der Organellen oder des Grundplasmas gar nicht vorstellbar ist. Wenn einmal auch nur lokal das Plasma und seine Kompartimentierung geschädigt sind, dann töten Störungen und Fehlreaktionen im Stoffwechsel die Zelle rasch ab. Eisbildung beim extrazellulären Gefrieren tolerieren die Zellen verschieden. Zuerst bilden sich Eiskeime außerhalb des Plasmalemmas, meist in Interzellularen oder Gefäßen. Die Bildung dieser festen Phase stört das Gleichgewicht im Dampfdruck zwischen dem Zellinneren und der Umgebung, da der Dampfdruck über Eis geringer ist. Daher wandern Wassermoleküle zum Eiskörper und kondensieren dort, und zwar so lange, bis der Dampfdruck über der konzentrierteren Lösung auf den Wert über dem Eis gefallen ist. Sinkt die Temperatur weiter, wird auch der Vakuole und dem Protoplasma weiter Wasser entzogen. Der langsam wachsende Eiskristall kann nicht in das Protoplasma eindringen: Die Zellwand verhindert das sehr wirksam. Gefährlich ist also nur der Wasserverlust der Zelle, vor allem des Protoplasmas. Bis wohin toleriert das die Zelle, und was ist daran schädlich? Protoplasten können sich bis etwa zur Hälfte ihres Maximalvolumens kontrahieren, also bis in einen Bereich, wo Wasserverlust auch bei höherer Temperatur schadet. Als Ursache der Schädigung wird Verschiedenes diskutiert. Manche Autoren betonen biochemische Effekte der konzentrierten Salz- und Zuckerlösungen im entwässerten Protoplasma, andere meinen, daß vor allem die Kontraktion das entwässerte Plasma schädigt, das bei tiefen Temperaturen sehr spröde ist. Ich nehme an, daß beide Phänomene zur Schädigung beitragen. Das Plasma ist nicht immer gleich kälteempfindlich. Im Jahreszeitenklima beginnen im Herbst Abhärtungsvorgänge. Vorbedingung ist ein Ende des Wachstums, erst dann können die Zellen abgehärtet werden. Dazu werden 171 Membranen umgebaut, Zucker und niedermolekulare Verbindungen angereichert. Fallende Temperaturen beschleunigen die Härtung, Wärmeeinbrüche reduzieren sie oder heben sie ganz auf. Erst nach dem Ende der Frostresistenz beginnt erneut Wachstum. Die tiefsten Temperaturen, die im Winter ertragen werden, schwanken von Art zu Art. In Vollhärte sind viele ausdauernde Arten höherer Breiten so resistent, daß sie selbst flüssigen Stickstoff (-196 °C) überleben. Voraussetzung dafür ist langsame Temperatursenkung von weniger als 2 °C pro Stunde. Sonst hat das Wasser zu wenig Zeit, aus den Protoplasten zu den Eiskeimen zu diffundieren. Langsames Sinken der Temperatur ist aber im Freiland die Regel. Nicht ganz standortgerechte Arten können freilich in strengen Wintern geschädigt werden. Beim Einsatz von Zierpflanzen ist das zu berücksichigen. Nicht alle Pflanzenzellen sind gleich resistent. In Richtung fallender Resistenz folgen bei ausdauernden Pflanzen aufeinander: Xylem (tote Elemente); Kambium; Phloem; geschlossene Knospen; Xylemparenchym; Nadeln oder immergrüne Blätter; Wurzeln; offene vegetative Knospen; offene Blütenknospen; Pollen und junge Früchte; Griffel und Eizellen. Es ist also nicht verwunderlich, daß Spätfröste oft die Obstproduktion vernichten, ohne den Körper der Bäume zu schädigen. Ferner sind jene Gewebe am resistentesten, deren Ausfall die ärgsten Sekundärschäden zur Folge hätte. Die Winterkälte ist ein sehr wirksamer Auslesefaktor, der die Besiedlung der temperierten Zonen der Erde stark beeinflußt hat. Nur recht wenige tropische Pflanzengruppen entwickelten Resistenz und konnten nach Norden und Süden vordringen.