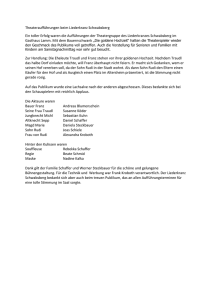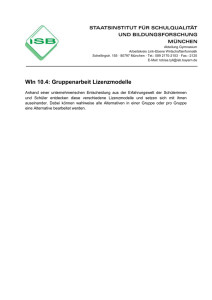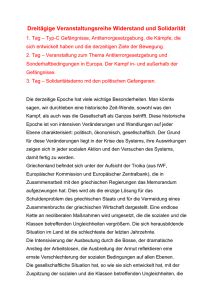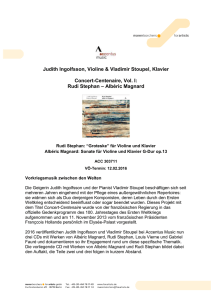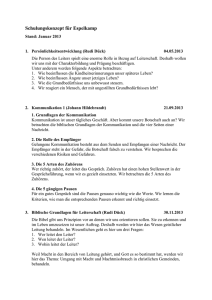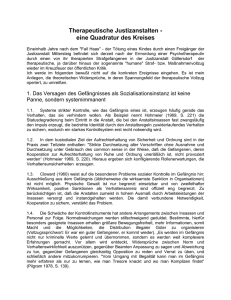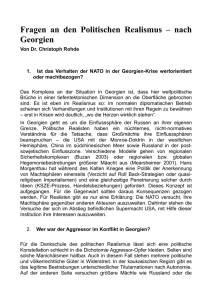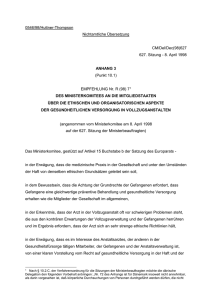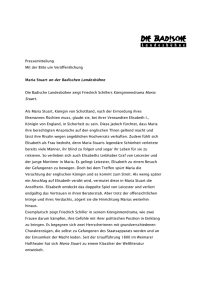Fritz Schuster (1859-1944), Erinnerungen aus meinem Leben
Werbung
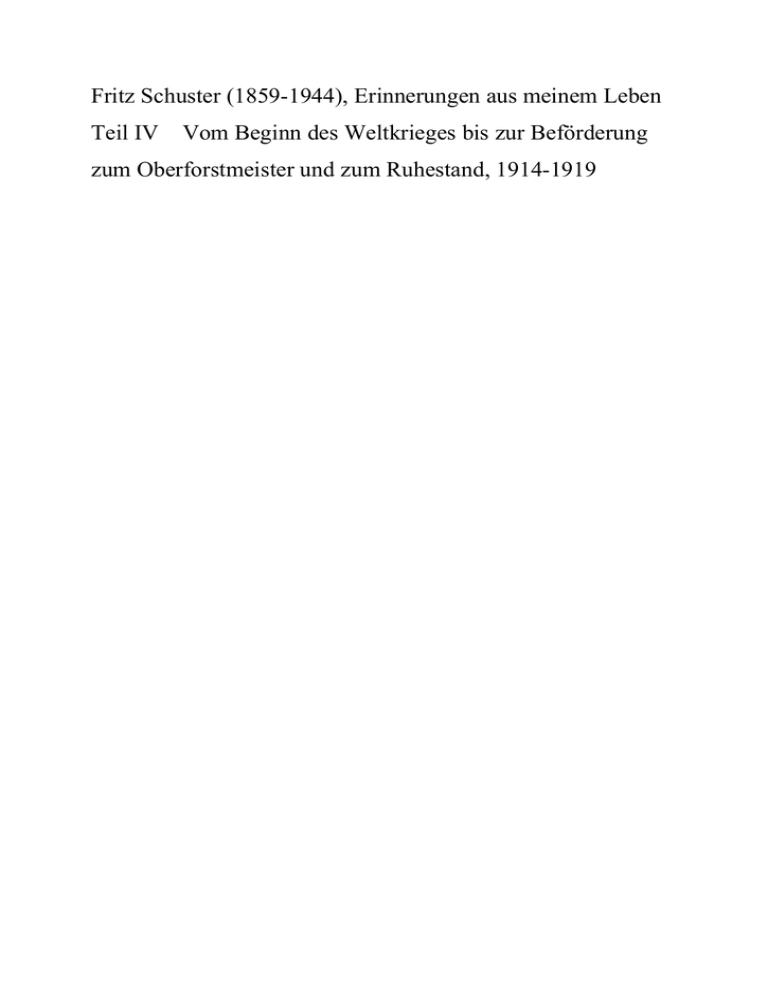
Fritz Schuster (1859-1944), Erinnerungen aus meinem Leben Teil IV Vom Beginn des Weltkrieges bis zur Beförderung zum Oberforstmeister und zum Ruhestand, 1914-1919 Der Weltkrieg Mitten in das friedliche und in voller Blüte stehende deutsche Wirtschaftsleben brach im August 1914 die Kriegsfackel verheerend und zerstörend ein. Der unheilvolle Weltkrieg, der sich über vier Jahre lang in einer früher unvorstellbaren Weise austobte, hat durch seine Wirkungen und Folgen so von Grund aus in unser aller Dasein eingegriffen, dass ich es mir nicht versagen darf, ihm hier ein ausführliches Kapitel zu widmen. Ich werde mich dabei aber auf meine eigenen Eindrücke und persönlichen Beobachtungen sowie auf die Kriegserlebnisse unserer beiden Söhne beschränken. Die ersten Anzeichen Schon lange vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten warf die Weltkrieg seine schwarzen Schatten voraus. Die drohenden Wolken des politischen Horizontes verdunkelten sich zu Beginn des zweiten Jahrzehntes unserer Jahrhunderts immer mehr. Das erste sichtbare Zeichen, dass die Kriegsgefahr in unmittelbare Nähe gerückt war, gab uns Brombergern der damals daselbst stationierte Divisionär Generalleutnant zur Linde, welcher in seiner Festrede, die er am 27. Januar 1913 bei Gelegenheit des Kaisers Geburtstagsessens im deutschen Kasino in Bromberg hielt, offen und geradeheraus schwere Kriegsbefürchtungen aussprach und eindringlich mahnte, sich des Ernstes der Lage bewusst zu bleiben. Ich erinnere mich, dass diese Rede auf mich, wie auf sämtliche Anwesende (es waren mehrere Hundert teilnehmende höhere Beamte, Offiziere u. hervorragende Vertreter der Wirtschaft und Finanz) einen sehr tiefen Eindruck gemacht hat. Die inneren Kriegsgründe Die inneren Kriegsgründe waren schon damals für jeden einsichtsvollen Deutschen klar und deutlich sichtbar. Frankreich verzehrte sich im unlöslichen Revanche- und Hassdurst gegen Deutschland für 1870/71, England erfüllte Konkurrenzneid und Eifersucht auf Deutschlands Aufstieg in der Weltwirtschaft, der dem britischen Krämergeist ernste Sorgen um seine Führerschaft bereitete. Russland stand vor innerer Revolution und suchte Ablenkung durch Krieg nach außen. So bereitete sich seit Jahr und Tag die verhängnisvolle politische Einkreisung Deutschlands vor. Die Hauptübeltäter dieser Politik waren der engl. König Edward der VII. und vor allem der franz. Ministerpräsident Poincaré, der sich zur Erreichung seiner verbrecherischen Ziele seines Komplizen, Clemenceaux, des gefürchteten ‘Tigres’ und der moskowitischen Handlanger, des russischen Außenministers Ssasanow sowie des russischen Botschafters in Paris, Iswolski, bediente. Wenn im Versailler Friedensvertrag die Kriegsschuld allein auf Deutschland abgewälzt wurde, und wenn die Feinde uns Deutsche unter drohender Gewalt zur schriftlichen Bejahung der Schuldfrage zwangen, so liegt darin eine über alle Begriffe niederträchtige und verbrecherische Irreleitung der Weltgeschichte, die förmlich nach Gerechtigkeit schreit. Die Nachwelt wird bestimmt anders urteilen, als es im Diktat- und Schmachfrieden von Versailles geschah. Kriegsausbruch und Kriegsvorbereitungen Am 1. August 1914 wurde abends die Kriegserklärung an Russland bekannt. Ich hatte für den Nachmittag eine Pirsch auf Rehbock in der Oberförsterei Schulitz vor und fuhr gegen 2 Uhr Nachmittags mit dem Zuge dahin. Bei der Abfahrt fiel mir schon auf, dass unser Hauptbahnhof wie ausgestorben da lag. Kaum ein Reisender war zu sehen, nur eine polnische Familie der besseren Stände Brombergs schleppte sich mit auffallend schwerem Handgepäck, worin sie anscheinend Gold, Silber und Wertsachen irgendwo auf dem Lande in Sicherheit bringen wollte. Ich zögerte erst, entschloss mich aber schließlich, die Fahrt anzutreten. In Schulitz war die Aufregung schon größer, und man munkelte schon von bevorstehendem Kriegszustand und plötzlicher Eisenbahnsperre. Der Vorsicht halber befragte ich den Bahnhofvorsteher, ob ich am selbigen Abend noch die Möglichkeit hätte, mit der Bahn nach Bromberg zurückzufahren. Er zuckte bedenklich die Achseln und sagte, dass bei Eintreffen einer Kriegsdepesche jeder Personenverkehr schlagartig sofort aufhöre. Ich ließ nun von meinem Vorhaben ab und wanderte die etwa 17 Km lange Strecke zu Fuß nach Bromberg zurück, wozu mich ein über alle Massen prächtiger, sonniger und warmer Frühherbsttag einlud. (Dies Prachtwetter beherrschte übrigens auch die Kriegstage der nächsten Wochen bis in den Oktober hinein.) Ich durchzog im gemächlichen Schritt das breite, im geologischen Urstrombette liegende Weichseltal, doch der Genuss an dem herrlichen Wetter und der Natur kam nur teilweise zur Geltung, denn die inneren Unruhen über die bevorstehenden schweren Ereignisse nahmen mich doch ganz in ihren Bann. Die nächste Sorge war natürlich, was wird mit unseren beiden Söhnen werden, die doch sofort in den Krieg ziehen müssen. Dann kamen wieder andere Gedanken, dass möglicherweise die Russen schon in den allernächsten Tagen dies schöne, fruchtbare und friedliche Weichseltal in wilden Horden plündernd, raubend und alles versengend überfallen würden. An einem kleinen Brückenübergang über die BrombergSchulitzer Chaussée sah ich bereits einen kleinen Trupp Pioniersoldaten, die unter Leitung eines Offiziers geheimnisvolle Arbeiten ausführten. Ich erfuhr, dass man vorsichtshalber die Sprengung der Brücke für den Fall eines plötzlichen Überfalls der Russen vorbereitete. Kurz vor Bromberg sauste ein Offizier in rasender Fahrt auf dem Rade an mir vorbei, er rief mir in aller Eile zu: ‘Weidmannsheil! Wissen Sie schon? Mobil!’ Nun war mir klar, dass die Entscheidung zum Kriege gefallen war. Als ich Bromberg erreichte, war die Aufregung und Spannung aufs Höchste gestiegen, ein Offizier in Ordonanzuniform zog mit zwei Trompetern von Straße zu Straße um den kaiserlichen Erlass über den Eintritt des Kriegszustandes zu verlesen und zu verkünden. Die nächsten Tage brachten nun eine völlige Umkehr vom gewohnten Leben. Alle militärpflichtigen Männer eilten zur Fahne, sie mussten in irgendeiner Weise ersetzt werden. Aber es war eine wahrhaft erhebende Tatsache, wie das ganze Volk in Deutschland trotz der vielen inneren Zwiespälte wie ein Mann aufstand, um unser geliebtes Vaterland gegen den äußeren Feind zu schützen. Bewundernswert war es auch, im Einzelnen zu beobachten, wie die Mobilmachung und Kriegvorbereitung am Schnürchen einem exakten Uhrwerk vergleichbar, verlief. Hierfür ein kleines selbst erlebtes Beispiel von tausenden. Bereits wenige Tage nach der Mobilmachung erschienen plötzlich aus allen Richtungen mehrere Tausend Waldarbeiter mit Säge und Axt in Bromberg, ihnen gesellten sich aus verschiedenen Regierungsbezirken über 30 Königl. Förster, desgleichen ca. ½ Dutzend. Königl. Oberförster als Betriebsleiter hinzu. Sie hatten die Aufgabe, die dem nördlichen Teil der Stadt unmittelbar vorgelagerten bewaldeten dünenartigen Anhöhen, die westlichen Ausläufer des ostpreußischen Mittelrückens, von den Waldbeständen der Oberförsterei Jagdschütz zu entblößen. Es geschah das, um eine durch das Gelände begünstigte Rückzugslinie mit freiem Schussfeld und mit vorbereiteten Schützengräben für dem Notfall herzurichten. Das erfolgte alles in Blitzeseile, und in kürzester Zeit waren Hunderte von Hektaren abgetrieben sowie Gräben mit Unterständen ausgebaut. Es war nicht schwer den Zweck dieser Maßnahmen zu erraten, sie sollten nämlich den Russen in einer ausgebauten Rückzugslinie den ersten Widerstand bieten, wenn sie von Hohensalza her ins Land einbrächen. Nun wussten wir, dass in einem solchen Kriegsfalle Bromberg den Russen preisgegeben war. In den nächsten Tagen vollzog sich bereits der Aufmarsch des deutschen Heeres an der russischen Front. Es begannen die Truppen- und Transportzüge auf der Hauptstrecke BerlinPetersburg, in der wir lagen, zu rollen, sie rollten und rollten acht Tage und ebenso viele Nächte in kürzest zulässigen Abständen hintereinander. Die Augustnächte waren warm, und wir schliefen bei offenen Fenstern, die nach Osten freien Raum vor sich hatten, sodass wir in der Nacht jeden Eisenbahnzug hören konnten. Das Rollen des einen Zuges ging fast unvermittelt in das des folgende über, so war es ein unaufhörliches Rollen in der Nacht, das sich meinem Gedächtnis so fest eingeprägt hat, dass ich heute noch, nach 22 Jahren, unwillkürlich mit meinen Gedanken zu jenen ersten Kriegsnächten zurückfliege, wenn in der Nacht das Brausen eines Zuges an mein Ohr dringt. Nach acht Tagen hörte das Rollen auf, es musste also einstweilen der Aufmarsch beendet sein. Schon am 3. und 4. August 1914 erschienen die ersten von unseren Grenztruppen gemachten russischen Gefangenen, die in Bromberg ausgeladen wurden. Es war ein kleiner Trupp von ca. 12 bis 15 Mann, die beim ersten Einbruch in Ostpreußen gefangen genommen wurden. Es waren sibirische und mongolischen Soldaten aus dem Inneren Asiens, das war ein deutliches Zeichen dafür, dass Russland schon lange den Krieg durch Zusammenziehen von Truppen tief aus dem Innern Russlands vorbereitet hatte, denn der Aufmarsch der Sibirer und Mongolen musste bei den mangelhaften russischen Verkehrsverhältnissen monatelang in Anspruch genommen haben. Ich sah die Gefangenengruppe zufällig vor dem Bahnhofsgebäude in Bromberg. Uns interessierte begreiflicherweise in erste Linie die Ostfront, weil wir bei einem Einfall der Russen doch in unserer persönlichen Sicherheit bedroht erschienen. Wir atmeten förmlich auf, als schon am 23/31. August 1914 Hindenburg und Ludendorf die Tannenbergschlacht siegreich schlugen und nicht weniger als über 90.000 Gefangene machen konnten. Nun rollten die Züge in rascher Folge in umgekehrter Richtung mit Gefangenen westwärts. Wie sich herausstellte, war auch meine frühere Oberförsterei Ruda und Umgebung von der Tannenbergschlacht in Mitleidenschaft gezogen. Während der Schlacht soll in dem Oberförstereigehöft in Ruda eine Zeit lang ein höherer russischer Stab gelegen haben. Dem Gute Guttowo – 20 Min. von Ruda entfernt – ist dabei sehr übel mitgespielt worden. Plündernde Soldateska haben sicherem Vernehmen nach das Gut nach allen Regeln der Kunst gebrandschatzt und das große Gutshaus mit den umfangreichen Wirtschaftsgebäuden dem Erdboden gleichgemacht. Mir liegt noch aus der Kriegszeit ein Zeitungsartikel eines Lokalberichterstatters aus dem Górznower Käseblättchen vor, der das fürchterliche Hausen der russischen Horden hinreichend illustriert. Es lautet wörtlich: Wie die Russen um Gorzno Krieg führten Es stürmten plötzlich etwa 40 russische Reiter im vollsten Galopp in das Städtchen Górzno (½ Stunde vom Oberförstergehöft Ruda entfernt) bis auf den Marktplatz. Dort machten sie halt. Alle Telegraphenstangen wurden umgehauen, dann plünderten sie das Warenhaus Caspar, die Waren schafften sie auf Górznoer Fuhrwerken über die Grenze. Post und Zollamt sind aufgelöst. Nachdem all dieses geschehen war, kam das Gros der Russen, ca. 4000 Mann russ. Kavallerie angesprengt, mit Feldküche und einigen Kanonen sowie sämtl. Bagage. Sie schlugen den Weg nach Radosk ein, bogen dann zu dem Weg nach der Oberförsterei Ruda ein, wo ebenfalls die Telegraphenstangen an der Chaussée abgehauen wurden und begaben sich nach Guttowo Gut. Dort loderten bald Feuersäulen auf. Unsere Radfahrerkompagnie begegnete dem Feind, wobei der Leutnant sein Leben verlor. Auf dem Rückwege stürmten etwa 40 Russen zu Pferde nach der Grenze über Górzno zurück. Das Gros der Russen ist auf Umwegen weitergezogen und soll sich in dem Forst um Guttowo und Górzno aufhalten.’ Waren wir in den ersten Monaten weit ab vom russischen Kriegschauplatz entfernt und hatten einen russischen Einfall in Bromberg weniger zu fürchten, so veränderte sich die Situation im Oktober 1914 für uns in bedenklicher Weise. Der Vormarsch Hindenburgs von Schlesien aus auf Warschau kam wegen der erdrückenden Masse russischer Truppen nicht recht vorwärts, so dass sich Hindenburg veranlasst sah, seine Streitkräfte von dort zurückzuziehen, sich umzugruppieren und den Angriff auf Warschau von Hohensalza aus zu verlegen. Das war Ende Oktober 1914. Zahlreiche deutsche Truppenmassen sahen wir nun mit allem Kriegsgerät und Tross, worunter sich merkwürdigerweise auch einige Kamele befanden, durch Bromberg in Richtung Hohensalza marschieren. Die Umgruppierung ging streng geheimnisvoll vor sich, doch merkten wir jetzt, dass uns der Kriegsschauplatz ernstlich näher rücken sollte. Wir wussten, dass sich geradezu erdrückende feindliche Truppenmassen in Polen und um Warschau befanden und waren darüber nicht in Zweifel, dass, wenn Hindenburg nicht siegreich vorging, wir in Bromberg vor den Russen nicht sicher blieben. Es brachen nun einige schwere und beunruhigende Wochen für meine Frau und mich an. Die Regierung hielt in dieser Zeit vorsorglicherweise für uns Beamte samt Familien am Hauptbahnhof in Bromberg einen Bergungszug unter Dampf, der uns im Falle der höchsten Not westwärts in Sicherheit bringen sollte. Es musste immerhin mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass wir aus irgendeinem Grunde den Anschluss an den Bergungszug verpassten. Es galt für diesen Fall noch einen andern Fluchtplan vorzusehen, der darin bestand, dass wir jeder einen Rucksack mit den notwendigsten Kleidungsstücken wochenlang bereitliegen hatten, um äußerstenfalls mit ihm auszurücken. Über das wohin war kein Zweifel, denn wir wussten, wie bereits erörtert, dass 20 Min. nördlich von Bromberg eine Rückzugslinie ausgebaut war. Hatten wir diese Linie erreicht, dann waren wir einstweilen geborgen und konnten uns mit Hilfe der vielen Forsthäuser meines Dienstbezirks landeinwärts weiter nach Norden retten. Glücklicherweise wurden wir der Sorge enthoben, denn der Armeeführer Mackensen warf am 10/13. November 1914 in der Schlacht von Wloczlawek (nur 32 Km von der preuß. Landesgrenze entfernt) die Russen siegreich zurück. In jenen Tagen lauschte ich ängstlich besorgt im Walde dem fernen Kanonendonner, den man deutlich nach russischer und deutscher Artillerie unterscheiden konnte, denn die russische Artillerie zählte in der Batterie mehr Geschütze als die deutsche, so dass man an den hintereinander abgegebenen Schüssen beurteilen konnte, wer schoss. Der Donner entfernte sich von Tag zu Tag mehr und mehr, woraus wir jedenfalls mit Genugtuung feststellen konnten, dass die Russen zum mindestens dem Drucke der Mackenzen’schen Armee weichen mussten. Meine persönliche Kriegsnotizen über unsere beiden Söhne Fritz und Rudi Fritz Seit dem 18. Juli 1915 hatte Fritz sein Kommando als Feldjäger bei der deutschen Südarmee, die damals neu aufgestellt wurde, inne. Das Oberkommando befand sich zuerst in Stryi, wurde jedoch bald darauf für längere Zeit nach Brzezany (Galizien) verlegt. Fritz wurmte es schon lange, dass seine Bemühungen, in die Kampffront versetzt zu werden, bisher vergeblich gewesen waren. Eine günstige Gelegenheit sollte ihn endlich zum Ziele führen. Damals trat ein Mangel an Fliegeroffizieren ein, infolge dessen ordnete das Kriegsministerium in Berlin an, dass etwaige Einstellungsanträge von Offizieren in die Fliegertruppe in keinem Falle abgelehnt werden dürften. So gelang es ihm, wenigstens als Flieger in die Kampffront zu kommen. Er wurde zu einem mehrwöchentlichen Schulungskursus nach Posen kommandiert und hatte dann das Glück, dass er als Beobachtungsflieger in die Fliegerabteilung des Oberkommandos der deutschen Südarmee in Brzezany, mit der er schon als Feldjäger die freundschaftlichen Beziehungen gepflegt hatte, versetzt wurde. Zahlreiche Kriegserkundungsflüge hat er mit seinem Flugzeugführer Bachem aus Köln ins feindliche Russland gemacht. Bei einem Fluge wurden sie von der Dunkelheit überrascht, verloren die Orientierung und irrten in der Luft umher, bis sie endlich am fernen Horizont ein Blinkfeuer von Lemberg aufblitzen sahen und glücklich landeten zur Beruhigung der ganzen Fliegerabteilung, die sich schon ernste Sorgen über ihren Verbleib gemacht hatte. Ein anderer Erkundungsflug sollte einen weitaus gefährlicheren Verlauf nehmen. Fritz hatte den Auftrag, weit hinter der russischen Front auf den Etappenstraßen, Eisenbahnen und Bahnhöfen den Nachschub des russischen Heeres festzustellen. Hierbei überraschten ihn zwei französische Kampfflugzeuge, die die russische Fliegerei unterstützen mussten. Sie suchten ihm den Rückzug abzuschneiden und nahmen sein Flugzeug unter heftiges Kreuzfeuer. Wie sich nach der Landung herausstellte, hatte es an die 30 Kugeleinschläge. Fritz selbst erhielt einen Streifschuss am Kopf, der sich glücklicherweise nicht als lebensgefährlich erwies. Die Flugkraft seines Flugzeuges verminderte sich zusehends, es gelang ihnen jedoch noch, in geringer Höhe von etwa 100 m. die russischen Gräben zu überfliegen und hinter einer Bodenwelle in unseren Linien zu landen. Letzteres bedeutete noch ein besonderes Glück, denn, wie später bekannt wurde, hatte die russische Artillerie bereits Anstalten getroffen, das Flugzeug beim Landen mit Granaten zuzudecken, was aber durch die verlorene Einsicht des Landungsplatzes verhindert wurde. Ein eigentümlicher Zufall fügte es, dass die beiden französische Flieger nicht lange darauf in deutsche Gefangenschaft gerieten und zunächst bei der Fliegerabteilung in Brzezany in kameradschaftlicher Weise aufgenommen wurden. (In der Fliegerei hat im Weltkriege zwischen den gegnerischen Fliegern außerhalb des Kampfes eine vorbildliche, mustergültige und gegenseitig sich achtende Kameradschaft bestanden.) Die Wiederherstellung von Fritz ließ nicht lange auf sich warten, doch mit dem Flugdienst war es vorbei. In der Folgezeit wurde er wieder als Feldjäger zum Kurierdienst in Berlin beordert. Von seinen zahlreichen Kurierreisen, welche nun wieder einsetzten, sind zwei erwähnenswert. Die eine ging nach dem Friedensschluss mit Russland vom 3. März 1918 nach Moskau, wo kurz nachher der deutsche Botschafter und an seiner Seite ein Feldjäger einem Bombenanschlag zum Opfer fielen. Die Reise war nicht ungefährlich, denn in Russland und besonders in der Ukraine wüteten innere Kämpfe und Plünderungen. Zu seinem persönlichen Schutze waren ihm deshalb zwei handfeste Gardisten mitgegeben worden. Auf der Durchreise konnten wir ihn in Bromberg am Bahnhof kurz sehen und sprechen, und ihm zur Stärkung auf der langen Reise eine Pulle Rotwein sowie einige kalte ‘Kartoffelplätzchkes’, welche er sehr liebte, in die Hand drucken. Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle. Eine andere Kurierreise hatte Finnland zum Ziel. Als sich Finnland von Russland losgelöst und am 7. März 1918 mit Deutschland Frieden geschlossen hatte, bildete sich die neue finnische Regierung mit Hilfe von Deutschland in Helsingfors am finnischen Meerbusen. Erst ging's nach Stockholm. Die Durchquerung der Ostsee nach Helsingfors war wegen der Minen, und weil die Fahrt durch die Kriegszone führte, ausgeschlossen. Es blieb nichts Anderes übrig, als von Stockholm aus zu Lande Helsingfors zu erreichen. Er musste einen weiten Bogen um den ganzen Bottnischen Meerbusen bis zum Norden hinauf nach Haparanda machen, von da ging's per Schlitten quer durch Finnland dem Reiseziel zu. Die Fahrt dauerte eine ganze Reihe von Tagen, aber Fritz war des Lobes voll über die finnländische Bevölkerung, deren Gastfreundschaft und ebenso deutschfreundliche Einstellung über jeden Tadel erhoben war. Kurz vor dem unglücklichen Ausgang des Krieges hatte Fritz das große Vergnügen als Feldjäger der deutschen Botschaft im Haag zugeteilt zu werden. Das Kommando dauerte mehrere Wochen. Fritz hatte sich inzwischen mit Mathilde Bonse, der Tochter meines Jugendfreundes und Kollegen Forstmeisters Rud. Bonse in Altplacht, Reg.Bez. Potsdam, verlobt. Alex und Cilli luden während des Haager Kommandos seine Braut zu sich nach Herzogenbusch ein und konnten damit auch die häufige Anwesenheit Fritzens genießen. Aber die deutsche Revolution machte dem Kommando ein vorzeitiges Ende. Fritz nahm nun seine Forststudien nach vierjähriger Unterbrechung wieder auf. Rudi Seine Beschäftigung in Le Havre an Bord der Phryné seit Ende 1915 war nicht von langer Dauer, denn bald schickte man ihn als Aufseher von deutschen Gefangenen in die Schlachthäuser von Rouen, aber auch hier war seines Bleibens nicht lange. Die franz. Regierung machte damals der Deutschen den Vorwurf, dass sie auch die gefangenen Sousoffiziere werktätig beschäftigte. Als Regressivmaßnahmen stellte daraufhin Frankreich sogenannte Vergeltungslager zusammen, in denen nur Unteroffiziere, Sergeanten, Vizefeldwebel und Vizewachtmeister sowie Offiziersstellvertreter zur Arbeit herangezogen wurden. Auch Rudi blühte als Vizewachtmeister dieses Missgeschick. Sein Vergeltungslager wurde nach dem südöstlichen Frankreich verlegt. Nun führte ihn die mehrtägige Eisenbahnfahrt von Rouen quer durch Frankreich nach Marseille und zwar in abgeblendeten Viehwagen, damit nur ja die Gefangenen nicht die Reize einer Fahrt durch fremdes Land genössen. Nach etwa acht-tägigem Aufenthalt in Marseille wurde das Lager nach Serre bei Carpentras (Vaucluse) unweit Avignon verlegt, wo die Gefangenen mit Weinbergsarbeiten beschäftigt wurden. Rudi urteilte über die Aufenthalt nicht ungünstig, er fühlte sich hier wohler als in den früheren Lagern, weil sie viel in der freien Natur, die in dortiger Gegend besonders reizvoll war, sich betätigen mussten. Mittlerweile war das Jahr 1918 herangebrochen und näherte sich der unglückliche Ausgang des Krieges. Schon vor dem Abschluss des Versailler Diktats schickte sich die franz. Regierung an, die deutschen Gefangenen unweit der deutschen Grenze in größeren Lagern zusammenzuziehen. Das erweckte mit vollem Recht in den Gefangenen das Gefühl, dass nun die Stunde der Erlösung aus der Not gekommen sei. Auf franz. Seite tat man alles um sie in dieser Erwartung zu stärken, aber sie sollten um eine der schwerste Enttäuschungen reicher werden. Der Schandfrieden von Versailles war von der deutschen Regierung unter unerhörtem Druck am 28. Juni 1919 unterzeichnet worden und damit in Kraft getreten. Während Frankreich daraufhin unter Androhung schärfster Maßnahmen in kürzester Frist – es waren wohl kaum 14 Tage – die Auslieferung auch des letzten franz. Gefangenen von Deutschland forderte, dachte es selbst nicht im Mindesten daran, den Austausch der Gefangenen irgendwie zu beschleunigen, im Gegenteil suchte es ihn in geradezu teuflichster Art nach Möglichkeit in die Länge zu ziehen. Die letzen deutschen Gefangenen, zu denen auch leider Rudi gehörte, musste ¾ Jahr und mehr nach dem Friedensschluss auf Erlosung warten. Rudi bezeichnete diese Wartezeit als die qualvollste, weil die Sehnsucht nach endlicher Befreiung von Tag zu Tag wuchs, und von Tag zu Tag die Hoffnung auf den folgenden vertröstet werden musste. In geradezu sadistischer Weise haben die Franzosen in ihrem unauslöschbaren Hass gegen Deutschland sich auch der bemitleidenswerten Gefangenen bedient. Es war das eine der vielen Gemeinheiten, die in der Weltgeschichte wirklich ihres Gleichen sucht. Endlich schlug auch für Rudi die Befreiungsstunde. Am 2. März 1920 wurde er im Durchgangslager Eglosheim (Baden) ausgeliefert. Am 30. April 1920 wurde er mit dem eisernen Kreuz 2 Cl. dekoriert. Am 4. Augustus 1920 erhielt er das Verwundetenabzeichen in ‘schwarz’. Am 8. Juni 1922 wurde ihm der Charakter als Leutnant verliehen, und am 30. April 1935 Verleihung des Ehrenskreuzes für Frontkämpfer. Inzwischen waren die Polen im Januar 1920 in Bromberg eingerückt und damit stand fast die ganze Provinz Posen unter polnischer Staatshoheit. Die Entwicklung des polnischen Werdeganges war noch in vollem Fluss, man musste jeden Augenblick befürchten, dass Rudis Einreise nach Polen auf unüberwindbare Schwierigkeiten stoßen würde. Vorsichtshalber hatten wir deshalb sämtliche Zivilsachen für Rudi an meine Schwester, Maria Sauter, in Dessau geschickt, wohin sich Rudi auf unsere Verabredung nach seiner Heimkehr zuerst wenden sollte. So geschah es und da die Einreise nach Bromberg derzeit möglich war, konnten wir ihn einige Tage nach seiner Auslieferung wohlbehalten bei uns begrüßen. Die Freude des Widersehens war beiderseits sehr groß, aber leider nur von kurzer Dauer, denn in den nächsten Tagen kündigten die poln. Zeitungen in Bromberg an, dass die poln. Regierung beabsichtige, in Kürze alle militärtauglichen jungen Leute ins Heer einzustellen. Das war für ihn nach den 4½ Jahren trüber Gefangenschaft zu viel. Der Gedanke, für Polen Militärdienste zu leisten und womöglich gegen Deutschland kämpfen zu sollen, war so unerträglich für ihn, dass er sich schweren Herzens entschloss, schon nach wenigen Tagen in aller Eile wieder auszurücken und unverzüglich sein Hochschulstudien in Darmstadt wieder aufzunehmen. Ich begleitete ihn bis Berlin, wo ich mit unserem Schwiegersohn Indemans, welcher im Auftrage des holländischen Gelben Kreuzes einen Eisenbahnzug mit Lebensmitteln für die ungarische Regierung nach Budapest geleitet hatte, auf der Rückreise nach Holland zusammentreffen wollte. In dieser Zeit fiel der ‘Kapp-Putsch’ der am 13. März 1920 ausbrach. Über Berlin wurde deshalb die Eisenbahnsperre gelegt. Die Regierung ließ mehrere Tage keinen Zug nach Berlin herein. Zufällig hatten Rudi und ich das Glück, mit dem ersten D-Zug, der wieder fuhr, nach Berlin hereinzukommen. Wir trafen gegen 10 Uhr abends auf Bahnhof Friedrichstraße ein. Berlin lag vollständig im Dunkeln, und als wir unser Hotel Westfälischer Hof am Bahnhof betraten, war auch hier – auf polizeiliche Anordnung! – jedes elektrische Licht gelöscht, und alle Hotelräume in kümmerlichster Weise durch Kerzen erleuchtet. Wir wollten noch ein Glas Bier draußen trinken und als wir uns dazu anschickten, warnte uns der Hotelportier eindringlich nicht in das Stadtinnere zu gehen, weil man für die Nacht größere Unruhen befürchtete und Schiessereien erwarte. Wir begnügten uns deshalb damit im Wartesaal des Bahnhofs noch ein Stündchen zusammen zu sitzen. In aller Frühe des anderen Morgen setzte Rudi seine Reise nach Darmstadt fort. Ich fuhr nach Bromberg zurück, da unser Schwiegersohn weder eintraf, noch Nachrichten geschickt hatte, vielmehr war er wegen der unterbrochenen Bahnverbindungen durch Deutschland mit seinem holl. Komitee gezwungen, etwa vier Wochen in Budapest zu verbleiben, wo die Holländer wegen ihrer großen Wohltätigkeit gegen das ungarische Volk von den Prominenten der ungarischen Staatsregierung, an der Spitze der Staatsverweser Horthy, sehr gefeiert wurden und später interessante Erlebnisse zu verzeichnen hatten. Hier seien noch einige Bemerkungen eingeschaltet über die bösen Erfahrungen Rudi’s in der Gefangenschaft. Als er heimkehrte, war er gegen früher auffallend still und in sich gekehrt, er hatte gar keine Neigung, viel zu erzählen von seinen Erlebnissen in Frankreich, anscheinend war er von Allem so tief beeindruckt, dass ihn eine gewisse Melancholie ergriffen hatte. Infolgedessen mussten wir unsere begreifliche spannende Neugier und Interesse zügeln und vermieden es, ihn durch Ausfragen zu belästigen. Es war für seine seelische Verfassung ungemein günstig, dass er sich sofort in sein Studium vertiefte und gerade nach Darmstadt zurückging, wo er in seinem Corps Hassia und im Kreise seiner alten Bekannten aufgemuntert wurde. Erst nach Jahr und Tag gewann er seinen Gleichmut wieder, so erfuhren wir erst allmählich folgende Einzelheiten über seine Gefangenschaft und seine Behandlung in der Gefangenschaft. Die zweite Champagneschlacht, die ihm zum Verhängnis wurde, war einer der Hauptversuche der Franzosen und Engländer, die Entscheidung des Krieges mit bis dahin nicht dagewesenem Aufwand an Truppen und Artillerie herbeizuführen. Das missglückte zwar, aber der Feind konnte doch die Frontstrecke bei Perthes-Tahure, wo Rudi stand, um mehrere Kilometer eindrücken. Rudi befand sich als Artilleriebeobachter im vordersten Schützengraben, als sie am 25. September 1915 überrannt und gefangen genommen wurden. Der Anprall war so stark, dass sogar sein ganzes Regiment, deren Geschütze doch einige Kilometer hinter den Schützengräben standen, samt und sonders mit allem Zubehör in Gefangenschaft geriet. Bei der Gefangennahme wurde ihnen von den Franzosen befohlen, zunächst landeinwärts zu laufen, wo sie dann weiter hinten gesammelt würden. Gleich darauf sollte er Zeuge eines ganz unerhörten Vorfalles werden, dessen sich ein höherer französischer Offizier schuldig machte. Neben Rudi lief ein blutjunger Fähnrich von der Infanterie, ein französischer Offizier kommt ihnen zu Pferd entgegen und stellt an den Fähnrich eine Frage in französisch, die er nicht verstand, und auf die er infolgedessen keine Antwort geben konnte. Ohne sich zu besinnen, zieht der französischer Offizier seinen Revolver, schießt ihn über den Haufen und reitet befriedigt weiter. Kann man sich eine wahnsinnigere Kriegspsychose denken? Die Gefangenen wurden zunächst in einem engen, mit Stacheldraht umzäunten Raum auf offenem Felde zusammengepfercht und dort 24 Stunden belassen, ohne das ihnen Gelegenheit gegeben war, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. In welchem Zustand sich schließlich die armen Gefangenen befanden, kann sich jeder selbst ausmalen. Hass, tierische Wut und Revanche, dass sind drei Begriffe, die den Franzosen gegen die deutsche Nation in höchster Potenz eigen sind. Aus den geringsten Anlässen erhielten die Gefangenen ‘prison’ bei Wasser und Brot. Mit Vorliebe bestraften sie dieselben in echt sadistischer Art, indem die aus der Heimat geschickten Päckchen oder Pakete vor den Augen der Empfänger geöffnet, der Inhalt ungenießbar gemacht – z.B. Tabak wurde mit Zucker oder Salz bestreut – und in diesem Zustand den Gefangenen ausgehändigt wurden. Rudi wurde öfters zum Fouragieren in die Stadt geschickt, selbstverständlich unter strenger Bewachung. Hierbei konnte er feststellen, wie tief der Hass bei der ganzen Bevölkerung eingefleischt war. Selbst fein gekleidete Damen entblödeten sich nicht, den Gefangenen die Zunge auszustrecken, sie anzuspucken und ihnen Schimpfworte zuzurufen. Am niederdrückendsten empfand aber Rudi, dass selbst die kleinen Kinder vor ihnen scheu im weiten Bogen auswichen, als wenn sie sich vor einem wilden Tier fürchteten. Die Zeit der Gefangenschaft wurde übrigens nicht ganz nutzlos verbracht. Die akademischen Kreise schlossen sich in den einzelnen Lagern zusammen, organisierten alle möglichen Schulungskurse, veranstalteten fachliche und allgemeine wissenschaftliche Vorträge und brachten so eine willkommene Ablenkung und Abwechslung in die düstere Atmosphäre der Gefangenschaft. Zeitweise genoss Rudi noch allerlei kleine Vergünstigungen dadurch, dass er dem franz. Lagerkommandanten als Dolmetscher und Rechnungsführer diente, wofür ihm eine besonderer Arbeitsraum und eine abgesonderte Lagerstätte und Abendbeleuchtung zugute kam. Einen einzigen franz. Lageroffizier hat Rudi in den 4½ Jahren der Gefangenschaft bei dem häufigen Lagerwechsel erlebt, von dem er wegen seines Verhaltens zu den Gefangenen des Lobes voll war, weil er sich in mustergültiger Weise durch menschenfreundliche und wohlwollende Behandlung der seiner Obhut anvertrauten Kriegsgefangenen auszeichnete. Woher der weiße Rabe? Die Erklärung lag nicht fern, denn der Besagte hatte einige Jahre in deutscher Gefangenschaft zubringen müssen, wo ihm am eigenen Körper zum Bewusstsein gekommen war, dass man Kriegsgefangene nicht als Feinde peinigen, sonder als hilflose Menschen behandeln sollte. Noch ein Wort über die Latrinenverhältnisse in den Gefangenenlagern, welche nach Rudi’s Angaben jeder Beschreibung spotteten. In dem Schlafraum, wo Hunderte von Gefangenen schliefen, war eine offene Tonne zur Aufnahme aller Fäkalien aufgestellt. Pfui Teufel kann man da nur sagen! Aber der Franzose, der sich so gern als ‘grande nation’ brüstet und sich als erster Kulturträger spreizt, nimmt ganz bestimmt nicht in Sachen körperlicher Reinheit und in sanitärer sowie hygienischer Beziehung unter den europäischen Völkern den ersten Platz ein. Es sei hier nur daran erinnert, dass selbst in den vornehmsten franz. Schlössern damals die Aborte nicht einmal eine Sitzgelegenheit sonder als Ersatz dafür nur eine eiserne Stange aufwiesen. Unsere Reisen während des Krieges nach Holland Im Laufe des Krieges besuchten wir fast jedes Jahr unsere Kinder Cilli und Alex in Holland. Zu Kriegsbeginn schloss sich Holland hermetisch gegen Deutschland ab, jeder Personen- und Postverkehr war wochenlang unterbrochen, und man kann sich die Sorgen vorstellen, die sich Cilli in jener Zeit um uns machte, wenn sie in den holländischen Zeitungen von dem Einfall der Russen im Osten las. Allmählich kam der Verkehr wieder in Gang, aber die Grenzrevisionen waren wenig angenehmer Natur. Männlein und Weiblein mussten sich ausnahmslos in Isolierzellen wegen etwaiger Spionagedienste am Körper untersuchen lassen. Man untersuchte den Tascheninhalt und tastete den Körper nach allen Richtungen ab. Verdächtige Personen mussten sich ganz ausziehen und wurden von Kopf bis zu den Füssen peinlichst untersucht. Die Spionage ist aber auch in tollster Weise betrieben worden, worüber man an der Grenze die sonderbarste Dinge hörte. Da sollen sich auffallend umfangreiche weibliche Busen als Schlupfwinkel für Brieftauben entpuppt haben. Die Mitnahme von Zeitungen, Drucksachen, Briefschaften war strengstens untersagt, selbst Visitenkarten nahm man uns ab, und als meine Frau einmal einen Hut in einer Tüte mitnahm, musste letztere auch zurückgelassen werden, weil auf ihr der Name der Hutfirma gedruckt war. Die Spione bedienten sich der pfiffigsten Kniffe, um Nachrichten dem Feinde zuzutragen. Briefe beförderten sie zwischen den Schuhsolen, ja sie ließen sich auf den bloßen Körper, auf Brust oder Rücken, Nachrichten mit unsichtbare Tinte schreiben, die dann am Ziel mit chemischen Stoffen leserlich gemacht wurden. Holland mobilisierte sofort die Armee und warf längs der deutschen Grenze Schützengräbern aus, die während des ganzen Krieges besetzt blieben, so dass auch Holland finanziell durch den Weltkrieg schwer zu leiden gehabt hat. Volk und Staat haben von jeher das größte Misstrauen gehegt, dass Deutschland bei der ersten Gelegenheit das Ländchen annektieren würde, woraus wohl die übertriebene Vorsicht zu verstehen ist, wenngleich die vom deutschen Standpunkt keine Berechtigung hatte, denn Deutschland hat nie diese Absicht gehabt, schon weil es ein politischer Missgriff ohne gleichen wäre. Bei unserem Aufenthalt daselbst merkten wir deutlich zwei getrennte Lager, die der pro- und antideutschen, die sich ab und zu recht kräftig in die Haare gerieten. England suchte die holländische Wirtschaft mit brutalster Macht zu terrorisieren, schuf eine Organisation, die NOT, die einen Zusammenschluss des Handels bezweckte, welche jegliche Geschäftsverbindung mit dem deutschen Handel boykottieren musste. Alle Firmen, die mit Deutschland Handel trieben, kamen auf die schwarze Liste und wurden aufs schärfste bekämpft. Echt englischer imperialistischer Krämergeist! Ganz Holland wimmelte von britischen Spionen und Aufpassern. Eines Abends saß ich in ’s-Bosch mit meinem Schwager Karl Lamers und einigen Bekannten im Bierrestaurant Lohengrin. Wir unterhielten uns natürlich über die Kriegslage und als ich über die Franzosen und Engländer herfiel, raunte mir mein Schwager geheimnisvoll ins Ohr: ‘Vorsicht, am Nebentisch sitzt ein englischer Spion, der aufmerksam unserer Unterhaltung zuhört.’ Persönlichen deutschfeindlichen Verunglimpfungen sind wir in Holland kaum ausgesetzt gewesen. Nur eines Nachmittags begegnete meiner Frau, Tochter und mir in einer engen Gasse ein Belgier, der, als er uns deutsch sprechen hörte, sich nach uns umdrehte und wutschnaubend rief: ‘boches, boches!’ Aber die Strafe folgte auf dem Fuße nach, denn in seiner Wut lief er gegen ein Baugerüst, so dass ihm der Hut vom Kopf flog. Unser Schwiegersohn gab ihn in einem humoristischen Zeitungsartikel der öffentlichen Lächerlichkeit preis. Durch das schnelle Vorrücken unserer Truppen in Belgien waren tausende belg. Familien mit Kind und Kegel nach Holland geflüchtet, wo sie in großzügigster und menschenfreundlichster Weise Aufnahme fanden. Sie brachten allerlei Kriegsgreuelmärchen über die deutschen Soldaten mit. Da sollten die ‘boches’ als wilde Hunnen und Barbaren bei ihnen zu Hause gewütet haben, sie hätten sich an den Burgundervorräten der Belgier sinnlos betrunken und dann ein förmliches Blutbad unter der wehrlosen Bevölkerung angerichtet, Greise, kleine Kinder und wehrlose Frauen hin ermordet oder auf grauenhafte Weise durch Abschneiden von Nase und Ohren, Herausreißen der Zunge und Ähnliches verstümmelt und ihre Behausungen niedergebrannt. Die Leutchen verschwiegen aber sorgsam, dass sie und ihre Frauen die kämpfenden deutschen Truppen aus dem Hinterhalt beschossen oder mit heißem Wasser und Öl begossen und davon nicht abließen, trotzdem die deutsche Heeresleitung schärfste Maßnahme ankündigte, wenn die Zivilbevölkerung sich irgendwie weiter am Kampf beteilige. Die Greuelmärchen fanden anfangs bei den Holländern viel Glauben und erweckte im ganzen Volke größte Empörung, die aber nicht lange andauerte, denn die Wahrheit kam schließlich doch ans Licht, ja die Empörung wandte sich bald gegen die belg. Flüchtlinge, welche in ihren Ansprüchen keine Grenzen kannten und noch nicht einmal ein Wort des Dankens beim Abschied fanden, wo sie wochen- und monatelang auf Kosten der Holländer gelebt hatten. Ich habe selbst gesehen, wie anmaßend belgische Jünglinge sich auf den Straßen und Promenaden der Stadt betrugen. Sie fuhren in großen Trupps auf ihre Rädern in rasender Fahrt dahin, und wer nicht zeitig auswich oder zur Seite sprang, kam in Gefahr, angerempelt zu werden. Zum Ärger der Holländer beherrschten sie Straße und Verkehr. Ich fand ihr Benehmen als geduldete Gäste im fremden Land auf Höchste ungebührlich. Zustände im Innern während des Krieges Als der Weltkrieg sich in die Länge zog, trat in Deutschland eine Verknappung von Lebensmitteln und lebensnotwendigen Stoffen ein, die sich im Laufe des Zeit katastrophal auswirkte. Alle Nahrungsmittel wurden rationiert, d.h. es wurden von der Regierung Brot-, Butter-, Fett-, Fleisch-, Mehl-, Milch-, Kartoffel- etc. Karten ausgegeben, die für einen bestimmten Zeitraum bestimmte Mengen pro Kopf oder Haushalt verzeichneten. Nur unter Angabe solcher Karten durften die Geschäfte bei Vermeidung hoher Strafen die betreffenden Nahrungsmittel verabreichen. Das Jahr 1917 stand vornehmlich im Zeichen dieser Verknappung. Aus dieser Zeit liegen mir noch verschiedene Karten vor. Nach meinen Kriegsnotizen gestaltete sich die Rationierung der Lebensmittel in Deutschland im Frühjahr 1917 wie folgt: 250 gr. Fleisch pro Kopf und Woche, 4/7 Pfd. Kartoffeln pro Kopf täglich, 60 gr. Butter pro Kopf und Woche, 750 gr. Zucker pro Kopf und Monat. Man kann sich vorstellen, wie die gesamte Bevölkerung die Lebensmittelgeschäfte bestürmte, um die winzigen Mengen auf ihren Karten zu erhaschen. In langen Schlangen standen sie ‘Polonaise’ auf der Straße in Wind und Wetter und mussten stundenlang warten, ehe sie an die Reihe kamen. Hausfrauen wissen ein böses Lied davon zu singen. Jede Kulanz war verschwunden, denn die Kaufleute brauchten sich ja nicht um die Gunst des Publikums zu bemühen, da sie ja um den Absatz ihrer Vorräte keine Sorgen hatten. Die Damen wurden angeschnauzt wie die Rekruten auf dem Kasernenhof. Besonders taten sich darin die Fleischer hervor, die ja auch den stärksten Ansturm auszuhalten hatten. Es war naheliegend, dass die Bevölkerung auf alle denkbare Arte und auf Umwegen versuchte, sich zu versorgen. Auf dem Lande war die Not weniger groß, bei den Bauern und kleinen Landwirten war noch allerlei zu haben, was durch Geld und gute Worte losgeeist werden konnte, wie z.B. Eier, Milch, Butter, Speck, Würste usw. Man schloss Freundschaften mit solchen Leuten und knüpfte, wie man sich damals ausdrückte, ‘Konnexionen nach unten’ an. Solche Streifzüge aufs Land suchte die hohe Obrigkeit natürlich nach Möglichkeit zu unterbinden. Gendarmen patrouillierten auf Landstraßen, an den städtischen Einfallstoren, in den Eisenbahnzügen und interessierten sich besonders für prallgefüllte Rucksäcke, und manches Pfund Butter oder dergl. verfiel zum Ärger der eifrigen Sammler der Beschlagnahme. Anerkennend muss ich hier hervorheben, dass die mir unterstellten Förster viel dazu beigetragen haben, unsere Notlage in der Stadt zu erleichtern. Wie groß letztere war, möge man zum Illustration daraus ersehen, dass meine Frau lange Zeit mehrmals in der Woche einen Marsch von 1½ Stunden zurücklegte um etwa zwei Liter Milch heimzubringen. Die schlimmste Zeit nannte man die ‘Wrucken- oder Steckrübenzeit’, es war damals die einzige landwirtschaftliche Frucht, die noch zu haben war, und alle Gerichte waren auf Wrucken abgestellt. Man bezeichnete auch jene Periode als die ‘Marmeladenzeit’. Wegen Mangel an Butter und Fett wurde der größte Teil der Obsternte zu Marmelade verarbeitet, die damals sozusagen zum täglichen Brot gehörte. In diese Notzeit fiel eine unserer Hollandreisen, die uns ungeahnte Genüsse kulinarischer Art brachte. Mein Schwager, der Arzt August Lamers, hatte sich gerade mit Lien Hoogveld verlobt und aus diesem Anlass war es uns vergönnt, mehrer feine Familiendiners mitzumachen und in allerlei Delikatessen zu schwelgen, welche wir uns schon lange verkneifen mussten. Meine Frau und ich hatten uns vorher verabredet, nichts von unserer gegenwärtigen Ernährungsnot schon aus politischen Gründen merken zu lassen, aber ich glaube annehmen zu dürfen, dass es uns nicht vollends geglückt ist, denn wir haben an den vielen Leckerbissen und Torten mit Schlagsahne einen Appetit entwickelt, welcher der Aufmerksamkeit unserer Verwandten kaum entgehen konnte und gewisse Rückschläge auf unsern ausgehungerten Zustand zuließ. Auf die Dauer machte sich der mangelhafte Ernährungszustand der Bevölkerung deutlich bemerkbar. Die Widerstandskraft gegen Erkrankungen nahm sichtbar ab, so traten infektiöse Erkältungen in Gestalt von Grippe und Influenza viel verheerender auf als in normalen Zeiten und forderten zahlreiche Todesopfer. Im Frühjahr 1917 trat in Bromberg sowie in anderen Gegenden eine Art Lungengrippe in geradezu beängstigender Weise auf. Sie befiel ausschließlich das weibliche Geschlecht und zwar nur im Alter von 30 und 40 Jahren. Die Erkrankungen verliefen meist tödlich, und wochenlang konnte man in den Zeitungen täglich drei, vier oder mehr Todesanzeigen dieser Art lesen. Die eifrigen Bierologen mit ihren dicken Schmerbäuchen und aufgeschwemmten Körper reagierten auf die eingeschränkte Nahrungszufuhr und veränderte Lebensweise am meisten, zumal das Bier immer wässeriger und weniger nahrhaft wurde. Sie magerten bis zum Skelett ab und mancher von ihnen musste ins Gras beißen, dessen Herz den Wandel nicht aushielt. Auch bei vielen Gebrauchsgegenständen trat allmählich empfindlicher Mangel ein, aber der deutsche Erfindergeist wusste Rat. Wo die Rohstoffe fehlten, schaffte man bald Ersatz. Leder wurde durch Kunstleder ersetzt, der Rohgummi durch synthetisch erzeugten Kunstgummi, die Bindfäden fertigte man aus Papier und ersetzte aus letzterem Stoff auch die leinenen Säcke. Auch auf dem Gebiete der Nahrungsmittel schaffte man allerlei Ersatz, so gab's Kunsthonig, Fleischersatz in Pastenform und vieles Andere. Die meisten Ersatzgegenstände verschwanden aber bald nach dem Kriege, weil sie doch keinen vollen Ersatz bieten konnten, nur die papieren Säcken haben ihre Daseinsberechtigung nicht ganz verloren denn sie werden heute noch viel für den Transport von Kunstdüngerstoffen etc. verwendet. Ganz neuerdings scheint die Herstellung von synthetischem Gummi gelungen zu sein, der allen Anforderungen genügen soll, nachdem die Reichsbahn und die Reichspost ihn auf seine Brauchbarkeit erprobt haben. Das wird eine völlige Umwälzung in der überseeischen Gummierzeugung hervorrufen. Meine Dienstobliegenheiten während des Krieges Während des Krieges nahmen meine Dienstobliegenheiten eine andere Gestaltung. Schon bald wurde der Kollege Reg. und Forstrat Hitschhold als Adjutant des in Bromberg stationierten Bezirksgenerals Krause zum Militärdienst einberufen. Seine Vertretung fiel mir zur Last, wodurch mein Inspektionsbezirk um acht Oberförstereien: Selgenau, Grabau, Podanin, Hollweg, Schönlanke, Behle, Dratzig und Notwendig, die alle im westlichen Teil des Regierungsbezirks Brombergs lagen, vergrößert wurde. Zu dieser großen Belastung kam noch, dass ein Teil der Oberförster und Förster zur Fahne einberufen waren, für deren Vertretung gesorgt werden musste. Wenn auch die Verwaltungsgeschäfte sich durch Einstellung der Ankaufspolitik vereinfachten, so trat auf der anderen Seite in der eigentlichen Bewirtschaffung des Forsten eine völlige Umkehr ein, die viel Arbeit verursachte. Der Mangel an Waldarbeitern musste durch russische Kriegsgefangene ersetzt werden, für welche Baracken zu errichten waren. Die ganze Forstwirtschaft wurde auf die Kriegsnotwendigkeiten umgestellt. Das Sammeln von getrocknetem Futterreisig nahm großen Umfang an, er wurde als Ersatz der immer mehr mangelnden Heues als Pferdefutter benutzt. Um der großen Knappheit an Harz, das in der Wirtschaft unentbehrlich war, abzuhelfen, wurden alle dazu geeigneten alten Kieferbestände auf Harzgewinnung angezapft. Der öffentliche Verkauf von Handelshölzern musste einer planmäßigen Verteilung an kriegsliefernde Holzfirmen zu festgesetzten Preisen weichen. Das Alles verursachte einen Wust von Erlassungen und Verordnungen, für deren ordentliche Durchführung in erster Linie der Reg.- und Forstrat verantwortlich war. Die Hauptarbeit bestand darin, dass ich von Oberförsterei zu Oberförsterei reiste, um dem ganzen Forstbeamtenapparat die notwendigen Anweisungen zu erteilen. Für zur Fahne eingezogenen Oberförster übernahm in der Regel der älteste Hegemeister die Vertretung. Hier war die Tätigkeit des Forstrates besonders mühselig, weil die Vertreter in den Verwaltungsgeschäften nicht geschult waren und in den geringfügigsten Dingen nicht der fortlaufenden Anleitung entbehren konnten. Aber jeder tat sein Bestes, und sind irgendwelche bemerkenswerte Betriebsstörungen nicht vorgekommen. Gegen Ende der Kriegszeit ereignete sich in der mir unterstellenden Oberförsterei Strehlitz ein tragischer Fall, der die ganze Bevölkerung tief erschütterte. Es war die Ermordung des Oberförsters Menz am helllichten Tage. Unter großer Beteiligung bestatteten wir den braven Kollegen an einer Stelle in seinem Waldrevier, die er schon bei Lebzeiten dafür ausersehen hatte. Der Oberförster Mentz war in der Frühjahrskulturzeit eines Morgens in den Wald geritten, um die im Gange befindlichen Kulturen zu kontrollieren. Bei dieser Gelegenheit fiel unweit der Kulturstätte, auf die er sich gerade befand, ein Schuss, welcher ihm und dem anwesenden Förster verdächtig vorkam. Der Oberförster entschloss sich kurzerhand, auf den Schuss zuzureiten und Näheres festzustellen. Einige Jagen weiter traf er die aus einigen Stücken Rindvieh und Ziegen bestehende Heerde des Forsters an, welche ein kleiner etwa zehnjähriger Junge im Walde weitete. In nächster Nähe stand ein mit einer Flinte bewaffneter Mann, der bereits eine Ziege erschossen hatte und sich anschickte sein unsauberes Handwerk fortzusetzen. Als der Oberförster die Situation erkannte, sprang er vom Pferde, um den Kerl zur Rede zu stellen. Dieser wurde rabiat, ging in Anschlag und schoss auf den Oberförster, wobei er ihm einen Finger zerschmetterte. Der Oberförster hatte in höchst unvorsichtiger Weise versäumt, auf seinem Revierritt Gewehr oder Revolver mitzunehmen und stand dem Raubschützen wehrlos gegenüber. Er vermochte noch Deckung hinter einer Kiefer zu nehmen und wollte versuchen, im passenden Moment dem Kerl an die Gurgel zu springen. Das missglückte aber und in geringer Entfernung ereilte ihn ein tödlicher Schuss. Der Bursche wurde bald festgemacht, aber befremdenderweise nicht zum Tode sondern nur zu langjähriger Zuchthausstrafe verurteilt. Ungefähr um dieselbe Zeit wurde in der benachbarten Tuchlerheide Reg.Bez. Marienwerder ein Oberförster Coß beim zufälligen Zusammentreffen mit einem Wilderer am hellen Tage erschossen. Ich erwähne diese Fälle um ein Bild von den damaligen Zuständen zu skizzieren. Der lange Kriegszustand hatte eine gewisse Schießpsychose entfacht, das Hantieren mit harmlosen Knallkörpern aber auch mit weniger harmlosen Handgranaten u.dgl. war in den Stunden der Dämmerung und nächtlichen Dunkelheit sozusagen an der Tagesordnung. Taugenichts und Tagediebe hielten sich berufen, die rauen Sitten des Krieges auf die inneren Zustände des Landes zu übertragen. Waffenstillstand und Friedensdiktat von Versailles Nachdem Deutschland am 1. Febr. 1917 unter dem Zwange des äußersten Not den unbeschränkten U-Bootkrieg eröffnete, erklärten die Vereinigten Staaten von Amerika unter ihrem Präsidenten Wilson am 6. April 1917 den Kriegszustand mit Deutschland. Nun war fast die ganze Welt zum Kampf gegen die Mittelmächte aufgerufen, und die Aussichten, siegreich aus ihm hervorzugehen, sanken für Deutschland immer mehr. Kein Wunder, dass sich auf unserer Seite trotz der die ganze Welt in Staunen versetzenden unerhörten militärischen Erfolge an unser West- und Ostfont, in Italien, Rumänien, Türkei eine gewisse Friedensbereitschaft einstellte, und als der Präsident Wilson am 8. Januar 1918 mit seinen 14 Punkten als Friedensprogramm herauskam, erklärten sich Deutschland und Österreich alsbald bereit, auf dieser Grundlage in Friedensverhandlungen einzutreten. Aber die Entente, vor allem Frankreich, hatte härteres mit uns vor als Wilson. Dort hieß die Parole in Abänderung eines lateinischen Zitates: ‘Ceterum censeo, Germaniam esse delendam’. Wenn ich hier etwas näher auf die geschichtlichen Ereignisse eingehe, so geschieht es deshalb, um meinen jungen Nachkommen, denen die inneren Zusammenhänge des Weltkrieges fremd sind, an meiner eigenen Beurteilung der persönlich erlebten Tatsachen zu zeigen, in welch schmachvoller, ehrloser und entwürdigender Weise Deutschland vollständig zu Boden gedrückt werden sollte. Die Figur, welche Wilson in den Friedensverhandlungen spielte, war so überaus kläglich, dass ich es mir nicht versagen kann, hier das Urteil wiederzugeben, welches der angesehene politische Schriftsteller Volkmann in seinem Buche Revolution über Deutschland über seine Rolle als Friedensvermittler gefällt hat. In dem betreffenden Abschnitt heißt es: ‘Am 13. Dezember 1918 landet Präsident Wilson in Brest mit Staatssekretär Lansing, der vor der Reise gewarnt hat. Als Triumphator zieht er in Paris, London und Rom ein. Er wird aber von Clemenceau so eingewickelt, dass seine 14 Punkte, die Deutschland in einer feierlichen Note als Grundlage für einen Friedensvertrag am 10. November 1918 ausdrücklich anerkannt hatte, vollständig unter den Tisch fallen. Lloyd George will einen vernünftigen Frieden, wird aber auch von der Blutgier Clemenceau’s überrannt. Wilson verzagt ganz, will nach Muttern und bestellt sein Schiff George Washington zur Heimfahrt. Drüben aber dekretiert man, er müsse durchhalten. Wilson will erst den Völkerbund, dann Friedensbehandlung, Clemenceau umgekehrt, ihm liegt nichts am Völkerbund, die Abreise Wilson’s flösst ihm Schrecken ein, er verzichtet auf Abtretung des Rheinlandes und gibt Zusicherung zum Völkerbund.’ Am 29. April 1919 trifft die deutsche Friedensdelegation unter Führung des Grafen Brockdorf in Paris ein, Oberst Henri nimmt sie in Empfang. Die deutsche Delegation sitzt vier Tage im Hotel, ohne dass man sie ruft, weil erst ein großer Stank in der Entente ausgetragen werden muss. Am 7. Mai werden die Friedensbedingungen überreicht, und am 23. Juni 1919 nach Vielem hin und her der Friedensvertrag deutscherseits unterzeichnet. Hindenburg legt an demselben Tage den Oberbefehl nieder. Deutschland konnte sich nach Allem auf härteste Friedensbedingungen gefasst machen, es hatte den Krieg verloren und musste selbstverständlich Opfer schwerster Art bringen, das war das unbestrittene Recht der Sieger. Aber was der Friedensvertrag von Versailles brache, war ein Monstrum ohne gleichen, welches in der Weltgeschichte kein zweites Bild kennt. Es ist ein einziger sinnloser Wutausbruch des französischen Revanchegedankens und die zügellose Konkurrenzgier Englands, eingekleidet in unglaublichen Entwürdigungen des deutschen Volkes, die auch nicht das Geringste mit der Großmut eines Siegers zu tun haben. Verdiente Heerführer sollten als ‘Kriegsverbrecher’ an Frankreich zur Aburteilung ausgeliefert werden. Deutschland wurde unter Androhung äußerster Gewalt gezwungen, die alleinige Schuld am Weltkrieg anzuerkennen (darin steckte die französische Revanche). Deutschland wurde als unfähig erklärt Kolonien zu verwalten, also fort mit ihnen und ad saccum der Entente Auslieferung der deutschen Kriegsflotte (beides zur Sicherung der englischen Weltherrschaft). Wie ein roter Faden zieht sich durch den ganzen Schmachvertrag ein förmliches Bündel gemeinster menschlicher Leidenschaften. In maßloser Weise ist da Hass mit Hohn, Unrecht mit Erniedrigung, Unersättlichkeit mit Hochmut und Wahnsinn mit politischer Kurzsichtigkeit gepaart. Jeder deutsche Junge muss einmal den ganzen Text des Schmachfriedens gelesen haben damit ihn die gerechte innere Wut erfasst, und er niemals vergisst, welche bodenlose und abgrundtiefe Erniedrigung sein Vaterland erdulden musste. Der Vertrag umfasste nicht weniger als 240 Druckseiten. Er wird bei aufmerksamer Durchsicht feststellen können, dass fast jede Seite unerfüllbare Forderungen enthält, welche Deutschland zum Weißbluten führen sollte.