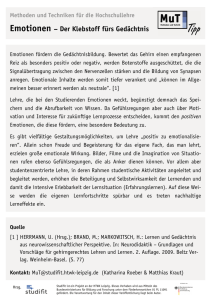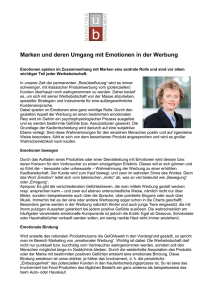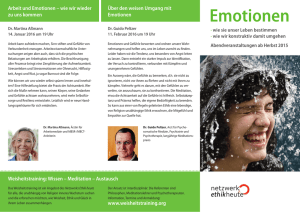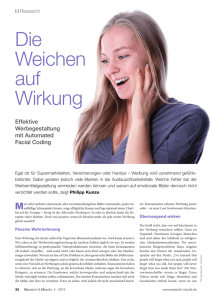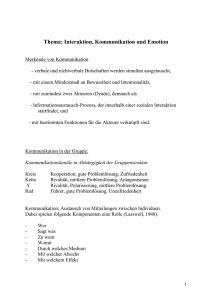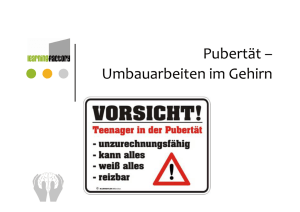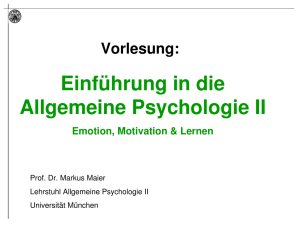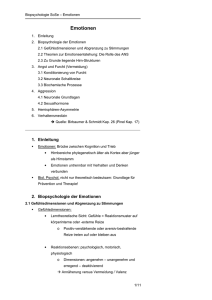EMOTION
Werbung

Vorlesung Allgemeine Psychologie II SoSe 2002 - THEMA: „EMOTION“ I Einführung - S. 2 Zentrale historische Entwicklungsrichtungen Subjektives Erleben Emotionsausdruck Peripher- physiologische Prozesse Neurophysiologische Prozesse Psychoanalytische Vorstellung Definitionsversuche Kleinginna & Kleinginna Zirkelschluß bei Gleichsetzung Emotion + Motivation Emotionsklassen- und dimensionen Suche nach Grundemotionen 1. Affektkomponente: Studie Schmidt- Atzert 2. Ausdruckskomponente: Studie Ekaman et al. Bestimmung abstrakter Emotionsdimensionen Wundts dreidimensionale Einteilung Schlosbergs Gefühlskreis Taxels zweidimensionaler Emotionskreis Smith & Ellsworth S. 2 S. 3 S. 3 S. 4 S. 5 S. 5 S. 5 S. 5 S. 7 S. 7 S. 7 S. 7 S. 7 S. 8 S. 8 S. 8 S. 8 S. 9 II spezielle Ansätze S. 10 1. S. 10 S. 10 S. 12 S. 14 S. 14 S. 14 S. 15 S. 16 S. 15 S. 16 S. 17 S. 17 S. 18 2. 3. 4. Psychophysiologische Ansätze James- Lange Cannon I. Studien in Anlehnung an James Emotionales Erleben Querschnittsgelähmter Studie Hohmann Selbstwahrnehmungsansätze Izard „Facial –Feedback- Theorie“ Bems Selbstwahrnehmungstheorie Laird Differentielle Ansätze Ax Studien in der Tradition von Ax (Funkenstein, Schachter, Ekman) II. Studien in Anlehnung an Cannon Hirnzentren Läsionsstudien (Klüver- Bucy; Oswold) elektrische Reizung (Olds & Milner) Le Doux Lindsleys Aktivationstheorie Weiterentwicklung der Aktivationstheorie (Routtenberg, Pribaum et al.) Lerntheoretische Ansätze Watson Mowrer Attributionstheoretische Ansätze Schachter & Singer Marshall & Zimbardo Maslach, Valins Kognitionstheoretische Ansätze Lazarus III Einzelthemen 1. - 2. - S. 20 S. 22 S. 22 S. 22 S. 23 S. 20 S. 21 S. 25 S. 25 S. 28 S. 30 S. 30 S. 34 S. 35 S. 37 S. 37 S. 43 Emotionsentwicklung Theorien: Emotionsentwiclung als WW Reifung- Lernen Theorien: Emotionsentwicklung als Reifungsprozeß Emotionsausdruck Funktionen Determinanten Formen Beziehung Emotionsausdruck und physiologische Erregung Empathie & Wahrnehmung des Emotionsausdrucks 1 S. 43 S. 43 S. 45 S. 45 S. 46 S. 46 S. 48 S. 44 S. 44 I Einführung Definition „Emotion“ = stammt vom lateinischen „emovere“= aufwühlen; bezeichnet einen heftigen, erregten psychischen Zustand (seit Ende 16Jhdt.); allgemeine, umfassende Beschreibung für psychische und physiologische Zustandsveränderungen, welche entweder ausgelöst werden durch: a) äußere Reize (Sinnesempfindungen) b) innere Reize (Körperempfindungen) c) kognitive Prozesse (Bewertungen, Vorstellungen, Erwartungen) Emotionen = extrem komplexes Phänomen mit vielen Veränderungen (z.B. Verhaltensänderungen...), daher wußte man nicht so recht wie man anfangen sollte => daher auch Heterogenität der Ansätze Ansätze zum Thema „Emotionen“ gibt es seit Ende des 18. Jhd / Anfang 19. Jhd. Zur Zeit des Behaviorismus war dieses Teilgebiet generell verpönt, so dass jahrzehntelang keine Forschung dazu stattfand. Erst seit den 1960ern erholt sich die Emotionsforschung wieder und zählt heute zu den zentralen Themen der Psychologie. Ein Anwendungsgebiet ist z.B. die Werbung. Anfang 20 Jhdt.: Behaviourismus; mit Emotionen wurde sich nicht befasst seit 1960: intensivere Auseinandersetzung mit Emotionen einzelne Komponeneten der Emotionen: (meisten Ansätze konzentrieren sich auf einige der Aspekte und vernachlässigen andere) 1. subjektives Erleben 2. physiologische Komponente = massive körperliche Reaktionen; peripherphysiologische Reaktionen, die vom autonomen NS gesteuert werden; gehen mit Emotionen einher, sind Bestandteil oder sogar Kern der Emotionen 3. Ausdruckskomponente / motorische Komponente = charakteristische Haltungsveränderungen: Mimik, Gestik, Stimme Funktionen der Emotionen: kognitive = sie teilen anderen etwas über unseren Zustand mit und machen dadurch Verhalten vorhersagbar Heterogenität in der Forschung - Gründe: - Komplexität des Phänomens (Erleben, Körperliche Reaktionen, Emotionsausdruck; Funktionale Seite: Nutzen der Emotion; kommunikative Funktion; etc.) - Anstöße aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen Z.B. Philosophie und Biologie / Physiologie (neurophysiologische Emotionsforschung). - Abgrenzbarkeit der Gebiete „Emotion“, „Motivation“ und „Lernen“ (z.B. kann man Phänomene wie „Angst“ unter allen 3 Aspekten behandeln). Zentrale historische Entwicklungsrichtungen der Emotionspsychologie - - Ansätze aus mehreren wissenschaftlichen Disziplinen: historische Ansätze aus verschiedensten Quellen: Philosophie (Aristoteles), Biologie (Bsp. Darwin), Ethologie, Psychologie Teilgebiete in der Allgemeinen Psychologie: „Motivation“ = motivationale Perspektive: zu welchem Verhalten führt die Emotion ? (z.B. Angst) „Lernen“ = Wie entsteht die Emotion? (z.B. Angst) „Emotion“ = Wie kann man die Emotion analysieren, erkennen an charkteristischen Mustern (z.B. Angst)? schwer einzelne Teilgebiete abzugrenzen: Antezedenz von Emotionen ist oftmals Lernen, Bestandteil ist das motiviertes Verhalten historischen Entwicklungsrichtungen der Emotionspsychologie: beziehen sich auf Subjektives Erleben Emotionsausdruck: Einfluß von Darwin Peripher-physiologische Prozesse: Sequenzproblem; Einfluß von James-Lange Neurophysiologische Prozesse: (Prozesse & Strukturen innerhalb d. ZNS) Sequenzproblem,; Einfluß von Cannon Psychoanalytische Vorstellung: Einfluß von Freud 2 Def. „das Sequenzproblem“= Frage nach der zeitlichen Beziehung zwischen dem körperlichen Emotionsausdruck und dem subjektiven Gefühlserleben a) subjektives Erleben: - philosophische Ansätze - zum Erforschen des subjektiven Erleben gehören 4 zentrale Themen: I. Verhältnis Gefühl – Bewusstseinsprozesse/kognitive Prozesse (Gedächtnis, Denken): Wie ist das Verhältnis zwischen Emotion und Bewußtseinsprozessen: Denken, Erinnern, Bewerten? Beeinflusst das Gefühl das Bewusstsein oder umgekehrt? II. Relation Gefühl – Begehren = Motivation; Antrieb zum zielgerichteten Handeln: Wie ist das Verhältnis zwischen Gefühl und Begehren/Motivation? III. Ursachen von Gefühlen = interne oder externe Bedingungen oder WW zwischen beiden: Wo kommt das Gefühl überhaupt her? Entstehen Gefühle aus Situationen oder aus sich selbst heraus? IV. Einteilung von Gefühlen = Taxonomie: Gibt es unendlich viele oder nur eine bestimmte Anzahl von qualitativen Unterschieden zwischen den Emotionen? Wie kann man Emotionen unterscheiden? 1. 2. - Zwei Grundpositionen: Aristoteles: Gefühle als nicht selbstständige, ableitbare, seelische Phänomene; negatives Phänomen: kontraproduktiv, Störung von rationalen Denkvorgängen werden daher nicht gebraucht Kant: Gefühle sind selbstständige, unabhängige geistig- seelische Tätigkeiten Wundt: Seelenleben/subjektives Erleben unterteilt in 2 Elemente (nicht weiter unterteilbar): (a) Empfindungselement = Sinneseindrücke; Wahrnehmung (b) Gefühlselement Empirische Erhebungsmethoden des subjektiven Erlebens (Wundt) : 1. Introspektion = Selbstbeobachtung, Beschreibung von Empfindungen, exakte individuelle Beschreibung von Zuständen Sprache als entscheidendes Medium subjektives Erleben zu erfassen Problem: nicht generalisierbar, Wahrheitsgehalt nicht objektiv überprüfbar Heute: - Heute: globalere Erfassungsmethoden = subjektive Erleben über die Sprache z.B. mittels standardisierte Fragebögen, Ratings, Skalen (Beschreibung des eigenen Zustandes in ganz bestimmten Situationen) Fragebögen zur Selbstbeschreibung STAI-G Form „Ich bin Ruhig“ =>Vpn müssen ankreuzen inwieweit jeweilige Aussage zutrifft: überhaupt nicht / ein wenig / ziemlich / sehr STAI: Messen der Angst; gibt Informationen über das Ausmaß an Angst. Problem: Angst ist ein komplexes Phänomen; es treten oft Mischformen von Emotionen auf. Vorteile der Fragebögen: - ökonomische schnelle Erfassung bestimmter Zustände - objektiv auswertbar Nachteile: - Konstruktion der Fragebögen aufwendig - Voraussetzung: Personen sind sich ihres Zustandes bewußt, können valide und reliable Aussagen darüber geben - nur erfassbar, was Erhebungsinstrumente messen wollen => undifferenzierter & undetaillierter als Introspektion: z.B. Mischformen der Emotionen nicht erfassbar; viele Informationen gehen verloren (Nachteil der Introspektion: Leute können lange über sich selbst reden, keine Mindestinformationsbasis) 2. Ausdrucksmethode = Erfassung objektiver Veränderungen mittels z.B. Messungen der Reaktionszeit b) Ausdruck von Emotionen: - Darwin, 1872: „The expressions of Emotions in Man and Animals“ - Darwin will evolutionstheoretische Überlegungen auf die Emotionsforschung übertragen. 3 - Evolutionsprozess nicht nur auf anatomisch- morphologische Prozesse beschränkt, gilt ebenso für Ausdrucksverhalten - erkennt an, dass Emotionen eine subjektive Komponente besitzen konzentriert sich aber ausschließlich auf Emotionen und deren Ausdruckskomponente - Entwicklung von Meßmethoden und systematische Untersuchungen zum Ausdruck von Emotionen: Mimik, Gestik, Körperhaltung, stimmliche Merkmale (z.B. Frequenz der Stimme) Kernaussagen: - Emotionaler Ausdruck weist Kontinuität auf. - Funktion der Emotionen (laut Darwin): Kommunikation, Signale bei sozialer Interaktion; Vorbereitung zum Handeln - Emotionaler Ausdruck ist angeboren: Grundlagen zu emotional-expressiven Verhaltens sind angeboren z.B. bestimmter Gesichtsausdruck bei bestimmten Emotionen (ebenso bei Tieren und Menschen: Zähneblecken des Wolfes = höhnisches Grinsen des Menschen) o niederen Tieren: verschiedene Ausdrücke schon bei niederen Tieren vorhanden o Kleinkindern und Erwachsenen: bevor die Kleinkinder noch Zeit hatten den emotionalen Ausdruck zu lernen, trat er schon auf o Blindgeborene: gleiche emotionaler Ausdruck wie Sehende o Angehörigen unterschiedlicher Rassen und Kulturen: gleicher emotionaler Ausdruck Wichtigster Punkt für Forschung: 60er/70er Jahre entwickelte man Meßverfahren um Gesichtsausdruck und andere Ausdrucksmerkmale zu erfassen: fand eine Reihe von Einzelemotionen die kulturübergreifend im Ausdruck gleich waren: Freude, Ekel, Ärger, Überraschung, Furcht - Empirische Belege für die Kontinuität des emotionalen Ausdruck bei Tier & Mensch - Konsequenzen aus Darwins „The expressions of Emotions in Man and Animals“ o Vorläufer der kulturvergleichenden Emotionsforschung: siehe Ekman o Methode der Fremdbeobachtung und hierzu verwendete Codierungssysteme o Grundlage für die behaviouristische Auffassung von Emotionen (Ausschluß der subjektiven Komponente: Aussagen über Emotionen können weder verifiziert noch falsifiziert werden) c) Peripher- physiologische Prozesse: - meßbare, charkteristische Veränderungen außerhalb des ZNS/ körperliche Reaktion: viszerale Reaktion unseres NS - Theorien mit der Auffassung: (entgegen der allgemeingültigen Auffassung) Körperreaktion seien Ursache der Emotion; zunächst Eintreten körperlicher Veränderungen, dann erst Entstehen der Emotion => um eine Emotion zu empfinden ist erst eine physiologische, körperliche Reaktion vorhanden sein - zeitliche Abfolge: bedrohliche Situation Körperreaktion Emotion James: „Wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen.“ - Beginn der Theorienbildung dieser Richtung: o James (1884) o Lange (1885) Formulierten unabhängig voneinander eine ähnliche Emotionstheorie 2 Konsequenzen: - Verstärktes Interesse am objektiven Messen von Körperreaktionen, körperlichen Begleiterscheinungen von Emotionen mit Schwerpunkt ANS. Entwicklung von Meßverfahren/Techniken, die nicht in Körper eindringen = non- invasive Messungen Non- invasive Messung: psychophysiologische Variablen: kardiovaskuläres System: Körpertemperatur, Blutdruck, periphere Durchblutung; Herzschlagfrequenz Haut/ Schweißdrüsen: Hautleitfähigkeit, Hautpotential (sympathisches System) Auge: Pupillendurchmesser Endokrines System: verschiedene Hormone Zentralnervöse Aktivität: Elektroenzephalogramm/ EEG Muskelaktivität: Elektromyogramm/ EMG (motorisch- muskuläres System) Atmung: Atemfrequenz, Atemtiefe Frage nach der Spezifität/ Unspezifität der Körperveränderungen: Rufen unterschiedliche Emotionen unterschiedlichen Körperreaktionen hervor = Spezifität oder sind Körperreaktionen bei beiden Emotionsarten gleich = Unspezifität? 4 Annahme bei James-Lange: Wenn Körperveränderungen kausal für Emotionen sind, impliziert dies, dass die Körperreaktion spezifisch für jede Emotion sein muß (um von Körperveränderungen auf die Emotion rück schließen zu können) = Postulat der Spezifität d) neurophysiologische Prozesse und Strukturen: - Cannon´s Neurophysiologische Emotionstheorie: aus Kritik an James- Lange –Theorie entwickelte er eigene Theorie - Cannon selber war Physiologe; ausschließliche Beschäftigung mit der objektiven Seite von Emotionen - erster Vertreter der Auffassung, dass es Emotionen gibt, die als Folge von Vorgängen im Gehirn entstehen /neurophysiologische Prozesse, nicht als Folge auf Prozesse aus der Körperperipherie (James- Lange) - Emotionszentrum (mittels Tierexperimente identifiziert) = Thalamus als Ort an dem Emotionen generiert werden: Thalamus veranlasst: 1. Signale an Körperperipherie: Körperveränderungen bestimmen Emotionen 2. Signale an den Cortex (Großhirnrinde) initiiert/bestimmt subjektives Erleben von Emotionen - Unspezifität der Körperreaktionen: unspezifische, periphere Körperveränderungen bei allen Emotionen identisch; in belastenden Situationen tritt ein gleichbleibendes, konsistentes Muster von Körperveränderungen auf - Körperliche Veränderungen = biologisch sinnvolle Funktion, setzt adaptive Prozesse in Gang intensive Emotionen Ausschüttung von Adrenalin als „Fight or Flight Response“ = Ziel der Adrenalinausschüttung ist die Mobilisierung des Körpers (Notfallreaktion) durch periphere Veränderungen Konsequenzen: - Unspezifitätshypothese - Forschungswelle an Hirnprozessen e) - Psychoanalytische Vorstellungen: Emotionen: „Affekte“; Schwerpunkt bei Freud: Analyse der Bedeutung von Emotionen für die Entwicklung pathologischer Störungen/ Neurosen; - Vernachlässigung der Frage nach der Existenz, Funktion und Beschaffenheit von Emotionen. - eher auf der Basis von Einzeluntersuchungen an Patienten; wenig empirische Überprüfung seiner Aussagen - keine systematische, einheitliche Affekttheorie: gibt z.B. mehrere Freudsche Angstsignaltheorien - Affekte nur im ZH mit Triebbegriff zu verstehen: Sexualtrieb, Todestrieb, Überlebenstrieb Entstehung von Affekten ist auf Triebkonflikte zurückzuführen (besonders Sexualtrieb) - Psychoanalyse; 5 Grundannahmen zu Emotionen: (1) Emotionen können sowohl subjekt- als auch objektbezogen sein: Orientierung auf eigene Person (Narzissmus, Autoaggression) oder Orientierung auf andere Objekte/ Personen (Aggression auf Vorgesetzten) (2) Emotionen sind vielfach unbewusst: v.a. warum in welcher Situation welche Emotionen ausgebildet werden. (3) Emotionen stehen häufig mit Steuerinstanzen in Konflikt (Ich und Über-Ich) und werden daraufhin ins Unterbewußte verdrängt nach Verdrängung oft Quelle psychischer Erkrankungen z.B. Emotionen, die gesellschaftlich sanktioniert sind (4) Psychoanalyse interessiert sich primär für mentale Prozesse (Träume, Phantasien ...) kein Interesse an körperlichen Prozessen bei Emotionen (5) Emotionen sind häufig ambivalent; widerstrebende Affekte (Hassliebe) Konsequenzen: - Behaviourismus versucht analytische Überlegungen auf empirische Basis zu stellen Definitionsversuche - 1. 2. Kleinginna & Kleinginna, 1981: 11 Gruppen an Definitionen: Affektiv: subjektives Erleben im Zentrum; Lust/ Unlust; postiv/negativ; Erfassung mittels Fragebögen; Zugang über Sprache Kognitiv: im Zentrum stehen Prozesse des Bewertens und Beurteilens von Situationen / Personen (nur nach Bewertung einer Situation kann eine Emotion empfunden werden). 5 3. Situativ: Definition über die auslösende Reizsituation; determinierende Situationsmerkmale; objektive Merkmale einer Situation ergeben das Urteil „Emotion“. 4. Psychophysiologisch: Definiert Emotionen über die Reaktion, v.a. Körperveränderungen, -reaktionen; Messung der potentiellen Größen (Blutdruck, Herzrate ...) 5. Expressiv: Definitionen, die Ausdrucksmerkmale zum Inhalt haben (Mimik, Gestik...) 6. Disruptiv: Emotionen als Störfaktor für Rationalität (= dysfunktional) bzw. für Zielhandlungen. (Aristoteles: Emotionen soll man reduzieren, beseitigen) 7. Adaptiv: Emotionen kein Störfaktor, sondern helfen zu überleben (lebensnotwendig), sich an die Umwelt anzupassen 8. Syndromisch: Definitionen, in denen Emotionen über mehrere der vorgenannten Aspekte definiert werden 9. Restriktiv: Negativ- Def. = was Emotionen nicht sind; Abgrenzung von Emotionen zu anderen Phänomenen; 10. Motivational: Emotion wird mit Motivation gleichgestellt; Emotion = Antrieb für zielorientiertes Verhalten; 11. Skeptische Aussagen: Frage nach dem Sinn des Arbeitens mit dem Konzept „Emotion“ (V.a. Behaviorismus); Schwierigkeit, Emotionen konzeptionell zu erfassen; Arbeits- Def. „Emotionen“( hier muss noch dran rumgefeilt werden); Kleinginna (1981) = Emotion als ein komplexes Interaktionsgefüge subjektiver und objektiver Faktoren, das von neuronal/hormonalen Systemen vermittelt wird und Veränderungen bewirkt Diese Faktoren können: Affektive Erfahrungen, wie Gefühle der Erregung oder Lust/Unlust bewirken. (Erfassung der subjektiven Komponente über Sprache) Kognitive Prozesse, wie emotional relevante Wahrnehmungseffekte, Bewertungen, Klassifikationsprozesse hervorrufen. (unbewusste Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse sind; nur indirekt erschließbar aus den anderen Komponenten) physiologische Anpassungen an erregungsauslösende Bedingungen in Gang setzen. (Erfassung der Körperveränderungen über non-invasive Messmethoden (ANS)) zu Verhalten führen, welches oft expressiv, zielgerichtet und adaptiv ist. (behavioral- expressive Komponente über Beobachtung des Verhaltens erfaßbar; dadurch auch Bestimmung der Dauer von Emotionen möglich) Emotionen - - Kognitive Komponente Subjektive Komponente Behaviorale Komponente Physiologische Komponente Bewertung Erleben Verhalten/Ausdruck Körperreaktionen Indirekte Erschließung Verbaler Report Beobachtung / Kodierung Physiologische Messungen Probleme – deswegen ist die Definition nur eine Arbeitsdefinition. Finden sich Veränderungen auf allen Ebenen? Sind bei Emotionen alle Hauptkomponenten immer vorhanden? Oder reicht Veränderung auf nur ein o. zwei Ebenen? Wie wirken die einzelnen Komponenten zusammen? Wie sind die zeitlichen/ kausalen Relationen zwischen den Komponeneten? Müssen die Maße auf allen Ebenen hoch miteinander korrelieren? Problem der fehlenden Definition trug zu einer Reihe von Inkongruenzen in der Emotionsforschung bei Die o.g. Fragen bleiben bis heute offen. Andere Konzepte/Begriffe: Emotion auch als Affekt (=kurzfristige, starke Emotion), Gefühl (Bezeichnung des subjektiven Erlebens), Stimmung (Gefühlszustand, weniger intensiv Bsp. depressive Stimmung) 6 Zirkelschluß bei Gleichsetzung von Emotion und Motivation = Ursachen (Emotion) und Folgen (Motivation) können nur schwer getrennt werden: jedoch sollte Emotion nicht mit Motivation gleichgesetzt werden; rationales, motivationales Verhalten kann auch unabhängig von Gefühlen stattfinden => Bsp. für Zirkelschluss „Warum zeigt jemand ängstliches Verhalten?“ (Motivation) => „ Weil er Angst hat!“ (Emotion)/ „Woher wissen wir, dass er Angst hat?“ (Emotion) => „Wir sehen es an seinem Verhalten!“ (Motivation) Emotionsklassen- und dimensionen - Unterscheidung abhängig vom methodischen Zugang (liegen physiologische Daten, Affekt-, oder Verhaltensdaten vor) 2 Grundformen methodischer Zugänge: Suche nach fundamentalen Emotionen = Grundemotionen; (z.B. Angst, Ärger) Dimensionsanalysen führen dazu einzelne Emotionen von anderen abzugrenzen Bestimmung abstrakter Dimensionen, die den Vergleich einzelner Emotionen gestatten; z.B. Dimension positiv vs. negativ (Was haben Angst und Ärger gemeinsam? Wie unterscheiden sie sich?) Suche nach Grundemotionen 1. Suche über die Affektkomponente: Studie Schmidt-Atzert: Wortfelduntersuchungen/Sprachanalysen = welche Wörter bezeichnen Emotionen - Vpn sollten 112 emotionale Wörter, die mit Puffer- Items (= Wörter, die mit Emotionen nichts zu tun haben) gemischt waren von „mit Sicherheit eine Emotion“ bis „mit Sicherheit keine Emotion“ beurteilen - ersten 60 Wörter aus diesem Ergebnis (solche, die mit recht hoher Sicherheit als Emotion bezeichnet wurden) wurden auf Kärtchen geschrieben; Vpn sollten sie nach Ähnlichkeit sortieren => anhand der Basis dieser Daten wurde eine multivariate statistische Analyse „Cluster- Analyse“ zur Gruppierung der Daten erstellt - sehr komplexes Vorgehen. - Einteilung in sog. „Cluster“; Es fanden sich 12 Cluster. CLUSTER ZUM CLUSTER GEHÖRIGE EMOTION Freude Begeisterung, Erleichterung, Freude, Fröhlichkeit, Glück, Heiterkeit, Hochstimmung, Triumphgefühl, Übermut, Zufriedenheit Lust Begehren, Erregung, Leidenschaft, Lust, Verlangen Zuneigung Dankbarkeit, Liebe, Verehrung, Wohlwollen, Zärtlichkeit, Zuneigung Mitgefühl Mitgefühl, Mitleid, Rührung Sehnsucht Heimweh, Sehnsucht Unruhe Ungeduld, Unruhe Abneigung Abneigung, Abscheu, Ekel, Schadenfreude, Verachtung, Widerwille Aggressionslust Ärger, Aggressionslust, Gereiztheit, Groll, Hass, Trotz, Wut, Zorn Traurigkeit Frustration, Kummer, Niedergeschlagenheit, Sorge, Trauer, Traurigkeit, Unlust, Verstimmtheit Verlegenheit Reue, Scham, Verlegenheit Neid Eifersucht, Neid Angst Angst, Entsetzen, Furcht, Panik, Verzweiflung Ergebnisse in anderen Kulturkreisen ähnlich (10 – 15 Cluster) Es gibt eine begrenzte und überschaubare Anzahl emotionaler Zustände. 2. Suche über die Ausdruckskomponente (besonders Mimik): Studie Ekman et al.; 1987: Suche nach fundamentalen Emotionen/ Grundemotionen, die sich universell in der Mimik erkennen lassen - Über 500 Vpn aus zehn Ländern sahen Fotografien von Gesichtern: je drei von den Gesichtern drückten (nach Ansicht von Ekman & Friesen) die unten genannten Emotionen aus - Vpn mussten die Gesichter bestimmten Emotionen zuordnen - Ergebnis: hohe Trefferquoten z.B. bei Freude 90%; Beurteiler aus Japan/Sumatra/Hongkong ähnlich hohe Trefferquoten wie Beurteiler aus westlichen Kulturen - Folgerung: 6 Basis- Emotionen/ Grundemotionen, die in allen Kulturen korrekt erkannt wurden happiness = Glück / Freude 7 - surprise = Überraschung sadness = Traurigkeit anger = Ärger disgust = Ekel fear = Angst Bestimmung abstrakter Emotionsdimensionen ältere Ansätze: meist nur eine Hauptunterscheidung: positiv/ negativ ; Lust/ Unlust; angenehm/unangenehm Wundt´s dreidimensionale Einteilung: Erweiterung der eindimensionalen Systeme o Lust - Unlust subjektive Komponente (subjektives Erleben): positiv - negativ o Erregung - Beruhigung physiologische Komponente (peripherphysiologische Körperveränderungen) o Spannung - Lösung (Körperreaktionen von Skelettmuskulatur) Diese Einteilung ist sehr hypothetisch. Wundt vertraute stark auf Introspektion, kaum empirisch abgesichert „nur“ Theorie Schlosberg´s Gefühlskreis (1952) zur zweidimensionale Einteilung des mimischen Ausdrucks: - erste streng empirische Untersuchung auf der Basis der Mimik - Ziel: allgemeine Beschreibungsdimensionen für Emotionen finden ( Ekman: Dimensionssuche) - Schauspieler sollten verschiedene, emotionale Zustände darstellen und wurden dabei fotografiert - Vpn wurden diese Fotos zur Beurteilung vorgelegt: ihnen wurden inhaltliche Dimensionen vorgegeben; z.B. „Lust – Unlust“ - Verfahren: Faktorenanalyse - 2-Faktorenlösung: P – U (Lust – Unlust); R – A (Zurückweisung – Zuwendung) Schlosbergs Gefühlskreis: (es lassen sich mehr mimische Ausdrücke auf der rechten Hälfte des Kreises finden) Liebe, Freude, Glück P Verachtung R Ekel Überraschung A Furcht, Leiden U Zorn, Entschlossenheit o o o nach statistischer Analyse eine weitere Dimension hinzugefügt 3 dimensional: Grad der Erregung (Erregung/ Beruhigung): NEU Zuwendung/ Zurückweisung Lust - Unlust; (angenehm/unangenehm) Taxel´s (1960) 2-dimensionaler Emotionskreis: Einteilung auf der Basis der Emotionsqualitäten - semantisches Differential = bestimmte Emotionsbegriffe werden anhand von mehreren bipolaren Adjektiven beurteilt z.B. „gut – schlecht“, „stark – schwach“ ... - Zuerst: 2-dimensional: Emotionskreis nach Traxel: 8 Ggs. zu 4 8. Angst 1. Abscheu, Widerwille U 2. Zorn Ggs. zu 3 7. Demut S D 3. Aggressionlust Ggs. zu 7 6. Anteilnahmen A Ggs. zu 8 4. Begehren Ggs. zu 2 5. Zärtlichkeit, Liebe Ggs. zu 1 - Später kam Traxel ebenfalls zur Schlussfolgerung, dass eine dritte Dimension benötigt wird: Motivationsgrad (vergleichbar mit Aktivierungsgrad bei Schlosberg) o Lust/Unlust o Submission (=Unterbewertung)/ Dominanz o Motivationsgrad (niedrig/ hoch) Emotionsqualitäten werden nach ihrer Ähnlichkeit beurteilt; unähnliche Emotionsqualitäten wie z.B. Demut/ Aggressionslust liegen einander gegenüber Smith & Ellsworth´s (1985) 6 Dimensionen: Smith & Ellsworth arbeiteten frühere Studien auf & führten eine Analyse über die Daten durch, die Emotionen a) aus dem Gesichtsausdruck herleiten oder b) subjektiv aus dem Gefühl berichten Bei a) und b) fand sich Unlust- Lust – Dimension und der Motivationsgrad/ Erregungskomponente Aufmerksamkeit (attentional activity: Zuneigung / Zurückweisung) fand sich nur bei a) unbewusst; nur im Gesichtsausdruck des anderen auffindbar. daneben ergaben sich weitere schwache Dimensionen wie Kontrolle, Erfahrung, Tiefe - theoretisch zunächst 8 Dimensionen postuliert; (Pleasantness, Attention, Control, Certainty, Perceived Obstacle (besondere oder normative Bedingungen), Legitimacy (Angemessenheit), Responsibility, Anticipated effort) - Nicht alle dieser über theoretische Überlegungen entstandenen Dimensionen konnten empirisch nachgewiesen werden (perceived obstacle & legitimacy fallen heraus) 6 Dimensionen: 1. Pleasantness – Unpleasantness (Lust/Unlust) 2. High Effort – Low Effort (antizipierte Anstrengung) 3. High Attention – Low Attention (Zuwendung/Abweisung) 4. Certaincy – Uncertaincy (Sicherheit/Unsicherheit) 5. Other Responsibility/Control – Self Responsibility/Control (Fremd – Eigenverantwortung) 6. Situational Control – Human Control (Situations – Eigenkontrolle) Empirische Überprüfung : - mittels Methode der Imagination = Vpn werden aufgefordert sich eine emotionsauslösende Situation möglichst lebhaft vorzustellen - Erinnerung an die Situation, in der Vp in der Vergangenheit eine bestimmte Emotion empfunden hat und sie soll anschließend ihr subjektives Erleben anhand von Beurteilungsskalen beschreiben - Induzierten bei Vpn 15 Emotionsqualitäten, die mit Beurteilungsskalen bewertet wurden: Happiness, Sadness, Fear, Boredom, Challenge, Interest, Hope, Frustration, Contempt, Disgust, Surprise, Pride, Shame, Guilt Die Darstellung der 6 Dimensionen erfolgt über 3 zweidimensionale Diagramme (effort – pleasantness; certainty – attention; control – responsibility) Beurteilung: - sehr gutes Beschreibungssystem - gute Grundlage zur Erfassung von Emotionen - es sind Mischformen von Emotionen enthalten (Reinformen lassen sich kaum auffinden) - FAZIT der Entwicklung von Emotionsdimensionen: differenzierte Beschreibungssysteme: ermöglicht die Beschreibung und den Vergleich einzelner Emotionen in Bezug auf die Dimensionen 9 - - durch Heranziehen abstrakter Dimensionen kann man sehr genau Messinstrumente entwickeln Ergebnisse sind stark abhängig von: Auswahl des Ausgangsmaterials (Emotionsbegriffe- ausdrücke, Anzahl der Emotionen) und von Auswahl der statistischen Mittel (bezogen auf Wahrscheinlichkeiten mit entsprechendem Entscheidungsspielraum) Forschung: konzentriert sich auf einzelne Dimensionen deskriptive vs. Emotionsanalysen auf Basis theoretischer Annahmen (z.B. Smith und Ellworth) II spezielle Ansätze der Emotionspsychologie 1. Psychophysiologische Ansätze - konzentrieren sich auf die Körperreaktionen bei Emotionen / beinhaltet (neuro-) physiologische Prozesse. James und Lange (an James orinetierte Richtungen) - Untersuchungen zur Querschnittslähmung - Selbstwahrnehmung/- Beobachtung (Bem) - differentielle Ansätze vs. Cannon (an Cannon orinetierte Richtungen) - Hirnzentren - Rolls-Modell - Le Doux Theorie - Aktivationstheorie (Lindsley) William James (1842- 1910) Walter Cannon (1871-1945) Professor der Physik in Harvard 1885 steigt er auf Philosophie, später Psychologie um. Ist gegen Wundts Auffassung, man solle das Seelenleben in seine einzelnen Bausteine zerlegen: ganzheitliche Orientierung Ist Gegner der empirischen Methode, präferiert Introspektion Mitbegründer der wissenschaftlichen Psychologie in USA Hauptwerk: „Principles of Psychology“ Professor der Physiologie in Harvard ohne jegliches philosophisches Interesse Gegner der Methode des Laborexperiments (akzeptiert sie aber) bevorzugt Introspektion verwendet nur Methode des Laborexperiments Tierexperimente experimentell orientierter Physiologe Adrenalin - Forschung Hauptwerk (1929): „Wut, Hunger, Angst und Schmerz“ James (-Lange); 1842 – 1911 - - zentraler Gegenstand der Theorie ist der Erlebnisaspekt von Emotionen: Beschäftigung mit Natur und Entstehung von Emotionen 1884: Veröffentlichung von „What is emotion?“; ursprüngliche Fassung der Theorie 1885: Lange veröffentlicht „Über Gemütsbewegungen“: übereinstimmend in den wesentlichen Punkten mit James Theorie; seither oft auch „James- Lange- Theorie“ genannt Unterschied: laut Lange körperliche Reaktion = Vasomotorik James: viszerale Reaktionen 1890: Veröffentlichung von „The Principles of Psychology“; präzisere Fassung seiner Theorie Verstoß gegen die allgemeingültige Auffassung = „Common- sense- Vorstellung“ der Entstehung von Emotionen: Objekt Emotion Körperreaktion James kehrte diese Kausalannahme um und bezeichnete körperliche Veränderungen als Ursache von Emotionen; Bsp. wir weinen nicht, weil wir traurig sind sondern: Wir weinen und deswegen sind wir traurig zentrale Annahme James (/Lange): körperliche Veränderungen gehen der Emotion voran Emotion = Empfinden der körperlichen Veränderungen; Emotion als Konsequenz von Körperveränderungen Zitat James: „die in gröberen Gemütsbewegungen hervortretenden Bewußtseinszustände sind Resultate des körperlichen Ausdrucks“ Objekt Körperreaktion Emotion Objekt Situation; Reiz Rezeptor Gehirn / ZNS Kortex (Wahrnehmung = Emotion) über viszerale Afferenzen 10 Körperreaktion James: Muskel und Eingeweide (viszeral) Lange: Vasomotorik (Gefäßveränderungen) - - Feedback- Schleifen: Ein Objekt wird über Rezeptoren wahrgenommen; die Infos werden hier schon ans ZNS gesendet, bewirken aber zunächst nur körperliche Reaktionen erst durch die Rückmeldung der peripheren Körperveränderungen in den Kortex wird das subjektive Erleben einer Emotion ausgelöst. Voraussetzung seiner Theorie ist also die Annahme, dass es Feedback- Schleifen gibt (solche gibt es physiologisch sind die Voraussetzung für diese Theorie vorhanden) und die Körperveränderungen dadurch in irgendeiner Form wahrgenommen werden Es muß sich dabei nicht unbedingt um bewußte Wahrnehmung handeln über die der Betreffende Auskunft geben kann (z.B. Erhöhung des Blutzuckerspiegels) Körperreaktionen: hauptsächlich viszerale Reaktionen = körperliche Veränderungen des autonomen NS; aber auch bestimmte motorische Reaktionen als Bestandteil der körperlichen Grundlagen für Emotionen Logisches Problem: Woher weiß die Körperperipherie, wie sie reagieren soll, um Emotionen auszulösen? Wie kann der Körper ängstlich reagieren, wenn noch gar keine Angst da ist? Emotionen sind laut James /Lange eng mit Instinkten verknüpft; Instinkte = reflexartige Reaktionen, die gesetzmäßig von bestimmten Sinneseindrücken ausgelöst werden Zitat, James: „jeder Gegenstand, der einen Instinkt auslöst, ruft auch eine Emotion hervor“ zentrale Argumente/Belege für die Theorie James: a. Unmittelbare körperliche Wirkungen von Wahrnehmungen: bloße Wahrnehmungen eines bestimmten Gegenstandes/ Sachverhaltes rufen unmittelbar körperliche Veränderungen hervor, auch ohne andere geistige Prozesse zwischen Wahrnehmung und körperlichen Veränderungen, die dem Entstehen einer Emotion vorangehen - erst Körperreaktion dann Emotion => Analogie zu Reflexen Bsp. gehen durch einen Wald, sehen eine düstere Gestalt: erst Anhalten des Atems, dann Angst b. Selbstwahrnehmung körperlicher Veränderungen: Jede körperliche Veränderung kann im Moment ihres Eintretens scharf oder unbestimmt wahrgenommen werden; sie ist also bewusstseinsfähig. - normalerweise werden sie nur nicht beachtet, da man sich auf das Objekt konzentriert c. Reaktionsspezifität: Spezifität der Körperveränderungen; verschiedene Körperreaktionen sind charakteristisch für verschiedene Emotionen - die körperlichen Veränderungen sind emotionsspezifisch und wir erleben sie in differenzierter Weise; Emotionen wie Wut, Freude, Trauer fühlen sich deshalb so unterschiedlich an, weil ihnen unterschiedliche, emotionsspezifische Muster von körperlichen Veränderungen zugrunde liegen - Bsp. Furcht: erhöhte Herzrate, flacher Atem, Zittern der Lippen, Gänsehaut/ vs. Wut: Schwellen der Brust, Blutandrang im Gesicht d. Trennung Gefühl- Körperzustand ist nicht möglich: ohne Empfindung von Körperveränderunegn, keine Empfindung der Emotion - Bei dem Versuch einen Gefühlszustand sich ohne die körperlichen Veränderungen vorzustellen, bleibt nichts übrig - Zitat (James, 1890/1950): „eine rein körperlose Emotion ist ein Nicht- Ding!“ „...Welche Art von Furcht übrigbleiben würde, wenn die Empfindung eines schnelleren Herzschlages noch die eines flachen Atems, weder die Empfindung zitternder Lippen, noch die der Gliederschwäche ...das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen“ e. Körperveränderungen lösen Gefühle aus, bzw. verstärken sie: - Das willkürliche Hervorrufen einer Körperveränderung als Ausdruck einer bestimmten Emotion (z.B. Herunterziehen der Mundwinkel) verursacht die Emotion selber (Trauer) o. verstärkt sie - bestimmte mimische oder gestische Reaktionen, sowie Körperhaltungen (Ausdrucksverhalten) können Emotionen verstärken oder abschwächen, u.U. sogar völlig unterdrücken falls z.B. willkürlich das Ausdrucksverhalten einer gegenteiligen Emotion hervorgerufen wird - Bsp: im Zustand der Trauer die Mundwinkel herabzieht, seufzt, mit schwacher Stimme spricht ...etc. verstärkt das Empfinden der Emotion; wohingegen Mundwinkel zu einem Lachen verzogen, geglättete Stirn, Augen weit geöffnet, erhoben Stimme das Gefühl der Trauer abschwächen; u.U. sogar zum Verschwinden bringen - James geht davon aus, dass es auch möglich ist unerwünschte emotionale Zustände zu überwinden, dadurch dass ihre Ausdruckserscheinungen willkürlich unterdrückt werden (therapeutisches Vorgehen) f. Körperveränderungen sind Rudimente früherer nützlicher Handlungen: Verhaltensweisen hatten füher eine sinnvolle Bedeutung/ evolutionäre Bedeutung 11 - Körperliche Ausdrucksveränderungen lassen sich als abgeschwächte Wiederholungen von Veränderungen erklären, die früher von Nutzen waren = rudimente Erregungen früher nützlicher Handlungen ( Darwin) - Differenzierung zwischen „gröberen Emotionen“ vs. „feinere Emotionen“: a) gröbere Emotionen = sind mit relativ starken körperlichen Reaktionen verbunden - James zentrale Argumente gelten nur für gröbere Emotionen - nur wenn deutliche Körperveränderungen zu verzeichnen sind - starke Emotionen z.B. Zorn, Furcht, Liebe, Haß, Freude, Kummer, Scham, Stolz b) feinere Emotionen = Kognitionen, kognitive Erkenntnisprozesse („erkennende Akte“) - hier sind die Körperreaktionen nicht stark - nicht ausgeprägt zu beobachten - gehören eher zu kognitiven Prozessen als zu Emotionen z.B. moralische, interlektuelle, ästhetische Gefühle Dankbarkeit, Genugtuung, Wissbegierde, Erleichterung Diese Einteilung immunisiert die Theorie gegen Falsifizierung. Es fehlt eine klare Definition des Emotionskonzepts Keine universelle Theorie. Cannon; 1927/ 1929 Kritik an James Theorie und gleichzeitig Entwicklung einer eigenständigen Emotionstheorie Empirische, experimentelle Befunde, v.a. Tierexperimente Annahme: Es ist nicht möglich, subjektives Erleben auszudrücken; Emotionen können nur über den körperlichen Ausdruck erschlossen werden. 5 zentrale Kritikpunkte an James Theorie: (1) Die Isolation der Körperperipherie vom ZNS (z.B. Trennung der Viszera = Eingeweide vom ZNS) verändert nicht das emotionale Verhalten - Laut James, dürften Personen, die aufgrund einer organischen Krankheit o. eines Unfalls vollständig empfindungslos hinsichtlich viszeraler Reaktionen sind (geistige und motorische Fähigkeiten allerdings nicht beeinträchtigt) keine Emotionen erleben - Konkrete empirische Überprüfung mittels Tierexperimente: chirurgischer Eingriff bei Hunden/Katzen denen das RM um den nervus vagus durchtrennt wurde (Trennung Körperperipherie vom ZNS): dadurch war Ausschüttung von Adrenalin, autonome Körperveränderungen wie Magen- Darm ausgefallen => dennoch blieb Ausdruck von Emotion bei den Tieren erhalten [Problem: befassen sich nur mit Ausdrucksverhalten von Emotionen, daher nicht im direkten Widerspruch zu James Theorie, der sich hauptsächlich auf Ausbleiben des subjektiven Erlebens bezog] - Cannon, Lewis, Britton, 1927: Beobachtung von Katzen, bei denen der gesamte sympathische Anteil des autonomen NS entfernt wurde; dennoch bei Aufkreuzen eines Hundes gleiches emotionales Verhalten wie zuvor: fauchen, Zähne blecken, Ausstrecken der Krallen ... (2) Die Sympathikuserregung ist unsepezifisch; dieselben viszeralen Veränderungen treten bei sehr verschiedenartigen emotionalen, auch nicht- emotionalen, Zuständen auf - Laut James fühlen sich Wut, Ärger etc. unterschiedlich an, weil ihnen jeweils unterschiedliche emotionsspezifische Muster viszeraler Veränderungen zugrunde liegen - Ärger, Furcht, Freude = Erregungssteigerung des Sympathikus; uniforme Sympathikusreaktion => führt zu gleicher physiologischer Veränderung: Beschleunigung des Herzschlages, Schwitzen, Hemmung der Magen- Darm- Aktivität, Erweitung der Bronchiolen usw. - Funktion des Sympathikus: Notfallreaktionen (fight-or-flight response): Energie wird bereitgestellt für potentiell gefährliche Situationen. - Diese unspezifische Sympathikuserregung ist viel zu gleichförmig um dadurch qualitativ einzelne Emotionen unterscheiden zu können - Darüber hinaus: gleiche viszerale Veränderungen auch bei nichtemotionalen Zuständen wie z.B. Fieber (Frösteln) - Fazit Cannon: Das Erleben einer bestimmten Emotion kann nicht durch viszerale Veränderungen determiniert sein, da gleiche viszerale Veränderungen bei unterschiedlichen, emotionalen Zuständen, sowie auch nichtemotionalen Zuständen, auftreten Unspezifität /„Cannon´s globale Reaktionstheorie der Emotionen“ = auf verschiedene Emotionen folgen keine spezifisch unterscheidbaren Körperreaktionen, sondern eine mehr oder weniger „globale Reaktion“ durch Entladung des sympathischen NS = viszerale Veränderungen wie z.B. Herzrate 12 (3) Die Eingeweide sind relativ unempfindlich; eine Selbstwahrnehmung ist nicht/kaum möglich - Laut James besitzt jeder die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung viszeraler Veränderungen - Eingeweide = unempfindliche Organe, da sie mit Rezeptoren und Nervenfasern ausgestattet sind; Prozesse wie Verdauung im Magen, Stoffwechsel in der Leber etc. sind für uns daher nicht differenziert wahrnehmbar - Fazit Cannon: Wenn Eingeweide derart unempfindlich sind, können sie nicht für unser reichhaltiges emotionales Erleben verantwortlich sein (4) Autonome Veränderungen sind zu langsam, um emotionale Reaktionen auszulösen - Latenz = Zeit von der Reizeinwirkung bis zur körperlichen Reaktion - Eine Erregungsleitung Reiz ZNS Peripherie dauert ca. 0,25 – 4 sek.; die Feedback-Schleife Peripherie ZNS braucht zusätzlich noch etwas Zeit. Insgesamt muss also (entspr. James) die Latenzzeit bis eine Reaktionsexpression stattfinden kann mindestens 0,8sek dauern. - Studie Wells, 1925: Latenz affektiver Reaktionen auf Bilder von Männern/Frauen weniger als 0,8s wenn affektive Reaktionen bereits begonnen haben vor den viszeralen Veränderungen, die ihnen zugrundeliegen sollen (lt. James), dann können diese viszeralen Veränderungen nicht die Ursache für Emotionen sein (5) Die künstliche Herbeiführung von bestimmten für starke Emotionen typischen Körperveränderungen (viszerale Reaktionen) führt nicht zum Auftreten der Emotionen - laut James müssten physiologischen Veränderungen, die auch bei nicht- emotioanlen Zuständen wie Fieberschüben oder durch künstliche Herbeiführung der physiologischen Reaktionen mittels Injektion von Adrenalin (Wirkung: Entladung des sympathischen NS, viszerale Veränderungen) ebenfalls zum Erleben starker Emotionen führen - Hier bezieht sich Cannon auf die Studie von Maranon (1924): Injezierung von Adrenalin an 210 gesunden und kranken in unterschiedlicher Dosis Auftreten von Empfindungen wie Zittern, pochende Arterien, Nervosität Beobachtung der Latenz, Dauer, Intensität und Form der darauffolgenden Reaktion Ergebnis: 70% nehmen körperliche Veränderungen wahr und erleben diese als unbestimmten, „kalten“ Erregungszustand, einige berichteten über ein „Als- ob- Gefühl“ aber kein reales, tatsächliches emotionales Erleben z.B. „Ich fühle mich als ob ich innerlich bewegt wäre...“ Personen können zwischen realen und „als-ob“ emotionalen Zuständen unterscheiden. - - Cannon´s „ Thalamustheorie der Emotionen“ (auch Thalamus – Hypothalamus- o. Cannon – Bard – Theorie) = 1. empirisch begründete neurophysiologische Emotionstheorie. weniger fokussiert auf subjektives Erleben, vielmehr Ausdruck von Emotionen Bezug auf Befunde des Physiologen Bechterew (1880/90): Beobachtungen an Tieren => emotionaler Ausdruck kann nicht willentlich unterbrochen werden; daher nahm er an, dass zumindest der emotionale Ausdruck unabhängig vom Cortex sei. ????? Cannon´s Schlußfolgerung: subkortikale Strukturen müssen am emotionalen Geschehen beteiligt sein Emotionen = nicht willkürlich unterdrückbar, deshalb müssen Emotionszentren im Gehirn (subkortikale Strukturen) für Emotionen mit verantwortlich sein Cannon, Bard (1928): empirische Untersuchungen zur „shame- rage“ / Scheinwut = Alle Phänomene der Wut treten auf, allerdings ohne entsprechendes Verhalten (oder entsprechenden Auslösereiz). tritt besonders häufig auf, wenn die Großhirnrinde operativ entfert wurde (Läsionsstudien) Ergebnisse (Folie) 1. Entfernen der Großhirnhemisphäre: häufigeres, intensiveres Ausftreten der „shame- rage“ 2. Entfernen des Mittelhirns, vorderer Teil des Zwischenhirns: Auftreten von Scheinwut 3. Entfernen des hinteren Teil des Zwischenhirns mit Thalamus: keine Scheinwut trat mehr auf Fazit: da im hinteren Teil des Zwischenhirn die thalamischen Kerne lokalisiert sind, wird der Thalamus als Schalt- und Entstehungsstelle für Scheinwut und damit für alle Emotionen gesehen. Thalamus = Emotionszentrum - Emotionsmodell Cannon: Objekt Thalamus Emotion & Körperreaktion (Körperreaktion = Begleiterscheinung statt Ursache) - Objekt: Situation, Reiz Rezeptor Kortex WW zwischen Thalamus und Kortex Muskulatur; Eingeweide Thalamus 13 - - - Eintreffende Reize werden auf 2 Bahnen weitergeleitet: (1) Rezeptor Kortex Thalamus: Auslösen der Emotion (2) Rezeptor Thalamus von dort nochmal zum Kortex Emotionales Verhalten entsteht nach Cannon durch WW Kortex und Thalamus - Thalamus = Emotionsgenerator ist für emotionales Ausdrucksverhalten und als „übergeordnete Steuerinstanz“ verantwortlich für autonome Prozesse (Eingeweide) - Kortex = Kontrollinstanz => der Thalamus wird vom Kortex kontrolliert: z.B. in gewissen Grenzen gehalten, gehemmt (z.B. in Situationen, in denen es nicht angebracht ist, Emotionen zu zeigen) - Ausnahme der Thalamus-Regel: Gerüche; werden sofort, ohne Zwischenstation im Thalamus, ans Cortex geleitet. Kritik an Cannon´s Emotionstheorie: Eingeschränkter Gültigkeitsbereich: bezieht sich auf objektiv beobachtbares Verhalten Cannon hat seine Emotionstheorie ausschließlich am Tiermodell und durch Tierexperimente entwickelt Theorie hat daher keine Gültigkeit für Erlebensbereich I Studien/ Theorien in Anlehnung an James Ansatz Emotionales Erleben bei Querschnittslähmungen - Querschnittslähmung = efferente (Innervation) und afferente (Rückmeldungen) Verbindungen von den Organen zum ZNS unterbrochen - nach Cannon müsste dies zu einer drastischen Reduktion im emotionalen Erleben führen - Untersuchungsmöglichkeiten: 1. Bildung zweier Vergleichsgruppen: Kontrollgruppe: gesunde Vpn/ Patientengruppe: querschnittsgelähmte Vpn Darbietung von emotionsauslösendem Material: Bilder o. Filme Erfassung des subjektiven Erlebens => Vergleich, ob signifikante Unterschiede im subjektiven Erleben vorhanden sind Erfassung physiologischer Werte Ergebnisse: meist hatten Vpn der Kontrollgruppe stärkere Emotionen Problem: kann nicht eindeutig interpretiert werden, da es den Vergleich vorher/nachher nicht geben konnte nicht klar, ob Querschnittslähmung Ursache für Unterschiede im emotionalen Erleben: „ex post facto“. Quasiexperiment durch keine randomisierte Zuteilung; Vorselektion keine kausalen Aussagen möglich. 2. Vergleich emotionales Erleben von Vpn vor /nach der Querschnittslähmung Studie, Hohmann, 1966: „effects of spinal cord lesions on expirienced emotional feelings“ - Hohmann selbst auch querschnittsgelähmer klinischer Psychologe - Befragung von 25 männlichen Vpn mit Durchtrennungen in verschiedener Höhe der Wirbelsäule: daraus ergaben sich 5 Gruppen unterteilt nach Art der Verletzung (Level: wieviele Organe betroffen) - strukturiertes Interview- Verfahren: Fragen nach Erleben verschiedener Emotionen vor/nach Querschnittslähmung - durch Dritte ließ er Interview in Bezug auf Ausmaß der Veränderungen im emotionalen Erleben beurteilen: wie stark sich subjektiv- emotionaler Zustand nach der Verletzung in einzelnen Bereichen verändert hat stark vermindert (- -), vermindert (-), gleichgeblieben (0), verstärkt (+), stark verstärkt (+ +). - Bereiche: sexuelle Erregung, Furcht, Ärger, Kummer, Stimmung, Gesamteinschätzung. - Ergebnisse: (siehe Folie) (1) sehr starke bis starke Abnahme der Gefühle sexueller Erregung (bei allen Vpn; bis auf 1 Vp) (2) ähnliche Ergebnisse bei Gefühlen von Furcht (bis auf Patienten mit Läsionen im unteren Wirbelbereich: berichteten über Zunahme von Furcht) und Ärger generelle emotionale Reduktion zeigte sich um so stärker, je mehr Organe durch Querschnittslähmung betroffen kongruent mit James- Lange Theorie: Abnahme im emotionalen Erleben nach Querschnittslähmung durch fehlende Rückmeldungen von physiologische Körperreaktionen (Ursachen für das Entstehen von Emotionen) (3) bei dem Gefühl von Kummer fiel auf, dass es vielen nicht möglich war darüber Angaben zu machen Erlärung Hohmanns: Pat. hatten vorher kaum Erfahrungen mit Kummer gemacht und konnten daher keine Vergleiche ziehen (vorher/nachher) 14 (4) deutliche Zunahme der Sentimentalität (23 von 25 Vpn) Erlärung Hohmanns: generelle Zunahme der Depressivität als Folge der Erkrankung - Trennung Emotionserleben und Emotionsausdruck: bei der Beurteilung muss man genau auf den Unterschied zwischen emotionalem Ausdruck und emotionalen Empfinden achten => durchaus möglich, dass emotionales Empfinden reduziert ist, aber trotzdem ein offenes emotionales Ausdrucksverhalten gezeigt wird (kann willkürlich gezeigt werden & instrumentell eingesetzt werden) Kritik: - retrospektive Beurteilung der Gefühle vorher/nachher kann zu Gedächtnisverzerrungen führen; seit der Verletzung sind unterschiedlich lange Zeitspannen vergangen. - Gründen die Befunde auf einem guten Mechanismus? Alternativhypothese: Der dramatische Einschnitt durch die Querschnittslähmung führt zum Unterdrücken von Gefühlen. Die Interpretation im Sinne James‘ ist nur eine Hypothese. (Lösung: Kombination Gruppen- & Messwiederholungsdesign: KG wären Personen mit vergleichbar schwerem Einschnitt im Leben wie bei QS. Eine solche Studie wurde noch nicht durchgeführt.) - Chwalisz et al, 1988: gegenläufige Befunde zum emotionalen Erleben Querschnittsgelähmter Interpretation der Befunde Hohmanns: Hohmanns Vpn tendierten zu einer passiven, resignierten Haltung gegenüber ihrer neuen Lebenssituation Studie an Vpn, die trotz Querschnittslähmung ein aktives, engagiertes Leben führten Ergebnis: Mehrzahl der Querschnittsgelähmten erlebten Freude, Sentimentalität, Traurigkeit nach der Verletzung tendenziell intensiver als vorher; generell fanden sie keine Unterschiede im emotionalen Erleben zu einer Kontrollgruppe von gesunden Vpn , sowie zu einer Kontrollgruppe mit ähnlich schweren Handicap: die an den Rollstuhl gebunden waren, aber keine Querschnittslähmung besaßen Selbstwahrnehmungsansätze Aspekt der Selbstwahrnehmung in der Theorie von James- Lange regte zu weiteren Überlegungen an - - - - Bem: Selbstwahrnehmungstheorie, 1972 Bem beschäftigte sich mit der Frage, wie wir als Menschen Emotionen bei Tieren erkennen wir nehmen sie dadurch wahr, dass wir eine komplette Analyse des Verhaltens der Tiere vornehmen und zusätzlich die Situation analysieren unter der dieses Verhalten auftritt Auf dieselbe Art & Weise schließen wir auf Emotionen anderer Menschen und auf unsere eigenen Emotionen „Individuen erfahren ihre eigenen Einstellungen, Emotionen und andere innere Zustände teilweise durch Schlussfolgerungen aus der Beobachtung ihres eigenen Verhaltens und/oder den Umständen unter denen das Verhalten vorkommt.“ (1972) Subjektives Erleben einer Emotionen entsteht durch die Verhaltensanalyse und Situationsanalyse (Umwelteinflüsse): wir schließen auf unsere Emotionen durch unser Verhalten und die Situationen unter denen das Verhalten auftritt Wir haben nur begrenzt Zugang zu unseren internalen Prozessen: sie geben uns nur minimal Hinweise, deshalb sind wir uns oft unklar über eigene Gefühle, Einstellungen daher greifen wir auf Beobachtung des eigenen, offenen Verhaltens und Einschätzung der Situation zurück Modell der Emotionensentstehung nach Bem: Verhalten, Gesichtsausdruck, Situation Selbstwahrnehmung und Interpretation Erleben einer Emotion Bems Theorie hat keine Bedeutung in der empirischen Forschung, aber großen Einfluss auf die Sozialpsychologie. Unterschiede zu Izard: 1. Es wird nicht ausschließlich die kausale Rolle des Gesichtsausdrucks thematisiert, sondern die des gesamten Verhaltens. 2. Es werden keine speziellen, refelxartigen Feedback- Prozesse angenommen, sondern der Prozeß der Selbstwahrnehmung wird viel globaler gesehen. 3. Es wird keine Aussage über genetische Bedingtheit von Ausdruckserscheinungen getroffen. 4. Bem interpretiert das gesamte Verhalten in seiner Bedeutung => es werden auch Informationen über die Angemessenheit des Verhaltens in speziellen Situationen gegeben. 5. Bem nimmt an, dass kognitive Prozesse an der Entstehung von Emotionen beteiligt sind. 15 - Izard: „Facial- Feedback- Theorie“; „Gesichtsmuskel- Feedback- Theorie“, 1971 Betonung der Selbstwahrnehmung der Gesichtsmuskel –Veränderungen für Emotionsentstehung Grundannahmen: 1. Wichtig sind nicht die Vorgänge in der Körperperipherie (James) sondern die Mechanismen, die auf die Gesichtsmuskeln einwirken. 2. Impulse/Information gelangt ins Gehirn, wird dort verarbeitet und weitergeleitet zur Gesichtsmuskulatur, wodurch bestimmte Ausdrücke ausgelöst werden. 3. Reflexhafte Auslösung: die Auslösung eines Gesichtsausdruck (analog zu Darwin) ist reflexhaft und daher auch genetisch veranlagt => automatisch ablaufender, rein neurophysiologischer Prozess. Bestimmte Reizkonstellationen führen zu bestimmten Gesichtsmuskelveränderungen. 4. Rückmeldeschleife /Feedbackschleife = Veränderungen werden dem Gehirn zurückgemeldet. 5. Entstehung einer Emotion (subjektiven Erlebens) durch die Verarbeitung der Rückmeldungen (= Feedbackschleife) der Gesichtsmuskelveränderungen. 6. Zweiprozesstheorie: Gesichtsmuskulatur bestimmt die Qualität einer Emotion; Rückmeldungen aus der Körperperipherie bestimmen die Intensität der Empfindung. - Emotionsmodell zur Gesichtsmuskel- Feedback- Theorie: Gesichtsausdruck: körperliche Reaktion bestimmen Emotionsqualität bestimmen Emotionsintensität Afferenzen Rückmeldungen an das Gehirn Erleben einer Emotion - Unterschied zu James: Izard ordnet der übrigen Muskulatur nur eine untergeordnete Rolle beim Entstehen von Emotionen zu => sie determinieren nur die Intensität, nicht die Qualität der Emotionen Unterschied zu Bem´s Selbstwahrnehmungsansatz (siehe oben): verlangt kein Denken/Kognitionen - Methodisches Problem bisheriger Studien: mangelnde Überprüfbarkeit UV: Gesichtsausdruck; AV: Emotionserleben Die UV muss verändert werden, ohne dass die Vp den Zweck der Veränderung kennt: Anstatt „Schauen Sie überrascht“ „Reißen Sie ihre Augen auf, ziehen sie die Augenbrauen hoch, ...“ Prototyp solcher Untersuchungen: LAIRD - Laird, 1974: Erklärung der Qualität der Emotionen ausschließlich mit Selbstwahrnehmung der eigenen Mimik. Individuum nimmt eine Veränderung des Gesichtsausdrucks wahr und sucht dafür eine Erklärung: (vergleiche Schachter & Singer, 1962 s.u.): nichtemotionale Erklärung; z.B. „der Gesichtsausdruck ist gestellt“ kein Bericht über eine Emotion emotionale Erklärung Rückschluß auf Emotion: „Ich lache, folglich bin ich fröhlich“ Annahme von kognitiven Interpretationen bei der Verarbeitung der Informationen über die eigene Mimik (Unterschied zu Izard). Selbstwahrnehmung der Gesichtsveränderungen: automatischer, unbewußter Prozeß => lediglich resultierende Emotion bewußt. Laird,(1974): klassisches Experiment zu Selbstwahrnehmungsansätzen Täuschung der Vpn/ „Coverstory“: Untersuchung von Gesichtsmuskelaktivitäten bei der Verarbeitung verschiedener Informationen; Anbringen von Elektroden, die für die eigentliche Untersuchung jedoch irrelevant waren. 38 Vpn wurden durch gezielte Anweisungen dazu gebracht bestimmte Gesichtsmuskeln zu kontrahieren/ einen bestimmten Gesichtsausdruck zu äußern: a) Stirnrunzeln (Frown)/ finstere Miene b) Lächeln (Smile) /freudiger Gesichtsausdruck Jeden Ausdruck mussten die Vpn 15 s lang beibehalten während sie sich ein leicht emotionsauslösendes Bild ansahen: „Ku Klux Klan Pictures“ vs. „Children Pictures“ = spielende Kinder Variierte Variablen: UV1 = Gesichtsausdruck (frown/smile); UV2 = Bildbetrachtung (Ku Klux Klan Pictures/ Children Pictures) - - - 16 - - - AV = abhängige Variable = emotionales Befinden Emotionsmessung mittels Adjektive in einem Fragebogen Emotionen die gemessen wurden: Aggression, Elation (Hochgefühl), Surgency (Durchdrungenheit), Anxiety, Remorse (Reue), social Affection (soziale Berührtheit) Ergebnisse: Bei allen 38 Vpn fand sich ein Effekt der Gesichtsmuskelanspannung auf das Empfinden, jedoch sind die gefundenen Effekte extrem schwach, teilweise insignifikant und es gibt auch in Nachfolgeuntersuchung nur sehr widersprüchliche Befunde: Haupteffekte der Bilder auf Emotion alle sehr signifikant (logisch). Haupteffekt Gesichtsausdruck: Nur signifikant bei Aggression, Hochgefühl und Durchdrungenheit. Finsterer Blick/frown stärkerer Ärger (Aggressionsskala) als bei Lächeln. Lächeln/smile stärkere Freude (Skala „gehobene Stimmung“, „Lebhaftigkeit“). Interaktion zwischen Gesichtsausdruck und Art der Bilder nur bei Hochgefühl: Lächeln ergab mehr Hochgefühl bei Kinderbildern. Problem: sehr artifizielle cover- story: kein unabhängiges Außenkriterium, ob Täuschung gelungen oder nicht; daher geringe interne Validität Theorie erscheint plausibel, aber kein ausreichender empirischer Beleg vorhanden FAZIT zu Selbstwahrnehmungstheorien (Bem, Laird & Izard): (1) Über Bedeutung der Wahrnehmung des eigenen Verhaltens (Bem) bzw. Gesichtsausdrucks (Izard) für das Erleben einer Emotion kann z.Zt. nur spekuliert werden (2) Eine empirisch – begründbare Entscheidung zwischen den Ansätzen von Izard & Bem ist momentan nicht möglich (3) Es müssen zukünftig vor allem geeignetere Versuchsanordnungen entwickelt werden, um die theoretischen Vorstellungen von Selbstwahrnehmungsansätzen angemessen zu überprüfen. Z.B. wäre es möglich durch eine pharmakologische Lähmung der Gesichtsmuskulatur das feedback zu unterbinden Differentielle Ansätze - Spezifität der Körperreaktion = entscheidend sind Unterschiede in der Körperreaktion bei verschiedenen Emotionen Minimal- Design = minimale Anforderungen an empirische Untersuchungen zu Emotionen; Erfassung physiologischer Prozesse des ZNS und peripheren NS und subjektiven Erleben des Individuums Man braucht mindestens 2 klar voneinander abgegrenzte Emotionen A und B und Personen Pi, die jeweils unter den beiden Emotionsbedingungen untersucht werden 2 Emotionen bei derselben Person hinsichtlich mehrerer physiologischer Merkmale (a – z) untersuchen (niedrige interindividuelle Varianz; kleinerer Messfehler) oder versch. P i bzgl. 1 Emotion untersuchen. Ziel: Feststellung ob es Spezifität = spezifische Muster physiologischer Erregung bei verschiedenen Emotionen gibt Person 1 2 N - - EMOTION A = z.B. Trauer physiologische Variablen a..............................z a..............................z a..............................z EMOTION B = z.B. Freude physiologische Variablen a..............................z a..............................z a..............................z Studie von Ax, 1953: Emotionsspezifische physiologische Reaktionen Grundlagen: Unspezifitätshypothese Theorie von Arnold: Bei Furcht wird der Parasympathikus aktiviert; bei Ärger werden Para- und Sympathikus aktiviert. Frage ob verschiedene Emotionsqualitäten zu spezifischen physiologischen Veränderungen führen Minimal- Design: Untersuchung von klar getrennte Emotioen Angst und Ärger in Verbindung mit charakteristischen Mustern peripherer Veränderungen (z.B. Durchblutung, Hautleitfähigkeit ...) einschließlich ihrer hormonalen Grundlagen (z.B. vermehrte Adrenalin/ Noradrenalin- Ausschüttung; Auslösung cholinerger Reaktionen) => überwiegende Betrachtung von sympathischer/ parasympathischer Aktivität 17 - - - Versuchsablauf: Manipulation der Emotionssituation Vpn liegen auf Ruhebett, sind an Meßwertgeräte angeschlossen; Kabelbaum der Elektroden im Blickfeld. Induktionsmethode = Änderungen der situativen Bedingungen 3. Furchtinduktion: gefährlicher Starkstrom- Kurzschluß wird simuliert durch Funkensprühen und aufgeregtes Fuchteln des Versuchsleiter. nach einer standardisierten Zeit erklärt er, es sei alles wieder i.O. 4. Ärgerinduktion: eine dritte Person (Gehilfe des Vl) stürmt in den Versuchsraum, verhält sich dem Vl und der Vp gegenüber unverschämt, beschimpft beide (macht Vorwürfe)/ Beleidigungen fallen (Vp sei nicht ruhig geblieben; Versuch sei missglückt, etc.) Zur Kontrolle, ob Induktionsmethode erfolgreich war, wurden subjektive Befragungsdaten erhoben Physiologische Variablen werden erhoben: Herzfrequenz (HR), Schlagvolumen, Systolischer Blutdruck, Diastolischer Blutdruck (DBP), Atmungsfrequenz (RR), Gesichtstemperatur, Fingertemperatur, Hautleitfähigkeit (Niveau = SCL und Häufigkeit unspezifischer Änderungen = NSR) , Muskelspannung (Niveau =MT & Häufigkeit von Spitzenwerten = MT) Ergebnisse: Furcht: Sympathikus => starke Zunahme der Muskelanspannung und Hautleitwerte (MT, SCL, RR) Ärger: Parasympathikus & Sympathikus => starke Zunahme des systolischen Blutdrucks, größere Hautleitfähigkeit, größere Muskelanspannung (DBP, HR, NSR, MT) Ablehnung der Unspezifitäts- Hypothese, denn es zeigten sich unterschiedliche physiologische Reaktionsmuster Ablehnung der Hypothesen von Arnold; Befund spricht eher für Spezifität. Interpretation von Ax bezieht sich auf die Freisetzung von Hormonen, aufgrund der Veränderungen in den kardiovaskulären Variablen, insbes. Herzfrequenz und Blutdruck (hier kann man aber nicht von empirischen Befunden sprechen: der Hormonspiegel wurde im Experiment nicht bestimmt!) - Furcht: Freisetzung von Adrenalin - Ärger: Freisetzung von Adrenalin & Noradrenalin Studien in der Tradition von Ax (Induktionsmethode) 1.) Funkenstein et al, 1954: vergleichbares Vorgehen wie bei Ax - konnte Differenzierungen auf physiologischer Ebene feststellen zwischen: Angst - Ärger innen (gegen die eigene Person gerichtet) - Ärger außen (gegen Objekte, andere Personen gerichtet) feststellen 2.) Schachter, 1959: - konnte Differenzierungen auf physiologischer Ebene feststellen zwischen: Furcht – Ärger – Schmerz - Furcht: Adrenalin (Kongruenz mit Ax) – Ärger: uneinheitlich – Schmerz: Noradrenalin mehr Interpretation der hormonellen Veränderungen (wie bei Ax) und keine direkte Messung Schlußfolgerungen aufgrund von Änderungen der kardiovaskulären Variablen, insbesondere Herzfrequenz und Blutdruck 3.) Ekman, Levenson & Friesen, 1983 (1990 repliziert) - 1983: physiologische Variablen: Herzfrequenz und Temperatur - 1990: physiologische Variablen: Herzfrequenz, Hauttemperatur, Hautleitfähigkeit, Muskelspannung. - Untersuchung, ob durch Veränderungen in der Mimik, die mit bestimmten Emotionen verbunden sind, bestimmte physiologische Veränderungen hervorgerufen werden . emotionale Zustände mit bestimmten physiologischen Reaktionen produzieren setzt voraus, das an den Selbstwahrnehmungsansätzen auch etwas dran ist - 6 Grundemotionen: Überraschung, Ekel, Trauer, Ärger, Furcht, Glück => detaillierte Muskelveränderungen für die 6 Grundemotionen in der Mimik vorhanden (Ekman hat vorher kleinste Veränderungen untersucht). - „Directed Facial Action Task“ = Induktionsmethode; genaue Anweisungen zur Veränderung der Gesichtmuskulatur/Mimik wurde den Vpn gegeben ohne Vorgabe der jeweiligen Emotion Bsp. Anweisungen für Furcht: Hebe Deine Augenbraue und ziehe sie zusammen, hebe Deine oberen Augenlider, strecke Deine Lippen horizontal in Richtung der Augen; alles innerhalb von 15 sek. Ziel: die Anweisungen sollen Furcht auslösen Über Videokontrolle werden Veränderungen verifiziert - Gleichzeitig: Messung der Veränderung in den physiologischen Variablen im Vergleich „Ruhemessung“ – „Situation mit Gesichtsausdruck“ => Erfassen der Herzfrequenz, Temperatur der Hände, Hautleitfähigkeit, Muskelspannung 18 - Ergebnis (Folie): (1) stärkerer Anstieg der Herzfrequenz bei Ärger, Furcht und Trauer als bei Überraschung, Ekel und Glück. (2) deutlich höherer Anstieg der Handtemperatur nur bei Ärger - Entscheidungsbaum Ekman et al, 1983: hoch: Ärger („heiße Emotion“) hoch & Handtemperatur Herzfrequenz niedrig: Furcht/Trauer niedrig: Glück, Ekel, Überraschung sehr starke Differenzen: Ärger, Furcht, Ekel Hautleitfähigkeit Mittelstarke Differenzen: Glück, Überraschung, Trauer - Keine Ergebnisse zur Muskelspannung. Ekman zeigt, dass auch Differenzierung innerhalb negativer Emotionen, wie z.B. zwischen Ekel und Trauer möglich sind. Kritik: + Unterschiede zwischen Emotionen können nachgewiesen werden (Beweis für Spezifitätshypothese) + Replikation der Ergebnisse 1990 + auch die positive Emotion Glück wurde einbezogen und Unterschiede zu den negativen Emotionen festgestellt. - Kann man anhand physiologischer Veränderungen stringent auf Emotionen schließen? (nein...) - Studie von Ekman wurde kritisch überprüft, besonders in Bezug auf die Induktion der Emotionen => Annahme: das Vorgehen Ekman´s führt nicht unbedingt zu Emotionen, sondern die Induktionsmethode führt zu einer Veränderung der Atmung; diese Atemveränderung kann einerseits ein zentraler Faktor sein oder nur „Moderatorfunktion“ haben - Erklärung der Befunde Ekmans durch Levenson und Ekman, 1992/2002: 1992/ Annahmen Levenson et al.: willentlich produzierte Gesichtsausdrücke rufen spezifische Reaktionen des autonomen NS hervor biologische Erklärung: im Laufe der Evolution haben die Organismen sich so entwickelt, dass sie aus Anforderungen der Umwelt wirkungsvoll reagieren, die mimischen und peripherphysiologsichen Reaktionen = effiziente Antwort des Organismus auf Umweltreize Spezifität leitet sich von den emotionalen Merkmalen der Gesichtskonfiguration ab a) autonome Unterschiede zwischen den Emotionen sind am ausgeprägtesten, wenn die Konfigurationen der Mimik entsprechen b) wenn die Person die entsprechenden Emotionen auch tatsächlich erlebt c) Fall b ist dann wahrscheinlich, wenn Fall a zutrifft. - - - - Cacioppo et al. (1993) Untersuchung von Emotionen und ihrer physiologischen Bedingungen. Studie nach dem Vorbild Ax‘; Methode: Imagination. Differenzierte Messungen des systolischen und des diastolischen Blutdrucks (+ Elektromyogramm, Herzfrequenz, Gesichtstemperatur, Fingertemperatur) Ergebnisse sprechen teilweise für, teilweise gegen die Spezifitätshypothese. Fazit Mehrzahl der Studien legt nahe, dass sich Emotionen in ihren physiologischen Korrelaten durchaus unterscheiden können: pro James, contra Cannon. 19 - Konsistenz der Befunde ist nicht hoch, daher ist auch die Identifikation von Emotionen aufgrund der physiologischen Korrelate z.Zt. noch nicht möglich => mag daran liegen, dass Studien sich in Anzahl & Auswahl der Variablen unterscheiden und die Methoden unterschiedlich sind) - atheoretischer Zugang = nicht hypothesengeleitet, nicht aufgrund von theoretischen Überlegungen/ Erklärungen => man hat sich nur um die Frage gekümmert, ob es Unterschiede zwischen Emotionen gibt (durch Vergleich der Reaktionen), nicht warum und durch welche vermittelnden Prozesse (Ausnahme: Ekman). Ansätze sind rein deskriptiv, bieten keine Erklärungen Sinn und Unsinn dieser Forschung: - Psychosomatik: teilweise psychische Ursachen für Erkrankungen. Unterschiedliche Erkrankungen gehen auf unterschiedliche Emotionen und deren (inadäquate) Bewältigung zurück (entsprechend dem Postulat der Psychosomatik). Erkrankungen sind spezifisch für die Systeme, die bei den inadäquat bewältigten Emotionen eine Rolle spielen. - Hier spielt das Spezifitätspostulat also eine wichtige Bedeutung, da Handlungsabläufe abgeleitet werden könnten. II Studien orientiert an Cannons Ansatz Aktivationstheorie (Lindsley, 1951) - Theorie ist zwischen der Physiologie und der Psychologie angesiedelt. Theorie hat eingeschränkten Gültigkeitsbereich: beschränkt sich auf Frage der Intensität von Emotionen, vernachlässigt deren Qualität Gefühlsintensität und Erregungsintensität stehen in einem festen Zusammenhang: Je intensiver das Gefühl, desto höher das Erregungsniveau/ Aktivationsniveau = physiologische Körperaktivität Emotionen kann man also hinsichtlich ihrer Intensität beschreiben: die Dimension der „Intensität“ von Emotionen ist ein physiologischer Indikator (Veränderungen im autonomen NS) Entdeckung von Gehirnstrukturen im Zusammenhang mit Intensitätsaspekt von Emotionen, nicht bestimmten Emotionsqualitäten (Suche nicht nach Gehirnstrukturen als Zentren für bestimmte Emotionen) Methodischer Zugang = Messung über EEG (Elektroencephalogramm) Messung der Spontanfrequenz der elektrischen Spannungsschwankungen an der Schädeloberfläche Rhythmische Spannungsveränderungen auf ereignisbezogene Potentiale: Messung von Frequenzen zwischen 0,5 –30 Hz / Amplituden von 1 – 200 mV Wichtigsten Frequenzbänder des EEG: a) Alpha- Wellen: 8 –13 Hz/ 5 – 100 mV / treten okzipital, parietal auf b) Beta- Wellen: 14- 30 Hz/ 2 – 20 mV /treten praezentral, frontal auf c) Delta- Wellen: 0,5 – 4 Hz/ 20 –200 mV/ treten variabel auf d) Theta- Wellen 5 – 7 Hz / 5 – 100 mV/ treten frontal, temporal auf (Je langsamer das EEG, desto stärker ist die Amplitude [mV]) EEG einer „normalen“ Person: EEG wesentlich synchroner bei Entspannung als bei Anspannung. EEG eines Angstpatienten: Im Normalzustand zeigt sich ein synchrones EEG (hier ); bei einem Angstanfall dagegen zeigt sich ein extrem hochfrequentes -EEG. Eindimensionales Aktivationskontinuum: starke Gefühle Tiefschlaf, Koma + -Aktivationsnieveau - Psychische Zustände und ihre Korrelate im EEG, Erleben und Verhalten (Lindsley, 1961) Aussage der Theorie: Frequenz des Spontan- EEG gibt Aufschluß über Aktivationsgrad des Organismus und somit über die Intensität emotionaler Zustände: Desynchronisation = steigender Aktivationszustand. Psychische Zustände EEG Bewusstseinslagen Verhalten und Leistung Desynchronisiert, Eingeengtes Bewusstsein Desorganisiert Starke Gefühle, kleine bis mittlere Amplituden, Aufmerksamkeitsspaltung Mangel an Kontrolle Erregung & schnelle, gemischte Frequenzen Konfusion Schreck- & Panikreakt. Spannung Teilweise synchronisiert; Selektive Aufmerksamkeit Gut organisiert Wache vorwiegend kleine & schnelle Erwartung & Antizipation Optimale Leistungsfähigk. Aufmerksamkeit Spannungsschwankungen Konzentration Reaktionsbereitschaft 20 Entspannte Wachheit Synchronisiert Optimaler -Rhythmus Wandernde Aufmerksamkeit Assoziationen Gute Routinereaktionen Schöpferische Leistungen Schläfrigkeit Desintegration des -Rhythmus Flache Kurven Vereinzelt langsamere Wellen Leichtschlaf Verschwinden des -Rhythmus Größere, langsame Wellen Schlafspindeln Teilweise Aufmerksamkeits& Bewusstseinsverluste Bilddenken Pseudohalluzination Stark herabgesetztes Bewusstsein Erhöhte Reizschwelle Tiefschlaf Aktivierter Schlaf Sehr langsame, große Wellen Wachähnlich Schnellere Wellen mittlerer Amplitude Unkoordiniert Verzögerte Reaktionen Gestörte Zeitsequenzen bei Geschicklichkeitsleistungen Reaktionen nur auf sehr starke oder bestimmten Einstellungen entsprechende Reize - Bewusstseinsverlust Traumaktivität Stark erhöhte Reizschwelle - Frage nach Gehirnstrukturen, die für Veränderungen im EEG verantwortlich sind Befunde Moruzzi & Magoun [bilden Basis für Aktivierungstheorie: im Tierexperiment setzten sie Elektrode in Formatio Reticularis => gaben elektrischen Reiz => Desynchronisation im EEG (vor elektrischen Reiz: alphaEEG, danach: beta- EEG) - Formulierung der Aktivierungstheorie durch Lindsley: [eigene tierexperimentelle Läsionsstudien und elektrische Reizungen bestimmter Hirnareale] Formatio Reticularis = neurophysiologische Grundlage für aufsteigende Aktivität; reguliert den Erregungszustand/ Intensität der Emotionen ARAS = aufsteigendes, retikuläres Aktivierungssystem; laut Lindsley alle Strukturen die bei der Aktivierung beteiligt sind; aufsteigende Impulse, die EEG- Aktivation auslösen (1) EEG zeigt bei starken Emotionen „Aktivationsmuster“: alpha- Reduktion, Beta- Zunahme (2) Eine elektrische Reizung der FR ruft eine kortikale Desynchronisation hervor. (3) Zerstörung der FR / Durchtrennung der aufsteigenden Bahnen von Formatio Reticularis zum Cortex führt zu synchroner hirnelektrischer Aktivität (4) Verhalten bei Zerstörung der FR gegenteiliges Verhalten zur emotionalen Erregung tritt auf: Schläfrigkeit, Apathie Formatio reticularis kann aber nicht alleine verantwortlich sein, da sich 2 Wochen später wieder regulärer Schlaf- Wach – Rhythmus zeigt (5) FR aufsteigende Impulse: EEG- Aktivation FR absteigende Impulse: peripherphysiologische und motorische Veränderungen Erregung der Großhirnrinde durch FR ist unspezifisch => zusätzlich kommt es aber durch das ARAS zu einer spezifischen Erregung des betroffenen sensorischen Areals Problem bei Lindsley: Untersuchung nur anhand negativer Emotionen - Weiterentwicklung der Aktivationstheorie - Spekulativ = keine empirischen Belege Routtenberg Brachte das limbische System vor allem mit motivationaler Aktivierung in Verbindung =>Erklärung für die Aufrechterhaltung von belohnungsmotivierten Verhalten Zwei Aktivationssysteme: Formatio Reticularis Septum (Teil des limbischen System) Pribram & McGuinness Drei Aktivierungssysteme: (weitere Ausdifferenzierung des Modells Routtenbergs) 1. „Arousal“; kurzfristige, reizbezogene Veränderung (Amygdala) 2. „Activation“; längerfristige Bereitschaft für eine Reaktion (Basalganglien) 3. „Effort“; Koordination von „Arousal“ & „Activation“; Willkürhandlungen (Hippocampus) Hirnzentren 21 - Frage nach verantwortlichen Hirnzentren für Emotionen Cannon war der Auffassung, dass Thalamus sensorische Reize emotional einfärbt; für alle Emotionen zuständig sei => andere Forscher suchen nach bestimmten Hirnzentren für spezielle Emotionen Problem: nur Tierversuche möglich, dadurch eingeschränkter Geltungsbereich: keine Aussagen über subjektives Erleben möglich weiteres Problem: strenge Lokalisation nicht möglich Methodisches Vorgehen: 1. Läsionsstudien = bestimmte Hirnareale werden entfernt (zerstört) durch chirurgischen Eingriff o. Hochfrequenzreizung; Überprüfung ob Emotion dann trotzdem noch vorhanden ist 2. künstliche, elektrische Stimulation bestimmter Gehirnregionen Theorien des limbischen Systems = alten Gehirnanteile der Endhirnhemisphäre & subkortikaler Gebiete: Hippocampus, Septum, Amygdala = Mandelkerne (Folie: Verbindungswege im limbischen System...) 1. Läsionsstudien: Klüver- Bucy- Syndrom: Läsionen im Bereich des Temporallappans führen bei Rhesusaffen zu: - hyperorales Verhalten (alles wird in den Mund genommen) - Hypersexuelles Verhalten (Kopulationsversuche z.B. mit anderen Spezies) - Verlust an Angst vor zuvor gefürchteten Objekten (z.B. Schlangen) und Verlust von Aggressivität. In Nachuntersuchungen wir die Rolle der Amygdalae untersucht. Schlußfolgerungen: Mandelkerne als Zentrum zur Generierung von Furcht & Aggression Rosvold, Mirksy & Pribram 1954: untersuchten Einfluß des bilateralen Entfernen der Mandelkerne bei einer Gruppe von Rhesus- Affen vor der Entfernung: innerhalb der Gruppe war eine klare Machthierachie vorhanden: (1) Dave = dominant, selbstsicher, majestätisch, (2) Zeke, (3) Riva ... (8) Larry = unterwürfig, wird von den anderen drangsaliert Ergebnis: nach der bilateralen Entfernung der Mandelkerne Änderung der Machthierachie: einzelne Affen mit entfernten Mandelkernen erfahren Rangplatzverlust: Dave (als erster) zeigt nach der Entfernung einen Agressionsverlust; rutscht in seiner Stellung unter Larry und bekommt nun die Schläge ab => Zeke tritt an seine Stelle: nach Entfernung der Mandelkerne bei Zeke, tritt auch bei Ihr Aggressionsverlust ein => Riva tritt an die erste Stelle: nach Entfernung der Mandelkerne bei Riva, zeigt diese jedoch stärkeres und unvorhersagbar aggressives und bösartiges Verhalten. nicht kontinuierlich alle der operierten Affen zeigen Aggressions- und damit einhergehenden Rangplatzverlust Erklärung für widersprüchliche Ergebnisse: (Riva) - bei der OP von Riva Fehler gemacht und nicht alle relevanten Strukturen wurden entfernt: Mandelkerne keine einheitliche Struktur, sondern viele Fasern, die miteinander in Beziehung stehen - andere Studien fanden heraus, dass Mandelkerne nicht monokausal für Aggressionsverhalten sind, sondern andere Strukturen mitverantwortlich sind => diese haben dann u.U. Aufgaben der Amygdala übernommen (z.B. Hippocampusformation) - Einzelexperiment - Hypothese über den Zusammenhang der Mandelkerne mit Aggressionsverhalten einfach falsch und die Ergebnisse der ersten vorangegangenen Tieren (Dave, Zecke) sind auf andere Faktoren zurückzuführen. - 2. - - künstliche elektrische Stimulation: Olds & Milner Nachweis von Belohnungs- /Lustzentren durch gezielte elektrische Reizung bestimmter Hirnzentren Ursprünglich Versuchsfehler: Elektrode die in der Formatio Reticularis plaziert werden sollte, landete im Septum Untersuchung an nahrungsdeprivierten Tieren Tiere erhielten auf der linken Seite eines sog. T- Labyrinths Futter auf der rechten Seite elektrische Reizungen des Septums: konnten zwischen elektrischen Reizen und Futter wählen Ergebnis: Obwohl Tiere Hunger hatten bevorzugten sie die Reizung des Septums Instrumentelles Lernen: Reizung im Septum als „positiver Verstärker“ Änderung der Versuchsmethode: Selbstreizung/-stimulation mit elektrischen Reiz durch Drücken eines Hebels Ergebnis: Tiere reizten sich selber mit unheimlich hoher Frequenz von bis zu 5000 mal/h 22 - Spätere Untersuchungen zeigten, dass es weitere Gebiete gibt, die einen ähnlichen Effekt wie Septum haben => Septum ist also nicht alleine ausschlaggebend - Fazit Hirnzentren: Strenge Lokalisationsansätze sind generell im Gehirn nicht haltbar: meist nicht eine einzelne, abgegerenzte Struktur, die für bestimmte Emotion zuständig ist mehrere Möglichkeiten zur Erklärung im veränderten Verhalten bestehen: niemals eindeutig, viele Fehlschlüsse möglich Probleme der Läsionsmethodik: Die lädierte Struktur ist alleine zur Steuerung des Verhaltens notwendig. Dieser optimaler Fall ist äußerst selten Die Störung des beobachteten Verhaltens ist nur ein Nebenprodukt der Elimination eines anderen Verhaltens => lädierte Struktur nicht notwendig zur Steuerung des Verhaltens Effekt der Läsion ist nur vorrübergehend; psychologische und neuronale Kompensationsprozesse führen oft zu vollständiger Wiederherstellung Die zerstörte Struktur besitzt Faserzüge zu einer entfernten Struktur, die für das Verhalten verantwortlich ist, aber Teilinformationen aus dem zerstörten Gebiet benötigt => lädierte Struktur nur teilweise notwendig zur Steuerung des Verhaltens Die Läsion in einem Gebiete führt zu einer Enthemmung einer anderen Region, die zuvor von der zerstörten Struktur gehemmt wurde Die Effekte sind nur sekundäre Prozesse der mit dem Eingriff & Heilung verbunden Prozesse. Neuere Ansätze Analyse der Neurochemie und biochemischen Vorgänge (Neurotransmitter), die bei Emotionen ablaufen Analyse von WW zwischen Gehirnstrukturen: nicht mehr eine Gehirnstruktur verantwortliche Struktur/ Zentrum für eine Emotion Entwicklung neurophysiologische Netzwerkmodelle, um die Fülle von Einzelergebnissen zu intergieren; z.B. Le Doux (a) (b) (c) (d) (e) (f) - Le Doux; 1989 - - Dies ist kein umfassendes Emotionsmodell: Nur Furcht wird untersucht. Dieses Modell hat Vorbildcharakter, ist aber inhaltich beschränkt. Cannon´s Annahme: Thalamus = Zentrum von Emotionen Fehlschluss, denn Thalamus (laut Le Doux) nur weiterleitende Instanz Amygdala / Mandelkerne = zentrale Funktion bei der Entstehung von Emotionen, allerdings nicht in Form eines „Emotionszentrums“, sondern sie sind eine wichtige Struktur innerhalb eines komplexen Netzwerkes. Hauptfunktion = sensorischen Reizen eine emotionale Bedeutung/ emotionale Einfärbung geben Auslösung der emotionalen Reaktion (endokrin & autonom) & emotionales Verhalten emotionale Reaktion: zentraler Kern der Amygdala Weiterleitung in verschiedene Kerngebiete z.B. Hypothalamus (autonomes NS) veranlassen bestimmte emotionale Reaktionen: Blutdruck, Hormonausschüttung, Streßreakion Weitervermittlung von Informationen aus der Umwelt: Die Information wird zuerst direkt in den Thalamus geleitet. Von hier aus gibt es 2 Wege: 1. Thalamus Cortex Amygdala peripher (emotionale Reaktion): elaborierte Reizanalyse/ „hoher Weg“ 2. Thalamus Amygdala peripher (emotionale Reaktion): „niederer Weg“ Von Peripher gibt es wiederum Rückmeldemechanismen zurück zur Amygdala. Der 2. Weg stellt eine grobe Reizverarbeitung im subkortikalen Bereich dar und dient als„Vorwarninstanz“; Bsp. Schlange => Furchtreaktion; es besteht möglicherweise eine Bedrohung; niederer Weg ermöglicht schnelle und direkte Adaption an Umweltsituationen Körperperipherie erfährt schnelle, essentielle Dinge über Qualität von Emotionen, kann noch vor elaborierter Bewertung aus dem Cortex (Bsp. Schlange ist doch nur ein Stock) reagieren LeDoux: „Es ist wesentlich besser einen Stock versehentlich für eine Schlange zu halten, als auf eine mögliche Schlange nicht reagiert zu haben.“ Zentraler Kern der Amygdala 23 Zentrales Grau - - Lateraler Hypoth. Paraventrikularer Hypoth. Reticulopontis caudalis Starre Blutdruck Stresshormone Schreckreaktion Identifikation von Rückmeldeschleifen (Feedbackschleifen ) aus der Peripherie an die Amygdala = Amygdala erhält Rückmeldungen über die Reaktionen, die sie veranlaßt hat hat zentrale Bedeutung für Feedback- Theorie von James und andere nachfolgende Feedback- Theorien Darstellung als komplexes Netzwerkmodell: weitere Faktoren, die Emotionen beeinflussen Rhinale (Übergangs-)rinde Erinnerungen Sensorische Großhirnrinde Hippocampus genaue Objektanalyse „hoher Weg“ Erinnerungen und Kontexte Sensorischer Thalamus grobe Reizmerkmale/ „niedererWeg“ Amygdala Mediale praefrontale Rinde Löschung FURCHT: Reaktionen (endokrin, autonom), Erfahrungen Emotionsmodell von Rolls - Emotionen und Verstärkungskontingenzen (Rolls, 1999) (Kontingenzen im Sinne Skinners) S+ Darbietung eines positiven Verstärkers S+! Beendigung eines positiven Verstärkers S- Darbietung eines negativen Verstärkers S- Auslassen eines negativen Verstärkers S+ Auslassen eines positiven Verstärkers S-! Beendigung eines negativen Verstärkers S+ Rage Anger Grief Ecstasy Elation Pleasure Frustration Relief Sadness Apprehension Fear Terror S-/S-! S-/S-! SDie Annahmen Rolls‘ sind vor allem auf der Seite des Organismus sehr differenziert: Welche Verhaltensmöglichkeiten gibt es? Was sind ihre physiologischen Grundlagen? Reflexe; vegetative Reaktionen; endokrine Systeme; implizites (unbewusstes) und explizites (bewusstes, planvolles) Verhalten. Sprachcortex Kortikale Motor- & Planungszentren Explizites Verhalten Amygdala & orbitofrontaler Cortex Striatum Primäre Verstärker Thalamus Assoziationskortex Sekundärer Kortex Implizites Verhalten ventrales Striatum Automatische Reaktionen Primärer Kortex Input Prämotorischer Kortex Hirnstamm Rückenmark Reflexe 24 Fazit der physiologischen Ansätze (James und Cannon) - James/ Cannon: beide Theorien in ihrer ursprünglichen Fassung beide inkorrekt gewesen => James konzentrierte sich nur auf Bewußtseinszustände; Cannon fast ausschließlich auf Emotionsausdruck 1. - Feedback- Prozesse spielen ohne Zweifel eine Rolle: Unklar: welche Feedbackprozesse (Körperperipherie und/ oder Gescihtsmuskulatur) entscheidend und ob ihnen tatsächlich eine kausale Rolle bei Emotionsentstehung zukommt Bestätigt Theorie James. Emotionen haben mit Selbstwahrnehmung zu tun 2. Gehirnstrukturen, vor allem subkortikale Strukturen, sind für Emotionen von (kausaler) Bedeutung: - Unklar: welche Strukturen im einzelnen von Bedeutung und ob bei unterschiedlichen Emotionen unterschiedliche Gehirnstrukturen beteiligt sind und welche Informationen (Umwelt & Körper) von diesen Strukturen wie verarbeitet werden - Klar: strenge Lokalisationsansätze nicht möglich => zukünftige Modelle: Bedeutung einzelner Strukturen nur im Kontext /Verbund mit anderen Strukturen (Le Doux: „Netzwerke“) Kerne dieser subkortikalen Strukturen lösen peripher – physiologische Reaktionen hervor 3. Periphere Körperreaktionen sind emotionsspezifisch: - Unklar: wie die peripheren Korrelate von unterschiedlichen Emotionen tatsächlich aussehen und über welche Strukturen und Mechanismen sie zustande kommen 2. Lerntheoretische Ansätze - - Zuerst Introspektion: „subjektive Psychologie“ ; mittels Methoden der Selbstbeobachtung versucht man Erlebens- und Bewusstseinszustände zu erfassen & zu analysieren. 1920-1960: Behaviourismus: „objektive Psychologie“ (Psychologie als Naturwissenschaft); Forschungsgegenstand war nicht mehr das „Erleben“, sondern ausschließlich das intersubjektiv beobachtbare Verhalten (Reaktion) und die das Verhalten auslösenden/beeinflussenden beobachtbaren Umweltgegebenheiten (Reize) o klassischer Behaviourismus: John Watson o Neobehaviourismus: Mowrer, Clark Hull, 1943 o Radikaler Behaviourismus: Skinner, 1953 Hauptmerkmale Lerntheoretischer Ansätze: 1.) Emotionales Verhalten wird in Abhängigkeit von Umweltereignissen analysiert 2.) Innere Strukturen oder Prozesse für die Erklärung von Emotionen keine bzw. keine zentrale Rolle: lerntheoretische Ansätze sind daher „antimentalistisch“ = nehmen kein Rekurs auf innere Zustände 3.) Der zentrale Erklärungsprozeß für das Entstehen emotionalen Verhaltens ist das Lernen: bestimmte Lernprinzipien, Lernkonzepte Watson, 1913 - - - 1913: soz. behaviouristisches Manifest unter dem Titel „Psychology as the Behaviourist Views“ Begründer des orthodoxen Behaviourismus = Forschung beschränkt sich nur auf Verhalten, welches durch Fremdbeobachtung zugänglich ist; Erleben/ Bewusstseinszustände sollen aufgrund der Privatheit nicht zum Gegenstand der Psychologie werden => Erlebniszustände müssen auch gar nicht berücksichtigt werden, da sie ohnehin nicht zur Erklärung und Verhaltensvorhersage dienen (lt. Watson) Def. Emotion (laut Watson): angeborene viszerale Reaktionsmuster, die durch bestimmte Reize verlässlich ausgelöst werden und den Organismus kurzfristig in einen „chaotischen Zustand“ versetzen. Reiz- Reaktionsmuster beinhalten Veränderungen des körperlichen Mechanismus als Ganzem, insbesondere der viszeralen Prozesse (Eingeweide und Drüsensysteme). disruptiv, disfunktional, unnütz: „... dass die Welt der Objekte und Situationen, von der die Menschen umgeben sind, viel komplexere Reaktionen hervorruft, als für eine wirksame Benutzung oder Manipulation des Objekts oder der Situation erforderlich wäre.“ (1930/76) unnütze Reaktionen: man muß sie daher kontrollieren, bestenfalls zum Verschwinden bringen reine Formen der angeboren emotionalen Reaktionsmuster treten nur beim Säugling auf, beim Erwachsenen werden die angeborene Muster durch Lernerfahrung modifiziert und auch durch andere, neue Reize ausgelöst 3 ungelernte emotionale Reaktionsmuster die von verschiedenen Gruppen von Reizen ausgelöst werden bilden die Grundlagen für alle späteren emotionalen Reaktion => Watson ließ die Frage allerdings offen, wie alle später entstehenden Emotionen sich aus diesen 3 Grundemotionen herausbilden. 25 - Untersuchungen anhand von Experimenten an vielen Säuglingen und Kleinkindern: z.B. Konfrontation mit Tieren/ lauten Geräuschen/ Wegziehen der Decke... I. Furcht (X): - UCS: laute Geräusche, Haltverlust - UCR: überwiegend Reaktion viszeraler Art , Anhalten des Atems, „Auffahren des Körpers“, Schreien, Defäkation & Urinieren II. Wut (Y): - UCS: Behinderung/Einschränkung der Körperbewegung (Bewegungsfreiheit) - UCR: Steifwerden des ganzen Körpers, Schreien, zeitweiliges Aussetzen der Atmung, Rötung des Gesichts bis zur Blaufärbung, etc. viele offensichtliche Reaktionen; die meisten sind aber wahrscheinlich viszeraler Art (z.B. Erhöhung d. Blutzuckerspiegels = vermehrte Sekretion d. Nebenniere bei unsanft behandelten Kindern) III. Liebe (Z): - UCS: Streicheln der Haut und der Geschlechtsorgane, Schaukeln, auf den Knien reiten usw. - UCR: Schreien hört auf, Gurgeln, Glucksen und viele andere nicht bestimmte Reaktionen; Vorherrschen viszeraler Faktoren ist an Veränderungen des Kreislaufs und der Atmung, sowie Erektion des Penis usw. erkennbar - Erwerb von Emotionen: Lernprinzip des „klassischen Konditionierens“ beim Erwachsenen haben sich aus den 3 Kernemotionen komplexe emotionale Reaktionen entwickelt durch Einfluß der Umgebungsfaktoren. „klassisches Konditionieren“ = ursprünglich neutrale Reize können durch Lernerfahrungen ebenfalls die Fähigkeit erwerben die 3 Grundemotionen auszulösen Substitution eines Stimulus = Reizersetzung; durch klassisches Konditionieren treten anstelle der ursprünglichen Reize (z.B. bei Furcht Verlust von Halt, laute Geräusche) andere (auch mehrere andere) Reize, die nun ihrerseits eine Furchtreaktion auslösen genauso wie auch weitere, über die Grundemotionen hinausgehende Emotionen durch Konditionieren erworben werden (aus den 3 Grundemotionen) große Unterschiede zwischen Individuen in Bezug auf die Situationen/Reize die eine bestimmte emotionale Reaktion auslösen (z.B. Furcht): aufgrund unterschiedlicher Lernerfahrungen Vorgang des klassischen Konditionierens: unkonditionierter Stimulus (UCS) löst eine angeborene, reflexartige Reaktion beim Individuum aus (UCR) neutraler Reiz (NS) löst nicht wie der UCS eine reflexartige Reaktion aus, lediglich eine Orientierungsreaktion (OR). wiederholte, zeitlich eng aufeinanderfolgende Kombination von NS mit UCS führt dazu dass auch in alleiniger Darbietung der zuvor neutrale Reiz, nun aber konditionierte Reiz (CS), die UCR auslöst, die nun auch konditionierte Reaktion (CR) genannt wird. Die CS ist nicht unbedingt identisch mit der UCR, jedoch sehr ähnlich. - - - empirische Untersuchungen zum Erwerb und Beseitigung von Furchtreaktionen vier zentrale Fragen a. Konditionierung von Furchtreaktionen: Kann man bei einem Menschen eine Furchtreaktion auf einen ursprünglich neutralen Stimulus konditionieren, wenn man ihn zusammen mit einem unkonditionierten Reiz darbietet? b. Reizgeneralisierung: Falls solch eine emotionale, konditionierte Reaktion hergestellt werden kann, überträgt sich diese dann auch auf andere Objekte? c. Zeitliche Beständigkeit: Welche Wirkung hat der Faktor Zeit auf die Aufrechterhaltung von konditionierten Reaktionen? d. Löschung/ Beseitigung: Wenn die konditionierte Furchtreaktion mit der Zeit nicht von selbst verschwindet, wie kann man sie dann im Laborexperiment beseitigen? I. „der kleine Albert“, Watson & Rayner,1920: Erwerb von Furchtreaktionen - 11 Monate alte Albert, Sohn einer Amme im Hospital - Ziel der Untersuchung: dem kleinen Albert die Furcht vor Felltieren zu lehren (a) Phase 1 : Test von NS und UCS 26 - - (b) (c) - (d) - (e) - Feststellung inwieweit bestimmte Tiere/ Objekte Furchtreaktionen bei Albert auslösen durch Konfrontation des Alberts mit Kaninchen, weißer Ratte, einem Affen, Maske mit weißem Haar etc. => Albert zeigte keine Furchtreaktion; NS = neutrale Reize Feststellung inwieweit bestimmte unkonditionierte Reize (UCS) eine unkonditionierte Furchtreaktion (UCR) auslösen: Konfrontation mit einem sehr lauten Geräusch; Vl schlug mit Hammer auf eine Eisenstange => Albert zeigte Furchtreaktion; UCS = unkonditionierter, angeborener Auslösereiz Phase 2 (2 Monate später): Konditionierte Furchtreaktion auf einen neutralen Stimuli soll hergestellt werden Gemeinsame Darbietung von UCS = Geräusch durch Schlag auf Eisenstange und NS = weiße Ratte Phase 3 (unmittelbar danach): alleinige Darbietung des CS Ratte wurde alleine dargeboten und Albert zeigte eine Furchtreaktion: der ursprünglich neutrale Reiz = NS der weißen Ratte hatte sich aufgrund von Lernprozessen die während der gemeinsamen Darbietung von NS und UCS stattfanden, in einen konditionierten Reiz = CS verwandelt, der eine konditionierte Furchtreaktion = CR auslöst, die der ursprünglichen Furchtreaktion ähnelt. Weitere Phase (5 Tage später): Untersuchung der Reizgeneralisierung = inwieweit werden Furchtreaktionen auch durch Reize ausgelöst, die dem konditionierten Reiz ähnlich sind Konfrontation mit Bauklötzen, Kaninchen, Hund, Pelzmantel, Seehundfell, Watsons Haar, Baumwolle, bärtige Nikolausmaske => Albert zeigte Furchtreaktion vor Kaninchen, Hund, Pelzmantel (negative Reaktion, leichte Furchtreaktion auch vor Watsons Haar, Nikolausmaske, Baumwolle), Bauklötze lösten keine Furcht aus, auch nicht der Raum in dem die Versuche stattfanden Furchtreaktion hatte sich nur auf solche Reize generalisiert, die dem ursprünglichen konditionierten Reiz besonders ähnlich waren Weitere Phase (nach 31 Tagen ohne weitere Tests):zeitliche Beständigkeit der konditionierten Furchtreaktion Erneute Konfrontation Alberts mit den o.g. Objekten (zusätzlich noch konditioniertes Furchtobjekt: weiße Ratte) => wieder zeigte Albert unverändert Furchtreaktionen vor der Ratte, dem Kaninchen, Hund und Pelzmantel Ergebnisse zusammenfassend: Es ist möglich einen Reiz, der ursprünglich keine Furchtreaktion auslöst, in einen konditionierten Reiz zu verwandeln, der Furcht als konditionierte Reaktion auslöst Reizgeneralisierung: auch andere Reize, die dem konditionierten Reiz (CS) ähnlich sind = Generalisierte CS , können Furchtreaktionen auslösen Furchtreaktionen auf den konditionierten Reiz (CS) und auf ähnliche Reize = generalisierte CS weisen eine gewisse zeitliche Beständigkeit auf II. „der kleine Peter“; Abbau von Furchtreaktionen Beseitigung von Furchtreaktionen: „Entkonditionierungsversuch“ - Konnte am „little Albert“ nicht durchgeführt werden, da dieser mit seiner Mutter wegzog. - Peter (3 Jahre) zeigte ebenfalls Furchtreaktion vor weißer Ratte, jedoch unbekannt, wie er diese erworben hat; zeigte darüber hinaus auch Furchtreaktion auf generalisierte CS (Pelzmantel, Feder, Kaninchen...) - Watson erforschte 4 konkrete Methoden zum Abbau von Furchtreaktionen: a. Nichtgebrauch: CS = der furchtauslösende Reiz wird längere Zeit nicht dargeboten => nicht sehr effektiv; führte beim kleinen Peter nicht zum Abbau der Furcht vor Tieren/ Gegenständen mit Fell b. Nachahmung: Beobachtung eines Modells => Beobachtung von jemanden, der ohne Angst/ Furcht mit der weissen Ratte spielt (konnte nicht genau untersucht werden, wegen Krankheit des kleinen Peters) c. Reizwiederholung/- überflutung: CS = der furchtauslösende Reiz wird großer Häufigkeit dargeboten => führte beim kleinen Peter zu negativen Effekten = Intensivierung der Furchtreaktion (Teilweise aber auch hilfreich). d. Ent-/ Rekonditionierung: Erlernen einer antagonistischen Reaktion Effektivste Methode Tauchte später in Verhaltenstheraphie unter „systematische Desensibilisierung“ auf - Vorgehensweise bei Desensibilisierung: - emotional aversiver konditionierter Reiz (CR) kann durch wiederholte Koppelung mit einem emotional positiven Reiz (UCR), der eine positive Reaktion hervorruft, auch zu einem emotional positiven Reiz werden, der eine positive Reaktion = antagonistische CR hervorruft - Peter wurde in ein Stühlchen gesetzt und erhielt sein Lieblingsessen; während Peter aß kam die Experimentatorin mit dem Kaninchen, das in einem Käfig saß in den Raum - das Kaninchen schrittweise näher an Peter herangebracht, so dass Peter am Ende der Therapie in der Lage war das Kaninchen zu streicheln, während er aß 27 - - Ergebnis: Ratte als ursprünglich furchtauslösender Reiz (CS) ist nicht länger mit Furcht assoziiert, sondern mit positiver Aktivität (UCS), löst daher auch positive Reaktionen aus (CR) Entkopplung von emotionaler Reaktion und den Reizen, die diese Verhaltensweisen auslösen gelungen positive Aktivität wie z.B. Nahrung, Entspannung, welches zu positiven Reaktionen führt: parasympathische Körperreaktionen vorsichtige, langsame Annäherung: ohne dass Angstreaktion ausgelöst wird gleichzeitige Darbietung des Furchtreizes: Ratte, welche zu Furchtreaktionen führt: sympathische Körperreaktionen systematische Desensibilisierung in der Verhaltenstherapie (Wolpe, 1958) = bei emotionalen Störungen, insbesondere Ängste /Phobien Unterschied zu Watson´s Desensibilisierung = der angstauslösende Reiz ist dabei nicht anwesend, sondern die Patienten haben sich den Reiz bloß vorzustellen; zunächst Vorstellung einer minimal angstauslösenden Situation gleichzeitig positiver Reiz = Entspannung; der Patient lernt sich zu entspannen gelingt es dem Patient auf den angstauslösenden Reiz/ Situationsvorstellung Entspannung zu zeigen ist die Angstreaktion beseitigt; im Laufe der Therapie wird auf diese Weise die gesamte Angsthierachie bearbeitet = von minimal bis stark angstauslösende Situationen Kritikpunkte Watson; klassisch behaviouristische Sichtweise (1) Repräsentativität/ Verallgemeinerung: jeweils nur ein Versuchsteilnehmer (Peter, Albert) (2) fraglich inwieweit klassisches Konditionieren als Erklärung für Furchtreaktion ausreichend ist: Erlernen von Furcht kann auch durch Beobachtung stattfinden oder Furcht wird durch verbale Mitteilungen hervorgerufen (Androhungen von Strafen) (3) keine alltagsnahe, wissenschaftliche Definition von Emotionen als beobachtbare Reaktionsmuster keine Aussage worin z.B. die Natur derjenigen Zustände liegt, die wir im Alltag als Emotionen beschreiben keine Berechtigung Emotionen als desorganisierende Reaktionen zu bezeichnen; Instinkte = adaptive Reaktionen => auch Emotionen beim Erwachsenen: keine Erklärung wie aus diesen 3 angeborenen Reaktionsmustern die anderen Emotionen entstanden sind Ausschluss des subjektiven Empfindens; innere Zustände, mentale Prozesse als Teil der Emotionen gänzlich ausgespart Positive Resultate: Einfluß in der Methodik der modernen Emotionspsychologie: das Experimentieren mit größeren Gruppen und die Erhebung physiologischer und von Verhaltensdaten spielt eine große Rolle Anstoß für weitere Forschungen über Konditionierung z.B. von Ängsten, emotionaler Bedeutungen ... Mowrer - - Neobehaviourist = liberalisierte antimentalistische Position Watsons => vermittelnde Prozesse, die nicht direkt beobachtbar sind, werden akzeptiert/ Akzeptanz von nicht direkt beobachtbarem Verhalten. Watson: S (Reiz) R (Reaktion)/ Mowrer: S (Reiz) O (Organismus) R (Reaktion) Vermittelnde Prozesse im Organismus = intervenierende Variablen; z.B. Emotionen und Motivation vermitteln zwischen Reiz und Reaktion Daher auch keine fixe Beziehung zwischen S (Reiz) und R (Reaktion); Reaktion kann je nach Einfluß der intervenierenden Variablen Emotion und Motivation unterschiedlich ausfallen Definition Emotion (laut Mowrer) = sekundäre, d.h. gelernte Triebe, die von sekundären – positiven o. negativen- Reizen hervorgerufen werden und die (analog zu den primären, ungelernten Trieben) verhaltenswirksam sein können. Dabei wird die Wirkung von Emotionen auf das Verhalten schwerpunktmäßig unter motivationalen Aspekten betrachtet. Neue Verhaltensweisen sind das Ergebnis der Reduktion eines sekundären Triebes, wobei diese Triebreduktion als Verstärker fungiert. Grundannahmen: (1) Differenzierung zwischen negativen und positiven Reizen; angeborene Reiz- Reaktions- Verbindungen S (-) Schmerz S (+) Lust (2) Lernprozess : Koppelung von angeborenen negativen/ positiven Reizen mit neutralern Reizen (CS) gekoppelt: - CS mit S (-) gekoppelt CS wird zum Gefahrensignal Angst tritt auf 28 Beeindigung der Gefahrensignale: Angstreduktion durch bestimmtes Verhalten (Flucht, Vermeidensreaktion...) wird positiv verstärkt - CS wird mit S (+) gekoppelt CS wird zum Sicherheitssignal Hoffnung tritt auf Beendigung der Sicherheitssignale: Enttäuschung resultiert Kurzzeitig: Emotion Ärger Längerfristig: Emotion Trauer - - - - - „Zwei- Faktoren- Theorie der Angst“ Mowrer befaßte sich hauptsächlich mit den negativen Reizen/ Gefahrensignalen und wie Angst gelernt wird, bzw. es sich auf das Verhalten auswirkt (motivationaler Aspekt). Kombination von klassischer Konditionierung und instrumenteller/operanter Konditionierung = eine Handlung, Reaktion wird reinforced (Belohnung) verstärkt und ihre Auftretenswahrscheinlichkeit erhöht sich => wird in Zukunft instrumentell eingesetzt, um Ziel = Erlangung der Verstärkung zu erreichen Emotion = sekundärer Trieb:„Triebe/Emotionen können erlernt werden“ z.B. Angst als instrumentell konditionierte Reaktion auf einen zuvor neutralen Hinweisreiz Phase 1 klassisches Konditionieren: - ein beliebiger, neutraler Stimulus, der zu einer neutralen Reaktion führt = R (z.B. Kopfwenden, OR) - neutraler Stimulus = NS wird zum CS = konditionalen Stimulus durch Koppelung mit UCS = SchmerzFurchtstimulus (z.B. e-Schock), der zu einer UCR = Schmerz- Furchtreaktion (Schmerzempfindung, Erregung) führt Phase 2 bedingter Reflex: - CS = konditionaler Stimulus CR = Angst- Furcht- Reaktion - CR ist nicht identisch mit der UCR, insofern als hier kein Schmerz, sondern eine antizipatorische Schmerzreaktion ausgelöst wird Phase 3 instrumentelle Vermeidenskonditionierung: - CS CR (Angst- Furcht- Reaktion) und CS + CR R = spontane Flucht- bzw. Vermeidensreaktion (z.B. Weglaufen) Reduktion der Angst = Verstärkung des Vermeidungsverhaltens Phase 4 gelernte Vermeidensreaktion: - CS R (Vermeidensreaktion) Verstärkung + CS führt abgeschwächt zu CR (Angst- Furcht- Reaktion) Empirische Überprüfung im Rattenexperiment; Miller 1948 Käfig mit 2 Kammern, durch Tür getrennt voneinander; diese Tür kann von Ratte über Betätigung einer Rolle/ eines Hebels geöffnet werden: a) weiße Kammer mit elektrifizierbarem Boden; Gitterrost b) schwarzer Kammer mit normalem Boden 1. Phase Exploration: - Tür offen - Ratte konnte sich frei im Käfig bewegen/ Test, ob Ratte Abneigung gegen eine Käfighälfte hegt 2. Phase Klassische Konditionierung: - Tür offen - Ratte in weißer Käfighälfte wird dort einem US = elektrischer Schock = primärer, angeborener Triebstimuli ausgesetzt UR = Schmerz- Furchtreaktion, Flucht/ Sprung in schwarze Käfighälfte - US kombiniert mit CS = weiße Käfighälfte; konditionaler Stimulus, wird zu erlerntem, sekundären Triebstimuli - Schwarze Käfighälfte ist mit Erfahrung des Schutzraumes assoziiert 3. Phase Test: - Überprüfung ob Konditionierung erfolgreich war - Tür offen - Ratte in weißer Käfighälfte ohne elektrische Schocks (UR) die verabreicht werden - CS = weiße Käfighälfte alleine löst CR = Angst- Furcht –Reaktion aus 4. Phase Instrumentelle Konditionierung I: - Tür zu: nur durch Betätigung einer Rolle zu öffnen - Ratte in CS = weißer Käfighälfte CR = Furchtreaktion R = Betätigung der Rolle, dadurch Tür offen und Flucht der Ratte ins schwarze Käfighälfte möglich Reduktion der Angst = Verstärkung des Verhaltens - Phase wurde 16 x wiederholt => Betätigung der Rolle wurde immer schneller, effektiver, genauer 29 5. Phase Instrumentelle Konditionierung II – Umlernen: Tür zu: nur durch Betätigung eines Hebels zu öffnen Ratte in CS = weißer Käfighälfte CR = Furchtreaktion R = Betätigung des Hebels, dadurch Tür offen und Flucht der Ratte ins schwarze Käfighälfte möglich Reduktion der Angst = Verstärkung des Verhaltens Problem: Aufgrund der schnellen Vermeidungsreaktion müsste die Verbindung zwischen CS und CR schnell gelöscht werden und damit die Vermeidungsreaktion verschwinden Dies ist allerdings nicht der Fall. Angstkonservierung „Irreversibilität des klassischen Konditionierens von Angst-Reaktionen“ (Kann nicht über die Zwei-Prozess-Theorie erklärt werden). Fazit: - emotionale Reaktionen können von ursprünglich neutralen Reizen ausgelöst werden (Erklärung über Lernprinzipien). Voraussetzung: Angeborene emotionale Verhaltensweisen. Emotionale Reaktionen können verhaltenswirksam werden, wenn sie als sekundäre Triebe konzipiert werden, deren Reduktion verstärkend wirkt. 3. Attributionstheoretische Ansätze - - Attributionstheoretische Ansätze existieren seit 1962 (Schachter & Singer) und markieren den Beginn der modernen Psychologieforschung. Attribution = Ursachenzuschreibung; für einen bestimmten Verhaltensaspekt wird eine Ursache gesucht und in Relation zu diesem Verhaltensaspekt gesetzt. Wichtig dabei ist, dass eine Person diese Ursachenzuschreibung für sich selbst vornimmt! Leistungsmotivation Emotionspsychologie Def. „Attribution“ im Zusammenhang mit Emotionen= kognitiver Prozeß bei dem man sein eigene wahrgenommene physiologische Erregung (Emotion = Erregungssteigerung) auf innere und äußere Ursachen hin untersucht; z.B. wahrgenommene Erregung wird auf Situationsmerkmale zurückgeführt „Ich bin erregt, weil ein knurrender Hund vor mir steht“ Auslösung von Emotionen. hier spielen wieder Aspekte der Selbstwahrnehmung eine Rolle Schachter & Singer, 1962: „Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion“ Zwischenposition zwischen James und Cannon: in Anlehnung an James: Wahrnehmung körperlicher Erregung als Vorraussetzung für Entstehung von Emotion. in Anlehnung an Cannon: Unspezifitäts- Hyothese; Erregung/“Arousal“ ist unspezifisch; künstliche Herbeiführung viszeraler Veränderungen führt nicht immer zum Erleben von Emotionen (siehe nichtemotionale Bewertung einer Situation). Dieselben viszeralen Veränderungen können aber zu verschiedenen Emotionen führen (siehe Plastizität von Erregung). Zusätzlich zu James/ Cannon: weiterer Faktor neben körperlicher Erregung: Kognition = Ursachenzuschreibung über erregungsauslösende Emotion entscheidend für die Entstehung bestimmter Emotionen Emotion = subjektives Erleben; Resultat der Interaktion zweier Komponenten a) Erregungskomponente; physiologische Erregung/ „Arousal“ = bestimmmt die Intensität der Emotion Plastizität von physiologischer Erregung = Erregungskomponente ist „unspezifisch“, diffus. Generell „sympathische Dominanz“ bei vielen Emotionen gleichförmig vorhanden entscheidend für die Intensität einer Emotion ist aber nicht die tatsächliche Erregungsempfindung, sondern vielmehr die wahrgenommene Erregung/ erlebte Erregungsempfindung. Voraussetzung: bewußte Wahrnehmung von Erregungsprozessen b) Emotionale Kognitionen über die erregende Situation = Wahrnehmung, Einschätzung, Bewertung über gewisse situative Bedingungen => bestimmt Qualität der Emotion. Kognition = subjektiver Bewertungsprozess von bestimmten Situationen als „emotional“/ „nichtemotional“: Bewertung der Situation als „emotionsrelevant“ z.B. „diese Situation ist gefährlich“ 30 „Etikettierung“ („labeling“) [Begriff „Attribution“ wurde damals noch nicht verwendet] = Ursachenzuschreibung der Erregung z.B. auf die Situationseinschätzung (siehe Reisenzein) z.B. „weil ich den knurrenden Hund als gefährlich einschätze, bin ich erregt. Ich habe Angst“ hoch automatisiert, schnell ablaufend subjektive Bewertungsprozesse bleiben zum größten Teil unbewußt - Emotionsmodell Schachter & Singer: Emotionen werden von zwei Faktoren bestimmt Physiologische Erregung bestimmt Intensität Situation: emotionale Reize; Kognitionen bestimmt Qualität Emotion Nur wenn beide Komponenten vorhanden sind, kann eine Emotion hervorgerufen werden!! - multiplikative Verknüpfung von wahrgenommener Erregung und emotionaler Kognition Für die Emotionsentstehung darf keiner der beiden Faktoren 0 sein. zunächst blieb bei Schachter & Singer unklar, welche Attributionsprozesse eine Rolle spielen; es mussten nur beide Komponenten vorhanden sein Keine Aussagen darüber, wo die Attribution stattfindet. Reisenzein: beide Komponenten müssen durch einen Labeling- Prozeß = Attributionsprozeß / Kausal- ZH miteinander verknüpft werden, so daß Erregung auf die emotionsauslösende Situation attribuiert wird. E = f (PA) x (EC) 1. 2. 3. E: Emotion PA: perceived arousal EC: emotional cognition. 3 Grundannahmen Schachters & Singers: Befindet sich ein Individuum in einem Zustand physiologischer Erregung, für den es kein selbstverständliche Erklärung hat, so wird es den Zustand anhand kognitiver oder situativer Gegebenheiten „etikettieren“ und die dem Etikett entsprechende Emotion empfinden. jedes Individuum hat das Bedürfnis eine Ursache oder Erklärung für physiologische Erregung zu finden, daher wird die Erregung interpretiert, z.B. angesichts der jeweiligen Situation. Vorstellung der Platizität von Erregung: Die gleiche Erregung kann – je nach kognitiver Bewertung – zu unterschiedlichen Emotionen führen. Befindet sich ein Individuum in einem Zustand physiologischer Erregung, für den es eine zureichende Erklärung nicht- emotionaler Natur hat, so wird es den Zustand als nicht- emotional bewerten und infolgedessen keine Emotion empfinden. Gleichung E = f (PA) x f (EC) / emotionale Kognition = f (EC) = 0, also keine Emotionsentstehung. Sind emotionsträchtige Kognitionen vorhanden, so reagiert das Individuum nur in dem Maße emotional, wie eine physiologische Erregung vorhanden ist. Gleichung E = f (PA) x f (EC) / wenn physiologische Erregung = f (PA) gegen 0 geht, wird auch resultierende Emotion weniger „groß“. Multiplikative Komponente der Gleichung. Entstehen eines Gefühlszustand laut Schachters Theorie: a) der alltägliche Fall: Eliciting stimuli Appraisal „Emotional cognition“ Physiological arousal Perceived arousal Attribution of arousal to emotional source - 3 Prozesse führen zu einer Emotion: Emotional getönte Kognition Physiologische Erregung und ihre Wahrnehmung Kausale Verknüpfung der wahrgenommenen Erregung mit der emotionalen Kognition. 31 Emotion Erregung und Kognitionen meist „vollständig miteinander verwoben“ (Schachter & Singer): diejenige Gegebenheit, die zur Erregung führt, z.B. der knurrende Hund, legt meist auch eine Kausalattribution über die Ursache der Erregung nahe b) Emotionsgenese im Falle unerklärter Erregung = dieser Fall liegt dann vor, wenn die Person für den Zustand physiologischer Erregung keine unmittelbare Erklärung oder geeignete Kognition zur Verfügung hat [z.B. nach Adrenalininjektion] Physiological arousal perceived arousal Attributional search (including reappraisal situation) „emotional“ cognition Emotion Attribution of arousal es entsteht ein Bedürfnis nach Erklärung für die Erregung, welches im Normalfall (alltäglicher Fall) nur ein kurzer Ursachen- Suchprozess ist, da wir aufgrund unseres Wissen über die Situation unmittelbar eine Erklärung über die Erregung haben Überprüfung dieser Theorie über entsprechende Situationsmanipulationen: Unter welchen Bedingungen kommt es (nicht) zu einer Emotion??? - Begriffe der Theorie: Emotion = subjektives Erleben Kognition = Bewertung einer Situation (schnell, automatisch, unbewusst) Emotionen sind postkognitive Phänomene - Erregung = unspezifisch / neutral Schachter und Singer geht es um Erregungswahrnehmung: Spezifitäten sind zu subtil, um Unterschiede wahrzunehmen. Die hier genannten Begriffen wurden nicht so definiert: Anhand des Vorgehens kann man aber annehmen, dass die Autoren die 3 Begriffe wie oben beschrieben verstehen. - Experiment von Schachter und Singer (1962) Coverstory: Täuschung aller Vpn durch Falschinformation des Versuchsleiter über Zweck des Experiments: es wurde gesagt, man wolle das Vitaminpräperat „Suproxin“ testen und seine Auswirkungen auf die visuelllen Fähigkeiten: in Wahrheit wurde Adrenalin oder Placebo (Kochsalzlösung) injeziert 3 UVs: a) Erregung vs. keine Erregung (durch Adrenalininjektion vs. Placeboinjektion (Kochsalzlösung)) b) Nicht-emotionale Erklärung vs. keine Erklärung (keine, falsche oder richtige Info über Wirkung des Adrenalins – nur in EG) c) Emotional getönte Situationen (Während einer Wartezeit verhielt sich ein Stooge euphorisch- freudig = spielte mit dort herumliegenden Gegenständen vs. verärgert- wütend = regte sich über z.B. zu persönliche Fragen eines in der Wartezeit auszufüllenden Fragebogens auf etc.) - AVs: a) Verhaltensbeobachtung (während dem Experiment) b) Selbstbericht (nach dem Experiment) Vorhersagen: - „informiert“ in zutreffender Weise über Wirkungen des Adrenalins: kein Erklärungsbedürfnis, da (nichtemotionale) Ursache für Erregung eindeutig; Nebenwirkungen des „angeblichen Vitaminpräperats“ wurden wie die Wirkungen bei Adrenalin beschrieben: zitternde Hände, Herzschlag - „falsch informiert“ über Wirkungen des Adrenalins: Nebenwirkungen des „angeblichen Vitaminpräparats“ seien z.B. Taubheitsgefühl in den Füßen, Juckreiz am Körper ... => Erklärungsbedürfnis tritt auf, Ursachensuche für eigenen Zusand - „nicht informiert“ über Wirkungen des Adrenalins: Injektion des „angeblichen Vitaminpräperats“ sei schwach und harmlos mit keinerlei Nebenwirkungen => Erklärungsbedürfnis, Ursachensuche für eigenen Zusand tritt auf 32 - Kontrollgruppe mit Placeboinjektion: Vpn erhielten selbe Informationen wie Vpn in der Bedingung „nicht informiert“: Vitamitpräperat habe keinerlei Nebenwirkungen. - Versuchsplan: 7 Gruppen von 184 Vpn ( idealer Versuchsplan: alle 12 Gruppen testen) richtig informiert nicht informiert falsch informiert Adrenalin Ärger X X Euphorie X X X Placebo Ärger X Euphorie X Hypothesen: - Bedingung „Placebo“/und Adrenalin „richtig informiert“: keinerlei Auftreten einer Emotion Gleichung: Placebo => f(PA) = 0; keine physiologische Erregung vorhanden Adrenalin, „richtig informiert“ => f(EC) = 0, Bewertung der Situation als „nicht- emotional“ - Bedingung Adrenalin „nicht informiert“/ „falsch informiert“: ausgeprägte Emotionen in der Ärger- sowie Euphoriebedingung; durch den Vertrauten des Vl wird eine emotionale Erklärung für den eigenen Erregungszustand nahegelegt F(PA) und f(EC) ungleich 0, vorhanden Misinformiert = Nicht informiert > Informiert = Placebo Ergebnisse: - Die Eigenaktivität erfüllt die Vorhersagen Schachters und Singers, der Selbstbericht dagegen nicht. (1) Euphoriebedingung; Selbstbericht: Geringer Unterschied zwischen „falsch informiert“ / „nicht informiert“ und Placebogruppe; großer Unterschied zwischen „Falsch informiert“ / „Nicht informiert“ und „Informiert“-Gruppe. Eigenaktivität: Bei Misinformierten am größten, dann Nicht informiert; schließlich Placebo und Informiert. (2) Ärgerbedingung; Selbstbericht: Informierte am ärgerlichsten, dann Placebos, dann Nichtinformierte. Eigenaktivität: Nichtinformierte sehr hoch; Placebos niedrig und Informierte < 0. (3) keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Placebo- Bedingung und anderen Bedingungen; Befunde entgegen die Theorie. Interpretation: - Ex- Post- Facto- Analyse von Schachter & Singer: durch Analysen im Nachhinein wurden Ergebnisse theroiekonform - Aus Nachbefragungen erhielten sie die Information, dass in den Gruppen Adrenalin „informiert“ und „falsch informiert“ einige Vp ihre Symptome trotz anderer Information durch Vl auf das Vitaminpräperat zurückführten = „Self informed“. Des Weiteren waren einige Vpn in der Placebogruppe allein durch die Spritze etwas erregt = „Self-aroused“ Die einzelnen Gruppen unterscheiden sich weniger. - Nach Bereinigung der Daten stimmen die Ergebnisse mit der Theorie überein!! - - Kritik an Studie/Experiment Schachter & Singer (1962): Pro: Die Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Personen Erregungszustände entspr. solcher Kognitionen etikettieren, die ihnen zur Verfügung stehen. Dies impliziert, dass in Erregungszuständen Emotionen manipuliert werden können, indem Kognitionen manipuliert werden. Hat eine Person eine zufriedenstellende Erklärung für seine Erregung gefunden, so wird er die Erregung nicht anhand alternativer Erklärungen / Kognition umetikettieren. Kontra: 1.) unvollständiger Versuchsplan: es wurden nicht alle möglichen Fälle untersucht, dadurch kann statistisch gesehen keine Varianzanalyse durchgeführt werden (WW können nicht festgestellt werden) Schachter & Singer untersuchten 7 Gruppen, anstatt 12; dennoch: Versuchsdesign: 2 (Placebo/ Adrenalin) x 3 („informiert“/ „falsch informiert“/ „nicht informiert“) x 2 (Euphorie /Ärger) 2.) problematische statistische Analyse in Form von Einzelvergleichen zwischen ausgewählten Gruppen 3.) Eliminierung von insgesamt 16 Vpn aus nicht näher erläuterten Gründen (11 Personen seien angeblich skeptisch gewesen) 4.) relativ undifferenzierte Emotionsmessung: Konzentration auf induzierte Emotionen (Euphorie / Ärger) 5.) theoriekonforme Befunde werden erst nach post-hoc- Analyse erhalten: Eliminierung von „selfinformed“ Vpn; Kontrolle von „self-aroused“ Vpn. 33 - - - Fazit: bisher kein überzeugender Nachweis, dass periphere physiologische Erregung eine notwendige Bedingung für einen emotionalen Zustand ist ( Schachter & Singer: f(PA) notwendig für Emotionsentstehung) könnte auch sein, dass Kognitionen alleine schon ausreichen, um einen emotionalen Zustand hervorzurufen. bei intensiverer emotionaler Reaktion durch unerklärte Erregung: kein Nachweis, ob zuerst Erregung als unerklärt empfunden und dann Suchprozeß eingeleitet wird. Evidenz spricht eher dafür, dass eine unerklärte Erregung mit Attributionsprozessen interferiert (wechselseitige Beeinflussung) und automatisch zu eher negativen emotionalen Zuständen führt Bedeutung der Theorie Schachter & Singers für die weitere Emotionsforschung: 1.) Heuristische Funktion = Theorie Schachter & Singers regte zahlreiche Untersuchungen und neue theoretische Überlegungen an [Heuristik = etwas, das brauchbar ist zum Finden neuer Tatsachen; z.B. eine Hypothese die noch ungesichert ist, kann dennoch heuristisch brauchbar sein] 2.) Kognitive Prozesse: die Theorie lenkte die Aufmerksamkeit auf Kognitionen und ihre entscheidende Rolle beim Entstehen von Emotionen; Körperprozesse dadurch nicht mehr ausschließlich im Mittelpunkt Marshall & Zimbardo, 1979 - modifizierte Replikation der Studie von Schachter & Singer, 1962 Ärgerbedingung von Schchter & Singer konnten sie jedoch durch Verbot einer Ethikkommission nicht realisieren; daher Begrenzung auf Euphoriebedingung Täuschung (analog zu Schachter & Singer) der Vpn, es handele sich um ein Experiment bei dem die Wirkung eines Vitaminpräperats getestet wird; tatsächlich aber Adrenalininjektion. 6 Versuchsbedingungen: (1) Gruppe „Placebo“: Injektion von destilliertem Wasser a) missinformiert ( = mislead): unzutreffende Mitteilung das Vitaminpräperat führe zu erregungsirrelevanten Symptomen (Trockenheit im Hals, Kopfschmerzen...) b) arousal = obwohl Kochsalzlösung gespritzt wurde, wird angegeben, das Symptome des Adrenalins auftreten werden Kontrolle von Erwartungseffekten: Überprüfung ,ob die korrekte Information einen vom tatsächlichen Erregungsstand unabhängigen Effekt hat (2) Gruppe „Adrenalin“ a) mißinformiert( = mislead): unzutreffende Mitteilung das Vitaminpräperat führe zu erregungsirrelevanten Symptomen (Trockenheit im Hals, Kopfschmerzen...) b) NS = neutrale Situation: der Stooge saß nur im gleichen Raum wie Vp und las ein Buch Vergleichsmöglichkeit, was passiert, wenn Vp Adrenalin injiziert bekommt, jedoch der Eingeweihte ruhig sitzen bleibt und nichts unternimmt c) IA (= increased arousal): Injektion von einer im Durchschnitt größeren Menge von Adrenalin, je nach Körpergewicht der Vpn (0,55-0,82 ml); falsche Informationen über die Wirkung. d) IS ( = increased sensitivity): Injektion von einer konstanten Dosierung von Adrenalin (0,50 ml), bewußt wird die Aufmerksamkeit der Vp auf die Erregung gelenkt z.B. musste Person etwas schreiben und die eigenen zitternden Hände bemerken. . - Versuchsdesign: Placebo mißinformiert - Adrenalin arousal mißinformiert NS IA IS außer Bedingung NS durchliefen alle die Euphoriebedingung AV (abhängige Variable) = Emotionsmaß Messung vorher und nachher: Ausgangsniveau des emotionalen Befindens und nach Zusammensein mit euphorischer Person Tatsächliche Erregung: Herzfrequenz Verhaltensmaße (wie bei Schchter & Singer): Imitation (von anderen Person) / Initiierung (eigene Verhaltensimpulse) Selbstbericht / Self- Report: Fragen zum momentanen emotionalen Zustand; gleichen Fragen wie Schachter & Singer; zusätzlich erweitert um ein multidimensionales Emotionsinventar wurde eingesetzt, um auch andere Emotionen abzudecken 34 - Hypothese: Adrenalin-Misinformiert > Placebo-Misinformiert. Modifikation zu Schachter & Singer: Berücksichtigung der Veränderung der Emotion durch Vorher/Nachhermessung; Messung der Herzfrequenz; mehr als nur Euphorie gemessen: Valenzemotion gemessen (andere Emotionen); verschiedene Kontrollbedingungen Ergebnis: Kein Befund, der für die postulierte Interaktion zwischen kognitiven und physiologischen Komponenten spricht. Befunde sind gegenläufig: - Emotionsmaße des Self- Report: Placebo- Gruppe berichtete über mehr Euphorie als beide Gruppen mit injiziertem Adrenalin => P(mis) > A(mis). - Emotionsmaße des Verhalten ebenfalls: Placebo Gruppe zeigte mehr euphorische Aktivität als Gruppen mit Adrenalininjektion. Adrenalininduzierte Erregung ist generell mit negativen emotionalen Reaktionen assoziiert: - Gruppen mit Adrenalininjektion zeigten häufig negative Werte = negatives subjektives Empfinden. Das Postulat der „Plastizität physiologischer Erregung“ ist nicht aufrecht zu erhalten bzw.: Das Postulat der „emotionalen Neutralität physiologischer Erregung ist nicht aufrechtzuerhalten. - Maslach, 1979 - - Unterschied zu anderen: keine Erregungsänderung durch Adrenalininjektion, sondern Induktion der Erregung über Hypnose. Vpn solllten hochsuggestibel sein, eventuell schon Erfahrungen mit Hypnosen haben. Während der Hypnose wurden sie auf ein Wort eingestellt, auf welches sie mit erhöhter Erregung reagieren sollten. posthypnotische Amnesie = nach der Hypnose sollte die Vp bei Darbietung des Wortes nicht wissen, woher die Erregung kommt. 2 UVs: Euphorie vs. Ärger Erregung: Aroused; Unaroused, Unhypnotized AV: Emotionsmaße aus Verhalten (verbal vs. non-verbal) und Self-Report Ergebnis: Im Gegensatz zu Marshall & Zimbardo wurde „Neutralität“ der Erregungskomponenete (Plastizität) durchschnittlich bestätigt: Aroused/ Erregte Gruppe berichtete sowohl in der Ärger als auch Euphoriebedingung negatives subjektives Erleben Zusammenfassende Bewertung der Theorie von Schachter und Singer 1) Keine der bisher berichteten Studien konnte überzeugend nachweisen, dass eine periphere physiologische Erregung eine notwendige Bedingung für einen emotionalen Zustand ist – wie von Schachter und Singer behauptet. 2) In denjenigen Fällen, in denen eine unerklärte Erregung emotionale Reaktionen intensivierte, konnten keine eindeutigen Belege dafür gefunden werden, dass zunächst die Erregung als unerklärt empfunden wird und dann einen Suchprozess einleitet mit dem Ziel, eine Erklärung für den Erregungszustand zu finden. Die vorliegende Evidenz spricht eher dafür. dass eine unerklärte Erregung mit Attributionsprozessen interferiert und quasi automatisch zu eher negativen emotionalen Zuständen führt. Eine Erregungswahrnehmung kann emotionale Zustände intensivieren und diese Beziehung zwischen Erregung und Emotion kann teilweise durch Attributionsprozesse modifiziert werden. - Die heutige Bedeutung der Schachter & Singer Theorie besteht somit darin... Sie hatte eine wichtige heuristische Funktion, indem sie zahlreiche Untersuchungen und neue theoretische Überlegungen anregte. Die Theorie war deshalb wichtig, weil sie die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung kognitiver Prozesse für die Entstehung emotionaler Zustände richtete und die Rolle von Körperprozessen nicht mehr ausschließlich in den Mittelpunkt der Betrachtung stellte. Heute akzeptieren alle Theorien, dass Emotionen postkognitive Prozesse sind. 35 Valins, 1966 - Übergang zu den kognitiven Theorien kritische Auseinandersetzung mit der Theorie von Schachter & Singer: gegen die Annahme, dass körperliche Erregung notwendige Bedingung zur Emotionsentstehung sei einzig und allein kognitive Komponente entscheidend Zentrale Hypothese: Ausschlaggebend für emotionale Reaktionen ist die kognitive Repräsentation interner Körpervorgänge. kognitive Repräsentation interner Körpervorgänge = Wahrnehmung körperlicher Vorgänge wie physiologischer Erregung können unzutreffend sein: teilweise gar nicht wahrgenommen können fehlerhaft wahrgenommen werden können vermeintlich festgestellt werden, obwohl sie gar nicht vorhanden sind unzutreffende Meinungen über physiologische Veränderungen haben dieselbe Wirkung wie tatsächliche körperliche Erregung [vs. Schachter & Singer: tatsächliche physiologische Erregung unerläßlicher Bestandteil zur Emotionsentstehung] Die Vorstellung von Erregung drängt die Rolle der tatsächlichen Erregung in den Hintergrund! - - - Biofeedback Es werden die Vorgänge im Körper gemessen und an die Person rückgemeldet, s.d. diese sie besser wahrnimmt. Bogus Heart Rate (HR) – Paradigma: Falsche Rückmeldung der Körpervorgänge: Es wird angeblich die Herzschläge der Person per Ton wiedergegeben. Tatsächlich wird aber eine manipulierte HR zurückgemeldet. Bogusbedingung: Die Vp glaubt, es würden ihre eigenen Herzschläge dargeboten; Soundbedingung: Die Vp weiß, dass es sich um fremde Geräusche handelt. - Experiment Valins (1966): Versuchsanordnung: diesmal wird nicht die tatsächliche Erregung manipuliert, sondern Manipulation der Meinungen der Vpn über ihren Erregungszustand. - männlichen Vp wurden Playboy-Schönheiten auf Dias gezeigt und es wurde ihnen gesagt man messe ihren Herzschlag (1) Experimentalgruppe: einige der Vpn ließen sie Signale hören welche angeblich ihrem tatsächlichen Herzschlag entsprächen - Gruppe 1: Rückmeldung, dass bei 5 Dias eine Zunahme der Herzrate, bei anderen 5 keine Veränderung - Gruppe 2: Rückmeldung, dass bei 5 Dias eine Abnahme der Herzrate, bei anderen 5 keine Veränderungen (2) Kontrollgruppe: hörten dieselben Signale, ihnen wurde jedoch mitgeteilt, das es sich dabei um bedeutungslose Signale handelt. - Emotionsindikatoren / AVs: Attraktivität der Bilder beurteilen Bis zu 5 Bilder auswählen und mit nach Hause nehmen. - Hypothese: Gruppen 1 + 2 führen die vermeintliche Veränderung der Herzrate auf Merkmale der gezeigten Frauen zurück, dementsprechend werden die Frauen als attraktiver beurteilt, bei denen eine Herzratenänderung rückgemeldet wurde; in der Kontrollgruppe hingegen sollten die als irrelevant betrachteten Signale keinen Einfluß auf die Wahl der Dias und Attraktivitätsbeurteilung haben. - Ergebnis: Die Hypothesen wurden bestätigt => die Experimentalgruppen beurteilten tatsächlich diese Frauen als attraktiver und wählten später die Dias häufiger aus, bei denen Herzratenänderung rückgemeldet wurde, im Vergleich zu den anderen Dias - Valins- Effekt = tatsächliche Veränderungen der Herzrate, also tatsächliche physiologische Erregungsänderung nicht Ursache für Emotionen, sondern nur fehlerhafte Kognition darüber. Erklärung: Ursachensuche findet statt (vgl. Schachter & Singer) = die Vpn betrachten und analysieren die Dias genauer und versuchen eine angebliche Herzratenänderung anhand von Charakteristika der Frauen zu rechtfertigen. - Problem: Die wahre HR wurde nicht kontrolliert. So bleibt unklar, ob die Emotionen evtl. nicht doch physiologisch vermittelt wurden. - Trotz diesem Kritikpunkt konnten die Ergebnisse Valins aber repliziert werden (s.u.) 36 Prozesse & Bedinungen des Valins-Effektes: Prozess Bedingung Erklärungssuche Motivation zur Erklärungssuche Attribution - Zugänglichkeit von Kontextinformation - Plausibilität und subjektive Bedeutsamkeit eines Kausalzusammenhangs Zuwendung von Aufmerksamkeit Valins, 1966: Nachbefragung 4/5 Wochen nach Versuchsdurchlauf ergab, dass Effekte zeitstabil sind: Dias der entsprechenden Frauen wurden immer noch als attraktiver eingeschätzt Valins,1974: Effekte relativ änderungsresistent; klärte Vp vor der Beurteilung der Dias auf, dass Rückmeldungen der Herzrate falsch waren => Einstellung der Vpn zu den Dias änderte sich selbst dann nicht, aufgrund der eingehenden Analyse Effekte treten dann nicht mehr auf, wenn den Vpn die Gelegenheit genommen wird, die Dias eingehend zu analysieren (Barefoot & Straub, 1971: Vergleich Versuchsgruppe mit 5 Min. Betrachtungszeit der Dias/20 Min. Betrachtungszeit der Dias) - Keine Bestätigung für Schachter & Singer = tatsächliche, physiologische Erregung keine notwendige Vorraussetzung für Emotionen (vs. Schchter & Singer), vielmehr ist die Überzeugungen/Kognitionen über physiologische Erregung (der Glaube erregt zu sein und die Rechtfertigung warum) ausreichend aus als Grundlage von Emotionen 4. Kognitive Emotionstheorien Lazarus, 1966; Stress- und Emotionstheorie - Betonung der Bedeutung kognitiver Faktoren bei der Emotionsauslösung: es finden verschiedene Phasen der Bewertung (appraisals) statt => Kognitive Faktoren steuern den Prozess der Emotionsauslösung und regulierung; Def. Emotion (laut Lazarus) = „complex organized states consisting of cognitive appraisals, action impulses, and patterned somatic reactions.“ = komplex organisierte Zustände bestehend aus kognitiven Bewertungsprozessen, Handlungsimpulsen und spezifischen physiologischen Reaktionsmustern. Cognitive appraisals = kognitive Bewertungsvorgänge, gehen der Emotionsauslösung voraus; Bestandteil der Emotion selber. Action impulses = Handlungsimpulse; kommunikative Komponente von Emotionen durch expressive Reaktionen, verbale Äußerungen etc. patterned somatic reactions = spezifische physiologische Reaktionsmuster - kognitive Bewertung (cognitive appraisal) = zentraler Faktor in der Emotionsauslösung. emotionale Prozesse hängen von Erwartungen ab, die eine Person in Hinblick auf den Ausgang einer spezifischen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt hat erklärt interindividuelle Unterschiede hinsichtlich der Art, der Dauer und der Intensität der Emotionen unter denselben Umweltgegebenheiten. steuern und erzeugen emotionale Intensität und Qualität zwei Arten kognitiver Aktivität: 1.) Wissen (kalte Kognition): bildet die Grundlage für Bewertung und Handeln in bestimmten Situationen; generelle und spezifische Erwartungen in einer Situation; Kenntnisse jedes Menschen hinsichtlich des Ablaufs einer Situation (z.B.Wissen über Gefährlichkeit von Schlangen) => führt alleine jedoch noch nicht zur Emotionsauslösung 2.) Bewertung (heiße Kognition) = Emotionsauslöser; anhand des Wissens über die Situation wird eine Bewertung hinsichtlich der Bedeutung dieser Situation für das persönliche Wohlergehen getroffen (z.B. Schlange ist stressbezogen – bedrohlich Angst) - 37 - 3 Kategorien von Bewertungsprozessen (appraisal) (1) Primäre Bewertung („appraisal of well-being“) = Feststellung, dass etwas das eigene Wohlbefinden in der Situation beeinträchtigt; bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit der Umwelt in Hinblick auf die eigene Integrität („well- being“) - Unterteilung der Primären Bewertungsprozesse (a) Irrelevant = neutrale Situation (b) angenehm-positiv (c) streßbezogen Schaden- Verlust („harm-loss“) = eine bereits eingetretene Beeinträchtigung Bedrohung („threat“) = eine antizipierte Beeinträchtigung Herausforderung („challenge“) = eine stressbezogene Situation mit der Möglichkeit des Gewinns - 3 Bewertungsdimensionen der Primärbewertung aus deren Ausprägungsmuster eine spezifische Emotion hervorgesagt werden kann: a. Zielrelevanz = Ausmaß, in dem ein Ereignis persönliche Ziele berührt, Bsp. Prüfung hat das Ziel das Selbstwertgefühl intakt zu halten b. Zielkongruenz = Grad, in dem die Auseinandersetzung mit einer Situation in Übereinstimmung mit persönlichen Zielen verläuft; Bsp. Prüfungssituation läuft entweder kongruent mit dem persönlichen Ziel das Selbstwertgefühl intakt zu halten (gute Note) Resultat: positive Emotion vs. Inkongruenz zwischen Ziel und Verlauf der Situation Resultat : negative Emotion c. Ich – Involviertheit = Aspekte des persönlichen Beteiligtseins bei einer Auseinandersetzung, z.B. moralische Werte, Ich- Ideale, Ich- Identität (2) Sekundärbewertung ( „appraisal of coping ressources“) = Was kann ich dafür/dagegen tun? Welche Bewältigungsstrategien stehen mir zur Verfügung? Abschätzung des Individuums hinsichtlich seiner Ressourcen und Möglichkeiten für einen erfolgreichen Abschluß der streßbezogenen Auseinandersetzung Art der Einschätzung von persönlichen Ressourcen beeinflußt wiederum, ob sich jemand in einer als streßbezogenen Auseinandersetzung herausgefordert oder bedroht fühlt - 3 Bewertungsdimensionen der Sekundärbewertung aus deren Ausprägungsmuster eine spezifische Emotion hervorgesagt werden kann: a. Verantwortungszuschreibung = Einschätzung durch die Person, welche Instanz für ein bestimmtes Ereignis verantwortlich ist b. Bewältigungspotential = variable Überzeugung einer Person, die Anforderungen mit bestimmten Mitteln meistern zu können c. Zukunftserwartung = Abschätzung des weiteren Verlaufs z.B. den Verlauf einer erlebten Krankheit als allgemein zur Besserung oder zur Verschlechterung hin. (3) Neubewertung („reappraisal“) = je weniger Handlungsmöglichkeiten vorhanden sind, desto eher muss ich meine Bewertung nochmal anpassen, bzw. neue Informationen können zu neuer Bewertung führen. - modifizierte situative Bedingungen = z.B. vorausgegangenes aktives Eingreifen. - „innerpsychische“ Auseinandersetzung mit der Situation („defensive Neubewertung“) = Umdeutung der Situation Neubewertung der Person- Umweltbeziehung, die u.U. zu veränderten emotionalen Reaktionen führt. Schematische Darstellung des Streßbewältigungsprozesses nach Lazarus: Umweltmerkmale formale Merkmale inhaltliche Merkmale Primärbewertung stressbezogene Auseinandersetzung Sekundärbewertung Streßbewältigung Neubewertung Irrelevant emotionsbezogen Günstig problembezogen streßbezogen Herausforderung Bedrohung Schaden- Verlust Personenmerkmale 38 - Lazarus et al, 1964; Empirische Untersuchung schwierig Lazarus Streßkonzept nachzuweisen, da die meisten kognitiven Prozesse unterbewußt ablaufen Manipulation der Primärbewertung bei einer bedrohungsrelevanten Reizdarbietung Vpn wurde ein Film dargeboten, der aufgrund seines Inhalts eine Bedrohung darstellte: Film über einen primitiven Beschneidungsritus australischer Ureinwohner - Erhebung der subjektiven und objektiven Streßreaktionen (über elektrodermale Aktivität = Hautleitfähigkeit) der Vpn - Vor der Darbietung des Filmes wurden verschiedene Vorab- Informationen gegeben, welche die Bewertung des Ereignisses in bestimmte Richtungen lenken sollte; 4 Versuchsbedingungen: a) Trauma- Bedingung = Betonung der Schmerzen, Gefahren, Grausamkeit des Eingriffs b) Intellektualisierende Bedingung = Darstellung des Geschehens aus emotional distanzierter , wissenschaftlicher Perspektive eines Antrophologen c) Verleugnungs- Kommentar = spielte die Schmerzen und gefährlichen Aspekte des Eingriffs herunter; statt dessen wurden positive Aspekte wie z.B. die Freude des Jugendlichen über die Aufnahme in die Welt der Erwachsenen betont d) Ohne Kommentar (Kontrollgruppe) - Ergebnis: - Stärkste Reaktionen unter „Trauma“ – Bedingung; zweithöchste Kurve der SCR unter Bedingung „Verleugnung“; gefolgt von Kontrollbedingung => schwächste gemessene Reaktion bei „Intellektualisierung“ - Insgesamt: signifikant stärkere Reaktionen der Vpn in der Traumabedingung als bei den durch abwehrende Vorab- Informationen (Verleugnungs- und intellektualisierender Kommentar) nahegelegte Bewertungen - Nachweis der Wirksamkeit von Bewertungsprozessen: Vorabinformationen beeinflussen die Einschätzung => primäre Einschätzungen bestimmen Emotionen - Einschränkungen: Subjektives Erleben wurde wenig bis gar nicht erfasst Art der Emotionsinduktion lässt ganz bestimmte Bewältigungsmöglichkeiten nicht zu; z.B. Flucht keine Widerlegung der Gegenannahme: Emotionen treten so schnell auf, dass keine Vorschaltung kognitiver Prozesse möglich ist (Emotionen = keine postkognitiven Phänomene); lediglich Gruppenunterschiede festgestellt Hier sollte eigtl. noch der andere Versuch dazu stehen: s.Persönlichkeit: Kommentar wird vor den Film geschaltet. Und noch ein zweiter „Sägewerk“-Versuch: Folien geben 0 Info... Kognitiv- phänomenologische Analyse von Emotionen nach Lazarus, 1991 = Analyse anhand von Aspekten der Primär- und Sekundärbewertung. A: Komponenten der Primärbewertung: (1) Zielrelevanz; bestimmt, ob generell Emotionen vorhanden sind. - Relevanz Emotion - Irrelevanz keine Emotion (2) Zielkongruenz: bestimmt, ob die Emotionen positiver oder negativer Natur sind. - Kongruenz positive Emotion - Inkongruenz negative Emotion (3) Ichinvolviertheit: bestimmt die Art der Emotion: bezieht sich auf Bekenntnisse, die als Ziele bezeichnet werden können und die in die Rubrik dessen fallen, was normalerweise mit „Ich-Identität“ gemeint ist. Typen der Ich-Involviertheit Self- and social esteem = Selbstbewußtsein und soziales Bewußtsein Moral Values = moralische Werte Ego- ideals = Ich – Ideale Meaning and ideas = Ideen und Bedeutungen (z.B. existentielle) Other persons and their well- being = das Wohlergehen anderer Life goals = Lebensziele B: Komponenten der Sekundärbewertung: (1) Verantwortungszuschreibung (Blame) (2) Bewältigungspotential (coping potential) (3) Zukunftserwartungen (future expactations) C: Core-relational themes for each emotion (zentrale Beziehungsthemen): Die Auslösung jeder Emotion hängt vom Vorhandensein eines spezifischen Musters aus Primär- und Sekundärbewertungen ab; dieses Muster wird als zentrale „Beziehungsthemen“ bezeichnet. 39 Lazarus geht von 15 Basisemotionen aus, von denen 11 negativ und vier positiv sein sollen: Anger A demeaning defense against me and mine Anxiety Facing uncertain, existential threat Fright Facing an immediate, concrete, and overwhelming physical danger Guilt Having transgressed a moral imperative Shame Having failed to live up to an ego-ideal Sadness Having experienced an irrevocable loss Envy Wanting what someone else has Jealousy Resenting a third party for loss or threat to another’s affection Disgust Taking in or being too close to an indigestible object or idea (metaphorically speaking) Happiness Making reasonable progress toward the realization of a goal Pride Enhancement of one’s ego-identity by taking credit for a valued object or achievement, either our own or that of someone or group with whom we identify Relief* A distressing goal- incongruent condition has changed for the better or gone away Hope* Fearing the worst but yearning for better Love* Desiring or participating in affection, usually but not necessarily resiprocated Compassion* Being moved by another’s suffering and wanting to help * unklar, ob genuine Emotionen Beispiele für Primär- und Sekundärbewertungen bei 5 verschiedenen Emotionen a) Bewertung als Ärger Komponenten der Primärbewertung: (1) Bei Zielrelevanz: Jede Emotion ist möglich, auch Ärger. Keine Zielrelevanz: keine Emotion (2) Bei Zielkongruenz: nur negative Emotionen sind möglich, eischl. Ärger. (3) Wenn der Typ der Ich-Involviertheit den Ich-Identitätsaspekt des Selbst- oder sozialen Bewusstsein gleich halten oder vergrößern soll, dann sind Emotionen wie Ärger, Angst und Stolz möglich. Komponenten der Sekundärbewertung (4) Bei Verantwortungszuschreibung aufgrund des Wissens, dass jemand für die harmful Handlungen verantwortlich ist, obwohl sie kontrolliert hätten werden können, dann tritt Ärger auf. Wenn die Verantwortungszuschreibung einer anderen Person zukommt, wird der Ärger extern ausgerichtet; kommt sie der eigenen Person zu, wird der Ärger intern ausgerichtet. (5) Wenn das Bewältigungspotential eine Attacke für haltbar hält, kann der Ärger reduziert werden. (6) Wenn Zukunftserwartungen positiv sind bzgl. der Umweltreaktionen auf die Attacke, wird der Ärger reduziert. b) Bewertung als Angst Komponenten der Primärbewertung: (1) Zielrelevanz: Jede Emotion ist möglich, auch Angst. (2) Zielkongruenz: Nur negative Emotionen sind möglich, einschl. Angst. (3) Wenn der Typ der Ich-Involviertheit Schutz der persönlichen Bedeutung oder Ich-Identität gegen existentielle Bedrohungen beinhaltet, dann werden die emotionalen Möglichkeiten eingeschränkt auf Ärger. Keine Sekundärbewertungskomponenten nötig. Verantwortungszuschreibung ist irrelevant (impliziert (3)). Das Bewältigungspotential ist ungewiss und Zukunftserwartungen sind auch ungewiss. c) Bewertung als Trauer Komponenten der Primärbewertung: (1) Zielrelevanz: Jede Emotion ist möglich, auch Trauer. (4) Zielkongruenz: Nur negative Emotionen sind möglich, einschl. Trauer. (5) Gibt es einen Verlust egal an welcher Art der Ich-Involviertheit (z.B. Einschätzung, moralische Werte, IchIdeal, Bedeutungen und Ideen, Personen und ihr Wohlergehen, Lebensziele), dann ist Trauer möglich. Komponenten der Sekundärbewertung (6) Keine Verantwortungszuschreibung: Trauer ist möglich. Externale oder internale Verantwortungszuschreibung: andere Emotionen, wie Angst, Schuld oder Scham sind möglich. (7) Bewältigungspotential: Wenn der Verlust ausgeglichen oder kompensiert werden kann, wird Trauer evtl. nicht auftreten oder wird mit Hoffnung assoziiert sein. (8) Zukunftserwartungen: günstig, Trauer ist mit Hoffnung assoziiert, anstatt von Hoffnungslosigkeit & Depression. d) Bewertung als Ekel 40 Komponenten der Primärbewertung (1) Zielrelevanz: Jede Emotion ist möglich, auch Ekel. (2) Zielkongruenz: Nur negative Emotionen sind möglich, einschl. Ekel. (3) Wenn für einen der 6 Typen der Ich-Involviertheit das Risiko besteht, dass er Verschmutzt wird durch irgendeine „giftige Idee“, dann wird Ekel auftreten. Keine Sekundärbewertungen nötig. e) Bewertung als Glück Komponenten der Primärbewertung (1) Zielrelevanz: Jede Emotion ist möglich, auch Glück. (2) Zielkongruenz: Nur positive Emotionen sind möglich, einschl. Glück. Typ der Ich-Involviertheit: Irrelevant Komponenten der Sekundärbewertung: Verantwortungszuschreibung und Bewältigungspotential irrelevant. (6) Zukunftserwartungen: Positiv Erwartung, dass Glück anhalten wird. Sieht das Leben generell günstig aus, ist der existentielle Hintergrund der Grund, warum wir glücklich sind. Wenn die Zukunftserwartung (und der existentielle Hintergrund) ungünstig aussehen, dann wird das Glück wahrscheinlich gebändigt oder gestoppt. Alle anderen Bewertungskomponenten sind nicht essentiell. Streßbewältigung (coping) = Handlungen (Copinghandlungen), die sich unter problematischen, neuartigen Bedingungen vollziehen; Management jener internen und externen Anforderungen, die die Ressourcen des Individuum stark beanspruchen problembezogene Streßbewältigung = die Person wendet sich direkt den Bedingungen zu, von denen eine Schädigung/ Bedrohung/ Herausforderung ausgeht emotionsbezogene Streßbewältigung = Anstrengungen der Person zunächst auf Emotionsregulierung gerichtet Bewältigungsverhalten determiniert durch personale und situative Faktoren: a) situative Faktoren/ Umweltmerkmale: - formale Bedingungen/ Antezedenzien = Informationen über Stärke, Dauer, Eintretenswahrscheinlichkeit der Gefahr (Bewältigung abhängig von Eindeutigkeit der Informationen; z.B. Ungewißheit über Eintretenszeitpunkt => Vermeidungsverhalten) - Inhaltliche Bedingungen/Antezedenzien = Art der Gefährdung: physisch oder psychisch b) personale Faktoren/ Personenmerkmale: - Motivationsmuster einer Person - Kontrollüberzeugungen in Hinblick auf persönliche Kontrolle über streßrelevante Situationen - Wissen - Kompetenzen - Kognitive Stile Grundmerkmale einer modernen kognitiven Emotionstheorie - - - - Zentrales Konzept der Einschätzung/ Bewertung (appraisals): Mensch wird als „wertender“ Organismus verstanden, der seine Umwelt auf Hinweisreize für seine Bedürfnisse untersucht und jeden Reiz nach Signifikanz und Relevanz und Signifikanz, die er für ihn besitzt. Das zentrale theoretische Konzept ist demnach das der Einschätzung/Bewertung („Appraisal“) Emotionen als post- kognitive Phänomene: Emotionen als Funktionen solcher Bewertungsprozesse Erregungsmuster bei Emotionen entsteht aus Handlungsimpulsen: Handlungsimpulse wiederum beruhen auf individueller Situationseinschätzung und Beurteilung der verfügbaren Handlungsmöglichkeiten Jede Emotion ist eine Funktion spezifischer Einschätzung (appraisals): Jede Emotion hat daher ihre eigenen Handlungstendenzen und demnach auch eine spezifische Konstellation physiologischer Veränderungen beinhaltet Spezifität Es müssen mindestens zwei determinierende Antezendenzbedingungen der Kognitionen unterschieden werden: a) situative = bezogen auf Umweltreize b) dispositionelle = bezogen auf psychologische Struktur der Person Schwierigkeit: Festlegung des Interaktionsschemas dieser beiden Faktoren, welches eine bestimmte emotionale Reaktion hervorbringt 41 - - kognitiver Filter zur Verarbeitung der Reizinformationen: Die Dispositionen sind in den meisten Fällen ein Produkt des Zusammenwirkens phylogenetischer, kultureller, ontogenetischer Entwicklung. Auf ihrer Basis verarbeitet das Individuum die Reizinformation durch einen kognitiven Filter. Emotionale Reaktion sind einer dauernden Wandlung unterworfen: Konsequenz aus der Rückmeldung der kontinuierlichen WW zwischen emotionsauslösenden Bedingungen und den Konsequenzen der Bewältigungsbemühungen, die wiederum die Kognitionen verändern, aus denen Emotionen entstehen (s. Neubewertung) Integrationsversuch von Parkinson, 1994: Vier- Faktoren – Theorie der Emotion Situation erforderlich Bewertung (Appraisal) Körperreaktion möglich, nicht erforderlich erforderlich Emotionale Erfahrung möglich, nicht erforderlich möglich, nicht erforderlich möglich, nicht erforderlich Gesichtsausdruck Handlungstendenz Körperreaktion, Handlungstendenz, Gesichtsausdruck wirken emotionsverstärkend Parkinson (1994); modifiziert von Vossel (2000) Vier- Faktoren -Theorie der Emotion Situation Neubewertung Körperreaktion Bewertung (subkortikal/kortikal) Emotionale Erfahrung / Emotionales Erleben Gesichtsausdruck Afferent Handlungstendenz Efferent Offene Fragen zum Gebiet der Speziellen Emotionstheorien: - - Wie ist die Beziehung zwischen: Körperreaktion Mimik Handlungstendenz Sind die Erkenntnisse von LeDoux zur Bedeutung subkortikaler Strukturen auf andere Emotionen übertragbar? Wie kann der zentrale Stellenwert von Bewertungsprozessen empirisch eindeutig nachgewiesen werden? 42 III Einzelthemen 1. Emotionsentwicklung Voraussetzungen für Emotionen Leistungsfähiges Informationsverarbeitungssystem Voll ausgebildete neuronale Systeme (vegetativ, somatisch) Ich-Gefühl Kann man bei Neugeborenen schon von Emotionen sprechen? Bei Emotionen sind eine Vielzahl an Subsystemen beteiligt, die bei Neugeborenen noch nicht voll entwickelt sind: Kategoriesierung und differenzierte Wahrnehmung von Reizen, kognitives System zur Bewertung von Situationen/Reizen, Ich- Identität usw. => bei Neugeborenen kann man daher eher von „unvollständig ausgebildeten Emotionsreaktionen“ sprechen Bei Neugeborenen sind unterschiedliche Emotionen dennoch nachzuweisen in Form von Anpassungsmechanismen: Neugeborene reagieren auf Umweltreize wie Schmerzreize, Geräusche, Lageveränderungen Dominierende Annahme: Emotionale Entwicklung ist ein Differenzierungsprozess. WW zwischen Reifungs- und Lernprozessen => Entwicklung von Emotionen als Differenzierungsprozeß Reifungsprozeß: Emotionen sind angeboren; d.h. Grundlagen für differenziertes, emotionales Erleben schon gelegt, kann jedoch erst umgesetzt werden, wenn sich bestimmte physiologische und kognitive Strukturen herausgebildet haben (Izard) Emotionsentwicklung als WW Reifung- Lernen Bridges; 30er Jahre - - Beobachtung von 60 Kindern in einem Waisenhaus Eigenschaften der emotionalen Entwicklung: Emotionen entwickeln sich aus einem zunächst vagen, undifferenzierten Zustand der Erregung. Art der emotionalen Verhaltensreaktion für jede spezifische Emotion verändert sich langsam mit der Entwicklung der Fähigkeiten und Gewohnheiten des Kindes. emotionales Verhalten wird in verschiedenen Altersstufen durch unterschiedliche Situationen ausgelöst, wobei die Situationen die eine bestimmte Emotion zur Folge haben sich dem Typ nach gleichen allgemeine Merkmale abstrakter Art, die zu unterschiedlichen, differenzierten Emotionen führen: Geburt: Erregung 3. Monat: Erregung, Lust/Unlust 6. Monat: Erregung, Lust/Unlust, Ärger, Abscheu, Furcht 12. Monat: Erregung, Lust/Unlust, Ärger, Abscheu, Furcht, Hochstimmung, Zuneigung 18. Monat: Erregung, Lust, Unlust + Eifersucht, Ärger, Abscheu, Furcht, Eifersucht, Freude, Hochstimmung Zuneigung (zu Erwachsenen und anderen Kindern) 24. Monat: Erregung, Lust + Freude, Unlust + Eifersucht, Ärger, Abscheu, Furcht, Eifersucht, Freude, Hochstimmung, Zuneigung (zu Erwachsenen und anderen Kindern) problematisch: ° wenig theoriebezogen ° es wurden lediglich Rückschlüsse durch verschiedene emotionale Verhaltensweisen erworben ° stark selektierte Stichprobe (alles Kinder aus dem Waisenhaus) Robert Emde psychoanalytisch beeinflusst, bezieht sich auf René Spitz. Theorie basiert auf Längsschnittuntersuchungen die von Emde et al. im Bereich des 1. Lebensjahres durchgeführt wurden. 3 Grundannahmen: 1. Die Entwicklung der physiologischen Strukturen und Verhaltensweisen verläuft ungleichmäßig und diskontinuierlich. 2. Emotionale Verhaltensweisen gehören zu den wichtigsten Indikatoren für Perioden besonders schneller 43 Veränderungen. Der anteilige Einfluß von Reifung und Erfahrung verschiebt sich gegen Ende des 1. Lebensjahres zugunsten der Erfahrung. Jede Periode schneller Veränderungen stellt einen „biobehavioural Shift“ dar, d.h. einen Entwicklungssprung auf die nächsthöhere Organisationsebene, der zur Herausbildung neuer Fähigkeiten und Verhaltensfunktionen führt. 3 Ebenen der Organisation werden unterschieden; sie verlaufen diskontinuierlich (siehe 1. Annahme) (a) Homöostase: Schreien aufgrund von biologischem Mangel. (b) 1. Shift: Exploration (3. Monat): aktive Exploration der Umwelt durch den Säugling; Kontaktaufnahme zur Pflegeperson, soziales Lächeln => mit der Zeit nimmt die Bereitschaft dieses Lächeln zu zeigen ab und hängt immer stärker von Stimmungen des Säuglings ab. (c) 2. Shift: Bindung (8./9. Monat): entscheidendes Verhaltensmerkmal ist das „Fremdeln“ = Furcht vor Fremden, damit verbunden große Unlustreaktion bei Trennung des Kindes von Pflegeperson; ein voll verankertes Furchtsystem hat sich schon herausgebildet, was dafür verantwortlich ist, dass sich die negativen Emotionen schneller entwickeln. 3. Sroufe - - - - - - in Einklang mit kognitiven Emotionstheorien. Betonung der kognitiven Voraussetzungen, damit emotionale Verhaltensweisen überhaupt auftreten => Bewertung der Situation durch das Kind Organisationsfaktoren der Entwicklung 1. Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen „Innen“- und „Außenwelt“. 2. Entwicklung des Gedächtnisses (insbesondere der Objektpermanenz). 3. Entwicklung des Selbstkonzepts. Stufentheorie: 0.-1. Monat: absolute Reizabweisung ° angeborener Schutzmechanismus 1.- 3. Monat: Zuwendung ° Orientierung zur Umwelt, ° hohe Anfälligkeit für Reizung, ° Exogenes (soziales) Lächeln 3.-6. Monat: Positiver Affekt ° Inhaltsbestimmte emotionale Reaktionen (lustbetonte Assimilation, Fehlschlagen von Assimilationsversuchen Enttäuschung, Frustration) ° Lust als Erregungsfaktor (Lachen, soziale Responsivität) ° Aktive Reizabwehr (Kontrolle der Affektreagibilität) 7. – 9 Monat: aktive Teilnahme ° Freude über eigene Fähigkeiten (Kompetenz, Initiierung sozialer Spiele) ° Fehlschlagen von Verhaltensabsichten (Erfahrung der Unterbrechung von Handlungsentwürfen) ° Differenzierung der emotionalen Reaktionen 9. –12. Monat: Bindung ° emotional getönte Schemata (spezifische affektive Bindungen) ° Integration und Koordination emotionaler Reaktionen (kontextbestimmte Verhaltensweisen einschließlich Bewertung und erste Bewältigungsversuche) 12. – 13. Monat: Üben ° Mutter als sichere Basis der Exploration ° Freude über Kompetenz ° Affekt als Teil des Kontextes (Stimmungen, verzögerte Gefühle) ° Kontrolle des emotionalen Ausdrucks 18. – 36. Monat: Entstehung des Selbstkonzepts ° Wahrnehmung des Selbst als selbstständigem Akteur (aktive Bewältigung, pos. Selbstbewertung, Scham) ° Gefühle der Eigenständigkeit (Zuneigung, Ambivalenz, Willenskonflikt, Trotz) 44 Entwicklung von Emotionen als Reifungsprozeß Izard - für Grundemotionen gibt es angeborene, neuronale Muster = grundlegende, physiologische Voraussetzungen Entwicklung von emotionalen Ausdrucksweisen als Resultat von Reifung, Lernprozesse spielen nur untergeordnete Rolle - Emotionen haben eine adaptive Funktion (im Laufe der Ontogenese entstanden), sie treten vor allem in sozialen Situationen auf - Verbindung zwischen sozialen, kognitiven, emotionalen Faktoren - Entwicklung von Emotionen: erhöht die Kapazität für Informationsverarbeitung von Umweltreizen, Voraussetzung für Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 3 Phasen: (1) sensorisch – affektive Prozesse - bis ca. 3. Monat - kommunikativer Aspekt - Schreien als Hilfe suchen; Aufmerksamkeitszuwendung bei neuen o. sich bewegenden Reizen; Freude beim Umgang mit Pflegeperson (2) affektiv- perzeptuelle Prozesse - ab 4. – 6. Monat - Entwicklung der Objektpermanenz, zuverlässige Präferenzen für bestimmte Reizmuster (menschliches Gesicht) - Überraschung => bei nicht Erwartetem/ Ärger => Reaktion auf wahrgenommene Einschränkung - Entwicklung des Selbstkonzepts; Einwirkungsversuche auf die Ärger auslösenden Reize (3) affektiv- kognitive Prozesse - ab 7. Monat - Entwicklung von Selbstbewußtheit: Selbstwahrnehmung- und kontrolle - Emotionen die das Abgrenzen von anderen erleichtern - Scham & Schüchternheit = Abwendung von der emotionsauslösenden Quelle - Ärger & Abscheu, Verachtung = Entwicklung eines Gefühles der Selbstkontrolle angesichts unangenehmer Situationen - Furcht- und Schuldentwicklung (z.B. Furcht durch Eingrenzung des Spielraumes bei Gefahr) ab 1. Lebensjahr sind emotionale Fähigkeiten voll ausgebildet weitere Differenzierung der Emotionen durch Speicherung der Emotionen im Gedächtnis; Symbolismus = hier werden die Emotionen mit einem Emotionswort verbunden Zusammenfassung d. Entwicklungstheorien von Darwin, Bühler/Hetzer, Bridges, Emde, Sroufe & Izard. Wann entwickeln sich die einzelnen Emotionen (in Monaten)? Interesse: 0 –2 Unlust, Unmut: 0 – 3 Schüchternheit: 12 – 18 Behagen: 1 – 2 (3: nur Bridges) / 27 (Darwin) Soziales Lächeln: 2 – 3 Abscheu: 0 – 3,5 Wachsamkeit: 4,5 Lachen, Freude: 3,75-5 Wut: 3 – 5 Furcht: 0 (Darwin) – 9 Schreckreflex: 0 Ärger: 3 –7 Schuldgefühl: 12 – 36 Überraschung, Staunen: Scham: 4 – 18 (Sroufe) 1-3 (18: Izard) Verachtung: 15 – 18 2. Emotionsausdruck Einleitung Emotionen als Syndrome = Bündel verschiedener Komponenten: (siehe oben; S. 2) Subjektive Komponente Physiologische Komponente Ausdruckskomponente/ motorische Komponente Emotionaler Ausdruck besitzt eine Vielzahl an Ausdrucksphänomenen: Forschung konzentriert sich auf Gesicht, Stimme, Körperbewegungen Historische Anfänge 45 - - - - Hippokrates (460 v. Chr.): Beschäftigung mit physiologischen und expressiven Wirkungen der emotionalen Erregung; Emotionen = Störungen des Gleichgewichts; Ausdruckserscheinungen sind quasi- automatische Folgen der internen physiologischen Veränderungen Engel; 1785/1968: „Ideen zu einer Mimik“; Unterschied „malende“ Gebärden/ „ausdrückende“ Gebärden (= nicht zu beeinflussende Wirkungen physiologischer Veränderungen), nachahmende Gebärden, absichtliche, willentliche Gebärden Herbert Spencer (1870): „die Sprache der Emotion“; Unterscheidung zwischen spezifischen Ausdrucksmustern und allgemeiner, diffuser Entladung nervöser Energie; Ausdrucksverhalten als Rudiment phylogenetisch adaptiver Verhaltensweisen Darwin (1972): „der Ausdruck der Gemütsbewegungen beim Menschen und bei den Tieren“ Grundannahme, dass Ausdrucksverhalten unmittelbar mit adaptiven Verhaltensweisen und der Übermittlung von Informationen über Emotionszustände an Artgenossen zusammenhängt Funktionen des Ausdrucks - adaptive Funktion = emotionaler Ausdruck hat sich stammesgeschichtlich entwickelt; erfüllen eine adaptive Funktion in bestimmten Situationen (z.B. Schutzfunktion des Furchtausdruckes) I. Intraorganismische Funktionen: (a) Optimierung der Informationsaufnahme und -verarbeitung = (bereits Spencer, Darwin) emotionales Ausdrucksverhalten dient dazu die Informationsverarbeitungskapazität des Organismus zu erhöhen; durch z.B. Zuwendung des Blickes etc. wird die Wahrnehmung externer Reize verbessert (b) Modulation der Erregung = emotionales Ausdrucksverhalten dient der Erregungsregulierung; das Erregungsgleichgewicht wird wieder hergestellt [Abfuhrhypothese vs. Feedback- Hypothese] (c) Energiebereitstellung und Handlungsvorbereitung = emotionales Ausdrucksverhalten mit seinen physiologischen Veränderungen dient der Bereitstellung von Energie, bzw. der optimalen Voreinstellung bestimmter Körperorgane für die jeweils adaptiven Verhaltensweisen z.B. den Organismus in Kampfbereitschaft versetzen. (d) Bahnung adaptiver Verhaltensweisen = emotionales Ausdrucksverhalten dient der Verhaltensreaktion, Handlungsdurchführung => Unterscheidung zwischen emotionalem Ausdruck und instrumenteller Handlung schwierig - soziale und kommunikative Funktion = Ausdruck stellt als motorische Komponente eine Externalisierung emotionaler Zustände dar; Übermittlung der Informationen über Emotionszustände der Artgenossen (Darwin) II. soziale Funktion/Kommunikationsfunktion: (a) Anzeige von Zustand und Reaktionen = für die Wahl der eigenen Verhaltensstrategie ist es wichtig, den motivationalen & emotionalen Zustand des anderen zu erkennen und die Reaktion anderer auf äußere Ereignisse einzuschätzen. (b) Anzeige der Verhaltensintention = im ZH mit Anzeige von motivationalem Zustand und emotionaler Reaktion steht die Andeutung der nächsten, tatsächlich geplanten und in Vorbereitung befindenden Handlung; dies muß nicht unbedingt mit dem emotionalen Ausdruck übereinstimmen z.B. kann ein Ärgerzustand erkennbar sein, jedoch der Wutausdruck unterdrückt werden und somit wird deutlich für andere, dass keine Aggressionshandlung folgen wird. (c) Soziale Repräsentation = emotionaler Ausdruck kann auch eine symbolische Repräsentationsfunktion haben z.B. bei Makaken- Affen gibt es verschiedene Alarmrufe je nach Art des Raubfeindes (Marler, 1980). (d) Anzeige und Veränderung von Beziehungen = Emotionsausdruck kann in erheblichem Maße zur Gestaltung sozialer Beziehung beitragen => kann soziale Beziehungen etablieren, verändern. Multifunktionalität = die meisten Ausdrucksweisen erfüllen mehrere Funktionen gleichzeitig (Geste des Wutausdruck: dient motorischen Vorbereitung, als auch Anzeige von Zustand und Verhaltensintention). Determinanten des Ausdrucks - Scherer et al.(1980) haben 2 Haupttypen von Determinanten des Ausdrucksverhalten unterschieden: 1.) Ausdruck als Begleiterscheinungen organismischer Veränderungen („Push-Faktoren“) auftretende physiologische Veränderungen, die das Ausdrucksverhalten in eine bestimmte Richtung „drücken“ physiologische Veränderungen haben unwillkürlich Auswirkungen auf Art & Intensität des motorischen Ausdrucks; können nur in geringem Maße in ihrer Wirkungsweise beeinflußt werden. Art und Stärke der physiologischen Veränderungen bestimmen die Wirkung auf das Ausdrucksverhalten. unabhängig von sozial- normativen Vorgaben. z.B. Erhöhung der Grundfrequenz der Stimme, Muskelzittern ... 46 somatisches und vegetatives NS => Dominanz des Sympathicus 2.) Ausdruck als soziokulturell determiniertes Signalmuster („Pull- Faktoren“) aufgrund soziokultureller Konventionen ziehen sie das Ausdrucksverhalten in Richtung eines spezifischen Zielmusters orientieren sich an externen Vorgaben, Normen wirken darauf hin, jene Ausdrucksmuster zu erzeugen, welche durch Selbstdarstellungsabsichten, Situationsanforderungen etc. vorgegeben sind. hauptsächlich somatisches NS = Muskulatur, da vegetatives NS nicht willkürlich steuerbar Durch die kommunikative Funktion von Ausdrucksverhalten („Pull- Faktoren“) ist anzunehmen, dass sich Emotionensausdruck im Laufe der Phylogenese durch Veränderungen der genetischen Programmierung des Ausdruckspotentials eine Anpassung an die Eindrucksbildung bei anderen ergeben hat. Ausdrucksverhalten wird auf die jeweiligen Interaktionsprozesse abgestimmt: Kommunikation über Senderzustand, Intentionen, Verhaltensapell an Interaktionspartner. - Versuch einer Typologie von Pull- Faktoren: (a) Anziehen und Vertreiben von Artgenossen im Tierreich (Darwin) = angenehmes oder unangenehmes Signalmuster an andere, um sie fernzuhalten/ anzuziehen. (b) Signalübermittelung und Lokalisierbarkeit: Signale werden angesichts der jeweils herrschenden Umweltbedingungen ohne allzu große Verluste vom Sender an Empfänger übermittelt. (c) Akkomodation = Angleichung der Ausdrucksmuster im Rahmen einer Interaktion mit einem Interaktionspartner der uns sympathisch ist, z.B. Sprechweise (Dialektverwendung, Pausen, Lautstärke...) oder bei Empathie. (d) Kontrolle und Maskierung von Push-Effekten = unbewußtes o. bewußtes Bemühen Ausdrucksverhalten zu unterdrücken oder durch anderen Ausdruck zu maskieren z.B. beim „Pokerface“ statt Erregunsausdruck zu äußern oder „soziales Lächeln“ statt Ärger- Ausdruck. - ritualisierte, stereotype Formen des emotionalen Ausdrucks z.B. ritualisierte Affektausdrücke im Gesicht bei Ekel oder das „soziale Lächeln“; ritualisierte Affektausdrücke wie vokale Embleme wie „ach“/ „oh weh“, durch spezifische soziale Situationstypen gefordertes Ausdrucksverhalten (bei Begräbnissen, Hochzeiten) wie Sprachstilform u. vokale, stilisierte Register („Mein herzliches Beileid“). - Selbstpräsentation = Intention des Senders beim Empfänger möglichst positiven Eindruck als z.B. kompetenten, sozialen Akteur zu hinterlassen - - Neuro-kulturelle Theorie (Ekman & Friesen) entsprechen der Regulation des Emotionsausdrucks aufgrund von verschiedenen Rollenerwartungen und Normen in verschiedenen Situationen: 2 Aspekte des Emotionsausdrucks: 1. Evolutionär kulturübergreifende Faktoren genetische Bedingtheit des Ausdrucks. 2. Bedeutung sozialer Lernprozesse für den Ausdruck universeller Emotionen „Display rules“ Display rules sind Regeln für den Ausdruck von Emotionen in bestimmten Situationen (z.B. Beerdigung), die kulturell verschieden sein können und über soziale Lernprozesse vermittelt werden. 1.) Übertreibung = Emotion wird stärker als eigentlich empfunden ausgedrückt. 2.) Deintensivierung = Ausdrucksverhalten wird reduziert, da der volle Emotionsausdruck in der Situation unangemessen wäre (z.B. Ärger über Chef). 3.) Affektlosichkeit = erlebte Emotion wird für andere nicht sichtbar; Neutralisierung. 4.) Maskierung = negative Emotionen werden z.B. durch ein soziales Lächeln verborgen. Einflussfaktoren: ° Merkmale von Kulturen ° Statusunterschiede, Machtdistanz ° Rolle und Geschlecht des Senders ° Ingroups/Outgroups Untersuchungen: I. Friesen, 1972: Zeigen des Filmes „Subincision“ Vpn: Japanische und amerikanische Studenten Bedingungen: alleine den Film schauen vs. zu zweit den Film schauen (Anwesenheit des VL) AV: Mimik Ergebnisse: War die Vp alleine, zeigten amerikanische und japanische Studenten keine Unterschiede in der Mimik. 47 Zu zweit maskierten japanische Vpn negative Affekte durch Lächeln. Im Nachinterview zeigten japanische Vpn eine vollkommen neutrale Mimik. II. Matsumoto, 1990 Befragung japanischer und amerikanischer Vpn anhand von Emotionsbildern, wie angemessen der Emotionsausdruck auf den Bildern sei unter folgenden Bedingungen: Alleine – öffentlich – Freunde – Familienangehörige – Zufallsbekanntschaften – Statushöheren – Statusniedrigeren – Kindern. Amerikanische Vpn fanden es angemessener Trauer ggüber Freunden & innerhalb der Familie auszudrücken. Japanische Vpn fanden es angemessener Ärger ggüber Leuten auußerhalb des Freundeskreises und der Familie auszudrücken. Japanische Vpn fanden es angemessener Ärger ggüber Statusniedrigeren zu zeigen. Amerikanische Vpn fanden es angemessener Freude in der Öffentlichkeit auszudrücken. - - - - Messverfahren Mimik (FACS/FAST) Stimme Körpermotorik Ausdrucksformen einzelner Emotionen Mimik Vokalisation Motorik Mimik Steuerung über motorische Zentren des cerebralen Cortex (Steuerungsareale nehmen (zusammen mit denen für die Hand) den größten Anteil ein): Obergesicht wird von „primitiven Bereich“ gesteuert = geringes Repertoire mimischer Bewegungen; Untergesicht = größeres Repertoire einzelner Ausdrucksweisen mimische Muskulatur steht – im Gegensatz zur übrigen Muskulatur – weitgehend dem Emotionsausdruck zur Verfügung (übrige Muskulatur hat primär andere Funktionen). - Messungen von distalen Hinweisen der Mimik: A: Messung mittels EMG = elektromyographische Techniken an Effektororganen. Problem: hochdifferenzierte, mimische Ausdrucksmuster können nicht erfasst werden, da die Elektroden oft Aktivitäten mehrere Muskeln gleichzeitig erfassen; optimale Nadelelektroden beeinflussen Vp zu sehr. B: Messung mittels Kodier- und Beschreibungssystemen: - Beobachter als Messinstrument; meist Videobandaufzeichnungen. - Kodiersysteme mimischen Ausdrucks basieren meist auf zugrundeliegenden Muskelstrukturen. 3. „Facial Affect Scoring Technique“ (FAST) von Ekman, Friesen & Tomkins (1971) Beurteilung einzelner Gesichtspartien auf Bildern oder Videos: ° Brauen / Stirn ° Augen ° Untere Gesichtshälfte Vergleich mit prototypischen Bildern aus dem FAST-Atlas Über eine Integrationsformel wird ein Profil für die Emotionen Freude, Überraschung, Traurigkeit, Wut, Ekel und Furcht bestimmt. 2. „Facial Action Coding System“ (FACS) von Ekman und Friesen (1978) mit diesem System werden mimische Ausdrucksweisen objektiv erfasst durch Unterscheidung von kleinsten Einheiten mimischen Verhaltens in „Action Units“ (AUs) (Aktionseinheiten) durch geschulten Beobachter; Action Units: ° Kleinste / minimalste Einzelbewegungen im Gesicht, die von außen erkennbar bzw. unterscheidbar sind ° Sie können entweder die Aktivität einzelner, aber auch mehrerer Gesichtsmuskeln wiederspiegeln. ° Es wird pro „Action- Unit“ (gibt insgesamt 44) kodiert, welche Muskeln innerviert wurden unabhängig von anderen Muskeln. ° Z.B. inner brow raiser; outer brow raiser; brow lowerer; upper lid raiser; ... jew clencher; Lip bite; cheek blow; cheek puff; cheek suck; ..... 48 FACS erfordert 4 Operationen a) Bestimmung derjenigen AUs, die für die beobachteten Gesichtsbewegungen verantwortlich sind. b) Beurteilung der Intensität auf einer 3-Punkte-Skala: niedrig (X), mittel (Y) und hoch (Z) c) Entscheidung, ob eine Gesichtsbewegung asymmetrisch oder unilateral ist d) Bestimmung der Kopf- und Augenposition während der Gesichtsbewegung. Probleme von FACS ° Aufwändige Beurteilerschung ° Charakterisierung von diskreten Einzelemotionen anhand von AUs bzw. Mustern von AUs steht erst am Anfang. ° Auftreten von Mischemotionen = „Blends“, mehrere emotionale Gesichtsausdrücke in rascher Folge o. gleichzeitig in Ober/Untergesicht, wenn z.B. ein Reiz mehr als eine Emotion auslöst Vorteile des FACS ° Weniger differenzierte Kodiersysteme haben den Nachteil, dass sie einen höheren Inferenzgrad vom Beobachter verlangen - - - - - Mangel an Untersuchungen, die mimische Ausdrucksmuster in Felduntersuchungen oder nach gezielter Induktion der Emotion untersuchen Problem: induzierte Emotionen in Laboruntersuchungen oft nicht eindeutig, intensiv genug und der Zugang zu wirklichen emotional involvierenden Situationen im Feld schwierig Ekman, Friesen et al (1980): durch zu betrachtende angenehme/unangenehme Filme wurden positive/negative Emotionen bei Vpn induziert und nach Aktionsmustern kodiert z.B. mimische Reaktionen bei Freude und Abscheu meisten Untersuchungen mehr als „Eindrucksuntersuchungen“ als Ausdrucksuntersuchungen zu werten = Beurteiler verschiedener Kulturen müssen bestimmten Fotografien Emotionsbegriffe zuordnen z.B. Ekman et al. (1973) bei diesen Untersuchungen wird mit gestelltem Gesichtsausdruck gearbeitet, welcher stereotyp und überzeichnet ist und nicht unbedingt dem echten Gesichtsausdruck entspricht Es existieren viele Beschreibungen prototypischer mimischer Ausdrucksmuster für diskrete Emotionen; z.B. Ekman et al. (1980) Vokalisation/ Stimme Spezielle kortikale Strukturen, u.a. limbisches System für vokalen Affektausdruck zuständig => jedoch noch sehr unbekannt Problem bei Messung : - mit Hilfe komplexer Messanordnungen könnte Vokalisation erfasst werden => führt zu starker Beeinträchtigung der Vp - Objektive Messungen vokaler Ausdrucksprozesse mit Tonaufzeichnungsgeräten die anschließend mit Hilfe elektroakkustischer Apparate/ Signalanalyseverfahren untersucht werden - Erfassung von artikulatorischen, vokalen Prozessen durch Expertenurteil => zu starke Einflüsse durch generelle Stimmqualität des Probanden; bislang nicht etabliert Weniger Aufmerksamkeit gefunden als Gescihtsausdruck durch größere methodische Anstrengungen und Vorrang des Visuellen. Bislang keine konkreten, akustischen Muster für vokalen Ausdruck einzelner Emotionen; zu Vorhersagen für Grundfrequenz der Stimme bei einzelnen Emotionen liegt jedoch schon empirische Evidenz vor. bisherige Befunde stellen zur Debatte, ob lediglich eine Unterscheidung zwischen „aktiven Emotionen“ mit Sympathikuserregung (Ärger, Furcht..) vs. „passiven Emotionen“ (Langeweile, Desinteresse, Trauer...) möglich ist: geringe Erregungsintensität => niedrige Grundfrequenz, langsames Tempo, geringe Variabilität hohes Erregungsniveau => höhere Grundfrequenz, schnelle Sprechgeschwindigkeit, große Lautstärke Motorik Sensomotorischer Cortex, Thalamus, Cerebellum, Hirnstammabschnitte, Basalganglien differenzierte Muster, wie in der Mimik sind hier nicht zu erwarten Messung: Kodiersysteme = objektive Beschreibungssysteme des menschlichen Bewegungsverhalten - z.B. Frey & Pool geben in ihrem Kodiersystem die Bewegung jedes Körperteils im Raum an 49 - - Kodiersysteme, die die Bewegungsqualität mit erfassen: nicht nur raum- zeitliche Charakteristika, sondern auch Dynamik und Rhythmus z.B. Hutchinsons „effort- Shape“- Methode kodiert Bewegungsabläufe auch nach „eckig“, „fließend“, „schnell“ - Notationssyteme zur Analyse des proxemischen Verhaltens= Beschreibung des Ausmaßes an interpersonaler Distanz; Körperberührung z.B. Vermutung Scherer & Wallbott, dass Scham und Schuld zu Distanz führt; Ärger und Freude zu Annäherungsverhalten Im Bewegungsverhalten (Gestik, Körperhaltung) werden keine spezifischen Emotionen ausgedrückt => nur Intensität der allgemeinen Erregung bisherige Verhaltensforschung hat sich auf Emotionen „Ärger/Aggression“ und „Furcht/Submission“ beschränkt: (Eib- Eibesfeldt, 1984) Emotion Ärger = Organismus sieht sich im Besitz der nötigen Ressourcen zur Bewältigung der Situation o. versucht sich zumindest so darzustellen. Tendenz sich „größer zu machen“ z.B. durch Heben des Kopfes, der Brust und Zurückziehen der Schultern. Emotion Furcht = Organismus nimmt an, dass seine Bewältigungsressourcen in der Situation nicht ausreichen. Erscheinungsbild des Körpers wird verkleinert; Senkung des Kopfes, Schultern fallen nach vorne. Beziehung des Emotionsausdrucks zu der Emotionskomponente physiologische Erregung - 2 Hypothesen zu dem Verhältnis physiologische Erregung- Emotionsausdruck: (1) Abfuhr- Hypothese = Ausdrucksverhalten kann dazu beitragen emotionale Erregung zu reduzieren - Ausagieren emotionaler Impulse durch z.B. heftige Bewegungen => „Abreagieren“ = ein „emotionaler Druck“ wird an einem äußeren Ventil abgeleitet - wenig empirische Evidenz => meisten Untersuchungen hierzu zu der Emotion Ärger; Aggressionsverhalten - Geen et al. (1975): physiologische Erregung konnte reduziert werden, wenn Aggression gegen ein frustrierendes Hindernis durchgeführt wurde; nicht reduziert wurde das Ärgergefühl der Vpn Schlußfolgerung, dass u.U. durch körperliche Aktivität unspezifische Erregung abgebaut wird, jedoch nicht der emotionale Zustand - Buck et al.: Untersuchung mit emotionsauslösenden Dias => Personen mit weniger Ausdrucksverhalten zeigten physiologisch stärkere Reaktionen, als Personen mit mehr Ausdrucksverhalten => Unterscheidung zwischen Externalisierenden = Personen, die emotionale Erregung eher im Ausdruck, weniger physiologisch zeigen und Internalisiserenden = Personen, die emotionale Erregung eher physiologisch, weniger im Ausdruck zeigen (Jones, 1950) - Generell ist der Nachweis eines inversen Verhältnisses Ausdrucksverhalten und physiologische Reaktion nicht ausreichend gelungen (2) Verstärkungs- Hypothese = Ausdrucksverhalten kann dazu führen, dass emotionale Erregung gesteigert wird - Emotion als integriertes Syndrom der 3 Komponenten (physiologisch, motorisch, kognitiv/affektiv) => Veränderung einer Komponente geht mit Veränderung der anderen Komponenten einher (James, Wundt) - im Einklang mit „Facial- Feedback- Hypothese“ = Rückmeldungen expressiver Motorik an zentral starke Version: mimisches Verhalten notwendig und hinreichend für das Erleben einer Emotion - empirische Evidenz: siehe Laird (1979); Ekman et al. (1983) abgeschwächte Version: Rückmeldungen des mimischen Ausdrucks stehen in positiver Beziehung zum emotionalen Erleben => je intensiver der Ausdruck, desto intensiver das Erleben der Emotion - empirische Evidenz: Lanzetta et al.(1976/77): Manipulation des Gesichtsausdrucks während eines Schmerzreizes, führte bei Ausagieren des Schmerzreizes zu intensiveren physiologischen Reaktionen und subjektiven Schmerzangaben als bei Unterdrückung der Schmerzäußerung Empathie und Wahrnehmung des Emotionsausdrucks Wie werden Emotionen durch den Beobachter aufgrund des Ausdrucksverhaltens erkannt? Lipps; 1907: Erklärung mittels Nachahmungstendenz = der Beobachter ahmt unbewußt das gesehene Ausdrucksverhalten nach; diese Nachahmung induziert im Beobachter eine Erfahrung oder ein Gefühl, was dann wieder über „Hinausverlegen“ der beobachteten Person zugeschrieben wird 50 Nachahmungstendenz stellt die Wurzel der Empathie dar Entspricht Rohracher´s Rudimententheorie (1963): „ideomotorische Reaktionen“ = imitierte Ausdrucksbewegungen induzieren Gefühle, die beim wirklichen Erleben von Emotionen mit diesen Bewegungen verbunden sind Flavell; 1977: Unterscheidung von 3 Arten des Erkennens von Emotionen bei anderen (1) „nicht- empathische Inferenz“ = der Beobachter schließt schlußfolgernd aus Informationen über Ausdrucksverhalten und situativen Kontext auf mögliche Emotion der anderen Person (2) „inferentielle Empathie“ = die Person erlebt die gleiche Emotion wie eine andere und schließt somit aus ihrem eigenen Erleben auf die Stimmung der anderen Person (3) „nicht- inferentielle Empathie“ = entspricht Lipp´s Nachahmungskonzept - generell haben eine Vielzahl an Untersuchungen gezeigt, dass Beurteiler gut in der Lage sind, Emotionen aufgrund mimischer Ausdrucksmuster zu erkennen auch interkulturelle Studien bewiesen dies (Ekman et al. (1982), Izard (1977), Rosenthal et al (1979)) Erkennungsleistungen sind abhängig von der Art der Emotion: Emotionen, deren Ausdrucksmuster spezifische Charakteristika aufweisen wie Lächeln bei Freude sind leichter zu erkennen, als die von subtileren Ausdrucksmustern begleitet werden Emotionen mit ähnlichen motorischen Teilkomponenten werden leichter verwechselt, als solche mit spezifischen motorischen Teilkomponenten z.B. das Aufreissen der Augen bei Furcht und Überraschung (vergl. Ekman (1982)/ Schlosberg (1952)) - Befunde zu dem Erkennen von Emotionen anhand Körperbewegungen: Ekman & Friesen (1967;1974): Beurteiler können aus der Beobachtung von Körperbewegungen (Videoaufnahmen) nur den generellen Erregungsgrad einer Person, nicht die Art der Emotion, bestimmen Widerspruch zu Rosnethal (1979): grobe Klassen von Emotionen können aufgrund von Bewegungen überzufällig genau erkannt werden Carmichael, Wessel, Roberts (1937): Gesten können emotionale Bedeutungen übertragen - Emotionserkennung/- eindruck = nicht durch einzelne Komponenten, sondern Vielzahl an Informationen wie visuelle, vokale Hinweisreize, Situationscharakteristika, zeitliche Abläufe, Normen- und Rollenmuster ein Verhaltensaspekt wird immer im Kontext anderer Verhaltensweisen & des situativen Kontext gesehen Emotionsbeurteiler müssen distale Hinweisreize (Ausdruck) proximal (im Situationskontext) abbilden und proximale Hinweisreize zu einem Urteil integrieren - Brunswick´s Linsenmodell; 1959 Untersuchung von Emotionausdruck nur im ZH mit Eindrucksprozessen im Rahmen interpersoneller Kommunikation Senderzustand: Merkmal Externalisierung objektiv beobachtbare, distale Hinweisreize: durch physiologische Prozesse und motorische Prozesse Perzeption = Übertragung in auditorischen, visuellen Sinneskanal des Empfängers Empfänger - Attribution des Senderzustandes Inferenz = Anwendung probabilistischer Inferenzmodelle - - beim Empfänger als proximale Perzepte abgebildet Bsp. Emotion Ärger: Senderzustand = Ärger; distale Hinweisreize/ physiologische, motorische Prozesse = Innervation des Masseter und Corrugator Muskels, Erhöhung der Grundfrequenz der Stimme, Erhöhung der Lautstärke...; proximale Perzepte = zusammengekniffene Augen, gespannter Mund, hohe Stimme, laute Stimme ...; Empfänger- Attribution = Ärger Zur Untersuchung des Eindrucks beim Empfänger und Emotionsausdrucks des Senders müssen alle der 4 Hauptkomponenten berücksichtigt werden und systematisch untersucht werden Nachteil bisheriger Forschung: hat sich bislang meist auf nur eine Hauptkomponente jeweils spezialisiert häufig subjektiv-bewertende Beschreibungen von Eindrucksprozessen keine klare Trennung zwischen distalen und proximalen Hinweisreizen: viele Forschungsansätze beiten detaillierte Beschreibungen der proximalen Perzepte, die beim Empfänger erzeugt werden keine Verbindungen/systematischer Bezug zu den objektiv bestimmbaren distalen Reizen oder auch von der Empfängerattribution zur auslösenden Attribution häufig kommt es zu naiven, psychologischen Schlußfolgerungen wie z.B. „niedergeschlagene Augen“ „Submission“ 51 - Bisherige Forschungen gestützt nur auf einzelne Komponenten des Linsenmodells: Variation des Sender- Emotionszustand = Induktion von Emotionen beim Sender (Problem: praktische, ethische Grenzen) Objektive Analyse distaler Hinweisreize = abgesicherte Erhebungsinstrumente und Kodierungsverfahren vorhanden Erfassung proximaler Hinweisreize = in vielen Ausdrucksmodalitäten sind proximale Hinweisreize keine 1:1 Abbildungen der distalen Hinweisreize; bilden den Input für Inferenzprozesse Erfassung der Beobachterattribution = bislang meist prozentuale Erkennungsgenauigkeit; heute: funktionale Validität = Korrelation zwiwschen Kriterium und Attribution oder sind Fehler in Emotionszuschreibungen entstanden (Verzerrungen in einem Kommunikationskanal, mangelhafte Inferenzregeln) Emotionstheorie Mc Dougall (1908, 1937) - 1908/1960: Veröffentlichung „Social Psychology“; Forderung einer „Evolutionären Psychologie“ auf Darwin´s Erkenntnissen aufbauend Theorie über Entstehung und Natur von Emotionen [an James orientiert]: Emotionen als im ZH stehend mit Instinkten Instinkte = angeborene, spezifische Dispositionen des Menschen gekennzeichnet durch spezifische Handlungsimpulse und Emotionen zur Bewältigung ganz bestimmter Anpassungsprobleme Funktion des Instinktes (biologische Funktion) = Lösung des Anpassungsproblem durch zielgerichtete Verhaltensweisen bereichsspezifisch = Instinkte sind insofern bereichsspezifisch, als das jeder davon einen im Laufe der Evolution entstandener Mechanismus zur Bewältigung eines bestimmten Anpassungsproblems darstellt Instinktverhalten = Gesamtreaktion des Organismus; nicht bloß zielgerichtete Instinkthandlung, vegetative Reaktionen, bei einigen Instinkten auch emotionaler Gesichtsausdruck - Instinktmechanismen (laut McDougall entspr. Emotion) Auslöser; jeder Instinktmechanismus (Emotion) wird aktiviert durch indirekte Auslöser = z.B. bestimmte instinktspezifischen Auslöser / Objekte hervorgerufen direkte Auslöser = Kognitionen emotionsspezifische/ instinktspezifischen Wahrnehmungen eines oder mehrerer Auslöser und Interpretation von diesen Objekten /Ereignissen (z.B. Sichtung eines bestimmten Objekt und Interpretation als „gefährlich“) - Differenzierung innerhalb der Auslöser (a) natürliche, angeborene Auslöser: - spezifische angeborene Auslöser - Mitgefühl (siehe unten) (b) modifizierte und erlernte Auslöser: - assoziierte Auslöser = durch Konditionieren erworben; Objekte oder Ereignisse, die ursprünglich keine Angst auslösten, lösen aufgrund von Assoziationen nun den Instinkt (z.B. Furcht) aus - ähnliche Auslöser = Objekte oder Ereignisse, die einem natürlichen oder konditionierten Auslöser ähnlich sind lösen ebenfalls den Instinkt aus - spezialisierte Auslöser = von den verschiedenen Varianten eines natürlichen Auslösers, die ursprünglich alle den Instinkt hervorriefen (z.B. alles was lauten Lärm hervorrief), verursachen aufgrund von Spezialisierung nur noch bestimmte Varianten Furcht aus (z.B. Alarmsirene, aber kein Türknall mehr) weiterer Auslöser: Emotionsauslösung bei anderen durch Mitgefühl - 52 - gilt für alle Instinkte: Auslöser für Instinktmechanismus nicht nur instinktspezifische Auslöser, sondern auch das für diesen Instinkt charakteristische Verhalten der Artgenossen Mitfühlen = „unspezifische, angeborene Tendenz“; Neigung, als Folge der Wahrnehmung von Instinktverhalten bei Artgenossen dasselbe instinktive Verhalten zu zeigen und die damit assoziierten Handlungsimpulse/ Emotionen 3 Komponenten des Instinktmechanismus besteht aus; jede der Komponenten ist instinktsspezifisch = für jeden Instinkt gibt es spezifisch angeborene Wahrnehmungen/ Kognitionen, spezifische Gefühlsqualitäten, spezifische Handlungsimpulse (a) kognitiver Teilprozeß = Erkennen/ Wahrnehmung eines instinktsspezifischen Auslösers (Objekt) (b) affektiver Teilprozeß = emotionale Qualität wird generiert; Fühlen in Bezug auf diesen Auslöser (Objekt) - viszerale Veränderungen = Informationsfunktion über Qualität der Emotion (c) konative Teilprozeß (Konation = zielgerichtete, physische Aktivität, Strebung) = Handlung/ Handlungsimpuls; zielgerichtetes Handeln; Streben vom instinktsspezifischen Auslösers (Objekt) weg/ hin; - motivationale Tendenzen (zur Lösung des Anpassungsproblems) - Instinktverhalten / Emotionsausdruck= von anderen Personen beobachtbares Verhalten wie beschleunigte Atmung, Veränderungen der Vokalisationen, mimische Veränderungen... Sozial- kommunikative Funktion = Instinktverhalten hat einen kommunikativen Effekt, es wird anderen Personen mitgeteilt welcher Handlungsimpuls bei Person momentan aktiviert ist => ermöglicht anderen den weiteren Handlungsverlauf vorherzusagen und sich darauf einzustellen 3 Teilsysteme des Instinktmechanismus = zusammengesetztes System aus sensorisch- motorischen Reflexbögen; alle diese Teilsysteme sind instinktspezifisch (siehe oben): (a) Afferentes Teilsystem = rezeptorische Teil; Gruppe von Neuronen am Sinnesorgan empfangen einen Impuls und verarbeitet ihn weiter => Resultat ist eine bestimmte Wahrnehmung und Erkenntnis - bezieht sich auf die kognitive Teildisposition des Instinktes (b) Zentrales Teilsystem = [anatomischer Sitz von McDougall in Basalganglien vermutet] Nervenimpulse werden an viszerale Organe gesandt und erzeugte viszerale Veränderungen, die notwendig sind um Instinkthandlung möglichst effektiv auszuführen (Herztätigkeit, Drüsen, Blutgefäße, Darmtätigkeit...) - primäre Emotionen verdanken ihre emotionale Qualität hauptsächlich den viszeralen Sinneseindrücken [Übereinstimmung mit James] - bezieht sich auf die affektive Teildisposition von Instinkten (Fühlen) (c) Efferentes Teilsystem = Nervenimpulse an Muskeln der Skelettmuskulatur durch die die Instinkthandlung bewirkt wird (Streben/Handeln) - bezieht sich auf die konative Komponente des Instinktes der afferente und efferente Teil des Instinktmechanismus ist stark modifizierbar durch Erfahrung und Lernen (siehe modifizierte, erlernte Auslöser) ; wohingegen der affektive Teil mit seinen viszeralen Veränderungen/ Gefühlen nicht veränderbar ist Def. „Emotion“ nach Dougall: mentalistische Definition = die zum Instinktprozeß gehörige emotionale Erlebensqualität; Bestandteil des Instinktprozeß Syndromdefinition = umfaßt viel mehr als momentane Erlebensqualität; bezeichnet den gesamten ablaufenden psychischen und körperlichen Prozeß, identisch mit Instinktprozeß Funktion von Emotionen: Lösung des Anpassungsproblems; situationsangemessene Aktivierung bestimmter Handlungsimpulse, die sich in der Evolution als geeignet zur Lösung wiederkehrender Anpassungsprobleme erwiesen haben (siehe Instinktverhalten- mechanismus) Primäremotionen = nur Hauptinstinkte; Liste von 14 Instinkten und dazugehörige Emotionen bei Aktivierung einiger Instinkte besonders deutlich ausgeprägte, auftretende Gefühlsqualität (mentalistisch) oder mit dieser Gefühlsqualität verbundener Instinktprozeß (Syndromdef.) diese Gefühlsqualität ist nicht mehr zerlegbar in andere Gefühle - 1. - Hauptinstinkte: Instinkt Angeborene Auslöser Fluchtinstinkt Abstoßungsinstinkt Plötzlich laute Geräusche, Verlust von Halt, Abweichungen vom Gewohnten Geruchs- /Geschmacksreize, Emotion Handlungsimpuls Biologische Funktion Furcht davonlaufen, verstecken Verletzungen/Tod meiden Ekel Zurückweisung der Substanzen Schädigung/Krankheit/ 53 Neugierinstinkt Kampfinstinkt Dominanzinstinkt Unterordnungs – instinkt Elterninstinkt Hautkontakt mit schleimigen Substanzen mäßige Abweichungen vom Gewohnten Behinderung der Ausführung eines Handlungsimpulses Individuen , denen man sich als überlegen betrachtet Individuen, denen man sich als unterlegen betrachtet Schmerzen, Furcht und Leid von Kindern Staunen Ärger Hochgefühl Unterwürfigkeit Zärtlichkeit aus dem Mund, Zurückweichen mit Körper Annäherung, erkunden Widerstand brechen, Hindernisse beseitigen Überlegenheit zeigen, Mitmenschen führen, sich behaupten/ auszeichnen unterwürfiges Verhalten zeigen, nachgeben, gehorchen ernähren, behüten, beschützen Tod meiden Auslösen anderer Instinktprozesse Andere Instinktziele erreichen Rangkämpfe vermeiden Rangkämpfe vermeiden Überleben der Nachkommen sichern 2. Sekundäremotionen = angeborene, unspezifische Dispositionen; Nebeninstinkte wie z.B. - Reproduktionsinstinkt, Konstruktionsinstinkt, Herdeninstinkt Emotionen wie z.B. Freude, Dankbarkeit, Mitleid, Schuld, Bewunderung, Verachtung, Neid zwei Formen: (1) komplexere (gemischte) Emotionen = Mischung von jeweils 2 (oder mehreren) Primäremotionen, „sekundäre Zusammensetzung“, z.B. Dankbarkeit - neue Emotionsqualitäten entstehen: Gefühlsqualitäten, die gleichzeitig ablaufen vermischen sich - selten treten Primäremotionen in reiner Form auf; vielmehr laufen im Regelfall zwei oder mehr instinktive Prozesse gleichzeitig ab - Gesinnung = Gefühlshaltung gegenüber dem Auslöse- Objekt gegenüber; komplexe Emotionen entstehen gegenüber Objekten gleichzeitiges Auftreten mehrerer Emotionen gegenüber einem Objekt, nur wenn vorher Lernprozese stattgefunden haben: durch Assoziation/ Konditionieren wird ein und dasselbe Objekt Auslöser für mehrere Primäremotionen Gesinnungen lassen sich in 3 Hauptgruppen einteilen: Zuneigung zu einem Objekt (dominierende Emotion Zärtlichkeit), Abneigung gegenüber einem Objekt (entspringt den Primäremotionen Ekel und Furcht), Respekt gegenüber einem Objekt (Hochgefühl und Unterwürfigkeit) Bsp. Bewunderung für ein Objekt: Mischung der Primäremotionen Staunen/ Handlungsimpuls sich nähern und weiter damit beschäftigen und Unterwürfigkeit/ Handlungsimpuls sich „klein zu machen“ (2) abgeleitete Emotionen (Menschen, höhere Tiere)= Zusammenwirken von Primäremotionen z.B. dem instinktiven Handlungsimpuls und anderen mentalen Prozessen - abgeleitete Emotionen sind affektive Reaktionen auf den vermuteten oder wahrgenommenen Erfolg/ Mißerfolg bei der Ausführung eines Wunsches = Handlungsimpulses => bestehen daher vielmehr aus dem Erleben von Lust- Unlustgefühlen/ weniger aus dem Erleben körperlicher Veränderungen - abgeleitete Emotionen setzen sich aus zwei Faktoren zusammen: a) konativen Faktor = erlebter Handlungsimpuls, Wunsch b) kognitiven Faktor = Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Erfolges/Mißerfolges des Wunsches, aus denen die Emotion abgeleitet ist - abgeleitete Emotionen lassen sich auf folgenden 2 Wunschemotionen zuordnen, je nachdem ob das Objekt des Wunsches in der Zukunft/Vergangenheit liegt: a) prospektive (vorausschauende) Wunschemotion = Zuversicht, Hoffnung, Angst, Hoffnungslosigkeit ... Bsp. Angst (antizipatorische Unlust) vs. Hoffnung (antizipatorische Lust) b) retrospektive (rückschauende) Wunschemotion = Bedauern, Reue, Enttäuschung... 54