3 Genetische Entwicklungstheorie
Werbung
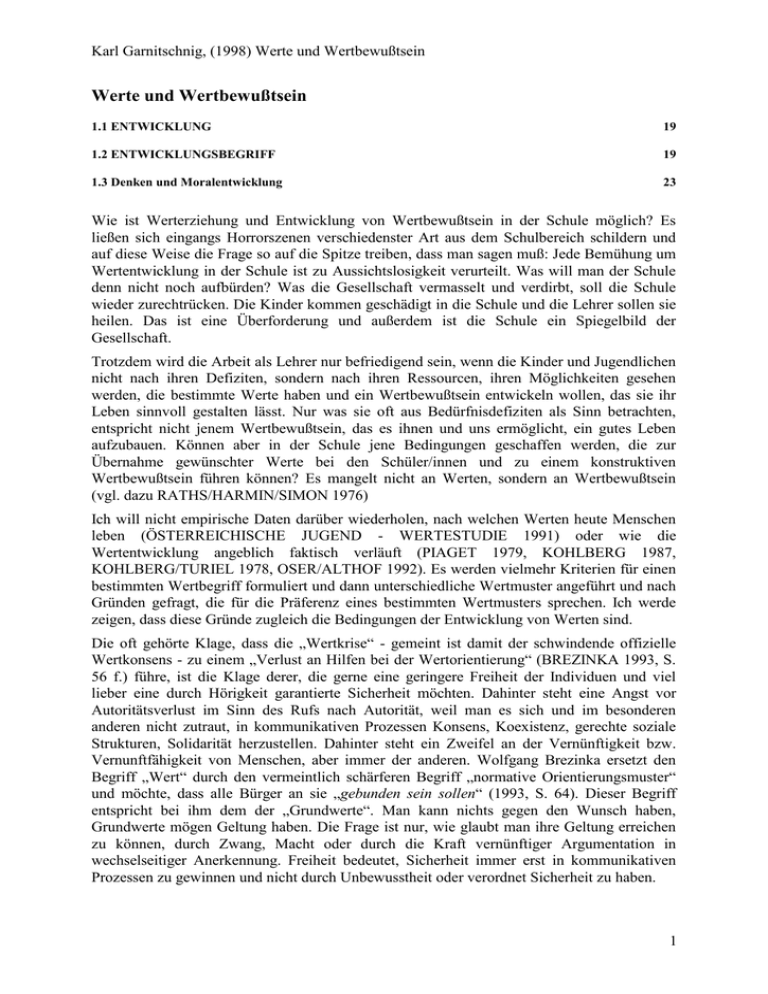
Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein Werte und Wertbewußtsein 1.1 ENTWICKLUNG 19 1.2 ENTWICKLUNGSBEGRIFF 19 1.3 Denken und Moralentwicklung 23 Wie ist Werterziehung und Entwicklung von Wertbewußtsein in der Schule möglich? Es ließen sich eingangs Horrorszenen verschiedenster Art aus dem Schulbereich schildern und auf diese Weise die Frage so auf die Spitze treiben, dass man sagen muß: Jede Bemühung um Wertentwicklung in der Schule ist zu Aussichtslosigkeit verurteilt. Was will man der Schule denn nicht noch aufbürden? Was die Gesellschaft vermasselt und verdirbt, soll die Schule wieder zurechtrücken. Die Kinder kommen geschädigt in die Schule und die Lehrer sollen sie heilen. Das ist eine Überforderung und außerdem ist die Schule ein Spiegelbild der Gesellschaft. Trotzdem wird die Arbeit als Lehrer nur befriedigend sein, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht nach ihren Defiziten, sondern nach ihren Ressourcen, ihren Möglichkeiten gesehen werden, die bestimmte Werte haben und ein Wertbewußtsein entwickeln wollen, das sie ihr Leben sinnvoll gestalten lässt. Nur was sie oft aus Bedürfnisdefiziten als Sinn betrachten, entspricht nicht jenem Wertbewußtsein, das es ihnen und uns ermöglicht, ein gutes Leben aufzubauen. Können aber in der Schule jene Bedingungen geschaffen werden, die zur Übernahme gewünschter Werte bei den Schüler/innen und zu einem konstruktiven Wertbewußtsein führen können? Es mangelt nicht an Werten, sondern an Wertbewußtsein (vgl. dazu RATHS/HARMIN/SIMON 1976) Ich will nicht empirische Daten darüber wiederholen, nach welchen Werten heute Menschen leben (ÖSTERREICHISCHE JUGEND - WERTESTUDIE 1991) oder wie die Wertentwicklung angeblich faktisch verläuft (PIAGET 1979, KOHLBERG 1987, KOHLBERG/TURIEL 1978, OSER/ALTHOF 1992). Es werden vielmehr Kriterien für einen bestimmten Wertbegriff formuliert und dann unterschiedliche Wertmuster angeführt und nach Gründen gefragt, die für die Präferenz eines bestimmten Wertmusters sprechen. Ich werde zeigen, dass diese Gründe zugleich die Bedingungen der Entwicklung von Werten sind. Die oft gehörte Klage, dass die „Wertkrise“ - gemeint ist damit der schwindende offizielle Wertkonsens - zu einem „Verlust an Hilfen bei der Wertorientierung“ (BREZINKA 1993, S. 56 f.) führe, ist die Klage derer, die gerne eine geringere Freiheit der Individuen und viel lieber eine durch Hörigkeit garantierte Sicherheit möchten. Dahinter steht eine Angst vor Autoritätsverlust im Sinn des Rufs nach Autorität, weil man es sich und im besonderen anderen nicht zutraut, in kommunikativen Prozessen Konsens, Koexistenz, gerechte soziale Strukturen, Solidarität herzustellen. Dahinter steht ein Zweifel an der Vernünftigkeit bzw. Vernunftfähigkeit von Menschen, aber immer der anderen. Wolfgang Brezinka ersetzt den Begriff „Wert“ durch den vermeintlich schärferen Begriff „normative Orientierungsmuster“ und möchte, dass alle Bürger an sie „gebunden sein sollen“ (1993, S. 64). Dieser Begriff entspricht bei ihm dem der „Grundwerte“. Man kann nichts gegen den Wunsch haben, Grundwerte mögen Geltung haben. Die Frage ist nur, wie glaubt man ihre Geltung erreichen zu können, durch Zwang, Macht oder durch die Kraft vernünftiger Argumentation in wechselseitiger Anerkennung. Freiheit bedeutet, Sicherheit immer erst in kommunikativen Prozessen zu gewinnen und nicht durch Unbewusstheit oder verordnet Sicherheit zu haben. 1 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein 1 Alles Handeln ist wertbesetzt Es wird - gegen die These von der Wertneutralität - von der Annahme ausgegangen, dass alles Handeln wertbesetzt ist. Es bezieht seine Motive aus Wertvorstellungen, aus Vorstellungen des Guten. Denn um eines für uns Guten oder gut Scheinenden setzen wir zielstrebiges Handeln ein oder verhalten wir uns auf eine bestimmte Weise. Beziehungshandeln als ein ausgezeichnetes Handeln in pädagogischen Kontexten ist ebenso von unseren Wertvorstellungen bestimmt. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, sie wirken. Da dies der Fall ist, brauchen Lehrer eine große Bewusstheit über ihre Handlungsmotive, von welchen Wertmustern sie diktiert sind. Denn alle unsere Interaktionen wirken auf andere, ob wir wollen oder nicht. Man kann sich nicht nicht verhalten. Daher ist es so wichtig, über die Motive der eigenen Interaktionen Bescheid zu wissen und vor allem darüber, aus welchen Wertmustern heraus wir uns verhalten oder handeln. Unter Handeln wird bewusstes, geplantes Verhalten verstanden, das unter Vorstellungen eines Guten steht. Man kann 1. alles unter einem größtmöglichen Lustgewinn sehen und sagen, was Lust verschaffe, ist gut, 2. unter dem größtmöglichen Nutzen entweder nur für sich oder auch für andere, und dann auch unter dem Prinzip von Gerechtigkeit, oder 3. unter dem Gesichtspunkt wechselseitiger Anerkennung unter Anwendung universeller ethischer Prinzipien und schließlich 4. kann man die Vorstellungen des Guten oder gutes Handeln unter dem Gesichtspunkt konkreter wechselseitiger Anerkennung, die in direkten symmetrischen Kommunikationen verläuft, sehen. Es ist eine Tatsache, dass es unterschiedliche Wertkonzepte gibt. Für welches aber wollen wir uns entscheiden? Angebote gibt es genug, aus allen Richtungen. Gibt es Kriterien, die uns bei dieser Entscheidung helfen können? Wir bejahen diese Frage und leiten diese Kriterien aus den Bedingungen ab, die erfüllt sein müssen, dass Menschen zu dem kommen, was für sie gut ist. Seien wir nicht dogmatisch und lassen wir einmal jede Vorstellung des Guten gelten und analysieren wir, was die Bedingung dafür ist, dieses Gute zu erreichen. Lust, Wohlbefinden im Sinne der unter 1 beschriebenen Vorstellung ist ein sehr sensibles Gut, sehr schwer zu bekommen. Das zeigt sich am deutlichsten in der frühen Kindheit. Das Kind ist bei seinem Bedürfnis nach Wohlbefinden völlig abhängig von Erwachsenen, die ihm wohlwollen. Das ist ganz leicht einsichtig und braucht nicht weiter bewiesen zu werden. Dies gilt so lange - wenn auch in einem immer weiter abnehmendem Maße - bis das Individuum in der Lage ist, voll für sich selbst zu sorgen. Was für das Erlangen von Lust oder Wohlbefinden gilt, gilt ähnlich auch vom Kriterium der Nützlichkeit. Der größte Zuwachs an Gütern für alle hat wechselseitige Anerkennung zur Bedingung. Also ist wechselseitige Anerkennung jenes Kriterium, das die Erfüllung aller anderen Kriterien oder Vorstellungen des Guten ermöglicht. Wir dürfen es daher mit Recht als den anderen übergeordnet ansehen. Leben Personen in wechselseitiger Anerkennung und regeln sie so ihr Zusammenleben, können sie auch die Bedingungen für ein gutes Zusammenleben schaffen. Wohlwollen und Anerkennung von anderen sind die Bedingungen einer gesunden sozialen Entwicklung. Bekommt ein Individuum, was es für seine Entwicklung braucht, nämlich Achtung, Wertschätzung und echte Anerkennung, kann es sich zu einer Person entwickeln, die Anerkennung geben kann. Das Selbst entwickelt sich aus sozialen Interaktionen, die von Anerkennung und Wertschätzung getragen sind (NOAM 1993, S. 174). Als Resumee der bisherigen Argumentation stellen wir fest, dass wir als vergesellschaftete Individuen unser wie immer verstandes Wohl nur unter der Bedingung wechselseitiger 2 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein Achtung und Anerkennug erreichen. Daraus kann die Forderung abgeleitet werden, dass alle Regeln des Zusammenlebens aus den Bedingungen wechselseitiger Anerkennung aufgestellt werden sollten. Dies lässt sich aber nur umsetzen, wenn Regeln nicht von außen vorgegeben werden, sondern aus den Notwendigkeiten des Zusammenlebens entstehen. Nur dann nämlich werden sich die Schüler ernst genommen und anerkannt fühlen. Hinweise auf Vorschriften bringen den Interaktionspartner in die Ecke eines unechten Menschen, der nicht ernst genommen wird. Dass diese Forderung auch an die Schulverwaltung adressiert werden muss, soll später aufgenommen werden. Werden Schüler ernst genommen, dann werden diese Regeln auch gut in diesem Sinne sein, dass sie aus eigenem ihr Bestes geben, ihre Freiheit zum Wohl der anderen einsetzen. Da wir, was wir tun, um eines für uns Guten willen tun, können wir bei allem Handeln nach seinen Grundmotiven fragen und werden dabei zu den faktischen Wertmustern von Personen kommen. Alles Handeln ist also motiviert, aber die Motive können meh oder weniger bewusst sein, und außerdem können wir uns bei verschiedenen Handlungen mehr oder weniger konsistent motivieren. 1.1 Anerkennung als Bedingung und Ziel des guten Zusammenlebens von Individuen Nehmen wir an, dass ein gutes Zusammenleben das Ziel sowohl der Entwicklung der Individuen als auch der gesamten Menschheit ist, wechselseitige Anerkennung aber die Bedingung für die Erreichung dieses Ziels, dann ist auch wechselseitige Anerkennung ein Wert für sich. Der Sinn des Sinns menschlichen Handelns wäre danach, dass Menschen in selbsttätiger und selbstbestimmter Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt zu einem guten Leben kommen. Da dies nur bei wechselseitiger Anerkennung möglich ist, wie wir bedingungsanalytisch festgestellt haben, müssten wir alles tun, dass Menschen tatsächlich wechselseitige Anerkennung lernen und leben können. Anerkennung ist somit Bedingung und Ziel eines guten Zusammenlebens von Individuen. Es wird sehr viel über Lernen und Lernprozesse auch über das Lernen von Werten gesprochen, aber es wird dabei der interaktionelle Aspekt des Lernens, die Bedeutung der Beziehungsdynamik für die Aneignung der Lerninhalte auf den verschiedenen Ebenen zu wenig beachtet. Gerade für die Aneignung von Werten bzw. von Wertmustern oder von Grundüberzeugungen, die wir bei der Aneignung von Welt zugrundelegen, ist der Beziehungsaspekt von herausragender Bedeutung, denn es kommt hier im besonderen das Sozialemotionale und der Wille zum Tragen. Im sozialemotionalen Bereich und in dem des Willens heißt Lernen, Austausch mit anderen zu pflegen und in diesem Austausch alle Erfahrungen über Welt einzubeziehen. Also spielt dabei immer auch der kognitive Aspekt hinein und wir brauchen bei der nötigen Betonung von Wertungsprozessen nicht zu befürchten, dass dadurch die intellektuelle Entwicklung leidet. Das Gegenteil ist der Fall. RATHS/HARMIN/SIMON konnten in empirischen Untersuchungen nachweisen, dass durch Wertklärungsverfahren sich neben anderen Faktoren auch Lernschwächen positiv verändern. Es verbessert sich die Einstellung zum Lernen, die Schüler werden initiativer, selbständiger, ausdauernder, beteiligen sich aktiver, werden tatkräftiger, zielbewusster und kreativer (1976, S. 65). Das ist klar, denn beim Prozess der Wertklärung werden generalisierte kognitive Fähigkeiten geübt. 3 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein 1.2 Beziehungsdynamik und Wertungsprozesse Erst in der Beziehungsdynamik - basierend auf Anerkennung - ist Wertklärung in einer Weise möglich, in der die Kinder/Jugendlichen zu selbständiger, freier Entscheidung bei Beachtung mehrerer Entscheidungsmöglichkeiten und der Abwägung ihrer Folgen kommen, in der es ihnen auch möglich ist, zu dem zu stehen, für das sie sich entschieden haben. Dies tun zu können, ist Bedingung für das Kennenlernen seiner selbst, um ein konstruktives Selbstbild zu entwickeln. Kinder haben zweifelsfrei schon von Anfang an ein Werterleben (vgl. HUBER 1993, S. 77 f.). Sie ziehen Wohlbefinden Magenkrämpfen vor und Zärtlichkeit und Fürsorge einer Vernachlässigung. Kinder „wissen“ äußerst sensibel, was für sie gut ist, weil sie ganz aus dem Gefühl leben und noch keinen Zeitbegriff haben, der es ihnen ermöglicht, Bedürfnisse aufzuschieben (vgl. GOLDSTEIN u. a. 1974, GARNITSCHNIG 1988). Da sie noch nicht rationalisieren können, reagieren sie auf Nichtbeachtung mit Apathie, Deprivation, Krankheit, sogar mit Sterben. Kinder können aber auch schon sehr früh, jedenfalls noch vor der Schule „die intrinsische Geltung universeller moralischer Regeln“ (NUNNER-WINKLER 1993, S. 105) von Spielregeln (z. B. Murmelspiel), sozialen Konventionen (Spaghetti nicht mit den Fingern essen) und Klugheitsregeln (Jeden Abend die Zähne putzen) unterscheiden (vgl. TURIEL 1983). In einer Untersuchung wurden kleine Kinder gefragt: „‘Stell dir vor, es gibt eine Familie/eine Schule/ein Land, da darf man Murmeln anders spielen/Spaghetti mit den Fingern essen/ein anderes Kind schlagen/da braucht man die Zähne abends nicht zu putzen.’ Es zeigte sich, dass die Kinder sehr klar zwischen Konventionen und Normen unterscheiden, die zu allen Zeiten und in allen Kulturen eine unbedingte, von Sanktionen und Autoritäten unabhängige Gültigkeit besitzen: Man darf ein anderes Kind nicht schlagen, auch wenn der Vater/der Direktor/der König es erlauben und nicht einmal Gott dürfte das tun oder erlauben.“ (NUNNER-WINKLER 1993, S. 105, vgl. NUCCI/LEE 1993) Bei der dynamischen Betrachtung der Moralentwicklung, die von dem Beziehungsgeschehen zwischen Kindern und ihrer sozialen Umgebung bestimmt ist, sind in die Moralentwicklung auch mögliche Brüche einzubeziehen. Grundsätzlich könnte es nämlich der Fall sein, dass zu jedem Zeitpunkt in der Entwicklung ein Ereignis eintreten kann, das für das Kind und später für den Jugendlichen und Erwachsenen bestimmend sein kann, welche Moral es/er annimmt. Die wesentlich beeinflussenden Faktoren sind das Beziehungsgeschehen, das Ausmaß an Zuwendung und Bedürfnisbefriedigung, an Achtung, Annahme, Verstehen und an Anerkennung, das Selbstbild v. a., was die Selbstwirksamkeit betrifft. Bedeutsam ist also die soziale Umwelt und ihr Druck in Richtung konformer Verhaltensweisen oder ihr Freilassen für eigenständige Entscheidungen je nach den Möglichkeiten der Person, von rigiden Erwartungen oder offenen Angeboten. Es wird hier eine genetische Theorie der Entwicklung zugrundegelegt, die nach den Vorgängern oder Vorläufern der vollen Ausprägung eines Sachverhalts, eines Persönlichkeitsmerkmals oder einer psychischen Funktion sucht (ERIKSON 1981, 1979). Die genetische Rekonstruktion von Moralentwicklung geht also von einem klar definierten Begriff von Moral aus und zeigt, wie sich seine Merkmale im Laufe der Entwicklung ausdifferenzieren. Wenn Moral die Regeln des guten Zusammenlebens betrifft, die in wechselseitiger Anerkennung gewonnen wurden und unter dem Prinzip wechselseitiger Anerkennung formuliert werden, ist für die Moralentwicklung zu fragen, wie ein Individuum im Laufe seiner Entwicklung wechselseitige Anerkennung leben kann und inwieweit es seine Umwelt begreift, bzw. wie weit es die Komplexität der Umwelt erfassen kann, um Vorstellungen über 4 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein das Leben und Zusammenleben entwickeln zu können. Das bedeutet: Wie konkret kann ein Individuum auf Situationen reagieren? Genauer: Welche Wirklichkeitsbereiche und welche ihrer Merkmale kann eine Person konkret in ihr Handeln einbeziehen? Fassen wir vorläufig zusammen: Aus der Definition von Moral als jene Regeln des Zusammenlebens, die in wechselseitiger Anerkennung zwischen Individuen ausgehandelt werden, lassen sich zwei Bedingungen von Moralentwicklung analytisch herausschälen: (1) Das Lernen wechselseitiger Anerkennung und (2) die kognitive Fähigkeit, die Situationen des Zusammenlebens beschreibenden Merkmale immer konkreter zu erfassen. Um Personen zu moralischem Bewußtsein zu führen, müssen die Interaktionen von dem getragen sein, was konstitutiv für Moral ist. Die Moralentwicklung von Kindern wird also davon abhängen, wie weit die erwachsenen Bezugspersonen zu wechselseitiger Anerkennung fähig sind und diese mit den Kindern leben können. Stehen die Bezugspersonen innerhalb der Form eines Weltverstehens, das nicht von freier Selbstbestimmung, sondern von Abhängigkeit von anderen Personen oder Normen und Wertvorstellungen getragen ist, dann wird die Beziehungsgestaltung ein Kind in die Heteronomie führen. Ist jedoch die Beziehungsgestaltung von allem Anfang an von freier Selbstbestimmung und wechselseitiger Anerkennung getragen, kommt es nicht zur konventionellen Stufe der Moralentwicklung. Die bisherigen Entwicklungstheorien hätten also nur insoferne recht, als die Beziehungsgestaltung, die jene Kinder, die für die Datenerhebung interviewt wurden, erlebt haben, von Heteronomie getragen war. Wie die Moralentwicklung verläuft, ist sowohl nach Jean Piaget als auch nach Lawrence Kohlberg von den Interaktionen mit der Umwelt abhängig. Dabei haben die sozialen Interaktionen eine besondere Bedeutung. Wie sie sich für das Kind gestalten, hängt in der Kindheit von den Interaktionen der erwachsenen Bezugspersonen mit dem Kind ab. Entscheidend dabei ist, wieweit es ihnen von ihrer eigenen Entwicklung her gelingt, auf das Kind verstehend einzugehen, dass dieses bei seinem Fühlen und Bewerten bleiben kann, auch wenn die Bezugspersonen anderer Meinung sein sollten. Bedingung für ein Gleiten in Heteronomie also ist, dass das Kind sich in seiner Existenz bedroht fühlt, was bei ihm dazu führt, dass es seine eigene Bewertung aufgibt. Die Selbstbewertung ist beim Kind verständlicherweise sehr sensibel und sehr schnell bedroht, solange es zu keiner Abstraktion und Rationalisierung fähig ist. Die Piagetschen oder Kohlbergschen Entwicklungsphasen lassen sich nur unter Bedingungen denken, unter denen dem Kind sein Selbst genommen wurde, es aufgeben musste, seine Bewertungsgrundlage in sich selbst zu spüren (vgl. dazu ROGERS 1989). Damit aber nehmen sie in ihre Theorie der Moralentwicklung moralfremde Aspekte auf und sie wird somit inkonsistent. Erfolgt die Entwicklung eines Kindes so, dass es immer vollständige Anerkennung erfährt (oder zumindest soweit, dass es sich nicht bedroht fühlt), dann wird beim Kind die Vorstellung „gut“ von eigenen inneren Bewertungsemotionen begleitet sein. Die Entwicklung verläuft dann in einer signifikant anderen Weise, wie sie von Piaget und im Anschluss an ihn von Kohlberg konzipiert wurde. Ihre Konzeption hat empirische Plausibilität, sofern es wenige Personen gibt, die wirklich vollständige Anerkennung leben können oder von ihren Bezugspartnern erleben. Daher wird es nur relativ wenige Kinder geben, deren Moralentwicklung und Moralvorstellungen die Piaget-Kohlberg’sche Theorie widerlegen könnten. Ließen sich einige Personen finden und einige genaue Fallstudien durchführen, reicht dies für eine erste Bestätigung der Hypothese. Als theoretischen Hintergrund konstruieren wir die Entwicklung der Vorstellungen von „gut“ unter Bedingungen von Anerkennung und von nicht ausreichender Anerkennung nach. Als Kriterien für gut setzen wir das an, was das Kind und dann der Jugendliche und Erwachsene 5 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein als Objekt wechselseitiger Anerkennung erkennt und austauschen kann. Das sind zunächst die Bedürfnisse, die ein Kind erfüllt haben muss, damit es sich gut entwickeln kann. Die Bedingungen einer solchen Entwicklung lassen zugleich das Kind diese Bedürfnisse entwickeln: Zärtlichkeit, Anerkennung, Vertrauen, Autonomie, d. h., die Erfahrung der Übereinstimmung mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Gefühlen (vgl. GRUEN 1990a). Es ist zwischen einer Moralentwicklung im Sinne einer genetisch entwicklungspsychologischen Theorie und den weltanschaulichen Wertkonzepten erwachsener Personen zu unterscheiden. Kinder erwerben erst im Laufe von Lern- und Reifungsprozessen Sozialperspektiven und die Fähigkeit, sich von ganz unterschiedlichen Situationen ansprechen zu lassen und sie differenziert zu sehen, dass sie auch die Folgen von Handlungen für andere abschätzen können. Erwachsene entscheiden sich mehr oder weniger bewusst und legen dabei ihren Entscheidungen Moralkonzepte bzw. Wertmuster zugrunde. Es sind daher zwei Konzepte der Moralentwicklung zu entwerfen: (1) ein entwicklungspsychologisches Konzept und (2) ein handlungstheoretisches Konzept von Moralvorstellungen bzw. Wertmustern der erwachsenen Person. Mit etwa zwölf Jahren, wenn das Kind und dann der Jugendliche fähig wird, formal zu operieren (vgl. PIAGET 1984), ist grundsätzlich die Kompetenz dazu gegeben, jedes Moralkonzept - auch das der wechselseitigen Anerkennung zu leben. Allerdings sind in der Regel Pubertierende so sehr mit sich selbst und dann mit dem Einstieg in die Ausbildung und das Berufsleben beschäftigt, dass die reife Form von Moralität sich erst mit der Gewinnung einer eigenen Identität um die Zwanzig herausbilden wird. Die Gefühle des Kleinkindes sind leider sehr leicht zu irritieren. Das Kind ist so sehr auf Sicherheit, Anerkennung und Zutrauen angewiesen, dass es sehr bald aufgibt, seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen, wenn es nicht anerkannt wird. Werden aber diese Bedürfnisse selbstverständlich anerkannt und kann das Kind vom Erwachsenen Liebe und Anerkennung erfahren, dann entwickelt das Kind selbstverständlich diese Personaktivitäten, die die erwachsenen Bezugspersonen ihm gegenüber zeigen. Ist dies nicht der Fall, wird das Kind sehr bald seinen Gefühlen misstrauen und das als gut und richtig ansehen, was die Erwachsenen von ihm wollen, sofern dies nicht gänzlich seinen Vorstellungen widerspricht. Wird das Kind gegen seine Vorstellugen immer wieder zu etwas gezwungen, was seinen eigenen Vorstellungen widerspricht, kann es schizoides Verhalten bis zu Schizophrenie (GREEN 1978) und andere neurotische Verhaltensweisen entwickeln. René SPITZ (1967), Alice MILLER (1980), Arno GRUEN (1990a, 1990b), John BOWLBY (1973, 1984) u. a. haben solche Entwicklungen beschrieben. Das Kind hat ein so großes Bedürfnis nach Angenommensein und Liebe, dass es, um sie zu bekommen, äußerst anfällig für Manipulationen aller Art und Konditionierung ist und begibt sich leicht in Abhängigkeit, wenn ihm nicht Liebe frei und bedingungslos gegeben wird. Zu seiner Entwicklung braucht jeder Mensch ein Mindestmaß an Achtung, Sicherheit, Wohlwollen und Anerkennung. Dieses Maß kann nicht von außen bestimmt werden, sondern ist an der positiven Entwicklung des Kindes zu messen, ob es Selbstvertrauen und Anerkennung anderen gegenüber zeigt. Machen wir das, was wir für unsere Entwicklung brauchen, zum Kriterium für gutes Handeln schlechthin, dann erhalten wir den Grundsatz für Moral: Was Menschen in gegewechselseitiger Achtung und Anerkennung als Regeln für ihr Zusammenleben entwerfen, ist gut. Damit sollten sich alle Regeln des Zusammenlebens aus den Bedingungen wechselseitiger Anerkennung konstituieren. Diese ist nicht nur die Grundlage aller Moralität, sondern auch der Motor der Entwicklung zu ihr. Menschen entwickeln Moralität, wenn sie in Beziehungen Anerkennung erfahren und dabei wechselseitige Anerkennung lernen. Ist dies der Fall, dann werden diese Regeln auch gut in 6 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein dem Sinne sein, dass Menschen aus eigenem ihr Bestes geben, ihre Verantwortung und ihre Freiheit zum Wohl prinzipiell aller Menschen einsetzen. Das Prinzip der Universalisierung kann real werden. Erfahren Menschen keine Anerkennung, dann geraten sie in Abhängigkeit, unterwerfen sich äußeren Mächten, und sie werden Verhaltenweisen entwickeln, über die sie sich Anerkennung verschaffen können. Solche sind dann meist mit Aggressionen verbunden. Die Spiele der Macht sind äußerst subtil und laufen nur zu oft unter der Devise, für den anderen das Beste zu wollen. Wir könnten alle Fehlformen von Verhalten unter dem Gesichtspunkt von Macht erklären (vgl. dazu GRUEN 1990b). Wird dem Kind nicht Autonomie zugesprochen, lernt es, „dass nichts zu lernen ist. Das Kind lernt, seine eigenen Reaktionen nicht zum Ausgangspunkt der Entwicklung seines eigenen Wesens zu machen.“ (GRUEN 1990b, S. 20) Betrachten wir dagegen Lernen als einen Prozess des Austauschs mit der Umwelt, in dem wir aktiv sind, dann müssen wir auch freigelassen sein, solche vernetzten Erfahrungen zu machen. Piaget und Kohlberg haben an die Kinder nicht wirklich beunruhigende Fragen gestelllt. Hätten sie das getan, dann hätten sie die Erfahrung gemacht, dass Kinder bei für sie essentiellen Fragen durchaus nicht heteronom urteilen, sondern sich selbst vertreten. Ein Gespräch mit Jasmin (5; 10) soll dies demonstrieren: I. Haben die Erwachsenen immer recht oder manchmal auch die Kinder? J. Manchmal auch die Kinder. I. Und wann haben die Kinder recht? J. Wenn die Eltern Fragen stellen, die die Kinder wissen. I. Z. B., wenn der Papa sagt, Du sollst die Hausschuhe anziehen? J. Wenn der Papa sagt, ich soll die Hausschuhe anziehen und ich will sie anziehen, dann hat der Papa recht. Wenn er sagt, ich soll die Hausschuhe anziehen und ich will nicht, dann hab’ ich recht. I. Angenommen, Du gehst ohne Hausschuhe wohin, wo es nass ist und der Papa sagt zu Dir, zieh’ die Schuhe an. Hat er dann recht? J. Ja, dann hat er recht. I. Gibt es Dinge, bei denen die Erwachsenen auf keinen Fall recht haben? J. Kein Mensch kann alles wissen. Wenn die Eltern es nicht wissen, hat man Pech gehabt, wenn sie es wissen, hat man Glück gehabt. I. Wenn ein Erwachsener ein Kind haut, hat er da recht? J. Manchmal schon. I. Wann hat er recht? J. Wenn er sich das vorher überlegt. I. Was meinst Du damit? J. Wenn er das vorher überlegt, aber wenn er es einfach macht, hat er nicht recht. I. Was sagst Du, wenn ich sage, dass es nie recht ist, jemanden zu hauen? J. Hauen ist keine gute Version. - Was heißt überhaupt Version? I. Version heißt Möglichkeit. J. A ja. Besser ist, das Kind wegtragen, wenn es schlimm ist. 7 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein I. Was kannst Du Dir denken, wann die Eltern nicht recht haben? J. Ja, z. B., wenn die Eltern sagen, mein Kind hat nie recht. Das stimmt überhaupt nicht (mit starker Betonung). [.........] I. Wenn die Eltern zu etwas zwingen? J. Die Eltern können die Kinder nicht zwingen; sie sollen sagen: willst Du mitkommen? I. Angenommen, ein Kind will über die Straße laufen und es kommt ein Auto? J. Sie sollen sagen, bitte lauf’ da nicht drüber. I. Das Kind könnte tot sein. J. Wenn das Kind die Eltern mag, dann wird es so etwas nicht machen. I. Wann mag ein Kind die Eltern? J. Wenn die Eltern zum Kind lieb sind. Sie müssen nachdenken. 1.3 Wertentwicklung geschieht, wenn Menschen in wechselseitiger Anerkennung in realen Handlungssituationen ihr Zusammenleben gestalten Wie aber bildet sich diese Wertüberzeugung heraus bzw. wie lässt sie sich herausbilden? Es interessiert uns also nicht die Tatsache des Wertwandels in unseren Gesellschaften, sondern wie können wir konkret zu einer gegebenen Zeit Wertüberzeugungen entwickeln. Vom Ansatz ausgehend wird die Frage so beantwortet, dass Bedingung der Entwicklung von Wertüberzeugungen ist, dass Personen in realen Handlungssituationen in wechselseitiger Anerkennung jene Vorstellungen entwickeln, wie sie ihr Zusammenleben gestalten möchten. Wertentwicklung geschieht, wenn wir unsere Vorstellungen des Zusammenlebens potentiell auf immer mehr Menschen in sich konkretisierenden Handlungssituationen beziehen. Für die Schulen würde das bedeuten, dass in ihnen das auch tatsächlich umgesetzt wird, was im Zielparagraphen gefordert wird, nämlich dass die Schüler demokratisches Bewußtsein erwerben (SchOG § 2). Das ist aber nur möglich, wenn Schüler die Möglichkeit zu demokratischen Entscheidungen haben. Damit dies auch tatsächlich unter den konkreten Bedingungen unserer Schulen umgesetzt wird, müssen unsere Schulen dereguliert werden und muß ihnen ein hohes Maß an Autonomie eingeräumt werden. Betrachten wir das Gesagte unter dem Gesichtspunkt der oben beschriebenen Wertmuster oder Formen des Wertbewußtseins. Wie schon gesagt, es ist nicht die Frage bedeutsam, wie Personen zu Werten kommen, denn solche haben sie, die Frage ist vielmehr, welche Bewußtheit sie über Werte haben, wieweit sie über Werte nachdenken und welche grundsätzlichen Annahmen diesem Nachdenken zugrundeliegen. So kann ein und dasselbe Gut, ein und derselbe Wert, sei es ein Ding (z. B. eine Wohnung) oder ein Sachverhalt (z. B. der Beruf oder eine bestimmte Beziehung) mit einer ganz anderen Wertbedeutung je nachdem besetzt sein, welche Grundüberzeugung, welchen Standpunkt des natürlichen Bewußtseins eine Person hat oder im konkreten Fall zugrundelegt.* Je nach Wertobjekt segmentieren Personen den Gebrauch ihrer Wertmuster. Es ist nicht nur eine Frage der Kompetenz, sondern auch der Bedeutsamkeit von Gütern für die Person, welches Wertmuster sie in einer konkreten Situation wählt (vgl. dazu DÖBERT/NUNNER-WINKLER 1978). * Dies ist die oben getroffene zweite Form der Unterscheidung von Wertentwicklung - das weltanschauliche Wertkonzept. 8 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein Abb.1: Entwicklung des moralischen Urteils Sozialperspektive unter der Bedingung von Anerkennung von mangelnder Anerkennung 0. Unmittelbarer Austausch mit Beschränkter Austausch Bezugspersonen Bezugspersonen Vorstellung von „gut“ unter der Bedingung von Anerkennung mit Gut ist, was mir wohltut von mangelnder Anerkennung Gut ist, wenn meine Bedürfnisse erfüllt werden, ein Mangel beseitigt wird 1. Das Kind unterscheidet sich von Das Kind unterscheidet sich von Gut ist, wenn meine Bedürfnisse Gut ist, wenn ich bekomme, was anderen, seine Bedürfnisse stehen anderen und ist auf seine von den Bezugspersonen befriedigt ich brauche, unabhängig von den im Mittelpunkt Bedürfnisse fixiert werden, bzw. wenn die Bedürfnisse Bezugspersonen in Übereinstimmung mit den Bezugspersonen ermöglicht werden 2. Übernahme der Perspektive Erkennt die Bedürfnisse anderer, Gut ist, sich mit jeweils einzelnen anderer, aber nur gegenüber bleibt aber um die Befriedigung der anderen austauschen zu können und Einzelpersonen eigenen Bedürfnisse bemüht die Bedürfnisse und Handlungserwartungen anderer zu berücksichtigen, zu beachten und gegebenenfalls auch zu erfüllen (ohne Zwang) Wenn ich Anerkennung bekomme, will ich Anerkennung geben. Gut ist, wenn die eigenen Bedürfnisse von anderen befriedigt werden, auch wenn es ihren Bedürfnissen widerspricht. Gut ist, von anderen Nutzen ziehen zu können (- niedriger Utilitarismus) 3. Wechselseitige Anerkennung in Das Individuum sieht sich als einer überschaubaren Gruppe zu einzeln gegenüber der Gruppe und einzelnen und zu diesen tritt nur zu einzelnen in Kontakt. untereinander Gut ist, was zur Befriedigung meiner Bedürfnisse durch die Gruppe beiträgt, wenn ich andere dazu bringen kann, meine Wünsche und Erwartungen zu erfüllen. Erwartungen anderer werden nur erfüllt, wenn ich von Gut ist, was in wechselseitiger Anerkennung zu einem guten Zusammenleben beiträgt, meine Wünsche, Erwartungen mit denen der anderen abzustimmen. Gut ist, wenn das, was die anderen wollen, mit dem übereinstimmt, 9 Karl Garnitschnig, (1998) Werte und Wertbewußtsein was ich will. 4. Wechselseitige Anerkennung Das Individuum schließt sich Gut ist, was Individuen in von Personen, die einem sozialen Interessensgruppen im System an, Anerkennung von Gleichheit als System angehören die seinen Interessen nützen Grundlage für ihr gesellschaftliches Zusammenleben aushandeln. Gut sind Regeln und Gesetze, die dazu dienen, dass in einem System das Zusammenleben aller gefördert wird 5. Wechselseitige Anerkennung Die Individuen beziehen potentiell Gut ist, wenn ein Individuum in von potientiell allen Individuen, alle anderen ein, aber nur im seine Handlungsentscheidungen Bedenken der Konsequenzen für Hinblick auf den Nutzen für die potentiell alle anderen einbezieht. alle Individuen Durchsetzung ihrer Interessen Gut sind Regeln, die für alle Individuen zu einem guten Leben führen. 6. Wechselseitige Anerkennung Die Individuen beziehen potentiell Gut ist, was Menschen in direkter von potentiell allen Individuen bei alle anderen ein, um sie direkt für wechselseitiger Anerkennung unter Abwägen der Konsequenzen in ihre Zwecke zu manipulieren Berücksichtigung der Bedürfnisse direkten symmetrischen und Interessen der anderen als Interaktionen Regeln für ihr Zusammenleben entwerfen oder wählen 10 anderen die Befriedigung meiner Wünsche ... voraussehen kann. Gut ist, was dem eigenen Vorteil und der eigenen Macht im System dient. Gut sind Regeln und Gesetze, die der Durchsetzung der eigenen Interessen nicht widersprechen Gut ist, was dem eigenen Vorteil und der eigenen Macht über potentiell alle Menschen dient Gut ist, wenn es gelingt, die anderen in direkter Weise für die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu nutzen. Sie sollen damit auch noch einverstanden sein. Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Demonstrieren wir das Gemeinte an einem Beispiel. Wählen wir dafür ein für Erziehung konstitutives Merkmal, das der Beziehung. Man kann 1. die Beziehung zu einem Menschen als Mittel-Zweck-Relation auffassen. Wenn dieser oder jener Zweck durch die Beziehung erreicht werden kann, wird sie aufrecht erhalten. Andernfalls wird sie abgebrochen. Der andere dient also als Mittel zu einem bestimmten Zweck für einen selbst oder für das System. Besonders deutlich ist das am Arbeitsmarkt. In der Schule erfüllt die Selektion diese Funktion. Verzichtet man auf die Mittel-ZweckRelation und betrachtet man den anderen in seinem Selbstzweck, müßten Bedingungen im Sinne von nicht nur einem einseitigen, sondern einem wechselseitigen Austausch zum Wohl aller organisiert werden. In der Schule scheint mir die Zielrelation in dem Sinne, dass Schüler da sind, um bestimmte Ziele zu erreichen, die vorgegeben sind, in der gleichen Zweck-Mittel-Relation zu stehen. Man müßte den anderen zumindest als gleich betrachten, um aus dieser Instrumentalisierung von Menschen, die sich negativ auf Kinder auswirken muß, herauszukommen. Man könnte 2. die Beziehung zu anderen unter dem Gesichtspunkt formaler Gleichheit sehen. Das würde bedeuten, dass in Austauschprozessen alle Individuen das formal gleiche bekommen. Jeder hätte unabhängig von seiner Individualität, seinen Besonderheiten das gleiche zu tun, das gleiche zu leisten. Die Zweck-Mittel-Relation wäre zwar aufgehoben, aber der andere bliebe abstrakt auf einen Zweck bezogen. Erreicht er ihn, ist es gut, erreicht er ihn nicht, muß er Einbußen erleiden. Alle werden über den gleichen Kamm geschoren, ihre Individualität wird nicht beachtet. Leistungen werden an dem Maßstab der großen Zahl gemessen, Gratifikationen für Leistungen erfolgen nach einem abstrakten Bezugsmaßstab à la Gaußscher Normalverteilung. Wir erkennen leicht, dass bei einem solchen Wertstandpunkt formaler Gleichheit viele auf der Strecke bleiben und nicht als Selbstzweck gesehen werden. Individuen werden zwar nicht als Mittel für einen vorgegebenen Zweck verwendet, wohl aber bleiben sie dem vorgegebenen Zweck äußerlich. Als Selbstzweck werden Individuen erst dann gesehen - seit Immanuel Kant unhintergehbarer Standard moralischen Bewußtseins - , wenn man 3. die Beziehung unter dem Gesichtspunkt konkreter Gleichheit sieht, wenn also die ganz individuellen Chancen, bestimmte Ziele zu erreichen, mitbedacht werden. Solange allerdings dieser Prozeß einseitig von einem der Bezugspartner aus erfolgt, können wir noch nicht von vollständiger Anerkennung sprechen. Auch ist eine Gesinnungsethik, die auf dem Prinzip der Universalisierung aufbaut, nicht ausreichend. Auch wenn man dem Handeln solche Grundsätze zugrundelegt, die für alle Menschen gelten könnten, bleibt der andere doch abstrakt außen. Erst wenn der andere 4. in die Beziehung als ganz konkreter Mensch mit all seinen Fähigkeiten und Mängeln einbezogen wird, der auch die Ziele aktiv und konkret mitbestimmt, ist vollständige wechselseitige Anerkennung gegeben, ist der andere real Selbstzweck. Erst in einer so wertbesetzten Beziehung dürften sich Menschen wirklich wohl und anerkannt fühlen. Erst mit einer solchen Beziehung dürften sie sich begnügen. Erst so kommt jeder zu seinem Selbstsein, wird er vollkommen als Mensch anerkannt. Was wir nun am Sachverhalt der Beziehung demonstriert haben, ließe sich am Lernen, an der Benotung, an jedem Ding und an jedem Sachverhalt demonstrieren. Etwas ist nicht an sich wertvoll, sondern bekommt seinen spezifischen Wert auf der Folie der unterschiedlichen Standpunkte von Wertbewußtsein. Daraus wird erkennbar, dass in diesem Konzept nicht über besondere Werte zu sprechen ist, denn alles Reale hat Wert, die Frage ist, welchen Wert wir ihm - aufgrund unserer Weise Welt zu sehen - geben. Betrachten wir alles als Mittel für unsere Zwecke oder betrachten wir alles als ein sensibles 11 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK System, in dem alles und jedes vom Kleinsten bis zum Größten Achtung verdient und in das wir uns selbst einbinden wollen. 2 Ansätze zur Wertentwicklung Zur Wertentwicklung gibt es zwei Ansätze: 1. die Wertklärung, beschrieben und dokumentiert durch Louis RATHS, Merill HARMIN und Sidney SIMON (1976)* und 2. die gerechte Schulgemeinschaft in der Tradition von Lawrence KOHLBERG (vgl. dazu in diesem Band OSER, S. .......). Der erste Ansatz zielt direkt auf die Bewußtheit von Wertvorstellungen in Wertklärungsgesprächen ab, der zweite Ansatz geht von der Vorstellung aus, dass moralisches Handeln nur in realen Situationen gelernt werden kann, die durch Fairness, Gerechtigkeit, wechselseitige Anerkennung gekennzeichnet sind und in denen Personen in echte Entscheidungsprozesse eingebunden sind.** Schule muß sich also dadurch auszeichnen, dass die in ihr Beteiligten ihr Leben selbst gestalten können. Dies stellt auch die Frage, welche gesellschaftlichen Kräfte und Bedingungen in Schulen Wertbewußtsein fördern und welche ihm gegenstehen. Was sind die Bedingungen in Schulen, dass Menschen sich wechselseitig anerkennen? Dies scheint nur möglich zu sein, wenn Menschen autonom handeln können. Autonom definieren wir als in Übereinstimmung mit sich selbst, mit seinen eigenen Bedürfnissen zu sein. Jeder Zwang, jede Herrschaft führt zu Heteronomie, zu Abhängigkeit. Was die Schulen betrifft, dürfte es nicht um vordergründige Reformen gehen, sondern um die grundsätzliche Einstellung, dass Schulen darin von allen Beteiligten unterstützt werden, dass sie zu einer autonomen Gestaltung des Schullebens kommen. Lehrer werden solange ihre Professionalität im pädagogischen Bereich nicht leben können, solange ihnen nicht wirklich Verantwortung für die Belange des Schullebens übergeben wird. Wie soll man initiativ und innovativ sein, wenn immer wieder Grenzen von außen gesetzt werden? Man gibt nur dann sein Bestes, wenn einem auch etwas zugetraut wird. Auf die Schule bezogen heißt dies, dass die Professionalität von Lehrern ernst genommen wird. D. h., dass man ihnen die Möglichkeit gibt, das Leben in der Schule zu organisieren und sie in ihren Bemühungen als Beweis dafür zu unterstützen, dass man es ihnen glaubt. Lehrer würden dann mehr kooperieren, weil sie mehr kooperieren müßten. Kooperation schließt Professionalisierung ein. Der Sinn des Handelns und im besonderen moralischen Handelns ist der Aufbau eines sozialen Systems. Dies ist umso eher möglich, je mehr Individuen das Wohl aller wollen. Dieser Prozeß läuft über Kommunikationen mit dem Ziel, von sich wechselseitig zu erfahren, was das jeweilige Wohl des anderen ist. Da kann es keine Kriterien außerhalb dessen geben, was Menschen als ihr Wohl betrachten. Man braucht da nicht zu befürchten, dass dieser Ansatz wilde Folgen haben müßte, weil er aller Willkür Tür und Tor öffne. Problematisch wird dieser Ansatz nur, wenn man wechselseitige Anerkennung irgendwo abbricht. Wenn man z. B. sagt, sie soll nur für eine bestimmte Gruppe gelten oder für ein bestimmtes System. Dann entwickeln sich gefährliche Partikularismen. Zuweilen mag die Forcierung eines Standpunkts eine bestimmte Idee deutlicher hervorheben und es kann so zu einer Klärung von Sachverhalten kommen. Dies führt zu einem zweiten Kriterium über das des Universalismus hinaus, nämlich das Kriterium der Konkretion, d. h. welche Merkmale wie konkret berücksichtigt werden. Das hat mit der Sensibilität für das Detail im * Da dieses Werk vergriffen ist, sei auf HARECKER (1991) verwiesen, die das Verfahren der Wertklärung in Theorie und Praxis anwenderfreundlich beschreibt. ** Beide Ansätze sind relativ gut in verschiedenen Veröffentlichungen dokumentiert, daher ist es nicht nötig, sie hier näher zu beschreiben. Zum Just community-Ansatz siehe OSER/ALTHOF 1992 und die darin zitierte Literatur. 12 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Zusammenhang mit der Frage zu tun, welche Folgen aus Handlungsentscheidungen entstehen. 2.1 Ein dritter Ansatz zur Wertentwicklung Die hier vertretene Theorie der Wert- bzw. Moralentwicklung legt einen dritten Ansatz nahe, der auf den beiden Merkmalen der Bestimmung konkreten moralischen Handelns und Bewußtseins basiert: (1) Welche Menschen von den ersten Bezugspersonen bis hin zu potentiell allen Menschen in Handlungsmotive einbezogen und (2) wie konkret die Merkmale der Handlungssituationen erfaßt werden (können). Jede Handlungssituation und jedes Merkmal an ihr kann Motiv für unser Handeln werden. Je sensibler jemand auf Handlungssituationen und die in ihnen liegenden Handlungsaufforderungen reagiert, ein desto ausgebildeteres moralisches Bewußtsein wird er haben. Auf den Unterricht bezogen heißt dies, dass seine Inhalte nicht nur unter ihrem kognitiven Aspekt, sondern auch unter dem gesehen werden sollen, wie der Schüler zu ihm wertend Stellung bezieht. Es wäre zu wenig, wollte man nur vom Erleben, Benennen, Beschreiben und schließlich methodischen Erfassen von Inhalten ausgehen, sondern es sind immer auch ihre Bewertung in ihrer Bedeutung für den einzelnen Schüler, die Möglichkeiten von aus ihnen entstehenden Handlungsentwürfen und auch die Verwirklichung des Erfaßten und positiv Bewerteten einzubeziehen. Bei diesem dritten Ansatz werden direkt Unterrichtssituationen einbezogen und es wird gefragt, unter welchen Bedingungen sie einen Wertungs- bzw. einen Gewissensanspruch enthalten können. Dies ist dann der Fall, wenn bei der Erörterung jeder Situation und jeder Frage zwischen dem Beschreiben und Erfassen von Gegenständen und Sachverhalten und dem Sinn des gewonnen Wissens für das Handeln unterschieden wird. Der Philosoph und Pädagoge Franz FISCHER (1975, 1979, 1980), der eine Philosophie des Sinns vom Sinn entworfen hat, hat sich überhöhende Bildungskategorien entwickelt, indem er jeweils nach dem Sinn unseres Aussagens über Wirklichkeit frägt. Definieren wir Lernen als aktiven Austausch mit der Umwelt (GARNITSCHNIG 1992), dann können wir fragen, wie man sich mit der Umwelt auseinandersetzen muß, damit sie Anlaß für Wertungen wird. Er hat dies in den Zusammenhang mit der „Erziehung des Gewissens“ (1979) gestellt (GARNITSCHNIG 1994). Der Gewissensbegriff hat bei Franz Fischer mit der Auslegung der Gesamtwirklichkeit zu tun. Er unterscheidet den Gegebenheitshorizont, der die vorausgesetzte unvermittelte Wirklichkeit meint, die benannt und beschrieben (das Unmittelbar-Allgemeine) und methodisch erfaßt (das Prädikativ-Allgemeine) werden muß, von der Sphäre des Gewissens, in der das Ich den Anspruch der vorausgesetzten Wirklichkeit im Positiv-Allgemeinen, Unmittelbar-Konkreten und Positiv-Konkreten erfährt (vgl. Abb. 2). Es taucht die Frage nach der Bedeutung für die Person selbst auf, nach dem, was sie tun soll, was gut ist. Abb. 2: Bildungskategorien 13 Genetische Entwicklungstheorie Bildungskategorie ETHIK:DOK Frage-Modus Was erlebe ich und wie erlebe ich es? Wirklichkeit 2. Das Unmittelbar-Allgemeine - Das Wie benenne ich es? Benennen, Beschreiben Das einzelne Gegebene 3. Das Prädikativ-Allgemeine - Das Was ist der Sachverhalt? Interpretieren, methodische Erfassen, Alltagstheorien und wissenschaftliche Theorien Hypothese 4. Das Positiv-Allgemeine - Die Was bedeutet es für uns? Bewertung Aufgegebenes 5. Das Unmittelbar-Konkrete - Das Wie kann ich es verwirklichen? Erkennen des Möglichen Motiv 6. Das Positiv-Konkrete Was verwirkliche ich und wie Das Verwirklichen verwirkliche ich es? Vorbild Sinn 1. Die vorausgesetzte unvermittelte Wirklichkeit Gemeintes Gewißheit Wissen positiver Sinn Vollbringen Bezeugung Im Positiv-Allgemeinen, also der Bildungskategorie, in der uns die Wirklichkeit als Forderung anspricht, fragen wir nach dem Wozu theoretischer Erkenntnisse für den Menschen, aber natürlich auch der Wirklichkeit insgesamt. Wir erleben in jeder Situation, wenn wir uns auf sie einlassen, ein je nach Bestimmtheit der Situation bestimmtes Aufgegebensein, das sich als Anspruch an uns äußert, aus dem sich für uns Motive für unser Handeln ergeben. Der neue Lehrplan für die Grundschule formuliert viele solche Lernsituationen, die schon im Wortlaut diese Kategorien ansprechen. Sehr deutlich zeigt sich das Gemeinte z. B. im Lernziel „Regeln für das Zusammenleben finden, anerkennen und einhalten“ (LEHRPLAN DER VOLKSSCHULE 1987, S. 135) oder wenn die Lernziele des Erfahrungs- und Lernbereichs Natur nach einer Reihe prädikativallgemeiner Lernziele mit dem positiv-allgemeinen Lernziel abschließen: „Die eigene Verantwortung gegenüber der Natur allmählich erkennen“ (a. a. O., S. 139). Im Erfahrungs- und Lernbereich Technik ist weiters angeführt: „Sachgemäßes und verantwortungsbewußtes Handeln im Umgang mit Stoffen entwickeln“ (a. a. O., S. 143). Die Reihe der Beispiele ließe sich fortsetzen, aber man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lernziele des prädikativ-allgemeinen bei weitem die des positivallgemeinen Typs überwiegen. Daneben bietet das Leben in der Schule viele Situationen, in denen Sensibilität für den Gewissensanspruch geübt werden kann: Ein Schüler merkt, dass ein anderer Lernhilfe braucht; ein Schüler signalisiert in seiner Mimik, dass es zu Hause Pronbleme gibt; im aggressiven Verhalten eines Schülers wird sein angeschlagenes Selbstwertgefühl offenbar; ein Behinderter bekommt genau das Maß an Hilfe, das er braucht ... Sollen Schüler wirklich Wertbewußtsein entwickeln, dann muß klar sein, dass jede Lernsituation so verstanden wird, dass sie auch einen Gewissensanspruch enthält (vgl. FISCHER 1975, S. 110). Stellen Sie sich vor, Sie würden in jeder Situation auf ihren Anspruch hören. So Sie das bisher noch nicht getan haben, würde sich Ihr Leben radikal ändern. Sie würden mit den Menschen und in den Dingen leben, was bedeutet, Sie würden sie erst wirklich erleben. Sie wären aufmerksam, voll Achtung allem zugewandt. Wirklichkeit würde sich Ihnen neu, aus ihrem Sinn heraus erschließen. 14 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Bei der Entwicklung von Wertbewußtsein bzw. bei der Gewissensbildung muß jede Forderung oder Aufforderung an den Schüler an die Unmittelbarkeit des Bewußtseins des jungen Menschen gerichtet sein, d. h. die Forderungen müssen ihm Motive vermitteln können, die dem Stand seiner Entwicklung entsprechen, d. h. er muß sich aus ihnen auch wirklich entscheiden können. Ein Schulanfänger wird noch nicht in der Lage sein, Regeln für die gesamte Schule zu entwickeln, wohl aber für das Zusammenleben in seiner Klasse als Gruppe. Aus den Situationen sollen Motive einleuchten, für die sich das Kind positiv entscheiden kann und Sollen und Wollen eins werden. Diese Motive sollte der junge Mensch auch umsetzen können. Er muß berechtigt sowohl aufgrund seiner Selbsteinschätzung als auch vom System "Schule " her glauben können, dass er seine Motive auch verwirklichen kann. Eine Bedingung dafür ist sicher die, dass auch der Lehrer glaubt, dass der Schüler sie verwirklichen kann, weil er ihm nur dann Gelegenheit dazu einräumt und weil er dadurch auch den Grad der Einschätzung seiner Selbstverursachung erhöhen hilft. Der Lehrer kann also dem Schüler helfen, den Glauben an sich selbst zu stärken. Betrifft diesen Glauben die Gewißheit des Schülers, bestimmte Motive, die von ihm in Entscheidungssituationen gewählt wurden, seien auch zu verwirklichen, kann sich in ihm Wertbewußtsein verlebendigen (FISCHER 1979, S. 34). Moralisieren, also jemandem allgemeine Grundsätze vorhalten, ist verfehlt, weil solche Grundsätze das Gewissen nicht zu konkreten Motiven bestimmen können. Außerdem wäre damit ein negatives Modelllernen verbunden, weil beim Moralisieren genau das passiert, was gegen den Gewissenssinn spricht, nämlich den anderen nicht als Selbstzweck, sondern "als ein zu veränderndes empirisch Gegebenes" zu sehen (ebd.). Der Lehrer müßte dem Schüler die Einsicht vermitteln können, dass er im anderen auch sich verneint. Angst ist ebenso kontraproduktiv, denn sie kann nicht Einsicht erzeugen. Abb. 3: Ansprüche aus der Gliederung der Bildungskategorien BILDUNGSKATEGORIE 1-3 GEWISSENSANSPRUCH Die vorausgesetzte unvermittelte Wirklichkeit Wahrhaftigkeit BILDUNGSKATGORIE 4-6 Das PositivKonkrete Betroffenheit Handlungswille Das UnmittelbarAllgemeine Das UnmittelbarKonkrete Sachgerechtheit Verantwortung Das PrädikativAllgemeine Das PositivAllgemeine Ordnungssinn 15 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Es ist vorausgesetzt, dass Gewissen die Gewißheit des Wissens in sich schließt, dass Wissen durch Gewissen seinen Sinn erfährt und Gewissen durch Wissen seinen Inhalt. Aus diesem Grund müssen die Bildungskategorien 1 - 3 mit den Bildungskategorien 4 - 6 in einem solchen Voraussetzungs- und Ergänzungsverhältnis stehen. Am Anfang eines jeden Lernprozesses als Austausch mit der Wirklichkeit steht das sich Einlassen auf die Wirklichkeit. Für die Schule heißt das, dass der Lehrer die Lernziele an konkreten Ereignissen und Sachverhalten festmacht, die für die Schüler erlebbar werden und mit denen er auch etwas machen kann, die eine Bedeutung für seine Handlungswelt haben. Hier geht es z. B. auch um Formen der Mitgestaltung in der Schule. Man weiß aus vielen Untersuchungen, dass moralische Entwicklung besser greift, wenn Schüler für sie bedeutsame Bereiche in demokratischen Entscheidungsprozessen, die von wechselseitiger Anerkennung getragen sind, zumindest teilweise gestalten können (KOHLBERG/WASSERMANN/ RICHARDSON 1978, OSER/ALTHOF 1992). Die Beteiligung an Entscheidungen muß natürlich alters- und kompetenzspezifisch erfolgen. Ein Kind in der ersten Klasse der Primarschule wird noch nicht über Belange der Schule entscheiden können, wohl aber über Regeln der Arbeit in der Klasse, der eigenen Lerngruppe. Erst aus dem Erleben kann Betroffenheit und damit Interesse entstehen und kann Wahrhaftigkeit im Umgang mit Sachverhalten gelebt werden. Bei der Betroffenheit wird es nicht bleiben können, weil, wenn etwas eine Situation für eine Entscheidung sein kann, dann muß man sie auch erkennen, zunächst in der Weise des bloßen Benennens und Beschreibens, aber dann auch im Zusammenhang mit anderen Sachverhalten und Ereignissen, ohne die die Situation nicht verstanden werden könnte und woraus dann auch kein Handeln folgen könnte. Das Handeln setzt den Glauben an seine Verwirklichung voraus. Es gibt zumindest vier Gründe, die diesen Glauben nicht entstehen lassen könnten: 1. Undurchführbarkeit von der Sache her, 2. Mangel an Kompetenz, dieser kann durch Lernen vermindert werden, 3. mangelndes Vertrauen in die eigene Verursachung - da kann der Lehrer helfen, 4. der Lehrer mißtraut den Möglichkeiten eines Schülers. Dieses Mißtrauen kann wieder begründet oder unbegründet sein. Ist es begründet, muß der Lehrer Schritte anbahnen, dass der Schüler die Kompetenz erreicht; im zweiten Fall bedarf der Lehrer der Weiterbildung. Gegen all das Gesagte kann man natürlich einwenden, dass Personen nicht so ideal, sondern vielmehr nach ihren negativen Impulsen, Trieben, Gewohnheiten, manipulierten Meinungen, Trends folgend handelten. Dagegen lässt sich als faktischer Aussage wenig einwenden. Die Frage ist nur, welche Konsequenzen man aus dieser Tatsache zieht. Zunächst einmal sei festgehalten, dass Impulse, Triebe, Gewohnheiten, Meinungen nicht an sich schlecht sind. Sie sind also nicht - wie nach gewissen Vorstellungen - auszumerzen, in welchem Fall sie nur ein verdrängtes und damit der bewußten Kontrolle entzogenes Dasein hätten. Alles, was ist, bedeutet ein Aufgegebensein, das man akzeptierend wahrnehmen soll. Daraus entstehen uns Motive, die zur Entscheidung herausfordern, deren Kriterium für ihr Gutsein der Selbstzweck seiner selbst und der anderen ist. Jede dieser Bildungskategorien bedarf eigener didaktischer Formen, wenn sie in schulische Lernprozesse eingebracht werden sollen. Aus dem Gesagten wird Abb. 4 unmittelbar verständlich, sodass sie nicht zusätzlich erläutert zu werden braucht. Ein solches Lernen kann jedenfalls nur bei aktivem Lernen realisiert werden, bei dem der Schüler sich mit seiner Umwelt über Wissen, das er sich selbst erwirbt, und eigenmotiviertes Handeln auseinandersetzt. Erfolgt Lernen auf diese Weise, dann werden die Lernformen, die in Abb. 4 den einzelnen Bildungskategorien getrennt zugewiesen werden, als Einheiten verstanden werden, wie die Bildungskategorien auch in den realen Lernsituationen eine Einheit bilden. 16 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Abb. 4: Bildungskategorien in ihrem Zusammenhang mit pädagogischen Lernprinzipien BILDUNGSKATEGORIE LERNFORMEN 1. Die vorausgesetzte unvermittelte Wirklichkeit Das Miterleben - Was und wie ich erlebe? erlebnisorientiertes Lernen 2. Das Unmittelbar-Allgemeine entdeckendes, fragendes Lernen Das Benennen, Beschreiben - Wie benenne ich es? 3. Das Prädikativ-Allgemeine genetisches Lernen an der Das Interpretieren, methodische Erfassen - Was ist Wissenschaft der Sachverhalt? 4. Das Positiv-Allgemeine Die Bewertung - Was bedeutet es für mich? stellungbeziehendes, weltanschauliches Lernen 5. Das Unmittelbar-Konkrete Das Erkennen des Möglichen - Wie kann ich es verwirklichen? projektorientiertes Lernen 6. Das Positiv-Konkrete Das Verwirklichen - Wie verwirkliche ich es? Lernen am Modell, Lernen durch Tun Fassen wir die einzelnen Aspekte der Entwicklung von Wertbewußtsein zusammen: Der Schüler muß sich als anerkannt, geachtet, wertgeschätzt erleben können. Der Schüler soll sich in Lern- und Entscheidungssituationen mit seiner Um- und Mitwelt selbständig auseinandersetzen und zu ihr Stellung beziehen. Der Schüler soll seine Entscheidungen dialogisch in wechselseitiger Anerkennung begründen. In einer offenen Atmosphäre soll der Schüler die Verwirklichbarkeit seiner Vorstellungen und Motive erleben können und so sein Glaube an ihre Verwirklichbarkeit gestärkt werden. Dadurch wird die Sensibilität für den Gewissensanspruch in allen Situationen erhöht, sodass der Schüler erleben kann, dass ein Entwerfen von Regeln in wechselseitiger Anerkennung tatsächlich ein gutes Zusammenleben zu fördern vermag. 3 Genetische Entwicklungstheorie Die genetische Betrachtungsweise der Entwicklung geht von der Annahme aus, dass durch Austausch mit der Umwelt ursprünglich vorhandene Funktionen zu immer komplexeren Fähigkeiten ausdifferenziert werden. Diese Vorstellung hat schon der große böhmische Pädagoge Johann Amos Comenius, dessen große Vision es war, allem Wissen eine geläuterte Form zu geben, vertreten. Er führt in seiner Großen Didaktik (1657) als dritten Grundsatz, der zu berücksichtigen ist, damit sich alle alles leicht einprägen, an: „Die Natur entwickelt alles aus Anfängen, die klein an Maß, aber groß an inneren Kräften sind.“ (1993, S. 100) Es ist daher zunächst einmal das genau zu bestimmen, dessen Entwicklung 17 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK man verfolgen möchte. Es ist nach seinen Merkmalen genau zu definieren und dann ist die Ausformung oder Ausfaltung dieser Merkmale zu beschreiben. Im besonderen muss für die Moralentwicklung klar sein, dass jeweils die moralspezifischen Merkmale gefördert werden. Daher muss auch bei der Erfassung des Entwicklungsprozesses auf die moralspezifischen Äusserungen des Kindes geachtet und diese verstärkt werden, natürlich durch entsprechende dies Merkmale wie Autonomie, Betroffenheit .... fördernde Interaktionen (vgl. dazu Döbert 1987, S. 496). Die Autonomie von der Geburt an zu verfolhen bedeutet, dass alle autonomen Äusserungen des Kindes beachtet werden und dies im Zusammenhang mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Es lässt sich nämlich feststellen, dass bereits Kinder entscheiden können, ob für sie etwas angenehm oder unangenehm ist und hier im besonderen im sozialen Kontext. Ist die Interaktion zwischen Kind und Bezugspersonen für das Kind befriedigend, dann wendet es sich seiner Umwelt und Mitwelt vermehrt zu. Die Initiaive geht dabei vom Kind aus. Stimulation ist schon für sich befriedigend und wird daher aufgesucht (empirisch nachweisen). Dies beweisen die Untersuchungen zum Hospitalismus, im besonderen die zur frühkindlichen Deprivation (vgl. Hellbrügge 19..). Etwas, was erreicht worden ist, wird nicht auf der nächsten Stufe wieder verloren, außer es handelt sich um psychodynamisch bedingte Abwehrprozesse. Dies wäre dann gegeben, wenn man Carol Giligans (19 ) Deutung Kohlbergs folgt, wenn Stufe 4 so beschrieben würde, als ginge in der Stufe der Systemperspektive die Perspektive der Stufe 3 von Zuneigung im intimen Raum von Familie und Freundschaft verloren. Ebenso stellt die Orientierung an Strafe und Gehorsam eine Unterbrechung moralischer Entwicklung dar und kann schon von daher nicht als Moralstufe bezeichnet werden. Der Moral gegenüber stellt sie eine pathologische Form dar. Das Kind will nicht primär Strafe vermeiden, sondern es ist auf den Erwachsenen angewiesen, und wenn es nicht anders kann, verleugnet es sein eigenes Wollen und folgt den Normen der Erwachsenen bei Abspaltung des eigenen Fühlens (Gruen 1990 a, 1990b). Die angebliche Orientierung an Strafe und Gehorsam ist auch nicht anthropologisch gedacht, denn der Mensch sucht Lust und Glück und nicht Vermeidung von Strafe. Letzteres kann nur als Folge des ursprünglichen Bedürfnisses interpretiert werden. Man sollte also nicht ein Derivat als Stufe der Entwicklung ansetzen. Bei einer dynamischen Betrachtung der Moralentwicklung, die von dem Beziehungsgeschehen zwischen dem Kind und seiner sozialen Umgebung bestimmt ist, sind in die Moralentwicklung auch Brüche einzubeziehen. Grundsätzlich könnte es nämlich der Fall sein, dass zu jedem Zeitpunkt in der Entwicklung ein Ereignis eintritt, das für das Kind und später den Jugendlichen und Erwachsenen sein Beziehungshandeln betreffend bestimmend sein kann, wie es sich moralisch entwickelt. Aus einer heteronomen Moral entwickelt sich nicht eine autonome Moral, sondern wir müssen annehmen, dass die Kräfte, die Autonomie, Selbständigkeit, freie Handlungsführung sowohl innerpsychisch als auch beziehungsdynamisch fördern, von Anfang an da sind. Jeder Organismus ist autopoetisch1 und strebt die Vollendung seiner artspezifischen Potentiale an. In diesem Zusammenhang spricht auch der humanistische Psychologe und Begründer der personenzentrierten Gesprächspsychotherapie in Analogie zu biologischen Organismen von einer organismischen Tendenz im Menschen als anthropologische Grundannahme.2 Karl Bühler spricht von einem Funktionstrieb im Zusammenhang mit dem Spiel. Das Kind sucht von Natur aus Stimulationen auf, im besonderen verstärkt durch seine Äußerungen des Wohlseins oder Wohlbefindens 1 2 Vgl. dazu die Thesen der beiden Biologen Maturana/Varela (19 ) Rogers Kartoffeln in 19 , S. 18 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK liebevolle Zuwendung von außenund tut dies im besonderen ab der dritten bis fünften Woche durch sein Lächeln, das wohl von Anfang anein soziales Lächelnals Antwort auf das Lächeln, Reden und Streicheln eines Bezugsperson ist (vgl. Stern 19 ). Allerdings kann dieses Aufsuchen von Stimulation schon sehr früh frustriert werden, wenn es z. B. keine Bezugsperson gibt, die das Kind annimmt. Dann wird sich das Kind zurück ziehen, um sein verletzliches Selbst zu schützen und um nicht weiter enttäuscht zu werden. Es wird sich in Analogie zu einer elektronisch gesteuerten Maschine, die nur noch ein Notprogramm fährt, wenn bestimmte Teilprogramme oder Teilfunktionen ausgefallen sind, eben auf ein Notprogramm einstellen. Dieser Sachverhalt darf als allgemein gesichert und anerkannt angenommen werden, zumal es ohne diese Annahme nicht denkbar wäre, wie sich Organismen entwickeln. Es ist auch klar, dass dies autonome Äußerungen eines Organismus sind. Für die Maralentwicklung gilt es aber im besonderen nachzuweisen, welche autonome Äußerungen schon von Säuglingen als Vorläufer für vollständige moralische Entscheidungen angesehen werden können. Die Äußerungen müssen in irgendeiner Form erkennen lassen, dass Säuglinge andere in einer Weise einbeziehen, aus der hervorgeht, dass sie andere respektieren. Beim Kleinstkind äußert sich dies zunächst in einem Interesse für das menschliche Antlitz unabhängig vom Nahrungs- und Pflegebedürfnis. Es ist also einerseits die sozial-emotionale Entwicklung zu verfolgen und andererseits das Unterscheidungsvermögen des Kleinstkindes zwischen qualitativ verschiedenen Personund Situationsmerkmalen und schließlich wie deren Zusammenhang gesehen werden kann. Es ist hier die Möglichkeit des Erfassens zunehmender Komplexität von Bedeutung. Die Systemperspektive in der Form einer legalistischen Orientierung ist nicht moralisch, sondern eben legalistisch. Wenn sich das Kind von den Normen der Erwachsenen noch nicht lösen kann, weil es auf ihre Fürsorge und Zuwendung angewiesen ist, dann bedeutet das nicht, dass das Kind auf einer Stufe der heteronomen Moral stehe, sondern fordert von den Erwachsenen, ihre Normen nicht als absolut gültig den Kindern zu präsentieren, sondern ihnen die Möglichkeit zu gewähren, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren. Die Phänomene bzw. Begriffe wären klar auseinanderzuhalten. 3.1 Entwicklung Der Erzieher hat es im wesentlichen damit zu tun, Individuen dabei zu helfen, dass sie von geringer organisierten Denkformen und Handlungsweisen zu höher organisierten und stärker internalisierten Denkformen und Handlungsweisen gelangen. Für den Nachweis dieses Prozesses ist es notwendig, die verschiedenen Formen von Denk- und Bewußtseinsstrukturen zu rekonstruieren, die Individuen in ihrer Entwicklung durchlaufen. Der Mensch organisiert die Welt, die so zu seiner Welt wird. Er ist nach dem Psychologen und Kliniker Robert Kegan ein „bedeutungsbildender Organismus“ (vgl. dazu auch LENK 1994). „Erfahrung ist, was wir mit dem, was uns begegnet, machen.“ (1986, S. 31) 3.2 Entwicklungsbegriff Ein nichttrivialer Entwicklungsbegriff, wie er von Theoretikern der kognitiven Psychologie entwickelt wurde, ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 1. Eine solche Entwicklungstheorie geht von einer einheitlichen Grundgegebenheit, einer gleichen Basisfunktion (z. B. Beziehung, Denken, Werten) aus, die Welt oder Teilwelten jeweils anders strukturieren. In diesem Sinne wären die Theorien der Entwicklung des moralischen Urteils von Piaget und Kohlberg keine solche Theorie, 19 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK weil die Basisfunktion, deren Entwicklung beschrieben werden soll, nicht schon in der ersten Stufe vorkommt. 2. Die einzelnen Phasen bilden in sich klar voneinander unterscheidbare, qualitative Strukturen, die sich auf die gleiche Basisfunktion beziehen. 3. "Diese differenten Strukturen bilden eine invariante Reihe, Ordnung oder Abfolge in der individuellen Entwicklung. Kulturelle Faktoren können die Entwicklung beschleunigen, verlangsamen oder stoppen, aber nicht ihre Sequenz ändern." (KOHLBERG 1980, S. 227, 1974, S. 17) 4. Die aufeinanderfolgenden Formen bilden "ein srukturiertes Ganzes". Sie stellen jeweils ein strukturiertes Interpretationsmuster der Gesamtwirklichkeit dar, die eine Ordnung von zunehmender Differenziertheit und Integriertheit bilden. Die nächsthöhere Stufe ist durch mindestens ein neues Element charakterisiert, das aber nicht nur additiv ist, sondern mit den bereits vorhandenen, errungenen Elementen ein neues Niveau, eine neue Struktur bildet3. Es handelt sich um hierarchisch geordnete Präferenzsysteme, die mit einer psychischen Disposition von Individuen verbunden sind, Problemlösungen oder Deutungen auf dem höchsten ihnen zugänglichen Niveau zu bevorzugen (vgl. KOHLBERG 1980, ebd., 1974, S. 18). Die neue Struktur ersetzt die alte Struktur, aber die Elemente bleiben erhalten oder es kommt ein neues Element hinzu und die Relationen der Elemente ändern sich. Bewußtsein entsteht nicht, sondern ist gegeben. Es formt sich, differenziert sich aus. Es könnte auch nicht durch irgendwelche Maßnahmen entwickelt werden, wäre es nicht schon gegeben. Es bedarf aber einiger Bedingungen, soll sich das Bewußtsein ausformen und zu sich selbst kommen können. Dies geschieht im Austausch mit der Umwelt, der natürlichen wie der sozialen Umwelt aber auch im Rückbezug auf sich selbst und im sich Öffnen geistigen Intuitionen gegenüber. Der Austausch mit der natürlichen Umwelt erfolgt immer zugleich in der und mit der sozialen Umwelt. Wir deuten die Welt von der erreichten Form des Bewußtseins her. Im Prozeß des Deutens von Welt wird offenbar, was für uns jeweils Realität ist. Entwicklung erfolgt dadurch, dass jeweils differenziertere Formen der Weltdeutung angestrebt werden, in der jeweils Welt weiter ausdifferenziert erscheint, und eine je neue Form des Subjekt-Welt-Bezugs (– kognitiv gedacht), auftaucht, in der jeweils neue differenziertere Verstehensstrukturen gebildet werden, über die Welt jeweils besser erklärt werden kann.. Emotional wird eine je weitere Sozialperspektive vom Egozentrismus über die Annahmen der Perspektiven anderer bis hin zu universeller Liebe eingenommen. Bildung soll zu je höheren Formen von Bewußtsein und Erfahrung hinführen bis zu einem autonomen und schließlich transpersonalen Bewußtsein. Der Mensch hat den Drang über sich hinauszuwachsen. Erziehung braucht eine Zukunftsperspektive, eine Utopie, ein Ideal oder einfach ein Ziel, auf das hin der Prozeß der Erziehaung läuft. Sie braucht ein Ideal dessen, eine Vorstellung davon, was der Mensch werden kann, woraufhin er sich entwickeln kann. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass es zu genügen scheint, einfach zu interagieren, einfach mit Menschen zu arbeiten, dass sie zu dem kommen, was sie momentan wollen oder brauchen: z. B. zu lernen, wie man ein Vorstellungsgespräch führt, wie man mit Kindern und mit sich umgehen soll, wenn sie einem auf die Nerven gehen, wie man mit einem alkoholsüchtigen 3 Vgl. dazu die Lernniveaus beim strukturellen Lernen, bei dem ebenso ein hierarchischer Aufbau von Lernprozessen angenommen wird, GAGNE 1969; vgl. auch OLECHOWSKI 1978, S. 289. Zum Entwicklungsbegriff siehe KOHLBERG 1980, S. 227, 247; HABERMAS 1976, S. 90, der FLAVELL 1972 zitiert; vgl. auch KÄRN 1978, S. 82 20 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Partner zurechtkommen könnte. Gewiß all das ist notwendig, aber all das muß eine weitere Perspektive haben, sonst bleiben solche Bildungsprozesse im Grunde unbefriedigend. Der Mensch braucht Sinnperspektiven, soll er glücklich sein. Das Eingebettetsein in soziale Zusammenhänge und dieser wieder in gesellschaftliche Zusammenhänge lässt Erziehung zu einer Reise ins Nichts werden, wenn der Erzieher nicht eine gesellschaftliche Verantwortung sieht. Dies liegt heute in einer Zeit, in der sich die gesellschaftlichen Probleme zuspitzen, mehr denn je auf der Hand: allem voran die Zerstörung der Umwelt und damit verbunden die Verantwortungslosigkeit für andere und die nachkommenden Generationen. Solange Menschen ihr Eigentum, ihr Auto, ihre Sicherheit wichtiger nehmen und das Leid anderer, die Zerstörung der Lebensgrundlagen nicht sehen, ist wohl jede andere Bildung Flickwerk. "Das größte aber ist die Liebe." Vielleicht genügt es schon zu sagen: Respekt, Rücksicht, Achtung, Wertschätzung, Ehrfurcht gegenüber der Natur und dem Menschen. Der Mensch und sein Glück sollen im Mittelpunkt stehen. Aber was ist Glück? Es gibt das vordergründige Glück der Befriedigung physischer und psychischer Bedürfnisse. Dieses Glück kennt keine andere Zukunft als eine lineare Fortsetzung von Einkommen, Verbesserung von Woh nung, Erholung, Arbeit. Sie ist eigentlich ohne Perspektive, weil der Mensch nur sich sieht, seinen kleinen Kreis, nicht die anderen. Dieses Glück der eigenen Häuslichkeit hat keine soziale Perspektive. Die Rede "Ich allein habe keine Wirkung", verrät nur die egozentrische Perspektive. Ziel ist die Sicherung des eigenen Lebens in einem Bereich. Die weitere Perspektive ist mit der Einsicht verbunden, andere anzuerkennen, weil mein Glück vom Glück der anderen abhängig ist. Um diese Perspektive gegenüber der ersten durchzuhalten, bedarf es allerdings der Anstrengung, jeweils zu erkennen, dass dies und wie weit dies zutrifft, sofern es nicht ohnehin klar auf der Hand liegt. Dann ist eine solche Person auch bereit, Arbeit oder Anstrengungen für andere in Kauf zu nehmen. In die eigenen Entscheidungen wird also die gesellschaftliche Perspektive einbezogen und es wird gefragt, was eine Handlung oder Entscheidung im Kontext des Zusammenlebens aller für ihr Wohlergehen bedeutet. Dauerndes Glück lebt in einem Menschen, der dem Zufälligen entwachsen konnte und der weiß, dass er sich selbst immer wieder täuschen kann, der aber zugleich im Wunsch nach Wahrheit und Klarheit konsequent sucht und erkennt, dass ihm in einer offenen glaubenden, vertrauenden und liebenden Haltung die Erkenntnis und die Einsicht in das Wahre, Gute und Schöne zufließt. Der so Rückgebundene (= Religiöse) erlebt Glück, wenn es da ist, ganz, auch wenn es viele Gestalten hat, die in sich wieder einen Kosmos bilden. Typen von Glück Befriedigung physischer und psychischer Bedürfnisse Eigene Sicherheit Zugehörigkeit, Anerkennung Wechselseitige Anerkennung Ganzheitliches Allerleben 21 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK 3.3 Moralisches Handeln Moral stellt die Frage, ob eine Handlung gut ist oder nicht. Daher hängt nun alles davon ab, wie wir das Prädikat „gut“ definieren. Gehen wir mit George Edward Moore davon aus, dass „gut“ ein undefiniertes Prädikat ist und es uns also intuitiv zugänglich ist, dann muß uns klar sein, dass moralisch gut durch kein anderes Prädikat zu ersetzen ist, etwa durch die Prädikate „angenehm“ (Hedonismus), „nützlich“ (Utilitarismus in seinen verschiedenen Ausprägungen), „gerecht“ usw.. Vielmehr müssen wir uns bei einem solchen Ausgangspunkt fragen, was dies für moralisches Urteilen und die Bestimmung dessen, was ein moralisches Urteil ist, bedeutet. 3.3.1 Moralisches Urteilen Gehen wir von der unmittelbaren Bedeutung moralischen Handelns aus, dann werden wir zunächst sagen können, dass moralisches Handeln nur dann vorliegt, wenn eine Person etwas nicht aus irgendeinem Zwang, sondern von sich aus tut. Moralische Urteile beziehen sich also auf Entscheidungen und ob man diese auch autonom getroffen hat. Folgt jemand in einer Entscheidung einem anderen, dann kann man also nicht mehr von einem moralischen Urteil sprechen, außer er identifieziert sich völlig bewußt mit der Fremdentscheidung. Dann ist sie aber so, als wäre es die eigene Entscheidung. Aus diesem Grund enthält jedes moralische Urteil eine intuitive Komponente, nämlich die eigene Vorstellung von gut und wie diese in die Handlungsentscheidung einfließt, und eine rationale Komponente, nämlich alle jene Überlegungen, die sich auf die Situationsmerkmale beziehen, in welcher die Entscheidung erfolgt. Für die Entwicklung des moralischen Urteils stellt sich dann die Frage, wieviele Situationsmerkmale von einer Person in einem bestimmten Alter einbezogen werden können. Die Situationsmerkmale müssen auch deshalb einbezogen werden, weil sie von Bedeutung für die Einschätzung der Folgen der Entscheidung sind. Die Abschätzung der Folgen der Entscheidung müssen in das moralische Urteil schon einfließen. Wer moralisch entscheiden will, wird sich sogar bemühen, sich kundig zu machen, weil seine Verantwortlichkeit am genauen Abwägung der Folgen seiner Entscheidung hängt. Da die Handlungsentscheidungen immer auch Personen betreffen, sind diese in die Überlegungen in der Weise einzubeziehen, dass erstens gefragt werden muß, ob eine Entscheidung auch in ihrem Sinne getroffen wird. Können die Personen direkt einbezogen werden, sollen sie auch tatsächlich einbezogen werden. Wegen der prinzipiellen Komplexität der Welt, ist jede Entscheidung individuell zu treffen, von Fall zu Fall. Es gibt also keine moralischen Regeln in dem Sinn wie Schicklichkeitsregeln, nach denen man sich immer wieder in gleicher Weise halten kann. Da alle moralischen Entscheidungen individuell sind, spielt der gute Wille, moralisch handeln zu wollen, nicht vorschnell zu entscheiden, sondern alle Umstände nach bestem Wissen und Gewissen zu berücksichtigen, eine wesentliche Rolle. Dies hat wohl Kant zu seiner Aussage veranlaßt, dass nichts gut sei, als allein ein guter Wille (Kant ). Der Wille bezieht sich einerseits darauf, überhaupt gut handeln zu wollen, das heißt, sich bei jedem Entscheidungselement auf die eigene intuitive Vorstellung von gut zu beziehen und andererseits sich angesichts der Komplexität von Entscheidungen nicht vorschnell zu handeln. Die grundsätzliche Kontingenz allen Handelns, Urteilens und Entscheidens wird hier deutlich. Wir können nur sagen, dass dies im Moment die beste Lösung ist. 22 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Was wir tun können ist, dass wir uns für andere und für Situationen sensibel machen, dass wir den anderen Achtung und Respekt entgegenbringen, dass wir schweigen, um auf den anderen und das andere zu achten, dem anderen Raum für seine Argumente geben. Vielleicht tragen seine Argumente Wesentliches für die Entscheidung bei. Aus dieser grundsätzlichen Kontingenz und der Einsicht in die Kontingenz entsteht Betroffenheit. Sich von der Situation und den anderen betreffen lassen, lässt uns auf Situationen zugehen und von ihnen Abstand nehmen. Sich betreffen zu lassen ist ein passiver und aktiver Vorgang zugleich. Im Sinne Bubers (19..) ist es ein Schweben über den Grundworten IchDu und Ich-Es, Nähe und Distanz, Begegnung und Anschauen. Moralisches Urteilen ist ein Urteilen in der Konkretion. Alle Momente sind einzubeziehen, es gibt nichts, was nicht Bedeutung hätte. 3.4 Denken und Moralentwicklung Denken spielt eine zentrale Rolle in der Moralentwicklung (Oser, 1981, S. 324). Allerdings benutzen auch intelligente Menschen das Denken nur zu oft, um unmoralisch zu sein. Zusammenfassung Die Welt wird unter sich überbietenden, nicht ausschließenden Ideen des Guten gedeutet bis hin zu der Einsicht, dass das Wahre, Gute und Schöne in einer offenen, meditativen Sicht der Realität uns jeweils neu anmuten kann. 4 Wollen Wenn vom Wollen ausgegangen wird, kann man dann sagen: Wenn eine Person etwas will, dann ist das Rechtfertigung genug. Dieser Standpunkt kann eine therapeutische und erzieherische Berechtigung haben. Man kann einer Person zugestehen, ihre Erfahrungen selbst zu machen. Die Frage ist nur, was folgt daraus für andere. Ist das für sie tragbar oder nicht. Ohne freiwilliges Zugeständnis könnte dies unter dem Titel des sittlichen Wollens nicht gefordert werden, wenn das Prinzip wechselseitiger Anerkennung aufrecht erhalten und nicht unterboten werden soll. Das Universalisierungsprinzp beruht zunächst auf dem Prinzip formaler Gleichheit und dann der Abwägung der Konsequenzen eines Handelns bzw. einer Entscheidung für die Allgemeinheit. Die Konsequenzen können je nach Materie höchst unterschiedlich sein und können daher nur von Materie zu Materie entschieden werden. Zu lügen, jemand zu verletzen, zu stehlen haben jeweils andere reale Konsequenzen. Würde man ein Kriterium, das allen gemeinsam ist, ansetzen, um unterschiedliche Konsequenzen zu beurteilen, würden Menschen psychisch oder physisch Schaden leiden, verletzt werden, es würde daraus Leiden entstehen. Ist also Leiden nicht zu verursachen das letzte Kriterium? Bejaht man diese Frage, dann ist doch klar, dass es sich hier allerdings nur um eine NegativVariante handelt. Die Positiv-Variante lautet: Ich will das Glück anderer befördern, nicht abstrakt, sondern in Formen eines beglückenden harmonischen den Einzelnen in seiner Entwicklung zu voller 23 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK Handlungsfähigkeit fördernden Zusammenlebens, kurz eines guten Zusammenlebens. Das Prädikat „gut“ darf nur nicht auf ein bestimmtes Merkmal fixiert werden, es kann aber alle als positiv bewerteteten Prädikate annehmen. Nehmen wir also alle von den unterschiedlichen Moralsystemen befürworteten Prinzipien zusammen und achten wir nur darauf, ob und wie weit diese Prinzipien miteinander in Konflikt geraten: Der Eudaimonismus, die verschiedenen Utilitarismen, der Emotivismus, die Gesinnungs- und Verantwortungsethik, der Kontraktialismus. 4.1 Selbstbewußtsein Wenn wir wechselseitige Anerkennung als grundlegendes Prinzip aller Ethik ansetzen, dann auch mit J. G. Fichte unter der Bedingung, dass ein Mensch nur unter der Bedingung wechselseitiger Anerkennung ein Selbstbewußtsein entwickeln kann (vgl. Mead 19..), was wieder Bedingung für die Möglichkeit der Anerkennung dieses Prinzips ist. 4.2 Gut Jede Theorie, jede Sicht der Dinge geht von Grundannahmen aus, die nicht weiter innerhalb der Theorie begründet werden können. Diese Grundannahmen mögen implizit oder explizit formuliert sein, sie bestimmen das Ganze, soll die Theorie konsistent sein. Wenn Entscheidungen zu treffen sind, wägt man ab, ob diese Entscheidungen spontan oder willkürlich getroffen sind. Soll Handeln und die es tragenden Entscheidungen konsistent verlaufen, dann lassen sich jedenfalls solche Annahmen nicht umgehen. Solche Grundannahmen gehen in die Definitionen der innerhalb der Theorie verwendeten Begriffe ein. Wenn also in der Moral „gut“ in bestimmter Weise definiert wird, und man will konsistent bleiben, dann entwickelt sich daraus ein bestimmtes Moralsystem, wie z. B. der Hedonismus oder der Utilitarismus. Wie die Frage der Wahrheit von Sätzen eine unendliche Aufgabe ist, genau so die Frage nach dem Guten. Wie die Frage nach der Wahrheit nur sinnvoll unter der Voraussetzung ist, dass sie zu erkennen möglich ist, und es unsere Aufgabe ist zu ermitteln, wie sie wirklich werden kann, indem wir die Bedingungen dafür formulieren, genauso müssen wir bei der Frage nach dem Guten wie bei allen Transzendentalien vorgehen. Es gibt ein Gut, wie ist es möglich, es zu erfassen und zu leben. Was sind die Bedingungen dafür. Gehen wir mit den Intuitionisten davon aus, dass „gut“ ein undefiniertes Prädikat ist, müssen andere Annahmen getroffen werden, um zu bestimmen, was ein moralisches Urteil von einem anderen Urteil unterscheidet. Moralität hat mit der Regelung zwischenmenschlichen Handelns zu tun, bei dem alle Beteiligten mit ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen berücksichtigt werden. Wie weit wird durch die Entscheidungsprozedur die inhaltliche Richtigkeit und Güte der Entscheidung bestimmt? Zur Universalisierung sind alle verpflichtet, auch jeder einzelne für sich. Den konkreten Inhalt bekommt sie erst durch die wechselseitige Anerkennung. Jemanden zu helfen, der sich nicht selbst helfen kann, ist gut. Vielleicht aber will der andere sich nicht helfen lassen? Vielleicht möchte jemand z. B. in einer Intensivstation lieber sterben als künstlich sam Leben erhalten werden? Konsens ist kein Moralkriterium. Diskurse können ideal 24 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK geführt werden oder real mit unterschiedlichen, ideale Diskurse verfehlenden problematischen Situatioen verbunden sein. 4.3 Sich für das Gute trainieren Dieser Gedanke kommt besonder bei Platon und Aristoteles, bei ersterem stärker zum Ausdruck, die eine stark normative Ethik entwickeln, die im wesentlichen auf die Entfaltung bon Tugenden aufbaut. Man müsse sich für das gute Handeln erst stark machen. Eine weitere Stufe über die prinzipiengeleitete Stufe hinaus ist deshalb notwendig, weil sonst die Dynamik der Entwicklung nicht verständlich wäre (1) und weil Prinzipien geradezu danach verlangen, den Ort ihrer Entstehung zu erklären (2). Sittlichkeit hat nicht mit einem Sollen, sondern mit Selbstverpfichtung zu tun, nicht mit einem kategorischen Imperativ, sondern mit dem Willen, andere Menschen zu achten und sie in den eigenen Handlungsentscheidungen zu bedenken. Es wäre klarer zwischen Moral und Sittlichkeit oder zwischen Sollen und Wollen zu unterscheiden. Die Verpflichtung sein Handeln an universellen Prinzipien auszurichten, bindet das Handeln an ein Sollen. Sittlichkeit als Selbstverpflichtung und als der Wille in wechselseitiger Anerkennung zu handeln darf ein Handeln nach universellen Prinzipien nicht unterbieten, aber überbietet es im Sinne der Regel „Was du willst, was die Menschen dir tun, das tu auch du ihnen.“ Was in dieser Regel enthalten sein kann, geht weit über das hinaus, was in einer Moral, die von universellen Prinzipien ausgeht, argumentierbar ist. Man kann niemandem Anerkennung, Emphatie, Verstehen andemonstrieren, er muß sie selbst ergreifen wollen. Wo es um ein Sollen geht, muß es sich um Gegenstände handeln, die erst dann ausgeführt werden können, wenn man sich auch gefühlsmäßig damit verbindet. Da muß mann wollen, seine Aufmerksamkeit darauf richten, seine Gefühle sprechen lassen. Wenn z. B. Otfried Höffe (1986, S. 61) über Zurechenbarkeit deer Handlungsbewertung und ihren imperativischen und kategorischen Charakter definiert, dann spricht er nur innerhalb der Sprache der Logik des Sollens. Allerdings hält er das nicht konsequent durch. Die Begriffe „Anspruch“ und „Aufforderung“ (a.a.O., S.62), gehören zur Sprache der Logik des Wollens. Der kategorische Imperativ braucht wie jedes Prinzip eine Richtung, ein Ziel, das durch die Handlungsmaximen gefördert werden soll, etwa das Allgemeinwohl. Wenn jemand eine Handlungsregel aufstellt, dann kann er das nur ernsthaft unter der Bedingung tun, dass er sich selbst auch in der Rolle des Betroffenen denkt (Keller/Reuss 1986, S.129). Darin bestehe die rationale Kraft des Argumentierens mit Moralprinzipien (ebd.) Kants These: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden als allein ein guter Wille.“ (Grundlegung zur Methaphysik der Sitten, Reclam 1904, S.21, Kritik der praktischen Vernunft, Vorländer 1906, S.71). Primat der praktischen Vernunft über die theoretische (Ib, S.153-156). Es muß für den Erkenntnisprozeß – soll er nicht in Dogmatismus und Skeptizismus verfallen – sowohl die Unendlichkeit des Wissens, d. h. 25 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK das die Aufgabe des Wissens eine unendliche Aufgabe bleibt, als auch die Idee, das Postulat des unendlichen Erkennens, aufrecht erhalten werden. Die genuine Frage der Philosophie als der Versuch, unser Sein und Erkennen zu klären, ist, wie von der Prämisse das Wahrheit wirklich ist, Wahrheit möglich werden kann, eine Klärung dieser Frage möglich ist. Wie das Gute erkannt und gelebt werden kann, wie das Schöne erkannt und verwirklicht werden kann und wie das eine und die Einung möglich ist. In der ersten Formulierung des kategorischen Imperativs darf man nicht nur die Universalisierung sehen, sondern auch die Erweiterung der zweiten Formulierung, jeden Menschen als Zweck und nicht als Mittel zu betrachten. Beide zusammen lassen sich unter dem Prinzip wechselseitiger Anerkennung zusammenfassen. 5 Wert Wertvoll ist, was Leiden mindert und Wohlbefinden erhöht. Wie verändert sich das von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Empirische Untersuchungen: zunächst Beobachtung, dann Interviews (Werte werden vorgegeben und nach ihrer Wichtigkeit 1 - 4 beurteilt, schließlich Fragebögen wie oben. Es müßte systematisch festgelegt werden, welche Bedeutung jeweils die Werte oder Einstellungsobjekte haben. Wert objektiv: „Die Eignung eines Gegenstandes, das Wertgefühl eines Menschen auf sich zu ziehen.“ (Meinong, zitiert nach Wieser/Rauter 1974, S.311) Ausgangspunkt allen Argumentierens, alltagssprachlichen, wissenschaftlichen wie moralischen Argumentierens ist das Bewußtsein, genauer das zum Zeitpunkt des Argumentierens so und so lebensgeschichtlich gewordene Bewußtsein des Individuums. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass jede Theorie für ihre Begründung auf eine Theorie höheren Grades zurückgreifen muß, die Letztbegründung beruht auf der Bedeutungsbildung im Alltagsleben, der alltäglichen Praxis, ausgedrückt in Wörtern der natürlichen Sprache. Von ihnen her als undefinierten Ausdrücken, bekommt jeder definierte Ausdruck seine Bedeutung. Die Bedeutung selbst wird im Prozeß des methodisch-systematischen Argumentierens transportiert und eindeutig zu machen versucht. Dem dienen die Definitionen und methodischen Regeln des Argumentierens. In diesem Prozeß werden immer wieder Entscheidungen derart getroffen, einen bestimmten Begriff so und so verstehen zu wollen. Man trifft Entscheidungen, um Komplexität zu reduzieren. Diese müssen als plausibel, sinnvoll anerkannt werden. Auf einer anderen Schleife oder einem anderen Pfad von Entscheidungen (Entscheidungspfade) können sie wieder aufgenommen werden. Werte als Güter dinglich psychisch, sozial geistig dingliche Werte Natur von Menschen gemachte kulturelle Güter psychische Werte Bewußtsein meiner Selbst – Selbstbewußtsein, Geschmack 26 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK soziales Bewußtsein – Anerkennung, Wertschätzung – individuelle Werte und soziale Werte sind wegen der Sozialität des Menschen immer wechselseitig imprägniert. geistige Werte Aus der Sinndeutung von Welt, alllgemeine Sinninterpretation, wodurch jeder Wert eine spezifische Bedeutung erhält: z. B. Eudaimonismus, Utilitarismus, Sittlichkeit, Transzendenz Werte können je nach Situation unterschiedliche Bedeutsamkeit annehmen. Z. B. Durst in der Wüste – Wasser ist ein hohes Gut, der Geschmack spielt erst wieder eine Rolle, wenn der Organismus durch das Verdursten nicht mehr bedroht ist. Die Moral von Personen ist aus ihren Handlungen ablesbar, im besonderen aus den emotionalen und kognitiven Anteilen. Handlungen sind zielorientert, man handelt, um etwas zu erreichen, sei es direkt oder indirekt. Übergänge zwischen den Ebenen: Einsicht, dass eine bestimmte Form der Interpretation von Welt über bestimmte Schemata nicht reicht. Bestimmte Phänomene können nicht mehr erklärt werden. Die Bedeutung von Krisen: Krisensituationen fordern zu ihrer Lösung in der Regel neue Einsichten. Dialektische Prozesse 5.1 Normen und Werte 6 Merkmale des moralischen Urteils 6.1 Autonomie Es ist sehr beliebt geworden, auch unter Pädagogen, denen es mehr um die entwicklung des Individuums zu sich selbst gehen müsste, Moral mit Normen zu identivizieren, die einzuhalten wären. Moralisch ist aber erst der Mensch, der aus Achtung, Wertschätzung und Anerkennung Normen, die ein gutes Zusammenleben garantieren, von sich aus tut. Etwas aus Zwang oder um negative Sanktionen zu vermeiden zu tun, geht an der Verantwortung über sich selbst und den anderen vorbei. 6.2 Selbstverpflichtung Moralisch gesehen verpflichtet also eine Person sich selbst, etwas zu tun. Bei der Sichselbstverpflichtung handelt es sich um eine reflexives Werk mit einem oder zwei Argumenten. In der Moral handelt es sich in der Regel um letzteren Fall. Das Tun erfolgt gegenüber einer anderen Person. Sich selbst zu verpflichten bedeutet Gründe zu haben, warum man etwas gegenüber einer anderen Person tun will. Es gehört Einsicht in Sachzusammenhänge und auch eine Person verstehen zu wollen dazu. 27 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK 7 Literatur BOWLBY, John: Mütterliche Zuwendung und geistige Gesundheit. Maternal Care and Mental Health.- München: Kindler, 1973 (=Kindler TB 2106) BOWLBY, John: Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung.- Frankfurt/M.: Fischer, 1984 (= Geist und Psyche 42210) BREZINKA, Wolfgang: „Werte-Erziehung“ in einer wertunsicheren Gesellschaft.- In: HUBER 1993, S. 53 - 76 Döbert, Rainer: Horizonte der an Kohlbert orientierten Moralforschung.- In: Zsch. f. Päd., 33. Jg. (1987), S. ............. DÖBERT, Rainer/NUNNER-WINKLER, Gertrud: Performanzbestimmende Aspekte des moralischen Bewußtseins.- In: PORTELE 1978, S. 101 - 121 EDELSTEIN, Wolfgang/NUNNER-WINKLER, Gertrud/NOAM, Gil (Hrsg.): Moral und Person.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993 Ego, Werner: Abschied von der Moral. Eine Rekonstruktion der Ethik Robert Musils.Freiburg: Herder, Universitätsverlag ERIKSON, Erik H.: Identität und Lebenszyklus. Drei Aufsätze.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1979, 5. Aufl. (=stw 16) ERIKSON, Erik H.: Jugend und Krise. Die Psychodynamik im sozialen Wandel.Frankfurt/M. u. a.: Ullstein, 1981 (Klett-Cotta im Ullstein TB 39013) FISCHER, Franz: Philosophie des Sinnes von Sinn. Frühe philosophische Schriften und Entwürfe (1950 - 1956). 1. Band der nachgelassenen Schriften mit einer Einleitung hrsg. v. Erich Heintel. Biographische Notizen von Anne Fischer.- Kastellaun: Henn, 1980 (= Ph.d.S.v.S.) FISCHER, Franz: Die Erziehung des Gewissens. Schriften und Entwürfe zur Ethik, Pädagogik, Politik und Hermeneutik. 2. Band der nachgelassenen Schriften hrsg. v. Josef Derbolav.- Kastellaun: Henn, 1979 (=D.E.d.G.) FISCHER, Franz: Darstellung der Bildungskategorien im System der Wissenschaften. Aus dem Nachlaß herausgegeben, eingeleitet und mit Nachworten versehen von Dietrich Benner und Wolfdietrich Schmied-Kowarzik.- Ratingen, Kastellaun: Henn, 1975 (= D.d.B.) FISCHER, Franz: Proflexion - Logik der Menschlichkeit. Späte Schriften und letzte Entwürfe 1960 - 1970. Hrsg. von Michael Benedikt und Wolfgang W. Priglinger.- Wien, München: Löcker, 1985 (=P.L.d.M) FISCHER, Franz /FISCHER-BUCK, Anne: "Proflexion" - ein Weg für die Psychotherapie?- In: KÜHN, Rolf /PETZOLD, Hilarion (Hrsg.): Psychotherapie & Philosophie: Philosophie als Psychotherapie?- Paderborn: Junfermann, 1992 FISCHER-BUCK, Anne: Franz Fischer (1929 - 1970). Ein Leben für die Philosophie.Wien, München: Oldenbourg, 1987 GARNITSCHNIG, Karl: Das Selbst sein, das man in Wahrheit ist - Aspekte einer Theorie der Selbstverwirklichung.- In: Arbeitsgemeinschaft Personenzentrierte Gesprächsführung (Hrsg.): Persönlichkeitsentwicklung durch Begegnung. Das personenzentrierte Konzept in Psychotherapie, Erziehung und Wissenschaft.- Wien: Österr. Bundesverlag, 1984, S. 73 94 28 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK GARNITSCHNIG, Karl: Werte als Wirklichkeitsrepräsentationen. Werten und Werden.In: LÄNGLE, Alfried (Hrsg.): Das Kind als Person. Entwicklung und Erziehung aus existenzanalytischer Sicht. Tagungsbericht der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE) in Düsseldorf 1989, 5. Jg. (1990), Nr. 1.- Wien: GLE, 1991, S. 65 84 GARNITSCHNIG, Karl: Die Kinder lieben, wie das Leben sich selbst liebt. Perspektiven gewaltfreier Erziehung.- In: KINDER IN WIEN (Hrsg.): Kinder leiden Gewalt. Gedenkbroschüre 1938 - 1988.- Wien: Österr. Kinderrettungswerk/Landesverband Wien, A-1010 Wien, Falkestr. 3, 1988, S. 57 - 65 GARNITSCHNIG, Karl: Aktives Lernen.- In: „aktive Erziehung“. Zsch. f. Konduktiv/Mehrfachtherapeutische Förderung und Integration von cerebral bewegungsbeeinträchtigten Kindern, 1993, Nr. 5, S. 2 - 9 GARNITSCHNIG, Karl: Die Erziehung des Gewissens.- In: ZÖLLNER, Detlef (Hrsg.): Wege zu Mitmenschlichkeit und Frieden. Franz Fischer-Symposion 1994.- Norderstedt: Fischer, 1994 GARNITSCHNIG, Karl: Werte und Wertentwicklung.- In: Österr. Zeitschr. f. Berufspäd., 13. Jg. (1994/95), H. 2, S. 6 - 10 GOLDSTEIN, Joseph/Freud, Anna/SOLNIT, Albert J.: Jenseits des Kindeswohls. Mit einem Beitrag von Spiros Simits.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1974 (=STB 212) GREEN, Hannah: Ich hab’ dir nie einen Rosengarten versprochen.- Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1978 GRUEN, Arno: Der Wahnsinn der Normalität. Realismus als Krankheit: eine grundlegende Theorie zur menschlichen Destruktivität.- München: Dt. Taschenbuchverlag, 1990a, 3. Aufl. (= dtv 15057) GRUEN, Arno: Der Verrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau.München: Dt. Taschenbuchverlag, 1990b, 6. Aufl. (=dtv 15016) HARTMANN, Nicolai: Ethik.- Berlin, Leipzig: de Gruyter, 1935, 2. Aufl. HARECKER, Gabriele: Werterziehung in der Schule. Anwendung der Werttheorie im Unterricht der Volksschule.- Wien: Universitätsverlag, 1991 HEIDEGGER, Martin: Was ist Metaphysik?- Frankfurt/M.: Klostermann, 1986, 13. Aufl. HUBER, Herbert (Hrsg.): Sittliche Bildung. Ethik in Erziehung und Unterricht.- Asendorf: MUT, 1993 HUBER, Herbert: Was ist Werterziehung?- In: HUBER 1993, S. 77 - 104 KANT, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft.- Hamburg: Meiner, 1959, 9. Aufl. (= K.d.pr.V.) KANT, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.- Stuttgart: Reclam, 1965, 6. Aufl. (= G.M.d.S.) KERSTIENS, Ludwig: Das Gewissen wecken. Gewissen und Gewissensbildung im Ausgang des 20. Jahrhunderts.- Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt, 1987 KOHLBERG, Lawrence: Moralische Entwicklung und demokratische Erziehung.- In: LIND/RASCHERT 1987, S. 25 - 43 29 Genetische Entwicklungstheorie ETHIK:DOK KOHLBERG, Lawrence/TURIEL, Elliot: Moralische Entwicklung und Moralerziehung.In: PORTELE 1978, S. 13 - 80 KOHLBERG, Lawrence/ WASSERMANN, Elia/ RICHARDSON, Nancy: Die Gerechte Schul-Kooperative. Ihre Theorie und das Experiment der Cambridge Cluster School.- In: PORTELE, Gerhard (Hrsg.): Sozialisation und Moral. Neuere Ansätze zur moralischen Entwicklung und Erziehung.- Weinheim, Basel: Beltz, 1978, S. 215 - 259 LIND, Georg/RASCHERT, Jürgen (Hrsg.): Moralische Urteilsfähigkeit. Eine Auseinadersetzung mit Lawrence Kohlberg über Moral, Erziehung und Demokratie.Weinheim u. Basel: Beltz, 1987 Mieth, Dietmar (Hrsg.): Christliche Sozialethik im Anspruch der Zukunft. Tübinger Beiträge zur katholischen Soziallehre.- Freiburg: Herder, Universitätsverlag MILLER, Alice: Am Anfang war Erziehung.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1980 MOORE, George E.: Principia Ethica.- Stuttgart: Reclam, 1970 NOAM, Gil G.: Selbst, Moral und Lebensgeschichte.- In: EDELSTEIN u. a. 1993, S. 171199 NUNNER-WINKLER, Gertrud: Zur moralischen Sozialisation.- In: HUBER 1993, S. 105 127 NUCCI, Larry/LEE, John: Moral und personale Autonomie.- In: EDELSTEIN/NUNNERWINKLER/NOAM 1993, S. 69 - 103 OSER, Fritz/ALTHOF, Wolfgang: Moralische Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich - mit einem Beitrag von Detlef Garz. Ein Lehrbuch.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1992 ÖSTERREICHISCHE JUGEND - WERTESTUDIE. Eine Untersuchung des Österr. Instituts für Jugendkunde. Projektleitung: Mag. Christian Friesl.- Wien 1991 PIAGET, Jean: Das moralische Urteil beim Kinde.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1979, 3. Aufl. (= stw 27) PIAGET, Jean: Psychologie der Intelligenz.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1984 RATHS, Louis/HARMIN, Merill/SIMON, Sidney: Werte und Ziele. Methoden zur Sinnfindung im Unterricht.- München: Pfeiffer, 1976 ROGERS, Carl R.: Freiheit und Engagement. Personenzentriertes Lehren und Lernen.Frankfurt/M.: Fischer, 1989 (= Geist und Psyche 42320) SPITZ, René: Vom Säugling zum Kleinkind.- Stuttgart: Klett-Cotta, 1967 TURIEL, Elliot: The development of social knowledge. Morality and convention.- Cambridge: Cambridge University Press, 1983 WHITEHEAD, Alfred N.: Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie.- Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984, 2. Aufl. Wieser/Rauter: Philosophie, Logik und kritische Problemlehre.- Wien: Deuticke, 1974 In Bearbeitung 30











