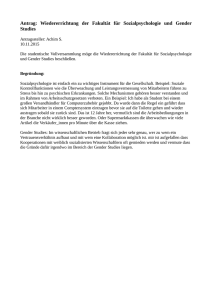Love Me Gender1 - Wir machen Kunst weil, es die feministische
Werbung

J O H A N N A S CH A F F E R Love Me Gender 1 Mein Text will Informationen darüber bereitstellen, was der Ausstellung Wir machen Kunst, weil es die feministische/ politische/gesellschaftliche/meine Situation erfordert inhaltlich und strukturell voranging. Dazu werde ich zunächst die Inhalte meines Gender Studies-Seminars, aus der die Ausstellung hervorging, und knapp deren strukturelle Bedingungen beschreiben. Es folgen Bemerkungen zum Logo der Ausstellung, die pinkelnde Figur im Kleid, und abschließend stelle ich kurz dar, was ich für die politischen Konsequenzen eines gegenwärtigen Stands aktueller Geschlechterforschung halte. Das Seminar Im Rahmen eines Zweijahresvertrags über eine Assistenzstelle im halben Beschäftigungsausmaß, finanziert aus staatlichen Mitteln zur Profilbildung der Kunstuniversität Linz im Bereich Gender Studies, begann ich im Oktober 2006 an der Abteilung Kunstgeschichte und Kunsttheorie/Schwerpunkt Gender Studies mit der Lehrveranstaltung Wir machen [Kunst], wenn es die politische Situation erfordert. Gender Studies, Feministische Theorien - was davon heute wie? 2 Das Seminar adressierte alle Student_innen3 der Kunstuniversität mit Lust und Interesse daran, sich auf verschiedenen Ebenen mit Geschichte und Gegenwart von Gender Studies und feministischen (und queeren und antirassistischen) Theorien zu beschäftigen, um entlang dieser Auseinandersetzung eigene künstlerische Arbeiten mit Blick auf eine gemeinsame Ausstellung und einen Katalog zu entwickeln. „Wir machen Filme, wenn es die politische Situation erfordert“, sagt eine der Protagonistinnen in Hanna Laura Klars Film Das schwache Geschlecht muß stärker werden, den sie 1969 als Studentin der Hochschule für Gestaltung in Ulm herstellte. In dem Film diskutieren sechs junge Filmemacherinnen das Verhältnis von Geschlecht, Patriarchat und Ausbeutung (z. B. im Rahmen von Hausarbeit, Kinderversorgung, Lohndumping). Und sie propagieren feministisch-antikapitalistische Gegenmaßnahmen. An diesen Satz einer Filmmacherin, an den Film und an die Geschichte feministischer Theorien und Ästhetiken lehnt sich also der Seminar- und auch der Ausstellungstitel an. Ausgangspunkt des Seminars war folgende Behauptung: Auch wenn die Vorstellung von nur zwei Geschlechtern, eins davon noch dazu schwächer, für manche heute vermutlich zwischen veraltet und peinlich oszilliert, lohnt sich fast vierzig Jahre später die Bezugnahme auf den Film - formal und inhaltlich. Warum? Weil vieles, was junge Frauen und Männer und Transpersonen und andere heute an Kunsthochschulen herstellen, ohnehin 1. auf derartige Produktionen Bezug nimmt, ohne es vielleicht zu wissen, 2. weil Retro Spaß macht, 3. weil es immer noch Ausbeutung und 4. eine Gewalt der Geschlechterverhältnisse gibt. Und vieles andere mehr. Im Mittelpunkt der inhaltlichen Auseinandersetzung im Seminar standen drei thematische Schwerpunkte und die Geschichte ihrer Diskussionen in den Gender Studies und den feministischen Theorien: 1) Reproduktionsverhältnisse (linke, antikapitalistische Kritiken am Verhältnis von Arbeit, Geschlecht, Sexualität). Auf diesen Schwerpunkt verwies im Seminar das Buch von Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, New York: Morrow 1970 [Dt. Frauenbefreiung und sexuelle Revolution, Übersetzung Gesine Strempel-Frohner, Frankfurt/Main: Fischer 1975]. 2) Antirassismus, Kritik an rassistischen, antisemitischen, (post)kolonialen gesellschaftlichen Verhältnissen. Dazu diskutierten wir Katharina Oguntoye, May Opitz (Ayim) und Dagmar Schultz (Hg.), Farbe bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, Frankfurt/Main: Fischer 1997. 3) Queeres 4 Denken, Kritik an Heteronormalität und Heteronormativität. Ausgangspunkt dieses Schwerpunkts war Monique Wittigs Buch The Straigth Mind, Boston: Beacon Press 1992, darin „One Is Not Born A Woman“, erstmals erschienen 1980 und 2003 als „Wir werden nicht als Frauen geboren“ von Luis Lüdicke übersetzt für die Zeitschrift IHRSINN. Eine radikalfeministische Lesbenzeitschrift 27, S. 8-19. Auf diese drei inhaltlichen Dimensionen wollte ich die theoretisch-wissenschaftliche Diskussion des Seminars konzentrieren, da sie grundlegend an der Herausbildung feministischen Wissens als politischer Kritik und Wissensressource beteiligt sind und waren. Im Rahmen der universitären Erfolgsgeschichte der Institutionalisierung feministischer Theorien als Gender Studies allerdings werden diese Dimensionen (vor allem in Österreich?) immer wieder marginalisiert. Dabei sind beispielsweise Shulamith Firestones „The Dialectic of Sex“ und Monique Wittigs „The Straight Mind“ aus einer heute in den Gender Studies durchaus hegemonialen Perspektive der Konstruiertheit und Fiktionalität der Geschlechter atemberaubend radikal, und das von Katharina Oguntoye, May Opitz (Ayim) und Dagmar Schultz herausgegebene Buch „Farbe bekennen“ ist gerade für die Entwicklung eines deutschsprachigen Wissens und einer antirassistischen Kritik aus Schwarzer 5 feministischer Perspektive von initialer und wegweisender Bedeutung. Daher möchte ich hier – zum Lust machen auf ein Weiterlesen und auch weil keiner der Texte auf Deutsch im Handel noch zu haben ist (außer antiquarisch) – zwei kurze Textausschnitte zitieren. Sie sollen die Aktualität der Argumentationen dieser Texte verdeutlichen. Monique Wittig, Wir werden nicht als Frauen geboren: „Eine materialistisch-feministische Annäherung an das Thema Unterdrückung der Frauen zerstört die Idee von Frauen als „natürliche Gruppe“. (…) Das Matriarchat ist nicht weniger heterosexuell als das Patriarchat: lediglich das Geschlecht der Unterdrückenden ist ein anderes. Darüber hinaus hält dieses Konzept immer noch an den Geschlechterkategorien Mann und Frau fest und ist außerdem der Idee verhaftet, dass Frauen über ihre Gebärfähigkeit (die Biologie) definiert werden. (…) Wenn wir zugestehen, dass es eine „natürliche“ Unterscheidung zwischen Frauen und Männern gibt, naturalisieren wir die Geschichte, setzen wir voraus, dass es immer „Männer“ und „Frauen“ gegeben hat und immer geben wird. Nicht nur naturalisieren wir so die Geschichte, als Konsequenz dessen naturalisieren wir zudem die gesellschaftlichen Phänomene, die unsere Unterdrückung ausdrücken. So verunmöglichen wir Veränderungen.” (S. 8 u. 10. Übersetzung leicht verändert, js) Und aus dem Vorwort der zweiten Auflage von Farbe bekennen, herausgegeben von Katharina Oguntoye, May Ayim und Dagmar Schultz: „Seit die erste Ausgabe von „Farbe bekennen“ veröffentlicht wurde, hat sich einiges in der weißen Frauenbewegung getan: Afro-deutsche Frauen haben weiße Frauen bei Lesungen, Diskussionen und in privaten Kreisen mit ihrer Unfähigkeit oder ihrem Unwillen, sie als Schwarze Deutsche anzuerkennen, konfrontiert. Gleichzeitig haben Immigrantinnen und Flüchtlinge weiße Frauen herausgefordert, mit der Angst, Konkurrenz und Distanz umzugehen, die sie in dem Verhalten weißer Frauen ihnen gegenüber empfinden. Jüdinnen haben öffentlich den Antisemitismus von christlichen deutschen Frauen angesprochen, die jüdische Frauen nicht als solche wahrnehmen, um Schuldgefühlen aus dem Weg zu gehen. Langsam beginnen weiße Frauen zu realisieren, dass Verantwortung übernehmen eine notwendige und konstruktive Alternative dazu ist, von Schuldgefühlen gelähmt zu sein. Die wachsende Gefahr von der Rechten und die Aussicht auf ein Europa, das vereint gegen Afrika, Asien und Lateinamerika auftritt, hat es noch dringender gemacht, direkt mit unserer Verwicklung in den Rassismus und Antisemitismus dieser Gesellschaft umzugehen, anstatt die Beschäftigung mit Rassismus und Antisemitismus lediglich als ein intellektuelles Unternehmen zu betreiben.” (S. 14) Als parallele Auseinandersetzung zu dieser Text- und Theoriebasierten Arbeit durchzog das Diskutieren ästhetischer Formen das Seminar als zweite inhaltliche Ebene. Grundlegend dabei war die Frage, wie eine Darstellung vermeiden oder zumindest minimieren kann, dass sie das, was sie kritisieren will, gleichzeitig auch bestätigt und bekräftigt. Ausgangspunkt dieser Diskussion um ästhetische Formen bildeten drei Filme mit den oben genannten Schwerpunkten: Hanna Laura Klars Film Das schwache Geschlecht muß stärker werden; Lizzie Bordens Born in Flames 6; und schließlich Elisabeth Scharangs Dokumentarfilm Tintenfischalarm 7. Als dritte inhaltliche Ebene schließlich war mir wichtig, aus der Perspektive einer feministischen und herrschaftskritischen Pädagogik, die auf die Ermächtigung vorhandenen Könnens und widerständiger und reflexiver Wissensformen bedacht ist, die Bedingungen zu adressieren, unter denen die gemeinsame Arbeit im Seminar stattfindet. Ermöglicht werden sollte so ein Mitdenken der Bedingtheiten der jeweils eigenen Handlungsmöglichkeiten – auch, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie und wo diese Handlungsmöglichkeiten erweitert werden können. Thematisiert wurde so zum Beispiel, wer beteiligt ist am Zustandekommen unserer Arbeitssituation sowie ihrer Finanzierung durch Mittel des Bundesministeriums, und was dies an Aufladung durch mögliche Repräsentationswünsche von verschiedenen Seiten bedeutet (inklusive meiner eigenen, als Leitende des Projekts). Bestandteil dieser Vermittlungspraxis war schließlich immer wieder die Reflexion der gemeinsamen Kommunikation und des gemeinsamen Umgangs miteinander. Als an einer Kunstuniversität Lehrende, die theoretische und wissenschaftliche Wissensproduktion unterrichtet, gilt mein primäres Interesse einer Untersuchung des gesellschaftlich reflexiven Potentials visueller und textueller Produktionen. Dazu gehe ich von einer Situation aus, an der Student_innen als in Ausbildung begriffene Künstler_innen beteiligt sind, die alle ein spezifisches Können bereits aufweisen – nicht zuletzt auch ein Können darin, sich auf der Ebene ihrer jeweiligen künstlerischen Arbeiten gegenseitig zu unterstützen und zu provozieren. An meiner Lehrveranstaltung nehmen sie teil, weil sie sich auch theoretisch-wissenschaftliches Können und Wissen in Auseinandersetzung erarbeiten wollen, für die ich das Material und die Ausgangsorganisation bereitstelle. Ihnen möchte ich vermitteln, dass die Möglichkeit und Fähigkeit zu theoretischer Auseinandersetzung ein enormes Ermächtigungspotential enthält – ebenso wie das Potential, sich von bekannten Wissenspfaden weg- und woanders hin tragen zu lassen. Selbstredend passt diese didaktische Haltung bestens zu den Erfordernissen eines zeitgenössischen Kunstbetriebs. Anders gesagt stellt es für Künstler_innen heute eine enorme berufliche Erleichterung, wenn nicht sogar eine Voraussetzung dar, in der Auseinandersetzung und auch der Produktion textuellen und theoretischen Wissens geübt zu sein. Darüber hinaus aber halte ich die skeptische Aufmerksamkeit gegenüber jeglicher Form der Disziplinierung von Wissen für eine politische Notwendigkeit (mit ehrwürdiger feministischer und linker, marxistisch-sozialistischer Tradition) – in meinem Berufsfeld zum Beispiel dort, wo eine unhintergehbare und kategoriale Differenz zwischen Kunst und Theorie bzw. Wissenschaft behauptet wird. Diese autoritätskritische Skepsis hat nichts gemein mit einer (Einsparungs-freudigen) Argumentation für die Abschaffung von hoher Spezialisiertheit und hohem Fachkönnen. Aber mit ihr will ich sehr wohl eintreten für die kontinuierliche Hinterfragung aller institutionellen und autoritären Verknappungen der Möglichkeiten, vielfältiges, widerständiges und vor allem reflexives Wissen zu produzieren. Zum Logo der Ausstellung: Stehend pinkeln im Kleid oder „Calling All Toilet Revolutionaries“8 Als Katharina Loidl ihre ersten Entwürfe für die Einladungskarte der Ausstellung präsentierte, war die überwiegende Mehrheit der Seminargruppe für die Karte mit der Figur im Kleid, die im Stehen pinkelt (alias Pissmädchen alias pinkelnde Lady). Zum Glück – denn ich wollte das Logo auch – war niemand unversöhnlich dagegen. Ich plädierte für das Logo, da es auf einen gegenwärtigen Diskussionsstand der Gender Studies/Geschlechterstudien verweist, und das zudem aus einer weiblich markierten Sprecher_innenposition (im Kleid!). Gemeint ist jener Diskussionsstand, von dem aus Einsprüche gegen eine heteronormative = zwangszweigeschlechtliche Ordnung formuliert werden. Dieses Geschlechtersystem wird angegriffen, da es Leute zwingt, eindeutig eins von nur zwei Geschlechtern zu sein und die jeweiligen sexuellen Wünsche an Personen des anderen Geschlechts zu richten. Die Gewalttätigkeit dieser binären Ordnung wird in queeren Zusammenhängen oft anhand der heteronormativen Logik öffentlicher Toiletten diskutiert: „Kürzlich auf dem Weg zu einem Vortrag in Minneapolis musste ich am Chicagoer O’Hare Flughafen umsteigen. Vom Bedürfnis getrieben, die öffentlichen Einrichtungen zu nutzen, mich frisch zu machen, mich zu erleichtern und andere derartige Euphemismen betrat ich zielbewusst die Frauentoilette. Kaum hatte ich die Toilettenkabine betreten, klopfte jemand an die Tür: „Hier ist der Sicherheitsdienst, öffnen Sie!“ (…) Einmal mehr war ich für einen Mann oder Jungen gehalten worden, und irgendeine Frau (die wovor genau Angst hatte?) hatte den Sicherheitsdienst gerufen (…) [D]ass das eigene Geschlecht von anderen in Zweifel gezogen wird, ist ein häufiges Vorkommnis im Leben vieler androgyner oder maskuliner Frauen. Tatsächlich geschieht das derart häufig, dass zu fragen ist, ob die Kategorie „Frau“ als Bezeichnung für öffentliche Einrichtungen nicht völlig überholt ist. (…) Das Toilettenproblem bringt allen daran Beteiligten die sonst unsichtbar bleibenden Geschlechtsstandards und deren Verletzung zu Bewusstsein, und es lässt uns empört gegen jene Gesetze aufbegehren, die Frauen an Weiblichkeit binden. Tatsächlich bringt der Vorwurf „Sie sind im falschen Klo“ zwei unterschiedliche Dinge zum Ausdruck. Erstens wird hier verkündet, dass mein soziales Geschlecht nicht mit meinem anatomischen Geschlecht übereinstimmt (zwischen meiner offensichtlichen Männlichkeit oder Androgynie und meinem vermeintlichen weiblichen Geschlecht herrscht Unstimmigkeit); zweitens wird suggeriert, dass Toiletten, die als für nur ein Geschlecht bestimmte ausgewiesen sind, nur für die da sind, die eindeutig in die eine (männlich) oder die andere (weiblich) Kategorie passen.“ (Judith Halberstam, The art of gender: bathrooms, butches, and the aesthetics of female masculinity, in: Jennifer Blessing (Hg.), Rrose is a rrose is a rrose: Gender Performance in Photography, New York: Guggenheim Museum, 1999, S. 176-189, S. 176. Übersetzung js) Bei dem von Judith Halberstam diskutierten Problem handelt es sich nicht um zufällige Wahrnehmungsfehler Einzelner, die in queeren Belangen uninformiert sind. Kritisiert wird hier ein herrschendes Darstellungs- und Wahrnehmungssystem, das bestimmte Weisen, ein Geschlecht zu leben, wahrnehmbar und lesbar macht – als normale Frau, als echter Mann, und andere in eine Sphäre des Unlesbaren, Nicht-Existenten, Unmöglichen, Abnormen, Nicht-Echten verweist. Und das ist Darstellungsgewalt: denn nicht echt, nicht wirklich, unwahr (kein echter Mann, keine Frau, so wie Frauen sein sollen, dieses Begehren eine jugendliche Absurdität, die sich auswachsen wird) genannt zu werden, produziert nicht nur eine Form der Unterdrückung (über die sich im übrigen das Echte, das Wirkliche, das Wahre bestimmt), sondern eine Form der „entmenschlichenden Gewalt“9, die sich über den Status oder besser: Nicht-Status der Unlesbarkeit herstellt. Produktion des Normalen und dessen, was als Abnormalität gilt, anzutreten. Die oft scheinbar leichtfüßig wirkende Ironie der Arbeiten ist aber vehement im Anspruch, in einer oft gewaltsam verlaufenden Normalitätsherstellung Zwischenräume zu öffnen. Verschiebungen entstehen durch einen kritischen Umgang mit der Frage, wie ständig sich wiederholende Zuschreibungen einer patriarchalen und heteronormativen Realität unterbrochen werden können. Damit setzen die Arbeiten an einem Wissenstand gegenwärtiger Geschlechterstudien an, der eine enorme politische Herausforderung zu bieten hat. Denn wie sind diese Forderungen nach Geschlechternormen-kritischen Räumen im politischen Alltagsgeschäft umsetzbar, zum Beispiel an einem dezidiert dem Gender Mainstreaming verpflichteten Arbeits- und Ausbildungsort, der gegen eine Benachteiligung von Frauen vorgehen will – und auch allen Grund dazu hat?10 Denn bereits diese Formulierung – gegen eine Benachteiligung von Frauen vorgehen – beinhaltet eine Blindheit gegenüber diversen gleichzeitig wirksamen Diskriminierungsachsen, und eine Blindheit dafür, dass sich diese Rede in der Praxis zunehmend und zunehmend ausschließlich an bürgerlichen weißen heterosexuellen österreichischen Passinhaberinnen ausrichtet. Eines der zeitgenössisch relevantesten Themen der Gender Studies – relevant für die konkreten politischen Forderungen ebenso wie für künstlerische und theoretischen Darstellungen – findet sich in der Frage, wie die Rede (und die Darstellungen generell) von „Frauen“ ein Wissen darum herstellen kann, dass die (gesellschaftlich hergestellte) Gruppe oder Klasse der „Frauen“, oder besser: dass all die Existenzweisen jener Personen, die als nicht-männlich klassifiziert werden, eine Vielzahl von möglichen, sehr unterschiedlichen und auch widersprüchlichen Existenzweisen umfasst.11 Das bedeutet, politisch sehr wohl von der Gleichheit aller als grundlegend zu fordernder Gleichberechtigtheit aller auszugehen. Aber dieser politische Ausgangspunkt muss getragen sein von einem Wissen um die Effekte, die die unterschiedlichen Positionierungen entlang der Achsen körperlicher Normentsprechung, sexueller Lebensweisen, Klassen- und Religionszugehörigkeit im Leben weiblicher und transgeschlechtlicher Personen haben. Besonders betont sei hier jene (rassistisch informierte) Diskriminierungsachse, die sich darüber herstellt, ob eine Person Zugriff auf die (staats)bürgerlichen Rechte und Privilegien des Landes hat, in dem sie lebt, oder eben nicht. Das verlangt auch nach einem Interesse daran, welche politischen Forderungen aus den Perspektiven dieser unterschiedlichen Positionierungen formuliert werden. Und das heißt nichts anderes, als sich umzusehen, sich Informationen zu beschaffen, sich auseinander zu setzen mit den Forderungen anders Positionierter – als allerersten Schritt im Zuge einer politischen Arbeit an der Gleichberechtigtheit aller Personen, die in einem gesellschaftlichen Zusammenhang anwesend sind. Linz, Wien, Juni 2007 Die Ausstellung und ihre Kontexte 1 Das sollte der Titel der Aufstellung sein – bis Anfang März 2007 der einwöchige Programmschwerpunkt des öffentlich-rechtlichen Radiosenders FM4 „zum Verhältnis der Geschlechter“ unter genau diesem Titel auf Sendung ging. Selbstredend befindet sich jegliche Äußerung immer in der Nähe zu anderen Äußerungen, aber wir beschlossen, uns doch eher Hanna Laura Klars Filmtitel-Nähe (dazu weiter unten mehr) als die uns inhaltlich unbekanntere FM4-Nähe auszusuchen. Mit vielem Dank an Barbara Paul für die Unterstützung bei der Ausarbeitung von Titel und Form der Lehrveranstaltung und der Ausstellungsumsetzung. 2 Für diese Schreibweise siehe den Artikel „Performing the gap“ (http://arranca.nadir.org/arranca/article.do?id=245): „Um die Illusion zweier sauber geschiedener Geschlechter aufrecht zu erhalten, kennt unsere Sprache nur die zwei Artikel „sie“ und „er“ sowie die zwei darauf bezogenen Wortendungen, zumeist das weibliche „...in“ und das männliche „...er“. Alles, was außerhalb dieser Ordnung liegt, wird fortwährend verleugnet, denn der Vorstellungshorizont unserer Sprache ist auf eine binäre Struktur eingegrenzt. Dagegen möchte ich einen anderen Ort von Geschlechtlichkeit setzen, einen Ort, den es zu erforschen gilt und um den wir kämpfen sollten, er sieht so aus: _.“ 3 4 Queer (engl. für schräg, sonderbar, falsch; lässt sich gut mit dem deutschen „pervers“ vergleichen) ist eines der klassischen homophoben und transphoben Schimpfwörter, hat aber im englischen und US-amerikanischen Sprachraum seit den späten 1980er Jahren, im deutschen Sprachraum seit Mitte der 1990er Jahre eine Rückaneignung erfahren. Heute wird es zum einen als Begriff der politischen (Selbst-)Bezeichnung und zum anderen in theoretischer/kritischer Arbeit verwendet. Zunächst bezeichnete die politische Verwendung von queer (z.B. in den Gruppen ActUp, Outrage in den USA) eine Position, die sich gegen Assimilation und Unsichtbarmachung in der heterosexuellen Normalität richtete. Mittlerweise wird queer zunehmend als Identitätsbezeichnung all jener Leute verwendet, deren sexuelle Lebensweisen nicht mit der heterosexuellen Norm übereinstimmen. Als theoretische Kategorie und Denkbewegung ist queer jedoch grundsätzlich identitätskritisch. Ausgehend von Sexualität als gesellschaftlicher Analysekategorie ist queere Theorie einer Kritik an heteronormativen und identitätslogisch operierenden Ordnungen verpflichtet und arbeitet daran, Klassifikationen anzufechten, durch die z.B. jene sexuellen/geschlechtlichen Identitäten zuallererst hergestellt werden, die dann als homosexuelle oder sonstwie perverse „Minderheiten“ zusammengefasst werden. Schwarz als Adjektiv mit großem Anfangsbuchstaben ist ein politischer Begriff der (Selbst-)Bezeichnung für Personen und Positionen, die über Hautfarbe, Religionszügehörigkeit und/oder ethnische Herkunft diskriminiert werden. 5 USA 1984, ein Sci-Fi: zehn Jahre nach Machtübernahme der „demokratischen Partei“ in den USA hat sich die Lage der Frauen verschlechtert. Wie also kann die feministische Revolution über Differenzen hinweg organisiert werden: Bürgerliche mit Revolutionärinnen, Latina- und weiße und schwarze und hetero- und bisexuelle und lesbische Frauen gemeinsam? 6 A 2005, „Im Herbst 2003 beschließt Alexandra, ihr Leben als intersexueller Mann fortzusetzen. Aus Alexandra wird Alex Jürgen. Und aus einem Dokumentarfilmprojekt über Intersexualität entsteht die Geschichte über einen Menschen, der durch seinen Witz bezaubert und seine Sicht der Welt erstaunt.“ http://www.tintenfischalarm.at 7 8 Vgl. den Text von Simone Chess u. a., Calling All Restroom Revolutionaries!, in: Mattilda, aka Matt Bernstein Sycamore (Hg.), That's Revolting: Queer Strategies for Resisting Assimilation. Brooklyn, N.Y.: Soft Skull Press 2006, S. 189-206. Siehe auch die Seite von PISSAR UCSB, einer Koalition aus behinderten und queeren Aktivist_innen am Campus der UC Santa Barbara, die dafür arbeiten, öffentliche Toiletten zu gewaltfreien Orten zu machen, besonders für Personen mit Behinderungen und queere Leute: http://www.uweb.ucsb.edu/~schess/organizations/pissar/ 9 Judith Butler, Undoing Gender, London, New York: Routledge 2004, S. 217. 10 Karina Koller hält in ihrem Text „Gender an der Kunstuniversität Linz“ fest, dass „die Konstanz der Frauenquote(n) [62,5 % der Studierenden, js] auf hohem Niveau zeigt, dass die Kunstuniversität Linz eigentlich schon lange vor der Aufgabe steht, die bestehenden Strukturen daran anzupassen, vorwiegend Frauen auszubilden.“ Darüberhinaus hat die Kunstuniversität Linz zwar Österreichweit mit 41% die höchste Professorinnenquote; aber, so Koller: „Die konkrete, inhaltliche Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse von UniversitätsprofessorInnen ist nicht mehr im Detail gesetzlich vorgegeben, sondern bleibt dem individuellen Arbeitsvertrag vorbehalten. Zusammen mit dem verkürzten Berufungsverfahren nach § 99 UG 2002 für Berufungen bis zu zwei Jahren, hat dies zu vermehrten Befristungen und zu einer generellen Flexibilisierung von Beschäftigungsverhältnissen der UniversitätsprofessorInnen geführt. Diese Entwicklung muss dem Anstieg der Frauenquote gegenübergestellt werden.“ Anders gesagt: wer an einer Überprüfung der Geschlechtergerechtigkeit am Arbeitsplatz interessiert ist, muß sich zusätzlich zur Quotierungsfrage auch mit der Frage nach unterschiedlichen Gehältern, unterschiedlich langen Arbeitsverträgen und unterschiedlich gut ausgestatteten Arbeitsplätzen beschäftigen. Noch stärker von Flexibilisierung und Deregulierung (z.B. fast nur mehr befristete Teilzeitverträge) ist der Mittelbau der Universität betroffen. Koller: „Die dadurch bedingte Vernachlässigung von Repräsentation und Kontrolle führt zu einer tendenziellen Entsolidarisierung, die wiederum Frauen besonders hart trifft.“ Karina Alice Koller, Gender an der Kunstuniversität Linz, zitiert nach dem mir von der Autorin überlassenen Manuskript, wird erscheinen in: flexart – flexible@art. Hg.: Kunstuniversität Linz 2007 (im Erscheinen). Mehr hierzu auch in meinem Text Antirassistische feministische Repräsentationskritik, in: Sabine Benzer (Hg.), Creating the Change. Beiträge zu Theorie & Praxis von Frauenförder- und Gleichbehandlungs-maßnahmen im Kulturbetrieb. Wien: Turia + Kant 2006, S. 104-113. 11 Alle Arbeiten, die von den Seminarteilnehmenden für die Ausstellung hergestellt wurden, haben sich als Untersuchungs- und Experimentierfeld die Produktion von Normen gewählt, vor allem die Produktion normativer Geschlechtlichkeit. Den künstlerischen Arbeiten gemeinsam ist somit die kritische Hinterfragung eines Geschlechtersystems, das Leute zwingt, eindeutig und nur eins zu sein, das heißt, entweder eine Frau (meist weniger wert; im Sitzen pinkeln) oder ein Mann (meist mit mehr Möglichkeiten; im Stehen pinkeln). Diese geschlechtliche Eindeutigkeit verlangt des Weiteren danach, das Begehren an eine (und nur eine) gegengeschlechtliche Person zu richten. Alles andere ist nicht normal oder, schlimmer noch, gilt gesellschaftlich als überhaupt nicht existent. Gemeinsam ist vielen künstlerischen Arbeiten zudem Ironie als Mittel, um gegen diese alltägliche Mit Dank an Franziska Schultz, Konrad Huybrecht, Andrea Roedig, Elke Koch für ihre Unterstützung im Zuge der Ausstellungsvorbereitung. Dank an Helga Hofbauer für den Selbstverteidigungs- und Interventionsworkshop für alle, die während der Öffnungszeiten die Ausstellung beaufsichtigen. Und Dank an die am Seminar und der Ausstellung teilnehmenden, genauer: mitmachenden Künstler_innen, den Student_innen (auch Silvia Koll, die früher aussteigen musste), weil die Projektrealisierung mit ihnen mich daran erinnert hat, dass es jenseits von Arbeits- und Privatleben und den diversen Befriedigungsmöglichkeiten, die beide zu bieten haben, noch eine wesentliche Ebene gibt: das Vergnügen am gemeinsamen Herstellen und am Erfinden und Definieren gemeinsamer Räume. Eine Art Beipackzettel innerhalb des Katalogobjekts zur Ausstellung: Wir machen Kunst, weil es die feministische/ politische/gesellschaftliche/meine Situation erfordert Herausgeber_innen: Johanna Schaffer, Barbara Paul, Kunstuniversität Linz, Abteilung Kunstgeschichte und Kunsttheorie/Gender Studies, Kollegiumgasse 2, A - 4010 Linz, www.ufg.ac.at Grafik, Layout: Katharina Loidl Erscheint 2007 bei: Kunstuniversität Linz Auflage: 300 Stück. ISBN 978-3-901112-40-9 www.machenkunstweil.ufg.ac.at