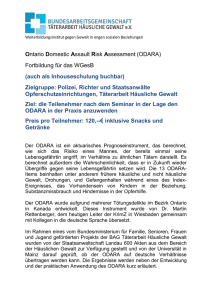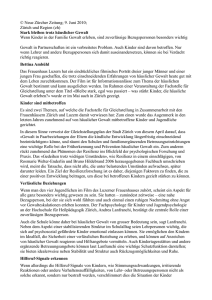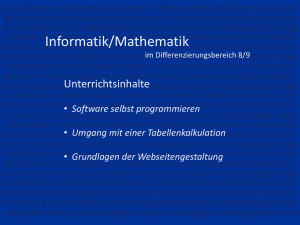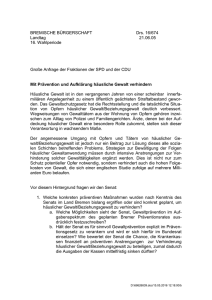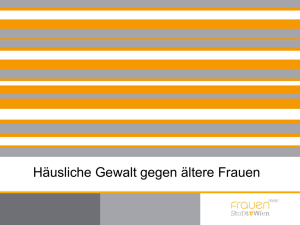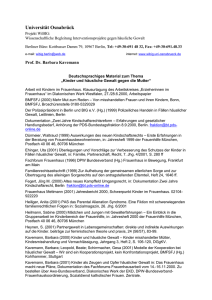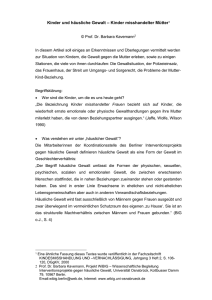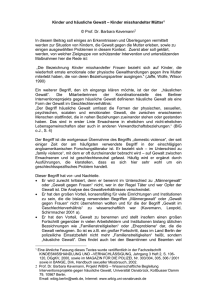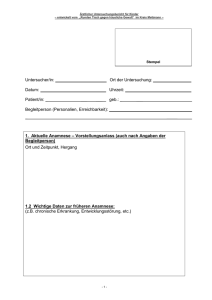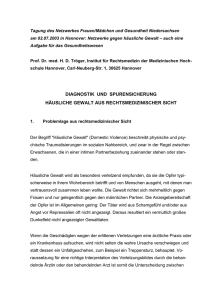Alle am Verfahren beteiligten Institutionen und
Werbung
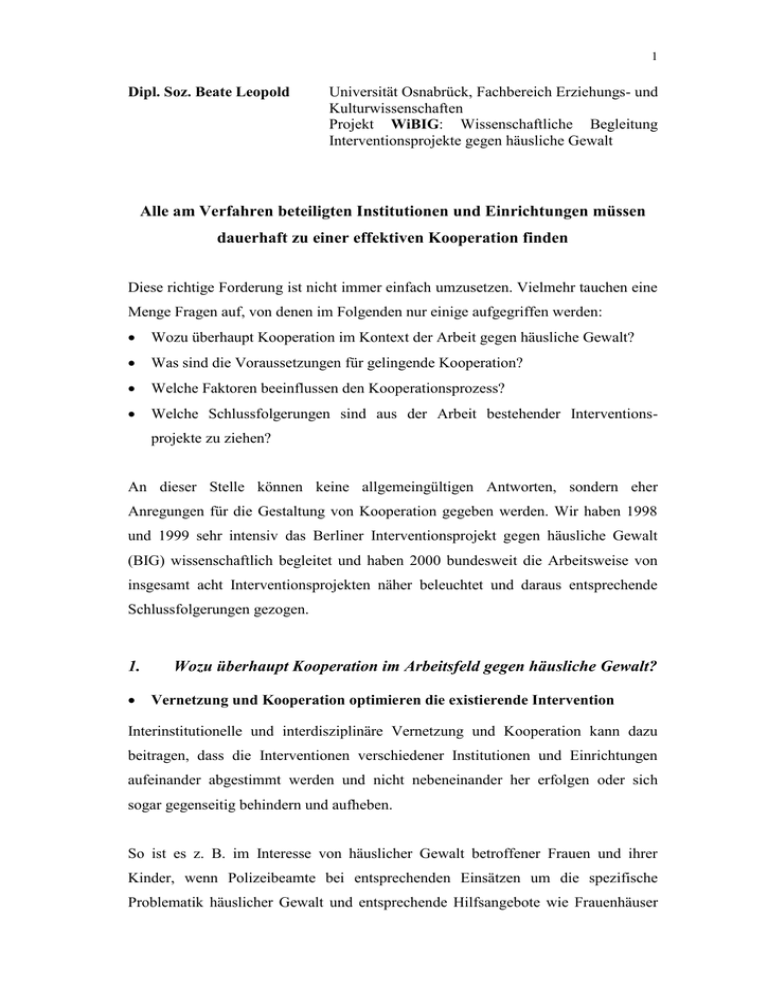
1 Dipl. Soz. Beate Leopold Universität Osnabrück, Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften Projekt WiBIG: Wissenschaftliche Begleitung Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt Alle am Verfahren beteiligten Institutionen und Einrichtungen müssen dauerhaft zu einer effektiven Kooperation finden Diese richtige Forderung ist nicht immer einfach umzusetzen. Vielmehr tauchen eine Menge Fragen auf, von denen im Folgenden nur einige aufgegriffen werden: Wozu überhaupt Kooperation im Kontext der Arbeit gegen häusliche Gewalt? Was sind die Voraussetzungen für gelingende Kooperation? Welche Faktoren beeinflussen den Kooperationsprozess? Welche Schlussfolgerungen sind aus der Arbeit bestehender Interventionsprojekte zu ziehen? An dieser Stelle können keine allgemeingültigen Antworten, sondern eher Anregungen für die Gestaltung von Kooperation gegeben werden. Wir haben 1998 und 1999 sehr intensiv das Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt (BIG) wissenschaftlich begleitet und haben 2000 bundesweit die Arbeitsweise von insgesamt acht Interventionsprojekten näher beleuchtet und daraus entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. 1. Wozu überhaupt Kooperation im Arbeitsfeld gegen häusliche Gewalt? Vernetzung und Kooperation optimieren die existierende Intervention Interinstitutionelle und interdisziplinäre Vernetzung und Kooperation kann dazu beitragen, dass die Interventionen verschiedener Institutionen und Einrichtungen aufeinander abgestimmt werden und nicht nebeneinander her erfolgen oder sich sogar gegenseitig behindern und aufheben. So ist es z. B. im Interesse von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder, wenn Polizeibeamte bei entsprechenden Einsätzen um die spezifische Problematik häuslicher Gewalt und entsprechende Hilfsangebote wie Frauenhäuser 2 etc. wissen. Dazu bedarf es der Kooperation zwischen Polizei und Frauenschutzprojekten auf verschiedenen Ebenen. Diese kann durch direkte Kontakte vor Ort erfolgen oder auch durch die Aus- und Fortbildung von Polizeibeamtinnen und –beamten zum Thema häusliche Gewalt gemeinsam durch Polizeiangehörige und Frauenhausmitarbeiterinnen. Auch das Einbinden der Staatsanwaltschaft in Kooperationsbezüge kann zu einer Optimierung vorhandener Interventionen führen. Dadurch kann erreicht werden, dass bei Strafanzeigen im Kontext häuslicher Gewalt die Zahl der Verfahrenseinstellungen und die Verweise auf den Privatklageweg erheblich sinken. Damit einher geht eine größere Zufriedenheit klagewilliger Frauen mit staatlicher Reaktion auf häusliche Gewalt und eine Verbesserung ihrer Situation. Darüber hinaus wird durch eine andere staatsanwaltschaftliche Reaktion auf Fälle häuslicher Gewalt auch die Motivation von Polizeibeamtinnen und –beamten gesteigert, entsprechende Anzeigen zu erstatten, müssen sie doch nicht mehr damit rechnen, dass die von ihnen angelegten Vorgänge keine justiziellen Konsequenzen haben und letztlich umsonst sind. Vernetzung und Kooperation hilft, das Angebot zu differenzieren Vernetzung und Kooperation kann dazu beitragen, dass das Unterstützungsangebot einer Stadt oder einer Region sich verdichtet, indem koordinierter gearbeitet wird und die rat- und hilfesuchenden Frauen sich nicht im Dschungel unterschiedlicher spezialisierter Dienste verlieren. Gleichzeitig fördert Vernetzung eine sinnvolle Spezialisierung. Die Lücken im Netz werden sichtbar, wenn das ganze Netz Thema ist. Nicht alle Lücken sind durch bessere Koordinierung bestehender Angebote zu schließen. Neue Konzepte und Angebote sind dann gefragt. Damit die Kooperation zwischen verschiedenen Einrichtungen und Institutionen gelingt, sollten jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: 2. Voraussetzungen für gelingende Kooperation Kooperationsbereitschaft bei allen Beteiligten Die Breitschaft zur Kooperation ist die Grundvoraussetzung für gelingende Kooperation. Diese entsteht am ehesten, wenn die Grenzen der eigenen Arbeit und 3 die Notwendigkeit eines gemeinsamen, aufeinander abgestimmten Handels gesehen werden. Es sollte Einigkeit über das anzustrebende Ziel herrschen Entscheidend für den Kooperationsprozess ist, dass Klarheit über das gemeinsame Ziel des Kooperationsgremiums herrscht. Selbst große ideologische Diskrepanzen können überwunden werden, wenn hier Einigkeit besteht. Sind diese Ziele nicht Konsens, scheitert die gegenseitige Verständigung. Es besteht dann die Gefahr, dass nur noch moralisch mit dem sehr globalen Ziel der Verbesserung der Situation von häuslicher Gewalt betroffener Frauen argumentiert wird und keine konkreten Veränderungen erreicht werden. Expertinnen-/Expertenstatus aller Beteiligten muss gegenseitig anerkannt sein Das heißt die Akzeptanz der kooperierenden Person und ihres fachlichen Hintergrundes. Es muss aber als sinnvoll und notwendig gesehen werden, dass die vertretene Institution in den Kooperationsverbund einbezogen wird. Dies beinhaltet auch, dass die Beteiligten ihre persönlichen und fachlichen Grenzen sehen, formulieren und Wert darauf legen, dass ihre Kompetenzen durch die der anderen ergänzt werden. Beteiligte brauchen Entscheidungsbefugnisse Kooperation ist neben dem fachlichen Austausch stark auf Entscheidungen angewiesen, die die angestrebten Veränderungen konzeptionell formulieren und in die Wege leiten können. Dazu ist es hilfreich, wenn die in einem Kooperationsgremium Zusammenarbeitenden von ihren Einrichtungen delegiert sind und nicht nur als privat interessierte Individuen dabei sind. Sie sollten auch ein Votum haben, im bestimmten Maße eigenständige Entscheidungen treffen zu können, so dass sie nur bei grundsätzlichen Fragen in ihrer Einrichtung oder ihrem Team Rücksprache halten müssen. Es kann den Einigungsprozess erheblich verzögern, wenn die beteiligten Personen keine Befugnis und Unterstützung ihrer Einrichtung haben. Es kann daher sinnvoll sein, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in Leitungsfunktionen in das Kooperationsgremium einzubeziehen, dies ist aber keine Voraussetzung. 4 Gerade die spezifische Kompetenz und Erfahrung von Praktikerinnen und Praktikern ist für das Ausarbeiten konkreter Interventionsschritte unverzichtbar. Es sollte aber klar sein, welche Befugnisse sie haben. Mut, Grenzen auszuloten und zu überwinden Die Beteiligten brauchen weiterhin Mut, die Grenzen des institutionell Möglichen auszuprobieren, dies fördert die Kooperation und die Qualität der Ergebnisse. Sie sollten also nicht bereits die Schere im Kopf haben. Strukturen müssen klar sein Es muss klar sein, unter welchen strukturellen Bedingungen die Kooperation erfolgen soll, wer in welchem Rahmen miteinander kooperiert, welche Gremien geeignet sind und in welchem Verhältnis diese zueinander stehen, wo welche Diskussionen geführt und Entscheidungen getroffen werden und wie diese dann auch umgesetzt werden. Dies kann sich je nach Situation und Gegebenheiten vor Ort unterschiedlich gestalten. Als Kooperationsgremien bewährt haben sich beispielsweise Runde Tische auf kommunaler oder Landesebene und interdisziplinäre, interinstitutionelle Fachgruppen. Wichtig ist jedoch, dass keiner der Beteiligten einen Führungsanspruch erhebt, sondern ein gleichberechtigtes Arbeiten erfolgt. Bewährt hat sich hier das Konsensprinzip. Konsens heißt nicht Nivellierung von unterschiedlichen Arbeits- und Herangehensweisen, sondern den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Das heißt, praktikable Lösungen zu suchen, die die Situation von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder konkret verbessern und mit denen alle am Kooperationsprozess Beteiligten leben können und die in den jeweiligen Arbeitsbereich integriert werden können. Die genannten Voraussetzungen müssen teilweise erst gemeinsam erarbeitet werden. Sie stellen die Weichen für einen erfolgreichen Kooperationsprozess. Es sollte daher genügend Zeit und Sorgfalt verwendet werden, ein tragfähiges Fundament für die gemeinsame Arbeit zu bauen. 3. Welche weiteren Faktoren beeinflussenden die Kooperation? 5 Das gemeinsame Ziel sollte konkretisiert und klar benannt werden Je konkreter die gemeinsame Zielsetzung formuliert ist, desto eher funktioniert der Kooperationsprozess. Die genaue Formulierung erleichtert einen zielorientierten Diskussions- und Arbeitsprozess. Je vager die Zielbestimmung, desto eher besteht die Gefahr, dass das Kooperationsgremium allgemeine Diskussionen führt und den Beteiligten nicht mehr deutlich wird, auf was sie eigentlich genau hinarbeiten. Die Zielbestimmung am Anfang stellt also die Weichen für die weitere Arbeit. Von daher sollte sich genügend Zeit genommen werden, um ein konkretes und realistisches gemeinsames Ziel zu formulieren. Eine breite fachliche Streuung der beteiligten Personen und Institutionen ist förderlich für die Diskussion und die Ergebnisse und deshalb einer homogenen Zusammensetzung vorzuziehen Kooperationsgremien, die aus eng miteinander verwandten oder verzahnten Arbeitsbereichen bestehen, laufen eher Gefahr, sozusagen „im eigenen Saft zu schmoren“ als Gremien, in denen die Beteiligte aus sich gegenseitig eher fremden institutionellen oder berufsspezifischen Bereichen kommen. In wurde beispielsweise in den Fachgruppen von BIG die Diskussion um so fruchtbarer erlebt, desto breiter die Zusammensetzung bzw. je fremder der jeweilige institutionelle Hintergrund in einer Fachgruppe war. Der Kooperationsprozess war dann gleichzeitig ein gegenseitiger Lernprozess, der den eigenen Blick auf die in der Fachgruppe behandelte Thematik erweiterte und schärfte. Es wurde als grundsätzliche Bereicherung empfunden, Einblick in andere Arbeitsfelder zu erhalten, neue Kontakte zu bekommen und somit unmittelbar für den eigenen Arbeitsalltag zu profitieren. Dies wiederum stärkte die Motivation zur weiteren Arbeit und wirkte sich somit auch positiv auf die kontinuierliche Teilnahme aus. Für die Mitarbeit in einem Kooperationsgremium reicht es nämlich auf Dauer nicht aus, etwas Gutes zu tun – d.h. sich gegen häusliche Gewalt zu engagieren, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter müssen dadurch auch etwas Gutes bekommen – d.h. neue persönliche oder fachliche Erkenntnisse und Anregungen für den eigenen Arbeitsbereich. Wichtig ist auch ine ausgewogene Zusammensetzung des Kooperationsgremiums: es sollte kein starkes zahlenmäßiges Übergewicht der einen oder anderen Einrichtung 6 bzw. eines Bereiches bestehen. Weiterhin müssen die Machtverhältnisse innerhalb des Gremiums berücksichtigt werden. Stehen beteiligte Institutionen und Einrichtungen in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis, besteht die Gefahr, dass sich die hierarchisch höherstehende Einrichtung unabhängig von ihren Argumenten durchsetzt und kein wirklicher Konsens erreicht wird. Persönliche Akzeptanz und ein guter Umgangston fördern die Kooperationsbereitschaft Entscheidend ist nicht nur, was gesagt wird, sondern auch wie etwas gesagt wird und beim Gegenüber ankommt. Dies spielt auch in Kooperationsprozessen eine große Rolle. Schwierige Diskussionen sind leichter zu führen, wenn die anderen als Personen, und nicht nur als Institutionenvertreterinnen und –vertreter wahrgenommen und akzeptiert werden. Vorwürfe oder Unterstellungen behindern die Kooperation. Die gegenseitige Akzeptanz hängt auch davon ab, ob in dem Kooperationsgremium Schwachstellen und Unzulänglichkeiten in der eigenen Arbeit bzw. der Arbeit der Herkunftsinstitution zugegeben und benannt werden. Offenheit und ein kritischer Blick auf die eigene Arbeit steigert die Glaubwürdigkeit und das gegenseitige Vertrauen. Grenzen des Machbaren werden von anderen eher akzeptiert, wenn die eigene Arbeit oder Institution nicht immer nur verteidigt wird. Die Art des Umgangs mit störenden Faktoren oder schwierigen Personen fördert bzw. hemmt den Kooperationsprozess Wie innerhalb eines Kooperationsgremiums mit störenden Faktoren oder auch schwierigen Personen umgegangen wird, trägt wesentlich zum Fortgang des Kooperationsprozesses bei. Gelingt es nicht, konstruktiv mit schwierigen Situationen umzugehen, behindert dies den weiteren Arbeitsprozess und kann somit auch die gemeinsame Zielsetzung gefährden. So müssen tragfähige Kompromisse gefunden werden, wenn sich abzeichnet, dass ein angestrebter Konsens nicht zustande kommen wird. Die Integration von als schwierig empfundenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fällt um so leichter, je größer die persönliche Akzeptanz innerhalb der Gruppe ist. 7 Um den gesamten Kooperationsprozess nicht zu gefährden, kann es jedoch kann es durchaus angebracht sein, sich im Interesse des gemeinsam formulierten Zieles von Personen zu trennen, die dieses Ziel nicht (mehr) mit tragen oder sich permanent destruktiv verhalten. Es muss jedoch klar herausgearbeitet werden, welche objektiven Gründe einer weiteren gemeinsamen Arbeit entgegenstehen. Gegebenenfalls sollte eine andere Person als Vertretung dieser Einrichtung angefragt werden. Der Erfolg von Kooperationsprozessen hängt wesentlich von der Auswahl und Zusammensetzung der beteiligten Institutionen und Personen sowie von der Gestaltung der Arbeitsprozesse ab. 4. Welche Erfahrungen mit Interventionsprojekten gibt es? Interventionsprojekte als institutionalisierte Kooperationsbündnisse gibt es in Deutschland seit Mitte der 90er Jahre in wachsender Zahl. Sie unterscheiden sich in Größe, Struktur und Schwerpunktsetzung. Sie verfolgen jedoch letztlich alle die gleiche Zielsetzung: den Abbau und die künftige Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und die gesellschaftliche Ächtung dieser Gewalt. Erreicht werden soll dies durch die konsequente Inverantwortungnahme der Gewalttäter sowie die Optimierung der Intervention und Unterstützung für betroffene Frauen und ihre Kinder. Die konkrete Umsetzung erfolgt in der Regel in Kooperationsgremien wie Runden Tischen und Facharbeitsgruppen, in denen alle beteiligten Institutionen, Einrichtungen, Projekte und Professionen zusammenkommen, die explizit gegen häusliche Gewalt arbeiten oder gesellschaftlich Verantwortung dafür tragen (sollten): Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Polizei, Justiz, Männerberatungsstellen, Kinderschutz, Ministerien, Kommunalverwaltungen. Die Vorgehensweisen der beteiligten Einrichtungen werden aufeinander abgestimmt, Richtlinien werden verbessert oder neu erarbeitet, gesetzliche Spielräume geprüft, um Intervention bei häuslicher Gewalt im Sinne der Betroffenen wirksamer zu gestalten. Gearbeitet wird in der Regel interdisziplinär, interinstitutionell, verbindlich und gleichberechtigt. 8 Die von uns wissenschaftliche begleiteten Projekte1 arbeiten alle strategisch und kooperativ gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: Sie haben eine unterschiedlicher Reichweite und Ausstrahlung, arbeiten landesweit oder auf die Kommune beschränkt, in Stadtstaaten und Flächenländern, sie sind unterschiedlich groß und komplex in ihren inneren Strukturen, sie sind finanziell und personell unterschiedlich ausgestattet, einige arbeiten vorwiegend strukturell, andere sind auf der operativen Ebene aktiv, es gibt Projekte, die im Zentrum einen Runden Tisch haben und solche, die ohne ein vergleichbares Kooperationsgremium arbeiten, es gibt Modellprojekte wie BIG und KIK-SH, andere wie beispielsweise HAIP arbeiten mit langjähriger Routine ohne Modellstatus und wieder andere sind bislang nicht über das Stadium einer Initiative hinaus gekommen. Genau so verschieden und komplex wie die Projekte sind auch die damit verbundenen Erfahrungen, diese Erfahrungen weisen darauf hin, welche Rahmenbedingungen und Anforderungen erfüllt sein müssten, was hilfreich ist und wo Konfliktfelder lauern. Notwendigkeit von Koordination Ein Kooperationsprojekt bedarf einer kompetenten Koordination. Sie hat eine Mittlerfunktion zwischen den beteiligten Institutionen und Projekten und sollte dazu beitragen, dass die Ebenen des Managements und der der praktischen Umsetzung im Unterstützungs- und Interventionsbereich immer gut verbunden sind. Problematisch wird es, wenn ein Kompetenzbereich fehlt. Ohne Managementkompetenz keine 1 „Koordinierungsstelle häusliche Gewalt“, BIG e.V., Berlin; „Neue Wege“ e.V., Bremen; „Gegenpol“ e.V., Gladbeck; „Hannoversches Interventionsprojekt gegen Männergewalt in der Familie“, HAIP, Hannover; „Koordinierungs- und Interventionskonzept“ Schleswig-Holstein, KIK-SH (Landeskoordination und örtliche Koordinationsstellen in Flensburg, Kiel, Schleswig und Landkreis Pinneberg); „Gewalt im sozialen Nahraum“, Passau; „Contra Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern“, CORA, Rostock (inkl. lokaler Koordinationsinitiativen in Bad Doberan und Güstrow); „RIGG – rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in nahen sozialen Beziehungen“, Mainz. 9 gelingende Kooperation, ohne fachliche Kompetenz und Praxiserfahrung womöglich eine Entwicklung, die an den Interessen der Zielgruppen vorbei geht. Bewährt hat sich ein von Projekten und Institutionen unabhängiges Koordinationsteam, in dem unterschiedliche Disziplinen vertreten sind. Es empfiehlt sich, dass die Koordinierenden hauptberuflich arbeiten. Dies ist jedoch nicht überall der Fall, so hat z. B das Hannoversche Interventionsprojekt HAIP ein nebenberuflich arbeitendes Koordinationsteam, das die Ressourcen von drei unterschiedlichen beteiligten Einrichtungen und Institutionen zusammenbringt. Mit ausreichender finanzieller Ausstattung wäre hier sehr viel mehr möglich gewesen und das Projekt hätte stärker auf Niedersachsen ausstrahlen können. Unabhängig davon, ob die Koordination haupt- oder nebenberuflich erfolgt, sie braucht ein klares Anforderungsprofil und klare Aufgabenstellungen. Sie sollte die Gesamtzielsetzung im Blick haben und vorantreiben, ohne jedoch die Inhalte vorzugeben. Kontinuität in Koordination und Kooperation Ein weiterer wichtiger Punkt ist Kontinuität in der Koordination, aber auch in der Kooperation. Ist keine Kontinuität gegeben, besteht die Gefahr, dass wichtige Informationen und Prozesse verloren gehen und immer wieder neu begonnen werden muss. Kontinuität in Koordination und Kooperation ist nicht gleichbedeutend mit einer „geschlossenen Gesellschaft“, sondern gewährleistet die kontinuierliche Weiterarbeit an dem bislang Erreichten und erleichtert neu hinzukommenden Kooperationspartnern den Einstieg in den Prozess. Klarheit über Aufgaben und Befugnisse der Kooperationsgremien Die Aufgaben der jeweiligen Kooperationsgremien müssen klar, aufeinander abgestimmt und allen Beteiligten transparent sein. Damit den am Kooperationsprozess Beteiligten der Gesamtzusammenhang und die Zielsetzung des Kooperationsprojektes nicht verloren geht, empfehlen sich in bestimmten Abständen Treffen aller am Projekt Mitwirkenden. Bei BIG zum 10 Beispiel fanden übergeordnete Fachgruppentreffen statt, auf denen ein Austausch zwischen den einzelnen Fachgruppen erfolgte und neue Querverbindungen geknüpft wurden. In fast allen Interventionsprojekten gibt es Runde Tische. Ein Runder Tisch, der die Ziele und Inhalte eines Interventionsprojekts mitbestimmt, sollte u. E. mehr sein wollen als ein Facharbeitskreis. Die Einbindung der politischen Ebene ist erforderlich, wenn Veränderungen verbindlich zur Umsetzung kommen und mit getragen werden sollen. Dieses Gremium braucht dann aber auch Entscheidungskompetenzen und eine gute Zuarbeit durch Facharbeitsgruppen. Wenn landesweit angelegte Projekte eine Vorgeschichte in Form eines kommunalen Interventionsprojekts haben, kann dies für die Durchsetzung der Idee von Interventionsprojekten sehr hilfreich sein und ein landesweites Projekt auf den Weg bringen. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass Experten und Expertinnen, die sich auf kommunaler oder regionaler Ebene engagieren, nicht in die Kooperationsgremien auf Landesebene abwandern und aus den regionalen Strukturen ausscheiden. Denn dann wird die zentrale Ebene auf- und die dezentrale Ebene abgewertet. Die Motivation zur Festigung und zum weiteren Ausbau kommunaler und regionaler Kooperationsstrukturen kann sinken, wenn deren Aufgabe und Bedeutung nicht klar wird. Gibt es eine zentrale Landeskoordination und regionale Koordinationen kann es zu einer Hierarchie und zu Machtkonflikten kommen. Die Bedeutung und Aufgabe der regionalen Arbeit muss daher deutlich sein und sie sollte in die zentrale Arbeit einbezogen werden, damit keine Kontroversen zwischen zentralen und dezentralen Strukturen ausbrechen und die Arbeit behindern. Wenn alles Wichtige nur in der zentralen Koordinationsstelle oder am landesweiten Runden Tisch passiert, und die regionalen Gremien wie Satelliten um die Landesgremien kreisen, dann besteht u.U. wenig Grund, sich in der Region zu engagieren. Investition von Zeit, Geduld und Geld Einige Interventionsprojekte arbeiten landesweit, andere auf kommunaler Ebene. Der Aufbau landesweiter Strukturen erfordert jedoch erheblich mehr an Zeit, Geduld und 11 Geld als der kommunaler oder regionaler Strukturen. Gleichgültig, auf welcher Ebene die Projekte arbeiten empfiehlt es sich, in ihren Aufbau zu investieren. Eine zu schnelle Konzentration auf Output und ein zu hoher Ergebnisdruck erschweren den Aufbau von Kooperationsstrukturen. Eine gründliche Klärung des Selbstverständnisses und der gemeinsamen Ziele am Anfang erleichtert ihn. Konkurrenzen und Einseitigkeiten vermeiden Interventionsprojekte sollten sich nicht als Frauenprojekte neben anderen Frauenprojekten verstehen. Dadurch entstehen Konkurrenzen und die Grundidee wird unterlaufen, nämlich gesellschaftliche Kräfte zu mobilisieren und die großen Institutionen für die Thematik häusliche Gewalt zu gewinnen. Ein Interventionsprojekt sollte u. E. seine Arbeit durch den Auftrag eines interinstitutionellen, demokratisch entscheidenden Gremiums legitimieren. Die Koordination sollte sich als unabhängig verstehen und nicht einer einzigen Einrichtung oder Richtung verpflichtet sein, dies schließt Parteilichkeit für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder nicht aus. Begrifflichkeiten klären Wichtig ist weiterhin die Klärung von Begrifflichkeiten. Was ist ein Interventionsprojekt, was eine Interventionsstelle, was ein Interventionskonzept? Hier verwirren sich Bezeichnungen, die sich an unterschiedliche rechtliche Bedingungen und Arbeitsaufträge knüpfen. Unter dem Terminus „Runder Tisch“ werden ebenfalls unterschiedliche Gremien mit unterschiedlichen Kompetenzen verstanden. Einige sind Facharbeitskreise, andere politische Entscheidungsgremien, die das gesellschaftliche Bündnis repräsentieren. Es wird auch in Zukunft die Frage sein, wie sich Interventionsprojekte verstehen wollen. Diese Diskussion sollte aber nicht vorschnell entschieden werden. Anschrift der Verfasserin: Projekt WiBIG, Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin, Tel: 030/691 48 32, e-mail: [email protected], Internet: www.wibig.uni-osnabrueck.de