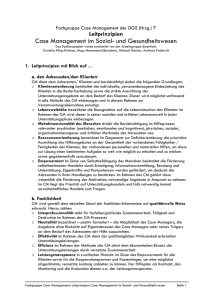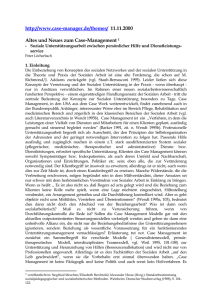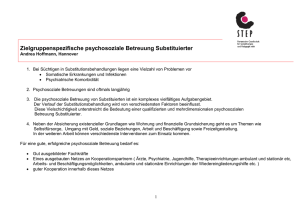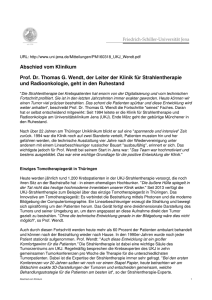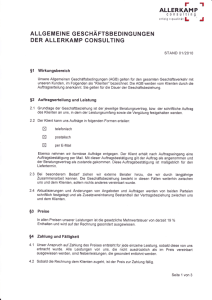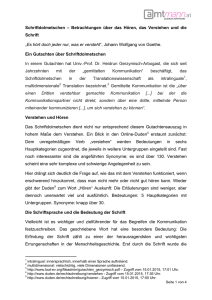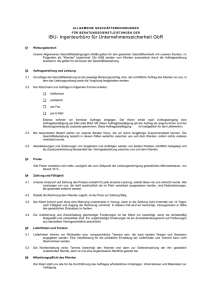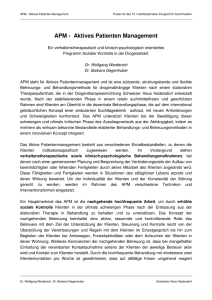Skript Teil 3 - gerhardinger
Werbung

1
Prof. Dr. Günter Gerhardinger
„Soziale Arbeit mit Einzelnen und Familien“
Skriptum zur Lehrveranstaltung
Teil 3:
III. Konzepte der sozialen Arbeit mit Einzelnen und Familien
1. Vorüberlegungen
2. Der psychosoziale (diagnostische) Ansatz in der Sozialen Einzelhilfe
3. Das Case Management
III. Konzepte der sozialen Arbeit mit Einzelnen und Familien
1. Vorüberlegungen
Bei der Darstellung der handlungsleitenden Konzepte für die Praxis der sozialen Arbeit mit
Einzelnen und Familien kann von einer Grobunterscheidung in
-
sog. klassische Konzepte der sozialen Einzelhilfe (incl. Arbeit mit Familien) (z.B.
"Psychosoziale Einzelhilfe" nach Hollis, "Problemlösende Einzelhilfe" nach Pearlman,
"Funktionale Einzelhilfe" nach Smalley) und
-
neuere Konzepte (z.B. "Engagierter Dialog" nach Hege, "Life-Model" nach Germain/
Gitterman, "Case-Management" nach Wendt).
ausgegangen werden.
Bei der Analyse der vorliegenden Kozepte zur sozialen Arbeit mit Einzelnen und Familien
können (wie in der Sozialen Arbeit allgemein) zwei Richtungen (Tendenzen) in Bezug auf das
Vorgehen ausgemacht werden. Zum einen sind es Konzepte mit einem eher integrativen
Charakter. Zum anderen stehen emanzipatorische Bemühungen im Vordergrund.
In Konzepten mit integrativer Grundtendenz ist die SozialarbeiterIn die ausgewiesene ExpertIn.
Die Probleme werden von Seiten der Sozialen Arbeit definiert. Diese bestimmt, was "normal" ist
und was als "abweichendes Verhalten" bezeichnet werden kann. Die Problemlösungen sind
dementsprechend an eben dieser Normalität orientiert. Die Lösungswege sind "vorgegeben", da
die Soziale Arbeit ja "weiß", wo sie ihre KlientInnen haben möchte und wie sie sie an diese Ziele
bringen kann. Das Handeln gestaltet sich innerhalb eines solchen Konzeptes natürlich
systemimmanent und ist meistens unkritisch auf die Gesellschaft bezogen.
Beim emanzipatorischen Vorgehen handelt es sich um den von der Kritik an den integrativen
Vorstellungen ausgehenden "Gegenentwurf". Hier ist die SozialarbeiterIn nicht ExpertIn,
sondern PartnerIn. Die Problemfassungen werden "ausgehandelt". Problem"lösungen" sind
eigentlich keine solchen mehr, da emanzipatorisches Geschehen sich nur als offenes Geschehen
gestalten kann. Die Veränderung orientiert sich an dem, was die KlientIn als "Wohlergehen"
formuliert. Verbesserungen in Richtung eines "gelingenderen" (nicht gelingenden!) Alltags
(vergl. Thiersch 1986, S.37) entspringen wiederum den angedeuteten Aushandlungsprozessen.
2
Das Handeln ist innerhalb solcher Konzepte nicht auf Systemerhaltung ausgerichtet. Die
Möglichkeit der (nicht vorher formulierten) Veränderung wird miteinbezogen (Systemtransparenz).
2. Der psychosoziale (diagnostische) Ansatz in der Sozialen Einzelhilfe
2.1. Der systemische Ansatz
Florence Hollis sieht ihr Konzept von Sozialer Einzelhilfe im wesentlichen als "systemtheoretischen Ansatz" (Hollis 1982, S. 48):
"Das Kernstück der psychosozialen Arbeitsweise lag von ihren
Anfängen bei Mary Richmond an und während ihrer weiteren
Entwicklung in der Betonung von Individuum und Situation als
den Faktoren, die durch die Diagnose erfaßt werden müssen, und
als den Elementen, in denen durch die Einzelhilfe Veränderungen
bewirkt werden können. Man hat allgemein erkannt, daß durch das
Aufeinanderwirken des einzelnen und seiner Situation Veränderungen in der Umwelt das Verhalten des Menschen beeinflussen, ebenso wie Veränderungen im Menschen sich auf das
Zusammenspiel der Elemente seiner Umgebung auswirken. Dabei
handelt es sich ganz offensichtlich um ein Konzept der Systemtheorie" (Hollis 1982, S. 72 f).
Der systemtheoretische Gedanke wird von Hollis auf drei Ebenen festgemacht:
-
auf der umfassenden Ebene des "Person-in-ihrer-Situation-Gefüges,
der Ebene des interpersonellen Systems und
der Ebene des Persönlichkeits-Systems.
Diagnose und Behandlung sind auf das "Person-in-ihrer-Situation-Gefüge" abgestellt (Hollis
1982, S. 48, vergl. auch Hollis 1973, S. 27). Der hilfebedürftige Mensch wird "im Zusammenhang mit seinen Interaktionen oder Transaktionen mit der Umwelt gesehen", wobei insbesondere
die Wichtigkeit der Familie betont wird (Hollis 1982, S. 48).
Angenommen wird, "daß ein ständiger Austausch zwischen den verschiedenen Komponenten
stattfindet und daß das gegenseitige Aufeinanderwirken ein lebendiges, wenn auch manchmal
labiles Gleichgewicht erhält" (Hollis 1982, S. 48). Die Parsonsche Vermischung von
Psychoanalyse und sozialwissenschaftlichen Überlegungen in dessen Systemtheorie ist hier als
Einfluss deutlich zu erkennen (vergl. Hollis 1973, S. 27; Hollis 1982, S. 52).
Analog zu Parsons verwendet Hollis den Begriff "Persönlichkeits-System". Für sie ist "die
organismische Sicht, aus der das Individuum betrachtet wird, ..... selbstverständlich eine Systemformulierung" (Hollis 1982, S. 48). Das Verständnis des Systems Persönlichkeit wird mit
Hilfe der Persönlichkeitstheorie Freuds geleistet, womit der zweite wesentliche wissenschaftliche
Bezugspunkt des psychosozialen Konzepts der Sozialen Einzelhilfe angesprochen wäre. Die Persönlichkeit der KlientIn selber wird also wiederum als System gesehen:
"Da die Persönlichkeitstheorie, die der psychosozialen Ar-
3
beitsweise zugrunde liegt, hauptsächlich auf Freud zurückgeht, sehen wir das Persönlichkeits-System als eine Reihe
aufeinanderwirkender Kräfte, die als Es, Ego und Super-Ego
bezeichnet werden. Das Wirken der vielen Ego-Aspekte, in
das das Funktionieren der Abwehrmechanismen eines
Menschen eingeschlossen ist, hat große Bedeutung bei der
Beurteilung, ob die Versuche des Klienten, mit seinen Problemen fertig zu werden, angemessen sind und wie weit er
selbst zu seinen Schwierigkeiten beiträgt. Die Ego-Funktionen eines Menschen müssen selbst dann überprüft
werden, wenn die Ursachen seines Problems hauptsächlich
in der Situation und weniger in der Persönlichkeit liegen"
(Hollis 1982, S. 67).
Dieses Konstrukt ist nicht unproblematisch. Es wird hier ein System konstruiert, das aus logisch
völlig unterschiedlichen Ebenen besteht. Während die Persönlichkeitssysteme, die das
interpersonelle System konstituieren, reale Menschen sind, werden diese aus thoretischen
Annahmen, dem ES, dem Ich und dem Über-Ich aus der Lehre Sigmund Freuds
zusammengesetzt. Wissenschaftstheoretisch ist dieses Vorgehen nur sehr bedingt akzeptabel.
Aus den "Persönlichkeits-Systemen der einzelnen Menschen" setzt sich dann das "interpersonale
System" , z. B. "Eltern - Kind, Ehemann - Ehefrau, Familie", zusammen (Hollis, 1982, S. 73 f).
In diesem interpersonellen System finden Transaktionen statt. Probleme gibt es bei diesen
Transaktionen insbesondere bei gestörten Wahrnehmungen und eingeschränkter Kommunikation
der Beteiligten (vergl. Hollis 1982, S. 74).
Abb.: "Person-in ihrer Situation-Gefüge" nach Florence Hollis
Persönlichkeitssysteme
Transaktionen
zwischen den
Systemkomponenten
ICH
ÜIch
Es
Person-in ihrer
Situation-Gefüge
4
Aus diesen grundlegenden Systemvorstellungen leiten sich die wesentlichen Punkte des
sozialarbeiterischen Prozesses, insbesondere die Diagnose und die Behandlung, ab.
2.2. Der Begriff der Diagnose im psychosozialen Konzept von Florence Hollis
"Diagnose" spielt im Konzept der sozialen Einzelhilfe von Hollis eine zentrale Rolle. Die
ursprüngliche Bezeichnung "diagnostische Richtung" verweist darauf.
Beim Diagnostizieren bemühen wir uns laut Hollis, "aus dem vorhandenen Material, das wir vor
dem Hintergrund dessen betrachten, was wir über menschliches Verhalten und soziale
Gegebenheiten wissen, zu erfahren, welche Schwierigkeiten der Klient hat, was zu ihnen beiträgt,
wo Änderungen herbeigeführt werden können, die seine Probleme entschärfen oder lösen, und
welche Schritte der Sozialarbeiter unternehmen kann, um dieses Ziel zu erreichen" (Hollis 1982,
S. 64).
Dabei "(besteht) der Diagnoseprozeß ..... aus einer kritischen Durchleuchtung des Komplexes
'Klient-in-seiner-Situation' und der Schwierigkeiten, die zur Kontaktaufnahme mit der Sozialstelle führten. Zweck dieser Untersuchung ist, die Natur des Problems genauer und deutlicher zu
erkennen. Der spezifische Komplex dieses Klienten in seiner Situation muß dabei wiederholt mit
einer Reihe von ungefähren Normen verglichen werden. Diese Durchschnittswerte betreffen das
Verhalten des Klienten und andere zur Sache gehörende Aspekte seiner sozialen Situation und
die konkreten Gegebenheiten" (Hollis 1982, S. 65).
Diese Aussage ist eine der problematischten im Konzept von Hollis. Der Vergleich mit einer
"Reihe ungefährer Normen" (gesellschaftlicher Durchschnittswerte) lässt eine ganze Reihe von
nicht ungefährlichen Missverständnissen zu. Gesellschaftliche Durchschnittswerte können,
abgesehen davon, dass es äußerst schwierig sein dürfte, sie für die vielen Bereiche menschlichen
Verhaltens zu erheben und zu beschreiben, nicht einfach als Orientierungspunkt für die
(Re)Integration von Menschen genommen werden. Geht man trotzdem so vor, wird Soziale
Arbeit zu einer unkritischen Anpassung an bestehende Zustände. Dies ist auch einer der
Hauptkritikpunkte, die an der psychosozialen Richtung der sozialen Einzelhilfe angebracht
werden müssen.
Die "kritische Durchleuchtung des Klient-in-seiner-Situation-Gefüges" hinsichtlich der
Erstellung einer Diagnose geschieht unter Berücksichtigung dreier Aspekte (die eigentlich eine
Einheit bilden und nur zu Analysezwecken getrennt werden können) vor sich:
- dem dynamischen Aspekt
(Wirkung verschiedener Aspekte in der Persönlichkeit des Klienten aufeinander und
Beeinflussung dieser Aspekte durch sein gesamtes Verhalten? Wechselwirkung zwischen dem
Verhalten eines Menschen und dem anderer Menschen und Systeme; Auswirkungen von
Veränderungen eines Teils eines Systems; gegenseitige Beeinflussung von Systemen);
- dem ätiologischen Aspekt
(Erkundung der Frage, ob Faktoren mit ursächlichem Charakter im gegenwärtigen Kräftespiel
oder in vergangenen Ereignissen liegen);
- dem klassifikatorischen Aspekt
(Klassifizierung/ Kategorisierung der verschiedenen Aspekte im Verhalten und Handeln des
Klienten; evtl. auch Einschluß einer klinischen Diagnose) (vergl. Hollis 1982, S. 66; vergl. S. 86).
"Diese beschriebene Dreiheit von Einsichts- und Verständnismöglichkeiten entsteht, wenn das
Klient-Situation-Gefüge aus der Perspektive verschiedener sozialer und psychologischer Bezugsrahmen betrachtet wird" (Hollis 1982, S. 66). Hollis vergleicht dies "mit der fluoroskopischen
5
Betrachtung eines lebendigen Organismus", "die dem Sozialarbeiter nicht nur zeigt, durch was
und in welcher Weise die Schwierigkeit verursacht wird, sondern ihm auch Hinweise darauf gibt,
bei welchen Aspekten der Person oder der Situation eine Änderung nützlich und möglich sein
könnte und welche positiven und negativen Auswirkungen sie wahrscheinlich auf die anderen
Teile des Gesamtkomplexes haben würde" (Hollis 1982, S. 86; vergl. S. 74). Dabei wird nach
"Echostellen" gesucht, "das heißt, nach den möglichen Veränderungen, die im Gesamtgefüge die
größtmögliche Wirkung hervorrufen" (Hollis 1982, S. 66).
Herangeszogen wird hier das "Prinzip der Äquifinalität oder des gleichwertigen
Endergebnisses". "Die Untersuchung eines Falles kann mehr als eine Art von Veränderungen
ergeben, die eine Besserung versprechen. Mehrere Sozialarbeiter wählen vielleicht verschiedene
Arbeitsweisen und erreichen damit ähnliche Ziele. Dies bedeutet nicht, daß alle Methoden gleich
angemessen sind, sondern vielmehr, daß häufig mehrere Möglichkeiten innerhalb einer
begrenzten Anzahl wirksam sein können" (Hollis, S. 86). Aussagen von Hollis lassen jedoch
darauf schließen, dass häufig auf die intrapersonellen Echostellen rekurriert werden wird:
"Obwohl wir uns bei zwischenmenschlichen Schwierigkeiten darum bemühen, die Familie oder
andere interpersonelle Systeme zu verändern, können wir uns nicht der Aufgabe entziehen, auch
auf die Modifizierung der Persönlichkeiten oder besser gesagt der Persönlichkeits-Systeme der
betroffenen Menschen hinzuarbeiten" (Hollis 1982, S. 74).
2.3. Der Behandlungsprozess
Die Aufgabe der sozialen Einzelhilfe besteht in diesem Konzept darin, das Person-in-ihrerSituation-Gefüge so zu beeinflussen und zu modifizieren, dass die Betroffenen darin wieder ohne
größere Schwierigkeiten leben können. Für Hollis ist Behandlung in der sozialen Einzelhilfe
"eine abgestimmte Mischung von Vorgängen", die "auf eine Änderung in der Person oder in ihrer
sozialen oder zwischenmenschlichen Umgebung oder in beiden hinarbeitet ..... Zum größten Teil
werden diese Ziele in Besprechungen zwischen Klient oder Klienten, Sozialarbeiter und
wichtigen anderen Personen und durch ein Angebot an konkreten Hilfsmaßnahmen verfolgt"
(Hollis 1971, S. 49).
Im Behandlungsprozess selbst wird unterschieden zwischen direkten und indirekten
"Behandlungsmethoden. Indirekte Behandlung bedeutet dabei die Beeinflussung der Umwelt des
Klienten. Der Sozialarbeiter kann als "Beschaffer", "Auffinder", "Dolmetscher", "Vermittler",
"Anwalt" und "Veränderer" tätig sein. Direkte Behandlung bedeutet die unmittelbare Arbeit mit
dem Klienten (vergl. Hollis 1982, S. 78 f). "In den meisten Fällen wird ein Kontakt zwischen
dem Klienten und einem System von Hilfsmöglichkeiten oder -quellen hergestellt, dessen sich
der Klient weiter bedienen soll" (Hollis 1982, S. 79).
Die Behandlung "besteht aus einer Reihe verbaler und nicht-verbaler Kommunikationen". Es
wird hier zwischen Unterstützung und direkter Beeinflussung unterschieden. "Äußerungen, die
unter die Rubrik 'Unterstützung' fallen, sind solche, in denen ein Sozialarbeiter sein Interesse am
Klienten, sein mitfühlendes Verständnis, seinen Wunsch zu helfen, sein Vertrauen in den
Klienten und seine akzeptierende Haltung oder seine Zustimmung zum Ausdruck bringt" (Hollis
1982, S. 80 f). Direkte Beeinflussung besteht in Ratgeben, Vermitteln von Informationen etc..
Es wird betont, dass Diagnose und Behandlung in einem sehr engen Verhältnis stehen und dem
dynamischen Aspekt des Person-in-ihrer-Situation-Gefüges Rechnung tragen sollen, indem sie
sich ebenfalls dynamisch darstellen (vergl. Hollis 1982, S. 85 ff).
Für die Behandlung im psychosozialen Konzept von Hollis ist "die Dimension der Kommunikationsdynamik (Hervorh. d. Verf.) von besonderem Interesse". Dadurch, dass die Behandlung aus
einer Reihe von verbalen und nicht-verbalen Kommunikationen besteht, wird eine verändernde
Dynamik erzeugt.
6
Hollis unterscheidet dabei sechs Möglichkeiten, von denen je die Hälfte nichtreflektierende
Dynamik und reflektierende Dynamik bezeichnet, wobei der Ausdruck "'reflektierend' ..... im
Sinne von 'geistiger Betrachtung', 'kontemplativ' gebraucht (wird)" (Hollis 1982).
Nichtreflektierende Dynamik steht dabei für
"a) Kommunikationen, durch die der Sozialarbeiter den
Klienten zu unterstützen sucht, und zwar durch Äußerungen
des Interesses, der Sympathie und des Verständnisses, des
Wunsches zu helfen, des Vertrauens in den Klienten und seiner wertungsfreien Annahme;
b) Kommunikationen, die das Verhalten des Klienten direkt unterstützen oder bremsen, indem der Sozialarbeiter seine Ansichten oder Haltungen verdeutlicht;
c) Kommunikationen, die die Erforschung oder Erörterung
von Material anregen, das mit dem Wesen oder der Situation
des Klienten ..... zusammenhängt ....."
Reflektierende Dynamik bezeichnet Kommunikationen, die den Klienten zur nachdenklichen Betrachtung, zum Verständnis und zum bewußten Erfassen anregen und zwar in Bezug auf
"d) des Klienten Person-Situation-Gefüge in der Gegenwart
oder der den Erwachsenen betreffenden Vergangenheit;
e) die psychologische Struktur und Dynamik im Verhalten
des Klienten oder
f) Aspekte aus dem früheren Leben des Klienten, die mit
seinem jetzigen Verhalten in Zusammenhang zu stehen
scheinen" (Hollis 1982, S. 81; Absatzbildung durch Verf.).
Ein weiterer zentraler Begriff im Behandlungsvorgang ist die helfende Beziehung. Die Beziehung
zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn soll ein Mittel der Kommunikation zwischen den an der
Behandlung beteiligten Personen sein; "sie besteht in einer Reihe von Haltungen und einer Reihe
von Reaktionsweisen, die sich im Verhalten ausdrücken" (Hollis 1971, S. 168). Bezugspunkt
dafür ist das Rekurrieren auf eine "jedem Individuum eigene Würde". "Es ist diese Grundhaltung,
die die für eine erfolgreiche Behandlung unerläßliche Vertrauensatmosphäre schafft. Aus ihr
entstehen die zwei Hauptmerkmale des Verhaltens der SozialarbeiterInnen gegenüber ihren
KlientInnen: das wohlwollende Annehmen und der Glaube an die Selbstbestimmung des
Einzelnen" (Hollis 1971, S. 30).
Dadurch, dass die Persönlichkeit der SozialarbeiterIn zum wichtigsten Bestandteil der
Behandlung gemacht wird, wird hier "die These vom instrumentellen Charakter der
Persönlichkeit und der gelebten Werthaltung deutlich" (Peter 1982, S. 17). Von der SozialarbeiterIn wird daher auch eine gelebte positive Werthaltung gefordert, die auch in ihre
Ausbildung eingehen soll, wie z.B. in einer Grundaussage der klassischen Methodenliteratur
formuliert wird: "Der Studierende wird sich nicht der Einsicht verschließen können, daß
Menschen, die im Rahmen ihrer beruflichen Arbeit anderen Menschen dazu verhelfen wollen, in
reiferer Weise mit dem Leben fertig zu werden, selbst über einen gewissen Grad von Reife
verfügen müssen" (Bang 1958, S. 22).
Wie die Problemlösung mit Hilfe der "helfenden Beziehung" vonstatten gehen soll, wird nur sehr
undeutlich beschrieben. Die KlientIn soll in der SozialarbeiterIn eine Person ihres Vertrauens
7
sehen können, da "der Erfolg aller Maßnahmen ..... in hohem Maße vom Vertrauen des Klienten
in der Sozialarbeiter als Fachmann oder als Autoritätsperson ab(hängt)" (Hollis 1971, S. 177). In
der sogenannten "korrigierenden Beziehung" "kann man wünschenswerte, psychisch gesunde
Aktivitäten des Klienten fördern ....." (Hollis 1971, S. 178 f). Die SozialarbeiterIn soll zum
Vorbild werden und über ihre Persönlichkeit und die Beziehung zu ihr zur Identifikation
einladen: "Es handelt sich um nachahmendes Lernen, das in dauerhafter Weise in der Persönlichkeit des Klienten seinen Niederschlag finden kann" (Hollis 1971, S. 181).
Angesichts solcher Postulate stellt sich natürlich sofort die Frage, wie denn nun die
SozialarbeiterInnenpersönlichkeit beschaffen sein soll, damit sie diesen Ansprüchen gerecht
werden kann.
Kritisch betrachtet worden ist hier immer schon die Funktion der SozialarbeiterIn über eine
(unkritische) gesellschaftsbejahende Haltung zu einer Integration (Anpassung) der Klienten
innerhalb eines systemimmanenten Vorgehens beitragen zu müssen.
Dieser unkritisch gesellschaftsbejahende Ansatz wird deutlich, wenn die von Hollis zur
Verfügung gestellten Praxisbeispiele analysiert werden (vergl. Hollis 1971, S. 53-65). In den
Fallgeschichten
-
-
-
wird aufgrund der Vorgabe einer Normalität diagnostiziert. Von dieser Normalität
abweichendes wird überhaupt nicht zugelassen;
findet die Behandlung unter bestimmten Zielvorgaben statt, die wiederum von
Normalitätsvorstellungen ausgehen. Das gemeinsame Entwickeln einer neuen Existenzform
für die in den Fällen agierenden wird ausgeschlossen;
ist der Ausgangspunkt ein Status quo, der wieder erreicht werden soll (z.B. Ehe). Deutlich
wird hier ein eher harmonistisches Weltbild. Alternativen (wie z.B. Ehescheidung) werden
ausgeschlossen;
ist das Vorgehen sehr stark individuumzentriert. Es werden Persönlichkeiten
(Persönlichkeitssysteme) und höchstens die sie umgebenden privaten Systeme behandelt.
Darüber hinausgehende makrosoziale Faktoren (wie die Rolle der Frau in Ehe, Familie etc.,
aber auch problematische männliche Rollenverständnisse) kommen nicht ins Gespräch.
Insgesamt also ist das psychosoziale Konzept Sozialer Arbeit mit Einzelnen von Florence Hollis
als ein integratives Konzept mit all seinen kritikwürdigen Punkten zu sehen. Die Beschäftigung
mit diesem Konzept ist wichtig, da in ihm wesentliche Merkmale des sozialarbeiterischen
Vorgehens in der Arbeit mit Einzelnen und Familien grundgelegt sind. In diesem Konzept gezeichnete Strukturen kennzeichnen die Praxis sozialer Arbeit in diesem Bereich auch heute noch
ganz wesentlich.
8
3. Das Case Management
3.1. Vorüberlegungen - Zur Entwicklung des Case Managements
Seit Beginn der 1990er Jahre kann in der Sozialen Arbeit mit Einzelnen und Familien beobachtet
werden, dass mehr und mehr die Umschreibung der Praxis mit Hilfe des Begriffes Case
Management geschieht. Dies wurde zunächst eher als modische Erscheinung abgetan,
zusammenhängend mit einem zu dieser Zeit allgemein einsetzenden Trend, gesellschaftliche
Erscheinungen mit Begriffen aus der Ökonomie zu erfassen. Der Verlauf der 90er Jahre hat aber
dann gezeigt, dass dieser Trend zur Ökonomisierung weiter Bereiche der Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland ein anhaltender war und so ist es nicht verwunderlich, dass dieser
Trend auf die Soziale Arbeit nicht nur übergegriffen, sondern sich dort zumindest im fachlichen
und wissenschaftlichen Diskurs zur Leitlinie entwickelt hat.
Festgestellt werden kann die "Verbetriebswirtschaftlichung Sozialer Arbeit" (vergl. SchmidtGrunert 1996) auf zwei Ebenen: der Ebene der Effizienz- und Effektivitätserhöhung der
Institutionen, was sich in der Diskussion vor allem als Sozialmanagement niedergeschlagen hat
und für unseren Kontext besonders interessant, der Ebene der Fallbearbeitung. Nicht nur
institutionelle Voraussetzungen sollten betriebswirtschaftlichen Rationalitätskriterien
unterworfen werden, sondern auch die Bearbeitung der Fälle selbst. Management als
Handlungskategorie zur Verbesserung und Optimierung von Handlungsabläufen wird nicht nur
für die Träger und Einrichtungen propagiert, sondern auch für das Geschehen auf der
Mikroebene der Sozialarbeit, den Umgang mit den KlientInnen selbst. Die betroffenen Personen
sollen nun nicht mehr behandelt, therapiert etc. werden, es wird nicht mehr interveniert, sondern
Lebenskontexte von Menschen sollen so gehandhabt, "gehandelt", also gemanaged werden, dass
das Leben wieder gelingen kann.
Ausgangspunkt für das Case Management als Konzept der Sozialen Arbeit mit Einzelnen und
Familien ist eine im Rahmen der allgemein ablaufenden Ökonomisierung der Gesellschaft
vehement vorgetragene Kritik der herkömmlichen Sozialen Arbeit in diesem Bereich. Diese
Kritik umfasst regelmäßig zwei Aspekte, einen quantitativen (die Soziale Arbeit würde in Zeiten
knapper Mittel zuviel kosten und darüber hinaus mit den zur Verfügung gestellten Mitteln nicht
effizient umgehen, ja, sie nicht selten verschleudern) und einen qualitativen (die Soziale Arbeit
würde trotz großer Mittelverschwendung nichts rechtes hervorbringen und bei den zu
bearbeitenden Problemen weitgehend versagen) (vergl. Gehrmann/ Müller 1996, S. 45-55)1.
Diese Doppelkritik ist an und für sich nicht neu, sie ist eigentlich eine kontinuierliche Begleiterin
Dies geschieht meist in sehr publikumswirksamer und plakativer, die Soziale Arbeit geradezu
verunglimpfender Art und Weise:
1
"Wir erleben Jugendhäuser, in denen sich längst nicht mehr die
Jugendlichen treffen, für die diese ursprünglich gedacht waren:
Jugendliche, die in einem Stadtteil die geringsten Chancen haben, ihre
Freizeit nach ihren Bedürfnissen und gleichzeitig in gesellschaftlich
akzeptierten Bahnen zu organisieren. Dort arbeiten seit langen Jahren
Sozialarbeiter, die das Ende der Selbstorganisationsbewegung in
Jugendzentren verschlafen haben. Diese leisten dann wenig effektive
Jugendarbeit und 'bedienen' lediglich einige Neigungsgruppen, um ihren
eigenen Hobbies nachgehen zu können. Gleichzeitig treffen sich
zunehmend Jugendliche auf der Straße und begehen aus
unterschiedlichen Motiven die ersten Schritte in einen für sie selbst nicht
wünschenswerten sozialen Aus- oder weiteren Abstieg." /Gehrmann/
Müller, S. 46)
9
der Professionalisierungsgeschichte der Sozialen Arbeit. Zu Beginn der 90er Jahre aber wird
daraus eine seltsame Mischung, die einschneidende und mit schmerzhaften Mittelkürzungen
einhergehende Veränderungen in der Sozialarbeit hervorbringt und diese nicht nur mit knappen
Mitteln, sondern vielmehr mit Qualitätssteigerung begründet. Weitgehend unwidersprochen
kommt sehr schnell das Schlagwort von mehr Qualität bei weniger Ressourcenverbrauch in die
Diskussion, letztendlich eine primitiv-naive Übertragung des ökonomischen Prinzips in die
Soziale Arbeit. Man müsste nur die Praxis der Sozialen Arbeit entsprechend umgestalten, dann
bräuchte es weniger Mittel bei gesteigerter Qualität der Ergebnisse der Sozialen Arbeit2.
Die wesentlichen Elemente zur Umgestaltung einer Sozialarbeit, welche angeblich
als "Samariter mit caritativem Engagement", "sich bis zum
Ausbrennen für die tätige Nächstenliebe auf(...)opfer(t), ohne
Feierabend und Privatsphäre, die den Klienten jederzeit
offensteht" und in deren "Wohnung ..... dann obdachlose
Klienten übernachten (könnten)" (Gehrmann/ Müller 1996,
S. 51 f),
kommen aus einer professionellen Ecke, die nicht wie diese irrational mit Problemen umgehe.
Gemeint sind (betriebs)wirtschaftliche Elemente, denn:
Es müsse "ins Bewußtsein der Praktiker treten, daß
Management in sozialen Organisationen im sozialen Sinne
'ganzheitliche Lösungen' anstrebt. Diese betreffen die
Konzeption auf der Ebene der Organisation, der
Zielentwicklung,
der
Kooperationsbeziehungen
der
Mitarbeiter untereinander sowie mit Klienten, die
Funktionalität der Arbeitsplätze und die Dokumentation der
Arbeit und nicht zuletzt die konkreten Arbeitsvollzüge auf
Konzept- Methodenebenen.
Sozialarbeiter brauchen Management-Kompetenzen, damit
sie Fehlentwicklungen und Widersprüche erkennen und auch
wissen, wie man diese verringern kann und vor allem auch,
wie eine kompetente Leitung einer Einrichtung
verantwortlich und professionell handeln kann. Diese
Kenntnisse sind wichtig aus der Perspektive der einzelnen
Sozialarbeiter in der Arbeit mit Klienten. Sie sind es aber
auch im Hinblick auf Leitungsaufgaben, die Sozialarbeiter
nicht fremden Berufen überlassen sollten" (Gehrmann/
Müller, S. 47).
Hier soll nicht so getan werden, als wäre die Tradition der Sozialen Arbeit und ihre aktuelle
Entwicklung eine problemlose. Es gibt enorm viel zu kritisieren und zu verbessern.
Problematisch ist jedoch in höchstem Maße, die nicht bewiesene oder logisch hergeleitete
bessere Alternative betriebswirtschaftlichen Denkens in der Sozialen Arbeit. Es ist nicht nur
Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
spricht in ihrer Kritik an der öffentlichen Verwaltung, zu der ja ganz
wesentlich die Soziale Arbeit gehört, davon, dass Reformen auf keinen Fall
durch weiteres Größenwachstum, also mehr Geld, sondern nur durch einen
grundlegenden Umbau der Srukturen erfolgen können.
2
10
Polemik, wenn angemerkt wird, dass betriebswirtschaftliches Handeln durchaus nicht immer
"erfolgreich" ist. Auch Management ist kein objektives Kriterium. Es gibt gutes und schlechtes
Management. Es ist durchaus Management denkbar, das den herkömmlichen
betriebswirtschaftlichen Idealen nicht entspricht.
Ab Beginn der 90er Jahre ist diese Art von Kritik an der Ökonomisierung der Gesellschaft auch
innerhalb der Sozialen Arbeit nicht sehr beliebt. Der Begriff des Management wird als
Allheilmittel für alle bisher ungelösten Probleme der Professionsentwicklung und besonders für
die in unserem Zusammenhang interessierenden Probleme der psychologisierenden und
pädagogisierenden Konzepte der Sozialen Einzelfallhilfe gesehen und es wird ein ungeheurer
Modernisierungsschub erwartet.
"Case Management ist eine Methode (! - GG.) der sozialen
Einzelhilfe oder der Organisation und Koordination von
Unterstützungsleistungen für eine ganze Klientel. Als soziale
Einzelhilfe ist sie die modernisierte, vom Psychozentrismus
befreite
sozial-ökologische
Weiterentwicklung
der
klassischen Einzelhilfe der Sozialen Arbeit" (Gehrmann/
Müller 1996, S.186).
Befördert wird die Einführung des Begriffes Management auf der Ebene der Fallbearbeitung
auch durch die institutionelle Eingebundenheit dieser Arbeitsform in den Bereich der
öffentlichen Wohlfahrtspflege. Soziale Arbeit mit Einzelnen und Familien findet zu einem nicht
unbeträchtlichen Teil in Einrichtungen öffentlicher Träger statt: in Jugend-, Sozial- und
Gesundheitsämtern, Allgemeinen Sozialdiensten. Diese Institutionen sind dem Bereich der
öffentlichen Verwaltung zugehörig und in diesem Bereich findet im Rahmen der allgemeinen
Ökonomisierung der deutschen Gesellschaft ebenfalls seit Beginn der 90er Jahre die Debatte um
die so genannte "Neue Steuerung" statt. Bei der Neuen Steuerung geht es darum, öffentliche
Verwaltungen so umzubauen, dass sie im Rahmen eines "Konzerns Stadt"
betriebswirtschaftlichen Kriterien Rechnung tragen, da nur so, hier ist die Kritik fast parallel zu
der im Bereich der Sozialen Arbeit, die Defizite in Bezug auf Effektivität und Effizienz abgebaut
werden könnten. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
hat zu diesem Thema eine ganze Reihe von Empfehlungen herausgegeben und insbesondere die
Jugendhilfeverwaltung als eine Art Pilotprojekt gewählt (vergl. insbesondere die KGSt-Berichte
5/93, 8/94, 9/94). Der Kern des Neuen Steuerungsmodells ist das sog. Kontraktmanagement,
dessen Sinn eine strikte Trennung von Politik und Verwaltung ist. Während die Politik auf der
Ebene des Stadt- oder Kreisrats darüber befindet, welche Ziele erreicht werden sollen, hat die
Verwaltung, in unserem Falle z.B. das Jugendamt oder der Allgemeine Sozialdienst dafür zu
sorgen, dass die Zielvorstellungen des Rates auch erreicht werden. Dabei wird möglichst viel
Verantwortung von oben auf untere Ebenen, also die ausführenden Ebenen delegiert. Im idealen
Falle soll z.B. die zuständige Abteilung des Allgemeinen Sozialdienstes selbstverantwortlich
(auch für das zugeteilte Budget) den Auftrag "Familien mit Erziehungsproblemen so zu
unterstützen, dass diese ihrem Erziehungsauftrag nachkommen kann" erledigen können. (vergl.
KGSt 1993).
Das Neue Steuerungsmodell bietet eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die für die
institutionelle Ebene formuliert sind, aber auch im Case Management für den Bereich der
Fallbearbeitung in ähnlicher Art und Weise auftauchen. Die Tatsache, dass gerade in
Arbeitsfeldern, die dem Bereich der öffentlichen Träger zugeordnet sind (Jugendamt, ASD etc.)
von den MitarbeiterInnen betont wird, dass sie ihre Praxis am Konzept des Case Management
ausrichten, dürfte in der Wichtigkeit der Diskussion um die Neue Steuerung in der öffentlichen
Verwaltung begründet sein (vergl. Wendt 1997, S. 22-28).
11
Auch Wendt als derjenige, der maßgeblich das Case Management in den deutschen Fachdiskurs
der Sozialen Arbeit eingebracht hat, geht von einer Kritik der Effektivität des bestehenden
sozialen Dienstleistungssystems aus. "Die Probleme sind komplexer geworden und haben sich
auf eine andere Art differenziert als die Sozialdienste, die ihnen abhelfen sollen" (1991, S. 11)
also hat die Soziale Arbeit es versäumt, sich den Gegebenheiten in einer effektiven Art und
Weise anzupassen, oder mit anderen Worten: Die Soziale Arbeit arbeitet an den eigentlichen
Problemen vorbei.
Darüber hinaus spricht Wendt von mangelnder "Sozialer Produktivität", d.h. Soziale Arbeit sei
häufig nicht nur wenig effektiviv, sondern nicht selten auch von wenig Effizienz gekennzeichnet:
"Mit Effektivität ist die Zielwirksamkeit gemeint: In
welchem Maße erreicht die Arbeit, was mit ihr beabsichtigt
wird? Effizienz bedeutet die Wirtschaftlichkeit des
Mitteleinsatzes: In welchem Verhältnis steht der gestiftete
Nutzen zum Aufwand, also zu den entstandenen Kosten?
Eine Hilfestellung kann geeignet (effektiv) sein, ohne sich
deshalb schon zu "lohnen". Und mehr Unterstützung ist nicht
unbedingt die bessere Unterstützung. Die Aufgabe von
Management besteht darin, Effektivität und Effizienz
miteinander zu verbinden, so daß ein anhaltender Erfolg
erreicht und gesichert wird". (1991, S. 15)
Damit haben wir es hier mit einem ökonomischen Ansatz der Wohlfahrtsproduktion zu tun. Die
Ökonomisierung betrifft auch das Leben der KlientInnen. "Die Produktion erfolgt in einer
geeigneten Kombination des Mitteleinsatzes (von Mitarbeitern, Kapital und Verbrauchsgütern)
und des Einsatzes weiterer Faktoren (wie persönliche Eigenschaften von Klienten und Faktoren
der sozialen Umgebung)" (Knapp, zit. nach Wendt 1991, S. 15; vergl. 1997, S. 72f).
Diese Gedanken sind ihrem Ursprung her verbunden mit den neoliberalen Konzepten des
Wirtschaftens in den USA und GB in den 80er Jahren (vergl. Wendt 1991, S. 14 f; 1997, S. 1421).
Hingewiesen werden muss an dieser Stelle auf das Verständnis von Wendt bezüglich des Begriffes Ökologie. Wendt spricht beim Case Management auch von einem ökosozialen Konzept
der Sozialarbeit. Soziales Handeln soll ökologisch aufbereitet werden: "Die Problemlage soll in
ihrer ganzen Komplexität und Ausdehnung gesehen und an eine ökologisch zu verantwortende
Bearbeitung verwiesen werden" (1989, S. 523).
Dabei geht Wendt von der wichtigen Annahme aus, dass sowohl seine wissenschaftlichen
Überlegungen selbst zum diskursiven Geschehen der Sozialarbeit zu rechnen sind, als auch die
Praxis der Sozialarbeit, sobald sie sich mit ihrem Gegenstand befasst, unweigerlich mit diesem
verbunden ist. "Im topischen Blickwinkel ortet Ökologie die Lebenserscheinungen in einem
Raum von Beziehungen, wobei unsere Wissenschaft in dem Moment, da sie sich der sozialen
Angelegenheit annimmt, nicht mehr darüber hinweg kann, daß sie selbst zu ihnen zählt, auch
gerechnet werden will und in dem bezeichneten Raum untergebracht ist" (1982, S. 5).
Ökologisch denken und Handeln bedeutet "haushaltend" umzugehen, das heißt für Wendt, "daß
es Probleme der Binnenorganisation des individuellen, familiären, gesellschaftlichen Lebens
sind, die ökosozial in erster Linie interessieren und nicht Probleme des Menschen in seiner
Umwelt" (1989, S. 523).
Bei Wendts ökosozialem Ansatz ist ökologisch also nicht als Bezug des Menschen zu seiner
Umwelt zu sehen. "Ökologisch" ist eher die Bezugnahme auf den "haushaltenden" Aspekt.
12
Hauptaufgabe des Case Managements ist demnach, "...potentiell auf die konkreten Problemlagen
passende Hilfen ausfindig und zugänglich zu machen" (Wendt 1991, S. 11). "Menschen haben
in ihrem eigenen Lebensbereich Probleme und Belastungen zu bewältigen, und im Sozial- und
Gesundheitswesen sind Ressourcen der Unterstützung und Behandlung vorhanden. Case
Management bringt im Einzelfall beide Seiten, das Bewältigungssystem von Klienten und das
formale Ressourcensystem, zusammen" (1997, S. 30). So ist nach Wendt Case Management zu
verstehen als "eine professionelle Verfahrensweise, mit der personenbezogen ein
Versorgungszusammenhang ..... bearbeitet wird. Er verknüpft formelle Dienste mit informeller,
'häuslicher' Lebensführung einer Person oder Familie in ihren sozialen oder gesundheitlichen
Belangen" (1997, S. 30).
Zumindest zwei kritische Anmerkungen müssen an dieser Stelle gemacht werden. Zum ersten
wird hier so getan, als wäre das System der Hilfemöglichkeiten in unserer Gesellschaft so
ausdifferenziert, dass für jede Problemlage zumindest potentiell eine Hilfemöglichkeit vorhanden
ist. Abgesehen von der Frage, ob diese Aussage phänomenologisch in Ordnung ist, muss ein
logisches Problem angesprochen werden. Es ist nicht so, dass Notlagen objektiv zu fassende
Angelegenheiten sind. Vielmehr ist hier zu sehen, dass subjektiv jede Lebenslage als Notlage
empfunden werden kann. Ob es aber für all diese "Notlagen" eine Hilfemöglichkeit gibt, die nur
ausfindig gemacht werden muss, ist mehr als fraglich. Mehr als fraglich ist auch, dass hier eine
Rolle spielende gesellschaftliche Definitionsprozesse in die Vorgänge des Case Managements
eingebaut werden können.
Dies leitet über zur zweiten notwendigen Anmerkung. Die Grundaussage, für jede konkrete
Problemlage gäbe es auch eine Hilfemöglichkeit in unserer Gesellschaft führt dazu, dass der
gesellschaftliche Status quo festgeschrieben wird. Die Case ManagerIn wird sich nicht daran
machen für die individuelle Notlage eine individuelle Hilfeleistung zu finden, was evtl. auch mit
einer Kritik der bestehenden Verhältnisse verbunden sein kann), sondern auf die Suche gehen
nach bereits bestehenden Hilfeangeboten (was impliziert, dass die bestehenden Verhältnisse
eigentlich grundsätzlich in Ordnung sind). Bei diesen dem Konzept zugrunde liegenden
Prämissen ist jede Gesellschaftskritik weit außen vor, es geht lediglich darum, Verwerfungen des
Systems selber wieder in Ordnung zu bringen, also die Hilfesuchenden mit den
Hilfemöglichkeiten in Verbindung zu bringen.
3.2. Der Fall als System
Case Management nach Wendt "nimmt die Vorgänge und Verfahren, die zu ihm zählen, als ein
System wahr, dessen Handhabung rational und rationell erfolgen kann" (1991, S.12) und die
Kompetenz des Case Managers wird dahingehend bestimmt, dieses System handhaben zu
können, in der Verfügung über "Mittel und Wege ....., mit denen sich angestrebte Ziele erreichen
lassen (1991, S. 12).
"Da nun im sozialen Feld die Mittel, Wege und Ziele nicht fix
vorgegeben und abrufbar sind, sondern sich im Fluß des gesellschaftlichen Geschehens und des Miteinander-Lebens finden,
agiert auch der Manager in ihm und verhandelt erst über das Erforderliche, bevor er sich dessen Bewerkstelligung zuwendet. Er
bewegt sich dabei unter Menschen und in institutionellen
Strukturen. In ihnen liegen die Ressourcen vor, die im Case
Management gehoben und fallweise erschlossen werden sollen"
(1991, S. 12).
Case Management hat mit zwei sich selbst organisierenden und steuernden Systemen zu tun:
13
-
-
dem institutionellen/ administrativen System. Dieses sei zweckorientiert. Praktisch ist
Sozialmanagement gemeint, die "Lenkung und Leitung einer zweckmäßigen
Zusammenarbeit in Institutionen und Personengruppen, die sich der Erfüllung sozialer
Aufgaben widmen".
Dem individuellen System. Hier geht es um subjektiven Sinn. Praktische Ausprägung sei das
Selbstmanagement, die "Kompetenz, das eigene Leben unter vernünftigem Einsatz
verfügbarer Mittel und Möglichkeiten so zu gestalten, daß es nach subjektiven oder
objektiven Maßstäben gelingt" (Wendt 1991, S. 12). Jede Einzelperson hat in ihrem Alltag
die unterschiedlichsten Aufgaben zu erledigen (Haushaltsführung, Pflege sozialer Kontakte
etc.) und leistet dort mehr oder minder erfolgreiches "Selbst- oder Lebensmanagement (life
management)" sowie "Alltagsmanagement". Bei sozialen oder gesundheitlichen Krisen ist
über das Alltagsmanagement hinausgehend "Krisenmanagement" gefordert (Wendt 1997, S.
43 ff).
Case Management hat nach Wendt in und mit diesen beiden Systemen zu agieren (1991, S. 12 f).
Es "..... beansprucht beide, den sozialen 'Betrieb' und die Verantwortung, in der jeder Mensch
sein eigenes Leben lebt und zu gestalten hat" (1991, S. 14).
Case Management habe es mit Menschen zu tun, die Schwierigkeiten in diesen beiden Systemen
haben und trägt "der Defizitsituation Rechnung, indem es um Ausgleich, neue Einbindung und
um individuell angemessene Bewältigungsmuster besorgt ist" (1991, S. 14).
Die Idee der beiden zu verknüpfenden Systeme stammt von Lowy (1988):
Klient-(Patient)System
Ressourcen- (Hilfe)System
Einzelne Menschen und Gruppen mit
Problemen/ in Notlagen/ Belastungen
Soziale Umwelt, Mitmenschen (Familie,
Freunde, Kollegen usw.), natürliches
Netzwerk und professionelle
Einrichtungen (institutionelles
Netzwerk)
Was soll erreicht werden?
Was haben sie zu bieten?
Wie können diese beiden Systeme
(zeitlich, räumlich, kompetent)
bestmöglich zusammen gebracht werden?
(Lowy 1988, S. 34)
Dieser Ansatz geht davon aus, dass sich die Angebote im sozialen Bereich stark differenziert
haben (große Anzahl von Angeboten; Unübersichtlichkeit für die KlientInnen). Hieraus ergibt
sich dann auch die eigentliche Aufgabe des Case Managements, nämlich das Hilfesystem für die
KlientInnen zugänglich zu machen. Als (ökonomisch) sinnvoll wird eine Kooperation der vielen
Dienste und Stellen erachtet, die aber eigens koordiniert werden muss. Das Case Management
hat sich nach Wendt dem Zusammenhang zu widmen, der durch die Aufsplitterung und Spezialisierung der Dienste zerrissen worden ist und auf Grund dessen die meisten Bedürftigen sich die
für sie richtige Mixtur an Hilfen nicht mehr selber zusammenstellen könnten (Wendt 1991, S. 16
ff).
Die Entstehung des Case Management wird mit Deinstitutionalisierungstendenzen bei Sozialen
Diensten in Verbindung stehend gesehen (Entstehung des Case Managements in den USA insbe-
14
sondere bei Öffnung geschlossener Einrichtungen) (vergl. Raiff/ Shore 1997, S. 18f; vergl.
Wendt 1997, S. 14f). Auch für Deutschland können immer mehr ambulante Angebote (weniger
Heimunterbringung von Kindern, weniger stationäre Hilfe für alte Menschen, psychisch Kranke
etc.) konstatiert werden. Diese nun nicht mehr quasi automatisch von auf stationäre Angebote
hinauslaufenden Strategien erfasste Menschen haben einen erhöhten Orientierungsbedarf
undurchsichtigen Gestrüpp der Angebote des psychosozialen Bereichs.
Bei den Deinstitutionalisierungstendenzen scheint wiederum die Verbindung
Effektivitätserhöhung bei den Maßnahmen und Effizienzüberlegungen durch.
von
"Sozialpolitiker verknüpfen die Deinstitutionalisierung überall mit der
Vorstellung, mit diesen ambulanten Arrangements mehr Nutzen zu stiften
und die Kosten senken zu können. Case Management schien unter dem
Vorzeichen angebracht, nicht nur für eine bedarfsgerechte Versorgung
der Klienten, sondern auch für einen ökonomisch vertretbaren Mitteleinsatz passend zu sein. Informelle Hilfe durch Freunde, Verwandte und
Nachbarn ließ sich einbeziehen und die Eigenleistung der Klienten
optimieren. Schließlich war das neue Verfahren auch dafür gedacht,
Reibungsverluste zwischen den Diensten zu vermeiden, sie vielmehr
zweckmäßig zu koordinieren." (Wendt 1991, S. 19)
Im us-amerikanischen Case Management scheint diese Verbindung eine Selbstverständlichkeit
zu sein. „Service effectiveness“, service efficiency“ und
„cost-effectiveness” sind
selbstverständliche, die Praxis bestimmende Bestandteile des Case Managements (Weil/ Karls,
zit. n. Klug 2002, S. 39).
3.3. Kontextualität
Die Case ManagerIn agiert nach diesen Vorstellungen als "AgentIn"3 der verschiedenen beteiligten Kontexte (Dienstleistungs-/ KlientInnensystem). "Die Integration von Lebenszusammenhängen und die Integration von Systemzusammenhängen und die Beziehung beider aufeinander"
ist unter dem Schlagwort Kontextualität zu verstehen (1991, S. 21). Die Case ManagerIn stellt
"das menschliche Bindeglied zwischen dem Klienten und dem Dienstleistungssystem" dar
(Intagliata, zit. n. Wendt 1997, S. 40).
Ein Problem besteht selbst nach Wendt darin, dass die beiden Kontexte des Case-Managements
nur schwer miteinander zu vergleichen sind (vergl. 1991, S. 20). Hier ist sicher auch eines der
größten Praxisprobleme dieses Konzeptes zu sehen. Beide Kontexte sind nicht nur schwer
miteinander zu vergleichen, sie sind auch für die als Case ManagerIn agierende SozialarbeiterIn
für eine Bearbeitung und Veränderung unterschiedlich schwer zugänglich. Das von Wendt
sogenannte institutionelle System ist gekennzeichnet durch juristische und administrative
Vorgaben, die von einer Case ManagerIn nicht einfach so gehandhabt werden können. Wenn der
Case Manager erkennt, dass eine Familie mit dem Regelsatz ihrer Sozialhilfe nicht auskommt,
wird er an den institutionellen Systemvorgaben auch dann nichts ändern können, wenn er eine
Änderung für noch so sinnvoll halten würde. Will er im Fall nicht völlig einflusslos werden,
dann wird höchstwahrscheinlich beginnen, im "individuellen System" Veränderungen zu
erwirken, die aber sehr schnell als Anpassungsleistungen der betreffenden KlientIn sichtbar
werden dürften. Der Hauptangriffspunkt der Intervention der SozialarbeiterIn wird also auch
hier, wie z.B. im systemischen Denken von Florence Hollis, bei den Betroffenen selbst liegen.
3
AgentIn ist hier im Sinne von VermittlerIn zu verstehen.
15
Abb.:
Gesellschaft mit ihrem Stand des normativen Diskurses
Rechts- und Verwaltungssystem
Zur Lebensbewältigung nutzbare Systeme
System
Sonstige
Case
Sozialer
zur
Manag
Dienstle
Lebensbew
erIn
istungen
ältigung
notwendige
Systeme
KlientInnensystem
Informelles System der
KlientIn
Familie/ Nachbarschaft/
Peers/ Vereine etc.
Case Management hat nach Wendt von der "aktuellen Lebenslage" auszugehen: "In ihr ist der
Bedarf an Unterstützung in dem doppelten Sinne 'auszumachen', daß er zunächst geklärt und
dann vereinbart wird" (1991, S. 21; Hervorh. GG). "Beides bedeutet ein Sich-Einlassen auf die
subjektive Verfassung und auf objektive Bedingungen, auf den Willen der betroffenen und
beteiligten Menschen und auf verfügbare oder zu erschließende Vermögen" (1991, S. 21).
Bezug wird also auch auf die Gemeinschaft genommen. Dies hat mit dem Postulat des Haushaltens zu tun (ökosoziales Paradigma) (vergl. 1991, S. 21 f).
"Sozialarbeit laboriert ausdeutend, planend, arrangierend, ändernd an diesem
Kontext und zieht dazu das eigene Bewältigungsverhalten von Klienten und
anderen 'Insidern' heran. Deren Tätigkeit wird in die Unterstützung, die erzeugt
werden soll, verstrickt. ..... Andererseits wird das System der Dienste durch
Case-Management für den Einzelfall auch aufbereitet" (1991, S. 22).
Case Management "befähigt und ermöglicht: Klient, seine Umgebung, die sozialen Dienste"
(1991, S. 23). Es zielt auf den "Zustand des ganzen Sozialraums, in dem der Hilfebedürftige lebt"
(1991, S. 22).
Prinzip ist dabei, dass mit den im Sozialraum vorhandenen "Unterstützungs- und Bewältigungsressourcen" ökologisch (haushaltend) umgegangen wird. Die individuellen Ressourcen, die
der näheren Umgebung und die der sozialen Institutionen werden so genutzt, daß sie nicht überbzw. unterfordert werden und möglichst große Effektivität und Effizienz erreichen. Die
Variationsbreite in Quantität und Qualität eines sozialen Bewältigungsgeschehens ist groß (vergl.
1991, S. 23 f).
"Als Prozeß läuft das Unterstützungsmanagement in mehreren Schritten oder
Phasen ab. Deren Einteilung folgt generell dem Schema des Managements von
Produktionsvorgängen ..... Die Analogie in der Gestaltung eines betrieblichen
16
Produktionsprozesses und in der Gestaltung von Lebenssituationen und abläufen ergibt sich einfach aus der Tatsache , daß hier wie dort eine Mehrzahl
von Personen beteiligt ist (mit denen Ziele zu vereinbaren und Aktivitäten
abzustimmen sind) und im Problemlösungsprozeß eine komplexe, Zeit
beanspruchende Umformung erfolgt" (1991, S. 25).
Hier wird deutlich die Übertragung von ökonomischen Prinzipien auf das individuelle Gestalten
von Leben sichtbar.
Daneben wird bei genauerer Betrachtung der Gedanken Wendts auch deren Problematik
sichtbar. Als eine zentrale Idee für die Durchführung des Case Managements wird die
Budgetierung (Budgetverwaltung) beschrieben. Dahinter steht eindeutig der Gedanke der
Effizienzerhöhung der aufgewendeten Mittel für den Hilfeprozess. Wendt spricht von "mehr
Klarheit über die Kosten" "auf der Nutzer- und der Anbieterseite" durch "eine freiere Disposition
in der sozialen Unterstützung".
"Der Klient kann eher eigenen Prioritäten folgen und gemeinsam mit dem
Kostenträger beziehungsweise dem Case Manager die Leistungen
absprechen, derer er bedarf. Wenn die so bestimmten Leistungen dann
ausgeschrieben werden, so daß um ihre Erbringung Anbieter sich in
Konkurrenz untereinander bewerben müssen ....., kommen die Gesetze
des Marktes zum Zuge. Für diesen Zweck sind allerdings genaue
Leistungsbeschreibungen und Standards erforderlich, welche die Angemessenheit von Angeboten zu bewerten erlauben." (1991, S. 44).
Wendt sieht so die Verantwortung der hilfebedürftigen Einzelpersonen und Familien und der
SozialarbeiterInnen für finanzielle Mittel gefördert. Letztendlich dürfte sich hier aber ein
Druckmittel gegen die Betroffenen entwickeln, um "Mitarbeit" zu sichern. Verweigerung oder
Kürzung von Leistungen und Hilfemaßnahmen kann diesen Vorstellungen nach leicht mit
mangelnder Bereitschaft der KlientInnen, sich zu engagieren, legitimiert werden:
"Im Einzelfall ..... besteht durchweg eine Wechselbeziehung zwischen
ausgewiesener Bedürftigkeit, Lebensweise und Lebensführung. Dieser
Komplex verdient eine ungetrennte soziale Bearbeitung. ..... Ein
Unterstützungsbetrag ist immer eine relative Größe; der Unterstützte hat
mit dem Geld auszukommen. ..... Zumindest bei Multiproblemfamilien
und im Rahmen einer Hilfeplanung sind finanzielle Einzelleistungen
kritisch in ihrem Einfluß auf die ganze Lage und Entwicklung zu sehen.
Die Bereitschaft von Klienten zur Mitwirkung etwa an einem Wandel in
der Familie und im persönlichen Verhalten steigt oder fällt mit den fühlbaren finanziellen Konsequenzen" (1991, S. 45).
3.4. Verlauf des Case Management-Prozesses
Wendt stellt in seinen Schriften zum Thema eine Reihe von Phasen, Funktionen oder auch
Dimensionen beim Prozess des Case Managements dar. Häufig zitiert wird die von Wendt
angeführte Einteilung von Moxley, aus der fälschlicherweise immer wieder 5 Phasen des Case
Managements abgeleitet werden, obwohl es sich vielmehr um Funktionen handelt:
"(a)
(b)
(c)
(d)
'assessment' (Einschätzung, Abschätzung),
'planning' (Planung),
'intervention' (..... 'Durchführung' .....),
'monitoring' (Kontrolle, Überwachung),
17
(e)
'evaluation' (Bewertung, Auswertung)" (1991, S. 25 f;
1997, S. 97).
Der Intension, den Verlauf eines Case Managements zu beschreiben, entspricht besser die
Einteilung von Wendt (1997):
Reichweite und Veranlassung, Assessment, Zielvereinbarung und Hilfeplanung, Kontrollierte
Durchführung, Evaluation, Rechenschaftslegung (S. 102-133). Im Folgenden deshalb die
wichtigsten Aussagen zu den eizelnen Schwerpunkten des methodischen Vorgehens im Case
Management.
3.4.1. Einstieg in das Case Management
Hier stellt sich die Frage, wie der Dienst, der Case Management anbietet an seine KlientInnen
kommt bzw. die Betroffenen den Status einer KlientIn des Case Managements zugewiesen
bekommen..
Wendt bringt in diesem Zusammenhang drei Aspekte ins Spiel: "(1) outreach: wohin der Dienst
reicht, (2) access: wie der Zugang zum Dienst gestaltet ist, (3) intake: die Aufnahme einzelner
Personen, ihre Identifikation als Klienten oder Patienten" (1997, S. 102).
Zu diesen Punkten wird im Grunde nicht viel Neues gesagt. Die Aussagen zur
Zugangsgestaltung unterscheiden sich nicht von denen in der Sozialen Arbeit mit Einzelnen und
Familien immer schon diskutierten Punkten (vergl Wendt 1997, S. 104; vgl. hierzu die
Überlegungen zum "äußeren Bedingungsgefüge in dieser Abhandlung).
Eine Abgrenzung zum herkömmlichen Vorgehen in der Sozialen Arbeit stellt die ausdrückliche
Betonung von Öffentlichkeitsarbeit dar, um den Dienst bei den potenziell Betroffenen bekannt
zu machen. Hier kommt auch ein mit ökonomischen Überlegungen in Verbindung stehendender
Präventionsgedanke ins Spiel (vergl. Wendt 1997, S. 104 f). Weiters zu erwähnen ist der offen
ausgesprochene Gedankae des "screenings", der Auslese der KlientInnen. Es muss überprüft
werden, "ob der Status (die Berechtigung) und die Situation einer Person zu der möglichen
Dienstleistung passen. Es erfolgt also eine Zugangskontrolle" (Wendt 1997, S. 105). Kritisch
angemerkt werden kann hier, dass diese Auslese nur dann Sinn macht, wenn entweder genügend
Alternativangebote für die Problematik des Betroffenen vorhanden sind (die Suche danach wäre
ja gerade Aufgabe eines Case Managements) oder die persönliche Gestaltung des Zugangs sich
so darstellen würde, dass ein Einbeziehen der Betroffenen im Sinne eines
Aushandlungsprozesses gegeben wäre.
Ob so ein Aushandlungsprozess das sog. "intake", die eigentliche Fallaufnahme prägt, ist eher
fraglich. Identisch mit einem so weit gefassten intake sind die Vorstellungen von Splunteren:
"1. Der Helfer informiert den Klienten über die Aufgabe und
Arbeitsweise der Institution.
2. der Helfer entwirrt mit dem Klienten die Problematik und
entscheidet danach, ob die Institution in seinem Fall ein
Hilfeangebot machen kann" (zit. n. Wendt 1997, S. 106).
Eine so weit gefasste Fallaufnahme stellt einen fließenden Übergang zum nächsten Station eines
Verlaufs eines Case Managements, dem Assessment, dar.
Die Praxis wird wahrscheinlich, auch unter der Perspektive von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
so aussehen, dass eine eher strikte Zugangsgestaltung betrieben wird. Der Grundgedanke ist ja
gerade der, dass keine zeitaufwändigen und teureren "Versuche" der Fallbearbeitung betrieben
werden sollen. In der Praxis werden also eher standardisierte Gespräche und Fragebogen das
18
Geschehen bestimmen.
Am Ende dieser Einstiegsphase in das Case Management soll dann die KlientIn "engagiert", "das
heißt: aktiv in den beginnenden Prozeß ihrer Beratung, Unterstützung oder Behandlung
einbezogen" werden Dabei soll auf Transparenz geachtet werden, der betreffenden Person genau
erläutert werden, was sie im beginnenden Case Management-Prozess erwartet (Wendt 1997, S.
106). Das nun anschließende
3.4.2. Assessment
meint nun die"sorgsame Einschätzung der Lage im Einzelfall und die Abschätzung der den
Umständen nach angebrachten Hilfemöglichkeiten" (1991, S. 27; vergl. 1997, S. 108).
Assessment unterscheidet sich dem Anspruch nach stark von herkömmlicher Diagnose:
Während in der Diagnose Krankheiten, Schwächen, Störungen festgestellt werden, besteht das
"Assessment als Einschätzung in einer Sondierung der Stärken wie der Schwächen, der Aktiva
wie der Passiva eines Menschen und seines ganzen Lebenszusammenhangs" (wie bei "Veranlagung" im finanzwirtschaftlichen Sinn) (1991, S. 27). Es würde zwar nicht völlig auf
herkömmliche diagnostische Feststellungen verzichtet, im Assessment kämen aber "bei dessen
ganzheitlicher Orientierung auch die Stärken einer Person zur Sprache". SozialarbeiterInnen
unterschätzten regelmäßig das "Potential an Selbsthilfe bei ihrer Klientel". "Es müssen deshalb
auch die Kriterien gelten, nach denen der Klient sein Handlungsvermögen beurteilt" (1997, S.
110).
Die soziale Einschätzung stelle ein Unternehmen dar, in dem sich Sozialarbeiter in die
Lebenswelt von Klienten begäben, um sich mit ihnen zu beraten. Die Sichtweisen der Klienten
seien gleichberechtigt mit fachlichen Sichtweisen. Aktive Mitwirkung des Klienten sei dabei
geboten. Expertenurteile verböten sich: "Gemeinsam muß herausgefunden werden, welche
Probleme vorhanden, wie sie im Kontext der individuellen Situation zu werten sind und was
getan werden kann, um das eine oder andere Problem zu lösen" (1991, S. 27 f).
Ganz zu trauen scheint Wendt diesem emanzipatorischen Postulat aber dann doch nicht: "Es
hängt mit seinem Urteilsvermögen zusammen. Ihn darin zu bestätigen und zu bestärken, ist
solange angebracht, wie es nicht gerade objektiv zu Fehlurteilen führt und vorhandene
Fähigkeiten in Abrede stellt" (1997, S. 110).
"Am Ende steht ein Übereinkommen zwischen dem Case Manager und dem Klienten, was zu
tun ist". "Der Gegenstand der Einschätzung ist aus ökosozialer Sicht die ganze Lebenslage des
Klienten, wozu auch Aspekte der überindividuellen sozialen Lage (z.B. auf dem Arbeits- und
Wohnungsmarkt) gehören ....." (1991, S. 28).
Zur Sprache müssten dabei 4 Dimensionen einer Lebenslage kommen: Lebensgeschichte, äußere
Lebensbedingungen, Lebensperspektiven (Ambitionen), innere Lebensbedingungen (im gesundheitlichen und psychischen Status) (1991, S. 28; vergl. 1997, S. 113, wo Wendt die Dimensionen
der Lebenslage mit Lebensgeschichte/ Biographie, Lebensentwurf/ Perspektiven, Außenwelt/
Sozialraum und persönliche Disposition/ Innenwelt umreißt). "Die vier Dimensionen .....
schneiden sich im gegenwärtigen Status einer Person und bilden zusammen die subjektive und
objektive Lebenslage des Individuums ..... . Über sie sammelt der Professionelle im Assessment
im ersten Schritt Informationen und analysiert diese in einem zweiten Schritt - allein für sich, im
Team und gemeinsam mit der Person oder der Familie, der sozial oder gesundheitlich geholfen
werden soll" (1997, S. 114). Eigentlich tut sich bei solchen Bemerkungen ein Widerspruch auf.
Die komplette Erfassung der Lebenslage einer Person wird kaum gelingen, wenn nicht mit einem
enormen Zeitaufwand gearbeitet wird. Die Abgrenzung vom Diagnostizieren und vom
19
therapeutischen Charakter des Vorgehens wird noch schwieriger, wenn davon ausgegangen wird,
dass ein Assessmernt nicht selten "zur Selbstklärung einer Person in ihrer Situation (führt) und
damit schon zu einer Problemlösung" (1997, S. 114). Wendt versucht dieses Ausufern zu
vermeiden, indem er bemerkt, dass "(b)ei der Vielfalt dessen, was in einem Einschätzungsprozeß
zur Sprache kommen kann, ..... anfangs oder beim Fortschreiten im Assessment eine Auswahl
getroffen werden (muß). Prioritäten sind zu setzen. Dazu hält man sich an den Bedarf. Wie aber
ist er näher zu bestimmen?" (1997, S. 114). Die Antwort auf diese Frage bleibt Wendt
weitgehend schuldig bzw. erklärt schwammig: "Was nötig ist, zeigt sich immer in einem
Bezugsrahmen, in einem engeren subjektiven Horizont und in intersubjektiven, kulturellen und
gesellschaftlichen Horizonten ..... . Die Professionellen beziehen sich auf sie und verweisen ihre
Klienten auf den Rahmen, in dem ein Bedarf besteht oder etwas zu tun nötig ist" (1997, S. 115).
"In der Breite der Person-Umwelt-Bezüge sind unter anderem die Erwerbsarbeit (und mit ihr die
finanzielle Situation des Klienten), das Wohnen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die
Freizeitgestaltung, auch Bildungs- und kulturelle Bezüge (im Lebensstil) wichtig, und zwar nicht
einfach nebeneinander, sondern in der gegenseitigen Durchdringung, in der sie für eine Person
oder Familie problematisch oder belastend oder auch förderlich sein können" (1991, S. 28).
"Im Case Management geht es nicht um die Einschätzung der Person abgesehen von ihren
Lebensumständen, sondern um die Einschätzung einer persönlichen oder familiären Situation mit
ihren Kontexten" (1991, S. 29).
"In der Praxis erfolgt die Einschätzung der Lage in einer Reihe von Gesprächen mit dem
Klienten und seinen Angehörigen, fortgesetzt unter den Mitarbeitern in einem Team und mit
beteiligten oder einzubeziehenden anderen Dienststellen" (1991, S. 29). Hier ist wieder darauf
hinzuweisen, dass die Case ManagerIn kaum in der Lage sein wird, auf die Breite der "PersonUmwelt-Bezüge" gleichmäßig Einfluss zu nehmen. Erwerbsarbeit, Wohnen etc. werden sich
regelmäßig ihrem Einfluss entziehen, so wird der Schwerpunkt der aus dem Assessment
resultierenden Überlegungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen sich ansiedeln.
3.4.3. Planung
"(ist) im Kontext von Case Management ..... ein systematischer Prozeß, in dem bedeutsame
Ziele identifiziert und Aktivitäten und Dienstleistungen entwickelt werden, die zu den identifizierten Zielen hinführen" (Moxley, zit. nach Wendt 1991, S. 30).
Es wird betont, dass Planung immer an die Lebensplanung der KlientInnen anschließen, zu deren
Lebensplanung "komplementär" sein soll (Wendt 1997, S. 190; vergl 1991, S. 31). Dies sollte in
der Sozialen Arbeit eigentlich selbstverständlich sein, stellt aber ein ganz wesentliches
Praxisproblem dar. Nicht selten geht der Bezug zwischen der Lebenswelt der KlientInnen und
den Planungen der mit deren Problemen befaßten SozialarbeiterInnen verloren. Im Case
Management von Wendt wird dieses Problem aber weniger von seiner emanzipatorischen Seite
beleuchtet, sondern in Bezug auf die Effektivität der Hilfen. Wenn schon im Assessment auf die
ganz persönlichen Perspektiven der Betroffenen geachtet werden muss, dann deshalb, weil
"Maßnahmen, die den eigenen Lebensentwurf eines Menschen durchkreuzen, ..... seinen
Widerstand heraus (fordern) oder ..... unwirksam (bleiben), weil er sie nur passiv oder unbeteiligt
hinnimmt. Der Effekt von Hilfen bestimmt sich nach ihrer Einpassung in die soziale, psychische
und physische Disposition des Menschen, also zuallererst danach, wie er disponiert." (Wendt
1997, S. 119).
Planung hat operativ zu sein, d.h. es soll festgelegt werden, wie die Hilfe im einzelnen Vorgang
für Vorgang vonstatten gehen soll. Sie muss "mit einer Verständigung über Ziele, die verfolgt
20
werden sollen", beginnen. "Verabredungen über die Aufgabenverteilung" beinhalten und mit
"Entscheidungen" schließen. "Der Hilfeplan als Schriftstück dokumentiert, wovon in der Planung
ausgegangen wurde, zu welchen Feststellungen die Beteiligten gekommen sind und was
verabredet, vereinbart oder vorgesehen wird". Nach Wendt soll eine "gute Dokumentation des
Weges im Case Management" letztendlich zu einer "juristischen Überprüfbarkeit" führen (Wendt
1991, S. 30f; 1997, S. 119-121).
Planung müsse auch strategisch sein, "in einer komplexen, sich ständig verändernden Umwelt
gewählte Ziele schrittweise anzustreben. Es gilt, sich aktiv der Varietät der Bedingungen anzupassen". "Eine praktische Konsequenz ist, daß die Planung als ein Prozeß wiederholt stattfinden
muß, wobei kurzfristige Verabredungen jeweils neu mit mittelfristigen und längerfristigen
Dispositionen abzugleichen sind" (Wendt 1991, S. 31). Hier stellt sich allerdings die Frage nach
der Sinnhaftigkeit eines solchen Vorgehens. Wenn ein dokumentierter Hilfeplan sogar zur
juristischen Überprüfbarkeit führen soll, dann kann es nicht sein, dass die Inhalte der
Beliebigkeit unterworfen sind. Hier kann es sehr schnell zu den selben Problemen kommen, die
den Begriff der (offenen) Diagnose in der Sozialen Einzelfallhilfe so suspekt und angreifbar
gemacht haben. Es stellt sich eben auch in Bezug auf das Case Management die schwer zu
beantwortende Frage, inwieweit das Leben eines Menschen überhaupt planbar ist. Die
methodischen Probleme des Versuchs etwas eigentlich nicht (zumindest nicht langfristig)
planbaren der Planung unterwerfen zu wollen, werden von Wendt jedenfalls nicht gelöst.
"Dem Case Manager obliegt speziell die operative Detailplanung der Unterstützung". "Der
Aktionsplan der Unterstützung weist aus, wer was wann in welchem Umfang zu tun hat". Als
Varianten der Planung im Case Management sieht Wendt "die Erziehungsplanung im Rahmen
der Kinder- und Jugendhilfe, die Therapieplanung bei Einsatz von psychologischen und
medizinischen Heilverfahren, die Rehabilitationsplanung in der Eingliederungshilfe für
Behinderte" (Wendt 1991, S. 31). Bedeutendstes Beispiel für die Praxis sei der Hilfeplan nach §
36 KJHG (Wendt 1991, S. 32; vergl. 1997, S. 121 ff). "Planung ist in allen Bereichen der
sozialen Arbeit ein Prozeß und in ihren Festlegungen, dem Plan, ein Produkt"
(Widersprüchlichkeiten siehe oben - G.G.). Verbindlich wird das im Vorgang vereinbarte für alle
Beteiligten durch den Kontrakt (1991, S. 32).
Die Ausführungen zum Thema Planung im Case Management bei Wendt machen den Eindruck,
als würde alles, was in der Sozialen Arbeit an Planung entwickelt worden ist, sich mühelos in die
Überlegungen zum Case Management einpassen lassen. Planung ist sicherlich ein wichtiges
Praxisthema für die Soziale Arbeit, mit ihr wird insbesondere mehr Transparenz geschaffen, die
eine wichtige Schutzfunktion für die KlientInnen darstellt. Planung hat aber auch eine nicht ganz
unproblematische Seite, nämlich die, dass offene Prozesse standardisiert und bürokratisiert
werden. Die Klagen von MitarbeiterInnen in Allgemeinen Sozialdiensten über mehr Bürokratie
seit Einführung der Hilfeplanung müssen hier zumindest zu denken geben. Darüber hinaus darf
die Gefahr nicht übersehen werden, dass Planung auch zum Selbstläufer werden kann, dass
übersehen wird, dass individuelles Leben nun einmal nicht planbar ist und von vielen
Zufälligkeiten und Unwägbarkeiten abhängt. Hier wird deutlich, dass das uralte
sozialarbeiterische Problem Alltagsorientierung oder Individualisierung mit mehthodischem
Handeln, also Planung zu vermitteln. Die Überlegungen im Case Management bedeuten
jedenfalls zum heutigen Zeitpunkt keinen Fortschritt.
3.4.4. Durchführung des Case Managements
Wie schon bei der Planung betont, arbeitet Case Management "in unmittelbarer Beziehung zur
21
Lebensgestaltung des oder der Klienten sowie in der Steuerung der Unterstützung in der
relevanten Umwelt und der administrativen Strukturen" (1991, S. 33). Wesentlich neu im Case
Management ist, dass in diesem Konzept die als Case ManagerIn tätige SozialarbeiterIn einzelne
Hilfen oder Behandlungen nicht selbst erbringt. "Es führt sie zusammen, koordiniert sie und
lenkt ihren Ablauf in der Phase der Umsetzung (Implementation) des Hilfeplans" (1997, S. 124).
Im Case Management nach Wendt ist die SozialarbeiterIn also so etwas wie eine
"ObersozialarbeiterIn", deren Hauptaufgabe in der Kontrolle und Überwachung, dem
Monitoring besteht. Dieses wird von Wendt für wichtig gegenüber dem Klienten gehalten, als
auch "gegenüber den informellen und formellen Helfern bzw. dem System ihres
Zusammenwirkens ....." (1991, S. 35).
Es handelt sich dabei um "Ausführungskontrolle, die sichern soll, daß die vorgesehene
Unterstützung bzw. Bewältigung tatsächlich erfolgt. 'Monitoring' schließt Prüfung, Revision, Informationsverarbeitung und Berichterstattung ein" (1991, S. 35). Kontrolle müsse von den
Beteiligten akzeptiert werden.
Formelle Protokolle werden als Instrumentarium des monitorings angesehen: z.B. Erziehungsoder Entwicklungsberichte, Behandlungs- und Bewährungshilfeberichte (vergl. 1991, S. 35;
vergl. 1997, S. 125).
Kontrolle diene auch der "Durchsetzung von Ansprüchen des Klienten gegenüber dem
Gemeinwesen".
Hier wird von Wendt der Begriff des advocacy eingeführt: Der Case Manager übersetzt "als Anwalt und Sachwalter" die Interessen des Klienten "aus dem subjektiven Horizont der Lebenssituation in den Horizont des Dienstleistungssystems, der politischen Parteien und der Pressuregroups sowie der Entscheidungsgremien" (1991, S. 36; vergl. 1997, S. 124 ff)).
"Dem Monitoring auf der Ebene des Einzelfalls entspricht auf der betrieblichen Ebene das
Controlling. Dies ist die Servicefunktion, die in einem komplexen System die Abstimmung des
vielfältigen Geschehens in ihm aufeinander (der Teilfunktionen auf die Funktion des ganzen
Systems) beobachtet und im System rückmeldet, insbesondere das Management informiert"
(1997, S. 125).
3.4.4.1. Funktionen des Case Managers
sind für Wendt abhängig "vom Fall" und vom "System der formellen Dienstgestaltung, in die er
eingebunden wird" (1991, S. 33). Die Managementfunktion müsse getrennt sein von
Therapeutenfunktion. Die beiden Funktionen würden sich gegenseitig stören (vergl. 1991, S. 33).
"Jedoch paßt sich die Unterstützung in ihrer Durchführung in das individuelle Bewältigungsverhalten ein und nimmt mithin Einfluß auf die Lebensgestaltung. Insoweit und ab einem
Mindestmaß an Kommunikation mit dem Klienten erfüllt der Case Manager auch einen direkten
Dienst" (1991, S. 33).
Moxley (zit. nach 1991, S. 33 f) unterscheidet:
direkte Dienstleistungsfunktion
(mit abnehmender Direktivität)
- Case Manager als "implementer" (nimmt Sache in die Hand)
- Case Manager als "Lehrmeister oder Instrukteur"
- Case Manager als "guide" (beratender Begleiter)
- Case Manager als "processor" (als eine Art technischer Assi-
22
stent des Klienten)
- Case Manager als "Spezialist für Informationen über das
Dienstleistungssystem"
- Case Manager als "supporter" (motiviert Klienten zur Eigenbefähigung)
indirekte Dienstleistungsfunktionen
(im sozialen Umfeld und im administrativen System)
- "Vermitteln von Diensten und anderen Ressourcen"
("brokering")
- "Überweisung der Klienten an Dienste und Einrichtungen"
- "Koordinieren von Dienstleistungen"
- "Anwaltliches Handeln für Klienten beim Korrigieren
mangelhafter oder unpassender Dienstleistungen ('advocating')
- "Knüpfen sozialer Netze"
- "Bereitstellung technischen Beistandes und Rates"
Wendt spricht davon, dass die Case ManagerIn, je nachdem, wer sie einsetzt und damit bezahlt,
unterschiedliche Rollen annehmen kann: "die Rollen
(1)
(2)
(3)
(4)
des Systemagenten
des Kundenanwalts
des Versorgungsmanagers und
des Dienstemaklers" (1997, S. 145).
Die Sozialarbeiterin wird nach dieser Auffassung zu einer DienstleisterIn, die ihre vielfältigen
Fähigkeiten und Kenntnisse in den relevanten Systemen anbietet, um je nach Perspektive des
Kunden das effektivste und effizienteste Ergebnis zu erreichen.
In der Rolle des "Systemagenten"
"..... übernimmt (in einer Variante) der Case Manager vor
allem Informations- und Vermittlungsaufgaben: Da der
einzelne Kunde sich mit der Leistungspalette des Anbieters
nicht auskennt und sie deshalb nicht ohne weiteres für sich
sinnvoll nutzen kann, bietet ihm der Dienstleister eine
Beratung an. In einer anderen Variante begleitet der Case
Manager den Leistungsnehmer auf seinem Weg durch die
Stationen seiner Versorgung. Der Case Manager ist dann im
Medizinsystem
als
Patientenbegleiter
oder
als
Rehabilitationsbetreuer,
im
Jugendhilfesystem
als
sozialpädagogischer Einzelbetreuer oder ifm Justizsystem
als Bewährungshelfer tätig" (Wendt 1997, S. 146).
Ein typisches Beispiel für die Case ManagerIn als KundenanwältIn ist die BerufsbetreuerIn nach
dem deutschen Betreuungsrecht. In diesem Handlungsfeld übernehmen SozialarbeiterInnen und
andere Berufgruppen die Aufgabe einer SachwalterIn auf Zeit für ihre KlientInnen. Ein weiteres
Beispiel für diese Funktion wäre die neuerdings intesiv diskutierte "AnwältIn des Kindes".
In der Funktion als Kundenanwalt steht der Case Manager
"ratsuchenden Bürgern zur Verfügung, klärt mit ihnen den
23
Unterstützungs- und Versorgungsbedarf ab und steht ihnen
bei der Beantragung von Leistungen zur Seite. Er kennt die
Anspruchskriterien und weiß, wie an Behörden und
Versicherungen heranzutreten ist" (Wendt 1997, S. 147).
Als Versorgungsmanager ist der Case Manager
"zuständig für eine ordnungsgemäße und erfolgreiche
Leistungserbringung. Entweder ist er Agent des
Leistungsträgers und von ihm dazu angestellt, die
Angemessenheit des Versorgungsangebots zu beobachten,
die zweckmäßige und kostengünstige Erbringung der
Dienstleistungen zu kontrollieren und Beschwerden der
Klienten nachzugehen. Oder er ist mit diesen Aufgaben in
einem Dienstleistungsbetrieb betraut, fungiert also in ihm als
Qualitätsmanager" (Wendt 1997, S. 148).
Als ein aktuelles Beispiel für Versorgungsmanagement kann uns das Untersuchungsdesign des
Modellversuches zur kontrollierten Heroinvergabe dienen. Dort soll ein Teil der Zielgruppen
psychosoziale Betreuung in Form von Case Management erhalten. Man macht sich in diesem
Praxisprojekt große Hoffnungen über Case Management vorher nicht erreichte Abhängige in das
Drogenhilfesystem einbinden zu können (vergl Bundesministerium für Gesundheit, Institut für
interdisziplinäre Suchtforschung Hamburg 2001, S. 3-5).
Die Aufgaben seien stets in Managementaufgaben auf der "Meso- und Makroebene" von Sozialarbeit eingebunden (Eingebundenheit in Arbeit im Stadtteil etc.) (vergl. 1991, S. 34 f). Daraus
resultiere der Gemeinwesenbezug von Case Management.
"Die Stellung von Case Management zwischen der Ebene
der Wohlfahrtsorganisation und lokalen Sozialpolitik
einerseits und der Ebene selbstorganisierten Lebens von
Einzelpersonen, Familien und Gruppen andererseits wäre
ohne Hinweis auf die horizontale Ausdehnung sozialer
Arbeit unvollständig beschrieben. Bei aller Konzentration
von Case Management auf Problemlagen und ihre
Bewältigung im Einzelfall greift es doch per Vermittlung
und Vernetzung in die weitere Umgebung aus, in der
grundsätzlich eine Mehrzahl von abträglichen und
zuträglichen Bedingungen, von Verführungen und Abhilfen
in der jeweiligen Lage vorhanden sind. Zu 'managen' ist
nicht eine Person, sondern das soziale Feld und der Haushalt
des alltäglichen und des systematisch regulierten Miteinanders unter Beiziehung verschiedener Ressourcen"
(1991, S. 54).
24
3.4.5. Evaluation
Diese "erfaßt die qualitative und quantitative Differenz zwischen der Situation ohne oder vor der
Unterstützung und der Situation mit bziehungsweise nach Hilfestellung" (1991, S. 36).
"Evaluation dient somit der Entscheidungsfindung im weiteren Case Management und seiner
Rechenschaftslegung" (1991, S. 36). Beteiligte Mitarbeiter müssen zu Rate gezogen werden und
die Stellungnahme der Klienten wird eingeholt (1991, S. 37).
Es wird unterschieden zwischen
"input evaluation": Aufwand in Beziehung zum
Erreichten ("die Geldmittel, der Zeitaufwand, die Zahl der
Überweisungen, die Anzahl der betreuten Klienten usw.
schlagen zu Buche");
Prozeßevaluation: Bewährung des Unterstützungsverfahrens im Verlauf; wichtig dabei "linking function
evaluation": "Wieweit gelingt die koordinierende Netzwerkarbeit des Unterstützungsmanagers?" (1991, S. 37);
"outcome evaluation": Konzentration auf Erreichung
der Ziele "sowohl bezogen auf das Ergehen einer Person
nach abgeschlossener Unterstützung als auch gruppen- und
gemeinwesenbezogen" (1991, S. 37).
Eng damit verbunden ist nach Wendt:
3.4.6. Ablösung ("Disengagement")
"Der Effektivität und Effizienz wegen wird mit dem Case Management auch allgemein
beabsichtigt, der Neigung in der Sozialarbeit zu begegnen, sich ohne Ende fortzuzeugen" (1991,
S. 38). Es soll keinen endlosen Einsatz von Sozialarbeit mehr geben, sondern Konzentration auf
die konkreten Unterstützungsmaßnahmen.