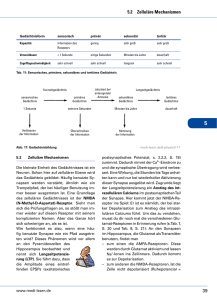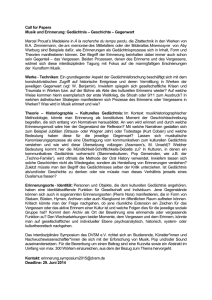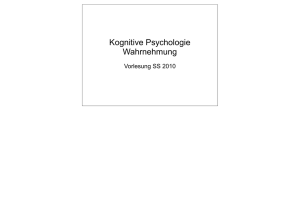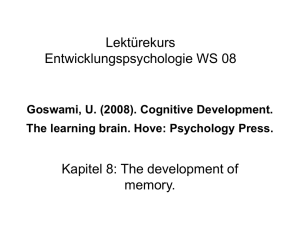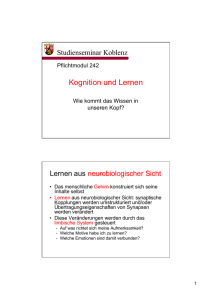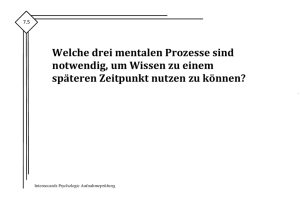2. Wissen erzeugen
Werbung

WISSEN ERZEUGEN KOGNITIONSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN EINER KULTUR DES LERNENS IN DER FRÜHEN KINDHEIT – AUS ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE GERD E. SCHÄFER "Man kann nicht alle geistigen Fähigkeiten, die die Menschheit besitzt, gleichzeitig ausbilden. Man kann nur von einem kleinen Ausschnitt Gebrauch machen, und dieser Ausschnitt ist je nach Kultur verschieden." (Claude Levi-Strauss, Das wilde Denken, 1968, S. 31 Kognitionswissenschaft beschäftigt sich mit drei großen Bereichen: der biologischen, der kulturellen und der individuellen Evolution von Erkenntnis. Der folgende Beitrag befasst sich mit der individuellen Evolution. Er stellt zentrale Modellvorstellungen über den Gewinn von Erkenntnissen in Bildungsprozessen dar, die auf Erfahrungslernen beruhen (1- 3), exemplifiziert einige dieser Überlegungen an einer zentralen Grundlage menschlichen Lernens, dem Gedächtnis (4) und zieht Schlussfolgerungen für ein allgemeines Lernmodell, das auch ohne Bewusstsein funktioniert (5- 6). Sodann werden Überlegungen angestellt, wie aus diesem Modell eines unbewussten, impliziten Anfängerlernens spätere, kulturell geprägte, Denkstrukturen hervorgehen (7 – 8) um schließlich anzudeuten, inwiefern ein solcher Entwicklungsprozess zu seiner Ausbildung und Förderung einer Kultur des Lernens bedarf. Diese Prozesse zu begreifen ist vor allem wichtig, um nachzuvollziehen dass junge Kinder einerseits großartige Lerner sind, sich aber in den ersten Lebensjahren zunächst nicht und dann auch erst allmählich des Bewusstseins und seiner Denk- und Lernmöglichkeiten bedienen. Gleichzeitig formuliert sich daraus die zentrale Frage frühkindlicher Bildung: Wie kommen junge Kinder von einem impliziten Lernen, in welchem das Bewusstsein allenfalls eine „auftauchende“ Rolle spielt, zu einem expliziten Lernen über Bewusstseinsprozesse, von einem anfänglichen Lernen, für das Kinder bereits weitgehend ausgestattet sind, zu einem kulturellen Lernen? Welche Rolle spielen dabei soziale und kulturelle Prozesse? 1. KOGNITIONSWISSENSCHAFT UND ERFAHRUNGSLERNEN Es ist ein Ergebnis kognitionswissenschaftlicher Zugangsweise, Denken und seine Entstehung, Lern- und Bildungsprozesse als komplexe konstruktive Prozesse anzusehen, die auch nicht mehr von einer Leitwissenschaft – z.B. der Entwicklungs- oder Lernpsychologie – angemessen beschrieben werden können, sondern ein interdisziplinäres Forschungsvorgehen notwendig machen. Gerade dieses interdisziplinäre Vorgehen wurde zu einer zentralen Grundlage der Kognitionswissenschaften. Nur so können unterschiedliche Wissenschaftsbereiche wie Evolutionäre Anthropologie, Kulturanthropologie, Verhaltens- und Genforschung, Neurobiologie, Linguistik, Informationstheorie, Psychoanalyse, Psychologie kognitiver Prozesse, Säuglings- und Kleinkindforschung – um nur die wichtigsten zu nennen – zusammen gespannt werden. Während diese Disziplinen sich in Einzelfragen vertiefen können, ist die Erziehungswissenschaft gezwungen, diese Aspekte zusammenzudenken und in einen Alltagskontext einzufügen. Ihr kognitionswissenschaftlicher Beitrag – den sie bisher kaum wahrgenommen hat – bestünde darin, zu erforschen (und als pädagogische Praxis zu erproben und zu evaluieren), wie Denken, Lernen oder Bildungsprozesse in komplexen Alltagsprozessen entstehen. Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht bildet Erfahrungslernen in Alltagszusammenhängen in den ersten Lebensjahren das grundlegende Lernen. Dieses Lernen aus Erfahrung benötigt zu seinem Verständnis und zu seiner Unterstützung ein anderes Denkmodell als ein Vermittlungs- und Instruktionsmodell. Ich nenne es ein Emergenzmodell1, das nachzeichnet, wie Kinder ihr Können und Wissen aus ihren Lebenserfahrungen erzeugen. Während das Instruktionslernen seinen Schwerpunkt darauf legt, bereits Bekanntes und Begriffenes weiter zu vermitteln, hat das Emergenzmodell seine Stärke darin, das Entstehen von neuen Erfahrungen zu beschreiben und der pädagogischen Unterstützung zugänglich zu machen. Es macht aber auch deutlich, dass (frühkindliche) Lern- und Bildungsprozesse als Prozesse, in welchen Kinder ihr neues Können und Wissen erzeugen, einer Kultur des Lernens bedürfen. Individuelle, biografische Möglichkeitsstrukturen, geeignete soziale Beziehungen, anregungsreiche und dem kindlichen Vermögen erschlossene Sachfelder, sowie passende institutionelle Rahmenbedingungen sind dabei gleichermaßen verantwortlich, dass qualitativ zureichende Bildungsprozesse entstehen. Im folgenden Beitrag sollen exemplarisch einige Erkenntnisse diskutiert werden. Die pädagogische Ausgangsposition dazu bilden einige Überlegungen zum Zusammenhang von Bildungsprozessen mit einer Kultur des Lernens.2 2. VIER ZENTRALE ASPEKTE VON BILDUNG Lernen ist immer eine Eigentätigkeit des Kindes. Deshalb ist es notwendig, Kinder zum Mittun an ihren Lern- und Bildungsprozessen zu gewinnen. Dieses Mittun der Kinder ist von Belang, weil es die Verbindung von neuem Können/Wissen und den bereits vorhandenen Erfahrungen ermöglicht. Ich versuche, Bildungsprozesse konsequent aus der Perspektive dieser notwendigen Mitwirkung des Kindes an seinem Bildungsprozess zu betrachten, aus der Perspektive ihrer Selbstbildungspotenziale. Unter diesem Begriff werden alle die Möglichkeiten zusammengefasst, die einem Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Biographie als eine individuelle Verbindung von biologischem und kulturellem Erbe zur Verfügung stehen. Diese können jedoch nur im Rahmen zwischenmenschlicher Kommunikation gedacht werden, denn jede Situation, in der ein Kind etwas lernt, ist implizit oder auch explizit eine soziale Situation. Insofern die jeweilige soziale Struktur das Lernen des Kinder unterstützt oder erschwert, muss sie unter dem Aspekt der darin enthaltenen Kommunikationspotenziale pädagogisch und erziehungswissenschaftlich mitgedacht werden. Zum dritten verlaufen Lernprozesse unterschiedlich, je nach den Möglichkeiten, die in der Sache liegen. Jede Sache verlangt eine ihr angemessene Disziplin und eröffnet neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Sie enthält unterschiedliche Sachpotenziale. Schließlich sind diese drei Bezüge immer eingebettet in übergeordnete soziale, institutionelle und gesellschaftliche Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen gehen als Strukturpotenziale, in der Regel implizit, in jeden Lernprozess mit ein. Lern- und Bildungsprozesse sind daher als Konstruktionen zu betrachten, in welchen alle vier Aspekte zusammenwirken. In einer Kultur des Lernens werden sie aufeinander bezogen und abgestimmt. Der Begriff der Potenziale soll den Blick von normorientierten Zielen auf die gegebenen situativen 1 Emergenz bedeutet hervorbringen, auftauchen, sich herausarbeiten. Das Hervorgebrachte ist vorher nicht vorhanden, sondern wird im und durch den Prozess erst erzeugt. 2 Genauer werden diese Zusammenhänge in Schäfer 2010 (a) reflektiert. Möglichkeiten richten. Möglichkeiten orientieren sich an Zielen, ohne diese durchsetzen zu wollen. Stattdessen öffnen sie Handlungs- und Denkspielräume, innerhalb derer man sich in eine gewünschte Richtung fortbewegen kann. Vor dem Hintergrund eines solchen möglichkeitsorientierten Bildungsverständnisses ergeben sich kritische Anfragen an das derzeit in der frühpädagogischen Diskussion vorherrschende, zielorientierte Modell der Vermittlung vordefinierter Kompetenzen. 3. DENKEN IST EIN INTERAKTIVES GESCHEHEN Piaget hat die Entwicklung des Denkens vorwiegend als einen sachverarbeitenden, individuellen Konstruktionsprozess ins Auge gefasst. Ziel war dabei die kognitive Ordnung der Welt. Die Psychoanalyse hat das Denken unter dem Aspekt der psychosozialen Problemverarbeitung untersucht. Ziel dabei war dabei zunächst die Regulation der Emotionen und in späteren Entwicklungen der Psychoanalyse die der Regulation von Beziehungen. In beiden Modellen stand jedoch ein individueller Denk- und Verarbeitungsprozess im Zentrum. Im Rahmen der Kognitionsforschung wurden nun beide zentralen Aspekte – der der Konstruktion und der von Beziehungen – zusammengefügt. Denken wurde zunehmend als interaktives Geschehen zugänglich. Im Folgenden möchte ich die Grundgedanken thesenartig zusammenfassen, die Bildungsprozesse als interaktives Geschehen aus einer kognitionswissenschaftlichen Perspektive kennzeichnen. THESE 1: GEDANKEN WERDEN ERZEUGT Die Kognitionsforschung geht konsequent konstruktivistisch vor. Dabei muss sie – implizit oder explizit, da unterscheiden sich die Autoren – die Trennung zwischen Objekt und Denken aufheben. Es wird nicht über Dinge oder Ereignisse nachgedacht, wie wenn die Welt der Dinge da und die Welt der Gedanken davon gesondert wären. Vielmehr werden die Dinge und Ereignisse durch Denken erzeugt, natürlich nicht in dem Sinne, dass sie ohne das Denken nicht vorhanden wären, sondern dergestalt, dass wir kein Ereignis, keine Sache wahrnehmen können, ohne sie für uns mit den Mitteln des Leibes – und hier vor allem des Zentralen Nervensystems – hervorzubringen. Die Erfahrung von jedem Ding 'da draußen' wird auf eine spezifische Weise durch die menschliche Struktur konfiguriert, welche 'das Ding', das in der Beschreibung entsteht, erst möglich macht. Das heißt, jedes Erkennen ist ein Tun und jedem Tun liegt ein Erkennen zugrunde. Erkennen wird hervor gebracht und dieses Hervorbringen bildet das Zentrum des Erkenntnisprozesses. THESE 2: GEIST UND MATERIE SIND NICHT GETRENNT Das bringt die Notwendigkeit mit sich, in der Erforschung kognitiver Prozesse die Trennung zwischen Körper und Geist aufzuheben. Die Descartsche Trennung zwischen res extensa und res cogitans und die Selbstbegründung des Subjekts durch das Denken wird mittlerweile von vielen Autoren kritisch hinterfragt. Damasio, einer der Neurobiologen, die sich vornehmlich mit den Emotionen auseinandersetzen, tituliert sein bekanntestes Werk „Descartes Irrtum“. Erkenntnistheoretisch bedeutsam sind dabei die Bemühungen, den Körper als eine Form des Geistes anzuerkennen. Am radikalsten hat das Bateson mit seiner Formel von der „Ökologie des Geistes“ (Bateson,1981) artikuliert. Er begründet, dass es keine scharfe Trennung zwischen dem Geist und biologischen wie physikalischen Formen der Materie gibt, insofern Geist eine Form der Ordnung ist. Nun gibt es keine ungeordnete und damit keine geistlose Materie, lediglich Ordnungen lebender und nicht lebender Materie. Insbesondere lässt sich vor diesem Hintergrund eine Trennung zwischen einem Körper, der lediglich als Haus für einen davon unabhängigen Geist betrachtet wird, nicht mehr aufrecht erhalten. Bateson macht darauf aufmerksam, dass unsere kulturelle, erkenntnistheoretische Gewohnheit, Geist und Natur trennen, zur Folge hat, dass wir Natur nur als Ressource betrachten – mit den bekannten Folgen ökologischer Probleme – und die Bereiche der Interaktion verleugnen, durch die die Menschen mit den anderen Formen der lebenden und der nichtlebenden Materie verbunden sind. Damit so etwas wie Geist entsteht, müssen körperliche, sinnliche, sachliche, emotionale und kommunikative Bezüge in einem hoch komplexen Prozess zusammenspielen. Dabei rückt das Denken als ein Vorgang in den Blick, der das gesamte Verarbeitungsspektrum umfasst, das im Körper, insbesondere im Gehirn angesiedelt ist, gleichgültig ob es bewusst oder ohne Bewusstsein verläuft. Den Denkbegriff so weit auszudehnen ist durchaus hinterfragbar und eine systematische Klärung steht noch aus Es gibt jedoch viele Begriffe innerhalb der Kognitionswissenschaften, die auf ein vorsymbolisches Denken hinzielen. Ich verwende diesen umfassenden Denkbegriff zunächst vorläufig, weil kein anderer Begriff zur Verfügung zu stehen scheint, der angemessen erfassen kann, was an Welterzeugungs- und Weltverarbeitungsprozessen von jungen Kindern ab dem Säuglingsalter lernend geleistet wird. Strategisch dient er dazu, die Prozesse, die Kinder in den frühen Lebensjahren zu ihrer Welterschließung zur Verfügung stehen und gebrauchen, nicht als Vorläuferfunktionen von Erwachsenenverhalten und damit aus der Defizitperspektive zu beschreiben. THESE 3: EMOTIONEN HABEN EINE KOGNITIVE FUNKTION Durch die so entstandene „embodied cognitive science“3 werden auch die Emotionen in ihrer kognitiven Funktion rehabilitiert. Statt dass sie dem Geist bei seiner Tätigkeit im Wege stehen, werden sie selbst in ihrer kognitiven Funktion erkannt. Sie erweisen sich als ein Aspekt, ohne den Handlungs- und Denkprozesse in einer kulturellen Qualität nicht zustande kommen können.4 Die Emotionen und ihre Regulation sind dabei in Beziehungen eingebunden, in Beziehungen zu Dingen, geistigen Gehalten und anderen Menschen. Sie sind es, die den Beziehungsaspekt in jedem geistigen oder körperlichen Akt verwirklichen. THESE 4: MENSCHLICHE ENTWICKLUNGSPROZESSE SIND EMERGENTE PROZESSE. Die große Herausforderung an die Wissenschaften besteht darin, das Wirken von Komplexität zu erfassen. Singer5 nennt dies das Bindungsproblem. Gerade dieses Problem verbindet sich direkt mit pädagogischen Fragestellungen, denn es stellt sich in jeder pädagogischen Handlung nicht nur die Frage, was funktional effektiv dabei herauskommt, sondern, wie bestimmte geistige und körperliche Prozesse in der Komplexität eines soziokulturell strukturierten Alltags überhaupt zustande kommen. Ähnlich wie die Neurobiologie der Wahrnehmung deutlich macht, dass sinnliche Empfindungen als Konstruktionen eines Prozesses angesehen werden müssen, in dem zahllose Einzelfunktionen, die teilweise im Gehirn auch lokalisierbar sind, sowohl hierarchisch wie auch parallel miteinander in Wechselwirkung treten, müssen wir davon ausgehen, dass soziale Handlungen – und pädagogische Handlungen sind soziale Handlungen – nur in Ausnahmefällen in deterministischen Ursache-Wirkungs-Verhältnissen zusammen gebunden werden können. 3 Z.B. Damasio 1994, Pfeifer, Scheier 1999, Varela 1990, 1994 4 Vgl. hierzu insbesondere: Damasio 1994, Ledoux, 1998, Vincent, 1992 5 Singer an mehreren Stellen, beispielsweise 2003: „Das Bindungsproblem resultiert aus der distributiven Organisation des Gehirns und dem Fehlen eines singulären Koordinationszentrums. Die Ergebnisse der vielen, gleichzeitig ablaufenden Sinnesfunktionen werden parallel an die ebenfalls zahlreichen exekutiven Zentren weitergegeben, ohne dass vorher alle Informationen an einem Ort zusammengeführt würden. Wie dennoch ganzheitliche Wahrnehmung und wohl koordinierte Bewegungen zustande kommen, ist unklar. Es muss Metarepräsentationen für die Ergebnisse dieser Teilprozesse geben, doch diese können ebenfalls nur nicht-lokale Gebilde sein, also wiederum einem distributiven Prinzip folgen. Wir vermuten, dass die Einbindung verteilter Neuronengruppen in diese Metarepräsentationen durch die zeitliche Synchronisation neuronaler Antworten erfolgt. Die Signatur, welche die Aktivität verteilter Neuronengruppen zusammenbindet, wäre die präzise zeitliche Synchronisation der entsprechenden Aktivitätsmuster“ (S. 42-43). Nach Maturana und Varela6 sind lebende Organismen autonome Systeme. Sie bilden „Netze molekulare(r) Interaktionen, welche sich selbst erzeugen und ihre eigenen Grenzen bestimmen...“ (S. 47), die also autopoietisch organisiert sind (S. 50). Sie bilden Einheiten, die sich von anderen unterscheiden und abgrenzen (S. 46). Diese Einheiten müssen sich von außen mit Energie versorgen. Dabei sind sie „in einem kontinuierlichen Netzwerk von Wechselwirkungen dynamisch miteinander verbunden“ (S. 51), einem Netzwerk„ das seine eigenen Bestandteile erzeugt“ (S. 53). Daher gibt es „keine Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis. Das Sein und das Tun einer autopoietischen Einheit sind untrennbar, und dies bildet ihre spezifische Art von Organisation“ (S. 56). Leben ist das emergente Produkt solcher autopoietischer Systeme. Mit Emergenz wird dabei das Entstehen neuer Strukturen und Eigenschaften aus dem Zusammenwirken eines komplexen Systems beschrieben. Aber auch lebendige Prozesse sind emergente Prozesse. Sie bringen lebendige Ordnungen hervor. In diesem Sinne ist auch Evolution ein emergenter Prozess, der neue Ordnungen erzeugt. Auch alle menschlichen Entwicklungsprozesse sind emergente Prozesse. Das bedeutet, auch pädagogische Prozesse als emergente Prozesse verstanden werden. Als solche sind sie selbstverständlich auch determinert, allerdings nicht im Sinne eines kausalen Ursache-WirkungsVerhältnisses, sondern im Sinne eines komplexen, evolutionären Determinismus7. THESE 5: EMERGENZ IST NICHT AN BEWUSSTSEIN GEBUNDEN Emergenz im Sinne des Entstehens neuer Strukturen und Eigenschaften aus dem Zusammenwirken eines komplexen Systems ist nicht an Bewusstsein gebunden. Vielmehr scheint es eher wahrscheinlich, dass Bewusstsein ein emergentes Phänomen des komplexen Zusammenspiels biologischer, sozialer und kultureller Prozesse ist. Das hieße, Bewusstsein ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein soziales und ein kulturelles Phänomen. Nach der Psychoanalyse hat die Kognitionsforschung das Problem eines begrenzten Bewusstseins und die bedeutsame Rolle eines unbewussten Denkens gestellt.8 Nach Gazzaniga9 hat das Bewusstsein die Aufgabe, das zu interpretieren, was ihm aus der übrigen Arbeit des Gehirns zugeführt wird und es in einen konsistenten, überprüfbaren Zusammenhang zu bringen. Die Arbeiten von Libet10 haben zeigen können, dass bewusste Entscheidungsprozesse in einen größeren Zusammenhang „innerer Verarbeitung“ eingebettet sind. Es gehen ihnen unbewusste 6 Maturana, Varela, 1987 7 Der Begriff determiniert beschreibt hier lediglich allgemeine Prozesse der Abhängigkeit und der Beeinflussung. Kausale Determiniertheit ist ein Spezialfall von Determination. Wenn man in Urlaub fährt, wird man sicherlich durch viele Faktoren determiniert. Vermutlich wird es jedoch keine eindeutige, kausale Determination geben. 8 Diese kurzen Bemerkungen zur Bewusstseinsdebatte wollen lediglich eine Position markieren, welche die kritischen Positionen einer evolutionären Anthropologie (Donald, 1993, 2002, Tomasello, 2003) der Neurobiologie (Libet, 2007, Roth, 1994, Singer 2002, 2003, um nur einige zu nennen), sowie die schon seit langem bekannten kritischen Positionen der Psychoanalyse und davor Nietzsches zum Thema Bewusstsein zur Kenntnis nimmt und dennoch dem Bewusstsein nicht nur den Status eines Epiphänomens zugesteht. Die Diskussion darüber ist im vollen Gange und es wäre vermessen, in solcher Kürze ein Bild dieser Diskussion zu zeigen. Es geht mir an dieser Stelle in erster Linie um die Fragen, die durch diese Forschungen insbesondere die Kognitionsforschung aufgeworfen werden, dann um begründete Zweifel an traditionellen Modellen von Handeln, Denken und Lernen und erst in dritter Hinsicht um bereits vorhandene Antworten dieser Wissenschaften. Die Antwort der Pädagogik auf diese Diskussion kann nicht sein, dort bereits erarbeitete empirische Befunde in ihrem Bereich anzuwenden. Vielmehr ist sie aufgefordert, selbst einen Beitrag zu diesen Forschungen zu leisten (s.w.u.) und diesen Beitrag in ein Verhältnis zu den Beiträgen anderer Disziplinen zum Thema „Wie entsteht Erkennen?“ zu setzen. 9 1988 10 Zusammenfassend: Libet, 2007 Prozesse voraus, die Entscheidungen möglicherweise schon in Gang gesetzt haben, bevor das Bewusstsein eine Entscheidung trifft. Es ist eigentlich klar, wenn man das Bewusstsein nicht als etwas Geistiges ansieht, das außerhalb unserer körperlichen Organisation beheimatet ist, muss es ein (emergentes) Produkt der Tätigkeit des Zentralen Nervensystems in einem lebendigen Körper sein. Und wenn es ein solches Produkt ist, dann gibt es Prozesse, die es hervorbringen. Deshalb stellt sich die neurobiologische Forschung u.a. die Frage, „Wie Bewusstsein entsteht“. Wenn wir das Bewusstsein hingegen nicht als das bloße Epiphänomen materieller Prozesse ansehen und ihm einen Einfluss auf den Verlauf der menschlichen Handlungs- und Denkprozesse zugestehen wollen, wovon wir als Alltagserfahrung in der Regel überzeugt sind, dann scheint es regulierend in die Handlungsverläufe einzugreifen. Bewusstsein wird daher erst begreiflich, wenn wir es in die DenkHandlungs-Kreisläufe einfügen, mit welchen das alltägliche Leben gelebt wird: Es kann Abläufe modifizieren und Neueinstellungen für zukünftige Abläufe verändern. Aber es ist nicht die alleinige Ursache von Entscheidungen. Vielmehr scheint es überhaupt keine klaren Ursachen für Entscheidungen und Bewusstseinsprozesse zu geben. Entscheidungen, wie Bewusstsein, sind Ergebnisse von Wechselwirkungsprozessen zwischen einem auf die Umwelt gerichteten Handeln und einem auf die innere Verarbeitung gerichteten Denken und machen nur innerhalb solcher Prozesse Sinn. Das heißt nicht, dass man sich bewusste Entscheidungen nicht tausendfach vorstellen und zurechtlegen kann. Nur, um wirksam zu werden, reicht es nicht, sie zu haben oder zu sagen oder niederzuschreiben. Sie bleiben so lange fiktional, als nicht nach ihnen gehandelt wird. Das Versagen eines kausal denkenden Bewusstseins an den komplexen Problemen des Alltags, wie an den übergreifenden Problemen der Ökologie wird damit zum stärksten Argument, über ein nicht individualistisches, verkörpertes und in der Umwelt verankertes Bewusstsein nachzudenken. WAS BRINGT DIE KOGNITIONSFORSCHUNG DER PÄDAGOGIK DER FRÜHEN KINDHEIT? Die Kognitionsforschung lädt ein, nicht vom Denken in seinen am weitesten entwickelten Formen, den vielfältigen Möglichkeiten bewussten Denkens auszugehen, sondern von seinen elementarsten. Das Problem lautet dann, wie aus elementaren (nicht unbedingt einfachen, wie sich zeigen wird), impliziten und unbewussten Formen der Weltwahrnehmung und der mentalen Welterzeugung, die Formen der Welterzeugung durch bewusstes, kontrolliertes Denken hervorgehen und wie sie möglicherweise zusammenspielen. So formuliert wird klar, dass dabei nicht nur biologisch und genetisch vorgeformte Denkstrukturen ins Spiel kommen, sondern ebenso die Strukturen, die die Kultur zu diesem Denken beiträgt. Wenn das anerkannt wird, dann rücken die kommunikativen Prozesse mit ins Zentrum der Überlegungen, denn offensichtlich kann sich individuell kein kulturell geprägtes Denken entwickeln, ohne dass das Individuum in Kommunikation mit dieser Kultur tritt und das erfolgt in den ersten Lebensjahren in wesentlichen Anteilen über die Kommunikation mit anderen Menschen. 4. „WIR SIND ERINNERUNG“11 Gedächtnis ist eine globale Eigenschaft neuronaler Netzwerke. Es spielt im Erzeugungsprozess von Können und Wissen eine zentrale Rolle. Ohne Gedächtnis sind lebende Wesen reine ReizReaktions-Organismen. Sobald lebende Wesen Ereignisabläufe speichern können, in die sie hinein verwoben werden, verändern sich die Möglichkeiten, auf gegebene Umstände zu reagieren. Auslösende Mechanismen und antwortende Reaktionen lassen sich nicht mehr eindeutig aufeinander beziehen, sie werden durch die vergangenen und gespeicherten Ereignisabläufe individuell und situationsabhängig modifiziert. Aus dieser Sicht ist „Gedächtnis“ keine 11 So der deutsche Titel von Daniel Schacters Buch über das Gedächtnis, 2001 abgrenzbare, funktionelle Einheit eines Organismus, sondern, es "... ist eine Eigenschaft, die von einem Beobachter dem gesamten Organismus zugeschrieben wird..."12 Nach Edelmans globaler Hirntheorie bildet der gesamte neuronale Apparat das Gedächtnis 13. Demnach findet sich das, was wir Information nennen, nicht in einzelnen Elementen des neuronalen Systems gespeichert, sondern ist eine Ergebnis der Verbindung bestimmter neuraler Einheiten. Die wesentliche Aktivität des Gehirns bei der Erzeugung von Können und Wissen besteht darin, Verbindungen herzustellen. Die unzähligen Ereignisse, die das Gehirn „registriert“, erzeugen unzählige, für die jeweiligen Ereignisse spezifische Verbindungen. Ereignisse unterscheiden sich von globalen Zuständen des Gehirns durch ihre Kohärenz. Sie bilden integrierte Muster. Wenn das Gehirn etwas repräsentiert, dann sind das zunächst Ereignisse, nicht Fakten. Wenn das Gehirn in Ereignissen denkt, wird eine Gewohnheit unseres alltäglichen Denkens auf den Kopf gestellt: Lernen heißt auf dieser Ebene integrierte Muster auf der Grundlage von Ereigniszusammenhängen zu bilden und nicht abstrakt-logische Denkschritte zu erzeugen. Das wirft zum einen das Problem auf, wie das „Denken“ in Mustern und das Denken in logischen Begründungszusammenhängen miteinander verbunden sein könnten. Zum anderen stellt sich die Frage, was es heißt, in komplexen Mustern zu denken, wenn man Denken – abweichend vom Alltagsgebrauch – einmal als die Grundtätigkeit des Gehirns annimmt, die in unterschiedlichen Varianten auftritt. Es ist gerade diese zweite Frage, die Edelmans globale Hirntheorie beantworten möchte. Sie stellt das neurobiologische Fundament zur Verfügung, mit dessen Hilfe das Lernen aus Erfahrung modellhaft nachvollzogen werden kann. Die Selektion von Repertoires Zur biologischen Ausstattung der menschlichen Gehirnentwicklung gehört, dass Babys bereits mit einem hohen Grad an unspezifischen Vernetzungen geboren werden. Die erste Aufgabe eines lernenden Gehirns besteht darin, aus diesen Verbindungen diejenigen auszuwählen, die sich zur Bewältigung der Aufgaben eignen, die sich dem Neugeborenen stellen. Diese Lernaufgabe nennt Edelman die Entwicklung eines primären Repertoires. Es bildet eine individuelle, neuroanatomische Struktur, die ein Stück weit die vorgefundenen Lebensbedingungen widerspiegelt, so wie die Anatomie des Fisches seine Lebensbedingungen im Wasser abbildet.14 Darauf baut ein sekundäres Repertoire auf. Durch die erfahrungsabhängige Bildung von neuronalen Netzwerkverbindungen, werden bestimmte Netzwerke für wiederkehrende Aufgaben optimiert. Die neurobiologische Grundlage besteht in der Schaffung neuer synaptischer Verbindungen und in der Verstärkung von vorhandenen, die genügend geeignet sind. Während das primäre Repertoire, je älter ein Individuum ist, umso weniger veränderbar ist, bleibt das sekundäre Repertoire ein Leben lang flexibel. Die Bildung neuer synaptischer Verbindung und die Verstärkung oder Schwächung vorhandener Netzwerke hängt davon ab, wie sehr sich das Individuum neuen Lernprozessen stellt. Im Bereich der sensorischen und motorischen Erfahrungen bilden sich durch den wiederholten Gebrauch Karten, die bestimmte Handlungszusammenhänge wiedergeben. Beispielsweise sind die Tätigkeiten der Hand in solchen sensorisch-motorischen Kartierungen niedergelegt. Sie speichern gewissermaßen die Routinen und sind an den Rändern offen für Veränderungen durch neue Erfahrungen. So verändern sich die Kartierungen der Hand durch das Erlernen eines Instruments. Bei einem Pianisten beispielsweise sind diese Areale deutlich vergrößert gegenüber Menschen, die kein Klavier spielen.15 Diese Kartierungen entstehen dadurch, dass die vorhandenen Erfahrungsmuster durch die neuen, vergleichbaren, immer wieder überschrieben und dadurch 12 Leutzinger-Bohleber et al. 1998, S. 545; kursiv im Original 13 Edelman 2004 14 Wie man unschwer an der Vielzahl der unterschiedlichen Fische und anderer Wasserbewohner absehen kann, können diese Lebensbedingungen in durchaus sehr unterschiedlichen Phänotypen abgebildet werden. 15 Vgl. hierzu Spitzer, 2002, a, S. 110 ff, 2002 b, S. 321 ff gefestigt sowie variiert werden. Es bildet sich – gegenüber einem Ungeübten – ein differenziertes Repertoire an Handlungsmustern. Je größer und je differenzierter ein solches Repertoire ist, desto mehr Möglichkeiten für zukünftige Aufgaben stehen einem Individuum zur Auswahl und als Grundlage weiterer Verbesserungen zur Verfügung. Je mehr Möglichkeiten bereits vorhanden sind, desto eher können sich daraus weitere Lernprozesse ergeben. In dem Maße, in dem diese Karten in alltägliche Handlungsvorgänge einbezogen sind, stehen sie in Verbindung zu emotionalen Verwertungs- und kognitiven Steuerungssystemen. Sie müssen durch die Zentren des Gehirns reguliert werden, die mit Gleichgewicht, Tages- und Nachtrhythmen oder dem Erhalt vitaler Funktionen in Verbindung gebracht werden. Diese Verbindung von sensorischmotorischen Karten zu den weiteren Systemen nennt Edelman globale Kartierungen.16 Den Grundmechanismus, der die erfahrungsabhängigen Veränderungen der neuronalen Netzwerke voranbringt, nennt Edelman „reentry“.17 Darunter versteht er eine komplexe Form von Rückkoppelung. Nicht nur einzelne Funktionen werden durch Rückkoppelung verändert und gegebenenfalls verstärkt. Vielmehr werden ganze, in globalen Kartierungen niedergelegte Erfahrungszusammenhänge umstrukturiert. Im wiederholten Durchlaufen werden sie immer wieder in ihren vergleichbaren Anteilen festigend überschrieben, durch situative Varianten differenziert und unterschiedlichen Voraussetzungen angepasst. Schon diese grundlegenden Erläuterung machen deutlich, dass das Gedächtnis als eine Funktion des ganzen Gehirns verstanden werden muss. "Da sich die Bahnungen neuronaler Gruppen in globalen Karten und damit die Wahrnehmungskategorien unter dem Einfluss des Verhaltens des Lebewesens ändern, entsteht Gedächtnis als Ergebnis eines ständigen Rekategorisierungsprozesses. Seiner Natur nach ist es prozessual und schließt ständige sensomotorische Aktivität, Abgleichung mit den Vitalwerden und Erproben in verschiedenen Kontexten ein. Die in unterschiedlichen Kontexten erworbenen Eindrücke, an deren Verarbeitung mehrere neuronale Gruppen beteiligt sind, führen zu ähnlichen, aber nicht exakt genau gleichen rekategorisierenden Gedächtnisantworten. Das Gedächtnis des Gehirns ist ungenau, aber hochgradig flexibel und fähig zur Verallgemeinerung".18 Man kann also metaphorisch sagen: „Wir sind Erinnerung“ (Schacter) und diese Erinnerung schreibt sich mit jedem Akt eines Individuums um. Die Veränderungen der Erinnerung folgen dabei einem Evolutionsmodell: Entlang den gegebenen realen Bedingungen werden die Erfahrungsmodelle selegiert und differenziert, die für die jeweil zu leistende Aufgabe am passendsten zu sein scheinen. 16 Edelman, Tononi (2002) heben dabei drei wichtige Verbindungssystem hervor: Das erste sind die thalamocorticalen Bahnen in welchen hohe Spezialisierung der sensorisch-motorischen Funktionen koordiniert wird: Das zweite System bilden polysynaptischen Schleifen, die den Cortex mit dem Kleinhirn, den Basalganglien und dem Kleinhirn verbinden. Kleinhirn und Basalganglien haben mit der Synchronisation, der Planung und Durchführung komplexer motorischer und kognitiver Abläufe zu tun. Der Hippocampus stellt eine Verbindung zum limbischen System her und damit zum Bereich der emotionalen Wahrnehmung und Bewertung und erfüllt eine wesentliche Aufgabe bei den Langzeitspeicherungen des Gedächtnisses. Dieses System ist nicht als Netzwerk organisiert „sondern gleicht eher einer Reihe parallel, richtungsgleich in Serie geschalteter Ketten...“ (S. 67). „Die dritte Art von kortikalem Arrangement erinnert weder an eine Netz noch an eine Reihe paralleler Ketten, sondern eher an eine diffuse Sammlung von Verbindung in Gestalt eines großen Fächers (...)“ (S. 68). Dieses Fasernetz erreicht die gesamte Großhirnrinde und hat die Möglichkeit Milliarden von Synapsen gleichzeitig zu beeinflussen. Seine eher biochemische Wirkung kann neuronale Tätigkeiten modulieren und liefert einen Beitrag zur Bewertung der jeweiligen Aktivitäten. 17 Dieser Begriff wird von Edelman an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Arbeiten erläutert. Ein verhältnismäßig kompakte Erläuterung findet sich in Edelman/Tononi, 2002, S. 72 ff. 18 Leutzinger-Bohleber et al. 1998, S. 568 MARKOWITSCH' MODELL DES GEDÄCHTNISSES Markowitsch'19beschäftigt sich mit unterschiedlichen Gedächtnisformen und unterscheidet grundlegend zwischen einem nicht deklarativen, impliziten und einem deklarativen, expliziten Gedächtnis aus. Mit dieser Unterscheidung wird deutlich gemacht, dass Bewusstsein und Gedächtnis nicht in eins gesetzt werden dürfen. Im impliziten Gedächtnis spielt das Bewusstsein keine, im expliziten eine große Rolle. „Das implizite Gedächtnis besteht darin, dass wir es einfach tun“.20 Das nicht deklarative und implizite Gedächtnis wird nun seinerseits in zwei weitere Einheiten unterteilt, in das prozedurale Gedächtnis und das sogenannte Priming. Unter prozeduralem Gedächtnis werden zunächst die nicht bewussten Erinnerungen an Handlungsabläufe verstanden. „Priming bezieht sich auf eine höhere Wahrscheinlichkeit des Wiedererkennens von Reizen, die man zu einem früheren Zeitpunkt unbewusst wahrgenommen hat. Was einmal 'geprimed' wurde, wird beim zweiten Erscheinen leichter oder eher als bekannt angesehen“.21 Dieses Modell verbindet Konzeptualisierungen aus dem Mensch-Tier-Vergleich, sowie solche aus der Untersuchung des menschlichen Gedächtnisses.22 Das deklarative und explizite Gedächtnis dürfte eine spezifisch menschliche Form des Gedächtnisses sein. In ihm wird zwischen einem episodischen und einem semantischen Gedächtnis unterschieden. Ersteres besteht aus bewussten Erinnerungen an singuläre Ereignisse, die von einem Subjekt erlebt wurden. Sie sind an den Kontext von Ort und Zeit gebunden. Davon heben sich die Inhalte des semantischen Gedächtnisses ab. Es besteht aus kontextfreien „Fakten“ und Wissenssystemen, also Beziehungen, die zwischen Fakten hergestellt werden können, ohne auf die konkreten Ereignisse Bezug zu nehmen. Wie die meisten Darstellungen des Gedächtnisses geht dieses Modell von einem entwickelten Gedächtnis aus. Es bringt daher Probleme mit sich, wenn man annehmen muss, dass diese Gedächtnisformen nicht von Anfang an so vorhanden und wahrscheinlich nicht einmal angelegt sind. Gleichzeitig wird damit auch ausgedrückt, dass junge Kinder explizite Gedächtnisformen erst entwickeln können, wenn sie sich das umgebende soziokulturelle Selbstverständnis in seinen wichtigsten Grundstrukturen einverleibt haben. Aus dieser Sicht macht die Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Gedächtnis Sinn, denn die frühesten Formen des Gedächtnis können wir uns nur als implizite Formen vorstellen, während unsere (kulturellen) Vorstellungen von einem expliziten Gedächtnis stark mit einem individuellen Ich, mit Bewusstsein und mit bestimmten Formen abstrakten Denkens verbunden sind. Von daher wird sich eine Entwicklung des Gedächtnis von implizit zu explizit vollziehen, allerdings – um Missverständnissen vorzubeugen – im Sinne einer Erweiterung, Differenzierung und Spezialisierung und nicht im Sinne einer Entwicklung, die die früheren Formen überwindet und auf archaischen Restfunktionen reduziert.. Entwicklung des Gedächtnisses "The world is experienced as a series of ongoing events,"23 mit dieser Aussage schließt Katherine Nelson unmittelbar an die bisherigen Überlegungen an: Die Grundeinheit von Erfahrungen sind nicht Fakten, sondern Ereignisse. Sie hinterlassen ihre Spuren in den neuronalen Netzwerken indem sie integrierte Verbindungen herstellen. Als solche sind sie zunächst ein Aspekt des impliziten Langzeitgedächtnisses. Sie sind nicht an bestimmten Stellen des Gehirns lokalisiert, sondern bestehen aus einem neuronalen Muster, das prinzipiell die Integration des gesamten neuronalen Systems beansprucht, auch wenn nur bestimmte Ausschnitte davon stärker betroffen 19 20 21 22 23 2002. Sein Modell kann als eines gelten, das in der Kognitionsforschung breit akhzeptiert wird. Ehrmann, 2001, S. 49 Markowitsch 2002, S. 88 vgl. Markowitsch ebenda Nelson, 1986, S. 4 sich. Gedächtnis und Lernen müssen als emergente Prozesse verstanden werden, die Zusammenhänge erzeugen. IMPLIZITES GEDÄCHTNIS IN DER FRÜHEN KINDHEIT "Neugeborene haben vermutlich globale Erlebnisse, in denen amodale, physiognomische und sensomotorische Wahrnehmung, kategoriale und Vitalitäsaffekte, hedonischer Tonus und State enthalten sind. Die einzelnen Erlebnisse sind global, aber wegen der nicht genügend ausgereiften Gedächtniskapazitäten nicht miteinander verbunden, nicht aufeinander bezogen."24 Diese Erlebnisse enthalten vermutlich die Erfahrung sich regelmäßig wiederholender Abläufe. In ihnen sind Inhalte und Kontexte gemeinsam gespeichert. Als Abläufe erzeugen sie Zusammenhänge, die sich als integrierte Ereignisse von anderen Zusammenhängen abheben. Es gibt in der Literatur zahlreiche Varianten von Untersuchungen, die in unterschiedlichen zeitlichen Abständen, mit oder ohne Auffrischung, gemacht wurden, welche die Annahme stützen, dass junge Kinder kontextuelle Zusammenhänge speichern, in welchen einzelne Elemente zu übergreifenden Mustern integriert sind. Köhler resümiert: "Während die Episode sich ereignet, wird – dem globalen Erleben des Kindes entsprechend – eine Gesamtheit wahrgenommen, gespeichert und 'er-innert'. Dazu gehören Komponenten wie das Ausmaß der inneren Erregung, die Affekttönung, die Wahrnehmung von Menschen, Dingen, Kontexten, Hintergründen, die propriozeptive Wahrnehmung der eigenen Bewegung und Ausdrucksweise, und das alles mit der jeweiligen Intensitätskurve, dem Rhythmus, dem zeitlichen Ablauf. Das Kind stellt dabei kausale Zusammenhänge her und bildet Erwartungen aus. Das Gedächtnis setzt sich aber nicht aus diesen Einzelheiten allmählich zusammen, sondern es ist eine episodische Ganzheit, aus der sich später, nach dem Spracherwerb, die Einzelheiten differenzieren lassen. In der Zeit um den18. Monat vollzieht sich ein Sprung in der Gedächtnisentwicklung. Nach Edelman führen die Entwicklungen vor der Sprache zu einem primären Bewusstseins. "Ein Menschenkind vor dem 18. Lebensmonat fühlt, handelt und nimmt senso-affektiv-motorisch in der Gegenwart wahr, unter anderem auch den Unterschied von Selbst und Nicht-Selbst, aber es weiß nicht – ... – dass es fühlt und wahrnimmt"25 Die Entwicklung symbolischer Repräsentationen führt zu einem „sekundären Bewusstsein“. Gleichzeitig vollzieht sich eine Erweiterung von einem impliziten zu einem expliziten Gedächtnis. EXPLIZITES GEDÄCHTNIS IN DER FRÜHEN KINDHEIT Dass sich das Kind etwa ab diesem Zeitpunkt im Spiegel erkennt, markiert den Beginn eines Bewusstseins von sich selbst, sowie die Möglichkeit, aus der Position eines Ich über etwas nachzudenken. Damit entwickeln sich auch die Voraussetzungen für eine symbolische Kommunikation und das episodische Gedächtnis: Imitierte Schemata erhalten symbolische Bedeutung. Sie lassen sich von ihren Ereigniszusammenhängen ablösen und frei verwenden, die Grundlage von Spiel und Phantasie. So wird neben der wahrgenommenen Realität eine imaginierte Welt geschaffen und auch im Gedächtnis behalten. Über sprachliche Kommunikation können Bedeutungen ausgehandelt werden. Schließlich erfordern Begriffsbildung und Sprache „eine totale Umorganisation des globalen Erlebens nach neuen Gesichtspunkten. Um das globale Erleben auch nur einer Sekunde sprachlich auszudrücken, bedarf es vieler Worte und begrifflicher Kategorien, die oft einem Erwachsenen nicht zur Verfügung stehen, geschweige denn einem Kind."26 24 Köhler, 1998, S. 152 25 Köhler a.a.O., S. 176 26 Köhler 1998, S. 185 Die Frage nach dem semantischen Gedächtnis bleibt an dieser Stelle offen. Durch die bisherigen Beschreibungen dürfte aber deutlich geworden sein, dass Fakten und Systeme des Wissens, die von den Handlungsereignissen unabhängig sind, erst mit einer symbolischen Organisation voll entwickelt sein dürften. Vermutlich entsteht das semanteiche Gedächtnis jedoch parallel zu den anderen Gedächtnisformen entwickeln. Allerdings, „erste wenn Kinder in der Lage sind, aktiv auf gespeicherte Informationen zurückzugreifen, ist die Basis für das Wissenssystem geschaffen.“27 Kathrine Nelson fasst die frühe Gedächtnisentwicklung auf eine andere Weise zusammen:28 Sie geht von basalen Gedächtnisprozessen aus, die in einem Ereignisgedächtnis (Episodengedächtnis) ohne Bewusstsein organisiert werden. In diesem Gedächtnis werden vorhandene Ereignismuster ständig durch neue, vergleichbare Muster überschrieben. Auf einer zweiten Ebene der mimetischen Gedächtnisprozesse können komplexe Handlungsweisen von den konkreten Ereignissen abgehoben werden. Das versetzt junge Kinder in die Lage, diese übernommen Ereigniszusammenhänge in simulierenden Handlungen zu reproduzieren und zu verändern. Die Gedächtnisleistung nimmt an Komplexität und zeitlicher Kapazität zu. Vor dem Hintergrund einer evolutionären Anthropologie29 beschreibt Nelson ein dritte, eine narrative Gedächtnisorganisation. Sie ist symbolisch organisiert, sprachgebunden und ordnet die Ereignisse, losgelöst von ihrem Ereigniszusammenhang, auf eine neue Weise in räumliche, zeitlich, kausale und psychologische Beziehungen ein. Sie ordnet die Welterfahrung der Kinder in Geschichten, die auch erzählt werden können. Dies ist die Grundlage dafür, dass soziale Erfahrungen mit anderen explizit geteilt und ausgehandelt werden können. In diesem Zusammenhang spricht Nelson vom episodischen Gedächtnis (episodic memory) und unterscheidet dies von Erinnerungen an Episoden (memory for episodes, episode memory)30, die den basalen Gedächtnisprozessen zuzuordnen sind. Gegenüber dem Episodengedächtnis sind die Inhalte des episodischen Gedächtnisses willentlich abrufbar, zeitlich und örtlich eingebunden und haben einen expliziten Bezug zum kindlichen Selbst. Schließlich diskutiert sie eine weitere Form des Gedächtnisses, das autobiografische Gedächtnis. Es taucht auf, wenn Kinder sich selbst im zeitlichen Strom, in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verorten können. „The present appears to be a distinctive although changing event-space, illuminated by experiences of the past, but not consciously located in the past. It is not until 4 or even 5 years of age that children begin to locate the self in events in the specific past and the future.“31 Und es wird insbesondere dadurch gefördert, dass Kinder mit ihren Eltern über die Vergangenheit sprechen „and through this pracice they acquire the discourse genre of narrativising their personal memories“32 Schließlich ist es die Form, in der Kinder beginnen (können) die kulturellen Speicher zu nutzen. 27 Markowitsch, Welzer, 2005, S. 163 28 Die folgenden Überlegungen fassen einige Gedanken zusammen, die Nelson (2006 b) in einem Papier zusammengefasst hat, das mir nur in einer privaten Fassung vorliegt. Es ist mir bisher nicht gelungen herauszubekommen, ob und – gegebenenfalls – wo es veröffentlicht wurde. eine Kurzform dieser Entwicklung findet sich auch in Nelson 2006 a. 29 Merlin Donald 1991, 2002 30 2006 b, S. 26 31 Nelson 2006 b, S. 27 32 ebenda; vgl. auch: Nelson, 2006 a,Tessler, Nelson 1994 DAS KOMMUNIKTATIVE GEDÄCHTNIS33 Bisher konnte es den Anschein haben, als wäre die Entwicklung des Gedächtnisses eine vorwiegend individuelle Angelegenheit, die allenfalls durch soziokulturelle Bezüge erweitert wird. Im folgenden Abschnitt soll jedoch gezeigt werden, dass das, was hier als eine Entwicklung von einem impliziten zu einem expliziten Gedächtnis skizziert wurde von Anfang an ohne den sozialen Beitrag überhaupt nicht verstanden werden kann. EPISODENGEDÄCHTNIS UND MIMETISCHES GEDÄCHTNIS Episoden entstehen durch Handlungszusammenhänge. Handlungszusammenhänge sind Zusammenhänge, die durch kulturelle Werkzeuge in einem konkreten, wie in einem geistigen Sinn geregelt sind. Es sind kulturelle Formen, die das Handeln in all seinen Formen insofern strukturieren, als sie von Menschen als mögliche Ausdrucks- und Gestaltungsformen assimiliert werden. Indem erwachsene Menschen in diesen Formen handeln, bieten sie diese in ihrer persönlich implizit und explizit angeeigneten Form der nachwachsenden Generation als Möglichkeiten der Handlungsstrukturierung an. Junge Kinder übernehmen diese Formen durch ein mimetisches Lernen von Anfang an. Diese kulturellen Handlungsformen organisieren das soziale und kulturelle Leben nicht nur auf der Ebene des Bewusstseins. Vielmehr sind es gerade wenig bis unbewusste Handlungsmuster, die das soziokulturelle Leben bis in feine Details durchziehen. Sie bilden einen individuell und sozial geprägten Habitus der zwischenmenschliche Verhältnisse regelt, ohne dass ein Bewusstsein davon benötigt wird34. Diese habituellen Formen des sozialen und kulturellen Umgangs prägen auch die Beziehungen zwischen Erwachsenen und ihren Neugeborenen. Indem diese in den ersten Lebensjahren diese Beziehungsformen mimetisch nachvollziehen und variierend zum Ausgangsmuster ihrer eigenen Bildungsmöglichkeiten nehmen, sind bereits die ersten Handlungen der Allerkleinsten von kulturellen Formen geprägt, ohne dass ihnen explizit Kultur übermittelt wurde. Es sind also nicht die bewussten sondern die zutiefst verkörperten, selbstverständlich erscheinenden und weitgehend unbewussten Beziehungsprozesse, die auf diese Weise das soziale und kulturelle Repertoire der nachwachsenden Kinder bilden. So gesehen sind Episodengedächtnis und mimetisches Gedächtnis die elementarsten Weisen, in einen soziokulturellen Kontext hinein zu wachsen. Das hat nicht nur für die sozialen Umgangs- und Beziehungsformen Bedeutung, sondern generell auch für die Entwicklung der Handlungs- und Denkformen. Es wird auf diese Art und Weise von Anfang an reguliert, wie man in unseren soziokulturellen Zusammenhängen handeln und denken darf, bzw. muss. Wenn wir Handlungs- und Denkformen nicht als Epiphänomene einer genetischen Entwicklung unter Einbezug realer Herausforderungen betrachten, sondern als Möglichkeiten, die in einer langen kulturellen Evolution entstanden sind, dann sind es die ersten Lebensjahre, in der junge Kinder nicht nur die sozialen und kulturellen Formen des Handelns und Denkens auf eine individuelle Weise aufnehmen, sondern auch die Theorien des Handelns und Erkennens, die in einer Kultur als gültig angesehen werden. Frühkindliche Bildung ist auf dieser Ebene eine Verkörperung kultureller Erkenntnis- und Handlungstheorien35. Sie werden später als so selbstverständlich erlebt, wie wenn sie Natur wären. In ihrer Verkörperung bilden sie eine zweite Natur. NARRATIVES UND AUTOBIOBRAPHISCHES GEDÄCHTNIS Die Wirksamkeit dieses Repertoires an habituierten Handlungs- und Denkformen zeigt sich erst 33 Eine lesenswerte Einführung in die Entwicklung des Gedächtnis in seinen individuellen und kommunikativen Aspekten bietet Welzer 2002 34 Bourdieu, auf gut nachvollziehbare Weise sind seine Überlegungen zum Habitus bei Krais, Gebauer 2002 zusammengefasst 35 Vgl. Schäfer 2002 recht, wenn das Kind in die Lage kommt, symbolische Formen zu bilden, zu finden und sich anzuverwandeln. Zu den impliziten soziokulturellen Formen treten nun die expliziten hinzu. Die Sprache ist vermutlich das wirksamste System einer sozialen und kulturellen Regulation und zwar nicht nur durch das, was sie an inhaltlichen Informationen erzeugt, sondern bereits durch das System, das sie zur Verfügung stellt. Man kann nicht in jeder Sprache alles gleich gut ausdrücken. Begriffe enthalten begrenzende und ermöglichende soziale Horizonte. Man muss sich innerhalb dieser Horizonte bewegen, wenn man verstanden werden will. Grammatikalische Konstruktionen lassen unterschiedliche Komplexitäten der Ausdrucksweisen zu. Auch hier bewegt man sich in sozial und kulturell gesteckten Grenzen.36 Das Phänomen des Memory Talk37 zeigt nicht nur, wie Gedächtnis und Erinnerung durch die Sprache eine entscheidende Differenzierung erfahren, sondern dass die sozialen Sprachgewohnheiten von Müttern, sich auf die Entwicklung des expliziten Gedächtnisses auswirken. Fivush et al.38 haben bei Kindern zwischen 3 und 6 den Einfluss des elterlichen Interaktionsstiles auf die Erinnerung der Kinder an frühere Erfahrungen untersucht. „In diesen Untersuchungen hat sich gezeigt, daß der elterliche Interaktionsstil – elaboriert versus nichtelaboriert – spezifische Auswirkungen auf die Erinnerungen der Kinder in den späten Vorschuljahren hat. Kinder von Müttern mit einem elaborierten Interaktionsstil erinnern sich detailreicher an ihre Erfahrungen und steuern zu den Gesprächen über Vergangenes (memory talk) in dieser späten Phase mehr eigene Kommentare bei ... Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß der mütterliche Gesprächsstil auf die Gedächtnisentwicklung des Kindes Einfluß nimmt und nicht umgekehrt.“39 5. Folgerungen für ein Evolutionsmodell des Erfahrungslernens Wenn emergente Ereignisse nicht als isolierbare Wenn-dann-Beziehungen begriffen werden können, in welcher Logik können sie dann miteinander verbunden werden? Edelmans Vorschlag ist, sie auf eine ähnliche Weise zu begreifen, wie die Organisation komplexer neuronaler Systeme, nämlich durch einen offenen evolutionären Determinismus.40 Dabei steht der Begriff der Komplexität nicht nur für einen hohen Grad von Vernetztheit. Die untersuchende Aufmerksamkeit kann sich in hochkomplexen Prozessen immer nur auf abgegrenzte Ausschnitte beziehen. Nun kann es Ereignisse geben, die außerhalb dieses Aufmerksamkeitsfokus liegen, die sich aber dennoch – über die starke Vernetztheit – auf ein Ereignis auswirken können. Sie erscheinen dann im Fokus der Aufmerksamkeit wie ein Zufall oder eine Störung. Komplexität steht also als Begriff für die prinzipielle Möglichkeit in hochgradig vernetzten Systemen, durch Ereignisse determiniert zu werden, die vom Fokus einer reflexiven Aufmerksamkeit nicht erfasst werden Bezogen auf das Erzeugen von Können und Wissen, spreche ich also von einem Evolutionsmodell 36 Das bekannte Buch von Bastian Sick, „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, häuft Beispiele soziokultureller Entwicklungen von semantischen und grammatikalischen Gewohnheiten, die innerhalb einer Lebensspanne verlaufen sind. 37 Tessler, Nelson, 1994 38 1987 39 Nelson 2006 a, S. 83 – 84; Hervorhebung Nelson. Detailliertere Information zum „memory talk“ finden sich überblicksmäßig ebenfalls an dieser Stelle. 40 Damit wird gesagt, dass der kausal-physikalistisch gedachte Determinismus nur eine Form der Determiniertheit ist, eine, die zur Erklärungen von lebenden Prozessen nicht ausreicht. Der offene, evolutionäre Determinismus ist auch ein Determinismus, dem physikalischen chaotischen Determinismus vergleichbar, dessen Ergebnisse nicht vorhersagbar sind. Er scheint typisch für hochkomplexe System zu sein. des Erfahrungslernens.41 Die wichtigsten Prozesse, die sich dabei abspielen, sind die folgenden:42 Zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung hat ein Individuum bestimmte Möglichkeiten des Handelns und Denkens. (Nur in den allerersten Anfängen individueller Entwicklung sind diese biologisch vorgegeben.) Im Rahmen einer gegebenen sachlichen und sozialen Umwelt verwirklicht es etwas von diesen Möglichkeiten. Dabei variieren diese Möglichkeiten entlang gegebenen Kontextzusammenhängen. Diese Variationen bilden die Grundlage für neue Handlungen innerhalb neuer, vielleicht ebenfalls etwas veränderter Kontexte. Inhalte, Handlungs- und Denkweisen, die auf solche Weise verwirklicht werden, entwickeln sich weiter. Anderes bleibt von weiteren Entwicklungen ausgeschlossen. Es ist also nicht so, dass eine, oder mehrere Bedingungen zusammen eine bestimmte neue Form hervorbringen. Vielmehr wird ein handelnder Gesamtzusammenhang im komplexen Zusammenspiel mit ermöglichenden oder begrenzenden subjektiven, sozialen und sachlichen Bedingungen, in einem offenen Auswahlprozess miteinander abgestimmt. Daraus ergeben sich neue Entwicklungsschritte. Es sind daher offene Variationen gegebener Möglichkeiten unter vorhandenen Bedingungen, die zusammenwirken und den nächsten Entwicklungsschritt gestalten. So gesehen ist es das Zusammenspiel eines Driftens43 und von Einschränkungen, welches die Entwicklung voran bringt. Das Neue, das entsteht, entsteht im Rahmen der Variationsbreite der Ausgangsbedingungen und der Einschränkungen des Feldes in dem dieses Driften stattfindet. Eigen und Winkler44 haben gezeigt, dass dieses Zusammenwirken von Variationen und Eingrenzungen als deterministisches Spiel verstanden werden kann. Es scheint, als seien komplexe Lebensprozesse in dieser Weise organisiert. Erzeugte Entwicklungsmuster festhalten, variieren, einschränken und umgestalten, sowie sie in einen Handlungsprozess unter gegebenen Bedingungen einbringen, sind die entscheidenden Prozesse dieser Entwicklung. Fasst man die verschiedenen Erkenntnisse der Kognitionswissenschaften zusammen, so lassen sich folgende Schlussfolgerungen für die frühe Kindheit ziehen: Die Trennung zwischen Geist und Körper ist erkenntnistheoretisch unproduktiv geworden. Gerade in der frühen und frühesten Kindheit, lässt sie sich nur dann aufrecht erhalten, wenn man all die elementaren Prozesse, mit welchen junge Kinder sich die Welt erschließen und die vor der Entstehung des Denkens in einem strengen Sinn vorhanden sind, als ein Noch-Nicht, als Vorläufer versteht und nicht als eine originäre Denkleistung. Eine Alternative lautet: Kleine Kinder in den ersten Lebensjahren denken anders. Sie sind hervorragende Lerner. Sie erzeugen ein implizites Können und Wissen. Grundlage dieses Lernens ist ein Prozess der evolutionären Erfahrungsbildung. In diesem Prozess sind Handeln und Denken und damit Körper und Geist nicht voneinander zu trennen. Die neuen Herausforderung besteht also darin, die im wahrsten Sinne des Wortes grundlegende, leibliche Verfasstheit des Denkens in ihrer Eigenlogik zu begreifen. Das bedeutet: 41 42 43 44 Handeln und Denken bilden einen einheitlichen Prozess; Es kann an dieser Stelle nur überblickshaft skizziert werden. Zur weiteren Begründung s. Schäfer 2010 (b) Vgl. hierzu u.a.: Edelman/Tononi, 2002; Eigen/Winkler, 1975; Maturana/Varela, 1987; so beschreiben Maturana/Varela, 1987, den Prozess der Variation 1975 leibliches Handeln findet in einer historischen, sozial und kulturell strukturierten Welt statt; somit sind Handeln und Denken ohne diese sozialen und kulturellen Anteile nicht denkbar; als komplexe, ereignishaft strukturierte Prozesse sind sie als Evolution von Erfahrung zu erfassen; diese Evolutionsprozesse sind nicht zielorientiert, sondern können als deterministisches Spiel verstanden werden; Individualität lässt sich dann als das Ergebnis eines andauernden geschichtlichen Prozesses begreifen, in welchem subjektives Handeln und Denken als individuelle Varianten soziokultureller Formen hervor gebracht wird; die historische Gewordenheit eines Subjekts zu einem beliebigen Zeitpunkt seiner Biografie ist damit eine ebenso wichtige strukturelle Bedingungen für aktuelles Handeln, Denken und Lernen, wie die sozialen und kulturellen Kontexte. Denken und Lernen können daher nicht mehr zureichend als Prozesse begriffen werden, die sich als eine unabhängige Funktionsleistung irgendwo im Gehirn abspielen. Denken wird erzeugt. Erzeugen ist ein Prozess, in den stets die Bedingungen mit eingehen, unter welchen gerade gedacht wird. Was bedeuten nun diese Überlegungen für die weitere Entwicklung des kindlichen Weltwissens? 6. ÜBER DEN AUFBAU VON WISSENSSTRUKTUREN45 CONCEPTUAL CHANGE Kinder sind „universelle Novizen,“46 Ihr Wissen entwickelt sich nicht entlang biologisch vorgegebenen Programmen, sondern aus den Erfahrungen, die sie machen. Über diese Erfahrungen erzeugen sie sich nicht nur die entsprechenden Wissensinhalte, sondern auch die Strukturen, mit deren Hilfe sie denken. Ihr Wissen ist dadurch einerseits höchst individuell, andererseits stark durch die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen geprägt. Von diesen Erfahrungen werden Repräsentationen erzeugt, die sich auf bestimmte Wissensbereiche beziehen.47 Solche Wissensbereiche werden Domänen genannt. Die Repräsentation des Wissens beginnt also mit den Wahrnehmungen, die Kinder in ihrer Umwelt und angesichts gegebener Umstände machen. Diese werden als Schemata oder Scripts im Gedächtnis gespeichert (Episodengedächtnis). In Sprache gefasst, treten sie ins Bewusstsein und werden durch Begriffe strukturiert. Durch Symbolisierung (z.B. durch die Sprache) wird also aus impliziten Erfahrungsschemata ein explizites, bewusstes Wissen. Die Verbindung solcher Begriffe lässt ein subjektives Weltbild entstehen. Dabei wird der Zuwachs an Wissen als konzeptueller Wandel beschrieben. Karmiloff-Smith48 hat dieses Denkmodell noch dadurch angereichert, dass sie verschiedene Repräsentationsebenen herausgearbeitet hat, auf welchen das Wissen auf mehrfache Weise im menschlichen Erfahrungs- und Wissenszusammenhang repräsentiert wird. Es gibt jedoch einige ungeklärte Punkte in diesem Denkmodell eines Aufbaus von Wissensstrukturen. 45 46 47 48 Das Verhältnis zwischen symbolischen und nichtsymbolischen Repräsentationen bleibt unklar. Einen kognitionspsychologischen Überblick gibt Goswami 2004 Carey 1985 Karmiloff-Smith 1996 Karmiloff-Smith 1996 Die Wissensbereiche (Domänen) werden von verschiedenen Wissenschaftlern unterschiedlich definiert. Es besteht also ein hohe Unsicherheit, was einen Wissensbereich ausmacht. Es ist ein Modell, das stark von Wissensvorstellungen ausgeht, die begrifflich-rational strukturiert sind. Andere Formen mehr oder weniger expliziten Wissens bleiben weitgehend unbeachtet. Die sinnlichen, episodisch-bildhaften, emotionalen und sozialen Aspekte des Wissens finden keine zureichende Berücksichtigung. Die Schwierigkeit für die Pädagogik (der frühen Kindheit) liegt nun darin, dass sie es mit unterschiedlichsten Lebenswirklichkeiten zu tun hat. Gerade für die frühe Kindheit ist es pädagogisch notwendig, den ganzen Bereich nicht sprachlich bzw. nicht symbolisch geordneten Wissens für die kindliche Erfahrung und das daraus entspringende Wissen als ebenso bedeutsam anzusehen, wie das symbolisch strukturierte; haben wir es doch in den ersten Lebensjahren in sehr weiten Bereichen mit Prozessen zu tun, die auch ohne symbolische Ordnung zur Strukturierung kindlicher Erfahrungs- und Wissensbereiche beitragen. Frühpädagogen müssen ganz explizit nach solchen Formen des „Wissens“ Ausschau halten. Vor dem Hintergrund solcher ungeklärter Fragen greife ich eine Weiterführung dieses Denkmodells auf, welches das vorangegangene so variiert, dass damit der kindliche Erfahrungsraum in seinen Alltagsbezügen besser zu erfassen ist. DEVELOPMENTAL CHANGE Nelsons Modell eines „developmental change“ setzt einige Akzente neu.49 Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist eine Vorstellung von Entwicklung als einer emergenten Evolution. Durch die Wechselwirkung von Organismus und Umwelt werden immer neue, weiterführende Repertoires der Erfahrung ausgebildet. Die Transformationen dieser Repertoires in neue, oft komplexere Erfahrungsstrukturen erfolgen selbstorganisiert. Sie schließen vielfältige Veränderungen ein wie „physical growth, neural development, and learning... Additionally, each transition involves the perturbation of social or symbolic encounters, or both“50. Sie übersteigen damit die domänenspezifischen Begrenzungen. Inwieweit diese Erfahrungen das Bewusstsein erreichen und mit den Mitteln des Bewusstseins gedacht werden können, hängt dann davon ab, wie die soziale und kulturelle Welt auf diese Erfahrungen reagiert. Das Denken der Erfahrung mit den Mitteln der Kultur bestimmt mit darüber, in welchem Ausmaß Erfahrungen ins Bewusstsein treten und kommuniziert werden können. Wo sie sich entfalten können, kann so etwas, wie ein „hybrider Geist“ entstehen. Ihm stehen vielfältige Denk- und Verarbeitungssysteme zur Verfügung, die im Verlauf der Entwicklung ausgearbeitet wurden. Sie können zur Lösung neuer Aufgaben eingesetzt und problemspezifisch kombiniert werden. Durch die Antworten der sozialen Welt werden dabei verschiedene Stadien des Bewusstseins abgrenzbar: level 1: Sensorisches Gewahrwerden gegebener sozialer oder sachlicher Erfahrungsmuster; level 2: Vorsprachlicher sozialer Austausch durch geteilte Aufmerksamkeit, geteilte Routinen und Imitation; level 3: Erkennen eines Selbst und von Anderen in einer sprachlich geteilten Welt; level 4: Erkennen von überdauernden Mustern in Gegenwart und Vergangenheit; 49 vgl. Nelson 1996; 2007 50 Nelson 2007, S. 24 level 5: Narratives Denken durch das integrierte Selbst, welches Zusammenhänge in der psychischen und physischen Welt erkennt und mitteilt; level 6: Kulturelles Denken als Teilnahme des Selbst an der geistigen Gemeinschaft einer Kultur der geschriebenen Sprache51. Es ist also eine Frage der soziokulturellen Resonanz, ob eine solcher „hybrider Geist“ sich entwickeln kann oder ein domänenspezifischer. „Developmental change“ umfasst im Gegensatz zum „Conceptual Change“ alle biologischen, psychischen, sozialen und kulturellen Aspekte, die am konkreten oder geistigen Handeln beteiligt sind. Das so modifizierte Modell eines Wissensaufbaus durch Erfahrung haben wir in unseren eigenen Untersuchungen weiterentwickelt und spezifisch für den Aufbau von Weltwissen der Kinder adaptiert.52 7. Denkformate: Formen des kindlichen Wissens - Ein kognitionswissenschaftlicher Beitrag aus der Pädagogik der frühen Kindheit Unter der Vorannahme, dass Erkenntnis und Erkenntnissysteme nur unter komplexen Alltagsbedingungen entstehen können. werden Phänomene wie Selbstorganisation, Emergenz nur dann sichtbar, wenn die dazu notwendigen Kontextbedingungen nicht – wie unter streng kontrollierten Bedingungen – aus der Untersuchungssituation herausgefiltert, sondern zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden. Zu diesem Zweck hat eine Kölner Arbeitsgruppe unter meiner Leitung mit Hilfe ethnographischer Bildungsforschung im Rahmen einer „Lernwerkstatt Natur“53 komplexe Bildungsprozesse von Kindern zwischen drei und sechs Jahren untersucht. Diese Studien verstehe ich als erziehungswissenschaftliche Beiträge zur Kognitionsforschung, auf einer theoretischen Basis, wie sie hier skizziert wurde. Im Zentrum dieser Untersuchungen steht das Erfahrungslernen der Kinder und seine Organisation – Lernen aus erster Hand. Dabei wird nicht behauptet, dass es kein Lernen durch Aneignung von Wissen gäbe. Dieses kommt jedoch erst zur Geltung, wenn Kinder symbolisierte Formen des Denkens benutzen können. Dieses „Lernen aus zweiter Hand“ ist nur dann Gegenstand unserer Untersuchungen, wenn es in Verbindung mit dem Erfahrungslernen der Kinder entsteht. Und nur in dieser Verbindung ist es auch nachhaltig wirksam. 54 Die „hybriden“ Denkformen55 – wir nennen sie Denkformate - kommen zum Vorschein, wenn Kinder in anregungsreichen Situationen unter akzeptierenden sozialen Bedingungen, die Möglichkeit haben, selbstorganisiert und engagiert an Themen ihres Interesses zu arbeiten. Ferner dürfen die Handlungs- und Denkmöglichkeiten der Kinder in diesem Feld nicht von vorne herein bereichsspezifisch – z.B. in Richtung biologischen Wissens – eingeschränkt sein. Wir verstehen diese Situationen als pädagogische optimierte und fachlich unterstützte Alltagsbedingungen. Dabei besteht diese Unterstützung nicht nur in den Rahmenbedingungen einer anregungsreichen Umgebung, sondern ebenso in der Berücksichtigung und Gestaltung geeigneter sozialer Beziehungen, sowohl zwischen Erwachsenen und Kindern, wie auch zwischen den 51 Vgl. Nelson 2007, S. 25 52 Schäfer et al. 2009 53 unter Mitarbeit von Marjan Alemzadeh, Barbara Bach, Hilke Eden, Diana Rosenfelder, Matthias Kleinow, Laura Kruszczak, Kathleen Panitz. Die hier vorgestellten Zusammenhänge sind jedoch meine eigenen Schlussfolgerungen und stellen nicht unbedingt die Meinung der Mitglieder dieser Arbeitsgruppe dar. 54 Vgl. Liegle 2010, der dafür Belege zusammengestellt hat. 55 Merlin Donald (2001) spricht von einem „hybriden Geist“, einem Geist, der vielfältige und unterschiedliche Weisen des Denken nutzen kann. Kindern selbst. Didaktik wird dabei verstanden als die Bereitstellung und Gestaltung geeigneter struktureller Bedingungen und sozialer Beziehungen, die in Wechselwirkung mit der kindlichen Tätigkeit, die Bildungsprozesse hervorbringen, die sich die Gesellschaft für ihre Nachkommen wünscht und die Pädagoginnen und Pädagogen vor einem persönlichen, wie einem erziehungswissenschaftlichen Hintergrund verantworten können. Vor diesem Hintergrund konnten wir bisher keine bereichsspezifischen Wissensentwicklungen der Kinder feststellen, sondern eher ein „wildes“ Handeln und Denken, quer durch alle Möglichkeiten, die ihnen einfallen56. Kinder gingen auf sehr unterschiedliche Weise mit diesem reichhaltigen natürlichen Umfeld um und nutzten dabei unterschiedlichste Weisen des „Denkens“. Dabei konnten wir vier Weisen des Könnens und Denkens herausarbeiten, mit deren Hilfe die Kinder ihre Erfahrungen organisieren. Sie können als eine Weiterentwicklung der Überlegungen Nelsons im Anschluß an Merlin Donalds Modell der kulturellen Evolution verstanden werden.57 Das Erfahrungswissen der Kinder entsteht aus der Ausbeutung ihrer sinnlichen Erfahrungen in Alltagszusammenhängen. Indem sie erfassen, wie die Dinge zusammenhängen, in welchen Kontexten sie sich im allgemeinen befinden, wie sie üblicherweise geformt und wozu sie gebraucht werden können, entsteht in ihren Köpfen eine sinnliche Ordnung der Wirklichkeit, mit der Kinder bereits denken, bevor sie überhaupt sprechen. Diese Erfahrungen durchlaufen Umwandlungen, bis sie schließlich symbolisch gefasst und sprachlich gedacht werden können.58 Vier Formen eines „hybriden Geistes“ konnten bisher heraus gearbeitet werden. konkretes Denken, aisthetisches Denken narratives Denken theoretisches Denken mit Hilfe kultureller Theorien , die nachfolgend skizziert werden. A. KONKRETES DENKEN: DENKEN DURCH HANDELN UND BEWEGUNG Mit konkretem Denken wird hier das Denken mit den Mitteln des Körpers bezeichnet, Denken als Bewegen und Handeln.59 Es ist an diese Handlungen zunächst gebunden, bevor es sich als ein inneres Handeln auch in der Vorstellung vollziehen kann. Das konkrete Denken verbindet motorisches Handeln mit dem Spektrum sinnlicher Eindrücke, emotionalen Erlebens und sozialer Beziehungen einer gegebenen Situation. Dabei geht es nicht um einen momenthaften Eindruck, sondern um einen Prozess, in dem Vielfältigkeit, Qualitäten und Nuancen wahrnehmend, empfindend und fühlend erschlossen werden. Durch Bewegen und Handeln macht der Körper seine ersten Erfahrungen von der Materialität der Welt. Indem Dinge in Handlungen miteinander verknüpft werden, heben sie sich als Handlungsmuster aus dem unendlichen Fluss der Ereignisse heraus. Sinnlich erfahrene Handlungszusammenhänge bilden daher die Grundlage einer Ordnung des kindlichen Wissens. 56 Hier ähneln die Denkweisen der Kinder denjenigen, die Levi-Strauss (1968) in anderen Kulturen beschrieben hat. 57 Nelson 1996, Donald 1991, 2001 58 In theoretischer Hinsicht knüpfen unsere Arbeiten an die Denkmodelle an, die in diesem Beitrag skizziert wurden. Insbesondere führen die Überlegungen zu den Denkformaten theoretische Modellvorstellungen weiter, die im Abschnitt über den Aufbau von Wissensstrukturen angesprochen wurden. Dabei werden vor allem auch Überlegungen weitergeführt, die Kathrine Nelson vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung sprachlichen Denkens vorgedacht hat. Vgl. Nelson 1996 59 Vgl. die Ausführungen über „embodied cognition“ in Schäfer 2008, Kapitel 10 B. AISTHETISCHES DENKEN Aisthetisches Denken ist ein Denken mit bildlichen Mitteln, ein Denken mit Hilfe von Vorstellungen, Phantasien, unterschiedlichen Weisen des Gestaltens und des Spiels. Hierzu einige Beispiele: SAMMELN UND ORDNEN ... ist eine elementare Weise über neue Erfahrungen nachzudenken. Die Kategorien des Ordnens müssen nicht den Kategorien der Erwachsenenwelt entsprechen. Es sind auch nicht unbedingt abstrakte, rein sachbezogene Kategorien, sondern Kategorien, die aus individuellen Handlungszusammenhängen entstehen. GESTALTEND NACH-SINNEN ... ist ein Nach-Denken mit sinnlichen Mitteln. Indem die Kinder ihre Erlebnisse mit Stift und Papier reflektieren, drücken sie auch aus, was an diesen Ereignissen für sie bedeutsam ist: Kinder waren morgens im Gelände und kletterten an den steilen Lehmwänden mit Hilfe der Seile. Nachmittags, in der Werkstatt, greifen sie zu Stiften und bringen ihre Erfahrungen zu Papier. BAUEN UND KONSTRUIEREN Gesammelte Materialien kann man in neuen Zusammenhängen verwenden. Man kann mit ihnen bauen und konstruieren, neue Welten entstehen lassen, die entweder die Realität der Kinder variierend rekonstruieren oder ihren Vorstellungen und Phantasien Ausdruck geben: Aus gesammelten Hölzern entsteht eine Brücke. Gesammelte Steine werden zum Material für vielerlei Bauwerke. Bei einem Brückenbau mit verschiedenen rechtwinkligen und gerundeten Steinen finden und „erfinden“ die Kinder deren Konstruktionsprinzipien. AISTHETISCHES DENKEN IM ZUSAMMENHANG MIT NATUR Denken in Vorstellungen fügt den Zusammenhängen und Ordnungen des konkreten Handelns neue – aisthetische – Ordnungen hinzu. Diese Ordnungen verinnerlichter Bilder und Szenen, Ordnungen des Spielens und Gestaltens, bilden eine zweite Dimension einer vorsprachlichen Ordnung des Denkens. Mit seiner Hilfe können die Naturerfahrungen der Kinder gedacht, in einer fiktiven Wirklichkeit ausgetestet und in neue Zusammenhänge eingefügt werden. Von diesen szenischen und bildhaften Gedankenwelten geht ein Denken in Geschichten, das narrative Denken, aus. C. NARRATIVES DENKEN BILDER IN SPRACHE VERWANDELN Erzählend werden Bilderszenen in Sprache verwandelt. Es entstehen Geschichten. Sie repräsentieren, was wahrgenommen, empfunden und in erinnerbaren Erlebnissen zusammengefasst werden konnte. Das narrative Denken markiert den Übergang von der bildhaft-szenischen Repräsentation zur sprachlichen und damit auch von einer performativen Logik zu einer sprachlichen logischen Ordnung. Die Beobachtung von Kindern bei ihren eigenen Denkbewegungen in der Lernwerkstatt zeigt dabei, dass die Bilder und Szenen auch im sprachlichen Denken zunächst die Hauptrolle spielen. Vor allem durch diese Versprachlichung wird Können und Wissen bewusst. Dabei verwandelt sich Wissen von einem impliziten zu einem expliziten Wissen. IN METAPHERN DENKEN Kinder benutzen erlebte Bilder und Szenen um Dinge, die ihnen unbekannt sind, zu beschreiben. Sie bezeugen, wie genau und intensiv sie ihre Welt wahrnehmen. Sie belegen aber auch, dass sie ständig darüber nachdenken, was diese Dinge bedeuten. Wie Lakoff und Johnson60 dargestellt haben, bilden diese Raum-, Bewegungs- und Handlungsmetaphern auch die Grundlage der abstrakten Begriffssprache. Sie folgern daraus, dass die Organisation des abstrakten Denkens auf der Grundlage eines konkreten Umgangs mit der Wirklichkeit erfolgt. 60 Lakoff, G., Johnson, M. 1998 Von daher wird verständlich, dass ohne ausreichende und differenzierte Erfahrungen von der belebten oder nichtbelebten materiellen Welt das Interesse an Natur und Naturwissenschaft nicht unterstützt wird. Darüber hinaus fehlt ein wichtiger Grundstein für eine differenzierte Sprachwelt. Hier drei Beispiele: Kinder waten mit ihren Gummistiefeln durch einen Sumpf. Dabei bleiben sie im Matsch stecken und kommentieren: „Die Erde schmilzt“. Ein Junge spielt mit einer grünen Wäscheklammer: „Das ist ein Krokodilschiff. Mein Krokodilschiff schwimmt auf alle Fälle, weil – Krokodile schwimmen ja auch!“ Kinder denken über Schnecken nach: „Die Schnecken haben an den Bäumen fest geklebt. Da haben wir die gefunden und abgemacht. Wie können die denn da kleben?“ - „Die machen in ihrem Körper so etwas ähnliches wie Kleber, und das ist ihr Schneckenschleim.“ IST-WIE-ERKLÄRUNGEN Kinder leiten aus den erlebten Bildern und Szenen Erklärungen ab, finden Gründe, warum die Dinge so sind, wie sie sind: Das Wissen ist wie in Einmachgläsern gespeichert, der Schatten ist wie der Abend am Tag, der Mond ist wie ein Ball. Das ist die Grundlage für das, was heute in der Entwicklungspsychologie "naive" oder "intuitive" Theorien genannt wird. Sie beruhen auf der sinnlichen Ausbeutung der kindlichen Welterfahrung, gedacht in Bildern, die in Sprache verwandelt und dann der sozialen Welt zu Ohren gebracht, mit anderen geteilt – ihnen mitgeteilt – wird. D. ÜBERGÄNGE ZUM THEORETISCHEN DENKEN, DENKEN MIT KULTURELLEN THEORIEN61 Der Weg zum Naturwissen – und erst recht zur Naturwissenschaft – führt nun darüber, dass Kinder die Vielfalt möglicher Erlebnis- und Erfahrungskontexte nicht mehr beliebig einsetzen, sondern es lernen, sich auf einen kulturell bestimmten, theoretischen Kontext – den biologischen, physikalischen, chemischen oder mathematischen – zu beziehen und zu beschränken. Das theoretische Denken übernimmt alle Vorzüge, die durch die Versprachlichung des Wissens im narrativen Denken gewonnen werden können. Der wesentliche Unterschied zwischen dem narrativen und dem theoretischen Denken besteht nun darin, dass das narrative Denken sich an den subjektiven inneren Überzeugungen orientiert, während das theoretische Denken darüber hinaus kulturell gegebene Theorien und Wahrheitskriterien mit einbezieht. Im narrativen Denken geht es um eine subjektiv überzeugende, innere Wahrheit, im theoretischen Denken um sachlich und interpersonell nachprüfbare, „objektivierbare“62 Kriterien, an welchen sich die eigene Überzeugung messen kann. Das Denken mit kulturellen Theorien verlässt auch den narrativen Handlungszusammenhang zugunsten abstrakter, logisch begründeter, kausaler Folgen. Dabei können Zwischenformen entstehen, in welchen sich das theoretische und das narrative Denken in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen miteinander verbinden:. Die Kinder überlegen, wie die Rehe die steilen Lehmhänge hoch kommen: „Wie machen das die Rehe? Die rutschen nicht.“ „Haben Rehe Hufeisen an den Füßen? Vielleicht ist da Magnetismus. Vielleicht haben die magnetische Füße mit Hufeisen.“ „Wir müssen den Rehen morgen auf die Füße gucken!“ 61 In der Entwicklungspsychologie spricht man auch von „naiven Theorien“ der Kinder. Sie würden hier dem narrativen Denken entsprechen, als einem Denken, in dem die von den Kindern erfahrenen Alltagszusammenhänge als Grundlage ihrer Weltdeutungen gebraucht werden. Ich selbst verwende den Begriff der Theorie nicht in diesem weiten Sinn, sondern behalte ihn für das Denken vor, das die kulturell anerkannten Theorien einbezieht, um den qualitativen Unterschied des Denkens zwischen diesen beiden „Theorieformen“ begrifflich hervor zu heben. 62 Ein konsequenter Konstruktivismus kennt keine objektiven Daten, sondern lediglich passende, gangbare oder viable. Z.B. Glasersfeld 1997, S. 43 Pferde haben Hufeisen, das scheinen die Kinder zu wissen. Aber sie sehen diese nicht als eine Art Laufsohle an, sondern als Hufeisenmagnet, der eine Klebrigkeit zum Untergrund herstellt. Es ist der Magnetismus, der die Pferde nicht ausgleiten lässt. Bei Rehen könnte das dann genauso sein. Sie klettern wie Pferde: magnetisch, mit Hilfe ihrer Hufeisen. Man bemerkt: In diese Erklärung geht bereits eine ganze Menge von Vorwissen ein, das für dieses Kind bekannt war. Erwachsene müssen diesen möglichen Kontext rekonstruieren, um den Sinn der Aussagen dieser Kinder zu erfassen. Ein weiteres Anzeichen für den Übergang zu theoretischen Denken scheint zu sein, dass Kinder beginnen, ihre Erfahrungen „empirisch“ zu überprüfen: „Wir müssen den Rehen morgen auf die Füße schauen!“ VOM IMPLIZITEN WAHRNEHMEN ZUM EXPLIZITEN DENKEN Den Weg der Kinder ins Naturwissen könnte man nun knapp und abstrakt als einen Weg beschreiben, der von den Naturerfahrungen im Alltags- und Handlungskontext zu den Beschreibungen dieser Naturerfahrungen mit Hilfe abstrakt theoretischer Symbolsysteme führt. Handlungs- und Sinneserfahrungen sind der Ausgangspunkt eines zunächst impliziten Erfahrungswissens. Sie werden in Bildern und Szenen gelebten Lebens implizit arrangiert, gespeichert und gedacht. Diese verbinden sich mit Erinnerungen zu neuen Szenen. Über Formen des Spielens und Gestaltens werden sie einem expliziten Bewusstsein näher gebracht. Doch erst die Sprache hebt sie vollends ins Bewusstsein und macht sie der bewussten Bearbeitung zugänglich. Sie ist aber auch das wichtigste Einfallstor für die Gedanken anderer, die nun, ebenfalls bewusster als vorher, in die eigenen Vorstellungs- und Denkwelten eingebaut werden können. Mit den versprachlichten Szenen und Bildern entstehen erste narrative Theorien, die sich aus subjektiven Überzeugungen speisen. Verknüpft mit dem Wissen aus den kulturellen Speichern können sie an dem überprüft werden, was sich im Laufe der Geschichte an Überzeugungen angesammelt hat. Dadurch gewinnen sie soziale Verbindlichkeit. Dazu ist es notwendig, dass den Kindern alternative, kulturelle Denkmodelle zur Verfügung stehen. Im Verlauf des Wandels vom konkreten Denken zum Denken mit Hilfe kultureller Theorien findet eine Kontextwechsel statt: vom individuellen Handlungs- und Erzählkontext zum kulturellen Theoriekontext. Das so über Wahrnehmen, aisthetisches Gestalten, Erzählen und theoretisches Verstehen gewonnene Erfahrungswissen von der lebenden und von der unbelebten materiellen Welt bildet eine Grundlage allen Naturwissens bis hin zum naturwissenschaftlichen Wissen. 8. Lernkultur als neues Verständnis für die Unterstützung frühkindlicher Bildungsprozesse Die bisherigen Überlegungen haben erbracht, dass ein Sozialkonstruktivismus, der sich nur als ein sozialer Konstruktivismus begreift, für das Verständnis frühkindlicher Bildungsprozesse nicht ausreicht. Die neuen Herausforderungen bestehen darin, die notwendige Abgegrenztheit von Individuen, ihre komplexen Leistungen in der Erzeugung von Welt- und Selbstbildern, mit der ebenso unhintergehbaren kulturellen und sozialen Konstruktivität in Einklang zu bringen. Es ist ein paradoxes Ergebnis der Hirnforschung, dass die menschlichen Lernprozesse gleichermaßen extrem individuell-biografisch und sozial-kulturbezogen konstruiert sind. Dieses Problem kann nur durch einen Konstruktivismus angegangen werden, der gleichermaßen den individuellen, wie den sozialen Konstruktivismus berücksichtigt. Zwischen beiden muss man eine Brücke schlagen, um frühkindliche Bildungsprozesse zu verstehen und zu unterstützen. Dieser Herausforderung begegnet der hier skizzierte evolutionäre Konstruktivismus. Seine pädagogische Umsetzung erfordert eine Kultur des Lernens, die sich in differenziellen, lokalen Lernkulturen unterschiedlicher Institutionen und Träger, mit unterschiedlichen Betonungen des Bildungsverständnisse umsetzen lassen. Das meint, Lern- und Bildungsprozesse nicht als das mehr oder weniger erfolgreiche Ergebnis einzelner Bemühungen um Förderung oder Kompetenzvermittlung zu betrachten, sondern als Ergebnis eines Zusammenspiels vielfältiger individueller, sozialer und gesellschaftlicher Prozesse.63 Um erfolgreich zu sein, bedürfen sie einer Kultur des Lernens in der Selbstbildungspotenziale, kommunikative, sachliche und institutionelle wie gesellschaftliche Potenziale64 aufeinander abgestimmt werden können. Dieses Zusammenspiel entscheidet über Form, Qualität und Nachhaltigkeit kindlicher Bildungsprozesse. Wir erwarten, dass Kinder, wenn sie älter werden, immer resistenter gegenüber solchen Kontextbedingungen werden. Ob diese Erwartung tatsächlich berechtigt ist, lasse ich dahingestellt. Allerdings, je kleiner die Kinder sind, desto mehr wird die Berücksichtigung aller vier Säulen zur Bedingung der Möglichkeit der Entstehung und Grundlegung eines tragfähigen und nachhaltigen Könnens und Wissens. Eine Kultur des Lernens in der frühen Kindheit geht also von den Möglichkeiten der Kinder aus; bettet sie – wo es geht – ein in erweiternde Beziehungen zum Können anderer Kinder, wie zu Erwachsenen, die etwas können; stützt sich auf personale Beziehungen, die den Kindern helfen, auftretende Schwierigkeiten zu meistern, sowie Fehler positiv als Lernmöglichkeiten zu begreifen; bedarf der Institutionen, die dem Tun und Denken der Kinder als einem Erzeugen im hier beschriebenen Sinn sowohl Erfahrungsräume zur Verfügung stellt, wie Zeitstrukturen, in welchen sie eigenen Rhythmen des Vollzugs ihrer Interessen entwickeln können; Institutionen, die die Eltern wie auch die relevante Öffentlichkeit als Unterstützer für die Bildungsprozesse der Kinder einwerben; braucht als Rückhalt eine kommunale wie auch eine gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit, die den Kindern, wo es geht, Gelegenheiten gibt, an die Öffentlichkeit zu treten und sich an den 63 Evaluationsstudien müssen daher die Strukturbedingungen von Lernkulturen erfassen und auf die jeweils entstehenden Handlungs- und Denkprozesse der Kinder beziehen. 64 Vgl. w.o. „Vier zentrale Aspekte von Bildung“. Ressourcen zu beteiligen, die der öffentliche Raum bietet. Eine Kultur des Lernens ist eine familiäre, eine institutionelle, eine kulturelle und eine gesellschaftliche Aufgabe. Die hektische Diskussion um frühkindliche Bildung mit ihrer Vermittlungs-, Förder- und Evaluationsmentalität, die die pädagogischen Aufgaben als spezielle Dienstleistungen ansieht, ist eher kontraproduktiv für die Entwicklung von nachhaltigen Lernkulturen, die den kindlichen Anfängergeist aufnehmen, unterstützten und ihm eine Chance geben, sich individuell weiter zu entwickeln. Literatur Bateson, G.: Ökologie des Geistes, Frankfurt/M., 198 Carey. S.: Conceptual Change in Childhood. Cambridge, MA. MIT Press 1985 Damasio, A., R.: Descartes Irrtum. München 1994 Donald, M.: Origins of the Modern Mind – Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge MA, Havard University Press 1991 Donald, M.: A Mind so Rare. New York, London 2001, W. W. Norton Edelmann, G. M.: Das Licht des Geistes. Düsseldorf, Zürich, 2004 Edelman, Gerald, M., Tononi, Guilio: Gehirn und Geist – Wie aus Materie Bewusstsein entsteht. München 2002 Ehrmann, M.: Die Kreativität des Träumens. In Schlösser/Gerlach (Hrsg.): Kreativität und Scheitern, Gießen 2001 Eigen, Manfred, Winkler, Ruthild: Das Spiel – Naturgesetze steuern den Zufall. München/Zürich 1975 Fivush, R. Gray, J. T., Fromhoff, F. A.: Two-year-olds talk about the past. Cognitve Development, 2, 1987, S. 393 - 410 Gazzaniga, Michael., S.: Das erkennende Gehirn. Paderborn, 1988 Glasersfeld, Ernst v.: Radikaler Konstruktivismus. Frankfurt/Main 1997 Goswami, Usha (Ed.): Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development. Malden Australia, Oxford UK, Carlton USA 2004. Blackwell Publishing Ltd. Karmiloff – Smith, Annette: Beyond Modularity. Cambridge MA, MIT Press 1996 Köhler, Lotte: Einführung in die Entstehung des Gedächtnisses. In: Koukkou, M. LeutzingerBohleber, M, Mertens, W. (Hrsg.): Erinnerung von Wirklichkeiten – Psychoanalyse und Neurowissenschaften im Dialog, Bd. 1. Stuttgart 1998, S. 131-222 Krais, B., Gebauer, G.: Habitus. Bielefeld 2002 Lakoff, George, Johnson, Mark: Leben in Metaphern – Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern. Heidelberg, 1998 Ledoux, J.: Das Netz der Gefühle. München, Wien 1998 Levi-Strauss, C.: Das wilde Denken.Frankfurt/Main 1968 Leuzinger-Bohleber, Marianne, Pfeifer, Rolf, Röckerath, Klaus (1998): Wo bleibt das Gedächtnis? Psychoanalyse und Embodied Cognitive Science im Dialog. In: Koukkou, Martha, LeuzingerBohleber, Marianne, Mertens, Wolfgang (Hrsg.): Erinnerung von Wirklichkeiten. Psychoanalyse und Neurowissenschaften im Dialog. Stuttgart: Verlag Internationale Psychoanalyse, S. 517 - 588. Libet, Benjamin: Mind Time. Frankfurt/M. 2007 Liegle, Ludwig: Zur Renaissance und Weiterentwicklung der frühpädagogischen Didaktik, in: Schäfer, Gerd. E., Staege, Roswitha, Meiners, Kathrin.: Kinderwelten – Bildungswelten. Berlin 2010 Markowitsch, H., J.: Dem Gedächtnis auf der Spur. Darmstadt 2002 Markowitsch, H. J., Welzer, H.: Das autobiografische Gedächtnis. Stuttgart, 2005 Maturana, Humberto, R., Varela, Francisco, J.: Der Baum der Erkenntnis. Bern, München, Wien, 1987 Nelson, Katherine (Ed.): Event knowledge. Hillsdale, N.J, 1986. Erlbaum Nelson, Katherine: Language in Cognitive Development. Cambridge MA, University Press, 1996 Nelson, Katherine: Das autobiografische Gedächtnis. In: Welzer, Markowitsch (Hrsg.): Warum Menschen sich erinnern können. Stuttgart 2006 (a), S. 78 – 94 Nelson, Katherine: Evolution an Development of Human Memory Systems. Unveröff. Manuskript . 2006 (b) Nelson, Katherine: Young Minds in Social Worlds. Cambridge MA, London UK, Harvard University Press, 2007 Pfeifer, Rolf, Scheier, Christian: Understanding Intelligence. Cambridge MA, London, UK,MIT Press Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Frankfurt, 1994 Schacter, Daniel, L.: Wir sind Erinnerung. Reinbek bei Hamburt, 2001 Schäfer, G. E.: Frühkindliche Bildung als verkörperte Erkenntnistheorie. In: Liegle, L., Treptow, R. (Hg.): Welten der Bildung in der Pädagogik der frühen Kindheit und in der Sozialpädagogik. Freiburg, 2002, S. 65 - 73 Schäfer, Gerd E.: Lernen im Lebenslauf. Expertise für die Enquetekommission „Chancen für Kinder“ des Landtags von Nordrhein-Westfalen, 2008 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/14_EK2/Gutachten/StudieSchaefer2008.pdf Schäfer, Gerd, E.: Die Bildung des kindlichen Anfängergeistes, Weinheim/München 2010 (a), in Vorbereitung Schäfer, Gerd, E.: Theorie der frühkindlichen Bildung. Stuttgart 2010 (b), in Vorbereitung. Schäfer, Gerd E., Alemzadeh, Marjan, Eden, Hilke, Rosenberger, Diana: Natur als Werkstatt. Weimar, Berlin 2009 Schäfer, Gerd. E., Staege, Roswitha., Meiners, Kathrin: Kinderwelten – Bildungswelten. Berlin, 2010 Singer, Wolf. Der Beobachter im Gehirn. Frankfurt/M., 2002 Singer, Wolf: Ein neues Menschenbild. Frankfurt/M., 2003 Solms, Mark, Turnbull, Oliver: Das Gehirn und die innere Welt. Düsseldorf/Zürich, 2004 Spitzer, M: Lernen. Heidelberg, Berlin 2002, a Spitzer, M: Musik im Kopf. Stuttgart, New York 2002, b Tessler, M., Nelson, K.: Making memories: The influence of joint encoding on later recall. In: Consiousness and Cognition, 3, 1994, 307-326 Tomasello, M., Call, J.: Primate Cognition. New York, 1997. Oxford University Press Varela, Francisco, J.: Kognitionswissenschaft – Kognitionstechnik. Frankfurt/M. 1990 Varela, Francisco, J.: Ethisches Können. Frankfurt/Main, New York, 1994 Vincent, J.-D.: Biologie des Begehrens – Wie Gefühle entstehen. Reinbek bei Hamburg 1992 Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. München 2002