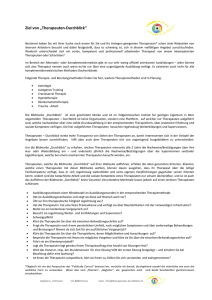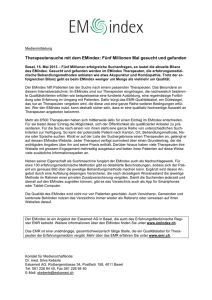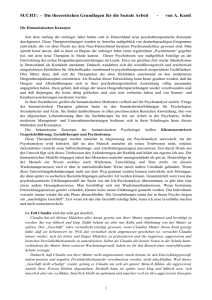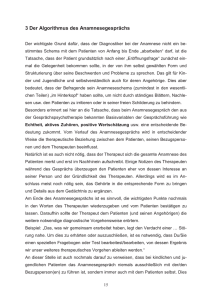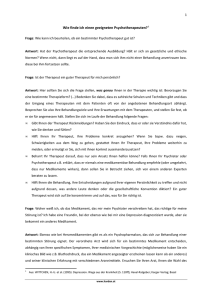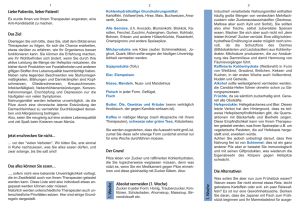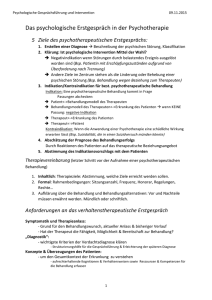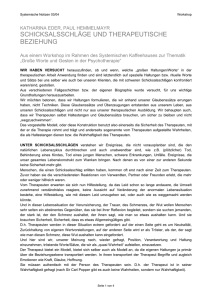2003-04-03_Thoma_Kin.. - la:sf Lehranstalt für systemische
Werbung

Christoph Thoma Christoph Thoma Von der „systemischen Therapie mit Kindern“ zur „systemischen Kindertherapie“ – Ein Vorschlag zur Settingfrage Zur Ausgangslage: Als ich vor einigen Jahren im Rahmen meiner Ausbildung zum Systemischen Psychotherapeuten die Gelegenheit hatte, Gianfranco CECCHIN zu fragen, ob systemisches Arbeiten mit Kindern im Einzelsetting („Systemische Kindertherapie“) sinnvoll sei, antwortete er nach kurzem Nachdenken sinngemäß: „Prinzipiell ist es möglich. Aber wenn man mit Kindern einzeln arbeitet, so beschneidet man sich freiwillig der Möglichkeit der Beobachtung und der Beeinflussung der Interaktion zwischen Kind und Eltern. Warum sollte man dies daher gezielt machen?“ Diese von Cecchin vertretene klassische Position stellt eine Weiterentwicklung der alten, familientherapeutischen Idee der 70er Jahre dar, zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen benötige man „die ganze Familie“ (was in vielen Fällen einfach nicht herzustellen war und oftmals zu Therapieabbrüchen führte), hat aber ihren konzeptuellen Schwerpunkt eindeutig auf einem Mehrpersonensetting. Dem gegenüber steht in der therapeutischen Praxis jedoch oft die völlig konträre Idee der Auftraggeber (im Regelfall die Eltern), der Therapeut solle (in Analogie zur medizinischen Intervention) „das Kind behandeln“ – also die Idee einer linear-kausalen Intervention in einem Einzelsetting. Wird daher dieser Auftrag vom Therapeutenen so angenommen, beginnt die Schere zwischen den Erwartungen der Eltern und seinen therapeutischen Möglichkeiten und Ideen der Einflussnahme bereits weit auseinanderzuklaffen. Die „Verführung zur schuldhaften Wahrheit“: Systemische PsychotherapeutInnen, die mit Kindern im Einzelsetting arbeiten, sind zudem noch mit einem zusätzlichen Phänomen konfrontiert, das ich als „Verführung zur schuldhaften Wahrheit“ bezeichnen würde, und das der Entlastung der Anwesenden zu Ungunsten der Nichtanwesenden dient. Wiewohl nahezu täglich damit in meiner Arbeit in der freien Praxis konfrontiert, möchte ich dieses Phänomen anhand der Ausgangslage von systemischen Therapeuten, die in stationären Kinderheimen arbeiten, illustrieren, um sie noch klarer zu zeigen: An die TherapeutInnen wird im Regelfall der Wunsch der Erziehungsleitung herangetragen, „das Kind zu therapieren“. Sämtliche Verhaltensweisen, die das Kind nach seiner Fremdunterbringung im Heim zeigt, werden quasi vom Kontext abgekoppelt und auf die Vergangenheit des Kindes in seiner Herkunftsfamilie zurückgeführt (frei nach dem von Gunther SCHMIDT so treffend formulierten Motto: „Mit uns hat es nix zu tun, bei uns wirkt es sich nur aus!“. Es gelte also für die Therapeutin/den Therapeuten, die Schädigungen des Kindes durch die Eltern in der Vergangenheit aufzuarbeiten, logischerweise im Einzelsetting. Die leiblichen Eltern des Kindes sind im Regelfall für die Therapeutin/den Therapeuten nicht greifbar, und würden unter dieser Problemdefinition wohl kaum interessiert sein, im Familiensetting an der Therapie teilzunehmen. Für die Therapeutin/den Therapeuten ergeben sich daraus zwei grundsätzliche Möglichkeiten: Die Therapie wird erfolgreich: Dies würde die Problemdefinition der Auftraggeber bestätigen, dem Kind jedoch eine gewisse Illoyalität abverlangen (die m.E. auch bei Kindern, die aus einem „schlechten“ Elternhaus kommen, aufgrund der Eltern-Kind-Bindung nicht vorausgesetzt werden kann) sowie dem Kind aus dieser Opferrolle heraus eine gewisse Machtposition den Eltern gegenüber zuweisen. Die Therapie wird nicht erfolgreich: In diesem Fall könnten die Auftraggeber zu der Ansicht gelangen, das Kind sei scheinbar noch traumatisierter als ursprünglich angenommen, es brauche noch mehr, noch intensivere Therapie – und möglicherweise einen anderen Therapeuten! In der freien Praxis sind ähnliche Situationen gegeben, wenn beispielsweise die Mutter eines Kindes meint, es gelte die Schädigung des Kindes - hervorgerufen durch dessen cholerischen Vater, von dem sich die Mutter mittlerweile getrennt habe - aufzuarbeiten, o.ä. Ist daher systemisches Arbeiten mit Kindern (und deren Eltern) aufgrund der Komplexität der Situation, der unterschiedlichen Ideen von Veränderung und Kooperation zwischen Eltern und Therapeuten ein unendlich mühvolles und aussichtsloses Unterfangen? Was muss beachtet werden, um ein sinnvolles Zueinander und Miteinander herzustellen? Zur Beantwortung der Fragen ist es notwendig, einige grundsätzliche Überlegungen zur Ausgangssituation der systemischen Arbeit mit Kindern anzustellen. Spezifisches abseits der Settingfrage: Grundsätzlich ist festzuhalten: Systemisches Denken und Handeln ist natürlich auch auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen anwendbar (wir benötigen dazu kein grundlegend neues Denken), jedoch ergeben sich für das Arbeiten mit dieser Zielgruppe folgende grundlegende Charakteristika (vergl. auch LENZ/OSTERHOLD/ELLEBRACHT, S.146f): 1. Der zu Behandelnde ist im Regelfall nicht ident mit derjenigen/demjenigen, der die Therapie induziert hat (Kinder haben keine Idee von „Psychotherapie“, haben keine Vorstellung davon, wie diesbezügliche Hilfe aussehen könnte. Dies gibt Spielraum für die Kontext- und Auftragsformulierung). Die Problembeschreibung erfolgt im Regelfall durch die Eltern. 2. Für eine Problembeschreibung (z.B. „schlimm“, „hyperaktiv“ etc.) brauchen die Eltern zunächst die Idee, dass der IST-Zustand vom SOLL-Zustand abweicht, und somit einen Vergleich mit einer anderen Person („schlimmer als seine Schwester“, „schwieriger als Buben in seinem Alter“ etc.) bzw. eine Abweichung von dem, was als „normal“ erachtet bzw. als sozial definiert wird. 3. Auch die Definition der sozialen „Normalität“ erfolgt also im Regelfall nicht vom Kind selbst, sondern von einem Erwachsenen (Eltern, andere Erziehungsberechtigte etc.). 4. Die Definition erfolgt nicht wahl- bzw. grundlos, sondern resultiert auf einer zueinander Bezogenheit in Verbindung mit einer sozialen Funktion („Ich bin Mutter/Vater etc. von diesem Kind, daraus leite ich das Recht/die Pflicht auf Bewertung ab“). 5. Bei der Sichtweise der Eltern, dass das Kind nicht o.k. ist wird eine lineare Beschreibung vorgenommen; der Focus liegt auf dem Kind. Diese Reduktion von Komplexität auf Seiten der Eltern beinhaltet nicht die systemische Sichtweise der Kontextabhängigkeit von Verhalten! (Kein Kind ist immer schlimm, hyperaktiv etc.) 6. Bei der Definition „das Kind ist nicht o.k.“ wird also ein kontextabhängiges Verhalten als Eigenschaft des Kindes definiert. Diese epistemologische Abkoppelung der Interdependenz des Verhaltens durch die Eltern ist in den meisten Fällen eine Form der Hilf- und Hoffnungslosigkeit, auf das Kind konstruktiv einzuwirken. Sie lässt aber sprachlich sämtliche (erfolglose, da ein mehr derselben, nicht zielführenden) Lösungsversuche außer Acht und beschneidet per Definition den Zugriff auf die familiären Ressourcen. 7. Dieser Reduktion von Komplexität einerseits steht in der Regel andererseits ein um außerfamiliäre Personen/Institutionen erweitertes Problemsystem gegenüber (Schule, Hort, Kindergärten, Jugendamt etc.). Die Problemdefinition wird letztendlich (mit-) beeinflusst durch die Sichtweise Außenstehender und resultiert aus der Interaktion dieser Personen mit den Eltern des Kindes. Aus all dem ergibt sich grundsätzlich, dass es vordringlichste Aufgabe der Therapeutin/des Therapeuten im Erstgespräch mit Kind und Eltern ist, neben anamnestischen Fragen auch Fragen zum Überweisungskontext zu stellen, Erwartungen abzuklären, durch Verflüssigungsfragen Eigenschaften in Verhaltensbeschreibungen umzuwandeln, Fragen nach Ausnahmen zu stellen um die Kontextabhängigkeit herauszuarbeiten etc. Dies ist eine Vorgangsweise, die wir auch in der Arbeit mit Erwachsenen wählen – mit dem Unterschied, dass uns bei der Arbeit mit Kindern in der Therapiesituation zumindest einer der Auftraggeber und „Etikettierer“ in der Gestalt der Eltern gegenübersitzt. Eltern als „unfreie Auftraggeber“: Auch wenn sich Eltern im Regelfall als außerhalb des Problemsystems stehend definieren („Mein Kind ist das Problem“), so sind sie ihrem Kind gegenüber niemals gänzlich „frei“; sie haben – per Definition - Fremdverantwortung für sein Wohl zu tragen – sie sind eben die Eltern dieses Kindes. Eltern können daher als Auftraggeber von systemischer Therapie mit Kindern nicht losgelöst von ihrer Funktion und ihren Gestaltungsmöglichkeiten betrachtet werden – auch wenn sie dies manchmal aktiv dem Therapeuten anbieten. Nimmt der Therapeut unreflektiert diese Einladung der Eltern zum Einzelsetting an, so läuft er Gefahr, sein ursprüngliches Terrain zu verlassen und entweder Elternaufgaben zu übernehmen (mit allen Problemen die sich daraus ergeben) – und damit früher oder später seine (Lösungs- )Neutralität zu verlieren, oder aber er mutet dem Kind zuviel Einfluss zu in einem Bereich, in dem es noch nicht eigenverantwortlich ist und sein kann (z.B. bei der therapeutischen Reflexion über Alkoholkonsum mit einem 12-jährigen). Dies wird früher oder später Kollisionen mit den Eltern hervorrufen und ein neues Problem erzeugen. Um diesen Situationen auszuweichen, könnte man die Prämisse formulieren, systemische Einzelarbeit mit Kindern ist nur in Bereichen sinnvoll, in denen das Kind bereits autonom ist (und es gibt solche Bereiche auch schon bei kleinen Kindern), z.B. Therapie mit einem 15-jährigen, der Beziehungsprobleme zu Gleichaltrigen hat o.ä. Diese Bereiche müssten in einem Erstgespräch jedoch mit allen Anwesenden geklärt werden. Das Abstecken der Terrains zwischen Eltern und TherapeutIn: Gilt auf Seiten der Eltern die Erziehungsprämisse, Erziehungsziel ist das Erreichen von Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Kindes in allen Lebensbereichen, so bedeutet das für das Kind, dass das Streben nach und das Erringen von Autonomie der Motor für seine Weiterentwicklung sein wird (nach dem Motto: Was gewinne ich, wenn ich mich schon selbst anziehen kann??? – Dann bin ich schon ein großer Bub und werde von meinen Eltern auch so behandelt, Mutti schreit dann nicht mehr so mit mir beim Anziehen etc.). Stirbt nun dieser Motor ab, läuft er übertourig etc. Wie immer man das Auftauchen von kindlichen Symptomen in diesem Zusammenhang auch bewerten will – sie haben zirkuläre Auswirkungen auf das Beziehungsgefüge Kind-Eltern – und somit auf die Versuche der Eltern, auf das Verhalten ihres Kindes Einfluss/keinen Einfluss zu nehmen (vergl. DE WAAL/THOMA). Aus dieser Perspektive ergibt sich, dass primäres Ziel der Auftragsklärung zwischen Therapeut und Eltern ein Dialog über die unterschiedlichen Möglichkeiten und Terrains der Einflussnahme wird – möglicherweise durch Metakommunikation. Die Eltern werden so zu Experten für die Herstellung von Wachstumsbedingungen, der Therapeut zu einem Experten für die Herstellung von Bedingungen im Sinne von Veränderung. Das ursprünglich komplementäre Zueinander von TherapeutIn und KlientIn gemäß ihren Positionen wird so um eine symmetrische Beziehungsebene gemäß ihren Funktionen erweitert. Die Therapeutin/der Therapeut weiß nicht, was dieses eine Kind speziell braucht (das werden die Eltern herausfinden), sie/er braucht sich also weder unterschwellig noch offen mit den Eltern zu duellieren („Sie sollten ihr Kind mehr...“). Eine mögliche negative symmetrische Eskalation könnte somit verhindert werden („Wer ist schuld dass sich das Kind noch immer nicht verändert hat?“). Der Schwerpunkt dieses Ansatzes ist also nicht so sehr, im Sinne G. SCHMIDT’s die Eltern zu CoTherapeuten zu machen (das können sie – je nachdem wie man Co-Therapeutenschaft definiert - ebenso wenig sein wie der Therapeut ein Co-Vater sein kann), sondern sie zur Kooperation gemäß ihren verschiedenen Möglichkeiten der Einflussnahme einzuladen. Es gilt, gemeinsam mit Eltern zunächst herauszufinden + was dieses Kind möglicherweise braucht + was dieses Kind in dieser speziellen Situation braucht + was Kinder in diesem Alter generell brauchen + und wer dazu von allen erwachsenen Anwesenden möglicherweise was beitragen kann (auch: was diesbezüglich Therapie leisten kann, was nicht). Also: „Schauen wir einmal, was jeder von uns gemäß seiner Funktion für das Kind tun kann!“ Dies kann möglicherweise zur „Arbeitsteilung“ zwischen den Eltern und der Therapeutin/dem Therapeuten führen, sodass unter dieser Prämisse ein therapeutisches Arbeiten mit einem Kind in einem Einzelsetting durchaus Sinn machen kann (aber auch immer wieder „Koordinationsgespräche mit den Eltern als Helfer mit einschließt). Dazu ein Beispiel: Die Eltern eines 15-jährigen kommen mit ihrem Sohn in Therapie. Ihr Sohn leide an massiven, unkonkreten Angstzuständen, die den Beginn einer Lehre unmöglich gemacht hatten. Sie würden ihn gern (im Einzelsetting, da dies ja nichts mit ihnen zu tun habe, Anm.) in Behandlung geben. Wiewohl es ihnen sehr wichtig gewesen war, in der ersten Stunde mitzukommen und den Therapeuten über ihren Sohn „aufzuklären“. Sie hatten zuvor eine therapeutische Behandlung für ihren Sohn veranlasst, doch der Therapeut habe ihnen nicht erlaubt, mit ihm zu reden, da er ja nur den Jugendlichen behandeln wolle. Nach 5 Stunden sei die Therapie durch den Therapeuten „erfolgreich“ beendet worden - das Symptom sei jedoch geblieben. Vater und Mutter schildern zunächst in sehr drastischen Worten, was passiert sei: Ihr Sohn habe vor wenigen Monaten eine Lehrstelle als Maurer begonnen – und zwar in einer Baufirma eines Bekannten des Vaters. Diese sei im gleichen Dorf, nur 5 Minuten vom Wohnhaus der Familie gelegen. Am ersten Arbeitstag (der Sohn hatte sich schon sehr darauf gefreut, zumal er wenige Wochen vorher schon ein paar „Schnuppertage“ in der Firma absolviert hatte) hätte der Sohn jedoch bereits nach einer halben Stunde „Angst“ bekommen und zu weinen begonnen. Er hätte selbst nicht gewusst warum. Dies hätte seine Angst noch verstärkt. Zu Mittag hätten Arbeitskollegen den Sohn dann nach Hause gebracht. Er gelobte, es am nächsten Tag noch einmal versuchen zu wollen. Am nächsten Tag wiederholte sich jedoch erneut die Situation. Er wurde nach Hause geführt und für den Rest der Woche krank geschrieben. Beim Arbeitsbeginn am darauffolgenden Montag sei dann die Angst wieder da gewesen, sodass er die Lehre schließlich abgebrochen habe. Auf tagelanges Zureden durch den Vater sei der Chef einverstanden gewesen, es noch einmal mit dem jungen Mann zu probieren – jedoch es ging wieder nicht. Vater und Mutter schilderten wortgewaltig und gestenreich welches Problem ihnen ihr damit Sohn angetan habe. Sie beide würden seit ihrem 15.Lebensjahr hart arbeiten und hätten sich immer bemüht, ihre Kinder zu rechtschaffenen Leuten zu erziehen. Und nun das. Sie waren furchtbar zornig und gleichzeitig hilflos. Die Mutter hatte Angst vor einer psychiatrischen Karriere ihres Sohnes. Der Sohn (ein 2-Meter-Mann mit Händen wie Baggerschaufeln) saß zusammengesunken in seinem Sessel und konnte in dieser Situation kaum Konstruktives am Gespräch beitragen („Ich weiß auch nicht was mit mir ist. Ich habe so viel Angst. Und weiß nicht wovor“.). Was die Eltern wiederum sehr wütend machte... An mich formulierten die Eltern den Auftrag, dem Sohn die Angst zu nehmen, damit er endlich arbeiten gehen könne. Auf mein Nachfragen meinten sie noch, ihr Sohn sei ziemlich sensibel und unreif; er habe einfach noch nicht den Ernst der Lage begriffen. Ihn würde nur lang schlafen, fernsehen und fortgehen interessieren. Der Sohn wehrte sich dagegen, konnte jedoch keine anderen Dinge aufzählen, die ihm wichtig waren. Ich fragte die Mutter, was sie zuvor mit „unreif“ gemeint hatte, worauf sie erzählte, ihr Sohn sei ein „Novembergeborener“, der schon mit fünf Jahren seine Schulbildung begonnen hatte. Er sei seinen Klassenkameraden (die bis zu einem Jahr älter waren) stets in Leistung und Verhalten hinterher gehinkt. Somit sei irgendwie verständlich, dass er sich auch mit dem Lehrbeginn schwer tue... Es gelang, gemeinsam das Problemverhalten sinngemäß als „Anpassungsstörung aufgrund mangelnder Reife“ zu definieren. Dies bedeutete aus therapeutischer Sicht, dass Bedingungen für ein Nachreifen des Jungen geschaffen werden mussten („Er muss lernen, was es heißt, reif wie ein 15-jahriger zu sein“ – bezüglich seines Verhaltens ein klarer Auftrag an seine Eltern, bezüglich seiner Angst ein klarer Auftrag an den Therapeuten). Ich gab den Eltern die Aufgabe, aufgrund ihrer eigenen reichhaltigen beruflichen Erfahrung bis zur nächsten Stunde eine Liste anzufertigen mit Punkten, die ein 15-jähriger können muss, um einer Lehre überhaupt gewachsen zu sein. In die nächste Stunde brachten die Eltern eine lange Liste von ca. 15 Punkten mit. Ich bat sie, neben der Aufzählung der Punkte (z.B. Pünktlichkeit, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit etc.) um eine Bewertung des Sohnes nach dem Schulnotensystem. Von den 15 Punkten gaben ihm die Eltern in zwei Punkten einen 1er (Freundlichkeit, Neugierde), neun 3-er oder 4-er, sowie vier 5-er. Was zunächst sehr hoffnungslos aussah schien dann aber machbar, als die Eltern ihre Idee des Maximums („Man muss überall einen 1-er haben“) auf die Idee des Minimums reduzieren konnten („Eigentlich reicht ja auch ein 4-er. Ein „Genügend“ heißt ja, dass es genügt!“). Wir einigten uns darauf, dass von den vier 5-ern drei in den Kompetenzbereich der Eltern „als Trainer“ fallen würden (z.B. das Erlernen einer entsprechenden Arbeitshaltung). Der Auftrag, der für mich überblieb, war das Überwinden von Angst durch das Fassen von Mut als Gegengewicht (vergl. dazu Susi SIGNER-FISCHER). Der Sohn zeigte sich für das Vorhaben erstmals motiviert. Die nächsten Stunde wurde vereinbarungsgemäß im Einzelsetting mit ihm abgehalten. Er erzählte, er wisse nun erstmals, warum er die Lehre nicht durchgehalten habe. Er sei keineswegs faul gewesen, sondern habe sich, im Gegenteil, schon sehr darauf gefreut, zumal ihm das „Schnuppern“ in der Firma einige Wochen zuvor viel Spaß gemacht hätte. Jedoch habe er am ersten Arbeitstag seiner Lehre schmerzhaft erfahren müssen, dass der Maurerberuf etwas völlig Anderes war als er sich ursprünglich gedacht hatte: keine so „schöne“ Arbeit wie beim „Schnuppern“, sondern nur monotone, körperlich schwere Arbeit. Er sei schlichtweg überfordert gewesen. Nun wisse er, was er nicht wolle, jedoch wisse er noch nicht was er wolle. Er wisse nicht, welche anderen Berufe es noch gäbe, und was man da arbeiten müsse. Er hatte Angst vor dem Unbekannten. Wir erstellten eine Liste, was alles er benötigen würde, um wieder Mut zu fassen um einen neuen Anlauf wagen zu können. Einerseits musste er mehr über mögliche andere Lehrberufe in Erfahrung bringen (hier nutzte ich therapeutisch seine positive Eigenschaft der Neugierde), andererseits wuchs zunehmend sein Bedürfnis nach eigenem Geld (er wollte nicht mehr auf das geringe Taschengeld seiner Eltern angewiesen sein), je mehr ich ihn beauftragte, sich mehr mit der Lebens- und Berufssituation seiner etwas älteren Freunde zu beschäftigen. Zudem fruchtete das „Arbeitshaltungstraining“ zuhause durch seine Eltern. Diese simulierten in ausgezeichneter Weise einen Wirtschaftsbetrieb: Er konnte nun nicht mehr bis Mittag im Bett bleiben und anschließend stundenlang fernsehen sondern musste um acht Uhr morgens seine Arbeit antreten. Seine Mutter gab ihm täglich neue Arbeitsanweisungen. Mittags hatte er jeweils eine Stunde „Mittagspause“, anschließend musste er bis 17 Uhr weiterarbeiten. Das Wochenende war frei. In der letzten Stunde meinte er, er sei nun „so weit“. Er habe das Arbeiten zuhause satt, wolle endlich richtig arbeiten und Geld verdienen. Seine Mutter würde ihn nerven, da könne es in einer richtigen Firma gar nicht schlechter sein. Er hatte sich mittlerweile auch schon in mehreren Firmen als Karosseriespenglerlehrling beworben und hätte bereits eine Lehrstellenzusage. Diese Lehrstelle hätte er ohne Wissen und Zutun seiner Eltern selbst gefunden. Er sei sehr stolz darauf. Besonders stolz sei er aber, dass er beim Vorstellungsgespräch den Chef gefragt, habe, was denn nun genau auf ihn zukommen werde und was sich dieser konkret von ihm erwarte. Dies hätte ihn „zu 99%“ sicher gemacht. 1% Unsicherheit sei o.k. Er selbst hatte zuvor gemeint, 90% Sicherheit würden bereits ausreichen, 10 % Angst vor dem Neuen seien für einen 15-jährigen aushaltbar. LITERATUR: DE WAAL, Helmuth/THOMA, Christoph: Wege aus der Elternfalle. Was in der Erziehung wirklich getan werden kann. Ennsthaler Verlag (Steyr) 2003. LENZ, Gerhard/OSTERHOLD, Gisela/ELLEBRACHT, Heiner: Erstarrte Beziehung – heilendes Chaos. Einführung in die systemische Paartherapie und –beratung. Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2000. SCHMIDT, Gunther: Hypnosystemische Arbeit mit Eltern als Co-Therapeuten. Audio-Cassettte. Carl-AuerVerlag (Heidelberg). SIGNER-FISCHER: Magie und Realismus in der Angstbehandlung. Hypnotherapeutische Methoden mit Kindern und Jugendlichen. In: Manfred Vogt-Hillmann/Wolfgang Burr (Hrsg.): Kinderleichte Lösungen. Lösungsorientierte Kreative Kindertherapie. S. 143-158. Borgmann (Dortmund) 2. verb. Auflage 2000 Dr. Christoph THOMA ist selbständiger Psychotherapeut für systemische Familientherapie (Amstetten) mit Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Eltern; Supervisor Praxis für Psychotherapie, Supervision & Coaching: Preinsbacherstraße 2, A-3300 Amstetten, Tel.: 07472/66537, Mail: [email protected]