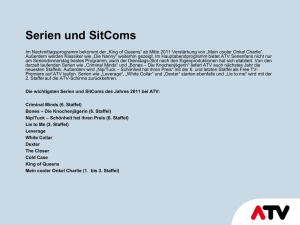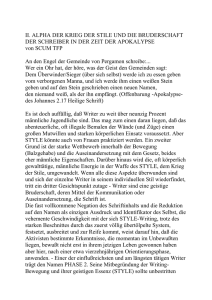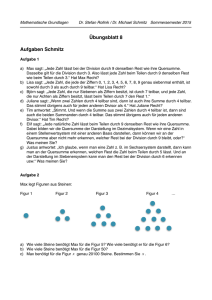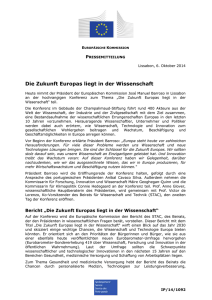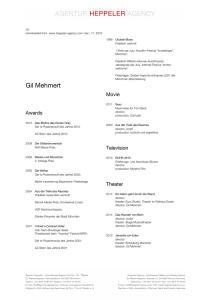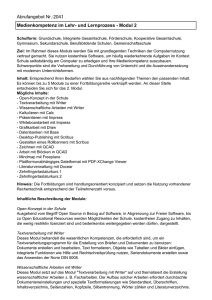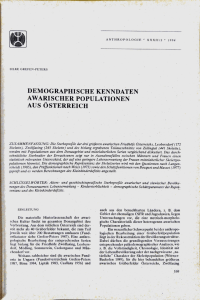Besser_als_Kino
Werbung
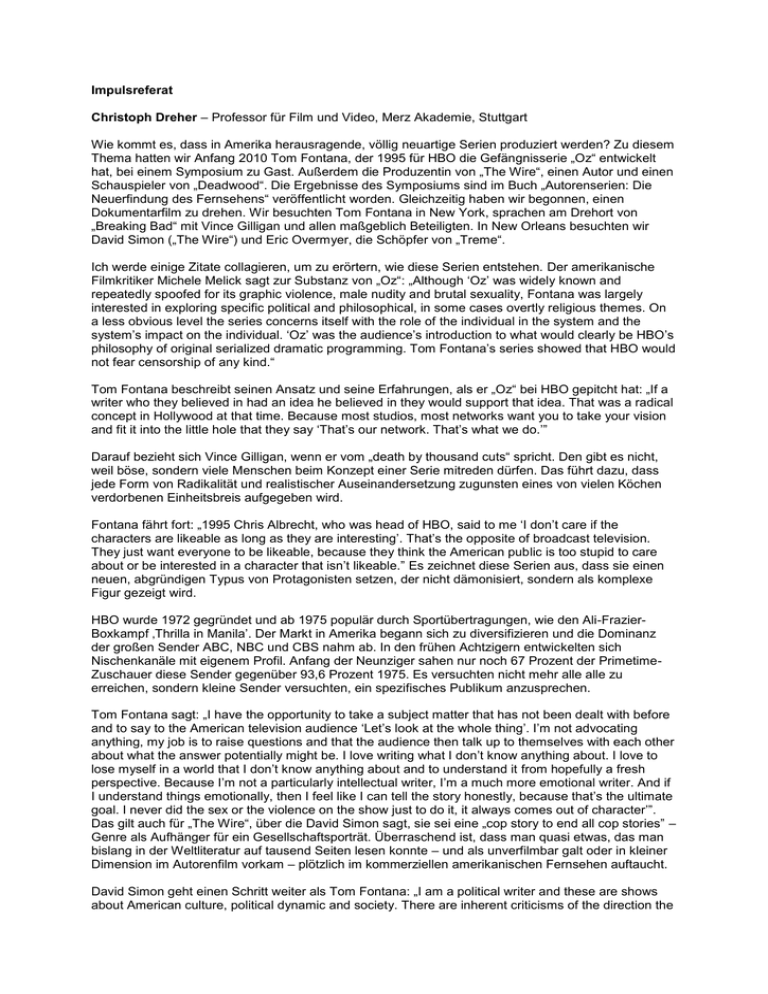
Impulsreferat Christoph Dreher – Professor für Film und Video, Merz Akademie, Stuttgart Wie kommt es, dass in Amerika herausragende, völlig neuartige Serien produziert werden? Zu diesem Thema hatten wir Anfang 2010 Tom Fontana, der 1995 für HBO die Gefängnisserie „Oz“ entwickelt hat, bei einem Symposium zu Gast. Außerdem die Produzentin von „The Wire“, einen Autor und einen Schauspieler von „Deadwood“. Die Ergebnisse des Symposiums sind im Buch „Autorenserien: Die Neuerfindung des Fernsehens“ veröffentlicht worden. Gleichzeitig haben wir begonnen, einen Dokumentarfilm zu drehen. Wir besuchten Tom Fontana in New York, sprachen am Drehort von „Breaking Bad“ mit Vince Gilligan und allen maßgeblich Beteiligten. In New Orleans besuchten wir David Simon („The Wire“) und Eric Overmyer, die Schöpfer von „Treme“. Ich werde einige Zitate collagieren, um zu erörtern, wie diese Serien entstehen. Der amerikanische Filmkritiker Michele Melick sagt zur Substanz von „Oz“: „Although ‘Oz’ was widely known and repeatedly spoofed for its graphic violence, male nudity and brutal sexuality, Fontana was largely interested in exploring specific political and philosophical, in some cases overtly religious themes. On a less obvious level the series concerns itself with the role of the individual in the system and the system’s impact on the individual. ‘Oz’ was the audience’s introduction to what would clearly be HBO’s philosophy of original serialized dramatic programming. Tom Fontana’s series showed that HBO would not fear censorship of any kind.“ Tom Fontana beschreibt seinen Ansatz und seine Erfahrungen, als er „Oz“ bei HBO gepitcht hat: „If a writer who they believed in had an idea he believed in they would support that idea. That was a radical concept in Hollywood at that time. Because most studios, most networks want you to take your vision and fit it into the little hole that they say ‘That’s our network. That’s what we do.’” Darauf bezieht sich Vince Gilligan, wenn er vom „death by thousand cuts“ spricht. Den gibt es nicht, weil böse, sondern viele Menschen beim Konzept einer Serie mitreden dürfen. Das führt dazu, dass jede Form von Radikalität und realistischer Auseinandersetzung zugunsten eines von vielen Köchen verdorbenen Einheitsbreis aufgegeben wird. Fontana fährt fort: „1995 Chris Albrecht, who was head of HBO, said to me ‘I don’t care if the characters are likeable as long as they are interesting’. That’s the opposite of broadcast television. They just want everyone to be likeable, because they think the American public is too stupid to care about or be interested in a character that isn’t likeable.” Es zeichnet diese Serien aus, dass sie einen neuen, abgründigen Typus von Protagonisten setzen, der nicht dämonisiert, sondern als komplexe Figur gezeigt wird. HBO wurde 1972 gegründet und ab 1975 populär durch Sportübertragungen, wie den Ali-FrazierBoxkampf ‚Thrilla in Manila’. Der Markt in Amerika begann sich zu diversifizieren und die Dominanz der großen Sender ABC, NBC und CBS nahm ab. In den frühen Achtzigern entwickelten sich Nischenkanäle mit eigenem Profil. Anfang der Neunziger sahen nur noch 67 Prozent der PrimetimeZuschauer diese Sender gegenüber 93,6 Prozent 1975. Es versuchten nicht mehr alle alle zu erreichen, sondern kleine Sender versuchten, ein spezifisches Publikum anzusprechen. Tom Fontana sagt: „I have the opportunity to take a subject matter that has not been dealt with before and to say to the American television audience ‘Let’s look at the whole thing’. I’m not advocating anything, my job is to raise questions and that the audience then talk up to themselves with each other about what the answer potentially might be. I love writing what I don’t know anything about. I love to lose myself in a world that I don’t know anything about and to understand it from hopefully a fresh perspective. Because I’m not a particularly intellectual writer, I’m a much more emotional writer. And if I understand things emotionally, then I feel like I can tell the story honestly, because that’s the ultimate goal. I never did the sex or the violence on the show just to do it, it always comes out of character’”. Das gilt auch für „The Wire“, über die David Simon sagt, sie sei eine „cop story to end all cop stories” – Genre als Aufhänger für ein Gesellschaftsporträt. Überraschend ist, dass man quasi etwas, das man bislang in der Weltliteratur auf tausend Seiten lesen konnte – und als unverfilmbar galt oder in kleiner Dimension im Autorenfilm vorkam – plötzlich im kommerziellen amerikanischen Fernsehen auftaucht. David Simon geht einen Schritt weiter als Tom Fontana: „I am a political writer and these are shows about American culture, political dynamic and society. There are inherent criticisms of the direction the country has taken. If I have finished a project and all I’ve done is entertain you and I haven’t provoked a certain amount of debate among people who have seen the material I failed.” Vince Gilligan sagt, dass sich alles aus den Figuren entwickeln muss. „We ask ‘What is Walter White thinking now? What is his fear right now? What is he hoping for? Jesse, does Jesse feel good about what he’s doing now?’ We try to tell our story as organically as possible. Every now and then I have an idea for a big scene but if I’m strict I put these ideas to the back of my head and try not to force the characters towards them. The most real characters dictate their own terms.” Der Aspekt der impliziten Dramaturgie ist bei „Breaking Bad“ herausragend. „What I like is visual storytelling. One of my writers gave me his new script and said: ‘There’s six pages that go by without a word of dialogue. Everything is just scene description. And the story is being told by the characters’ behaviour and not by what is coming out of his mouth.’” Case Study Stephan Rick – Drehbuchautor „Allein gegen die Zeit“ Silja Clemens – Drehbuchautorin „Allein gegen die Zeit“ Rick: „Allein gegen die Zeit“ ist eine dreizehnteilige Thrillerserie für Jugendliche à 25 Minuten. Die Idee kam vom NDR, er wollte etwas haben in der Richtung „24“ für Kinder. Wir haben uns gefragt ‚Wie machen wir das ohne Foltern und Ins-Knie-Schießen’? Clemens: Es ging darum, ob man ein spannend erzähltes Echtzeitformat für Kinder in Deutschland machen kann, und nicht darum, thematisch bei „24“ zu klauen. Was uns an „24“ fasziniert hat, war, die Atemlosigkeit und Spannung. Ansonsten haben wir uns nicht an „24“ orientiert. Es ist die Geschichte von fünf Nachsitzern – eher Underdogs als klassische Helden –, die an einem Samstag in der Schule sind und plötzlich merken, dass eine Klasse im Chemiesaal gefangen gehalten wird. Es geht aber nicht um die Klasse, sondern um den Vater eines unserer Helden, einen berühmten Wissenschaftler. Er hat das Nanotron erfunden, mit dem man Nanobots herstellen kann. Damit zerstört man Gehirntumore. Die Nebenwirkung: Wenn sie an den Synapsen im Hirn andocken, kann man den menschlichen Willen steuern. Das wissen die Bösewichter, und deshalb muss der Wissenschaftler als Chemielehrer untertauchen. Die Bösewichter haben ihn ausfindig gemacht und den Plan, die Nanobots bei einem Treffen der EU den Staatschefs zu injizieren, um die Macht über Europa an sich zu reißen. Natürlich geht am Ende alles gut aus. Rick: Es war uns wichtig, dass die Hauptfiguren normale Schüler sind, die die Herausforderung erstmal annehmen müssen und Probleme mit Witz und Cleverness lösen. Die Gangster treten martialisch auf, weil sich „Allein gegen die Zeit“ an die älteste Zielgruppe richtet. Wenn man für sie spannend erzählen will, wird es irgendwann schwierig, ohne Waffen usw. die Spannung aufrechtzuerhalten. Die Serie musste günstig herzustellen sein. Deswegen haben wir sie hauptsächlich an einen Ort, die Schule, verlegt. Dann kam die Idee mit der Geiselnahme. Weil wir also einen Thriller erzählen wollten, mussten wir überlegen, was der Plan der Antagonisten ist. Man kann so eine Geschichte nicht schreiben, bevor man nicht weiß, was die Antagonisten wollen. Wir haben eine Dreiaktstruktur entwickelt, mit klassischem erstem Wendepunkt, Midpoint und zweitem Wendepunkt. Das hat geholfen, weil wir vom Großen ins Kleine kommen konnten. Der erste Wendepunkt: Die Kinder waren erfolglos bei der Polizei und nehmen den Kampf mit den Gangstern selbst auf. Midpoint: Die Kinder stehen kurz davor, die Gangster zu besiegen, aber dann geht alles schief. Der zweite Wendepunkt ist der große Tiefpunkt: Alle glauben, sie haben verloren, dann kommt noch eine Wendung in Folge 10. Davon ausgehend haben wir die Folgen grob durchgeplottet und Cliffhanger festgelegt. Wir haben die Folgen über mehrere Wochen im Writer’s Room entwickelt. Ganz wichtig sind die Cliffhanger. Die spielen in episch erzählten Geschichten eine wichtige Rolle, weil der Zuschauer wissen will, wie es mit ‚seinen’ Helden weiter geht. Bei „24“ sind die Cliffhanger meist sehr negativ. Uns war wichtig, neben einem negativen Cliff auf einem anderen Handlungsstrang einen positiven zu haben, damit die Kinder nicht traumatisiert ins Bett entlassen werden, z. B. macht jemand eine wichtige Entdeckung. Die Gewaltdarstellung ist reduziert und sehr abstrakt. Der Comic Relief ist sehr wichtig, für komische Momente sorgen immer wieder von der Grundanlage her eher statische Figuren. Uns war wichtig, dass die Kinderhelden Entwicklungspotenzial haben, innere Konflikte, Geheimnisse. Der eine verheimlicht, dass er Insulin braucht, die andere, dass sie in den einen verliebt ist. Es gibt alle möglichen Punkte, die zu Wendungen und Rückschlägen führen. Es gibt mehrere Handlungsebenen, meist zwei Handlungsstränge auf der Heldenebene, weil die Kinder nicht immer zusammen sind. Es gibt den Handlungsstrang in der gefangenen Klasse, den GangsterHandlungsstrang und ein oder zwei Erwachsenenhandlungsstränge. Sehr viel in knapp 25 Minuten. Clemens: Wir springen viel hin und her zwischen den schlussendlich sechs Handlungssträngen, alle 25-Minuten-Bücher sind fast so lang wie 45-Minuten-Bücher. Jede Folge hat so viele Schnitte wie ein „Tatort“. Man darf zwischendurch lachen, aber selten Atem holen. Wir haben substanziell entwickelt. Stephan und ich hatten ein fünfzehnseitiges Konzept mit den Hauptfiguren, einem Abriss der Nebenfiguren, einem Fünfzeiler, was pro Folge passiert. Damit sind wir in den Writer’s Room gegangen, sind drei Tage in ein Landhaus gefahren, haben uns dem Thema angenähert und darüber gesprochen, welche Serien wir im Moment toll finden, welche uns geprägt haben. In den ersten Tagen war sogar der Redakteur dabei, die Producerin war fast die ganze Zeit dabei, der Regisseur und drei andere Autoren. Das Ganze war effizient, wir haben keine Rückschläge erlitten. Wir haben mit dem Redakteur auf dem kurzen Dienstweg gesprochen. Wenn es um das Budget ging oder darum, die Kinder in einem Auto durch die Stadt fahren zu lassen, haben wir beim Produzenten angeklopft. Alle hatten den gleichen Ton und die gleichen Figuren im Kopf. Wer die Drehbücher liest, hat nicht den Eindruck, dass sie von verschiedenen Autoren stammen. Rick: Wir saßen bis in die Bilder-Treatment-Phase zusammen. Wir haben auch Patenschaften gebildet. Von uns fünf, die permanent im Writer’s Room waren, stand jeder für eine der Figuren Pate und ist für deren Interessen eingetreten, damit sie nicht nur funktional wird. Clemens: Wir haben die Kritik nicht nur Produktion und Redaktion überlassen, sondern uns die Folgen gegenseitig zugeschickt. Es war ein Glücksfall, wir haben uns sehr gut ergänzt. Um im Writer’s Room arbeiten zu können, muss man uneitel sein und Lust auf Teamarbeit haben. Es gibt keine blöden Fragen. Eine schlechte Idee kann Vorlage für die nächste gute sein. Publikum: Es heißt, Writer’s Rooms seien nicht finanzierbar. Gab es mehr Geld? Clemens: Nein. Ich verstehe die Frage auch nicht. Wenn ich allein eine Folge für irgendwas schreibe, kriege ich das große Geld auch erst am Schluss, die ganze Arbeit mache ich davor. Das ist so als Autor, für den großen Teil der Arbeit gibt es wenig und für das bisschen Polieren das große Geld. Publikum: Wie bewegt ihr euch zwischen den Plot Points und dem Wunsch, den Figuren ein Eigenleben zu verpassen? Clemens: Ein Thriller ist per se ein Plot-driven-Format, ein Drama ein Character-driven-Format. Wir haben aber versucht, innerhalb des Thrillers schöne Charakterentwicklungen zu finden. Publikum: Das Format hat Endlichkeit durch die Story, die kann man nicht über Staffeln erzählen. Clemens: Wir haben eine zweite Staffel gemacht, allerdings mit einer neuen Geschichte: Die Kinder fahren zusammen ins Ferienlager und Ben wird entführt. Wir hätten wahnsinnig gern auch noch eine dritte Staffel gemacht. Das Problem ist, dass die Kinder zu alt werden und aus der Kika-Zielgruppe herauslaufen. Wir mussten uns beeilen, um das noch hinzukriegen, bevor die alle einsneunzig sind. Rick: Um den Eindruck von Echtzeit zu erwecken, gibt es das Uhr-Element. Im Vorspann sieht man die Schuluhr und noch mal in der Mitte. Wir haben das benutzt, um Zeitsprünge zu machen, weil die 25 Minuten, die eine Stunde erzählen, natürlich nicht Echtzeit sind. Clemens: Auch bei Jack Bauer ist es nicht Echtzeit. Nach der Ausstrahlung gab es die letzten zwei oder sogar drei Folgen in der Mediathek zu sehen. Wir hatten das Glück innerhalb kurzer Zeit ausgestrahlt zu werden, vier Abende die Woche über zweieinhalb Wochen. Rick: Dann wurde es noch mal komplett wiederholt. Kika-quotentechnisch lagen wir etwa auf Senderschnitt, aber das ist, wenn man nach den Zahlen geht, eher traurig. Es gab im Internet noch mal ungefähr so viele Clicks wie im Fernsehen zugeschaut haben. Case Study Stefan Kolditz – Drehbuchautor „Unsere Mütter, unsere Väter“ Benjamin Benedict – Produzent „Unsere Mütter, unsere Väter“ Kolditz: Ich habe seit 2005 an dem Stoff gearbeitet. Damals traf ich mich mit Nico Hofmann, der mir anbot, einen Film oder Mehrteiler zu machen, der einen Dialog mit seinem Vater über den Zweiten Weltkrieg darstellt. Also nicht wieder die Bild-Zeitung mit der Titelseite zu optionieren oder den sechzigsten Jahrestag von irgendwas nachzugestalten. Jemand hat ein persönliches Anliegen. Das war auch mein Anliegen. Es ist letztlich – so absurd das klingt, weil es ein sehr teurer Film geworden ist – ein Dialog zwischen Nico Hofmann und seinem Vater geworden, der noch lebt, und mir und meinem Vater, der seit dreißig Jahren tot ist. Beide waren in dieser Zeit als Soldat in Russland. Ich wollte vom klassischen Heldenkonzept abgehen und eine Gruppe von Figuren erzählen, die nicht in das klassische duale, Schwarz-Weiß-Konzept passen – der SS-Offizier und der Widerstandskämpfer oder, wenn es um die DDR geht, der Stasi-Offizier und der aufrechte Bürgerrechtler. Ich wollte das Salz dieses Systems erzählen, etwas über Leute, die wie die meisten von uns versuchen, über die Runden zu kommen, ihre Existenz zu leben. Es sollten junge Leute sein, eine Gruppe, die am Anfang steht: Ablösung von Zuhause, Erwachsenwerden in einer sehr existenziellen Situation. Der Film – er fällt als abgeschlossener Dreiteiler hier ein bisschen raus – beginnt 1941 mit dem Überfall auf die Sowjetunion und endet kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Plotlinien berühren sich, gehen aber immer wieder auseinander. Dramaturgisch und inszenatorisch muss viel geleistet werden. Es sollte ein Stoff sein, der sich nicht, an der Illustration historischer Momente orientiert, also z. B. the ‚Best of RAF’, und man sieht, was man hundert Mal gesehen hat, mit Schauspielern nachgespielt. Oder zum 26. Mal den Mauerfall. Mein Ziel war, etwas zu machen, das sich von dem unterscheidet, was bis jetzt in Deutschland dramaturgisch wie vom Grad der Grausamkeit her zu sehen war. Grausamkeit nicht als Pornografie, sondern im Bezug auf die Figuren, in dem Sinne, dass diese an Grenzen geraten, die sie nicht erahnt haben. Die einen sind nicht politisch, die anderen vom Krieg überzeugt. Sie lernen über den Krieg, den sie mit prägen, wer sie wirklich sind – es ist ja nicht der Krieg, der sie nur prägt, sie prägen den Krieg auch. Die Erkenntnisse, zu denen sie gelangen, finden sie selber nicht immer gut. Benedict: Kontur und inhaltliche Ausrichtung des Projekts sind zentral mit Stefan Kolditz verbunden. Er hat die drei Mal neunzig Minuten zusammen mit der Dramaturgin Carolin Haasis geschrieben, die auch eine entscheidende Rolle hat. Der Zeitraum von sechs Jahren für Stoffentwicklung ist enorm. Der Film ist in dem, was er erzählen möchte, sehr anspruchsvoll, das Budget ist es auch. Wir liegen knapp unter 14 Millionen, allein mit deutschen Mitteln, was in der deutschen Produktionslandschaft singulär ist. Es gibt Koproduktionen, die in so eine Höhe kommen. Das ZDF trägt den Löwenanteil und es gibt Förderung. Damit ist die Grenze dessen erreicht, was man für ein Fernsehprojekt an Budget mobilisieren kann. Serielles Erzählen kann sich über Staffeln hinweg fortschreiben. Es gibt Serien, denen erzählerisch gedient wäre, wären sie nicht fortgesetzt worden, die aber Opfer ihres Erfolges sind, wie „Prison Break“. Die Idee war für eine Staffel gut. „24“ ist ein innovatives Format, weil es mit dem tendenziellen Echtzeitverfahren – die Werbepausen sind reingeschummelt – spannend ist. Bei mir setzte aber in Staffel 7, als die Welt wieder innerhalb von 24 Stunden bedroht und gerettet wurde, eine gewisse Ermüdung ein. Serien wie „Mad Men“, „Breaking Bad“ oder „Big Season“ sind wunderbar in Ihrer Fortschreibung. Die zehnteilige amerikanische Serie „Band Of Brothers“ war für mich die kopernikanische Wende in der Wahrnehmung der Möglichkeiten, die Fernsehen in Differenzierung und Genauigkeit hat. Die englische sechsteilige Miniserie „State of Play“ ist auch ein gutes Beispiel. Wichtig ist zu klären, welche Partnerschaften man eingehen kann. Ein Projekt dieser Größenordnung ist nur in der Verabredung mit einem Sender zu machen, der dabei ein Risiko eingeht. Es ist einerseits Mode, andererseits problematisch bei Senderentscheidungen von Mut und Risiko zu sprechen. Es ist vonseiten des Senders ein Zugeständnis. Das eine ist das Zugeständnis der Zeit in der Programmierung. Man kann streiten, wie weit Quote ein geeignetes Kriterium zur Beurteilung von Programmen ist. Nichtsdestotrotz ist es ein zentraler Aspekt, auch da eine strategische Partnerschaft mit dem Sender zu haben. Und es ist entscheidend, dass man nicht den „death by a thousand cuts“ hat, nicht in aller Radikalität anfängt und ganz woanders endet. Wir hatten von März bis August 88 Tage Drehzeit. Man verlangt für einen langen Zeitraum, der auch den vieler Kinofilme übertrifft, besonderes Engagement. Welche Schauspieler kriegt man? Wir haben einen wunderbaren Cast, aber alle mussten bereit sein, das Investment zu tätigen und sich die Zeit freizunehmen. Und es war gesplittet, wir haben in Litauen und quer durch Deutschland gedreht. Die organisatorischen Anforderungen waren größer als bei vergleichbaren TV-Movies oder Eventfilmen. Eine andere Frage ist, ob man es sich leisten kann, über einen so langen Zeitraum zu entwickeln. Für einen Produzenten ist ein Projekt, das sechs Jahre braucht von der Idee bis zum Dreh, schwierig einzuplanen in der Art, wie es Energie und Ressourcen im Hause bindet. Das bricht sich auf individuelle Fragestellungen runter, da ist keine grundsätzliche Lösung zu finden. Es ist oft so, dass man von einem Sender nur ein minimales Entwicklungsbudget bekommt. Wir reden über einen Zeitpunkt, der entscheidend ist. In dem ein Produzent auf eigenes Risiko arbeitet und der für einen Autor problematisch ist, weil der entscheidende Anteil der Arbeit der schlecht bezahlte ist. Es hängt an der Leidenschaft, mit der man an Stoffe glaubt. Auch da ist der Autor besonders zu nennen, der in dieser Phase höchster Unsicherheit Zuversicht haben muss. Die ersten Drehbuchfassungen lagen fast zehn Millionen über dem Budget. Eine eigentlich groteske Vorstellung, zehn Millionen kürzen zu müssen. Das hat zu, diplomatisch ausgedrückt, emotional intensiven Phasen geführt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Mehrteiler, so sehr ich ihn schätze, die problematischste Form von allen. Bei einer Serie zahlt man Lehrgeld in der ersten Staffel, in der zweiten bringt man das auf null. In der dritten muss man nicht neu akquirieren. Ein Mehrteiler ist fertig und bringt dem Produzenten wirtschaftlich nichts mehr. Es ist zu früh, um zu sagen, ob sich ein Weltvertrieb findet, es ist bewusst eine sehr deutsche Geschichte. Aber wie programmiert man sie? Ist das Publikum bereit, sich an drei Abenden in einer Woche neunzig Minuten Zeit zu nehmen? Ich frage mich, wie weit man den Vergleich epischen Erzählens mit literarischen Gattungen einführen kann. Ich selber mache Literaturadaptionen unterschiedlichster Art. Mein Eindruck ist, dass fünfzig Seiten literarischer Text ungefähr neunzig Minuten Film ergeben. „Kommissarin Lund“, mit zwanzig Folgen bzw. in Deutschland mit zehn, hat einen Thrillerroman als Vorlage. Man kann auch über 15 Stunden einen Roman verfilmen. Das merkt man in der Verdichtung und den Möglichkeiten, Figuren ausführlich zu erzählen. John Grisham schreibt sehr filmisch, aber das ist die Ausnahme. Romane folgen in Figurenentwicklung und Dramaturgie viel eher einem eigenen Gesetz. Unser Film ist auch episch, weil er eine Größe hat und eine Epoche erzählt. Panel Christian Junklewitz (Redakteur, www.serienjunkies.de): Was ist der Reiz an Figuren, die sich durch Ambivalenz zwischen dem, was sie denken und sagen, ihrem Handeln und ihrer Moral auszeichnen? Kolditz: Es ist für jeden Autor existenziell im Dialog die Differenz zwischen dem, was wir sagen und was wir meinen, zu erzählen, und das hat mit epischem Erzählen überhaupt nichts zu tun. Das ist der Fall bei den guten amerikanischen Filmen oder Serien. Der Reiz an den Figuren, die nicht in klassische Muster hineinfallen, ist, dass sie die Differenzierung dessen widerspiegeln, was wir möglicherweise selber erlebt haben, eben wie kompliziert das Leben geworden ist. Niemand, außer in Soaps, erzählt die ganze Zeit, was er denkt. Ich komme aus der DDR. Ich kenne diese ganze ideologische Überfrachtung. Vor etwas mehr als zwanzig Jahren gab es Konzepte, die uns erklären sollten, wie das Leben funktioniert, aber wir wissen, es funktioniert so nicht. Wir wissen aber auch, dass das, was uns als Heilsversprechen des Kapitalismus gepredigt wurde, auch nicht funktioniert. Wir leben in einer hoch differenzierten Zeit. „Breaking Bad“ ist ein Beispiel dafür, dass sich Charaktere in einer solchen Zeit plötzlich nicht nur anders verhalten, sondern auch anders dargestellt werden können. Da bietet Erzählen über einen größeren Zeitraum die Möglichkeit, Charaktere an Punkte zu führen, die einem neunzig Minuten gar nicht ermöglichen. Peter Hacks, ein bedeutender Autor aus der DDR, der in Vergessenheit geraten ist, sagt in den „Maßgaben der Kunst“: „Der Autor weiß immer mehr, als er kann, und kann immer mehr, als er weiß.“ Die Leerstelle entscheidet, ob die Sache schief geht, oder ob er mehr konnte, als er wusste. Das kann ich für mich noch nicht beantworten. Es ist erstaunlich, dass sich das ZDF auf das Risiko eingelassen, etwas zu tun, was man so in Deutschland noch nicht gesehen hat, auch weil ich ein Konzept gewählt habe mit fünf jungen Schauspielern, die zwar ihre Meriten haben, aber dem klassischen ZDFPublikum nicht bekannt sind. Wir wollten über das Konzept eine Art von größerem authentischem Erzählen bringen, als mit Schauspielern zu arbeiten, die beim Publikum eine bestimmte Art der Wahrnehmung auslösen. In puncto Radikalität kommen wir immer wieder auf „Breaking Bad“. Da haben wir einen Chemielehrer, der in Dinge verwickelt wird und Dinge tut, die man mit so einer Figur im normalen Leben nicht verbinden würde. Wenn man so eine Figur hat, müssen im Konzept die Ereignisse, die auf sie einwirken und dann von ihr zurückwirken, von einer solchen Kraft und Radikalität sein, dass am Anfang banale Figuren über ihre Entblätterung ihrem Kern ganz nahekommen und entdecken, was sie alles in sich haben. Nur so ist dieser Krieg auch zu erklären. Rick: In vielen epischen Serien, wie bei Tony Soprano, der seinen Neffen umbringt, finden wir als Zuschauer unsere dunklen Kerne auf einer überhöhten, transponierten Ebene wieder. Junklewitz: Ist es das Wiedererkennen von Ambivalenz, wodurch die Figuren Nähe zum Publikum herstellen, trotz der unsympathischen Dinge, die sie tun? Rick: Auf jeden Fall. Tony Soprano, Chef der Mafiafamilie, hat zuhause eine pubertierende Tochter, mit der er sich rumschlagen muss. Es werden Momente genommen, die wir kennen, und mit Dingen vermengt, die wir fasziniert beobachten, weil sie in einer völlig fremden Welt spielen, in die wir eintauchen dürfen. Darüber funktioniert auch Walter White in „Breaking Bad“. Das ist überhöhtes Erzählen, aber es wird authentisch, fast dokumentarisch erzählt, wie er jeden Schritt gehen muss. Kolditz: Wir reden nicht zufällig die ganze Zeit über amerikanisches Fernsehen. Es gibt aus meiner Sicht im deutschen Fernsehen so gut wie nichts, das man hier referenziell verwenden könnte – obwohl viele von uns selbst Teil des Problems sind. Walter Schmidinger, der große Theaterschauspieler, hat gesagt, dass er ins Theater gehe, um etwas zu sehen, das er noch nie gesehen hat. Beim deutschen Fernsehen – ich will kein Bashing machen, das sind oft Plattitüden – hat man das Gefühl, ist es umgedreht: Ich will nicht sehen, was ich noch nie gesehen habe. Voraussetzung, dass wir es machen, ist, dass wir es schon mal gesehen haben. Das gibt uns die Gewissheit wieder erfolgreich zu sein. Wenn dieser Ansatz breitenwirksam Bestand hat, und das ist zu befürchten, wird auf Dauer nichts an Innovation passieren. Rick: „Monaco Franze“ ist für mich ein Beispiel für eine moderne Serienfigur: Er betrügt seine Frau, er ist ein Opportunist, also eine Figur, bei der man auch in aller politischen Korrektheit sagen würde, das geht nicht. Und das gab es schon mal bei uns. Junklewitz: Warum gibt es das dann heute nicht mehr? Kolditz: Ich habe mit einer Schauspielerin zu Mittag gegessen, für die ich etwas schreiben soll. Plötzlich kam eine Produzentin – von der Schauspielerin war ein Film gesendet worden – und sagte zu ihr: Herzlichen Glückwunsch, es war eine großartige Quote. Die anderen Quoten sind alle schlecht. Sie hat nicht gesagt, dass es ein toller Film und die Quote auch gut war. Ich finde die Quote auch wichtig. Aber was ist denn ‚Erfolg’? Nico Hofmanns Ansatz ist großartig, einen Film zu machen, in dem er sich mit seinem Vater unterhalten kann, und nicht einen, der eine noch höhere Quote hat als „Dresden“. Wenn man einen Film macht, in dem sich zwei Leute mit ihren Vätern unterhalten, kann man doch die Hoffnung haben, dass es am Ende Millionen sind, die diesen Dialog auch führen. Steve Hudson: Quote ist fixiert auf eine Realität, die technologisch nicht auf alle Menschen unter 50 zutrifft. Meine Mutter in England hat einen HD-Rekorder. Sie guckt ihre Serien seit zehn Jahren mit dem HD-Rekorder zeitversetzt. Wir fokussieren auf eine verzogene Messung und sind baff, dass nur Rentner vorm Fernseher sitzen, die sich nicht wegbewegen können. „Die Sopranos“ hatten vielleicht nicht Mega-Quoten, aber sie haben über DVD und Internet eine große Verbreitung. Kolditz: „Die Sopranos“ entwickeln nicht nur über die DVD-Auswertung zweite Kraft. Die entwickeln sie auch über andere Serien. „Breaking Bad“ wäre ohne bestimmte Serien, die es davor gab, überhaupt nicht möglich. Die Wirkung von Serien kann nicht rein statistisch in Verkaufs- oder Zuschauerzahlen gemessen werden. Man muss berücksichtigen, was sie an Innovation im Hinblick auf Seh- und Erzählweisen gebracht haben. Publikum: Warum werden neue, originäre Serien hier nicht mal wenigstens entwickelt? Clemens: Wenn in Amerika klar ist, es funktioniert nicht mehr, werden zehn Leute beauftragt, die zehn neue Ideen liefern sollen. Merkt man hier, es funktioniert nicht mehr, fragt man sich, was hat in den letzten fünf Jahren funktioniert und macht es wieder genauso. Da ist eine Blockade im Kopf bei entsprechenden Leuten, die hoffentlich irgendwann gelöst werden kann. Publikum: Was die Diskussion ein bisschen verfälscht, ist, über welch kleinen Teil des amerikanischen Fernsehens wir reden. Die durchschnittliche Quote von „The Wire“ ist 2,8 bis 3 Millionen Zuschauer. Das ist Abofernsehen, ein ganz kleiner Teil. Wenn man in Europa nach so einer Serie guckt, kann man Dominik Graf nehmen. Nehmen wir „Xanadu“, die lief auf Arte. Eine kritische französische Serie, die es in der Form noch nicht gegeben hatte. Oder englische Serien. Die BBC und ITV machen super Sachen. Das Ganze ist systemisch bedingt. Solange wir systemisch unkritisch sind, ändert sich nix. Die guten Produktionen, in denen deutsches Geld steckt, werden im Ausland gemacht. Kolditz: Das mit dem Systemischen und Ökonomischen ist richtig, es ist es aber auch nur die halbe Miete. Das Geld ist da, wir reden im Moment ja nur über gebührenfinanziertes Fernsehen. Es ist nach wie vor die entscheidende Frage, was für uns erfolgreiches Fernsehen ist. Kollege Benedict hat dieses Jahr ein Homevideo produziert, damit Preise gewonnen und hatte drei Millionen Zuschauer. Solange solche Filme als Misserfolg gelten, werden sich solche Dinge nur singulär durchsetzen lassen. Publikum: Was wichtig ist, und auch immer wieder versucht, aber nicht geschätzt wird, ist, von hier zu erzählen. Wenn man „24“ in Deutschland adaptiert, hat man eine Form der Abstraktion, die nicht viel mit meiner Realität zu tun hat. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich vom Fernsehen gebannt bin, weil ich etwas sehe, das quasi vor meiner Haustür passiert. Warum kann HBO so gut erzählen? HBO erzählt aus einem Amerika, das so reich ist, landschaftlich, subkulturell, metropolitisch. Das haben wir so nicht, aber auch deutsche Realität kann sexy dargestellt werden. Den Spagat müssen nicht nur Autoren, sondern auch Regisseure hinkriegen. Junklewitz: Inwieweit muss man realistisch, inwieweit ‚larger than life’ erzählen? Rick: Ich interessiere mich für Überhöhung, sonst guck ich mir einen Dokumentarfilm an. Im epischen Erzählen kann man überhöht und gleichzeitig authentisch sein; wie bei „Die Sopranos“ nicht in jeder Folge einer umgebracht wird und sich viel über die Familiendynamik entwickelt. Das kann ich mir problemlos für deutsche Realität vorstellen. Ich mag Serien, wie „Irgendwie und sowieso“ oder „Kir Royal“, die satirisch mit deutscher Realität umgehen. Das würde ich auch gern machen. Junklewitz: Es wird häufig kritisiert, dass deutsche Serien nur noch als Krimiserie stattfinden. Muss es eine Ausweitung des Repertoires geben, um innovative Stoffe zu erzählen? Kolditz: Alles, was sich nicht auf Krimi reduziert, wäre eine Bereicherung. Das ist ja tautologisch. Aber über die Sender und Produzenten herzuziehen, ist eindimensional. Man selber würde ja die größten Filme machen, wenn man nur könnte. Dieses ‚nur könnte’ hat mit einem selbst zu tun. Mein vorvorletzter Film hieß „An die Grenze“, eine Geschichte über meine Zeit als Grenzsoldat in der DDR. Ich hatte Christian Granderath, damals noch Produzent, erzählt, dass ich Grenzsoldat gewesen bin. Er hat fünf Jahre gebraucht, mich davon zu überzeugen, das zu schreiben. Ich fand es banal. Nicht ich war der, der mit der Innovation ankam, sondern der Produzent, der auf mich eingeredet hat. Es sind nicht nur die ‚revolutionären’ Drehbuchautoren oder Regisseure, es sind Menschen, die an eine bestimmte Art von intelligenten und erfolgreichen Filmen glauben. Ich wünsche mir, dass wir mutiger werden, was auch mich betrifft. Es geht nicht, immer nur auf die anderen zu zeigen. Wir müssen Partner finden, die Dramaturgien, Erzählweisen und Figuren suchen, die die düsteren Seiten unserer Existenz zeigen. Eigentlich bin ich pessimistisch. Viele Redakteure erzählen mir, wie toll sie „Breaking Bad“ finden, um mir im nächsten Moment zu erklären, warum das nicht geht. Junklewitz: Warum verlieren horizontal erzählte Serien in Deutschland im Verlauf an Zuschauern, wie „Im Angesicht des Verbrechens“ oder „Weissensee“? Publikum: Man muss sich auch mal darüber unterhalten, welche Quote es bei welchem Programm gibt. Ob es immer acht Millionen sein müssen oder ob man bei einem bestimmten Programm auf ein kinoaffines Publikum trifft. Dann sind es vielleicht zwei oder drei Millionen. Welcher deutsche Kinofilm hat denn zwei oder drei Millionen Zuschauer? Man muss das deutlich relativieren. Wenn man sagt, „Im Angesicht des Verbrechens“ sei quotentechnisch ein Misserfolg gewesen, schließt man sich der Meinung der ARD an, die daraus ein PR-Desaster gemacht hat, das größer nicht hätte sein können. Publikum: Ich befasse mich gerade mit Serien und habe Interviews mit Leuten gemacht, vom Producer über Redakteur bis hin zum Autor. Es stimmt: Jeder schiebt dem anderen die Schuld zu, warum es nicht klappt. Es wurde deutlich, dass es gut ist, wenn ein Autor viel Freiheit hat, oder Unwägbarkeiten und Indifferenzen seitens von Redaktionen durch ein starkes Autorenteam ausgehebelt werden können. Eine gute Sache ist, sich zusammenzutun. Case Study Peter Nadermann – Produzent „Kommissarin Lund“ Nadermann: Viele Programme, die wie „Kommissarin“ Lund auf dem Sonntagabendplatz um 22 Uhr im ZDF laufen, sind skandinavische Koproduktionen, an denen wir beteiligt sind. Vor zehn Jahren haben wir entdeckt, dass es dort Projekte gibt, die bei uns funktionieren können. Es war aber ein weiter Weg bis zu „Kommissarin Lund“. Henning Mankell war der Türöffner. Der war nötig, es ist nicht einfach, einen Sender davon zu überzeugen, einen schwedischen oder dänischen Krimi zu machen. Ich habe ein Jahr daran gearbeitet, die Verantwortlichen zu überzeugen. Im dänischen Original sind es zwanzig Folgen à eine Stunde. Wenn es schiefgegangen wäre, was hätte man gemacht? Unterbrechen? Noch mal an einem anderen Platz senden? Diese Produktionen haben größere Budgets zur Verfügung, „Kommissarin Lund“ ca. 2,5 Millionen – das kann man schlecht genau sagen, weil viele Inhouse-Leistungen drin stecken. Ein gut dotierter „Tatort“ kostet 1,6 Millionen. Die Skandinavier haben wesentlich geringere Kosten im Casting. Das Geld fließt direkter in die Produktion. Im Vergleich zu vielen unserer Projekte haben ihre den Vorteil, dass es von vornherein ein klares Budget und einen festen Produktionsplan gibt. Man kann in Ruhe planen und die Synergien des Umfeldes nutzen. Das ist in Deutschland nicht so einfach. Hier plant man zwei Jahre und hat dann noch drei Wochen Zeit, das umzusetzen. In den skandinavischen Ländern ähnelt die Situation, der, die wir in den achtziger oder neunziger Jahren hatten. In Dänemark, mit nur fünf Millionen Einwohnern, gibt es starke öffentlich-rechtliche Sender, die eminent hohe Einschaltquoten haben, es gibt kaum Privatsender. Im Trailer konnte man „80% Market Share“ sehen. Das ist eine irre Zahl, die erreichen wir kaum mit einem Endspiel der Fußball-WM. Sie ist darauf zurückzuführen, dass in diesen Ländern der Wettbewerb an FictionProgrammen nicht groß ist, weil es nicht so viele gibt. Dass man ohnehin ein großes Publikum erreicht, führt offensichtlich zu einer Befreiung. Die Sender lassen die Kreativen viel mehr machen. „Kommissarin Lund“ vertreiben wir weltweit. Mittlerweile macht sie sogar in England Furore, obwohl die Engländer nicht synchronisieren. Die Quoten sind natürlich begrenzt, BBC 4 ist ein Kultsender, der ein anspruchsvolles, urbanes Publikum bedient. „Kommissarin Lund“ hat aber doppelt so hohe Einschaltquoten wie andere Programme. Fox hat mit sogar ein erfolgreiches Remake gemacht, „The Killing“, es ist eigentlich eine Kopie. Es spielt in Seattle, es sind amerikanische Schauspieler, aber es ist derselbe Pullover, es sind dieselben Einstellungen, dieselben Szenen. Die Dänen haben sich darauf verlegt, nicht Literatur zu verfilmen, sondern eingenständige Konzepte zu entwickeln, die sie seriell stricken. Solche Programme passen sehr gut zu ihrem Topsendeplatz, Sonntagabend von 20 bis 21 Uhr. Die Dänen hatten zunächst Serien – geprägt von amerikanischen Vorbildern – mit abgeschlossenen Folgen, die Bögen hatten, die weiter verwiesen, wie in unserer Serie „Der Adler“. Unser Autor Søren Sveistrup hat mit „Kommissarin Lund“ dieses Prinzip auf die Spitze getrieben. Der Autor ist auch Produzent, ähnlich wie im amerikanischen Kontext, oder er arbeitet eng mit dem Produzenten zusammen, entwickelt das Produkt und steuert es. Dann kommen meist jüngere Regisseure aus dem Spielfilmumfeld dazu. Dänemark verfügt über ein relativ großes Reservoir Regisseuren und Kreativen, produziert aber weniger als wir, was an deren kleinem Markt liegt. Weil sie mehr Zeit haben, beschäftigen sich die Kreativen intensiver mit den Produkten. Ein Schauspieler kann sich bis zu zwei Monaten auf eine Rolle vorbereiten, ein Regisseur macht einen Film im Jahr, nicht sechs. Für ein Projekt wie „Kommissarin Lund“ muss man mit verschiedenen Arenen arbeiten. Politik ist eine Arena, es gibt die Schule als Teil der Gesellschaft und die Familie. Die Familie ist neu und wird in die Geschichte mit eingewoben. Normalerweise sieht man sie im Krimi nur am Anfang, meist in der Szene in der Pathologie und dann nicht mehr. Die klassische Koproduktion läuft so, dass man sagt, wir bezahlen soundso viel dafür, und dafür wollen wir soviel haben, etwa wir drehen in Deutschland, wir wollen eine deutsche Hauptrolle. Meine Philosophie ist, Originale liefern zu wollen. Ich versuche den Film mit dem investierten Geld größer und besser zu machen, nicht deutscher. Das wird vom Zuschauer honoriert. Publikum: Was spricht dagegen, in Deutschland mit deutschen Protagonisten zu drehen und das Geld von den Skandinaviern zu bekommen? Nadermann: Ich würde das gerne machen. Das erste Problem ist ein ökonomisches, weil die Skandinavier, die mittlerweile reicher sind als wir, für Fernsehen weitaus weniger Geld haben. Wir können mehr investieren, weil wir für einen größeren Markt produzieren. Wir müssten auch diese Freiheit herstellen, die das Fluidum ist, in dem so etwas entsteht. Stephan Brüggenthies: Hat Søren Sveistrup ein Netzwerk aus Dramaturgen um sich oder sitzt er allein in seinem Kämmerlein und trifft sich alle paar Wochen mit dem Produzenten? Nadermann: Es gibt ein Team von Co-Autoren, die unter seiner Führung den Stoff weiter entwickeln. Er hat als Headwriter die Kontrolle. Dann gibt es Autoren, die einzelne Episoden schreiben. Publikum: Was muss ein deutscher Autor tun, um ein solches Projekt verwirklichen zu können? Nadermann: Es gab das ja, Dominik Grafs „Im Angesicht des Verbrechens“ hatte die Qualität. Das ist in Grund und Boden gesendet worden. Wir tun uns in unserem Markt, der viel härter ist, offenbar schwer und trauen uns wenig. Das Problem ist, dass man immer Sorge hat, dass die Quote nicht stimmt. Deshalb macht man eher defensive Programme. Das rächt sich auf lange Sicht für die Öffentlich-rechtlichen besonders, weil der Zuschauer gar nicht mehr damit rechnet, dass da was läuft. Ein 15-jähriger Teenager nimmt nicht an, dass im ZDF oder der ARD etwas läuft, das cool ist. Das ist wie in einem Oma-Laden, in dem eine Diesel-Jeans hängt. Die kauft keiner, weil keiner weiß, dass es die da gibt. Der Sendeplatz Sonntag, 22 Uhr, funktioniert, wenn man die Zuschauer mit guten Stoffen füttert, und weil sie wissen, wo sie das finden. Wir unterschätzen unsere Zuschauer grandios. Publikum: „KDD – Kriminaldauerdienst“ war doch auch eine hoch angesetzte Geschichte. Nadermann: „KDD“ wurde von Leuten entwickelt, die sich an Sachen wie „Kommissarin Lund“ orientiert haben. Es war übrigens die einzige Serie, die ich mal nach Schweden verkauft habe. Trotz vieler Preise hat man nie richtig an diese Serie geglaubt. Sie ist als zu komplex eingestellt worden. Publikum: Wie sehen denn ihre begleitenden Maßnahmen aus, um eine Serie zu uns zu bringen? Nadermann: Jeder Sender hat seine Marketingpower über die sogenannte innere Crosspromotion. Wir haben zu „Kommissarin Lund“ eine Website gemacht, wo Themen der Sendung aufgegriffen wurden, die User voten konnten, und es gab ein Forum. Das fand eine jüngere Szene lustig, wir hatten viele Clicks. Diese Programme lassen sich auch besser vermarkten, weil die Leute, die darüber schreiben, lieber über „Kommissarin Lund“ schreiben als über den „Bergdoktor“. Umgekehrt bin ich davon überzeugt, dass viele hämische Kritiken über das öffentlich-rechtliche Fernsehen daher rühren, dass viele Journalisten bitter von ihm enttäuscht sind. Wir haben aber unsere letzte Reihe „Protectors“ selber versenkt. Die haben wir gegen das Endspiel der Frauenfußball-WM gestartet. Da waren bei uns nur die treuesten Zuschauer. Wenn die Deutschen im Endspiel gewesen wären, hätte das wahrscheinlich gar keiner mehr gesehen. Case Study Christoph Hochhäusler – Regie, Drehbuch „Dreileben“ Frank Tönsmann – Redakteur Hochhäusler: Christian Petzold, Dominik Graf und ich wurden vor drei Jahren zu einem Symposium an der DFFB eingeladen, um über die Berliner Schule zu diskutieren, deren ästhetische Tendenzen Dominik Graf kritisiert hatte. Es entwickelte sich ein Dialog, in dem es um Genre ging, Kino in Deutschland und der Welt, was das Fernsehen kann, was das Kino kann. Dominik Graf ist ja der Meinung, dass im Fernsehen die interessantesten Sachen passieren. Daraus entspann sich eine bereichernde Diskussion via E-Mail. Christian Petzold hatte die Idee, diese Korrespondenz im Film fortzusetzen. Und zwar so, dass man Nachbarschaften hat. Filme, die aufeinander reagieren, im Austausch miteinander sind. Wir haben uns auf einen Ort, einen Zeitraum und ein Ereignis verständigt, und das zieht sich durch die drei Filme. Den Ort haben wir Dreileben genannt und eine Art fiktive Landkarte gezeichnet, was dieser Ort können muss oder haben soll. Danach wurde erst der reale Ort gefunden. Mit dem Konzept in Exposéform, es waren einige, wenige Seiten, sind wir zum ZDF gegangen. Die haben eine Weile überlegt und wollten dann nicht. Frank Tönsmann fand das sehr interessant, und später ergab sich die ungewöhnliche Konstellation aus BR, WDR und Degeto. Dann ging es sehr schnell: Ich hatte im Mai 2010 noch kein fertiges Drehbuch, und im August habe ich angefangen zu drehen. Ich habe meinen ersten Krimi gemacht, der subjektiver erzählt als meine anderen Filme. Christian fühlte sich getroffen von Dominiks Kritik, seine Filme seien asexuell. Bei ihm spielt die Liebesgeschichte eine größere und körperlichere Rolle als sonst. Dominik hat ein Kammerspiel mit viel Dialog gemacht, er hat den Krimi fast ganz beiseitegelassen. Es war nie das Ziel, die Filme zentralperspektivisch zusammenzufügen. Es gibt zwischen den Filmen Widersprüche, es gibt auch Fehler. Das wollten wir aber, weil es uns wichtiger ist, dass wir als Autoren-Regisseure unabhängig sind und Filme machen, die hundertprozentig dem entsprechen, was wir wollen. Gleichzeitig bedaure ich manchen gescheiterten Brückenversuch. Was mich an dieser Zusammenarbeit und am Medium überhaupt fasziniert, ist die Dimension der Erinnerung. Man hat die Filme gesehen, und der Ort, den man wiedersieht, verändert sich produktiv. Auch weil er in neuen Kontexten gezeigt wird. Diese Dimension von Erinnerung, die in seriellen Formaten aller Art eine große Rolle spielt, ist das, was Kino nicht hat oder selten. Anders ausgedrückt ist es das, was uns mit einem bestimmten Star verbindet, den wir früher schon oft gesehen haben: eine Art von Resonanzraum, die entsteht, wenn wir Henry Fonda in „Spiel mir das Lied vom Tod“ plötzlich als Bösen sehen. Diese Verschiebung hat zu tun mit unserer Erinnerung, dem Resonanzraum in uns. Und das finde ich aufregend. Tönsmann: Mit „Dreileben“ sind wir hier Außenseiter. „Dreileben“ ist keine Serie und auch nicht horizontal erzählt, sondern besteht aus drei eigenständigen Filmen. Es handelt sich um die Erweiterung eines ästhetischen Dialogs, den die drei Filmemacher in Film übersetzen. Dieser Dialog, der unterschiedliche Umgang mit Genre, Krimi in diesem Fall, ist das umfassende Moment des Projekts. Darauf sollte man achten, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die drei mit den Vorgaben umgehen. Man kann sie in beliebiger Reihenfolge gucken und hat kein Verständnisproblem. Die Reihenfolge, in der wir sie gesendet haben, war eine pragmatische. Wir sollten den Blick weiten und überlegen, wie man Fernsehen als Medium mit erzählerischen Formaten nutzen kann. Horizontal erzählte Serien sind eine Möglichkeit, Dreileben ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es noch ganz andere Möglichkeiten. Wir schauen auf einzelne Programmplätze, unsere Slots, und erweitern unseren Blick nicht auf das, was sonst passiert. Eine der spannendsten Sachen der letzten fünf Jahren war die holländische Show „The Donor“, in der vorgeblich eine Frau ihre Niere verkaufte. Man glaubte das, bis sich in der letzten Folge herausstellte, dass das ein Fake ist. Oder in den siebziger Jahren „Das Millionenspiel“ von Wolfgang Menge. Das erste Mal habe ich von „Dreileben“ kurz vor Drehbeginn von „Im Angesicht des Verbrechens“ gehört. Ich hielt das von Anfang an für eine sehr spannende Sache. So eigenartig die Konstellation mit BR und Degeto für Außenstehende klingen mag, so wenig ist sie es, wenn man sie auf die Personen runterbricht. Mit Bettina Reitz, die noch Fernsehspielchefin beim BR war, und dem inzwischen leider verstorbenen Jörn Klamroth als Geschäftsführer der Degeto fand sich eine personelle Konstellation, die durch diverse gemeinsame Projekte erprobt war. Hochhäusler: Die Konstellation war einerseits kompliziert. Es gab nicht nur die drei Sendereinheiten, sondern auch drei unabhängige Produktionen, und im Fall von Dominik Graf und mir noch einen CoAutor. Andererseits ist die Freundschaft geblieben, und wir sprechen aktuell darüber, wie man Experimente dieser Art fortsetzen könnte. Tönsmann: Bei so einem Projekt liegt der Teufel im Detail. Wenn eine oder mehrere Figuren in drei Filmen vorkommen, müssen die Kostümdepartments Absprachen treffen, es muss zahlreiche logistische Absprachen zwischen drei Produktionsfirmen geben. Man muss schachbrettartig mit leichten Überschneidungen drehen, was dazu führt, dass Wetteranschlüsse Schall und Rauch sind. Trotzdem muss man es glaubhaft machen. Publikum: Wurde mal überlegt, die Filme nicht direkt hintereinander zu senden? Ich habe versucht sie zu sehen, habe aber nicht bis zum Ende durchgehalten, weil ich einfach zu müde war. Tönsmann: Uns stand die Möglichkeit offen, die Filme in drei aufeinanderfolgenden Wochen, mittwochs um 20.15 Uhr, zu senden, dem klassischen Sendeplatz für ARD-Fernsehfilme. Dann kam die Einladung zur Berlinale 2011. Dort waren die drei Filme in enger Nachbarschaft zu sehen, nicht getrennt durch eine Woche Lebenszeit. Das hat uns darauf gebracht, das im Fernsehen genauso zu machen. Der Nachteil der Form, die wir gewählt haben, ist, dass der letzte Film zu einer Zeit lief, als viele schon müde waren, keine Frage. Wir haben das flankiert, indem wir die Filme auch noch auf Einsfestival in derselben Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen um 20.15 Uhr gezeigt haben. Das wäre bei der Programmstruktur der ARD nicht durchsetzbar gewesen. Aber hinsichtlich der Wahrnehmbarkeit und – was ich ganz wichtig finde – der Imagebildung, die man mit so einem Projekt haben kann, war es die richtige Entscheidung. Hochhäusler: Wir haben die Filme tatsächlich zum allerersten Mal bei der Premiere zusammen gesehen, hauptsächlich auf Wunsch von Dominik und Christian. Es war ein aufregendes Erlebnis. Publikum: Sind die Drehbücher während der Drehzeit geändert worden? Hochhäusler: Es war wichtig, dass nach dem Drehbuch gearbeitet wurde. Vereinbarungen mussten stimmen, wegen der Kostüme, der Darsteller. Mit Christian habe ich teilweise parallel gedreht. Das war dann mitunter komisch: ‚Ich brauche jetzt deine Hauptdarstellerin. Könnte ich sie haben?’ ‚Ja, aber nicht vor soundsoviel Uhr.’ Panel Thomas Lückerath (Geschäftsführer DWDL.de): Kam Ihnen jemals die Idee, „Dreileben“ den Privaten anzubieten? Hochhäusler: Wir haben es nicht erwogen, weil wir das für chancenlos halten. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn die Privaten innovativer arbeiteten. Die Öffentlich-rechtlichen werden ständig gebasht, weil sie dankbare Opfer sind. Es ist richtig, zu kritisieren, was nicht gut ist. Die Kritik müsste auch in den Häusern selbst lauter werden. Aber grundsätzlich wird alles, was mich im deutschen Fernsehen oder Film interessiert, durch die Öffentlich-rechtlichen ermöglicht. Nadermann: Es ist eine Wettbewerbssituation entstanden, in der ARD und ZDF untereinander und mit den Privaten konkurrieren. Wenn sich ARD und ZDF darauf einigen könnten, sich zu radikalisieren und miteinander zu arbeiten, könnte man die Qualität des Fernsehprogramms blitzartig anheben. Lückerath: Teamworx produziert fiktionale Stoffe von Einzelfilmen über Reihen und Mehrteiler hin zu Serien. Bei den Ein- und Mehrteilern überwiegend und erfolgreich für die Öffentlich-rechtlichen, die Serienprodukte für die Privaten sind in der Regel schief gegangen. Benedict: Man muss einen statistischen Faktor in der Bewertung von seriellen Formaten mit einrechnen. Ein TV-Movie, der einen Abend schlecht läuft, läuft einen Abend schlecht. In der nächsten Woche ist das vergessen. Wenn eine Serie schlecht läuft, ist es so qua Natur der Sache, dass man zehn schlechte Abende hat. Das fällt das stärker auf und deswegen ist die Risikobereitschaft geringer. Wenn es mal läuft, hat man eine Zuschauerbindung, wie man sie bei Einzelstücken nie bekommt. Das ist kein Geburtsfehler, aber ein Geburtsproblem beim seriellen Erzählen. Es wird oft berechtigte Kritik sowohl an den Öffentlich-rechtlichen wie den Privaten geübt. Aber neben allem, das kritikwürdig ist, laufen herausragenden Sachen, wie „Kommissarin Lund“, „Dreileben“, „Im Angesicht des Verbrechens“ und bei den Privaten „Danni Lowinski“ und „Doctor’s Diary“. Man muss auch in die Waagschale werfen, was alles geht. Lückerath: Mit vielen amerikanischen Serien können deutsche nicht mithalten, weil das Produktionsbudget kleiner ist. Mit welchen können wir denn mithalten? Nadermann: Wir befinden uns in einer Situation, in der wir, weil wir zu viel produzieren, Budgets kürzen. Wenn man mit kleinem Geld etwas macht, muss man umso innovativer sein. Vielleicht auch mit Schauspielern arbeiten, die noch nicht teuer sind, weil sie gerade entdeckt werden. Das macht es umso schwieriger. Die BBC verkauft ihre Programme und holt sich zwanzig bis 35 Prozent aus dem Ausland. Wir verkaufen unsere Programme kaum. Wir produzieren sehr viel, aber wir bezahlen zu viel und haben zu wenig. Es wäre schlauer, weniger zu machen, das höher zu dotieren und dann zu versuchen, andere anzusprechen, um das besser verkaufen zu können. Publikum: Man könnte doch sagen: In Deutschland sitzen tolle Autoren. Ich schaffe den Freiraum, dann sammeln wir das Geld ein. Ich bin mal böse und sage, der Nadermann macht sich es einfach, gibt den Skandinaviern das Geld, hält sich kreativ raus und fokussiert sich auf die Vermarktung. Nadermann: Einfach ist es schon mal gar nicht. Es ist ja nicht alles gut, was aus Skandinavien kommt. Und Koproduktionen sind verdammt schwer zu verkaufen, weil jeder lieber ein nationales Produkt hat. Und man kann sie nur verkaufen, wenn man einen Selling Point hat. Die Skandinavier haben sich das erarbeitet. Vor zehn Jahren war das noch nicht so. Tönsmann: Es richtig, wir werden in Zukunft tendenziell weniger machen. Um den Qualitätsstandard zu halten, können wir in der Quantität nicht weiter produzieren. Das ist aber für die Produzenten- und kreative Landschaft nicht gut, weil natürlich auch immer weniger Leute Arbeit finden werden. Lückerath: Wird „Dreileben“ oder „Im Angesicht des Verbrechens“ ins Ausland verkauft? Tönsmann: „Im Angesicht des Verbrechens“ wurde von Telepool, soweit ich weiß, nach Dänemark und Schweden verkauft. Der romanische Raum hat sich dafür nicht interessiert. Die Briten haben das Problem, dass sie nicht synchronisieren, und deutsche Serie gedubbt auch nicht zeigen wollen. Bei „Dreileben“ machen es drei verschiedene Rechteinhaber. Da habe ich noch keine Rückmeldung. Lückerath: Wenn man Filmemacher werden möchte, stellt man sich die große Leinwand vor. Wann haben Sie sich gesagt, auch Fernsehen kann gute Geschichten erzählen? Hochhäusler: Ich arbeite für einen Zuschauer, der sich für meinen Film entscheidet und konzentriert ansieht. Die Wahrnehmungsweisen verändern sich ständig, es gibt Leute, die sehen sich Filme im Internet oder auf ihrer Taschenuhr an. Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich gehe davon aus, dass jemand, der sich meinen Film anschaut, ihn sehen will. Alexander Kluge hat das mal als ‚erotisches Verhältnis’ beschrieben. Ich persönlich sehe viele Filme auf DVD. Das hat sich so entwickelt, auch weil ich Kinder habe. Gleichzeitig sehne ich mich nach der Konzentration und der Gesellschaft von Mit-Kinogängern. Insofern arbeite ich imaginär immer fürs Kino. Deshalb macht das für mich keinen großen Unterschied. Lückerath: Quote heißt letztlich Zuschauerinteresse – ‚Quote’ ist aber negativ besetzt, ‚Zuschauerinteresse’ gar nicht so verkehrt. Mit „Dreileben“ haben Sie mehr Zuschauer gehabt als die meisten Kinofilme, die in Deutschland starten. Interessiert Sie diese Debatte? Hochhäusler: Quote ist eine Währung, die man auf politischem Parkett braucht, wo es um Legitimation geht. Der Künstler kann nicht nach Quote arbeiten. Mich interessiert, ob ein Film relevant geworden ist. Ich lebe wie alle vom Feedback, aber Relevanz ist etwas, das man nicht in einer Zahl ausdrücken kann. Es geht darum, sind wir in der Lage, Gegenwart zu erzählen? Gebrauchen wir einen Film als Beispiel, um über etwas zu sprechen? Oft weiß man das erst 15 Jahre später. Wer nicht so lange warten kann, freut sich über Messbares und schaut auf die Quote. Ich weiß nicht, ob 500.000 oder 600.000 Zuschauer besser sind. Ich weiß nichts über die Intensität ihres Eindrucks, ob sie von dem Film träumen, ob er für sie wichtig war oder sie nur die Zeit abgesessen haben. Bendict: 600.000 Zuschauer sind besser als 500.000. Und das Werben um Publikumsbindung ohne Preisgabe von Differenzierung ist eine Qualität, die viele amerikanische Serien haben. Es ist faszinierend, dass sich Menschen in der ganzen Welt „Mad Men“, „Die Sopranos“ oder „Breaking Bad“ anschauen, was spezifisch von amerikanischer Kultur und nicht immer Gegenwart, aber amerikanischer Identität erzählt. Es stimmt, dass das in Amerika teilweise nicht so aufgenommen wird. Aber die Sachen sind auch hier nur für eine spitze Zuschauergruppe relevant. Lückerath: „Mad Men“ hat, wenn man es auf die Größe unseres Fernsehmarktes übertragen würde, eine Einschaltquote von 400.000 Zuschauern. Das ist nur eine Nische. Hochhäusler: Oder „The Wire“, die quotenmäßig unter ferner liefen ist. Die Serie ist aber zu dem relevanten Material geworden, um über amerikanische Gegenwart zu sprechen. Es gibt inzwischen Bücher darüber, sie ist extrem wichtig für viele Kollegen. Tönsmann: Die Quote ist schon allein deshalb wichtig, weil sie das einzige Messbare ist. Aber es ist mindestens genauso wichtig, Marksteine zu setzen, Image bildendes zu machen. Beide Wege müssen wir gehen, sonst marginalisieren wir uns oder gehen in der Masse unter. Nadermann: Wenn die öffentlich-rechtlichen Sender weiter an Zuschauern verlieren, werden sie irgendwann auch ihre Legitimation verlieren. Öffentlich-rechtliches Fernsehens ist aber wichtig, weil wir Fernsehen brauchen, das unabhängig von Werbebuchungen ist. Wir müssen mehr riskieren, um jüngere Zuschauer anzusprechen. Das würde eine Durststrecke bedeuten. Es wird eh schwierig, weil mediale Verwehungen die Leute in unterschiedlichste Medien treiben. Tönsmann: Wenn wir vom jüngeren Zuschauer reden und uns davon indirekt besseres Programm erhoffen, bin ich skeptisch. Was jüngere Zuschauer tatsächlich gucken, ist das, was RTL am Samstagabend sendet, „Dschungelcamp“ oder ähnliche Geschichten. Ich finde das persönlich nicht schlimm, aber ich weiß nicht, ob es das ist, das hier konsensfähig wäre. Hochhäusler: Der Grund, warum HBO so reife Serien machen kann, ist das ältere gesetzte Publikum, um das man nicht permanent werben muss. Die Verteufelung von Altersgruppen finde ich völlig albern. Natürlich geht es darum, auch in der Breite relevant zu sein. Aber – nur zur Erinnerung – Helmut Thoma, der ehemalige RTL-Chef, hat vor einigen Jahren zugegeben, dass die Behauptung, es gäbe eine besonders relevante Zielgruppe gäbe, eine Erfindung war. Vortrag – Otto-Meissner-Serienwettbewerb Ronald Gräbe (Produzent, Serienexperte): Den Otto-Meissner-Serienwettbewerb haben wir zur Berlinale 2011 ins Leben gerufen. Es war eine Idee von unserem Vorstand Mischa Hofmann, der sich gefragt hat, wie man an Autoren und neue Ideen kommen und wie man Kreativität befördern kann. Die Maßgabe war, auf zehn Seiten eine Serienidee zu entwickeln, sie mit einer Dialogprobe zu versehen und eine Biografie beizufügen. Das für uns ideale Konzept versucht, etwas vom Geist und der Welt erahnen zu lassen, die Sie als Serie präsentieren. Wenn ein Sitcom-Konzept nicht lustig ist, haben Sie es schwer bei der Jury oder auch sonst weiterzukommen. Langweilen Sie nicht mit ellenlangen Figurenbeschreibungen über Biografien. Stellen Sie das Thema vor und beschreiben Sie, worum es Ihnen in diesem Konzept geht. Als Produzent merkt man schnell, ob man das irgendwo anbringen kann. Und vergessen Sie bitte nicht – auch das ist vorgekommen – draufzuschreiben, wie Sie erreichbar sind. Womit wir nicht gerechnet haben, war, dass wir 879 Konzepte bekommen würden. Ich habe sie gelesen, nicht alle in ihrer Gänze. Denn letztlich geht es darum, Konzepte zu finden, die einer Jury vorzuschlagen sind. Die ersten Konzepte kamen schnell. Die ARD hatte ihre Crime&Smile-Offensive gestartet. Alles, was dort durch das Raster gefallen war, landete bei uns. Die Krimiserie ist nach wie vor des deutschen Autors liebstes Kind. Ein zweiter Schwerpunkt des Materials war, was sich Dramedy nennt, bei dem keiner recht weiß, ob das die lustige Familienserie oder Sitcom ist. Ein weiterer Schwerpunkt war Fantasy in jeder Spielart. Unter den etwa 35 vorgeschlagenen Konzepten gab es drei eindeutige Kinderserienkonzepte, eins davon hat den zweiten Platz belegt. Die Autoren arbeiten gerade mit Disney zusammen. Es gab vier Konzepte zum Thema Afghanistan. Ich hätte gedacht, dass zu diesem Thema mehr Einsendungen kommen. Eins davon haben wir ausgezeichnet, weil es ein unter die Haut gehendes Drama ist. Gewonnen hat Rochus Hahn, als Schreiber kein Unbekannter, mit einer Fantasy-Idee: Am 21. Mai 2012 fällt der Strom aus und kommt nicht wieder. Was entsteht danach? Es ist ein episches Konzept, das wir gerade als Mehrteiler zu realisieren versuchen. Mit zwölf weiteren Konzepten arbeitet die Odeon AG weiter, sowohl mit öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern. Die Rechte an den Konzepten, verbleiben bei den Autoren. Wir haben uns vorbehalten, eine vierwöchige First-Look-Vereinbarung zu treffen. Konzepte, die wir nicht auf diese Weise optioniert haben, sind wieder zurückgegangen. Skype-Interview mit Vince Gilligan (Show Runner – „Breaking Bad”) Junklewitz: How did this trend in recent US series come about, concerning narrative, characters, their ambiguity and moral ambivalence? Gilligan: American television has gotten more complex narrativewise in the last twenty years. Great credit is due to the television series „The Sopranos“ which is centered around a very unlikeable sort of an anti-hero character. The evolution of anti-heroes in American television itself has probably stem from its history in which American TV networks desired their show runners to essentially tell stories of heroes and villains. And they wouldn’t be allowed of crossover between the two. As we all know that most people are neither good nor bad television has started to reflect that in recent years. It is nice to be able to have characters and narrative be more complex and to do it in a hyper-serialized television show, which requires an audience to watch very attentively from week to week. Steve Hudson (Regisseur, Schauspieler): Is cable TV the new home of the great American novel? Gilligan: Television in general allows long term story telling process. When I set out to create „Breaking Bad“ and come up with an idea I typically think to myself: does this constitute two hours or does it constitute a hundred hours worth of story. If the answer is the latter then maybe I have a TV show here. The ability to tell that long term story is a blessing and we are allowed that here in the cable world. In the network world, which I used to work for with the „X-Files“ for seven years, it is much more important that episodes can rerun out of order which of course implies that it should not be particularly serialized. Hudson: You could even argue that the audience watching „Breaking Bad“ is asked to watch the story even closer than your average movie audience. You got a negative character, you sadistically bring him down. How low can you take him? How does it work on cable TV in a way that it doesn’t work in a movie theatre? Gilligan: Television is or certainly can be a process of slow seduction. When you go to see a movie you see a story within two hours. The whole thing – I’m stating the very obvious – has to be compact and contain everything that satisfies an audience within that two hours stretch. A television series allows you the great extravagance of ending an episode on a cliffhanger with the audience hopefully breathlessly wanting more. You’re very seldom allowed that on movie. The only movie I could think of off the top of my head would be the “Star Wars” movie “The Empire Strikes Back” which ends on a cliffhanger. There’s something about delayed gratification, of having to wait another week for a cliffhanger to be resolved. That is both a frustrating and a wonderful thing. It’s a freeing thing for a writer such as myself to not have to answer every single question within a finite two hour block of time. Junklewitz: What elements do you figure out first? Gilligan: We’re at the beginning of season 5 right now. This is probably the end of our fourth week of sitting in this room coming up with ideas. The first weeks have been slim basically talking in broad strokes coming up with ideas for the entire season. This first month of time spent in the room is to dead end, it is meant to ensure we’ll have a pretty good idea where we’re headed. We sit in front of a cord board and write stuff on index cards and pack them up, figure out the scenes one by one. An individual episode will fill one of these cord boards in its entirety. An individual episode takes us about two weeks. After the episode is plotted out in detail any particular writer who spent all those two weeks in this room can write that episode into screenplay format. It’s not my typical experience of TV shows to have that much leading time to break a story. I’m blessed to have it. For instance here we are in December. We’re working through the first eight episodes. We’re not gonna start shooting them until the end of March. So we’ve got three or four months of this working time to come up with scripts. Junklewitz: Do you have already figured out the finale? There must be a lot of pressure, I guess. Gilligan: It is a wonderful, a high-class problem, that people have responded so favourably. But, of course, it ratchets up the pressure every year. We never wanna disappoint our audience, so, yes, there’s a lot of self imposed pressure. We have talked ahead to the very finale of the sixteen episode arc we’re setting out to do. But the devil is in the details. And a lot of details remain to be figured out. Hudson: It seems that the system in Germany is different from yours. Here you’re either writer or producer. And there’s a sort of assumption: if you’re a writer you can’t do sums very well, budgets roll a little bit. And here you are: you are executive producer and show runner. How does this work? Gilligan: On “Breaking Bad” all of my writers except for one – who is essentially a first-time writer starting off – have a producer credit. I will admit the producer credit is thrown around with a bit of abandon here in the United States. I expect all of my writers who have the title of producer – and indeed I expect my junior writer who does not have it yet – to act as producers to the best of their ability. For instance Chris Carter – who created the “X-Files”, a writer who very much was a producer as well – expected us to not only write our scripts but to take an active hand in choosing the actors, to aid the director in pre-production, to take an active hand in the editing room. When told by our physical producers that we’re over budget we were expected to find creative ways to help the budget be met. We expect our writers to think as producers and stop themselves before they go too crazy and say ‘It would be great if Hannibal crossed the alps on a hundred elephants’, though there’s no way we can afford to shoot that. Hudson: There’s an episode in season 3, “Fly”, which is like Samuel Beckett just invaded “Breaking Bad” and took it over. Is this an episode which is consciously produced on minimal budget with minimal cast? Artistically it is sublime. Gilligan: Though as I said we try to be good producers in season 2 we were hopelessly over budget about half a million dollar, maybe more, by the midpoint of the season. We had to do everything we could to get our show back on budget. We had to do an episode which took place in one set. We were a trepidatious going forward because we liked to have action and to keep the scenery changing. It felt more like a stage plight. Two of my writers are former actors and also playwrights, Moira WalleyBeckett and Sam Catlin, co-own that episode. It does remind me of „Waiting for Godot“. They did a marvellous job and we had an excellent young director named Rian Johnson. I felt like Richard Levinson und William Link, who created „Columbo“, must have felt in 1971 when they got to work with the young Steven Spielberg directing an episode. Rian Johnson is somebody to keep an eye on. He made that episode into something very visual and cinematic. Publikum: How did you sell a pitch like “Breaking Bad” to a TV network? Gilligan: I pitched “Breaking Bad” in the same way I pitched everything I’ve ever pitched. As to why it got accepted? To this day honestly I don’t know. On paper there was no reason that “Breaking Bad” should have ever become a television show, as it’s about a fifty year old man who’s dying of cancer and cooks crystal meth. I pitched it to Sony Television, a production company. They were interested in it, thank goodness they were. Then we began the process of pitching it to the various television networks in America who would conceivably show it. We didn’t even bother pitching it to broadcast networks because „Breaking Bad“ was a far too edgy show. So we pitched to HBO, FX, Showtime and TNT, four edgy cable networks. They all ultimately said ‘no’. But then the AMC network showed up sort of as a white knight on a horse. I came up with the idea for “Breaking Bad” in an unusual way. I was talking to a writer friend of mine about what we were gonna do now that the “X-Files” was over. ‘Gee, we had this great job. We’re out of money. What’ll we do next?’ My buddy said ‘Why don’t we buy a camper and put a meth lab in the back and drive around cook crystal meth and make money?’ I laughed and said ‘That’s a great idea for a TV show.’