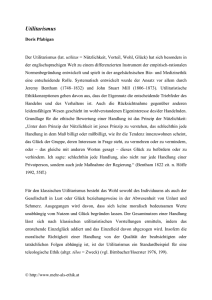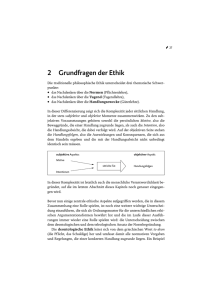Ethik - Stephan Sturm
Werbung

Ethik – Moral Die Begriffe Ethik und Moral werden häufig nicht trennscharf benutzt. Historisch betrachtet bezeichnet der Begriff „Moral“ zunächst übliches Verhalten oder gelebte Sitte (> lat. Mos Gebrauch). = In Sitte, dieser Bedeutung wird der Begriff i.d.R. auch im angelsächsischen Sprachraum benutzt (z.B. moral economy oft he poor bei Thompson = übliche ökonomische Haltung von Armen). Im bezieht sich Deutschen der Begriff moralisch dagegen meistens auf das spezifische Verständnis der Moralität bei Kant (= Handlungen, die aus Pflicht getan werden). Man kann davon ausgehen, dass zur Verhaltensregelung ursprünglich Moral ausreichte. Ein bestimmter Kanon von Handlungs- und Verhaltensweisen ist kulturell unreflektiert vorgegeben und wird einfach als Rahmen für das eigene Entscheiden akzeptiert (vgl. Heideggers „Man“). Vor allem in archaischen Gesellschaften mit 1 segmentärer Differenzierung wird der Entscheidungsrahmen durch die Ehrfurcht vor den Göttern/dem Numinosen hergestellt, Handlungsreglementierung erfolgt durch Tabus (vgl. lat nefas). Vor allem im Übergang zur hochkulturellen Standesgesellschaften mit stratifikatorischer Differenzierung entwickeln sich Standesethiken, die das Verhalten der Personen darüber steuern, dass bestimmte Verhaltensweise für die Aufrechterhaltung des Ansehens, des Standes und der Abgrenzung gegenüber (vor allem niedriger) Stände erwartet oder als notwendig empfunden werden. Von einem freien Adligen kann erwartet werden, dass er sich großzügig und nicht kleinlich zeigt, dass er sich um Bildung kümmert, sich besonnen zeigt usw. (vgl. die Megalopychia als Wert im klass. Griechenland), da ein anderes Verhalten eine pöbelhafte Gesinnung (vgl. Pöbel, peuble, populus und die heutige Verwendung des Begriffs „gemein“) verriete. Grundlage ist die persönliche Ehre und die Ehre des Standes (noblesse oblige) und gerade keine ethische Universalisierung mit Bezug auf alle Menschen. Es geht nicht um Pflichten, die für alle Menschen aus moralischen Gründen gelten, sondern um solche, mit denen man sich gerade von der Mehrheit abgrenzen kann.1 In entsprechender Abwandlung nach dem Durchgang durch Prinzipien der Moralität kann man hierin allerdings eine Vorform der Kantischen Pflichten gegenüber der Menschheit in der eigenen Person sehen. In dem Augenblick, wo moralische Standards und Standesethiken keine ausreichende Verhaltenssteuerung mehr leisten oder hinsichtlich ihrer Begründbarkeit oder Anwendbarkeit Zweifel aufwerfen, kommt es zur Ausbildung von Ethik als Reflexionstheorie von Moral.2 In der Ethik werden Fragen aufgeworfen, warum es überhaupt sinnvoll ist, sich nach Normen zu richten und welche Maßstäbe hierfür gelten sollen. In klassischen griechischen Antike wird dieser Impuls durch Beobachtungen und die Ansprüche der Sophisten ausgelöst. Zum einen kommt man in Bekanntschaft mit offenkundig andersartigen Normen anderer Völker, wodurch die selbstverständliche Geltung 1 In der Ilias ist Agamemnon offenbar durchaus berechtigt, dem Achill die Sklavin Briseis zu stehlen (die dieser seinerseits gestohlen hatte), weil Achill nicht in der Lage ist, sie gegen den Angriff zu verteidigen. Hier herrscht noch einfach das Naturrecht des Stärkeren. Das Verhalten von Agamemnon ist allerdings problematisch, weil Briseis Tochter eines Priesters ist und für sie schon Lösegeld bezahlt wurde. 2 Vgl. Niklas Luhmann, Paradigm lost, Frankfurt/M. 1990, S. 14ff.; Luhmann ist allerdings der Meinung, dass hierfür insbesondere die Umstellung von stratifikatorischer auf funktionale Differenzierung in der modernen Gesellschaft verantwortlich ist, vgl. ebd. S. 20. 2 der eigenen Normen in Frage gestellt werden, zum anderen behaupten die Sophisten nicht nur, sie könnten andere tugendhaft machen, sondern stellen auch Normen auf, die zur Kritik aufrufen (so z.B. die These des Trasymachus, Gerechtigkeit sei nichts anderes als das Recht des Stärkeren). Diese Tendenz trifft zusammen mit philosophischen Spekulationen darüber, wie man ein angenehmes oder glückliches Leben führen kann. Beim Urvater der teleologischen Ethik (< telos=Ziel) Aristoteles wird als oberstes Ziel noch ohne ethische Qualifizierung aus deskriptiven Sätzen (also empirischen Beobachtungen) die Glückseligkeit gesetzt. Da der Mensch allerdings ein kulturell anspruchsvolles, also gutes Leben nur in Gemeinschaft erreichen kann (anthropos physei zoon politikon= der Mensch ist von Natur ein gesellschaftsbezogenes, staatenbildendes Wesen) ergibt sich aus diesem Umweg die Notwendigkeit, z.B. gerecht zu sein.3 Teleologische Ethiken zeichnen sich dadurch aus, dass die Bestimmung der Handlung aus den nächstliegenden und letztlich höchsten Zwecken abgeleitet werden, eine Handlung ist gut, wenn sie geeignet ist, dieses Ziel zu befördern. In der Ethik von Aristoteles steht ebenso wie in den Lebensphilosophien des klass. Griechentums die Glückseligkeit (Eudämonia) als oberstes Ziel unreflektiert fest. Dabei hat die Ethik etwa von Epikur noch ganz den Charakter von Empfehlungen zu Verhaltensweisen, die geeignet sind, die eigene Glückseligkeit zu befördern (individualistischer Hedonismus). Im Wesentlichen wird dazu geraten, sich besonnen zu verhalten, da übermäßige Ansprüche ebenso wie z.B. Völlerei auf die Dauer mehr Unglück als Glück erzeugen. Hier zeigen sich bereits die Grundprinzipien des Utilitarismus: Glück vermehren, Unglück vermindern, allerdings auf einer ethisch noch unreflektierten Ebene. Zu ethischen Reflexionen zwingt allerdings in der römischen Moralphilosophie die Konkurrenz solcher Empfehlungen für ein gutes Leben mit weiterhin wirksamen Regeln konventioneller Moral und insbesondere des in der römischen Oberschicht ausgeprägten Standesethiken. In Ciceros „De officiis“ (von den Pflichten -> Kant) entwickelt sich das klare 3 Strukturell analog folgen bei Kant die Ansprüche anderer Menschen mir gegenüber aus den Pflichten, die ich der Menschheit in meiner eigenen Person gegenüber habe. Da ich verpflichtet bin, auf meiner eigenen Ehre zu bestehen, dies aber faktisch zu sicherstellen kann, wenn ich anderen Menschen dasselbe zugestehe, haben diese sekundär mir gegenüber Ansprüche. In der politischen Philosophie Kants folgt daraus mit Notwendigkeit die bürgerliche Gesellschaft und ich bin aus ethischen Gründen berechtigt, wenn nicht gar verpflichtet, andere dazu zu zwingen, mit mir in eine bürgerliche Gesellschaft einzutreten. 3 Gegensatzpaar von utile (nützlich) und honestum (ehrenhaft) und wird breit diskutiert. Hier schlägt sich die Erfahrung nieder, dass unehrenhaftes Verhalten für den einzelnen nützlich sein kann (während für Sokrates noch feststand, dass es besser ist, Unrecht zu leiden als unrecht zu tun), während umgekehrt ehrenhaftes Verhalten (in der ausgehenden Republik) nicht mehr ohne weiteres Ansehen und Ruhm (und die entsprechenden Ämter) mit sich führt. Bereits hier wird eine Abgrenzung spezifisch ethisch begründeter Regeln von solchen, die aus Erfolgsabsichten resultieren, nötig: Es ist besser, sich ehrenhaft zu verhalten, weil man sich dann besser fühlt? In den Invektiven gegen Epikur, er begründe eine Ethik für Schweine (der dann später bei den Utilitaristen wiederholt wird) zeigt diesen Widerstreit von Ehrenbegriffen und Nützlichkeitserwägungen (vgl. a. die Abgrenzung der Ethik gegenüber hypothetischen Imperativen bei Kant). Für die Ausbildung einer eigenständigen Ethik als Reflexionstheorie moraltheoretischen Probleme entscheidend ist die Abgrenzung ethischer Imperative gegenüber Präferenzen und Empfehlungen. Eine individuelle Präferenz („Ich möchte ...) zu äußern ist unabhängig davon, ob alle anderen dieselbe Präferenz haben, selbst dann, wenn sie sich auf das Handeln eines anderen bezieht („Ich möchte, dass du ...) etwas anderes als einen ethischen Imperativ zu formulieren. Ein solcher Imperativ zwangsläufig führt einen Universalisierungsanspruch mit sich („Jeder sollte ...“), unabhängig davon, wie dieser Anspruch begründet wird (teleologisch „jeder sollte dies tun, weil sonst ein notwendiges Ziel, das alle teilen sollten, nicht erreicht 4 werden kann“, situationsethisch „jeder sollte in dieser Situation so handeln, weil so die Situation am besten bewältigt werden kann“, deontologisch „jeder sollte so handeln, weil nur so allgemeinen Pflichtbegriffen genüge getan werden kann“). Schwieriger ist die Abgrenzung gegenüber Empfehlungen, weil viele moralische (möglicherweise aber ethisch nicht qualifizierte) Regeln genau solche hypothetischen Imperative formulieren4, die sich auf die Förderlichkeit auf eigene Glückseligkeit beziehen. Diese Abgrenzung wird letztlich erst von Kant geleistet. Der Utilitarismus dagegen führt den antiken Vorläufern gegenüber zunächst nur das Universalisierbarkeitsprinzip ein. An die Stelle von Imperativen wie „Du solltest dies tun, um deine eigene Glückseligkeit zu befördern“ treten Imperative der Art „Jeder sollte dies tun, um die allgemeine Glückseligkeit, das Glück der Mehrheit usw. zu befördern“; der individualistische Hedonismus weicht einem universalistischen Hedonismus. Utilitarismus Der Utilitarismus steht in der Tradition der teleologischen Ethiken, weitet diese jedoch stark auf Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit aus. Menschliches Handeln wird im wesentlichen auf Probleme der Verteilung von Gütern und property rights reduziert. Er steht zudem in derselben liberalen Tradition, die in der Staatstheorie die Vertragstheorie zur Grundlage politischer Systeme macht, hier allerdings in der gegen den Pessimismus und Egoismus bei Hobbes und für das optimistische, ausgleichende Modell eines Locke. Hinzu kommen als Traditionsgrundlagen die Überlegungen der klassischen Nationalökonomie, die sich im 18. und 19. Jahrhundert verbreitet. Gegen die Theorie A. Smiths spielen S. 267 Z. 58ff 1 Gefühle (Mitleid) keine Rolle und der Markt hat nicht in jedem Falle eine ausgleichende Wirkung (invisible hand), auch die Theorien von Malthus werden moralisch abgelehnt. 4 So z.B. die goldene Regel „was du nicht willst, das man dir tu, das füge auch keinem anderen zu“ oder „wer anderen eine Grube gräbt...“ „mit dem Hut in der Hand...“, „Lügen haben kurze Beine“, auch die 10 Gebote: „du wirst nicht stehlen, dann wirst du lange im Land deiner Väter leben...“. 5 Allerdings ist Bezugspunkt immer die Mehrheit der Gruppe, der gegenüber die Interessen der Minderheit geopfert werden dürfen. Die Vorstellung von der Gruppe als organischer Körper (vgl. Rousseau) wird wie in der liberalen Staatstheorie vermischt von der Vorstellung, der Körper bestehe aus Individuen und der Wert für das Gesamtsystem sei am Wert für die einzelnen Beteiligten zu messen. Der Utilitarismus steht überdies in der Tradition des Empirismus (Locke). Jeremy Bentham Bentham geht dementsprechend nicht von einer präskriptiv gewonnenen Norm, sondern von einer deskriptiven Beschreibung aus, um daraus Kriterien für gut und schlecht abzuleiten. Hieran zeigt sich bereits eine Schwierigkeit des Utilitarismus: Versteht man unter „gut“ lediglich nützlich in einem hypothetischen Sinne, ist die Ableitung logisch korrekt, verfällt dann aber möglicherweise dem Verdikt, im ethischen Sinne nicht prinzipienfähig zu sein. Versteht man unter „gut“ dagegen eine ethisch qualifizierte Aussage, also einen moralischen Wert, dann unterliegt der Utilitarismus einem naturalistischen Fehlschluß5. Zudem berücksichtigt er in der simplen Form bei Bentham keine kulturellen Güter. Die Begriffe von Freud und Leid sind so nicht qualifiziert. Bentham geht davon aus, dass alle Menschen faktisch von Leid und Freude regiert werden und deshalb nach Vermehrung von Freude und Verminderung von Leid streben. Daraufhin wird für jede Handlung umstandslos gefordert, dass sie geeignet ist, Bentham S. 266 Z. 0-21 1 das Glück derjenigen, die davon betroffen sind, zu vermehren bzw. das Leid zu vermindern. 5 Ein naturalistischer Fehlschluss zieht logisch falsch präskriptive Folgerungen aus deskriptiven Aussagen, erhebt also das faktische Sein zum Sollen, obwohl es sich um sprachlogisch völlig unterschiedliche Klassen von Aussagen handelt. 6 Bentham entwickelt daraufhin einen geradezu ökonomischen Kalkül, wie die Qualität einer Handlung berechnet werden kann. Hierzu muss berücksichtigt werden, wie stark das Glücksempfinden ist, das durch die Handlung bei den Betroffenen ausgelöst wird, wie lange dieses Glücksgefühl anhält und wie sicher das Eintreten dieser Folge ist. Daraufhin wird berechnet, welche Glücks- und Leidwerte kurzfristig und welche langfristig zu erwarten sind. Fällt die Rechnung positiv aus, ist die Handlung gut. Hier zeigt sich bereits eine Grundproblematik jeder Ethik, die den moralischen Wert einer Handlung aus ihren Folgen ableitet, also konsequentionalistisch verfährt: Ähnlich wie in der klassischen und neoklassischen Nationalökonomie werden den handelnden Subjekten vollständige Rationalität und Bentham S. 266 Z. 25-34 1 vollständige Kenntnis unterstellt. Versucht man aber bei allen Handlungen die Folgen für sämtliche direkt oder indirekt Betroffenen zu kalkulieren, wird eine solche Rechnung unmöglich6, außerdem können die z.B. ökologischen Folgen von Handlungen auf unbegrenzte Zeit berechnet, infinit werden, so dass gar nicht mehr gehandelt werden kann. Bentham sagt zwar, es sei nicht zu erwarten, dass eine solche Rechnung immer akkurat durchgeführt wird, hält sich aber trotzdem für eine anzustrebendes Ideal. Robert Spaemann kritisiert dagegen: „Der Utilitarismus scheitert erstens an der Komplexität und Undurchschaubarkeit der langfristigen Folgen unserer Handlungen. Wenn wir die Gesamtheit der Handlungsfolgen in Betracht ziehen müssten, kämen wir vor lauter Kalkulieren nicht mehr zum Handeln. Die Senkung der Kindersterblichkeit in armen Ländern hat oft langfristig katastrophale Folgen, diese aber führen dann wieder zu einem Druck, die Lebensverhältnisse insgesamt zu Norbert Hörster, S. 269 Z. 1-10 1 verbessern; ob das gelingt, ist offen. Was insgesamt am Ende 6 Darauf, dass die Berechnung solcher Folgen selbst mit Zeitaufwand und damit mit Transaktionskosten verbunden ist, reagiert der sogenannte Regelutilitarismus (im Unterschied zum Handlungsutilitarismus): Er formuliert Regeln, die der Erfahrung nach meistens zur Glücksvermehrung führen und fordert, dieser Regel auch dann zu folgen, wenn sie im Einzelfall nicht zum Erfolg führt, weil dieser Verlust immer noch geringer ist, als die Kosten durch eine Dauerreflexion über mögliche Folgen einer einzelnen Handlung. 7 überwiegt, wer will das beurteilen? Niemand könnte mir handeln, wenn er zunächst zu einem solchen Urteil kommen müsste. […]“ (s. S. 276). Entscheidend ist letztlich, wie viele mittelbar Betroffene ins das Kalkül einbezogen werden. Die Effizienz des Verfahrens neigt dabei natürlich dazu, bestimmte Interessen für nicht relevant zu erklären. Ein weiteres Problem zeigt sich darin, dass jede konsequentionalistische Ethik letztlich dazu neigt, die Mittel um des Zweckes willen zu heiligen, also keine eigene Qualifikation der Mittel anbietet: „Jedes Verbrechen wäre gerechtfertigt, wenn der, wer es begeht, dabei einen Zweck verfolgt, der dieses Mittel „heiligt“.“ (Spaemann, S. 276). „Das zweite Argument ist das folgende: der Utilitarismus liefert das sittliche Urteil des normalen Menschen der technischen Intelligenz von Experten aus. Denn man kann nach ihm die sittliche Qualität von Handlungen nicht an diesen selbst ablesen, sondern man bedarf dazu einer universalen Nutzenfunktion; und diese zu erstellen, ist Sache von Experten, seien diese auch selbst ernannt. […] Unsere sittliche Verantwortung ist nur dann konkret, bestimmte und nicht beliebig manipulierbar, wenn sie zugleich begrenzt ist, das heißt, wenn wir nicht davon ausgehen, wir müssen jeweils die Gesamtheit der Folgen jeder Handlung und jeder Unterlassung verantworten. […]“ (ebd.) Zudem gibt es in der utilitaristischen Ethik keine absoluten Werte (z.B. Menschenrechte), vielmehr ist alles kalkulierbar und gegeneinander aufrechenbar: „Es gibt […] bestimmte Handlungsweisen, die ohne Ansehung der Umstände immer und überall schlecht sind, weil durch sie unmittelbar […] die Würde der Person negiert wird. Bei solchen Handlungen gehört jeder Kalkül der Folgen auf. Das aber heißt: für die Folgen der Unterlassung einer in Sie schlechte Behandlung trifft uns keine Verantwortung. Der Mann, der sich weigerte, ein jüdisches Mädchen zu erschießen, das ihn um sein Leben an flehte, hatten nicht die Verantwortung dafür, dass sein Vorgesetzter daraufhin 10 andere Menschen erschießt, mit deren Erschießung er ihm zuvor gedroht hat. Sterben müssen wir schließlich alle einmal; aber morden müssen wir nicht. Für die Unterlassung dessen, was wir 8 nicht dürfen, trifft uns so wenig die Verantwortung wie für die Unterlassung dessen, was wir physisch gar nicht können.“ (Spaemann, ebd.) „Im Übrigen fördert der Konsequentialismus Erpressungen. Ein Konsequenzialist muss immer bereit sein, einen Mord zu begehen, wenn man ihm droht, ansonsten zehn Menschen umzubringen. Aber nur einem Konsequenzialisten kann man damit drohen. [...] Wer den konsequenzialistischen informierten Begriff von Verantwortung teilt, muss dieser Erpressung nachgeben. In Wirklichkeit aber kann kein Mensch auf die Länge mit diesem Begriff von Verantwortung leben, ohne sich einerseits moralisch zu korrumpieren und ohne sich andererseits permanent zu überfordern.“ (Robert Spaemann, Die schlechte Lehre vom guten Zweck, FAZ, 23. Oktober 1999, Nummer 247) McIntyre zu Bentham S. 269 1 9 John Stuart Mill Als eines des zentralen Probleme des Utilitarismus bei Bentham zeigt sich, dass dessen Kriterien für das Glück rein quantitativ gedacht sind. Mill versucht, den utilitaristischen Ansatz in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln, indem er qualitative Kriterien für Glück auszumachen versucht. Damit versucht Mill zugleich, der Kritik am Utilitarismus zu begegnen, dieser sei eine rein egoistische Ethik, die nur an einem verwerflichen Lustprinzip orientiert sei. Wie Bentham geht Mill zunächst davon aus, dass eine Handlung dann moralisch gut ist, wenn sie die Tendenz hat, Glück zu befördern, und moralisch schlecht ist, wenn sie die Tendenz hat, Leid zu vermehren. Mill S. 270 2 Er bezieht aber in seine Überlegungen mit ein, dass der Wert des Glücks nicht ausschließlich in seiner Quantität, sondern in seiner Qualität zu suchen ist. Eine erste Schwierigkeit zeigt sich hierbei jedoch darin, dass es keine objektiven Maßstäbe dafür gibt, welche Freude einen höheren Mill S. 270 1 qualitativen Wert hat. Mill gibt daher als Grundlage der Qualitätsprüfung letztlich rein empirische, statistische Messungen an, bei denen fraglich ist, inwiefern sie einen spezifisch moralischen Wert (kontrafaktisch) begründen können. Dabei geht Mill ohne weiteres davon aus, dass kein vernünftiger Mensch wählen würde, z.B. ein Tier zu sein, selbst dann, wenn man garantierte, dass es dann ungestört der tierischen Lust nachgehen könnte. Als weiteres Problem zeigt sich, dass die subjektive Einschätzung des Glücks durch den bloßen Zuwachs an Freude bestimmt sein könnte, so dass dasselbe Glück von verschiedenen Menschen unterschiedlich eingeschätzt werden könnte, z.B. ist das Glück, Nahrung zu bekommen für denjenigen höher, der hungert, als für den, der stets genug zu essen hat. Mill S. 270 3 Letztlich zeigt sich dasselbe Ergebnis wie bei Epikur, dass nämlich eine Steuerung der Bedürfnisse die Glückserwartung erhöht. Zwar betont Mill, dass es jenseits subjektiver Maßstäbe quasi objektiv feststehe, dass manche Werte besser sind als andere, damit sprengt er aber letztlich den eigenen Ansatz, der bei den empirisch feststellbaren Mill S. 271 4 10 Vorstellungen der Menschen ansetzt. Seiner Meinung nach liegt der feststellbare Gegensatz zwischen objektiven und subjektiven Interessen in der mangelnden Kenntnis (von Ungebildeten) über den wahren Wert des Glücks begründet. Deshalb fordert er auch, dass die Erziehung dahin wirken solle, dass die Menschen sich Ziele und Wünsche setzen, die mit dem Gemeinwohl vereinbar sind. Mill S. 271 5 Mill verteidigt zudem den Ansatz des Utilitarismus gegen den Vorwurf, egoistisch zu sein, indem er betont, dass der Utilitarist den Wert seiner Handlung nicht allein daran bemisst, wie viel Nutzen er selbst davon hat, sondern den Nutzen aller Betroffenen zum Maßstab macht. Mill S. 272 1 Dadurch, dass der Utilitarismus in dem Augenblick, wo er den Glücksbegriff qualitativ bestimmen will, entweder Erziehung, also letztlich Manipulation, benutzen muss, um gemeinwohlfördernde Wünsche bei den Einzelnen zu erzeugen, begibt er sich in einen Widerspruch zu den ursprünglichen empirischen Prinzipien. Der Inhalt der eigentlichen Wertbegriffe bleibt auf diese Weise unbestimmt. Letztlich ist in dieser Hinsicht der Präferenzutilitarismus bei Singer konsequenter, indem er dem Nutzenkalkül eine subjektive Wertlehre unterlegt, so dass tatsächlich die zufälligen Präferenzen des Einzelnen als qualitativer Maßstab für die Bemessung des Glücks herangezogen wird. Hier entsteht dann freilich das Problem, welche Präferenzen (z.B. beim Kind) man ernst nehmen kann und welche nicht, zudem zeigt sich wie in allen letztlich ökonomischen Ansätzen das Problem von nichtstabilen Präferenzen bzw. das Problem, dass den einzelnen Subjekten keine vollständige Rationalität und Kenntnis unterstellt werden kann (homo ökonomicus). Einen Ausweg bietet hier die Umstellung auf die Verteilung von Lebenslagen bzw. die Allokation von property rights. In diesem Falle löst sich dann allerdings das ursprünglich als ethisch gedachte Projekt des Utilitarismus in ein Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit auf, also in einen ökonomischen Ansatz. Kant Kant geht in seinen Überlegungen in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten unmittelbar vom Universalisierungsprinzip aus. Dieses hatte sich ja als für eine Ethik konstitutiv gezeigt. Zunächst ist ein Imperativ der praktischen Vernunft anders als ein Gesetz der theoretischen Vernunft ein Grundsatz, der, weil der Mensch kein reines Vernunftwesen ist, stets einen präskriptiven 11 und keinen deskriptiven Satz enthält. Ein praktisches Gesetz ist also ein solches, das bei einem reinen Vernunftwesen deskriptiv dessen Handlungsweisen beschreibt, bei einem nicht reinen Vernunftwesen dagegen präskriptiv beschreibt, was dieses tun soll. Dadurch wird von vornherein ein naturalistischer Fehlschluss vermieden. Anschließend unterscheidet Kant zwischen Maximen und Gesetzen. Maximen sind Bestimmungsgründe, die für den Willen nur subjektiv sind, also nur für das Subjekt gelten, Gesetze sind dagegen Bestimmungsgründe, die objektiv, also für alle Menschen gelten. Es ist ohne weiteres klar, dass nur die Gesetze dem ethischen Anspruch auf Universalisierbarkeit genügen können. Daraus leitet sich im Grunde schon die spätere Formulierung des kategorischen Imperativs ab, nämlich dass die Maximen, also die subjektiven Beweggründe zu einer Handlung, von objektiven, also universalisierbaren Gesetzen bestimmt sein müssen. Der kategorische Imperativ ist also nichts anderes als das Universalisierungsprinzip. Die praktischen Grundsätze können nun bezogen sein auf die Kausalität des Menschen in Ansehung auf eine Wirkung, oder lediglich den Willen zur Hervorbringung von Wirkungen betreffen. Sie können also teleologisch oder deontologisch sein. Grundsätze, die sich auf die Hervorbringung von Wirkungen beziehen, sind zunächst immer hypothetisch, d.h. sie gelten nur insoweit als geboten, als die Wirkung selbst geboten ist. D.h. sie sind Grundsätze der Geschicklichkeit (wenn man diesen Zweck erreichen will, muss man jenes tun). Solange solche Grundsätze aber ein Bedingungsgefüge (wenndann) enthalten sind sie solange bloß hypothetisch, wie der anvisierte Zweck nicht als solcher durch ein kategorisches Gesetz bestimmt werden kann (dieser Zweck ist später die Menschheit). Hypothetische Grundsätze können daher niemals kategorisch sein, weil der darin vorausgesetzte Zweck zunächst ein bloß subjektiver ist (er ist durch kein kategorisches Gesetz bestimmt) und überdies von empirischen Grundlagen abhängt und als Geschicklichkeitsregel durch empirische Grundsätze bestimmt ist. Ohnehin wäre ein solcher Imperativ nicht unversalisierbar, weil dann auch die Fähigkeit, die Zwecke zu bewirken, moralisch vorgeschrieben sein müsste, was für einen empirisch gegebenen Menschen nicht möglich ist. Daraus folgt, dass hypothetische Imperative kein moralisches Gesetz abgeben können, so dass weiter folgt, dass die Qualifikation für ein universalisierbares praktisches Gesetz nur Imperative haben können, die sich ausschließlich auf den Willen beziehen (unabhängig davon, was dieser Wille bewirkt). Gut ist also allein ein guter Wille. Folglich gelten kategorische Imperative zwangsläufig unabhängig von jeder Wirkung. 12 Aus diesen Darlegungen folgt bereits, dass der Ansatz einer Ethik beim Prinzip der Glückseligkeit von vornherein versperrt ist. Kant geht zwar deskriptiv wie die Utilitaristen davon aus, dass Glückseligkeit notwendig der Bestimmungsgrund für das Begehrungsvermögen jedes Menschen darstellt, jeder also notwendig glückselig werden möchte. Dass dies notwendig der Bestimmungsgrund ist, liegt darin, dass Menschen bedürftig sind. Daraus folgt jedoch zugleich, dass alle Menschen in unterschiedlichen Dingen bedürftig sind, folglich auch Unterschiedliches erstreben. Auf diese Weise ist es nicht möglich, aus den subjektiven Bestimmungsgründen ein objektives praktisches Gesetz zu machen, zumal die jeweilige Bedürftigkeit nur aus Erfahrung, also a posteriori bestimmt werden kann. Selbst wenn alle Menschen an denselben Dingen bedürftig wären, wäre diese Übereinstimmung nur zufällig, würde also auch dann nicht für ein praktisches Gesetz taugen. Da nach Kant alle materialen, also inhaltlichen, Bestimmungen des Begehrungsvermögens, notwendig durch das Strebe nach Glückseligkeit erfüllt sind, können materiale Bestimmungsgründe insgesamt kein praktisches Gesetz abgeben, so dass für ein solches nur noch formale Bestimmungsgründe übrig bleiben. Danach kann dann aber auch der Inhalt einer gebotenen Handlung nicht mehr selbst ein praktisches Gesetz sein. Kant unterscheidet deshalb bei einer Handlung zwischen der Legalität und der Moralität derselben. Legalität bedeutet, dass eine Handlung material dem entspricht, was geboten ist, also eine pflichtgemäße Handlung ist, Moralität dagegen bedeutet, dass eine Handlung nicht nur pflichtgemäß ist, sondern auch nur deshalb erfolgt, weil sie pflichtgemäß ist, also aus Pflicht. 13 Dass der moralisch Handelnde nicht nur das tut, was solchen Prinzipien entsprechen kann, sondern es auch nur deshalb tut, weil er das Prinzip als vernünftig erkannt hat, scheint zunächst überflüssig. Warum mir jemand hilft, wenn ich in Not bin, kann mir zunächst egal sein, Hauptsache er tut es. Ohnehin kann ich die Motive des Handelnden von außen gar nicht einsehen oder gar beurteilen. Anders sieht es jedoch aus, wenn ich die subjektive Berechenbarkeit der Handlung in Betracht ziehe. Hilft mir jemand nur deshalb weil er mich mag, kann ich mit seiner Hilfe nur solange rechnen, wie ich sein Wohlwollen genieße. Wenn ich dagegen in Ungnade falle, muss ich damit rechnen, dass die Hilfe ausbleibt. Ohnehin könnte ich von völlig Fremden keine Hilfe erwarten. Ähnliches ergibt sich, wenn ich auf Mitleid, Nächstenliebe oder Eigeninteresse setze. Denn alle diese Faktoren können im besonderen Falle ausbleiben und so bliebe auch die Handlung aus. Alle Systeme, die auf Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person angewiesen sind, setzen ohnehin voraus, dass bestimmte Leistungen aus Pflichtbewusstsein der Handelnden beruhen, so z.B. die gerechten Urteile eines Richters, die unparteiische Beurteilung des Finanzamtes oder auch die gerechte Benotung eines Lehrers. Auch für den Handelnden selbst ergibt sich aus der Grundlegung des kategorischen Imperativs ein nicht zu verachtender Vorteil hinsichtlich der Sicherheit des moralischen Urteils. Der kategorische Imperativ sichert nämlich vor moralischer Überforderung insbesondere in Situationen und Umständen, in denen der Handelnde nur einen geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat, bzw. voraussetzen muss, dass auch bei Aufbietung aller zur Verfügung stehenden Mittel ein bestenfalls akzeptables, ethisch aber jedenfalls nicht wünschbares Ergebnis herauskommt. In einem ungerechten System (Schule) oder gar einer Diktatur müsste der Handelnde stets daran verzweifeln, dass das Ergebnis seiner Handlungen unterhalb des geforderten Maßstabes bleibt. Die berühmte Einschränkung „so viel an mir ist“ bewirkt, dass der Handelnde sicher sein kann, richtig gehandelt zu haben, wenn vorausgesetzt werden kann, dass alle vernünftigen Wesen die zugrundeliegenden Prinzipien teilen könnten, auch wenn dies faktisch nicht der Fall ist. Auch in einer Welt voller Teufel kann so noch moralisch richtig gehandelt werden. Umgekehrt schützt der kategorische Imperativ aber auch vor moralischer Unterforderung. Die Tatsache, dass durch den moralisch gebotenen Einsatz faktisch nichts bewirkt wird, hindert nicht, dass die Handlung dennoch geboten ist. Auch die möglicherweise gegebene Tatsache, dass auch alle anderen unmoralisch handeln, kann an diesem Urteil nichts ändern. Schließlich hat insbesondere auch die sogenannten Menschheitszweckformel wichtige ethische Valenzen: Dass man Menschen nie nur als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck behandeln soll, schließt einerseits aus, dass andere Menschen nur Spielfiguren in einem Spiel, gleichviel welchen Wertes, gesehen werden können. Kein Ziel kann so erhaben sein, dass auf die mögliche Zustimmung der beteiligten Personen (vorausgesetzt sie können als vernünftig angesehen werden) verzichtet werden könnte. Interessanter noch ist der Schutz vor den sogenannten objektiven Interessen. Die Menschheitszweckformel verbietet es nämlich auch, als wohlmeinender Diktator zugunsten einer fremden Glückseligkeit zu 14 handeln, die der Betroffene so gar nicht sieht (wir wollen doch nur Dein Bestes…). Auch hier muss der Betroffene (als vernünftiges Subjekt vorgestellte) prinzipiell selbst zustimmen können, man kann also letztlich nicht besser wissen, was gut für andere ist, es sei denn, man kann es beweisen. Schließlich verhindert die Formulierung der Menschheit in der eigenen Person dann auch, dass jemand sich selbst zu einer bloßen Figur in der Verwirklichung fremder Glückseligkeit macht und damit als Subjekt selbst herabwürdigt. Kein noch so hehres Ziel erlaubt es nach Kant, sich selbst aufzugeben und zum bloßen Faktor eines vermeintlich höherwertigen Zweckes zu machen und damit als Person aufzugeben. In anwendungstheoretischer Hinsicht ergeben sich freilich erhebliche Bedenken hinsichtlich der Ethik Kants. Kant scheint überall vorauszusetzen, dass schon klar ist, welche Handlungen pflichtgemäß und welche pflichtwidrig sind. Denn eine solche Bestimmung folgt aus dem kategorischen Imperativ nicht. Der kategorische Imperativ ist vielmehr ein rein formales Prinzip, das als Filter angewandt werden kann, wenn aus irgendwelchen anderen Gründen heraus eine Handlung schon beabsichtigt ist und erst nachträglich gefragt werden kann, ob die Prinzipien, aus denen die Handlung als gut bewertet wird, verallgemeinerbar sind. Kants Ethik setzt überdies einen Menschen voraus, der in seinem Willen durchweg nicht von Gefühlen und Neigungen bestimmt ist. Dass dies faktisch nie der Fall ist, tut der Ethik keinen Abbruch, weil man ja trotzdem moralisch fordern kann, dass dies so sein soll. Fraglich ist allerdings in der Anwendung, ob dies überall wünschenswert sein kann. In den Fällen (s.o.), wo ein unbeeinflusstes Handeln ohne Ansehung der Person wünschenswert ist, ist dies klar, ob aber reines Pflichtbewusstsein für das Handeln im sozialen Nahbereich ausreicht und ob der moralische Wert einer Handlung unter Umständen nicht gerade darin besteht, dass darin eine Zuneigung, Philanthropie oder ähnliches ausgedrückt wird, bleibt bei Kant außen vor. Jonas Der Verantwortungslosigkeit der Kantischen Ethik versucht Jonas zu entkommen, indem er objektive Zwecke formuliert, die sich seiner Meinung nach aus dem Wandel der Technik ergeben haben. Diese Technik ist zum bestimmenden Moment des Daseins des Menschen geworden, weil sie inzwischen Dimensionen erreicht hat, die alle bisherige Technik weit übersteigt. Die Technik strebt eine universelle Herrschaft über die Natur und den Menschen an, die zwangsläufig neue Dimensionen der Verantwortung erzeugen muss. Bislang nämlich war die Anwesenheit des Menschen in der Welt „ein erstes und fraglos Gegebenes“, jetzt dagegen ist „sie selber ein Gegenstand der Verpflichtung geworden“. Denn Technik ist inzwischen in der Lage, jegliches menschliches Leben auf der Erde unmöglich zu machen, und Technik ist inzwischen in der Lage, den Menschen selbst zu verändern. Letzteres kommt im Wesentlichen in zwei Hinsichten zum Tragen: Durch medizinischen Fortschritt wird es immer stärker möglich, die Lebenszeit der Menschen zu verlängern. Daraus resultiert das Problem, das entschieden werden muss, welche Menschen in den Genuss des medizinischen 15 Fortschritts kommen, bzw. welche Menschen leben sollen und welche Menschen kein Recht auf Leben haben. Es muss auch gefragt werden, in welchem Verhältnis alte und junge Menschen leben sollen, ob z.B. eine Gesellschaft unendlich altern soll oder darf. Die Möglichkeiten der Gentechnik erlauben es darüber hinaus, den Menschen selbst zu verändern und zu gestalten. Auch hierfür muss es ethische Kriterien geben (wer darf sich wann klonen lassen, welche Eigenschaften von Kindern dürfen von den Eltern gestaltet werden, welche Klone darf man aus möglicherweise egoistischen Gründen in die Welt setzen (s. Die Klavierspielerin), darf man Menschen als Ersatzteillager verwenden usw.?) Die moderne Ethik kann also nicht einen existierenden Menschen einfach voraussetzen, wie es die Ethik Kants tut. Vielmehr muss sie zunächst dafür sorgen, dass es überhaupt Menschen auf der Erde gibt, und dass diese menschenwürdig leben können. Das ist nämlich die physische Voraussetzung dafür, dass es moralisch handelnde Menschen geben kann. Jonas behauptet deshalb, dass es über die Imperative Kants hinausgehende Imperative geben muss, die dies sicherstellen. Kant dagegen setzt diese Existenz der Menschheit immer schon voraus. Die neuen Imperative bei Jonas sind: a) Positiv ausgedrückt: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden!“ b) Negativ ausgedrückt: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens. Für Jonas gilt aufgrund der oft noch unabsehbaren Folgen von Technik dabei das Prinzip der Heuristik der Furcht. Man muss bei der Planung einer Handlung (oder eines Regierungsprogramms) immer von den schlechtest möglichen Folgen ausgehen (also vom worst case). Jede Handlung, die unter diesem Gesichtspunkt das Überleben der Menschheit gefährden könnte, ist dann zu unterlassen. Das Problem dabei ist freilich, dass sich die Folgen technischen Handelns für die Zukunft in der Regel nicht hinreichend bestimmen lassen. Wie jede teleologische Ethik setzt Jonas vollständige Rationalität und vollständiges Wissen voraus. Die Heuristik der Furch umgeht zwar dieses Problem, weil die bloße Möglichkeit katastrophaler Folgen schon ausreicht, um eine Handlung als unmoralisch zu qualifizieren, wenn man diesem Prinzip konsequent folgt, kann aber jede Handlung unabsehbare Folgen haben. Folglich könnte man eigentlich nie handeln, was unter Umständen aber auch katastrophale Folgen haben kann. Jonas ist überdies beeinflusst von einer Technikphobie, wie man sie in der Entstehungszeit seines Buches „Prinzip Verantwortung“ (erschienen 1979) hatte. Es ist fraglich, ob man diesen Zeitgeist ohne weiteres jeder Ethik unterstellen kann. 16