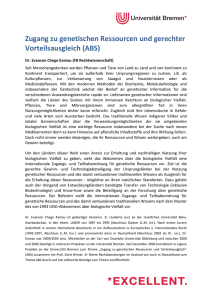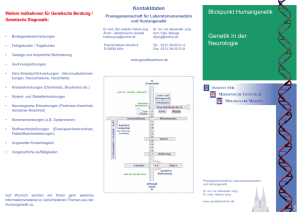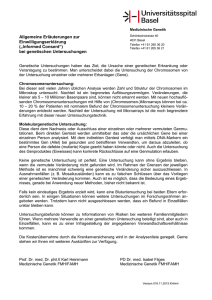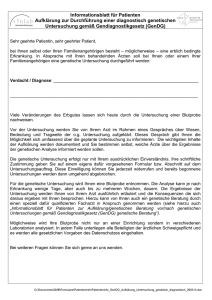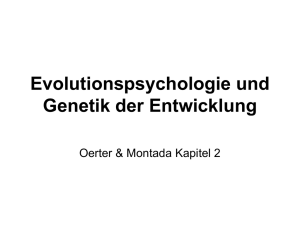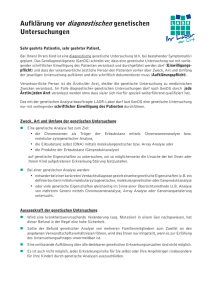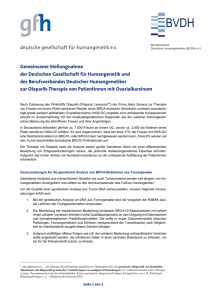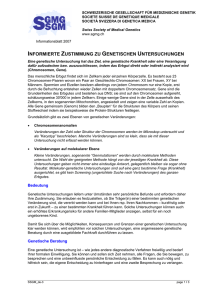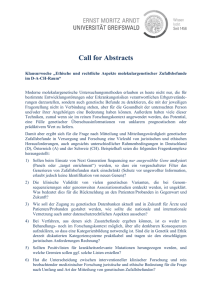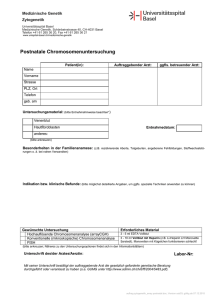Thesenblatt (Schockenhoff) zum
Werbung

Ethische Probleme im Zusammenhang mit der Ausweitung diagnostischer Verfahren Die Möglichkeiten der Genomanalyse haben die Medizin ihrem alten Traumziel näher gebracht, die biologischen Rätsel des Lebens lückenlos zu durchschauen. Seit dem vorläufigen Abschluss des Humangenomprojektes im Jahr 2001 und seiner offiziellen Beendigung im Jahr 2003 liegt das menschliche Erbgut in vollständiger Sequenzierung vor. Die Forschung verspricht sich von der detaillierten Erfassung des menschlichen Genoms nicht nur eine Erweiterung ihrer Grundlagenkenntnisse, sondern wesentliche Fortschritte in der Behandlung von Krankheiten, bei deren Bekämpfung die Medizin mit ihren herkömmlichen Verfahren seit langem auf der Stelle tritt. Individualisierte Therapieansätze („Medizin nach Maß“) sollen passgenaue, auf die Ansprechbarkeit des jeweiligen Patienten abgestimmte Medikamentengaben ermöglichen, die geringere Nebenwirkungen als standardisierte Behandlungsschemata haben und dennoch jedem den optimalen, der Besonderheit seines genetischen Krankheitsbildes entsprechenden Therapieerfolg garantieren. Die Erstellung einer persönlichen Genkarte soll darüber hinaus jedem Menschen Auskunft über den wahrscheinlichen Verlauf seiner biologischen Lebenskurve geben und ihn vor wichtigen Lebensentscheidungen in Partnerschaft, Familienplanung und Beruf über deren genetische Risiken informieren. Im Vorfeld der weltweiten Arbeit an dem Humangenomprojekt vertraten viele Wissenschaftler die These, nicht nur Gesundheit und Krankheit, sondern mehr oder weniger alle Lebensäußerungen des Menschen seien genetisch bedingt. Der Glaube an die schicksalhafte Macht der Gene, den viele Forscher heute mit guten Gründen als Ausdruck eines verfehlten genetischen Determinismus beklagen, wurde ursprünglich von der scientific community selbst propagiert, um ihre Forderungen politisch besser durchsetzen zu können. Damals wurde nicht nur die bald bevorstehende Entdeckung von Genen „für“ bestimmte Krankheiten in Aussicht gestellt, was inzwischen wenigstens teilweise eingetreten ist, beispielsweise durch die Entdeckung der für die Entstehung des erblichen Brustkrebses verantwortlichen Mutation. Man glaubte vielmehr, auch die genetischen Ursachen von Verhaltensabweichungen und besondere Intelligenz- und Begabungsanlagen sicher identifizieren zu können.1 1 Die Zeitschrift Science, neben Nature das weltweit angesehenste Wissenschaftsjournal, vermeldete im Jahr 1993 zwei spektakuläre Entdeckungen, die US-amerikanischen Forschern mit der sicheren Identifizierung eines „Aggressions-Gens“ und eines zur Homosexualität führenden „Schwulen-Gens“ gelungen seien. Seitdem wurden nicht nur die medizinischen Verheißungen der Gen-Religion – ein besonders reißender Buchtitel aus der emphatischen Anfangszeit der Genforschung lautete: Come, let us play God – heftig diskutiert, sondern auch die mit dem genetischen Determinismus verbundenen Gefahren der sozialen Kontrolle und der gesellschaftlichen Stigmatisierung genetischer Merkmalsträger schärfer erfasst. Inzwischen ist die humangenetische Forschung von dem eindimensionalen Krankheitskonzept, das um die 1980er Jahre in der molekularen Medizin vorherrschte, wieder abgekommen. Das gegenwärtige Paradigma vertritt keine kausale und hierarchische Beziehung zwischen Genotyp und Organismus mehr, sondern berücksichtigt stärker die Wechselwirkung zwischen genetischer Anlage und nichtgenetischen Faktoren wie Umwelteinflüssen, Ernährungsweise und Lebensstil. Wenn diese Faktoren als prinzipiell gleichrangige Ursachen bei der Krankheitsentstehung zusammenwirken, sind den prognostischen Möglichkeiten der molekularen Medizin von vornherein engere Grenzen gesetzt als dies bei dem deterministischen Modell der Fall ist. Auch in seiner modifizierten Form läuft das Grundkonzept der genetischen Medizin auf einen weitreichenden Paradigmenwechsel des medizinischen Denkens und eine Neuausrichtung des Krankheitsbegriffes hinaus. Eine Krankheit wird nicht mehr als pathologische Veränderung an bestimmten Organen oder als Störung der Zellfunktion, sondern lange vor dem (eventuellen) Auftreten ihrer Symptome als genetische Disposition aufgefasst. „Krankheit erscheint als ein ‚Fehler’ oder ‚Defekt’ im genetischen Make-up eines Individuums oder als Folge einer Kombination genetischer Dispositionen mit anderen Risikofaktoren.“2 Mit dem Übergang von einem biochemisch-zellulären zu einem genetisch-molekularen Erklärungsansatz verändert sich auch die subjektive und gesellschaftliche Wahrnehmung der Krankheit. Ein Diagnosekonzept, das an molekularen Veränderungen ansetzt, um die betreffende Person über ihre genetischen Gesundheits- und Krankheitsrisiken aufzuklären, schafft einen künstlichen Zwischenstatus zwischen Gesunden und Kranken. Der „potentiell Kranke“ ist noch nicht Patient, weil bei ihm keine Erkrankung festgestellt werden kann, aber auch nicht mehr völlig gesund, da ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen diagnostiziert wurde.3 Insofern sie nicht Krankheiten aufspürt, sondern nur 2 Wahrscheinlichkeiten angibt, mit der Krankheiten, an denen die betreffenden Testpersonen zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht leiden, in naher oder ferner Zukunft auftreten können, führen die Informationen der genetischen Medizin zwangsläufig zur Verunsicherung der Menschen. Sie nehmen ihnen Spontaneität und Vertrauen, indem sie die gewohnte Lebenssicherheit in Frage stellen und einen bisher unauffälligen Normalzustand problematisieren. Auf diese Weise erweitern genetische Informationen den Krankheitsbegriff durch die Einbeziehung von Risiken und Krankheitsdispositionen, von denen niemand weiß, ob sie sich jemals zu symptomatischen, mit den gängigen medizinischen Verfahren erfassbaren Krankheiten entwickeln. Dies verändert die Krankenrolle, indem eine Art von VorläuferStatus zum Kranksein eingeführt wird. Krank ist man nicht mehr aufgrund des subjektiven Befindens oder messbarer Krankheitswerte, sondern weil man durch die Erfassung des genetischen Risikoprofils auf einer Art Warteliste verzeichnet ist, die mögliche künftige Gesundheits- und Erkrankungsszenarien vorwegnimmt. Lange vor ihrem Ausbruch wird die Krankheit so zu einer virtuellen Realität, die bei der Lebensplanung aufgeklärter Individuen Berücksichtigung erfordert. Da genetische Daten nicht nur die untersuchten Risikoträger betreffen, sondern auch für ihre Familienangehörigen und leiblichen Verwandten relevant sind, erstrecken sich die Sorge um mögliche Erkrankungsrisiken und ein vorausschauendes Gesundheitsmanagement auf einen immer weiteren Kreis von Menschen. Die Trennung zwischen den beiden Ebenen des individuellen Phänotyps (des einzelnen Kranken, bei dem sich die Erkrankung manifestiert) und der des Genotyps Verwandtschaftsbeziehungen (der vielen gemeinsam ist), Individuen verändert aufgrund den Fokus genealogischer medizinischer Untersuchungen: Nicht mehr der einzelne Patient und sein erkrankter Organismus stehen im Mittelpunkt, sondern der Körper eines Familienmitgliedes, der als bloßes Vehikel der Gene auch für andere zum aussagekräftigen Informationsträger wird. In der modernen Wissensgesellschaft wird der prädiktive Gentest zu einer neuen Form des Orakels oder der Wahrsagerei, die den Betroffenen und ihren Angehörigen offenbart, wer sie „eigentlich“ oder „in Wirklichkeit“ sind.4 Für viele ist der „gläserne Mensch“, der unter den Händen von Wissenschaftlern und Sozialingenieuren alle Geheimnisse seines Lebens preiszugeben gezwungen ist, eine 3 Horrorvorstellung, die der Abschaffung von Menschenwürde, Autonomie und Freiheit gleichkommt. Sie sehen in der aus Anlass eines Berufswechsels, eines Versicherungsbeitritts oder der Teilnahme an einer obligatorischen Reihenuntersuchung aufgezwungenen Kenntnisnahme der eigenen genetischen Identität eine Freiheitsberaubung, die das Individuum immer neuen Zwängen des gesellschaftlichen Gesundheitssystems ausliefert. Da es die Freiheit unserer gegenwärtigen Lebenssituation erheblich einschränkt, wenn wir unsere noch ausstehende Zukunft durch ihre genetische Offenlegung vorwegzunehmen gezwungen sind, fordern sie ein prinzipielles Recht auf Nichtwissen, das dem Einzelnen gesetzlich zu verankernde Weigerungsmöglichkeiten gegenüber jeder Form der Genomanalyse einräumt. 5 Dabei berufen sie sich auf die dem Schutz der Privatsphäre dienende informationelle Selbstbestimmung, die jedem das Recht gibt, selbst zu entscheiden, welche persönlichen Daten durch medizinische Testverfahren erhoben, und in welchem Umfang sie an andere weitergegeben werden sollen. Nach dieser in der ethischen und juristischen Diskussion unseres Landes weithin anerkannten Position dürfen genetische Informationen, die nach dem jeweiligen diagnostischen Standard erhoben werden können, dem Einzelnen weder vorenthalten noch ohne ausdrückliche Zustimmung aufgezwungen werden. Das Recht der freien Selbstbestimmung umfasst demnach nicht nur den negativen Schutz der Privatsphäre, also das Recht, nicht ausgeforscht zu werden, sondern auch die positive Freiheit, all das und nur das über sich selbst in Erfahrung zu bringen, was man selbst wissen will.6 Auf der anderen Seite des Spektrums sprechen angelsächsische Bioethiker von einer Pflicht zu wissen (duty to know), die den Einzelnen vor sich selbst und vor der Gesellschaft zum höchstmöglichen Risikoausschluss als selbstverständlichem Bestandteil einer rationalen Lebensplanung verpflichtet.7 Unter dem Vorzeichen genetischer Diagnosemöglichkeiten, die dem Individuum erhöhte Verantwortungslasten für sich und für andere auferlegen, kommt es so zu einer unverhofften Wiederbelebung paternalistischer Einstellungen. Obwohl das Recht auf informationelle Selbstbestimmung das Recht auf Wissen und das Recht auf Nichtwissen als gleichrangige Komponenten umfasst, wird es immer schwieriger, das Nicht-Wissen-Wollen im Blick auf molekulare Gesundheitsrisiken gegenüber dem Druck medizinischer Diagnosemöglichkeiten und der Erwartungshaltung von Familienangehörigen tatsächlich durchzuhalten: „Der Wille zum Nichtwissen wird (…) als ein ethisch zweifelhafter Wille betrachtet, der von so hohen 4 finanziellen und sozialen Folgekosten belastet sei, dass seine Realisierung unverantwortlich erscheint.“8 In Rechtsprechung und Literatur wird eine genetische Offenbarungspflicht gegenüber Dritten, die vom Risiko mitbetroffen sind, für Ärzte inzwischen immer häufiger bejaht. Die Bundesärztekammer fordert in ihren Richtlinien zur prädiktiven genetischen Diagnostik eine individuelle Bewertung der Gefahrenlage durch den Arzt, ohne dafür eindeutige Kriterien zu nennen: Sofern prognostizierbare Erkrankungen Gefährdungen Dritter hervorrufen können, wie dies bei bestimmten Berufen (Piloten, Busfahrer, Lokführer usw.) anzunehmen ist, muss der Arzt „zwischen Ausmaß und Wahrscheinlichkeit der Gefahr für die Allgemeinheit einerseits und dem Patientengeheimnis andererseits abwägen“9. Wenn der Patient sich im Beratungsgespräch uneinsichtig zeigt und nicht freiwillig in einen Berufswechsel einwilligt, kann dies als rechtfertigender Notstand gelten, der eine Informationsweitergabe gemäß § 34 StGB rechtfertigt. Auch der Nationale Ethikrat (NER) empfiehlt in seiner Stellungnahme „Prädiktive Gesundheitsinformationen bei Einstellungsuntersuchungen“ (2005) gezielte Eignungstests unter Einschluss genetischer Untersuchungen, wenn sie „unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit notwendig sind, um in der Art der Tätigkeit liegende spezifische Risiken für Dritte auszuschließen.“10 Ob die schärfere diagnostische Erfassung der eigenen Lebensrisiken den Freiheitsraum des Einzelnen immer mehr einengt oder die autonome Lebensplanung umgekehrt auf eine gesicherte Datenbasis stellt, lässt sich nicht in toto für alle Patientengruppen und Einsatzmöglichkeiten der prädiktiven Medizin entscheiden. Einzelnen Risikoträgern fällt es leichter, mit einem unbekannten Unsicherheitsfaktor zu leben, der ihnen noch Hoffnung lässt, während andere eine klare Diagnosestellung auch auf die Gefahr eines negativen Ergebnisses hin bevorzugen. Manche erbbedingten Erkrankungen sind mit Sicherheit vorherzusagen, andere lassen den Träger der verhängnisvollen Erbinformation auch nach erfolgter Diagnosestellung im Ungewissen über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und den zu erwartenden Grad der auftretenden Symptome. Schließlich führt die molekulargenetische Analyse nicht nur zur Erkennung bereits therapierbarer, sondern zunehmend auch solcher Krankheiten, die gegenwärtig und auf absehbare Zeit unheilbar bleiben. Im ersten Fall, wie bei der im Jugendalter auftretenden polypenartigen Dickdarmgeschwulst Polyposis coli fällt der Einsatz der Genomanalyse nicht aus dem Rahmen der bisherigen Diagnoseverfahren; eine möglichst frühzeitige und gesicherte Diagnose ist in jeder Hinsicht wünschenswert, solange sie die Chance einer vorhandenen Therapie erhöht. Wo der Einsatz der prädiktiven Medizin jedoch dazu führt, dass sich die Schere zwischen vorauseilender Diagnostik und nachhinkenden Therapiemöglichkeiten noch weiter öffnet, wirft dies schwerwiegende ethische Probleme auf, die im Einzelfall 5 unzumutbare Belastungen für die Betroffenen mit sich bringen können (1). Weitere kritische Anfragen, die aus ethischer Sicht an eine unkontrollierte Ausweitung diagnostischer Verfahren zu stellen sind, richten sich auf ein monokausales Krankheitsverständnis, dem die Genomanalyse in der Bevölkerung erneut Vorschub leisten kann (2), auf die zu erwartende Umschichtung der Krankheitslasten und Risikofolgen zuungunsten des Individuums (3) und auf die wachsenden Möglichkeiten der Fremdbestimmung menschlichen Lebens, die sich aus der pränatalen Diagnostik und der genetischen Familienplanung ergeben können (4-5). 1. Diagnostische Erfassung ohne Therapie? Eine sicher diagnostizierte genetische Anomalie unterwirft ihren Träger schweren psychischen Belastungen, weil er seine Lebensführung dem Diktat genetischer Informationen unterwerfen muss, lange bevor die eigentlichen Krankheitssymptome solche Einschränkungen erzwingen. Dies gilt nicht nur für Erwachsene, bei denen die Durchführung präsymptomatischer Tests an ihre informierte Einwilligung gebunden bleibt, sondern auch für Kinder, bei denen sie den stellvertretenden Entscheid ihrer Eltern erfordert. Gezielte Neugeborenen-Screenings können dazu führen, dass Kinder vorzeitig in einen Patientenstatus gedrängt werden, weil das Wissen ihrer Eltern um eine möglicherweise ausbrechende Erbkrankheit den Umgang mit ihnen beeinflusst. So bleibt ihnen der Schonraum kindlicher Unbefangenheit versagt, obwohl sie eine unbeschwerte psychosoziale Entwicklung besonders nötig hätten, um die eventuellen Belastungen ihres späteren Lebensweges tragen zu können. Obligatorische Suchtests, wie sie in den USA verbreitet sind, sollten deshalb schon aus medizinischer Sicht nur auf behandelbare Krankheiten hin durchgeführt werden. Ob die Empfehlung der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages, nicht-therapierbare Krankheiten von den präsymptomatischen Tests solange auszunehmen, bis erfolgversprechende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, auch tatsächlich befolgt wird, hängt weitgehend von den genetischen Beratungsstellen selbst ab. Die schleichende Ausweitung genetischer Diagnoseverfahren in der Perinatalmedizin sollte jedoch Anlass zu besonderer Wachsamkeit geben. Wie diese Entwicklung belegt, sind es nicht immer medizinische, sondern häufig auch ökonomische Gründe und die Ausnützung vorhandener Laborkapazitäten, die bei der Ausweitung von Diagnoseverfahren den Ausschlag geben.11 6 In welches ethische Dilemma die prädiktive Medizin führen kann, zeigt sich besonders im Fall der Huntington’schen Krankheit (dem so genannten „Veitstanz“), die in der zweiten Lebenshälfte zu einem unaufhaltsamen Verfall des Nervensystems führt. Mit Hilfe der präsymptomatischen Tests kann der Träger eines Huntington-Gens sein künftiges Schicksal lange vor dem Ausbruch der ersten Krankheitssymptome sicher in Erfahrung bringen. Die unheilbare Krankheit wird so schon früh ein fester Bestandteil seines täglichen Bewusstseins – mit allen schwerwiegenden Folgen, die dies für ihn selbst, seinen mitbetroffenen Ehepartner und seine möglichen Kinder haben wird. Weil seine künftige Erkrankung dominant vererbbar ist, belastet sie nicht nur den Entschluss zur Eheschließung; sie schränkt darüber hinaus auch seine Fortpflanzungsfreiheit ein, da die Vererbung eines sicher diagnostizierten 50 ProzentErkrankungsrisikos vielen mit einer verantwortlichen Familienplanung unvereinbar erscheint.12 Vom Zeitpunkt der positiven Diagnosestellung an ist der Träger dieser genetischen Anomalie zu einem unabsehbar langen Leben im ständigen Aufschub verurteilt, denn er weiß um die Unausweichlichkeit seiner Erkrankung, ohne dass er sie durch die eigene Lebensführung beeinflussen könnte. Mit diesem belastenden Wissen muss er in einer langfristigen „als-ob“-Normalität leben, in der ihm die menschlichen und sozialen Privilegien versagt bleiben, auf die ein Kranker gegenüber seiner Umgebung sonst rechnen kann. Diese Faktoren führen nicht nur zu einer äußerst belastenden individuellen Situation des Betroffenen und seiner Familie, sondern auch zu einer folgenreichen Problemverlagerung. Wenn die diagnostischen Möglichkeiten der prädiktiven Medizin Einzug in unser gesellschaftliches Alltagsleben halten, werden auf Dauer nicht nur die biologischen, sondern auch die sozialen Lebenschancen nach genetischen Kriterien verteilt werden. Wegen solcher grundsätzlicher sozialethischer Bedenken, aber auch, weil das Wissen um ein auswegloses Schicksal niemandem zugemutet werden darf, riet die Deutsche Huntington-Gesellschaft zunächst von der Teilnahme an genetischen Früherkennungstests ab.13 Ihre Nachfolgeorganisation, die Deutsche Huntington-Hilfe, spricht heute keine generelle Empfehlung mehr aus. Sie fordert mögliche Testpersonen aber auf, sich vor der Untersuchung Klarheit über ihre eigenen Motive und die Auswirkungen zu verschaffen, die ein positives oder negatives Ergebnis für ihre Partnerschaft, die Verwirklichung eines Kinderwunsches und ihr Berufsleben sowie für ihre Eltern, Geschwister und weiteren Verwandten haben kann. Zugleich wirbt sie dafür, dass auch das Nicht-Wissen-Wollen, das in einer Informationsgesellschaft allzu leicht als Schwäche erscheint, als ernsthafte Option bedacht werden sollte.14 7 2. Monokausale Erfassung genetischer Risiken? Die ethischen Bedenken gegen den flächendeckenden Einsatz präsymptomatischer Testverfahren (Gen-Chips, Hochdrucksatzsequenzierung) rühren auch daher, dass der Wahrscheinlichkeitsgrad medizinischer Prognosen in der Bevölkerung häufig falsch eingeschätzt wird. Weder kann eine genetische Untersuchung die Geburt und ungestörte Entwicklung eines gesunden Kindes garantieren, noch lassen sich bei einem positiven Ergebnis in allen Fällen Auftreten, Zeitpunkt und Schwere eines möglichen Defektes mit Sicherheit vorhersagen. Wenn die genetische Beratung den informierten Selbstentscheid der Betroffenen zum Ziel hat, muss sie auch über die Unsicherheit der medizinischen Prognose aufklären. Diese ist keineswegs nur durch die Unvollkommenheit der angewandten Testmethoden, sondern auch dadurch bedingt, dass monokausale genetische Erklärungen eines künftigen Krankheitsverlaufes prinzipiell zu kurz greifen. Sie blenden die Wechselwirkung genetischer Risiken mit sozialen, umweltbedingten und psychischen Krankheitsfaktoren aus und verkennen so den mehrdimensionalen Charakter von Gesundheit und Krankheit. Die multifaktorielle Genese der meisten Krankheiten führt etwa dazu, dass durch den Einsatz der Genomanalyse in der Arbeitsmedizin nur erhöhte Unverträglichkeitsrisiken im arbeitsplatzbedingten Kontakt mit Staub, Rauch oder bestimmten chemischen Substanzen, aber nicht ganze Listen von Berufskrankheiten vorhergesagt werden können. Abgesehen davon, dass sich die vorrangigen Anstrengungen zur Humanisierung des Berufslebens auf gesundheitsgerechte Arbeitsplätze und nicht auf die biologische Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer richten müssen, setzt die nur teilweise Erfassung der Krankheitsaitiologien einer Steuerung der beruflichen Ausbildung und Beschäftigung durch die prädiktive Medizin enge Grenzen.15 In der erwähnten Stellungnahme fordert der NER daher, dass sich arbeitsmedizinische Untersuchungen auf solche Daten beschränken sollen, die erforderlich sind, um die Eignung eines Bewerbers für die vorhergesehene Tätigkeit zum Zeitpunkt der Einstellung festzustellen. Prognostische Untersuchungen dürfen demnach nur begrenzt und mit dem Einverständnis des Bewerbers herangezogen werden, wenn sie Krankheitsdispositionen belegen, die sich in erheblichem Ausmaß und mit überwiegender Wahrscheinlichkeit innerhalb eines festgelegten Zeitraums (z.B. während der sechsmonatigen Probezeit) auf die Eignung für den vorgesehenen Arbeitsplatz auswirken.16 Die gesundheitspolitische Aufklärung der Bevölkerung über diesen Bereich muss deshalb gerade in einer medialen Informationsgesellschaft, die zur Vereinfachung medizinischer Zusammenhänge neigt, vor einer Überschätzung genetischer Testverfahren warnen. Ihre unkontrollierte Ausweitung würde nicht nur einzelne Risikogruppen zu Unrecht von Berufsund Sozialchancen ausschließen. Von ihr ginge auch ein falsches gesundheitspolitisches 8 Signal aus, das eine fatalistische non-compliance des Einzelnen gegenüber seinem attestierten Krankheitsverlauf begünstigt. Ein Zukunftsszenario, das die ärztliche Heilkunst von der kurativen über die präventive zur prädiktiven Medizin voranschreiten sieht und im öffentlichen Bewusstsein eine entsprechende Erwartungshaltung schafft, beruht auf einer fragwürdigen Überschätzung der genetischen Grundlagen von Gesundheit und Krankheit. Eine solche Entwicklung drohte die mühsamen Ansätze zu einem ganzheitlichen Medizinverständnis erneut zu unterlaufen. Eine verstärkte Ausweitung diagnostischer Verfahren durch isolierte Fortschritte der Humangenetik könnte so nicht nur einzelne Risikoträger vorzeitig mit ihrem unabwendbaren Lebensschicksal konfrontieren, sondern auch kontraproduktiv auf das allgemeine Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung wirken.17 3. Welche Schlüsse legen erhöhte genetische Krankheitsrisiken nahe? Da die prognostische Sicherheit gendiagnostischer Risikoanalysen für einzelne Krankheitsanlagen sehr breit gefächert ist, lässt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen aus dem Vorliegen eines positiven Testergebnisses zu ziehen sind, nicht durch verallgemeinernde Aussagen beantworten. Selbst bei monogenetischen neurodegenerativen Erkrankungen wie dem Morbus Huntington und seltenen Demenz-Formen oder bestimmten Varianten des erblichen Dickdarmkrebses (Familiäre Adenomatöse Polyposis – FAP), bei denen die Träger der entsprechenden genetischen Anomalie mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit im Laufe ihres Lebens erkranken, sind die individuellen Bewältigungsstrategien und die psychosozialen Folgen für die Betroffenen so unterschiedlich, dass generelle Empfehlungen kaum möglich sind. Die meisten der diagnostisch erfassbaren, krankheitsrelevanten Genmutationen weisen jedoch eine deutlich niedrigere Penetranz auf; sie erlauben daher nur die Angabe eines ungefähren zukünftigen Erkrankungsrisikos. Dieses reicht je nach Krankheitsbild von ein bis zwei Prozent (chronische Pankreatitis) bis zu zwischen vierzig und achtzig Prozent (erblicher Brustkrebs); innerhalb dieser erheblichen Bandbreite bewegen sich multifaktorielle Krankheiten wie Diabetes vom Typ 2, bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, Morbus Parkinson, die Anlage zur Hypertonie oder auch genetische Dispositionen zu Epilepsie, Schizophrenie oder manisch-depressiven Krankheitsbildern. Einzelne genetische Mutationen tragen in den meisten dieser Fälle nur in geringem Umfang zur Erhöhung des statistischen Durchschnittsrisikos bei, das die Testperson ohnehin trägt; zudem lässt sich nicht 9 sicher vorhersagen, in welchem Lebensjahrzehnt die Krankheitssymptome eventuell auftreten können.18 Welche Konsequenzen soll eine verantwortlich denkende, zu rationaler Zukunftsplanung fähige Person für ihre eigene Lebensführung aus dem Wissen um derartige erhöhte Erkrankungsrisiken ziehen? Da das Auftreten der Krankheit bei multifaktoriellen Ursachen wie dem erblichen Eierstock- oder Brustkrebs nicht allein genetisch determiniert ist, sondern ebenso von Umweltfaktoren und dem eigenen Lebensstil abhängt, ist eine fatalistische Resignation in solchen Fällen unangebracht. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und eine Änderung der Lebensgewohnheiten (Verzicht auf Rauchen, eingeschränkter Alkoholkonsum, Diät, Bewegung) können den Ausbruch der Erkrankung verzögern oder sogar verhindern; häufig kann er aufgrund engmaschiger, regelmäßiger Untersuchungen so frühzeitig erkannt werden, dass die Erfolgschancen einer Behandlung deutlich höher als bei fatalistischem Abwarten sind. Dennoch bleibt das Dilemma bestehen, dass ein bewusstes Gesundheitsmanagement in Kenntnis des eigenen Risikoprofils von einem ohnmächtigen und nicht selten auch schädlichen Aktionismus nicht klar abgegrenzt werden kann. Das beste Beispiel für diesen Konflikt ist die Entscheidung mancher Frauen zu einer „vorbeugenden“ operativen Brustentfernung, nachdem bei ihnen ein genetisches Risiko für erblichen Brustkrebs festgestellt wurde. Da keineswegs sicher ist, ob sie ohne diese prophylaktische Maßnahme überhaupt erkrankt wären, nehmen viele von ihnen die körperlichen und seelischen Belastungen dieses radikalen Eingriffs auf sich, ohne daraus einen medizinischen Nutzen zu ziehen; zudem gibt die Entfernung der Brustdrüsen keine hundertprozentige Sicherheit, nicht doch zu erkranken. Aber auch Frauen, die sich gegen eine prophylaktische Brustentfernung entscheiden, entkommen der psychischen Falle nicht mehr, in die sie durch das Wissen um ihr genetisches Erkrankungsrisiko geraten sind. Dieses bleibt für immer Teil ihrer eigenen Selbstdefinition. So wie jemand sich als ein Mensch mit erhöhtem Blutdruck oder höheren Cholesterinwerten bezeichnet und somit um ein größeres Schlaganfall- oder Herzinfarkt-Risiko weiß, verstehen sie sich als potentielle Krebspatientinnen. Dieses Stigma geht in ihr Selbstbild ein, ohne dass sie die psychischen und sozialen Privilegien in Anspruch nehmen könnten, mit denen sie beim Ausbruch der Erkrankung rechnen dürften. Hier zeigt sich wiederum der fatale Zwischenzustand, in dem ein noch gesunder Mensch sich bereits als latent Kranker fühlt und deshalb einen hohen Preis für die Kenntnis seines genetischen Risikos bezahlt. 10 Im Ausbleiben der im Krankheitsfall erwartbaren Solidarität und erhöhten Aufmerksamkeit der Umgebung liegt auch ein denkbarer Erklärungsgrund dafür, dass Testpersonen nicht selten mit Enttäuschung reagieren, wenn bei ihnen nur ein niedriges Erkrankungsrisiko festgestellt wird, während ein positiver Befund überraschenderweise größere Zufriedenheit auslöst. Unterhalb einer bestimmten Risikoschwelle werden die Testpersonen nicht mehr zu weiteren Vorsorgeuntersuchungen eingeladen; auch entwickeln sie zum Teil Schuldgefühle oder Missgunst und heimlichen Neid gegenüber denen, die in höherem Maß gefährdet sind als sie selbst. Umgekehrt zeigt sich die Gruppe mit der Diagnose eines erhöhten Krankheitsrisikos häufig insgeheim einverstanden, da sie auf die Macht medizinischer Kontrollmöglichkeiten vertrauen und Gefühle der Sicherheit und Beruhigung entwickeln.19 Der Charakter der genetischen Medizin als „Überwachungsmedizin“ (surveillance medicine – David Armstrong) kann somit sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Lebensgefühl der Betroffenen haben. Die Rechtfertigung genetischer Risikoanalysen durch die Erwartung, die eigene präsumptive Gesundheitsentwicklung durch Änderungen der Lebensgewohnheiten positiv beeinflussen zu können, wird durch das tatsächliche Verhalten der meisten Testpersonen allerdings nicht bestätigt. Nach der Auswertung mehrerer Studien zu den Reaktionsweisen der Studienteilnehmer auf die Mitteilung negativer Testergebnisse auf unterschiedliche Krankheitsdispositionen kommen Regine Kollek und Thomas Lembke zu dem Ergebnis: „Die verbreitete, die Einführung von prädiktiven genetischen Tests begleitende Hoffnung, dass positive Untersuchungsergebnisse die Probanden dazu motivieren könnten, ihren Lebensstil zu verändern, bestätigt sich (…) nicht. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein: Obwohl sich die positiv getesteten Personen ihres Risikos bewusst sind, vertrauen sie doch eher der Effektivität einer medikamentösen Behandlung, als der Umstellung des Lebensstils.“20 Zwar begünstigen prädiktive medizinische Gentests nicht generell eine fatalistische Einstellung gegenüber einer möglichen Krankheitsentwicklung, doch führen sie nur in geringem Umfang dazu, die Eigenverantwortlichkeit der Menschen im Sinne eines vorausschauenden Gesundheitsmanagements wach zu rütteln. Die Identifizierung genetischer Risiken verstärkt im Gegenteil den allgemeinen Trend zu einer Medikalisierung des Lebens, die stärker auf medizinisch-technische Interventionen als auf die Präventivregeln einer gesunden Lebensweise vertraut. 11 Die durch die molekulare naturwissenschaftlichen Medizin noch verstärkte Krankheitsinterpretation kann Vorherrschaft auch zu einer rein gefährlichen Schlussfolgerungen verleiten. Personen mit einem negativen Befund, bei denen kein genetisches Risiko festgestellt wurde, ziehen daraus nicht selten die falsche Konsequenz, sie seien aufgrund ihrer erblichen Konstitution gegen bestimmte Erkrankungen geschützt, so dass diese auch bei ungesunder Lebensweise keine Gefahr für sie darstellen.21 Um einer solchen verhängnisvollen Fehldeutung vorzubeugen, sollten die Durchführung genetischer Untersuchungen und insbesondere die Teilnahme an Screening-Testverfahren nur im Zusammenhang mit einer ausführlichen humangenetischen oder ärztlichen Beratung erfolgen. Nimmt man die Einschränkung auf gesundheitliche Zwecke oder gesundheitsbezogene Forschungsziele hinzu, die das europäische Menschenrechtsabkommen zur Biomedizin in Artikel 12 als generelle Voraussetzung fordert, so stehen Angebot und Zugänglichkeit genetischer Informationen unter einem doppelten Vorbehalt: Sie sollen nur im Rahmen gesundheitlicher Fragestellungen und nicht zu allgemeinen Lifestyle-Zwecken (Augenfarbe, Körpergröße, Intelligenz usw.) erhoben und nur unter ärztlicher Begleitung übermittelt werden. Die Einschränkung auf gesundheitsbezogene Daten und der Arztvorbehalt richten sich insbesondere gegen kommerzielle Anbieter von Gentests zu Lifestyle-Fragen, die ihre Serviceangebote über das Internet vermarkten.22 Auch wenn die geforderten Einschränkungen als Ausdruck eines fragwürdigen Paternalismus erscheinen können, der autonomen Individuen gewünschte Informationen vorenthält, sind eine Abkopplung von Labordiagnostik und Beratung und die Verdrängung einer persönlichen Beziehung zwischen Arzt und Patient durch anonyme Serviceanbieter nicht wünschenswert. Beide genannten Einschränkungen werden daher sowohl von den Richtlinien der Bundesärztekammer als auch in einer Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur prädiktiven genetischen Diagnostik aus dem Jahr 2003 unterstützt.23 Die DFG fordert die Einbettung genetischer Tests in eine qualifizierte Beratung sowohl vor dem Test als auch nach der Bekanntgabe der Testergebnisse, damit deren Bedeutung der Testperson angemessen vermittelt werden kann (Dreischritt: Beratung-Test-Beratung). 1 Die Abhängigkeit spezifischer Begabungen von vererbten Faktoren wurde von der Vererbungslehre schon lange diskutiert. Berühmte Beispiele sind die auffällige Musikalität in der Familie Bach und die mathematischen Leistungen mehrerer Mitglieder der Familie Bernoulli. Dem steht als Gegenbeispiel der Mathematiker Carl Friedrich Gauß gegenüber, 12 dessen Vater Gärtner und dessen Mutter die Tochter eines Steinmetzes waren. P. Propping, Von Genotyp zum Phänotyp: Zur Frage nach dem genetischen Determinismus, in: ders./L. Honnefelder (Hg.), Was wissen wir, wenn wir das menschliche Genom kennen?, Köln 2001, 90-102, bes. 91 erklärt dies damit, dass die genetisch bedingten mathematischen Fähigkeiten der Eltern von Gauß wegen mangelnder Förderung nicht in Erscheinung treten konnten. 2 Regine Kollek/Th. Lembke, Der medizinische Blick in die Zukunft. Gesellschaftliche Implikationen prädiktiver Gentests, Frankfurt a.M. 2008, 119; vgl. auch K. Bayertz u.a., Wissen mit Folgen. Zukunftsperspektiven und Regelungsbedarf der genetischen Diagnostik innerhalb und außerhalb der Humangenetik, in: JWE 6 (2001) 271-307, hier: 273. 3 Vgl. B. Irrgang, Der Krankheitsbegriff der prädiktiven Medizin und die humangenetische Beratung, in: A.M. Raem u.a. (Hg.), Gen-Medizin. Eine Bestandsaufnahme, Berlin 2001, 651660, hier: 652. 4 Vgl. C. Rehmann-Sutter, Prädiktive Vernunft. Das Orakel und die prädiktive Medizin, in: ders., Zwischen den Molekülen. Beiträge zur Philosophie der Gentechnik, Tübingen 2005, 243-265. 5 Vgl. dazu K. Krahnen, Chorea Huntington. Das Recht auf Wissen versus – das Recht auf Nicht-Wissen, in: T.M. Schroeder-Kurth (Hg.), Medizinische Genetik in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt a.M. 1989, 66-103, bes. 96-100; S. Höchst, Recht auf Nichtwissen, in: D. Beckmann u.a. (Hg.), Humangenetik – Segen für die Menschheit oder unkalkulierbares Risiko?, Frankfurt a.M. 1991, 143-152, bes. 144f.; J. Reiter, Prädiktive Medizin – Genomanalyse – Gentherapie, in: IKZ. Communio 19 (1990) 115-129, bes. 121 und H.J. Münk, Die christliche Ethik vor der Herausforderung durch die Gentechnik, in: J. Pfammater/E. Christen (Hg.), Leben in der Hand des Menschen (= Theologische Berichte 20), Zürich 1991, 75-178, hier: 142. 6 Vgl. E. Benda, Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik, in: R. Flöhl (Hg.), Genforschung – Fluch oder Segen?, München 1985, 223-230. 7 So M. Shaw, Testing for the Huntington Gene. A right to know, a right not to know or a duty to know, in: Journal of Medical Genetics 26 (1987) 243-246. 8 Regine Kollek/Th. Lembke, a.a.O., 257. 9 Abgedruckt in: JWE 8 (2003) 493-510, hier: 507. 10 Empfehlung Nr. 5, Berlin 2005, 62f. 11 Vgl. dazu den Bericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages „Chancen und Risiken der Gentechnologie“, hg. von W.M. Catenhusen und H. Neumeister München 1987, 156 und den Bericht des Bundesministers für Forschung und Technologie (Hg.), Die Erforschung des menschlichen Genoms – Ethische und soziale Aspekte, Frankfurt a.M.-New York 1991, 199f. 12 Aus der Auswertung einer weltweit erhobenen Datensammlung ergibt sich, dass die meisten Testpersonen als Motiv für ihre Teilnahme an prädiktiven Huntington-Tests „Sicherheit für die Zukunft“ und „Familienplanung“ angeben. Aufgrund der weltweiten 13 Verfügbarkeit von Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik fallen in vielen Ländern allerdings auch die pränatale Ermittlung von Merkmalsträgern und ihre selektive Abtreibung unter den Begriff der Familienplanung. Vgl. Gerry Evers-Kiebooms, Comments from the Praxis of Predictive Testing: The Example of Huntington’s Disease, in: Lisa S. Cahill (Ed.), Genetics, Theology and Ethics, New York 2005, 171-181, bes. 174ff. 13 Das Unverständnis, auf das diese Empfehlung bei angelsächsischen Wissenschaftlern gestoßen ist, zeigt jedoch, wie schwer ein gesundheitspolitischer Konsens auf internationaler Ebene zu erreichen ist. Vgl. dazu S. Engel, Der präsymptomatische Gentest am Beispiel der Huntingtonschen Erkrankung, in: D. Beckmann u.a. (Hg.), Humangenetik, 181-195, bes. 189192. 14 Vgl. Christine Lohkamp, Denkanstöße. Informationen für Risikopersonen der HuntingtonKrankheit zur prädiktiven molekulargenetischen Diagnostik, unter: www.huntington-hilfe.de. 15 Vgl. I. Flagmeyer/K. Schlotmann, Genomanalyse in der Arbeitsmedizin, in: D. Beckmann u.a. (Hg.), Humangenetik, a.a.O., 225-231; H.W. Rüdiger, Genomanalyse in der Arbeitsmedizin, in: H.M. Sass (Hg.), Genomanalyse und Gentherapie. Ethische Herausforderungen in der Humanmedizin, Berlin-Heidelberg 1991, 68-80 und H.J. Münk, Die christliche Ethik, a.a.O., 144-149. 16 Empfehlung Nr. 2, a.a.O., 61f. 17 Vgl. B. Klees, Der Griff in die Erbanlagen. Verdrängte Probleme der Genom-Analyse, Braunschweig 1999, 43-45; vor einem einseitig molekularbiologischen Krankheitsverständnis warnt bereits U. Eibach, Gentechnik – der Griff nach dem Leben. Eine ethische und theologische Beurteilung, Wuppertal 21988, 183-186. 18 Vgl. P. Propping, Vom Sinn und Ziel der Humangenetik, in: JWE 6 (2001) 89-106, bes. 93 und Regine Kollek/Th. Lembke, a.a.O., 73. 85. 19 Vgl. Regine Kollek/Th. Lembke, a.a.O., 143 und 163. 20 A.a.O., 99. 21 Vgl. a.a.O., 113 und 121. 22 Seit dem Jahr 2007 bietet die US-amerikanische Firma 23andMe, die von der Ehefrau eines Mitentwicklers der Internetsuchmaschine Google gegründet wurde, einen Gen-Check über das Internet für € 999 an. Ein europäischer Serviceleister wirbt für ein ähnliches onlineProdukt, das für € 700 zu haben ist, mit einem Slogan, der die Teilnahme an einem genetischen Schnelltest via Internet als eine Art Mutprobe darstellt: „Nötig sind dafür nur ein wenig Speichel und etwas Mumm!“ Vgl. Regine Kollek/Th. Lembke, a.a.O., 210ff. und S. Salm, Gene sind nur Moleküle – aber: Wohin führt die Genmedizin?, in: D. Döring/E.J.M. Kroker (Hg.), Gentechnik zwischen Natur und Ethos, Frankfurt a.M. 2005, 15-33, bes. 24f. 23 Vgl. den Abdruck der Stellungnahmen in: JWE 8 (2003) 505 und 512 und M. Uhl, Richtlinien der Bundesärztekammer, a.a.O., 39ff. 14