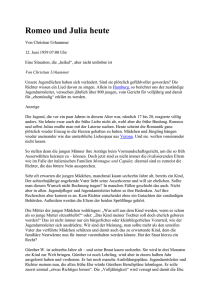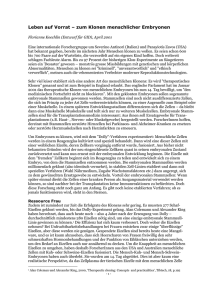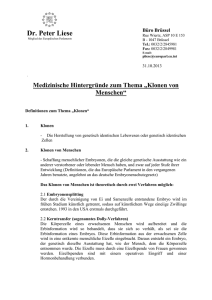R E C H T S K U N D E
Werbung
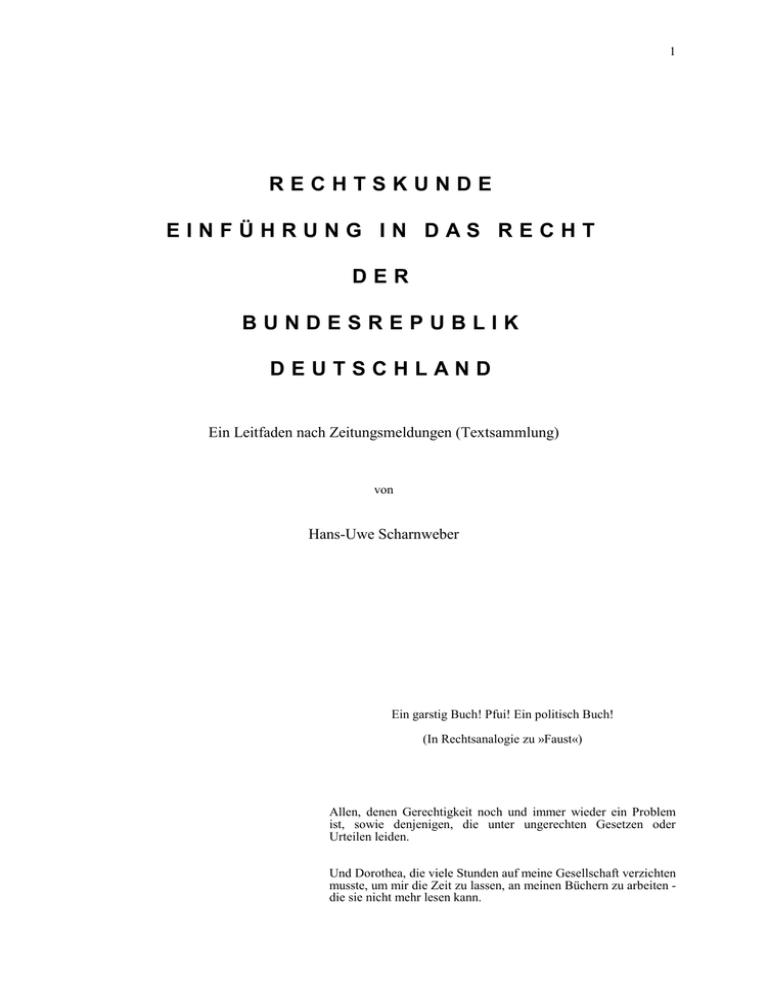
1 RECHTSKUNDE EINFÜHRUNG IN DAS RECHT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Ein Leitfaden nach Zeitungsmeldungen (Textsammlung) von Hans-Uwe Scharnweber Ein garstig Buch! Pfui! Ein politisch Buch! (In Rechtsanalogie zu »Faust«) Allen, denen Gerechtigkeit noch und immer wieder ein Problem ist, sowie denjenigen, die unter ungerechten Gesetzen oder Urteilen leiden. Und Dorothea, die viele Stunden auf meine Gesellschaft verzichten musste, um mir die Zeit zu lassen, an meinen Büchern zu arbeiten die sie nicht mehr lesen kann. 2 Inhaltsübersicht Abkürzungsverzeichnis Einleitung I. TEIL: Das Verhältnis von »Recht« und »Gesetz« 1. Das »Grundgesetz« (GG) als unsere »Verfassung« 2. »Gesetz« und »Recht« II. TEIL: Die Funktion im Recht des NS-Herrschaftssystems 1. Rechtsprechung als Terrorinstrument 2. Grundrechte zur Disposition der Staatsmacht 3. „Furchtbare Juristen“ als Steigbügelhalter der braunen Diktatur 4. Wiederholte Straffreistellung für jeden, der bei politischen Morden ein braunes Hemd getragen hatte 5. Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 24.03.33 als „Verfassungsurkunde des Dritten Reiches“ und seine Auswirkungen III. TEIL: Die Funktion des Rechts im SED-Herrschaftssystem der DDR 1. „Recht darf sich nie wieder mit dem zum Gesetz erhobenen Willen einer Klasse und ihrer Partei identifizieren.“ 2. Organisiertes Verbrechen als Herrschaftssystem 3. Unrechtsregime wie die DDR unter SED-Herrschaft negieren Menschenrechte, Verfassung und eingegangene internationale Verpflichtungen 4. Ideologiebedingtes Geschichts-, Gesellschafts- und Rechtsverständnis 5. Volksdemokratien mangelt es an Rechtsstaatlichkeit als Fundament einer echten Demokratie 6. „Amnesty international“ zur Lage der Menschenrechte in der DDR 7. Staatlicher Terror bis zur physischen Vernichtung 8. Staatliches Kidnapping durch „Zwangsadoptionen“ 9. Faktisch bestehende Abhängigkeit der Richter trotz anders lautender Verfassungsbestimmungen 10. Justiz in Diktaturen als wichtiges Instrument zur Durchsetzung der Staatsideologie IV. TEIL: Das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland 1. Privatrecht und öffentliches Recht 2. Erste Einblicke in das Privatrecht 3. Öffentliches Recht 4. Das Bundesverfassungsgericht als Hüter und Wächter des GG durch Urteil mit Gesetzesverwerfungskompetenz und durch mahnende Existenz 5. Überprüfung von Urteilen durch das BVerfG hinsichtlich möglicher Grundrechtsverletzungen 6. Mahnende Existenz und Rechtsprechung des BVerfGs Abgrenzung gegenüber den Aufgaben der Politik an einem Beispielsfall 7. In bewusster Abkehr von den Bestimmungen der Weimarer Verfassung getroffene staatsorganisatorische Bestimmungen im Grundgesetz 8. Reform-Ideen zur Umgestaltung unserer durch Verschmelzung in der EU und Globalisierungsherausforderungen neuen Erfordernissen anzupassenden Verfassung V. TEIL: Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSCHG) als Beispiel für die Schwierigkeiten konkreter Gesetzesabfassung, -anwendung und möglicher –verbesserung VI. TEIL: Tabellarischer Überblick über die wichtigsten Rechtlichen Entwicklungsstufen (Recht und Lebensalter) Index 3 INHALTSVERZEICHNIS Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................................................................... 8 Einführung........................................................................................................................................................................ 9 I. TEIL ....................................................................................................................................................................... 39 DAS VERHÄLTNIS VON »RECHT« UND »GESETZ« ..................................................................................... 39 1 Das »Grundgesetz« (GG) als unsere »Verfassung« ............................................................................................. 39 1.1 Präambel....................................................................................................................................................... 40 1.1.1 Gott als in der Präambel herausgehobener Bezugspunkt staatlichen Handelns ..................................... 41 1.1.2 Text der Präambel als Auslegungsregel für das GG .............................................................................. 46 1.2 »Grundgesetz« oder »Verfassung«? ............................................................................................................. 46 1.2.1 Der räumliche Geltungsbereich des GG ................................................................................................ 48 1.2.2 GG und Länderneugliederung ............................................................................................................... 48 1.3 Das GG als oberste rechtliche Norm unseres Staates für insbesondere staatliches, eingeschränkt aber auch privates Handeln................................................................................................................................................. 54 1.3.1 GG und Zivilrecht ................................................................................................................................. 55 1.3.1.1 Grundsätzliche Vertragsfreiheit im Bereich des Zivilrechts und (meist nur) eingeschränkte »mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte ............................................................................................... 55 1.3.1.2 Privates Hausrecht überwindet das Diskriminierungsverbot des (speziellen) Gleichheitssatzes aus Art. 3 III GG............................................................................................................................................... 56 1.3.2 Grundrechte und ihre Bedeutung am Beispiel des allgemeinen und des speziellen Gleichheitssatzes von Art. 3 GG ................................................................................................................................................. 60 1.3.2.1 Allgemeiner Gleichheitssatz des Art. 3 I GG ................................................................................. 60 1.3.2.1.1 Gleichheitssatz des Art. 3 GG als »Willkürverbot« ................................................................. 61 1.3.2.1.2 Unterschiedliche Geltung des Gleichheitssatzes im öffentlich-rechtlichen Bereich von Kirche und Staat ................................................................................................................................................. 90 1.3.2.1.3 Art. 33 GG als den Staat verpflichtende spezielle Ausgestaltung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes ........................................................................................................................... 90 1.3.2.2 Gleichberechtigungsproblematik .................................................................................................. 115 1.3.2.2.1 Die in Art. 3 II GG angeordnete Gleichberechtigung von Frau und Mann als Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes ........................................................................................................ 115 1.3.2.2.2 Benachteiligung von Frauen unter der Geltung des GG seit 1949 im niederrangigeren Recht trotz Art. 3 II GG und allmähliche rechtliche Angleichung .................................................................. 121 1.3.2.2.3 Art. 3 II GG und Ehenamensrecht ......................................................................................... 125 1.3.2.2.4 »Schwangerschaftsurlaub« und die Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes in Art. 3 II GG ................................................................................................................................................. 135 1.3.2.2.5 Erziehungsurlaub und die Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 II GG135 1.3.2.2.6 »Mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte, insbesondere des Gleichheitssatzes, im Arbeitsrecht .......................................................................................................................................... 135 1.3.2.2.7 Art. 3 II GG schützt auch die Männer ................................................................................... 138 1.3.2.2.8 Beispiele für den Kampf um Gleichberechtigung in einigen anderen Ländern ..................... 148 1.3.3 Art. 3 III GG und Asylrecht ................................................................................................................ 151 1.3.4 »Wesensgehaltssperre« bei Grundrechtseinschränkungen und Asylrecht............................................ 152 1.3.5 Auslegung von Grundrechtsbestimmungen am Beispiel von Art. 6 GG Ehe und Familie und Art. 16 GG Asylrecht................................................................................................................................................ 153 2 »Gesetz« und »Recht« ....................................................................................................................................... 162 2.1 »Gesetz« und »Recht« in Art. 20 III GG .................................................................................................... 165 2.2 »Gesetz«, »Recht« und »Gerechtigkeit« ..................................................................................................... 167 2.3 Gesellschaftliche Befriedungsfunktion des Rechts ..................................................................................... 169 2.4 Das »Brett des Karneades« und die Frage nach »Gesetz«, »Recht« und »Gerechtigkeit« .......................... 171 2.5 Strafrechtliche Prüfung des Falles „Brett des Karneades“ ......................................................................... 173 2.6 Annäherung an die »Idee des Rechts« ........................................................................................................ 176 2.6.1. Widerstreit zwischen menschlichem und göttlichem Gesetz und Recht ............................................. 177 2.6.2 »Gesetz« und »Recht« in griechischen Tragödien ............................................................................... 177 2.7 »Gesetz« ..................................................................................................................................................... 181 2.7.1 Die Notwendigkeit exakter Abfassung von Gesetzen .......................................................................... 182 4 2.7.2 Kampf um gesetzliche Neuregelungen auf Grund geänderter gesellschaftlicher Verhältnisse am Beispiel der Feiertagsruhe ............................................................................................................................ 186 2.7.3 Juristisches Konfliktfeld Organ»spende« ............................................................................................ 193 2.7.4 Das GG als lebender (Rechts-)Organismus ......................................................................................... 215 2.7.5 Regelungen der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern im GG................................ 215 2.7.6 Technische Neuerungen bewirken oft einen juristischen Regelungsbedarf ......................................... 216 2.7.7 BVerfG als "juristische Notbremse" unterlegener Politiker ................................................................ 217 2.7.8 Beispiele für juristischen Regelungsbedarf aus dem Bereich der Biomedizin .................................... 217 2.7.9 Notwendigkeit der ständigen Anpassung und Korrektur von Gesetzen am Beispiel möglicher Organentnahme bei anenzephalen Föten ...................................................................................................... 253 2.7.10 Wertungswidersprüche durch verschiedene - eventuell ungenau formulierte - Gesetze möglich ...... 256 2.7.11 Gesetzesinterpretationen durch Auslegung oder Analogiebildungen zur Ermöglichung juristisch gewollter Ergebnisse ohne Gesetzesänderungen .......................................................................................... 259 2.7.12 »Einzelfall«-Gesetze trotz »abstrakt« (für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen) gehaltenen Wortlauts ...................................................................................................................................................... 261 2.7.13 Auch unsinnig erscheinende Gesetze haben oder hatten meistens – aber nicht immer - einen nicht unbedingt billigenswerten, aber von der Intention des Gesetzgebers her nachvollziehbaren, zwischenzeitlich eventuell verschütteten Sinn ......................................................................................................................... 261 2.7.14 Gesetze können legalisiertes Unrecht sein......................................................................................... 274 2.8 »Recht«....................................................................................................................................................... 275 2.8.1 »Recht« und subjektives Rechts-/Gerechtigkeitsempfinden ................................................................ 276 2.8.2 »Recht« als Definition einer Machtelite .............................................................................................. 278 2.8.3 »Recht« zur Absicherung der Herrschaft einer staatlichen Machtelite ................................................ 278 2.8.4 In einer Demokratie steht der Staat unter der Herrschaft des Rechts und nicht das Recht unter der Willkür der Exekutive .................................................................................................................................. 279 2.8.5 Wer soll über die Auslegung von »Recht« entscheiden? ..................................................................... 280 2.8.6 Medien sind als publizistisches Wächteramt der kritischen Öffentlichkeit gegenüber richterlichen Entscheidungen die »vierte Gewalt« im Staate ............................................................................................. 283 2.8.7 Willfährige und/oder dogmatisierte Richter als Büttel der Staatsmacht setz(t)en legalisiertes Unrecht durch............................................................................................................................................................. 284 2.8.8 Rechtsanalogien in der Hand fanatisierter Richter im Strafrecht ......................................................... 286 2.8.9 Zivilrichter sorgten in der NS-Zeit für den "bürgerlichen Tod", Strafrichter schickten den Henker hinterher ....................................................................................................................................................... 288 2.8.10 Die neuere deutsche Rechtsgeschichte in der NS- und der SED-Diktatur ist eine Geschichte der Gesinnungsjustiz .......................................................................................................................................... 289 2.8.11 "Kein Verbrechen, keine Strafe ohne entsprechendes Gesetz".......................................................... 290 2.8.12 Problemfeld: Hinreichende Bestimmtheit einer Strafbestimmung und "offene Rechtsbegriffe" ....... 290 2.8.13 Rechtsfragen sind oft Machtfragen .................................................................................................... 293 2.8.14 Juristerei ist keine Mathematik, darum sind Rechtsfragen oft Wertungsfragen ................................. 293 2.8.15 Was ist dann „Recht«?....................................................................................................................... 294 2.8.16 Vorstellungen von »Recht« in anderen Kulturkreisen anhand von Zeitungsmeldungen .................... 311 2.8.17 Unterschiedliche Ansichten über das »Recht« und den Rechtsgüterschutz innerhalb selbst einer kulturell einheitlich geprägten Gesellschaft.................................................................................................. 327 2.8.18 Was »Recht« sein soll, ist in einer sich verändernden Gesellschaft ständig im Fluss, ständig umkämpft ..................................................................................................................................................... 328 2.8.19 Notwendigkeit der Anpassung gesetzlicher Regelungen an geänderte gesellschaftliche Verhältnisse wegen sich wandelnden Rechtsbewusstseins in der Bevölkerung ................................................................ 341 2.8.19.1 Wertewandel - eventuell durch wissenschaftlichen Fortschritt verursacht - bedingt Rechtswandel .................................................................................................................................................................. 341 2.8.19.2 Gesellschaftliche Umbrüche sind immer auch gravierende Umbrüche im Rechtssystem ........... 358 2.8.19.3 Aus u.a. Gerechtigkeitsstreben heraus entstandene Revolutionen installieren oft ein neues Unrechtssystem ........................................................................................................................................ 360 2.8.19.4 Das Mehrheitsprinzip - unter rechtlich abgesicherter Achtung von Minderheitenrechten - ist der Königsweg demokratischer Willensbildung ............................................................................................. 360 2.8.19.5 Ständige Kämpfe um »das Recht« auch in unserer demokratisch verfassten und damit auf ständigen Wandel angelegten Gesellschaft............................................................................................... 363 2.8.19.6 Beispiel Umweltschutz und Recht .............................................................................................. 363 2.8.19.7 Vorzüge der demokratischen Staatsform aus ihren rechtlichen Grundentscheidungen heraus ... 365 5 2.8.20 Rechtsunterworfenheit in Sonderbereichen nur durch Beitritt ........................................................... 381 2.8.20.1 Verbandsgerichtsbarkeit im Bereich des Sports ......................................................................... 382 2.8.20.2 Rechtsunterworfenheit durch Kirchenbeitritt ............................................................................. 387 2.8.20.3 Allgemeinverbindliche Rechtsetzung im Bereich des Arbeitsrechts auch durch Übernahme privatrechtlicher Vereinbarungen ............................................................................................................. 398 2.8.21 »Vor-Rechtsnischen« Begnadigungen und Ordensverleihungen ....................................................... 403 2.8.22 Wächteramt der Presse gegenüber der öffentlichen Gewalt als "vierte Gewalt" im Staate ............... 405 2.8.23 Rechtsprechung hat leider nicht zwangsläufig etwas mit Gerechtigkeit zu tun - und Verwaltung erst recht nicht! ................................................................................................................................................... 406 2.8.24 Opposition als demokratieunabdingbares »institutionalisiertes Misstrauen« und widerstehende Bürger u.a. zur Abwehr staatlichen Unrechts ............................................................................................... 406 2.8.25 Recht und Moralvorstellungen .......................................................................................................... 406 2.8.25.1 Die Gesetze müssen den sich ständig wandelnden gesellschaftlichen Vorstellungen und Verhältnissen in einem ständigen Rückkopplungsprozess behutsam angepasst werden, weil sich die Vorstellungen über »das Recht« ändern. .................................................................................................. 406 2.8.25.2 »Wilde Ehe« als Beispiel für die Notwendigkeit rechtlicher Anpassung an geänderte gesellschaftliche Verhältnisse................................................................................................................... 422 2.8.25.3 Rechtlich umkämpfte »Schwulen- und Lesben-Ehen«................................................................ 430 2.8.25.4 Der Kampf um § 218 StGB als Beispiel für den Kampf um die Anpassung des Rechts an gewandelte gesellschaftliche Vorstellungen ............................................................................................. 455 2.8.26 Die Menschenrechte als Beschwörungsformel der neuzeitlichen Menschheitsgeschichte ................ 461 2.9 »Gesetz« und »Recht« ................................................................................................................................ 506 2.10 Recht und Rechtssicherheit ...................................................................................................................... 507 2.10.1 Rechtssicherheit will durch die damit bezweckte rechtliche Stabilität der Zukunftsplanung und der Gerechtigkeit dienen..................................................................................................................................... 510 2.10.2 Rechtssicherheit und ungerechte Urteile ........................................................................................... 511 2.10.3 Rechtssicherheit durch Urteil vor Gerechtigkeit? .............................................................................. 511 2.10.4 Wiederaufnahmeverfahren zur Durchbrechung der durch Urteil geschaffenen Rechtssicherheit für die Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit ................................................................................................. 513 2.10.5 Wiederaufnahmeverfahren zur Durchsetzung der Gerechtigkeit gegenüber der durch Urteil geschaffenen Rechtssicherheit in Strafsachen auch nach dem Tode eines Verurteilten durchführbar .......... 515 2.10.6 Das Problem verstärkter Rechtssicherheit, selbst zu Lasten der Wahrheit und Gerechtigkeit, im englischen »Fall-Recht« in Strafsachen ........................................................................................................ 520 2.10.7 Das Problem verstärkter Rechtssicherheit, selbst zu Lasten der Wahrheit und Gerechtigkeit, im Kirchenrecht der katholischen Kirche am Beispiel des Falles Kurie gegen Galilei...................................... 524 2.10.8 Rechtssicherheit durch Fristablauf im deutschen Strafrecht .............................................................. 532 2.10.9 Deliktbezogener Verjährungsbeginn bei sexuellem Missbrauch von Kindern .................................. 532 2.10.10 Rechtssicherheit durch Fristablauf im Zivilrecht ............................................................................. 535 2.10.11 Rechtssicherheit durch Fristablauf allgemein .................................................................................. 537 2.11 Abschließende Betrachtungen zum Wesen des Rechts............................................................................. 539 2.11.1 »Recht an sich« gibt es nicht ............................................................................................................. 539 2.11.2 »Recht« ist oft nur eine Antwort einer Machtelite auf eine historische Situation .............................. 540 2.11.3 Historische Bedingtheit des »Rechts« ............................................................................................... 541 II. TEIL .................................................................................................................................................................... 542 DIE FUNKTION DES RECHTS IM NS-HERRSCHAFTSSYSTEM ................................................................ 542 1 Rechtsprechung als Terrorinstrument ................................................................................................................ 545 1.1 Der Volksgerichtshof als Terrorinstrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherrschaft ......................................................................................................................................................................... 546 1.2 Durchsetzung des Naziterrors u.a. durch Juristenterror .............................................................................. 550 1.3 Die Richter machten das Volk wehrlos ...................................................................................................... 552 1.4 Charakterlose Juristen als Blutrichter ......................................................................................................... 553 1.5 Die "Polenstrafrechtsverordnung" als Beispiel gesetzlichen Unrechts und ein Beispiel ihrer darüber hinausgehend exzessiv gnadenlosen Anwendung ............................................................................................. 553 1.6 Sondergerichte als "Standgerichte der inneren Front" ................................................................................ 556 1.7 Offene Rechtsbegriffe als Henkersstricke .................................................................................................. 557 1.8 Die Deutschen: "Volk der Dichter und Denker" wie auch der NS-Richter und Henker ............................. 558 1.9 Erschießungen ohne Gerichtsverfahren ...................................................................................................... 559 2 Grundrechte zur Disposition der Staatsmacht ................................................................................................... 559 6 2.1 Art. 48 II WV als trojanisches Pferd der braunen Diktatur ........................................................................ 560 2.2 "Verfassungsfestes Minimum" des Art. 79 GG als Antwort des Verfassungsgesetzgebers auf diese historische Erfahrung ....................................................................................................................................... 561 3 "Furchtbare Juristen" als Steigbügelhalter der braunen Diktatur ...................................................................... 562 4 Wiederholte Straffreistellung für jeden, der bei politischen Morden ein braunes Hemd getragen hatte ........... 566 5 Das Ermächtigungsgesetz vom 24.03.33 als "Verfassungsurkunde des Dritten Reiches" und seine Auswirkungen ............................................................................................................................................................................. 569 5.1 Das »Ermächtigungsgesetz« als Schlussstein in der gesetzlichen Pervertierung der Weimarer Verfassung572 5.2 Die Bedeutung des Ermächtigungsgesetzes ............................................................................................... 575 5.3 Der "Führer" als oberster Gerichtsherr ....................................................................................................... 576 5.4 »Recht« als Mittel zur Ausrottung weltanschaulicher Gegner .................................................................... 577 5.5 § 2 StGB von 1935 als archimedischer Punkt für die Bestrafung jedes Missliebigen durch Beseitigung der Garantiefunktion der Straftatbestände .............................................................................................................. 577 5.6 Völlige Pervertierung des Rechts durch das Reichsgericht ........................................................................ 579 5.7 Die Fallbeiljustiz der "Mörder in den Roben" blieb in der Bundesrepublik durch gewollte Versäumnisse ungeahndet ....................................................................................................................................................... 580 5.8 Die Geschichte der Justiz im Dritten Reich beweist, dass Juristen zu allem fähig sein können ................. 583 5.9 Weder die Einhaltung des vorgeschriebenen Rechtsweges noch die Autorität der wissenschaftlichen Rechtslehre gewährleisten einen automatischen Schutz vor der moralischen Entwurzelung einer der Form nach intakten Rechtsordnung und Rechtswissenschaft ............................................................................................. 583 5.10 Euthanasie: Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ ................................................................................. 585 III. TEIL ................................................................................................................................................................... 590 DIE FUNKTION DES RECHTS IM SED-HERRSCHAFTSSYSTEM DER DDR ........................................... 590 1 "Recht darf sich nie wieder mit dem zum Gesetz erhobenen Willen einer Klasse und ihrer Partei identifizieren." ............................................................................................................................................................................. 590 2 Organisiertes Verbrechen als Herrschaftssystem............................................................................................... 596 3 Unrechtsregime wie die DDR unter SED-Herrschaft negieren Menschenrechte, Verfassung und eingegangene internationale Verpflichtungen ............................................................................................................................. 598 4 Ideologiebedingtes Geschichts-, Gesellschafts- und Rechtsverständnis ............................................................ 601 4.1 Aus der Verfassung der DDR ersichtliches kommunistisches Gesellschaftsverständnis ............................ 601 4.2 Untersuchung ausgewählter Artikel der DDR-Verfassung ......................................................................... 602 4.2.1 Führungsanspruch der SED mit Verfassungsrang festgeschrieben; keine Chance zum Machtwechsel602 4.2.2 Wahlen nach demokratischem und nach "volksdemokratischem" Verständnis ................................... 603 4.2.3 Trotz offenen Wortlauts Grundrechte nur in den engen Grenzen kommunistischer Ideologie ............ 605 4.2.4 Meinungs-, Versammlungs- und Redefreiheit in der DDR als Verfassungstheorie und in der Verfassungswirklichkeit ............................................................................................................................... 605 4.2.5 Verfassungsrechtliches System als Unterdrückungsinstrument gegen Oppositionelle ........................ 607 5 Volksdemokratien mangelt es an Rechtsstaatlichkeit als Fundament einer echten Demokratie ........................ 609 6 „Amnesty international“ zur Lage der Menschenrechte in der DDR ................................................................. 610 7 Staatlicher Terror bis zur physischen Vernichtung............................................................................................ 610 8 Staatliches Kidnapping durch "Zwangsadoptionen" ......................................................................................... 612 9 Faktisch bestehende Abhängigkeit der Richter trotz anders lautender Verfassungsbestimmungen ................... 613 10 Justiz in Diktaturen als wichtiges Instrument zur Durchsetzung der Staatsideologie ...................................... 615 IV. TEIL................................................................................................................................................................... 622 DAS RECHTSSYSTEM DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND .......................................................... 622 1 Privatrecht und öffentliches Recht .................................................................................................................... 622 2 Erste Einblicke in das Privatrecht ..................................................................................................................... 627 2.1 »Leihmutterschaft« und Zivilrecht.............................................................................................................. 636 2.2 »Offene« Rechtsbegriffe als Einfallstore für die Wertordnung des GG ..................................................... 640 3 Öffentliches Recht ............................................................................................................................................. 647 3.1 Verzahnung von zivilem und öffentlichem Recht in ein und demselben Lebenssachverhalt ..................... 652 3.2 Der Rechtsweg ist nicht immer eindeutig ................................................................................................... 653 3.3 Rangordnung unter den Rechtsnormen im öffentlichen Recht ................................................................... 653 4 Das Bundesverfassungsgericht als Hüter und Wächter des GG durch Urteil mit Gesetzesverwerfungskompetenz und durch mahnende Existenz .............................................................................................................................. 657 5 Überprüfung von Urteilen durch das BVerfG hinsichtlich möglicher Grundrechtsverletzungen ...................... 660 5.1 Staatliche Macht beschränkende Funktion der Grundrechte ...................................................................... 660 5.2 »Bluttransfusionsfall« und die in Art. 4 I GG geregelte Glaubensfreiheit .................................................. 666 7 5.3 Glücksspiel Rechtsprechung ...................................................................................................................... 671 5.4 Grundrechtsabwägung bei Zielkonflikt zwischen gleichzeitig betroffenen, widerstreitenden gleichen oder unterschiedlichen Grundrechten (Grundrechtskollision) .................................................................................. 672 5.5 Justizielle Grundrechte der Art. 101 bis 104 GG ....................................................................................... 683 5.6 Die Rechtsprechung des BVerfGs zur Kriegsdienstverweigerung aus individuellen Gewissensgründen (Art. 4 III GG) und zur Wehr- und Dienstpflicht (Art. 12 a GG) als Beispielsfälle für notwendige Abwägungen bei widerstreitenden grundgesetzlichen Regelungen .............................................................................................. 686 6 Mahnende Existenz und Rechtsprechung des BVerfGs; Abgrenzung gegenüber den Aufgaben der Politik an einem Beispielsfall ............................................................................................................................................... 713 7 In bewusster Abkehr von den Bestimmungen der Weimarer Verfassung getroffene staatsorganisatorische Bestimmungen im Grundgesetz ............................................................................................................................ 717 7.1 "Grundgesetz" contra "Verfassung" ........................................................................................................... 718 7.2 Grundrechte vorrangig vor Gesetzen als jederzeit gerichtlich einklagbare Rechte .................................... 718 7.3 Grundrechte als Abwehrrechte ................................................................................................................... 720 7.4 Weiterentwicklung einiger Grundrechte von Abwehr- in Teilhaberechte .................................................. 721 7.5 Weiterentwicklung einiger Grundrechte von Abwehr- über Teilhabe- in Leistungsrechte......................... 721 7.6 Verfassungsgerichtsbarkeit zum Schutz der Grundrechte; Verwirkung von Grundrechten ........................ 722 7.7 »Parteienprivileg« mit »Parteienirrtumsprivileg«; Parteienverbotsmonopol beim BVerfG; Widerstandsrecht ......................................................................................................................................................................... 724 7.8 »Ewigkeitsgarantie« für ein »verfassungsfestes Minimum« ....................................................................... 732 7.9 Wahlsystem der Bundesrepublik ................................................................................................................ 732 7.10 Konstruktives Misstrauensvotum ............................................................................................................. 735 7.11 Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung.................................................................. 736 7.12 »Notstandsverfassung« statt Notverordnungen......................................................................................... 737 7.13 Föderaler Bundesstaat statt eines zentralistischen Einheitsstaates............................................................ 737 7.14 Abschaffung der Todesstrafe .................................................................................................................... 741 7.15 Äußerst eingeschränktes Selbstauflösungsrecht des Bundestages ............................................................ 742 7.16 Gerichtswesen .......................................................................................................................................... 743 7.17 Volksbegehren, Volksentscheid ............................................................................................................... 751 8 Reform-Ideen zur Umgestaltung unserer durch Verschmelzung in der EU und Globalisierungsherausforderungen neuen Erfordernissen anzupassenden Verfassung ................................................................................................ 757 V. TEIL .................................................................................................................................................................... 758 DAS GESETZ ZUM SCHUTZ DER JUGEND IN DER ÖFFENTLICHKEIT (JÖSCHG) ALS BEISPIEL FÜR DIE SCHWIERIGKEITEN KONKRETER GESETZESABFASSUNG, -ANWENDUNG UND MÖGLICHER VERBESSERUNG .............................................................................................................................................. 758 Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit) ........................................................................................................................................................ 766 Stand: Änderung durch Art. 16 Abs. 2 G v. 28.10.1994 I 3186 ................................................................................... 766 Jugendschutzgesetz (JuSchG) vom 23.Juli 2002 ...................................................................................................... 771 VI. TEIL................................................................................................................................................................... 784 TABELLARISCHER ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN RECHTLICHEN ENTWICKLUNGSSTUFEN (RECHT UND LEBENSALTER)........................................................................................................................ 784 Index ............................................................................................................................................................................ 789 8 A BKÜRZUNGSVERZEICHNIS a.F. AG ArbG Art. Az. BAG BGB BGH BGHSt BVerfG BVerfGE BVerfGG BVerwG BWG DLF EheG ESchG EuGH FR GG GVG HH A i.V.m. JGG JÖSchG KDV LAG LG n.F. NJW OGHSt OLG OVG OWiG RGSt Rn. StGB StGB-DDR StPO StVG StVO SZ TierSchG TPG VA Verf-DDR VG VwVfG VO WV Ziff. ZPO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = alter Fassung Amtsgericht Arbeitsgericht Artikel Aktenzeichen Bundesarbeitsgericht Bürgerliches Gesetzbuch Bundesgerichtshof Entscheidungssammlung des BGH in Strafsachen Bundesverfassungsgericht Entscheidungssammlung des BVerfGs Bundesverfassungsgerichtsgesetz Bundesverwaltungsgericht (auch BVG) Bundeswahlgesetz Deutschlandfunk Ehegesetz Embryonenschutzgesetz Europäischer Gerichtshof Frankfurter Rundschau Grundgesetz Gerichtsverfassungsgesetz Hamburger Abendblatt in Verbindung mit (Paragraph ...) Jugendgerichtsgesetz Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit Kriegsdienstverweigerer Landesarbeitsgericht Landgericht neuer Fassung Neue Juristische Wochenschrift (verbreitetste juristische Fachzeitschrift) Entscheidungssammlung des Obersten Gerichtshofes in Strafsachen für die brit. Zone Oberlandesgericht Oberverwaltungsgericht Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen Randnummer Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch der DDR Strafprozessordnung Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Süddeutsche Zeitung Tierschutzgesetz Transplantationsgesetz Verwaltungsakt Verfassung der DDR von 1974 Verwaltungsgericht Verwaltungsverfahrensgesetz Verordnung Weimarer Verfassung Ziffer Zivilprozessordnung 9 E INFÜHRUNG Viele Normalbürger und auch Juristen klagen über die Verrechtlichung des Lebens in einer immer komplizierter werdenden industriellen Massengesellschaft, in der u.a. der Bereich des Rechts - zwangsläufig - immer weiter ausufert: Es müssen immer mehr Problemfelder anders oder neu geregelt werden. Und die Juristen verteidigen ihr Revier wie alte Silberrückengorillas, die denken, einem ihrer Weibchen gehe es ans oder - schlimmer noch ins Fell. Unternehmer klagen über die Flut immer neuer Reglementierungen, die sie davon abhielten, das zu tun, was sie als ihren Lebenszweck ansehen: etwas zu unternehmen. Es ist nicht unbedingt die einzelne Verordnung, von der sie sich gegängelt fühlen, obwohl das – wie z.B. im Fall der Pfandregelung auf Einweggetränkebehälter – auch der Fall sein kann. Aber die Flut der Verordnungen - und in deren Gefolge der Formulare - ist es, was bewirkt, dass sie sich wie Gulliver in Liliput fühlen. Sie fühlen sich von den Fangarmen der »Hydra bürocratica« so umschlungen und gefesselt wie Gulliver, als die Zwerge ihn, den »Riesen«, mit vielen kleinen Tauen gebunden hatten. Aber wenn wieder einmal ein Umwelt- oder die Menschen und ihre Lebensgrundlagen sonst wie näher berührender Skandal aufgedeckt wird, dann wird in diesem Zusammenhang nicht nur über so behauptet zu laxe staatliche Kontrollen zur Durchsetzung von den Schutz der Bürger bezweckenden Eingriffsgesetzen, sondern öfters auch darüber geklagt, dass die staatliche Lebensvorsorge in Form von die Bürger und ihre Lebensgrundlagen schützenden Gesetzen offensichtlich nicht weit genug gehe. Auch aus einem legitimen Sicherheitsbedürfnis heraus entsteht Nachfrage nach Bürokratie. Und damit die gesetzestreu arbeiten kann, müssen die dazu erforderlichen Gesetze und Verordnungen erlassen werden. Um notwendige staatliche Kontrollen vornehmen zu können, müssen zu einem großen Teil Lebensvorgänge erst einmal erfasst und dokumentiert werden, um sie dann gegebenenfalls analysieren zu können, damit möglichen Gefährdungen vorbeugende Gesetze und Verordnungen erlassen werden können: Gefahrenabwehr als ein vorrangiges Ziel juristischer Regelungen als Eingriffsgrundlage für die Exekutive. Man muss wissen, was auf welcher sachlichen Grundlage juristisch möglichst sinnvoll zu regeln ansteht, denn sonst wird die Gesetzgebung zu einem Ritt auf einer Rasierklinge. Und so benötigt man von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare! Aber da wird bestimmt auch des Guten zu viel getan; das zeigen in manchen Bundesländern sehr erfolgreich durchgeführte »Gesetzesentrümpelungsaktionen«, als deren Auswirkungen ein Drittel und mehr der Landesgesetze und der auf ihnen gründenden Verordnungen ersatzlos gestrichen worden sind. Trotzdem gilt, trotz sich immer wieder einstellender Resignation relativ unverdrossen weiterzumachen. Wir können aus dem Regelungsgeflecht, das unser Leben gegen große Risiken absichernd mitgestaltet, nicht millionenfach ausbrechen. Aber Vorschriften sollten auf ihre Notwendigkeit hin durchforstet werden. So hat der saarländische Ministerpräsident Müller seit seinem Regierungsantritt zwei Drittel aller saarländischen Vorschriften abgeschafft! Müllers im Wortsinne fragwürdiges und nicht ganz unproblematisches Prinzip ist die Umkehr des „Verbots mit Erlaubnisvorbehalt“ in eine „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“. Das kann aber nicht in allen Bereichen funktionieren. Beim nächsten Umweltskandal wird der Schädiger vorbringen, dass sein Verhalten ja nicht verboten gewesen war! Und wenn die Leute sich nicht mit Formularen herumschlagen müssen, dann entdecken sie vielleicht andere »Probleme«: 1999 klagten zwanzig ostdeutsche bildende Künstler, weil ihre Bilder in der Weimarer Ausstellung »Aufstieg und Fall der Moderne« auf grauem Wandhintergrund aus Platzgründen dicht an dicht und übereinander mit Hunderten anderer DDR-Werke gezeigt wurden. Durch die ihrer Meinung nach „herabsetzende Art der Hängung“ der Bilder fühlten sie sich in ihrem „Urheberpersönlichkeitsrecht“ zutiefst verletzt und „diffamiert“. In der ersten Instanz vor dem Landgericht Erfurt obsiegte eine Künstlerin in dem ersten dieserhalb entschiedenen Verfahren wegen des auch nach Meinung des erstinstanzlichen Gerichts angeblich nicht mehr hinzunehmenden Eingriffs durch die Ausstellungsleitung in ihr Urheberpersönlichkeitsrecht. Daraufhin legte die Kunstsammlung Weimar Berufung bei dem Oberlandesgericht Jena ein, weil sie in dem Urteil nun ihrerseits einen unerlaubten Eingriff in ihre Meinungsfreiheit und wohl auch ihr eigenes Urheberpersönlichkeitsrecht von Ausstellungsmachern sah. Somit stand Künstler-Persönlichkeitsrecht gegen Aussteller-Persönlichkeitsrecht. Hätte die erstinstanzliche Entscheidung Bestand gehabt, hätte sie katastrophale Auswirkungen für Galerien und Museen nach sich gezogen, weil jeder (exaltierte, egomanisch-spinnerte) Künstler mit Hinweis auf sein von ihm so gesehenes »Urheberpersönlichkeitsrecht« wohl so ziemlich jede Ausstellung nachträglich entwerten oder vielleicht sogar kippen könnte. Was machen manche Menschen nicht alles, um ins Gerede zu kommen! Das streichelt das nach Anerkennung lechzende, oft überspannte Ego und kann in der überdrehten Schicki-MickiKunstszene den Marktwert der eigenen Produktion immens erhöhen! Das ist einem Künstler dann schon einmal eine gerichtliche Auseinandersetzung wert. So klagte z.B. (der damals aber schon bekannte) Beuys, weil eine 10 Reinmachefrau, mit nur »natürlichem« und zu wenig beuysschem Kunstverständnis geschlagen, dafür aber mit ausgeprägtem natürlichem Reinigungsbedürfnis gesegnet, in einem Museum das von ihm auf einem Badewannenrand platzierte halbe Pfund Butter weggeworfen hatte, nachdem es ranzig geworden war. Streitwert: ein sechsstelliger Betrag wegen der Zerstörung seines ausgestellten »Kunstwerkes« »Badewanne mit Butter(?)« – anstatt, wenn es denn sein musste, durch die Museumsleitung einfach ein neues Paket hinlegen zu lassen. Das sei nicht mehr sein »Kunstwerk«. Darüber hatte dann das von Beuys angerufene Gericht zu entscheiden – und schmetterte den von ihm erhobenen spinnerten Schadensersatzanspruch ab. Wir sind ja schließlich nicht in den USA mit seinen teilweise mit dem gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehbaren Gerichtsentscheidungen – ohne dass ich damit allen in Deutschland gefällten Gerichtsentscheidungen Nachvollziehbarkeit attestieren möchte: davon bin ich sehr weit entfernt; aber es scheint in Deutschland mit mehr gesundem Menschenverstand geurteilt zu werden, als in den USA. In Deutschland werden nicht so viele hanebüchene »Ausreißer« insbesondere in Schmerzensgeldprozessen produziert, die dann die Presse beschäftigen: Ein eiliger Autofahrer hatte sich bei einem Drive-in-Imbiss einen Becher mit heißem Kaffee gekauft, sich zwischen die Beine geklemmt und war dann losgefahren. Als er bremsen musste, schwappte heißer Kaffe auf eine seiner empfindlichsten Körperregionen, wofür er über eine Million Dollar Schmerzensgeld erhalten hat! Auswirkung der in diesem Punkt nicht mehr nachvollziehbaren us-amerikanischen Rechtsprechung sind die ausufernden blödsinnig anmutenden Warnhinweise auf Produkten, mit denen die Hersteller ihr unwägbar gewordenes Haftungsrisiko zu minimieren trachten. Letztlich wird in solchen Prozessen wie dem der in dem Museeum »falsch« aufgehägten Bilder, in denen sich von jeder Prozesspartei als verletzt behauptete gleichlautende Persönlichkeitsrechte sich gegenseitig ausschließend gegenüberstehen, eventuell das Bundesverfassungsgericht entscheiden müssen, was »für Recht erkannt« werden soll, weil sich jede Seite auf ihr vom Grundgesetz garantiertes gleichlautendes Grundrecht berufen wird, wie sie es nun einmal von persönlichem Interesse geleitet - anders als die Gegenpartei - versteht. Der Normalbürger steht dem Bereich des Rechts völlig überfordert gegenüber. Und der Bereich des Rechts überfordert nicht nur Herrn Otto Normalverbraucher oder seine Freundin Frau Lieschen Müller, sondern auch die Juristen – einschließlich der Richter, obwohl »das Gericht das Gesetz zu kennen hat«. Auch den Juristen geht es wie z.B. den Ingenieuren oder den Medizinern: Jeder versucht, über (s)einen Teilbereich möglichst weitgehend informiert zu bleiben, aber einen Überblick über den gesamten Bereich kann keiner mehr erreichen. „Durch unser Wissen unterscheiden wir uns nur wenig, in unserer grenzenlosen Unwissenheit aber sind wir alle gleich.“ (Karl Popper) Das ist bei rund 2197 bundesdeutschen Gesetzen, 3131 Verordnungen mit mehr als 86.500 in Paragraphen oder Artikel gefassten Einzelbestimmungen, die unser Zusammenleben regeln und oft auch noch geändert werden, gar nicht mehr möglich!1 Der Deutsche Bundestag erließ in der 12. Wahlperiode 507 Gesetzesbeschlüsse (Änderungen bestehender oder Schaffung neuer Gesetze), in der 13. Wahlperiode 565 und in der 14. Wahlperiode 558! Hinzu kommen die vielen Verordnungen aus »Berlin« und die von der EU vorgegebenen, die in Berlin dann in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und selbst im »eigenen« Bereich, den zu überblicken man sich müht, sind Fehlbeurteilungen nicht nur möglich, sondern auch gang und gäbe - auch von Gerichten! Der Rechtsstreit um die Einführung der zum 01.08.98 endgültig in Kraft getretenen Rechtschreibreform mit seinen divergierenden Entscheidungen lieferte ein bundesweit beachtetes Beispiel. Wie jeder andere Staatsbürger erfahren auch Juristen im Bereich des Rechts die Unvollkommenheit menschlichen Bemühens! Das gilt sogar für unser oberstes Gericht: Ende 1997 entschied der Erste Senat des BVerfGs, dass Mediziner schadenersatzpflichtig seien, wenn auf Grund eines Behandlungsfehlers bei einer Sterilisation eine ungewollte Schwangerschaft entstehe oder auf Grund einer falschen genetischen Beratung ein missgebildetes Kind zur Welt komme. Zusätzlich zu den von den Ärzten oder ihren Versicherungen zu tragenden Unterhaltskosten wurde den Eltern ein eigener Schmerzensgeldanspruch zugestanden. Das empörte den Zweiten Senat, der 1993 bei der von ihm vorgenommenen Überprüfung der damals mittels eines Normenkontrollverfahrens angegriffenen Abtreibungsregelung außer den »ratio decidendi« (den eine Entscheidung tragenden Gründen, ohne die eine Entscheidung nicht hinreichend schlüssig begründet wäre) in 1 Die Zahlen gehen - wohl je nach juristischer Vorbildung des jeweiligen Journalisten oder seines Informanten oder dessen Quellenlage - fast beliebig auseinander, teilweise wird von „rund 100.000 deutschen Gesetze und Verordnungen“ gesprochen. Vielleicht hat das Statistische Bundesamt einen mengenmäßigen Überblick. 11 einem »obiter dictum« ganz nebenbei in einem eigentlich gar nicht zur Sache gehörenden Statement außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches hatte verlauten lassen, dass ein Kind niemals als ein »Schaden«, sondern immer als ein Gottesgeschenk anzusehen sei. Der Erste Senat hatte dieses damalige »obiter dictum« des Zweiten Senats wohl als einen Eingriff in seinen eigenen Kompetenzbereich empfunden und ihn nun 1997 bei nächstpassender Gelegenheit - in einem bisher einmaligen Vorgang(!) - zurückgewiesen. Solch eine juristische Ohrfeige schmerzt; insbesondere dann, wenn man selber Verfassungsrichter ist und in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich bei (teils behauptetem) Vorliegen der dafür erforderlichen Voraussetzungen die gesamte Gesetzgebung unseres Landes, alle Urteile aller anderen Gerichte und jegliches Verwaltungshandeln »mit (mehr als) einem Federstrich« kippen kann. Da hatte der aufjaulende Senat das Bewusstsein für seine eigenen, ihm vom Gesetzgeber gesetzten (Zuständigkeits-)Grenzen verloren, denn sonst hätte er sich nicht über den Spruch der Kollegen öffentlich, aber machtlos empört – und so seine ungedeckte Flanke geöffnet. Manche als solche empfundene Kränkung muss man im Leben ohne lautes Klagen hinnehmen können. Das gehört zu den psychischen Wachstumsschmerzen. Auf Grund ihres Fachstudiums können sich Juristen aber natürlich besser in rechtliche Sachverhalte hineinarbeiten und dort mitdenken, aber adäquat lösen können sie sie auch längst nicht immer! Als Beispiel sei erinnernd auf die Berliner Justizposse verwiesen, der zufolge der Prozess gegen Honecker - eine der wenigen von Gerichten zugelassenen, von der PDS als „Siegerjustiz“ diffamierten Anklagen als Ergebnis ungefähr 13.000 eingeleiteter Ermittlungsverfahren - mit Rücksicht auf seine bei weiterer Inhaftierung durch "Leberkrebs im letzten Stadium" gesundheitlich gefährdete Menschenwürde - die er den seiner Parteidiktatur Unterworfenen stets verweigert hatte - vorzeitig beendet, Honecker aus der Haft ent- und mit einem Pass nach Chile gelassen wurde, und ihm hinterher ein Bote des Gerichts mit einer neuerlichen Ladung zu einem erneuten Verhandlungstermin in Berlin nach Chile nachgeschickt wurde. Er solle doch bitte erneut noch ein paar weitere Verhandlungstage auf der ihm nun schon vertrauten Anklagebank Platz nehmen, um das Verfahren mit einem Urteil statt des erlassenen Beschlusses beenden zu können. Und es wurde die rechtliche Belehrung oder Drohung ausgesprochen, dass notfalls auch ohne ihn verhandelt würde! Bei seiner von zwei deutschen Gutachtern angenommenen angeblich geringen Belastbarkeit und Lebenserwartung von nur noch wenigen Monaten, die dann aber von chilenischen Ärzten gleich nach seiner Ankunft anders beurteilt wurde ("Der Gesundheitszustand ist ernst, aber nicht lebensbedrohlich, der Leberkrebs ist nicht im letzten Stadium."; Honecker lebte noch 16 Monate), wird er sich das letzte Jahr seines Lebens vielleicht über das Ansinnen der Berliner Richter totgelacht haben! Übrigens: Chile scheint für Diktatoren ein hervorragendes Heilklima zu haben, denn der in Großbritannien nur noch im Rollstuhl bewegte, nach Befund britischer Ärzte völlig gebrechliche, demente und deswegen aus humanitär-rechtlichen Gründen wegen seiner zu großen Gebrechen aus britischer »Auslieferungsverwahrung« entlassene Ex-Diktator Pinochet konnte gleich nach seiner Heimkehr nach Chile sofort wieder auf seinen eigenen Füßen gehen und die Front der angetretenen Ehrenkompanie abschreiten! Aber wie sollten Richter ohne - ausreichende - eigene Sachkenntnis über medizinische Detailfragen urteilen können? Das kann ihnen niemand vorwerfen, denn da sind sie auf das Untersuchungsergebnis hoffentlich sachverständiger Gutachter angewiesen. Doch zurück zu den sowieso bestehenden, gerade angesprochenen Schwierigkeiten der Juristen mit der Juristerei: Noch schlimmer kann es werden, wenn Richter ihren Paragraphen-Dschungel verlassen und außerhalb der reinen Paragraphenanwendung Angeklagte beurteilen. Ein schon mehr als unappetitliches, abschreckend verdeutlichendes Beispiel: Die »Fast-Seligsprechung« eines früheren NPD-Vorsitzenden durch Richter einer Mannheimer Strafkammer in der Urteilsbegründung zu einem wegen der »Auschwitz-Lüge« angestrengten Verfahren. Bei dieser grundsätzlichen Schwierigkeit der Materie des Rechts nützt es darum auch längst nicht immer etwas, mit einem Rechtsanwalt, Richter, Staatsanwalt, Verwaltungs- oder in der Privatwirtschaft tätigen Juristen verheiratet zu sein, aber in manchen Situationen hilft es, einen Juristen oder eine Juristin geheiratet zu haben. Doch wegen des Numerus-clausus auch in diesem Studienfach lässt sich die Lebensplanung nicht verlässlich darauf einstellen. Was bleibt, ist daher, sich selber ein bisschen um ein Anfangsverständnis gegenüber dem Bereich des Rechts zu mühen. Dabei zu helfen - und sicher auch manchmal subjektiv gefärbte Führung zu geben -, ist das Anliegen dieses Buches. Vielleicht machen Sie dann ja auch eine Entdeckung, die der Jurist Goethe an sich selber festgestellt hat: „Es ist mit der Jurisprudenz wie mit dem Bier: das erste Mal schaudert man, doch hat man’s einmal getrunken, kann man’s nicht mehr lassen.“ Mir geht es mit dem Strafrecht so, obwohl ich schon lange wieder in meinen ursprünglichen Beruf als Lehrer zurückgekehrt bin. Wer nicht auf Grund seiner Ausbildung einen gewissen erleichternden Zugang zu dem Bereich des Rechts gefunden hat, der steht dieser Materie zunächst völlig hilflos gegenüber. Seine eigene Hilflosigkeit erfährt man 12 als Nicht-Jurist sehr schmerzhaft, wenn es einmal »darauf ankommt«, und man nicht weiß, wie man sich in einer konkreten Situation am geschicktesten verhalten sollte, ohne später Rechtsnachteile zu erleiden. Noch schmerzhafter ist es, wenn es schon darauf angekommen war, und der Richter einem hinterher erklärt, wie man sich - seiner Meinung nach - anders hätte verhalten müssen, um sein angestrebtes Ziel ohne den nun eingetretenen rechtlichen Nachteil zu erreichen. In der nächsten Instanz erzählen einem deren Richter dann vielleicht etwas ganz anderes! „Auf See und vor Gericht ist man nur noch in Gottes Hand!“ Das habe auch ich als Rechtsanwalt in eigener Sache in einem für mich existenziellen Rechtsfall am eigenen Leibe schmerzlichst erfahren. Ich weiß deshalb ganz genau, wovon ich rede! Wenn Sie kein Geld mehr haben, einen langjährigen Rechtsstreit finanziell durchzustehen, dann rettet Sie auch nicht Ihre (vielleicht nur eingebildete) überlegene Rechtskenntnis vor den Folgen, die Ihnen die Richter der Unterinstanz zumuten. Darum kann eine Rechtsschutzversicherung (= Rechtsverfolgungskostenversicherung) so hilfreich sein wie eine private Haftpflichtversicherung, auf deren Abschluss auch keiner verzichten sollte. Um dem juristisch unverbildeten Laien einen Blick über die Mauern der Paragraphen hinweg in den Irrgarten des Rechts - in dem man sich nicht nur verirren, sondern manchmal sogar an seinem gesunden Menschenverstand irre werden kann - zu ermöglichen, soll ihm mit diesem Buch eine Leiter gereicht werden. Dabei wird nur ein kurzer Blick in den Irrgarten des Rechts angestrebt. Es wäre ein völliges Missverständnis, wenn der Leser hoffte, nach der Lektüre dieses Buches ohne weiteren sachkundigen Rat gegen die Fallstricke des Rechts hinreichend gewappnet und in der Lage zu sein, das Skalpell »Recht« in den ihn bedrängenden Fällen hinreichend sicher benutzen zu können! Erreicht werden soll aber auf jeden Fall - durch einen interdisziplinären Ansatz mit Rückgriff auf Geschichte, Politik und Recht - die Vermittlung eines Gespürs dafür, dass »Recht und Gesetz« nicht - wie man früher oft glaubte oder die Leute Glauben machte - gottgegeben vom Himmel gefallen sind; dass sie grundsätzlich zwar befolgt werden müssen, so lange sie gültig sind, dass sie aber in einer Demokratie trotzdem nicht gottergeben hingenommen werden müssen, sondern bei nicht sachgerechter Regelung eines Lebenssachverhaltes durch zu organisierende Mehrheitsentscheidung des jeweiligen Gesetzgebungsorgans auch geändert werden können. Es soll ein Gefühl dafür geweckt werden zu erahnen, was »Recht und Gesetz« für ein Gemeinwesen bedeuten und zu leisten vermögen. Damit soll auch der sich möglicherweise einstellenden Ehrfurcht vor dem den Einzelnen und seine Gelüste bezwingenden »Recht« und dessen Durchsetzung bezweckenden (gerade geltenden!) Gesetzen vorgebeugt werden: Was in einer Gesellschaft unter »Recht« und mehr noch unter einem von seiner (angeblichen) Intention her Rechtsfrieden stiftenden »Gesetz« verstanden wird, ist oft interessengebunden. »Recht« und »Gesetz« sind beileibe nichts »Heiliges«! Zum Beweis nur zwei Aussprüche: „Recht ist, was der proletarischen Klasse nützt“ (Lenin) und „Das Recht und der Wille des Führers sind eins“ (Göring). Und selbst die als höchstes anzustrebendes gesellschaftliches Ziel vielbeschworene »Gerechtigkeit« ist auch von unterschiedlichen Vorverständnissen abhängig und keine allerorts geltende verlässliche Elle! Wie schon früher vor der Einführung des Meters allein in Deutschland die Elle als Maßsystem unterschiedlichste Ausprägungsformen kannte, so ist auch heutzutage die Elle der Gerechtigkeit, an der alles gemessen werden soll, und erst recht die des Rechts, in der Welt sehr unterschiedlich definiert. Als endlich 2004 im Rahmen der Agenda 2010 zur Rettung unserer angeknacksten sozialen Sicherungssysteme die ersten behutsamen Einschnitte in den nur noch verbliebenen »Rest-Kuchen« vorgenommen wurden, begehrten die Betroffenen auf: es sei ihrer Meinung nach bei der Neuverteilung der zu tragenden Lasten nicht sozial »gerecht« zugegangen. Abgenötigter sozialer Verzicht wird - menschlich durchaus verständlich - meistens als »ungerecht« empfunden. Und Forderungen nach mehr »Gerechtigkeit« dienen oft dazu, Eigeninteressen moralisch zu überhöhen. Wenn Gerechtigkeitstheoretiker in akademischen Gedankenspielen fordern, der auszuhandelnde Gesellschaftsvertrag sollte von Leuten gemacht werden, die nicht wissen, ob sie unter diesem Vertrag als Reiche oder Arme, Starke oder Schwache leben müssen, dann ist das eine illusionistische Glasperlenspielerei, denn jeder ist in unsere Gesellschaft irgendwie eingebunden, und wenn er an verantwortlicher Stelle ein Gesetz schafft, dann hat er zu wissen, was die Folgen seines Tuns sein werden, dann weiß er genau, wo er seinen Platz in dem Koordinatensystem hat, ob er »stark« oder »schwach« ist. Im Zusammenhang der Hartz-IV-Auseinandersetzung druckte der STERN (01.04.04) Antworten auf die Umfrage, was sozial »gerecht« sei. Die Antworten von Parteiführern, Kirchen und Verbänden waren vielfältig: Der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering definierte »soziale Gerechtigkeit« mit den Worten: 13 „Zur sozialen Gerechtigkeit gehört Chancengleichheit. Vor allem gleiche Bildungschancen für alle. Auch gleiche Berufschancen für Frauen und Männer. Verteilungsgerechtigkeit gehört dazu; sie muss Leistungswilligkeit berücksichtigen, aber auch Leistungsfähigkeit. Die Stärkeren müssen mehr leisten als die Schwächeren. Und gerecht ist Politik nur, wenn sie auch für morgen gut ist, die Verantwortung für die kommende Zeit ernst nimmt. Ohne Freiheit und Solidarität ist Gerechtigkeit unvollkommen. Deshalb bestimmen diese drei Grundwerte unsere Politik.“ Der Parteichef der Grünen, Reinhard Bütikofer, sekundierte: „Gerechtigkeit meint Parteinahme für die Schwächsten. Sie will mehr als Verteilungsgerechtigkeit. Es geht darum, den Menschen zu ermöglichen, ihr eigenes Leben zu leben. Gerechtigkeit zielt auf Teilhabe für alle an Arbeit und Bildung. Generationengerechtigkeit soll das Verhältnis von Alt und Jung bestimmen. Gerechtigkeit fordert, die ökologischen Probleme zu lösen, um Lebensbedingungen und Lebensqualität zu sichern. Gerechtigkeit verlangt, die Globalisierung fairer zu gestalten und die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann durchzusetzen.“ Als Vorsitzende der größten Oppositionspartei gab die CDU-Vorsitzende Angelika Merkel ihre Sicht sozialer Gerechtigkeit zu Protokoll: „Sozial gerecht ist, was Menschen befähigt, für sich selbst sorgen zu können, und dort zum Ausgleich verpflichtet, wo diese Fähigkeit unzureichend ist. Viele Menschen haben heute das Gefühl, dass diese Grundsätze aus den Fugen geraten sind. Es fehlt an verlässlicher Politik, die dem Einzelnen deutlich macht, dass seine Leistung und die Gegenleistung des Staates in einem gesunden Verhältnis stehen. Wir brauchen einen klaren Vertrag: Wohlstand und Sicherheit für Leistung und Veränderungsbereitschaft.“ Der sich mit ihr in der Opposition befindende Parteivorsitzende der FDP definierte aus seiner Sicht als Wirtschaftsliberaler soziale Gerechtigkeit mit den Worten: „Sozial gerecht ist, wenn sich Politik vor dem Verteilen um das Erwirtschaften kümmert. Eine Neidkultur, die Fleiß und Anstrengung bestraft, ist sozial ungerecht, denn sie treibt eine Gesellschaft in die kollektive Pleite. Sozial gerecht ist eine Anerkennungskultur, die Leistung befördert und belohnt, damit den Schwächeren geholfen werden kann. Sozial gerecht ist Hilfe für die sozial Bedürftigen, nicht die Findigen, denn es gibt kein Recht auf staatlich bezahlte Faulheit. Wir sitzen alle in einem Boot, aber einige müssen auch rudern, sonst kann man niemals soziale Gerechtigkeit in Deutschland finanzieren.“ Der Vorsitzende der größten Gewerkschaft der Welt, der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske, erklärte sichtlich um Volkstümlichkeit bemüht: „Die 70-jährige Oma wird nicht den schweren Koffer schleppen müssen, wenn sie mit ihrer Familie in den Urlaub fährt. Das Tragen übernimmt der Enkel, während sich die Oma um die Wegzehrung für alle kümmert. Das heißt: Jeder übernimmt die Leistung, die seinen oder ihren Kräften und Fähigkeiten entspricht. Ich verstehe unter sozialer Gerechtigkeit: Alle leisten ihren Beitrag entsprechend ihren Möglichkeiten, soziale Risiken, die uns alle jederzeit treffen können, werden abgefedert. Dann funktioniert das Ganze, im Großen wie im Kleinen.“ Sein verbandspolitischer Gegenspieler, der Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt, steuerte den folgenden Diskussionsbeitrag bei: „Gerechtigkeit bedeutet für mich die Gleichheit aller Menschen in ihrer Würde und Freiheit sowie vor dem Gesetz. Sozial gerecht ist es, allen Menschen gleichermaßen die Teilhabe an Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zu ermöglichen. Dazu gehört untrennbar, sie auch für ihr Handeln in die Pflicht zu nehmen: Eigenverantwortung und Solidarität mit den Schwachen sind die zwei Seiten derselben Medaille. Sozial gerecht ist, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und nachhaltig für Generationengerechtigkeit in der Sozialpolitik zu sorgen.“ Das Mitglied des Attac-Koordinierungskreises Sven Giegold stellte als seine - teilweise stark idealistische - Sicht 14 heraus: „Sozial gerecht ist, wenn alle Menschen gleiche soziale Rechte, gleiche Chancen und einen angemessenen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum bekommen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Nahrung, Wohnung, Gesundheit, sauberes Wasser, Bildung, eine intakte Umwelt sowie ein Einkommen, das die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Soziale Gerechtigkeit ist in Deutschland sowie zwischen den reichen und den armen Ländern massiv verletzt. Jede Politik, die soziale Ungerechtigkeit verstärkt, erfordert unseren Widerstand.“ Eine krasse Gegenposition nahm der verstorbene, gleichwohl zitierte liberale Ökonom Friedrich August Hayek ein: „Womit wir im Falle der ‚sozialen Gerechtigkeit’ zu tun haben, ist einfach ein quasi religiöser Aberglaube von der Art, dass wir ihn respektvoll in Frieden lassen sollten, solange er lediglich seine Anhänger glücklich macht, den wir aber bekämpfen müssen, wenn er zum Vorwand wird, gegen Menschen Zwang auszuüben.“ Der PDS-Vorsitzende Lothar Bisky definierte ohne jede klassenkämpferische Attitüde: „Soziale Gerechtigkeit ist modern. Sie ist das Gerüst der Demokratie. Armut macht es morsch. Gleiche Bildungschancen, Gesundheitsversorgung nicht nach dem Geldbeutel, Zugang zur Kultur für jedermann, menschenwürdige Alterssicherung, existenzsichernde Arbeit ermöglichen gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Damit das geht, müssen starke Schultern mehr tragen als schwache. Soziale Wohlfahrt ist auch das einzige Mittel, um den internationalen Terrorismus weltweit dauerhaft den Boden zu entziehen.“ Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) definierte ihr Ratsvorsitzender Bischof Wolfgang Huber: „Wie gerecht eine Gesellschaft ist, kann man daran sehen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Es zeigt sich ebenso daran, wie sie für die nächsten Generationen Sorge trägt. Denn alle Menschen sind Gottes Kinder – mit gleicher Würde und mit gleichen Rechten. Weil nach uns nicht die Sintflut kommt, müssen wir zukunftsfest handeln und fair mit dem umgehen, was uns anvertraut ist. Die Weitergabe des Lebens, die Freude am Aufwachsen von Kindern, die Förderung von Familien und Geschlechtergerechtigkeit sind hohe Güter. Sie sollten nicht vergessen werden, wenn es um die Gestaltung einer gerechten Gesellschaft geht.“ Beschlossen wurden die vorstehend teilweise widergegebenen Stellungnahmen mit der Sicht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Kardinal Karl Lehmann: „Soziale Gerechtigkeit ist nichts Statisches. Eine Gesellschaft muss sich vielmehr immer wieder vergewissern, was hier und jetzt gerecht ist. Grundsätzlich gilt: Sozial gerecht ist ein Gemeinwesen, wenn es allen Bürgerinnen und Bürgern hilft beziehungsweise ermöglicht, durch eigenes Handeln ihr Wohl zu erreichen. Sozial gerecht handeln Menschen, wenn sie bereit sind, in das Gemeinwesen all das einzubringen, was um des Gemeinwohls willen notwendig ist, ob es gesetzlich vorgeschrieben ist oder darüber hinaus geht.“ In der zuletzt zitierten Stellungnahme kommt schon zum Ausdruck: In jeder Gesellschaft ist das System von Recht und Gesetz ein lebender Organismus, der - wie es lebenden Organismen eigen ist - ständigen Veränderungen unterworfen ist. Dieser Organismus muss laufend der Lebenswirklichkeit angepasst werden, um nicht irgendwann als drückendes Unrecht empfunden zu werden. Das gilt nicht nur für offene demokratischdynamische, sondern auch für konservativ-restaurativ ausgerichtete, dann oft ideologisch oder theokratisch geprägte Gesellschaften. Um diese kritische Sichtweise auf das gerade geltende Recht und die jeweiligen Gesetze als oft durchaus fragwürdige rechtliche Regelungen deutlich zu machen, werden in diesem Buch an manchen Stellen alte Schlachten nachgezeichnet, auch wenn die Entwicklung von Recht und Gesetz inzwischen darüber hinweggegangen ist: 15 o o o Wer würde z.B. heute noch das Zusammenschlafen von Verlobten als strafwürdiges Kriminalunrecht ansehen und die Eltern, in deren Wohnung das geschieht, wegen Kuppelei bestrafen? Aber das war der Stand der Rechtsprechung in den frühen Jahren der Bundesrepublik. 1969 hatte Touropa in Rheinland-Pfalz ein Gerichtsverfahren wegen Verbreitung pornographischer Schriften zu bestehen, weil diese Firma es als erste gewagt hatte, einen - nur unter dem Verkaufstresen weitergereichten - bebilderten Katalog über FKK-Reisen bereithalten zu lassen. Wer würde heute noch durch ein Gesetz erzwingen wollen, dass eine Frau mit ihrer Heirat zwangsweise auf ihren bisherigen Namen verzichten müsste? (Anfang des 20. Jahrhunderts unterfiel sogar ihr Privatvermögen durch den Akt der Eheschließung automatisch der Zwangsverwaltung des ihr nun vorangestellten Ehemannes!) Wieso galt die bei uns bis noch vor kurzem allein zulässige und wegen (schließlich erfolgreicher) Änderungsbestrebungen lange Jahre heftig umkämpfte Ehenamensgebungsregelung in vielen Ländern Europas schon lange nicht mehr, ohne dass dort das gesellschaftliche System kollabierte, was von Reformgegnern bei uns als Folge einer diesbezüglichen gesetzlichen Regelung als Schreckgespenst an die Wand gemalt worden war? Bei uns wurde von konservativster Seite trotz des seit dem 23.05.49 mit all seinen anderen Bestimmungen geltenden Artikels 3 Grundgesetz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes ... benachteiligt oder bevorzugt werden“, noch Jahrzehnte verbissen an der alten, die heiratenden Frauen benachteiligenden und somit dem Gleichheitssatz widersprechenden Regelung festgehalten! Es wurde fast der Untergang des Abendlandes beschworen, wenn unser Ehenamensrecht geändert würde! Und dann wurde es - in mehreren klitzekleinen einzelnen Schritten – doch geändert. Der erste Schritt bestand darin, dass heiratende Frauen zwar weiterhin unverzichtbar den Namen des Ehemannes anzunehmen hatten, zusätzlich aber, dem etwas geläuterten neuen Rechtsgefühl der Männer entsprechend, ihren Geburtsnamen als Appendix daran anhängen und so einen Teil ihrer bis dahin eigenständigen und oft sogar im Vergleich zu der des Mannes erfolgreicheren Biographie retten durften. Doch warum musste der Name des Ehemannes dem der Ehefrau vorangestellt sein. Woher das Recht zu der Macho-Dominanz? Darum wurde als nächster Schritt gesetzlich die Möglichkeit eröffnet, dass eine heiratende Frau zwar immer noch den Namen des Mannes anzunehmen hätte, dem aber ihren bisherigen Namen voranstellen dürfe. Inzwischen dürfen die Eheschließenden nicht nur wählen, welchen der beiden Geburtsnamen sie als Ehenamen führen wollen, sondern sogar, ob sie einen der beiden Geburtsnamen als gemeinsamen Ehenamen wählen oder weiterhin so heißen wollen, wie sie bisher in ihrem sozialen Umfeld oder sonst wie einem größeren Kreis mehr oder weniger bekannt waren. Und der deutsche Teil des christlichen Abendlandes steht immer noch! Nur durch das Bewusstmachen der Relativität von dem, was sich oft hinter der Floskel von »Recht und Gesetz« verbirgt, nur wenn man sich auch die Geschichtlichkeit von »Recht und Gesetz« in ihren sozialen Bezügen und das Fundament des Rechts letztlich in der Religion vergegenwärtigt, erhält man die geistige Freiheit, diesen Problemkreis (je nach Sachlage ständig) zu hinterfragen und zeit- und damit sachgerechte(re) Lösungen für Probleme des Zusammenlebens in einer Gesellschaft zu erarbeiten. Dazu sind wir als Staatsbürger alle aufgerufen. Wir müssen uns manchmal rechtzeitig empören können! Das Aufkommen des Nationalsozialismus hätte sich vielleicht verhindern lassen, wenn die Menschen sich in Massen gegen dessen durch ungerechte Gesetze verfolgte Ziele empört hätten, als noch gefahrlos Zeit dazu da war. Die von der »Heldenstadt Leipzig« ausgegangene, in den Montagsdemonstrationen zu Zehntausenden und damit für den Einzelnen gefahrloser öffentlich geäußerte Empörung brachte ja auch die rote Diktatur des Arbeiter- und Bauernstaates zum Einsturz! Ein solches Engagement verlangt aber - neben Zivilcourage - auch ein etwas fundiertes Problembewusstsein und nicht nur ein dumpfes Unmutsgefühl im Oberbauch. Darum müssen wir uns um Fragen von Recht und Gesetz kümmern - was zur Voraussetzung hat, dass wir zumindest ein Gefühl für diesen Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenlebens entwickeln. An dieser Elle müssen wir dann die uns durch die Massenmedien ins Haus gebrachten Tagesmeldungen über Regierungshandeln messen - und eventuell aktiv werden. Wenn man dem zuzustimmen vermag, dann ist dieses Buch sogar ein Stück praktische Lebenshilfe. Darum wurde dieses Buch bewusst um viele seit mehr als zwei Jahrzehnten hauptsächlich an den Schwerpunkten der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung orientiert gesammelte Zeitungsmeldungen herum aufgebaut, die in ihrem rechtlichen Zusammenhang betrachtet werden: Gleichberechtigung, Freiheit der Person in ihren verschiedensten Facetten bis hin zur bedarfsmäßig neu geschaffenen informationellen Selbstbestimmung und der Versammlungs- und Pressefreiheit als Wesenselemente eines freiheitlichen Staates. Die Demonstrationsfreiheit als Teil der Versammlungsfreiheit, die „Pressefreiheit des kleinen Mannes“, ist dabei größeren Gefahren der Einschränkung durch die Exekutive ausgesetzt als die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nur einmal ernsthaft in Frage gestellte Pressefreiheit, als der CSU-Verteidigungsminister Strauß SPIEGEL-Redakteure wegen eines regierungskritischen Artikels über die Bundeswehr – „Bedingt abwehrbereit“ – wegen 16 angeblichen Geheimnisverrats durch bei Gerichten erwirkte Haftbefehle vorübergehend einsperren ließ, wobei auch das Franco-Regime eingeschaltet wurde, um einen in Spanien urlaubenden SPIEGEL-Redakteur dort für die beantragte Auslieferung festsetzen zu lassen. Aber Demonstrationen werden ständig mit einschränkenden Auflagen versehen; schon alleine, um die Kampfhähne bei den Demonstranten und den Gegendemonstranten auseinander zu halten, damit die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen können, was manche von ihnen am liebsten täten: „Kein Mord fürs freie Wort!“ Manche Demonstrationen würde die Exekutive am liebsten an die Stadtränder verbannen, um sie dort wirkungslos verpuffen lassen zu können. Aber dann fallen die Gerichte den Polizeibehörden in die Arme: das in Art. 8 Grundgesetz (GG) gewährte Recht der Versammlungsfreiheit als Möglichkeit der kollektiven Meinungskundgabe (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. (2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. sei so konstitutiv für eine Demokratie, dass auch den Schmuddelkindern der Demokratie die Gelegenheit gegeben werden müsse, durch das Erregen von Aufsehen (und Ärgernis) auf ihr Anliegen aufmerksam machen zu können, wenn sie sich denn (relativ) friedlich und nicht offensichtlich mit Waffen versammeln. Die vorstehend zitierte Formulierung des Art. 8 GG gibt Anlass, schon gleich zu Anfang des Buches auf einen Teilaspekt der Technik juristischen Arbeitens aufmerksam zu machen. Die besteht nämlich u.a. auch im Bilden von Rückschlüssen, die zur Begründung juristischer Argumentationen gebildet werden, wenn der Wortlaut eines Gesetzes, einer Verordnung oder Satzung nicht an jeder Stelle zweifelsfrei formuliert ist. Dann kommen oft nichtjuristische »Freunde des gespaltenen Haares«, wollen etwas für sich herausschlagen und die Richter, ebenfalls oft und gerne dem gleichen Freundeskreis angehörig, versuchen, ihnen zu weit gehende Gesetzesauslegungen zu unterbinden. Das kann sich bis zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG) durch viele Instanzen ziehen, weil sich Richter auch sehr gerne Argumente um die Ohren hauen: Wie konnte die Unterinstanz bloß so blöde sein! Das muss doch genau andersherum entschieden werden, meinen dann die jeweils zuständigen Berufungsrichter. In der Revisionsinstanz kann das Problem wieder anders gesehen werden, und letztlich entscheidet das BVerfG, was „für Recht erkannt“ wird. Manchmal ist eine Interpretationsschwierigkeit aber auch gleich in der ersten Instanz erledigt. Lesen Sie bitte noch einmal den vorstehenden Art. 8 I GG und Sie werden erkennen, dass das Demonstrationsrecht zunächst uneingeschränkt gewährt wird; eine Einschränkungsmöglichkeit erfolgt erst in Art. 8 II GG für „Versammlungen unter freiem Himmel“. Rückschluss: Für Versammlungen, die nicht unter freiem Himmel stattfinden, bestehen keine Einschränkungen. Als 1949 der Parlamentarische Rat das Grundgesetz konzipierte und verfasste, dachte er natürlich »offline«. Konrad Zuse hatte zwar schon 1941 die erste programmgesteuerte Rechenanlage der Welt geschaffen, aber in meinen älteren Lexika bis 1975 wird er, werden Computer überhaupt nicht erwähnt. Wie sollten da die Mütter und Väter des Grundgesetztes die sich nur für einige wenige Insider unter den Physikern in der Morgendämmerung des Computerzeitalters am Horizont schemenhaft andeuteten technischen Möglichkeiten bei der Formulierung des Grundgesetzes mitbedenken? Technische Neuerungen fordern Juristen halt erst dann heraus, wenn ihre Relevanz absehbar ist. Und dann müssen sie sich den Anforderungen stellen, jedenfalls wenn sie Richter sind und ihnen ein solches Problem auf den Tisch kommt; und notfalls auch »online« denken. Warum dieser lange Vorspruch im Zusammenhang mit dem Demonstrations- und Versammlungsrecht? Lesen Sie die Zeitungsmeldung, die mich dazu veranlasst hat, diesen Aspekt in mein für juristisch Interesierte konzipiertes Lehrbuch aufzunehmen: GERI CHTSENTSCHEI DUNG Aufruf zur Online-Demo ist strafbar Von Martin Brust Online ist nicht mit Offline vergleichbar, entschied das Amtsgericht Frankfurt, und wertete die Blockade der Lufthansa-Website im Juni 2001 als Nötigung. Die Organisatoren wollten mit der Blockade gegen das Abschiebegeschäft protestieren und beriefen sich auf das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das Betätigen der Computer-Maus kann eine Form von physischer Gewalt sein, ausgeübt mittels der elektrischen Impulse, die der Mausklick bewirkt und die wiederum eine Aktion eines Computerprogramms auslösen. Das entschied jedenfalls das Amtsgericht Frankfurt/Main unter Richterin Bettina Wild im Prozess gegen den Inhaber der Domain www.libertad.de. 17 Der arbeitslose Schreiner Andreas-Thomas V. war angeklagt, im Jahr 2001 als Mitglied der Initiative "Libertad!" durch Texte auf der Webseite und in gedruckter Form zur Beteiligung an einer OnlineDemo und damit zur Nötigung aufgerufen zu haben. Am Tag der Hauptversammlung des Konzerns sollte zwischen zehn und zwölf Uhr massenhaft die URL www.lufthansa.com aufgerufen werden mit dem Ziel, die Zugriffszeiten deutlich zu verlangsamen. Die Initiative "Libertad!" warf der Lufthansa vor, von der Abschiebung von Flüchtlingen zu profitieren, die mit Maschinen der Airline nach Hause geschickt werden. Im besten Fall erhofften sich die Aktivisten, dass die Webseite nicht mehr zugänglich sei - was, wie sich im Laufe des Prozesses herausstellte, für acht bis zehn Minuten auch tatsächlich der Fall war. Auf einer weiteren Webseite wurde von anderen Protestierenden eine Software bereitgestellt, die diese Aufrufe automatisierte, beschleunigte und vor allem verhinderte, dass die Seite nach dem ersten Aufruf nur noch aus dem lokalen Cache geladen wurde. Von Libertad.de wurde zu dieser Seite verlinkt. Nun wurde der Domaininhaber von libertad.de zu einer Strafe von 900 Euro verurteilt. Der Angeklagte und sein Anwalt kündigten noch im Gerichtssaal Revision an. In ihrem Urteil betonte die Richterin - wie bereits zuvor die Staatsanwältin -, dass es nicht um die Verurteilung der politischen Aktivität des Angeklagten gehe. Verurteilt werde auch nicht ein Aufruf zu einer Demonstration, sondern die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Denn die Blockade der Lufthansa-Webseite sei ebenso Gewalt mittels elektrischer Energie wie beispielsweise die Anwendung eines ElektroSchockers, so die Richterin. Dadurch seien User, die im fraglichen Zeitraum auf der Webseite beispielsweise Tickets hätten buchen wollen, genötigt worden. Und zwar unbeschadet von den Ausweichmöglichkeiten und ungeachtet der Tatsache, dass zwei Lufthansa-Zeugen keine konkreten Angaben zu Buchungsausfällen machen konnten. In seinem Schlusswort sagte der Angeklagte, die Fluglinie versuche einen Spagat: Die Wirkung der Online-Demo werde geleugnet und zugleich Strafanzeige eingereicht. Der Konzern behaupte einen immensen Schaden, könne dazu aber keine Zahlen über die gut 42.000 Euro für technische Abwehrmaßnahmen hinaus vorlegen. Die Airline trage auch selbst Schuld: "Die Blockier-Software sei lange nicht so effektiv gewesen wie die Lufthansa-eigenen Maßnahmen, etwa die, zwischen Servern, die die Seite lufthansa.com bereit hielten, hin und her zu switchen. Die "Demonstrierenden" hätten keinen Einfluss darauf gehabt, dass bei diesem Umschalten die in den Speichern gehaltenen Kundendaten und Buchungen nicht "mitgenommen" wurden, sagte der Angeklagte. Der Anklageschrift zufolge gab es in den fraglichen zwei Stunden rund 1,2 Millionen Zugriffe von gut 13.600 verschiedenen Rechnern, darunter waren fast 160 IP-Adressen mit einer auffällig hohen Zahl von Zugriffen. Dies dürften vermutlich Rechner gewesen sein, die sich der Protestsoftware bedienten. Aber wer kann letzten Endes unterscheiden, warum jemand am fraglichen Tag zur fraglichen Zeit die Webseite aufrief? Der Klick der Kundin besteht wie der des Demonstranten aus Einsen und Nullen - damit sieht ein Klick dem anderen nun mal zum Verwechseln ähnlich. Dass die rechtliche Beurteilung schwierig ist, darauf deutet nicht nur die lange Verfahrensdauer hin. Sondern auch, dass noch am Vorabend der Aktion das Bundesjustizministerium von Terrorismusverdacht sprach. Das förmliche Ermittlungsverfahren wurde dann aber erst nach einer Anzeige der Lufthansa aufgenommen und lautet auf "Verdacht auf Computersabotage und Eindringen in Datennetze". Übrig blieb dann nur noch die Anstiftung zur Nötigung - und zahlreiche Versuche der Staatsanwaltschaft, einen Prozess zu vermeiden. "Wir wurden mit Kompromissangeboten geradezu überhäuft. So sollte das Verfahren wegen geringer Schuld gegen eine Geldbuße von 50 Euro eingestellt werden" hatte der Anwalt des Angeklagten im Vorfeld des Prozesses in einem Interview mit dem Onlinemagazin Telepolis gesagt. SPIEGEL ONLINE 04.07.05 Zurück zum »Offline-Demonstrationsrecht«. Man war z.B. schon öfters bemüht, Aufmärsche von Rechtsextremisten zu verhindern. Aber die Gerichte erlaubten die Demonstrationen meistens doch, wenn mittels eines geringeren Eingriffs in das Versammlungsrecht als durch ein Verbot, nämlich durch die Erteilung von Auflagen, Sicherungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf eingebaut werden konnten. So durfte die NPD sogar unter dem Motto "Deutschland ist größer als die Bundesrepublik" an der Grenze zu Polen demonstrieren. Immer wieder erlaubten Oberlandesgerichte Auftritte, hob das Bundesverfassungsgericht Versammlungsverbote auf. Begründung: Das Schutzgut der Versammlungs- und Meinungsfreiheit sei so wichtig, dass auch Extremisten ihre 18 Ansichten in friedlichen Demonstrationen mitteilen dürften. „Demokratie ist nichts für ängstliche Menschen“, sagte der niederländische EU-Kommissar Frits Bolkestein. Und es ist mehr als ungewiss, ob die Richter von dieser Grundposition der Meinungsfreiheit auch für Schmuddelkinder der Demokratie abgehen werden: „Kein Aufstand der Richter Der Präsident des Leipziger Bundesverwaltungsgerichtes lehnt es ab, gerichtlich NeonaziAufmärsche zu verhindern. Die Richter würden so ihre Unabhängigkeit verlieren LEIPZIG epd Der Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes, Eckart Hien, hat Forderungen nach richterlicher Zivilcourage bei Entscheidungen über Neonazi-Aufmärsche zurückgewiesen. Ein Richter gebe seine Unabhängigkeit auf, "wenn er politischen Mut in seine Entscheidungen legt", sagte Hien bei einer Diskussionsveranstaltung in der Leipziger Thomaskirche. Wenn Neonazis sich eine Stadt für Versammlungen aussuchten, zögen viele Bürgermeister vor die Verwaltungsgerichte, "nur um den Richtern letztlich den schwarzen Peter zuschieben zu können", kritisierte Hien. Zuletzt war es vor dem NPD-Bundesparteitag im thüringischen Leinefelde und Neonazi-Aufmärschen in Leipzig zu rechtlichen Auseinandersetzungen gekommen. Verwaltungsrichter seien an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes gebunden, "an denen sie nicht ständig rütteln können", sagte Hien. Das NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht habe allerdings "in einem Fiasko geendet", kritisierte der Präsident des obersten deutschen Verwaltungsgerichtes. Gerichte könnten nur Aufmärsche von verbotene Parteien oder Gruppierungen verbieten. Der Leipziger Thomaspfarrer Christian Wolff warnte vor einer "zu positivistischen Rechtshaltung". Leipzig war im Oktober vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen mit dem Vorschlag gescheitert, die Route einer Neonazi-Demonstration zu verlegen. Gegendemonstranten hatten daraufhin am 3. Oktober verhindert, dass Neonazis durch ein alternatives Stadtviertel ziehen konnten.“ (taz 10.11.04) Der vorläufig letzte Versuch, den Wirkungsbereich der insbesondere in Ostdeutschland erstarkenden Neonazis mit administrativen Mitteln zu beschränken, bestand darin, ein Verbot von Demonstrationen vorzusehen, wenn "zu erwarten ist, dass in der Versammlung nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft verharmlost oder verherrlicht wird." Verherrlichen, das ist ziemlich klar, aber ab wann wird die Strafbarkeitsschwelle des „Verharmlosens“ überschritten? Man kann nicht jeden Unsinn unter eine Strafdrohung stellen. Das lässt schon der fragmentarische Charakter des Strafrechts, der nur die schwerwiegendsten Verstöße gegen grundlegende Normen des Zusammenlebens unter Strafe stellen will, gar nicht zu. Es bestehen Probleme mit der Verfassungsmäßigkeit, wenn bereits die „Verharmlosung der NS-Gewaltherrschaft“ unter Strafe gestellt würde. Das wäre ein zu weit gefasster „offener Rechtsbegriff“. Ähnliche juristische Schwierigkeiten ergäben sich bei einer auf die Anhängerschaft der NPD zielenden Einschränkung des Demonstrations- und Versammlungsrechts. Darum regte die CDU im Bundestag an, das demokratiekonstitutive Recht der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit an ihr wichtigen Orten zu einem im Öffentlichen Recht häufig so geregelten „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ umzugestalten. Dieses juristische Konstrukt bedeutet, dass eine Sache grundsätzlich verboten ist und nach Antragsprüfung ausnahmsweise erlaubt werden kann. Damit würde eines der wichtigsten Rechte einer Demokratie oder eines der wichtigsten, unter Lebensgefahr in Anspruch genommenen Rechte eines Volkes, das um Demokratie kämpft und mit Demonstrationen schon Diktaturen zum Einsturz gebracht hat – siehe u.a. die Nelkenrevolution in Portugal, die Massenaufmärsche in Polen, der Ex-DDR und der Ukraine – zu einem Gnadenakt heruntergestuft. Das hatten wir in der Ex-DDR so, als Art. 28 Verf-DDR regelte, dass die Bürger sich ausschließlich „im Rahmen der Grundsätze und Ziele der Verfassung“ des laut Art. 1 Verf-DDR als „sozialistisch“ definierten Staates versammeln durften – und damit Versammlungen der Willkür der SEDDiktatur anheimgegeben waren. (Dazu mehr im dritten Teil des Buches.) Ein Verbot von Neonazi-Aufmärschen sollte an herausragenden Orten der Erinnerung gelten, die "an die Opfer einer organisierten menschenunwürdigen Behandlung erinnern und als nationales Symbol für diese Behandlung anzusehen sind." Die Absicht, etwas gegen die Neonazis zu tun, darf aber nicht zu einer generellen Einschränkung des Versammlungsrechts führen und auch nicht zu einer partiellen in Berlin-Mitte. Es ist schwer, unseren jüdischen Mitbürgern als Nachfahren von (fälschlich als „Holocaust“ bezeichneten) ShoaOpfern zu erklären, dass wir selbst an Orten der Erinnerung gegen die Gräuel des Nationalsozialismus wie dem „Holocaust“-Mahnmal nur mit am Grundgesetz geeichten rechtsstaatlichen Mitteln gegen rechtsextreme Provokationen vorgehen können. [Die durch Rechtsverordnung festzulegenden Orte waren unter den Parteien strittig: In Berlin sollten unstrittig das „Holocaust“-Mahnmal und das mit oder wegen des internen Streites der 19 Zigeunergruppen ohne Inschrift geplante „Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma“ – so der Wunsch des Zentralrates der deutschen Sinti und Roma - oder allgemein „Mahnmal für die ermordeten Zigeuner“ – so die Sinti-Allianz -, die sich teilweise selbst als „Zigeuner“ bezeichnen und auf jeden Fall mehr als die Gruppe der Sinti und Roma umfassen2, dazugehören; als strittig galten das Brandenburger Tor und die Neue Wache.] Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, Nickels, wandte sich gegen das Demonstrations- und Versammlungsrecht einschränkend verschärfende gesetzliche Regelungen. Ihr Argument: „Man kann eine Demokratie nicht schützen, indem man sie einschränkt.“ Der stellvertretende Chefredakteur des STERN schrieb am 03.02.05 in seinem wöchentlichen Zwischenruf aus Berlin: „Ist die NPD verfassungswidrig, muss sie nach sorgfältiger Prüfung verboten werden. Rasch. Solange das nicht geschehen ist, hat sie Anspruch auf den Schutz des Grundgesetzes und die Wahrnehmung aller Freiheitsrechte. ’Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden’: dieser Satz Rosa Luxemburgs ist nicht allein nach links gesprochen – in der Demokratie sind alle Andersdenkende. Er gilt nur dann nicht, wenn die einen die Freiheit der anderen beseitigen wollen. Die NPD aber zuzulassen und sie unterhalb eines Verbots durch Spezialgesetze als verfassungswidrig zu behandeln ist in sich verfassungswidrig und macht die Demokratie unglaubwürdig – zum Nutzen der NPD. Alle bislang präsentierten Vorschläge empfehlen solche Spezialgesetze und –regeln, die den Neonazis Argumente liefern, um die Demokratie als undemokratisch verächtlich zu machen: Ausschluss aus der Parteienfinanzierung, Einschränkung der parlamentarischen Immunität, Wortentzug im Landtag, Aufhebung der Versammlungsfreiheit auf Verdacht, Verbot von Kundgebungen an Gedenkstätten. ... All das bestätigt NPD-Wähler und lockt neue.“ Mit der dann umgesetzten Gesetzesinitiative zur Verschärfung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts sollte der von der NPD angekündigte und angemeldete Marsch durch das Brandenburger Tor am 08.05.05, dem 60. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands, verhindert werden. Sollten die Neonazis am Abend des 60. Jahrestages der bedingungslosen Kapitulation - eventuell mit einem Fackelzug - in Marschkolonne durch das Brandenburger Tor ziehen, wie sie im Jahre 2000 dort schon marschiert sind, würde das fatal an den Fackelzug der Nazis durch das Brandenburger Tor erinnern, mit dem sie die „Machtergreifung“ und dann an jedem Jahrestag den Beginn der NS-Diktatur am 30.01.1933 gefeiert hatten. Das würde auch im Ausland obwohl sich in praktisch jeder freien Gesellschaft an beiden politischen Rändern Extremisten in nicht ganz unerheblichen Prozentsätzen von in etwa 5-15 % tummeln - auf Grund der Belastung unserer Geschichte mit dem unter der Naziführung begangenen größten Menschheitsverbrechen der in eigens dafür konstruierten Hochleistungskrematorien industriell betriebenen Massenvergasung und anschließenden Verbrennung aller europäischer Juden, derer man habhaft werden konnte, wenn man es nicht vorzog, die Kräftigsten durch Schwerstarbeit unter Kalorienentzug durch Sklavenarbeit umzubringen, beklemmende Erinnerungen wecken! Deswegen versuchten demokratische Kräfte im Vorfeld der parlamentarischen Arbeit, ihrerseits eine Demonstration am Brandenburger Tor anzumelden, damit dann die Neonazis wegen der Vergabe des Platzes am Jahrestag der Kapitulation Großdeutschlands keine Demonstrationserlaubnis erhalten könnten. Die NPD scheiterte vor dem BVerfG mit ihrem Antrag, ihren Demonstrationszug gegen den "Schuldkult" und gegen die "Befreiungslüge" am 60. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands durch das Brandenburger Tor hindurch und am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas entlang durchführen zu dürfen. Es wurde ihr nur eine nicht so »geschichtsträchtige« Ersatzstrecke vom Alexanderplatz zum Bahnhof Friedrichstraße zugebilligt. Diese Ersatzstrecke war dann zusätzlich von mindestens einer vierfachen Menge von Gegendemonstranten blockiert worden. Die Umstände der blockierten Demonstration ließ Juristen aus grundgesetzlichen Erwägungen heraus die Einhaltung und Durchsetzung des Demonstrationsrechts fordern. Das Argument: Das Vorgehen der Polizei und der Gegendemonstranten sei "klar rechtswidrig" gewesen. Eine Demonstration, die genehmigt ist, müsse 2 Um den Bau des Mahnmals voranzubringen, hatten sich die Kulturpolitiker der Bundestagsfraktionen im November 2004 auf den Satz geeinigt: "Wir gedenken aller Kinder, Frauen und Männer, die von den Nationalsozialisten in ihrem menschenverachtenden Rassenwahn als Zigeuner in Deutschland und Europa verfolgt und ermordet wurden." "Der Begriff Zigeuner ist eine Beleidigung und Diffamierung für unsere Minderheit", argumentierte dagegen der Vorsitzende des Zentralrates der Sinti und Roma, Rose, der das Problem wohl ähnlich sieht, wie die Inuits die Bezeichnung „Eskimo“ als abwertend empfinden. "Der Rechtsstaat muss akzeptieren, dass wir uns als Sinti und Roma verstehen." Rose betonte, das Denkmal erfülle nur dann einen Zweck, wenn man sich über die Inschrift einigen könne. Rose beharrt weiter auf einem Zitat des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog. Darin heißt es: "Der Völkermord an Roma und Sinti ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt worden wie bei den Juden." Die in Köln ansässige Sinti-Allianz sprach sich gegen das Herzog-Zitat und für den Begriff "Zigeuner" in der Inschrift aus, weil der Begriff „Zigeuner“ umfassender sei und bei einer Verwendung von „Sinti und Roma“ Teile der Opfergruppe Zigeuner unberechtigt ausgegrenzt würden. Dazu fiel Rose dann kein Gegenargument mehr ein! 20 stattfinden können. Wegen des Gewaltmonopols des Staates unterliege die Polizei der Verpflichtung, alle Hindernisse auf der vorgeschriebenen Strecke aus dem Weg zu räumen. "Ihr steht heute hier für die Nazis", beschimpfte eine Frau aus dem Kreis der autonomen Gegendemonstranten am Hackeschen Markt die Polizisten: "Haut einfach ab." Doch das Demonstrations- und Versammlungsrecht gilt nicht nur für »die Guten«. Es kann nicht in das Belieben einer mehr oder minder zufälligen Mehrheit oder gewaltbereiten Minderheit gestellt werden, ob das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrgenommen werden kann! Und rechtlich äußerst bedenklich ist es, wenn die Verbraucherschutzministerin Renate Künast (Grüne) als ausgebildete Juristin den Festbesuchern zu einem "lockeren Spaziergang" zur Brücke neben dem Dom riet, um dort die Demo-Route der NPD zu blockieren: "Wir sind viele, wir sind viel mehr, und wir sind stark", sagte Künast. Die Polizei hätte mit Verweis auf die Rechtswidrigkeit der Demonstrationsbehinderung die Gegendemonstranten zum Verlassen der Straße auffordern müssen, bei deren Weigerung die Personalien der behindernden Gegendemonstranten aufnehmen, diese mit einer Polizeikette von der Straße drängen und notfalls sogar, wenn das alles nicht geholfen hätte, als letztes Mittel Gewalt anwenden müssen. Sie hätte nicht den rechtswidrig handelnden Gegendemonstranten von vornherein einen Freibrief ausstellen dürfen, indem sie vor Demonstrationsbeginn verlauten ließ, bei einer friedlichen Blockade würde sie nicht mit Gewalt einschreiten. Szenen wie eine Woche zuvor in Leipzig, wo linke Gegendemonstranten von der Straße gespritzt worden waren, wollte die politische Führung Berlins unter den Augen der Weltöffentlichkeit am 8. Mai vermeiden. Doch gut gemeinte Deeskalationsmaßnahmen dürfen nicht so weit gehen, dass durch sie das demokratierelevante Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit außer Kraft gesetzt wird! Der Berliner Polizeipräsident liegt falsch mit seiner Entschuldigung, wenn er vorbringt: "Das geltende Recht läßt nicht zu, dass wir einen Aufzug durchprügeln." Wer weiß, ob es überhaupt dazu gekommen wäre, wenn die Polizei von vornherein klargestellt hätte, dass sie – wie es ihres Amtes ist! - dem Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit Geltung verschaffen werde! Das Verhalten der Berliner Polizeiführung provoziert geradezu die Frage nach dem umgekehrten Fall: "Wie würde die Diskussion aussehen, wenn 2.000 NPD-Anhänger eine genehmigte Demonstration von friedlichen Bürgern blockiert hätten und die Polizei nicht eingeschritten wäre?" Es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel und zeigt, wenn man solcherart »Nadelstich-Demonstrationen« der Rechtsextremisten nicht glaubt ertragen zu können, die Notwendigkeit auf, das Problem so grundsätzlich zu regeln, dass demokratische Kräfte nicht für jeden Tag des Jahres und jede Stunde eine Demonstration am Brandenburger Tor anmelden müssen, damit die Neonazis als Bewahrer des Gedankengutes der braunen Faschisten nicht einen Fuß in das Tor stellen können; denn das Brandenburger Tor zu schließen geht ja auch nicht, nachdem man jahrzehntelang unter der Parole: „Macht das Tor auf!“ gegen die roten Faschisten der SEDDiktatur und ihren Mauerbau demonstriert hatte und in dieser Forderung direkt vor dem Brandenburger Tor von u.a. us-amerikanischen Präsidenten unterstützt worden war. Würde das Problem durch ein Demonstrationsverbot am Brandenburger Tor durch z.B. die Ausweitung des um das Reichstagsgebäude geltenden befriedeten Bezirks geregelt, würde die Funktionsfähigkeit des Parlamentes nur zu dessen Sitzungszeiten geschützt; an sitzungsfreien Tagen könnte aber gleichwohl dort demonstriert werden. Die Ausweitung des befriedeten Bezirks wäre nur eine Verlegenheitslösung, denn am vom Parlament schon etwas entfernteren Brandenburger Tor schütze man nicht die Funktionsfähigkeit des Bundestages, was ja der Sinn eines befriedeten Bezirkes ist. Au0erdem könnten demokratische Kräfte auch nicht mehr zu besonderem Anlass dort demonstrieren, und das will man natürlich nicht unterbinden, denn kein Bauwerk symbolisiert die wechselvolle insbesondere neuere deutsche Geschichte mehr als das von 1788-91 nach den Plänen von Langhans erbaute, im Zuge der napoleonischen Kriege nach der Niederwerfung Preußens 1807 von den Franzosen geraubte, nach dem Sieg über Napoleon 1814 dann wieder zurückgeholte, im Zweiten Weltkrieg durch die Rote Armee eroberte und 1958 zur Beseitigung der Kriegsschäden nach erhalten gebliebenen Gipsabgüssen wiederhergestellte Brandenburger Tor. Bleibt, wenn man es so will, rechtlich nur die inhaltliche Beschränkung der Demonstrationsfreiheit, wenn "zu erwarten ist, dass in der Versammlung nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft verharmlost oder verherrlicht (werden) wird." Auf die Schwierigkeit mit dem offenen Rechtsbegriff „verharmlosen“ war schon eingegangen worden. Hinzu kommt, dass man das im Genehmigungsverfahren für die beantragte Demonstration nicht im Vornherein zweifelsfrei prognostizieren kann. Zur bestimmt nicht nur in Deutschland wahrgenommenen gesellschaftspolitischen Provokation unseres politischen, bei den Neonazis „verhassten Systems“ durch »Nadelstich-Demonstrationen« genügt es außerdem ja schon, dass NPDler unter mit NPD-Emblem versehenen nicht verbotenen schwarz-weiß-roten Fahnen durch das Brandenburger Tor marschieren. Denn gleich nach der „Machtergreifung“ war auf Betreiben der Nazis vom Reichspräsidenten von Hindenburg entgegen dem nicht misszuverstehenden Wortlaut des Art. 3 1 WV „Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold.“ 21 durch die sogenannte Flaggenverordnung (zur Einbindung der republikfeindlichen kaiserlich-konservativen Kräfte des gerade erst untergegangenen Kaiserreiches) neben die Hakenkreuzflagge (als Flagge der unter die Herrschaft der Nazis geratenen Weimarer Republik) die schwarz-weiß-rote Flagge des untergegangenen deutschen Kaiserreiches3 gesetzt worden. Bei offiziellen Anlässen der Nazis wurde nur noch die Hakenkreuzflagge gehisst oder schwarz-weiß-rot geflaggt. Auf jeden Fall wurden aber nicht mehr die schwarzrot-goldenen Reichsfarben der von den Nazis so beschimpften „Judenrepublik“ gezeigt. Da muss heutigen Tages nicht erst noch expressis verbis eine Verherrlichung verbalisiert werden, wenn NPDler mit schwarz-weiß-roten Fahnen durchs Brandenburger Tor marschieren; es genügt, allein durch schwarz-weiß-rote Fahnen die NaziHerrschaft nur indirekt verherrlichend zu visualisieren! Die Gerichte werden, wenn die geistigen Nachfolger der den Zweiten Weltkrieg entfacht habenden Nazis so tun, als wären sie keine Neonazis, wegen der demokratiekonstitutiven Bedeutung des Versammlungsrechts den Demonstrationszug aus grundsätzlichen und grundgesetzlichen Erwägungen heraus trotzdem genehmigen, ohne die mit dem NPD-Emblem versehenen schwarz-weiß-roten Fahnen zu verbieten; höchstens die ähnlich gestaltet gewesene Vorlage der NPD-Fahnen, die von den Neonazis gern verwandte „Reichs-Kriegsflagge“, wird als einschränkende Demonstrationsauflage verboten werden. Die NPD ist eine Partei, deren sich selbst als „nationalrevolutionär“ bezeichnender Vorsitzender u.a. gesagt hat: „Das Holocaust-Denkmal in Berlin eignet sich vorzüglich als Fundament für einen Neubau der Reichskanzlei!“, der im Zusammenschlagen von „Linken“ im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf 2005 nicht mehr als eine „Abwehrmaßnahme“ zu sehen vermochte. Der dortige Fraktionschef im sächsischen Landtag gab nach der für die Neonazis triumphalen Wahl 2004 Äußerungen zum Schlechtesten wie: „Uns hat gewählt, wer noch Deutscher bleiben will.“ Und über 90 % der Wahlberechtigten, die zu Hause geblieben sind oder andere Parteien gewählt haben, wollen keine Deutschen mehr sein? Wie kommen solche Leute dazu, Mitbürgern deren Willen, sich als Deutscher zu sehen und zu fühlen, abzusprechen? Er sprach im sächsischen Landtag in Dresden vom „Bomben-Holocaust“ auf diese Stadt, als die Alliierten in einer auch heute noch und selbst in Großbritannien in ihrer Notwendigkeit zumindest umstrittenen Kriegsmaßnahme4 das mit Flüchtlingen aus dem Osten völlig überbelegte Dresden am 13./14.02.45 in Schutt und Asche gelegt hatten, wobei schätzungsweise 23.000-35.000 Menschen den Tod gefunden haben. Und legte damit geschickt den Finger in eine Wunde: Da es das vorrangige Ziel der alliierten Bombenangriffe war, möglichst viele Deutsche zu töten und nicht so sehr, kriegswichtige Anlagen außer Betrieb zu setzen oder gar hunderttausende Menschenleben zu retten, indem z.B. Auschwitz und andere Vernichtungslager, über deren Funktion die Alliierten u.a. durch die Kurie genau unterrichtet gewesen waren, und die dorthin führenden Eisenbahnstrecken bombardiert worden wären – die Bomber flogen über Auschwitz hinweg, ohne es anzugreifen, was relativ gefahrlos möglich gewesen wäre, da dort keine deutsche Flugabwehr zum Schutz kriegwichtiger Anlagen stationiert gewesen war -, ist der Angriff auf Dresden wohl eher als kleines Hiroshima zur Brechung des Durchhaltewillens der Bevölkerung zu werten. Mit der sprachlichen Gleichsetzung durch die Verwendung des Wortes „Holocaust“ versuchte er eine Gleichsetzung der von den Alliierten als Mittel der Kriegsführung eingesetzten Flächenbombardierung in einem ihnen von der Nazi-Führung Deutschlands aufgezwungenen Krieg mit einem von den Nazis als vorrangiges Ziel ihrer Herrschaft angesehenen ideologischen Zweck zu erreichen – und versuchte so bewusst zu vernebeln, dass Dresden ein (unverhältnismäßig eingesetztes?) Mittel der Verteidigung gewesen war, die Shoa aber ein ideologischer Zweck! Das betont auch der britische Historiker Taylor, wenn er in einem im SPIEGEL vom 13.02.05 abgedruckten Interview u.a. sagt: „Alle Seiten bombardierten im Krieg die Städte des anderen. Eine halbe Million Sowjetbürger starben in den Bombenangriffen der Deutschen, während der Invasion und der Besetzung Russlands. Das entspricht ungefähr der Anzahl der Deutschen, die bei den Angriffen der Alliierten umkamen. Aber die Bombardierungen hingen mit militärischen Operationen zusammen und endeten, sobald diese Operationen endeten. Der Holocaust und die Ermordung all dieser Millionen von Menschen, die die Nazis so sehr hassten, dass sie sie umbringen wollten, hätten jedoch nicht geendet, wenn die Deutschen den Krieg 3 4 Hindenburg hatte nach der „Machtergreifung“ am 30.01.1933 am 12.03.1933 eine Flaggenverordnung erlassen, die bestimmte, dass entgegen Art. 3 WV, der als alleinige Farben der Reichsflagge „schwarz-rot-gold“ angeordnet hatte, die ihm vertrautere schwarz-weiß-rote des ehemaligen Kaiserreiches und – als politische Gegenleistung an die Nazis - die Hakenkreuz-Flagge der Nazis als gleichberechtigte Reichsflaggen verwendet werden dürften. Damit war Art. 3 WV auf dem Verordnungsweg praktisch abgeschafft. Näheres über die Hintergründe hierzu im II. Teil des Buches unter dem Gliederungspunkt 5.1 Das britische Unwohlsein kommt zum Ausdruck in Churchills Memorandum vom 28. März 1945 an General Ismay, den Vorsitzenden des britischen Generalstabs, in dem der Premier schrieb: "Der Moment scheint mir gekommen, wo die Frage der Bombardierung deutscher Städte einfach zum Zwecke der Erhöhung des Terrors, auch wenn wir andere Vorwände nennen, überprüft werden sollte. Die Zerstörung Dresdens bleibt eine ernste Frage an die alliierte Bombardierungspolitik." (DIE WELT 12.02.05) 22 gewonnen hätten. Bombenangriffe sind eine rücksichtslose Form der Kriegsführung, aber das Wort Holocaust zu benutzen, um einen Krieg als unbarmherzig zu beschreiben, heißt zwei vollkommen verschiedene Dinge zu verwechseln. ... Auf die eigene Opferrolle zu schauen und Deutschlands unprovozierten aggressiven Krieg gegen den Rest Europas und die Aspekte des Völkermords dieses Kriegs auszublenden, kann überhaupt nichts Gutes bewirken.“ Die Ziele der Rechtsradikalen werden deutlich, wenn sie »ungeschützt« vom Leder ziehen, wie ein als ehemaliger(?) Rädelsführer der inzwischen verbotenen Schlägertruppe „Skinheads Sächsische Schweiz“ (SSS) wegen schweren Landfriedensbruchs, Bildung einer kriminellen Vereinigung, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung durch u.a. Training seiner Gefolgsleute für Übergriffe auf Einzelpersonen und die Erstürmung von Gebäuden, systematische Computererfassung der erkorenen politischen Feinde und maskierte brutale Überfälle mit einer Bewährungsstrafe zu zwei Jahren Haft verurteiltes NPD-Mitglied – Kommentar zu dem Urteil: „Meine Freunde und ich haben nur unsere Freizeit nach den eigenen Vorstellungen gestaltet!“ -, das mit seinem Schlägertrupp auf NPD-Veranstaltungen als Saalschutz tätig gewesen war und sich in der Öffentlichkeit nicht so zurückhaltend äußern muss, wie es die Parteiführung aus taktischen Gründen für angeraten erachtet, zum STERN (27.01.05): „Die rechte Bewegung steht generell für eine andere Gesellschaftsform. Deshalb bringen auch Gespräche mit anderen demokratischen Institutionen nichts. Es wird nie einen Konsens geben. Wenn man nationaler Sozialist ist, dann ist die Gesinnung schlicht nicht zu vereinen mit der Demokratie. Ich kenne viele NPDler seit Jahren, auch höhere wie den [Abgeordneten des Sächsischen Landtags und Parlamentarischen Geschäftsführer seiner Fraktion; der Verf.] Leichsenring5. Die sind nicht weichgespült. Die denken genau wie ich. Wir wollen ein anderes Land.“ Und was wollen wir Demokraten? So hat sich die Pest des Nationalsozialismus schon einmal ausgebreitet, nach dessen Niederringung ca. 6 Millionen Menschen in Vernichtungslagern und anderweitig umgebracht worden waren, ca. 50 Millionen Menschen im von den Nazis angezettelten Zweiten Weltkrieg ihr Leben hatten lassen müssen, Millionen andere auf der ganzen Welt vertrieben worden waren und Deutschland mit den Ostgebieten von der Oder-Neiße-Linie „bis an die Memel“ mehr als ein Viertel seines Staatsgebietes verloren hatte! Wenn man die ständig Grenzen auslotenden Provokationen der Neonazis ertragen kann, sollte man sie besser leer laufen lassen, indem man aufzeigt, dass sie außer „Ausländer raus!“ keine Lösungskompetenz zur Bewältigung der notwendigen und sehr komplexen Umstrukturierungsmaßnahmen unserer Gesellschaft anzubieten haben, anstatt in einen kurzatmigen gesetzgeberischen Aktionismus zu verfallen! In den USA wird das Recht der Meinungs- und Versammlungsfreiheit als so konstitutiv für eine demokratische Staatsform erachtet, dass die us-amerikanischen Nazis sich in Nazi-Uniformen und mit Hakenkreuzbinde am Arm versammeln und demonstrieren dürfen! Und das bei der ungemein starken gesellschaftlichen Stellung, die die jüdischen Interessensverbände in den USA traditionell innehaben! In den USA werden viel weniger »Gesinnungsgesetze« erlassen, weil es einen verbreiteteren, als Kitt in der Gesellschaft wirkenden „common sense“ darüber gibt, wie die gesellschaftlichen Bezüge organisiert sein müssen, damit die Gesellschaft idealtypisch als Gesellschaft freier Bürger funktioniert: Ungehinderte Rede-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit gehören unabdingbar dazu; auch wenn sehr oft gegen diese Prämissen verstoßen wurde, z.B. als selbst in dem Land der Demokratie, den USA, McCarthy seine hysterische Kommunistenhatz als Teufelsaustreibungskampagnen inszeniert hatte oder Martin Luther King hauptsächlich in den Südstaaten, wo es ging, Steine in den Weg gelegt worden waren, damit er nicht auf den Bürgerrechtsveranstaltungen sprechen konnte, wo die Afro-Amerikaner von der Polizei niedergeknüppelt oder vom Ku Klux Klan gelyncht worden waren, wenn sie auch für die Farbigen Menschen- und Bürgerrechte einforderten. So etwas miterleben zu müssen, brachte den Satiriker Oscar Wild zu dem bitterbösen Satz: „Demokratie ist nichts anderes als das Niederknüppeln des Volkes durch das Volk für das Volk.“ Die Wichtigkeit des Versammlungsrechts für jede Staatsform, insbesondere aber für eine (bürgerliche) Demokratie, haben wir in unserer eigenen allerjüngsten Geschichte erfahren: Dass Demonstrationen selbst ein diktatorisches, von Geheimdienst, Polizei und Millitär geschütztes Regime zum Einsturz bringen können, wenn die Zeit reif dafür ist und die Massenkundgebungen so mächtig sind, dass nicht mehr Einzelne zur 5 Der Parlamentarische Geschäftsführer der NPD-Fraktion im sächsischen Landtag, NPD-Kreisgeschäftsführer und Stadtrat, Uwe Leichsenring, hielt stets engen Kontakt zu den Skinheads Sächsisch Schweiz (SSS). Die Justiz leide seiner Meinung nach unter Verfolgungswahn und drangsaliere Bürger "vielleicht nur deshalb, weil sie von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht haben". 23 Einschüchterung der demonstrierenden Massen herausgegriffen werden können, haben wir 1989 erleben dürfen, als die Ostdeutschen durch die Leipziger Montagsdemonstrationen ihre Freiheit von der SED-Diktatur erkämpften, weil »der Große Bruder« UdSSR das Regime nicht mehr – wie bei der Niederschlagung des Aufstandes vom 17. Juni 1953 – stützte. Und in der Ukraine, um einen weiteren europäischen Staat zu nennen, war es nicht anders. Natürlich sind Versammlungen unter freiem Himmel meist mit Belästigungen Dritter verbunden: Wenn sich ein möglichst aufgebauschter und durch große Zwischenräume möglichst in die Länge gezogener Demonstrationszug zu einem die Gesellschaft insgesamt nur marginal tangierenden Thema zur Rush-Hour durch die eine innenstädtische Verkehrspulsader quält und durch diesen Stau die Autofahrer und die Teilnehmer am Öffentlichen Nahverkehr gehindert werden, ihr Fahrtziel schnellst möglich zu erreichen, dann bekommt schon mancher der in seiner Bewegungsfreiheit Eingeschränkten einen »dicken Hals«! Die mit der Ausübung des körperlich wahrgenommenen Demonstrationsrechts meist einhergehenden Behinderungen müssen Dritte aber, so lange keine unmittelbare Gefährdung anderer gleichwertiger Rechtsgüter gegeben ist, wegen dessen überragender, demokratiekonstitutiver Bedeutung ertragen (lernen). Dabei hat natürlich die Bundeshauptstadt Berlin die Hauptlast zu tragen: 3.000 Demonstrationen pro Jahr, im Mittelwert neun pro Tag! Da entsteht auf der Seite der Exekutive das Bedürfnis, engere Grenzen ziehen zu dürfen. In Zukunft sollen nach ihren Vorstellungen extremistische Versammlungen leichter verboten sowie Aufmärsche von Extremisten vor Orten mit Symbolwirkung und nationaler Bedeutung verhindert werden, die dort die menschenunwürdige Behandlung der Opfer billigen, leugnen oder verharmlosen: zum Beispiel vor dem Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Zudem sollen Anhänger radikaler islamischer und arabischer Organisationen nicht mehr offen im Stadtbild ihre Sympathie für Terroristen und terroristische Anschläge bekunden dürfen, wie es z.B. ein Araber machte, der seine zweijährige Tochter als Selbstmordattentäterin mit Bombengürtel verkleidet auf eine Demonstration mitgenommen hatte. Schließlich will der Bundesminister des Inneren Demonstrationen auch dann einschränken und verbieten können, wenn keine strafbare Verletzung der öffentlichen Sicherheit droht, aber die Gefahr einer Verunglimpfung besteht. Der Berliner Innensenator geht noch weiter. Er will bei der Genehmigung auch Interessen von Anwohnern und Geschäftsleuten stärker berücksichtigen. Es müssten seiner Meinung nach sowohl "die persönliche Freiheit des Einzelnen, als auch die Interessen Dritter stärker in den Abwägungsprozess einbezogen werden." Ihm geht es darum zu verhindern, dass bei Demonstrationen die Innenstadt lahm gelegt werden kann. Der Senator will deshalb verfeinerte Möglichkeiten schaffen, Demonstrationen zu kanalisieren, nach dem Motto: "Ihr seid nur 30 Leute, Ihr dürft nur auf dem Bürgersteig demonstrieren". Diese Arbeit des überschlägigen rechtlichen Bewertens von sich andeutenden gesellschaftlichen Entwicklungen ist ständig, vielleicht sogar täglich zu leisten. Um es an einem aktuellen Beispiel deutlich zu machen: Am 21.03.2000 berichteten Nachrichten in Rundfunk und Zeitungen, dass die Regierung in Großbritannien den Lebensversicherungen die Befugnis einräumen wolle, von den potenziellen Versicherungsnehmern - den Bürgern, die das Todesfall- und eventuell auch das Berufsunfähigkeitsrisiko abgesichert haben möchten - einen »vorhersagenden Gentest« zu verlangen. Am 12.03.01 wurde berichtet, Krankenkassen sei in Großbritannien der Zugriff auf Gentests gestattet. Das ermöglicht den biologisch »gläsernen Menschen«! Insbesondere dann, wenn Biochips, mit denen irgendwann einmal das gesamte menschliche Erbgut in einem Schritt analysiert werden könnte, Realität werden sollten. Die technische Entwicklung wird so verlaufen, dass man mit sehr schnellen und präzisen Methoden das gesamte Genom eines Menschen analysieren, auf eine CD pressen und mit sich herumtragen können wird, so dass auf der Gesundheitskarte eines Chipkartenbesitzers sein gesamtes Genprofil stehen wird – wenn man auf sein Recht auf Nichtwissen verzichtet. Job in naher Zukunft nur noch nach Gentest? Zu unserem Glück sprachen sich in der Bundesrepublik gesellschaftliche Gruppen, insbesondere die Ärztekammern, als Schutz vor dadurch möglicher »GenDiskriminierung« durch Selektion, wie sie in den USA schon anzutreffen ist und in der BRD die Erstellung der ersten genetische Diskriminierungsstudie an der Universität Frankfurt veranlasste, gegen einen solchen tiefen Einschnitt in unser Persönlichkeitsrecht aus. Als Ergebnis einer kurzen öffentlichen Diskussion verzichteten auf Grund einer bis 2011 geltenden Selbstverpflichtung die deutschen Lebensversicherungsunternehmen auf die Vorlage von Gentestzeugnissen. Bereits vorliegende Testergebnisse müssen allerdings bei sehr hohen Lebensversicherungen mit Gesamtsummen von mehr als 250.000 Euro oder Jahreszahlungen über 30.000 Euro mitgeteilt werden. Eine über 2011 hinausgehende Selbstverpflichtung, eine unbefristete gesetzliche Regulierung oder gar ein gesetzliches Verbot der Forderung nach Vorlage eines Gentests vor Antragsannahme lehnen die Versicherungen aber ab, weil sonst, so der Branchenverband GDV, die Gefahr bestünde, dass "zukünftig zwischen Versicherungsnehmern und Versicherern keine Wissensgleichheit mehr besteht": wer um ein in absehbarer Zeit sich tödlich auswirkendes Gen in seinem Körper weiß, könnte aus verständlicher Sorge für ihm 24 nahestehende Personen zu deren Absicherung eine Lebensversicherung mit einer hohen Laufzeit und dadurch sehr niedrigen Prämien abschließen, wohlwissend, dass er das Ende der vertraglich vereinbarten Laufzeit mit Sicherheit nicht erleben werde und die Versicherung an die Begünstigten zahlen müsse. Die Position »Kein Gentest zur Erlangung einer Tätigkeit« wird sich jedoch nicht bruchlos durchhalten lassen. So kann z.B. die genetisch bedingte Rot-Grün-Blindheit getestet werden. Und das ist u.a. für die Ausbildung von Piloten wichtig. Aber diese Wahrnehmungsbehinderung kann ja auch durch einen Farbtafeltest ermittelt werden; wenn ein gefährdeter Pilot nicht die verdeckt dargestellten Zahlen auswendig lernt, um noch einmal glatt durch den Gesundheitschek durchzurutschen und weiter fliegen zu können. Wir hier mussten also zunächst nicht auf die Barrikaden gehen. Aber die Briten sollten es schleunigst tun, bevor die Entscheidung gefallen ist, damit sie nicht auch solche Zustände erhalten, wie sie in den USA inzwischen schon angebrochen sind, denn am 15.11.01 veröffentlichte der STERN ein Interview mit dem 96-jährigen Biochemiker Erwin Chargaff, einem der »Väter der Gentechnologie«, in dessen Verlauf zur Sprache kam: „Vor kurzem wurde eine Studentin an einer US-Elite-Universität abgelehnt. Sie hatte alle Aufnahmetests bestanden, und sie war gesund. Der Gentest aber wies eine Veranlagung für eine tödliche Krankheit aus. Das aufwendige Studium, meinte dann die Uni, lohne sich nicht für sie.“ Ähnlich erging es nach Aussage des hessischen Datenschutzbeauftragten Simitis in Deutschland Bewerbern um eine Lehrstelle und in Hessen einer angehenden Lehrerin, die der hessische Staat nicht hatte verbeamten wollte: Mit dem Hinweis auf die genetisch bedingte Erbkrankheit Chorea Huntington (= Veitstanz) in der Familie war 2004 dort die Verbeamtungen der damals 35-jährigen Lehrerin abgelehnt worden und es wurde von ihr verlangt, durch einen differenzierten Gentest nachzuweisen, dass die Disposition für diese Erbschädigung bei ihr nicht vorläge. Bei diesem auf einen einzigen Gendefekt zurückführbaren monogenen Nervenleiden - an einer bestimmten Stelle des Chromosoms 4 wird die Buchstabensequenz CAG öfter als 40-mal wiederholt - bedeutet schon eine einzige schadhafte Genkopie, dass die Krankheit mit absoluter Sicherheit ausbrechen und der Patient vorzeitig sterben wird. Die Pädagogin klagte vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt und gewann - allerdings mit dem Hinweis, ihre Erkrankung sei mit einer Chance von 50 Prozent ja "nicht überwiegend wahrscheinlich". [Bislang sind rund 5.000 monogene Krankheiten bekannt, bei denen aber, wie bei der Eisenspeicherkrankheit (Hämochromatose), der Genfaktor nur ein Faktor unter mehreren ist und zum Ausbruch der Krankheit führen kann. Von den bisher bekannten monogenen Krankheiten weisen rund 600 eine größere Verbreitung auf, unter denen der Veitstanz besonders herausragt.] Nicht jeder Betroffene weiß um seine irgendwie geartete Genschädigung. Doch jeder muss das Recht auf eigenes Nichtwissen haben und sich darum nicht im Interesse einer Anstellung einer solchen Zumutung eines potentiellen Arbeitgebers unterziehen müssen, um auf diesem Wege ungewollt das Wissen um eine bei ihm oder ihr irgendwann ausbrechende Krankheit aufgedrängt zu bekommen. Das sind gravierende Verstöße gegen die informationelle Selbstbestimmung. Darum wurde der hessische Staat im Fall einer 35-jährigen Lehrerin, die wegen erblicher Genbelastung nicht verbeamtet werden sollte, durch Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt zum Beidrehen gezwungen. Solch eine gefährliche Entwicklung muss ganz dringlich gestoppt werden! Darin müssen wir uns alle einig sein! Diese Bedeutung darf der Molekulargenetik nicht zugewiesen werden! Kein privater oder staatlicher Arbeitgeber darf das potentielle genetische Risiko eines Bewerbers mit einem Gentest untersuchen lassen, sondern muss zur Eignungsüberprüfung Verfahren verwenden, die ausschließlich eine tatsächlich vorliegende Funktionsstörung feststellen können. Die neue Vorsitzende des Nationalen Ethikrates, Kristiane Weber-Hassemer, hat zu Amtsantritt 2005 vor den Risiken einer Ausweitung der Gendiagnostik gewarnt: „Die Risiken einer Ausweitung der Gendiagnostik liegen auf der Hand. Natürlich gibt es hier in der Wirtschaft enormen Appetit. Im Arbeitsrecht hat aber die Gendiagnostik wie auch die übrige prädiktive Diagnostik im Zweifel nichts zu suchen. Diesem Appetit also gilt es zu begegnen. Dabei sind gesetzliche Regelungen unerläßlich. Den gläsernen Menschen darf es einfach nicht geben. Mit Forschungsfeindlichkeit hat das nichts zu tun“ (DIE WELT 28.06.05). Nach dem vom Gesundheitsministerium erarbeiteten Entwurf des Gendiagnostikgesetzes sollen allerdings Gentests "bei bestimmten gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten" erlaubt werden. Auch soll der Arbeitgeber fragen dürfen, ob bei einem vorhergehenden Gentest "die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit festgestellt worden ist". Nach dem Amtsverzicht unserer vorherigen Gesundheitsministerin 2001 bestand auch für uns die Gefahr der Gen-Ausforschung für Versicherungszwecke, denn deren Nachfolgerin kündigte an, die Frage der Eröffnung von Gentests für Lebensversicherungen noch einmal überprüfen zu wollen! Aber was bedeutet das für den möglicherweise Betroffenen? Zum Beispiel wird die genetisch bedingte Krankheit »Chorea Huntington« mit 50- 25 prozentiger Wahrscheinlichkeit vererbt. Dieser dominant erbliche Veitstanz bricht üblicherweise zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr aus. Wenn nun ein Elternteil an dieser Krankheit leidet oder gestorben ist, dürfen dann Krankenkassen und andere Versicherungen die Nachkommen zu einem Gentest zwingen? „Keine Gentests vor Verträgen Berlin – Die deutschen Versicherer verzichten darauf, Gentests als Voraussetzung für einen Vertragsabschluß durchzuführen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDW) legte jetzt nach eigenen Angaben eine entsprechende Selbstverpflichtung vor. Gentests zur Diagnose bestehender Krankheiten sind in der Medizin selbstverständlich. Bei sogenannten prädikativen Gentests, die Aussagen zum Ausbruch von Krankheiten noch gesunder Menschen ermöglichen, hatte es im Zusammenhang mit Versicherungsverträgen jedoch Befürchtungen gegeben, dass belastete Personen nicht mehr versichert würden. Die freiwillige Selbstverpflichtung gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2006.“ (HH A 08.11.01) Und dann? Der Staat geht da auf der Basis des Beamtenrechts mit seinen weitgehenden Verpflichtungen für sich selbst als Dienstherrn schon radikaler vor: „Geisel der eigenen Gene Eine gesunde Lehrerin aus Hessen wird nicht verbeamtet, weil ihr Vater an der Erbkrankheit Chorea Huntington leidet. Nun fühlt sich sie sich von den Behörden zu einem Gentest genötigt. Sie wollte eine Anstellung auf Lebenszeit. Stattdessen bekam sie einen Brief, in dem ihr mitgeteilt wurde, wie lange sie wohl noch zu leben hat. ’In den nächsten zehn Jahren’ werde die tödliche krankheit mit ’erhöhter Wahrscheinlichkeit’ ausbrechen, schrieb die Amtsärztin der jungen Frau: ’Sie werden voraussichtlich nicht bis zum 65. Lebensjahr arbeiten können.’ ... Die Lehrerin ... trägt unbestreitbar ein hohes genetisches Risiko in sich. Ihr Vater ist an Chorea Huntington erkrankt, einer Nervenkrankheit, die auch unter dem volkstümlichen Namen Veitstanz bekannt ist. Der Verlauf ist grausam: Die Hirnmasse schwindet. Der Körper gehorcht nicht mehr dem Willen, das Wesen des Erkrankten verändert sich. Viele Huntington-Patienten werden jähzornig, sind geplagt von Angstzuständen, ehe sie in völlige geistige Umnachtung fallen. Am Ende steht immer ein früher Tod. Nicht nur die Symptome sind teuflisch, sondern auch die Vererbung: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent geht das defekte Gen von einem kranken Elternteil auf das Kind über – egal, ob es ein Mädchen oder Junge ist. Hätte sie tatsächlich auf dem vierten Chromosom das schadhafte Gen, wäre das Schicksal der jungen Lehrerin schon bei ihrer Zeugung besiegelt worden. So ist sie zur Geisel ihrer eigenen Gene geworden. Gewissheit darüber, ob sie an Huntington erkranken wird oder nicht, könnte ihr allenfalls ein Gentest verschaffen. Fällt er negativ aus, stünde auch der Verbeamtung nichts mehr im Wege. Was aber, wenn das Ergebnis positiv ist? Genau wegen dieses Dilemmas ist in der Biomedizin-Konvention des Europarats ein ’Recht auf Nichtwissen’ über die eigene genetische Bestimmung festgeschrieben. Niemand darf zu einem Gentest gezwungen werden. Das ist auch im hessischen Fall nicht geschehen. Doch indirekt übt der Verwaltungsbescheid sehr wohl Druck auf die Kandidatin aus, zur Erbgutanalyse zu schreiten. ... Niemand darf aber wegen der eigenen DNS benachteiligt werden – sagt zumindest die Biomedizin-Konvention. Ein Gesetz, das Fälle wie den der hessischen Lehrerin klar regelt, gibt es jedoch in Deutschland noch immer nicht. ... Doch der Druck auf Huntington-Familien ist groß. Welcher Arbeitgeber möchte nicht gern wissen, ob es sich lohnt, in den Angestellten zu investieren? Und welche Versicherung möchte sich nicht vergewissern, dass ihr Kunde nicht schon bald ein Fall für die Berufsunfähigkeit wird? ... In der Privatwirtschaft sind Fragen nach einem Gentest bislang nicht statthaft. So haben sich die deutschen Versicherer einer Selbstverpflichtung unterworfen, wonach ’die Durchführung von prädiktiven Gentests nicht zur Voraussetzung eines Vertragsabschlusses’ gemacht wird. Doch in der Praxis wird schon längst das genetische Risiko mit in das Geschäft einbezogen. ... In Zukunft könnte dieses Versteckspiel mehr als jene rund 8000 Menschen betreffen, die in Deutschland an Huntington leiden. Denn die Zahl der Krankheiten, deren Spuren in den Chromosomen nachgewiesen werden können, wächst ständig. ... Die Zahl der in Deutschland 26 vorgenommenen Genuntersuchungen steigt folglich rapide an, es sind schon heute mehrere zehntausend jährlich. ... Wenn der Fortschritt in der Gentechnik so weitergehe, so der Datenschutzexperte aus Frankfurt, ’dauert es nicht mehr lange, und bei jedem Menschen wird man irgendeinen genetischen Fehler feststellen’. (SPIEGEL 20.10.03) Jeder sollte das Recht haben, seine genetische Disposition zu kennen. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass es ebenso ein strikt zu handhabendes »Recht auf Nichtwissen« geben muss! Dieses Recht muss zunächst für jeden möglicherweise Betroffenen gelten, denn nicht jeder hat die starke Persönlichkeit, seine Gene untersuchen zu lassen, um dann hinterher im Falle eines »positiven« Untersuchungsergebnisses mit festgestelltem niederschmetternden Befund mit dem Wissen um einen ihm vorher nicht bekannten Gendefekt leben zu können, der zum Ausbruch einer Krankheit führen kann, denn Hoffnungen auf Erfolge im Bereich einer vorbeugenden genetischen Medizin, eine genetisch bedingte Krankheit schon vor ihrem Ausbruch erkennen und durch Genreparatur verhindern zu können, werden noch einige Zeit unerfüllt bleiben. Die Gentherapie hinkt der Gendiagnostik weit hinterher, aber Gendiagnostik ist der erste Schritt auf dem Weg zur Gentherapie. Nach derzeitigem Wissensstand kann man erst ein Promille der rund 25.000 Gene des Menschen - ungefähr so viele, wie z.B. die Maus und das heimische Unkraut Ackerschmalwand auch vorweisen können - bestimmten Krankheiten zuordnen. Und das wird bestimmt noch mehr werden, wenn man die Wirkzusammenhänge besser zu verstehen gelernt hat. Damit kann man die so erkannten Krankheiten aber noch längst nicht heilen; das ist nur in einzelnen Fällen möglich. So kam es, dass nach einer seit Jahren gelaufenen Debatte die Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) 2004 ein Modellprojekt startete, gegen das die eingeschaltete Ethikkommission keinerlei Bedenken hatte: In Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover waren 6.000 KKH-Versicherte auf eine Erbkrankheit, die so genannte Eisenspeicherkrankheit, untersucht worden. Gegen diese Stoffwechselerkrankung, die im Laufe der Jahre lebenswichtige Organe durch Eiseneinlagerung massiv schädigt, gibt es bei rechtzeitigem Erkennen gute Therapiechancen. Entsprechend hoch war das Interesse der Versicherten an einer Teilnahme gewesen. Eine solche Testteilnahme darf aber grundsätzlich nur freiwillig sein und das Ergebnis des Tests sollte zunächst nur dem von einem Fremdlabor zu Testenden bekannt gegeben werden dürfen! Das zu regeln ist, um Missbrauch vorzubeugen, die Aufgabe eines seit 1998 angekündigten, schleunigst abzufassenden Gendiagnostikgesetzes, denn Ende 2006 läuft die freiwillige Verpflichtung der privaten Versicherungswirtschaft aus, auf Gentests zu verzichten. Sollte es bis dahin nicht zu einer rechtlichen Regelung gekommen sein, droht die zumindest abstrakte Gefahr des Missbrauchs. Arbeitgeber und Kranken- sowie Lebensversicherer haben schließlich ein starkes materielles Interesse an entsprechenden Untersuchungsergebnissen. "Vermeintlich freiwillige, faktisch jedoch unfreiwillige Gentests könnten dann um sich greifen", warnte der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Schaar. In anderen Ländern gebe es derartige Entwicklungen und Ausgrenzungen im gesellschaftlichen Leben durch negativ zu bewertende positive Ergebnisse von Genuntersuchungen. Wie ist es aber, wenn spezielle Krankheiten nur an nicht-einwilligungsfähigen Kranken (Behinderten, psychisch Kranken, Dementen oder Kindern) untersucht werden können, um die zu der Krankheit führenden Wirkzusammenhänge verstehen zu lernen und mit fortschreitender Erkenntnis eventuell heilen oder gar durch Genbehandlung verhindern zu können? Das wäre der Einstieg in die fremdnützige Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Patienten. Eine vermittelnde Position zwischen strikter Ablehnung und bedenkenloser Befürwortung wäre es, wenn Gentests an nicht-einwilligungsfähigen Patienten nur dann durchgeführt werden dürften, wenn diesen ansonsten Leiden drohe und außerdem eine konkrete Aussicht auf Heilung bestünde. Sprich, der Gentest darf nur im Eigeninteresse des Patienten gemacht werden. Fremdnützige Forschung, mit der beispielsweise medizinische Erkenntnisse gewonnen oder ergänzt werden sollen, würde somit ausgeschlossen. Kritiker begründen diese eine »freie« Forschung einschränkende Regelung mit dem aus Art. 1 GG abgeleiteten "Instrumentalisierungsverbot", das verbietet, dass Menschen zum (Forschungs-)Objekt degradiert würden, heißt es im Enquete-Bericht des Bundestags vom Mai 2004. Aus diesem Grund hat die Bundesrepublik Deutschland bis heute die Bioethikkonvention des Europarates aus dem Jahre 1996 nicht unterzeichnet. Jetzt droht das anstehende Gendiagnostikgesetz, diese Tür wieder aufzustoßen. Einigkeit besteht dagegen bei der Notwendigkeit zum Test auf Kinderkrankheiten, für die es zwar keine Heilung, wohl aber eine Therapie gibt. So kann z.B. Mukoviszidose zwar nicht geheilt, aber bis zum 50. Lebensjahr therapiert werden, wenn man mittels eines Gentests früh eine präzise Diagnose stellen kann. Immer mehr Menschen könnten nach Gentests – bisher ohne Heilungschance - als »genbedenklich« oder »gengeschädigt« eingestuft werden! Sollen sie das wissen müssen? Sollen das andere wissen dürfen? Völlig offen ist dabei außerdem, ob der »Gengeschädigte« diesen möglichen Ausbruch einer bisher unheilbaren schweren, 27 schleichenden Krankheit überhaupt erleben wird, denn ein Unfall oder eine andere Krankheit als die in seinen Genen erkennbar angelegte kann unvorhergesehen sein Leben beenden. Dann hat er ohne das ihm möglicherweise wider seinen Willen aufgedrängte Wissen um einen krankheitsauslösenden Gendefekt die Zeit davor angstfrei gelebt! Ohne eine solche entlarvende Genuntersuchung ist mehr Raum für Hoffnung. Wenn diese Untersuchung nicht vorgenommen und so kein positiver Befund festgestellt wird, hat der Betroffene nicht jeden Morgen, jeden Tag und jede Nacht nach Erhalt des Untersuchungsergebnisses mit der Angst aufwachen, leben und einschlafen müssen, wann diese auf Grund seines festgestellten Gendefektes ihm möglicherweise oder sehr wahrscheinlich drohende schwere, schleichende Krankheit irgendwann bei ihm ausbrechende werde! Und dieses unbesorgte Nichtwissen wiegt schwer! Dieses »Recht auf Nichtwissen« muss meines Erachtens erst recht gegenüber neugierigen Dritten wie insbesondere Krankenkassen und Arbeitgebern gelten. Haben Sie z.B. verfolgt, dass von interessierter Seite schon seit einigen Jahren ins Gespräch gebracht worden ist, dass Bewerber um einen Arbeitsplatz dem Arbeitgeber mit ihrer Bewerbung ihren Gentest vorweisen sollten? Selbstverständlich nur »zum Wohle der Arbeitsuchenden, um gesundheitliche Gefährdungen an gefährlichen Arbeitsplätzen möglichst weitgehend auszuschließen«! Wir können aber absolut sicher sein, dass dann, sollten die Dämme erst einmal brechen, über eher kurz und gewiss nicht lang nicht nur von Samenspendern ein generell vorzulegender Gentest verlangt werden wird! Was glauben Sie, wie Ihre Chancen oder die ihrer Kinder trotz exzellenter Zeugnisse stehen würden, wenn einem Arbeitgeber durch die vorgelegte Genanalyse bekannt würde, dass bei Ihnen oder Ihren Kindern eine erhöhte Gefährdung durch eine möglicherweise oder sogar sicher in ungewiss naher Zukunft ausbrechende Epilepsie, ein Krebsrisiko von 60:40, eine Frühdemenz, eine der schrecklichen Erbkrankheiten FOP, MLD, ..., die die Menschen von innen heraus versteinern, erblinden und ertauben lässt, ... vorliegt, Suchtschädigungen oder durch Umweltschäden erbliche Belastungen durch Ihre Eltern nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, das Eintreten von Multipler Sklerose nicht ganz unwahrscheinlich ist, ... . Wehret den Anfängen! »Safer lex«! Denn die Anfänge sind schon gemacht: „Britische Gen-Elite AFP London – Die britische Armee will einem Zeitungsbericht zufolge künftig ihre Elitesoldaten per Gentest auswählen. Wie die ‘Sunday Times‘ unter Berufung auf Militärkreise berichtet, würden derzeit an Rekruten Tests vorgenommen, mit denen die für die körperliche Leistungsfähigkeit verantwortlichen Gene gefunden werden sollen. ...“ (HH A 06.10.97) Krankenkassen sind Einrichtungen der Solidarität. Da muss man nicht vorher Risikoprämien auf sonst nicht entdeckbare, sich aus einer bestimmten Genstruktur möglicherweise erst viel später im Verlauf von Jahren ergebende Krankheiten erheben. Und Arbeitgeber sind im Zweifelsfall mitleidloser als die eigene Solidargemeinschaft der bei einer Krankenkasse Versicherten. Da hat dieses Wissen um Gendefekte erst recht nichts zu suchen! In Deutschland wurde 2004 versucht, Kraftfahrer auf ihre Genstruktur hin untersuchen zu lassen. Nach einer kurzen Phase des Nachdenkens meldeten die Medien im März 2001, dass sich die neue Gesundheitsministerin Schmidt nunmehr zu der hier vertretenen Ansicht durchgerungen habe - die ich nach gewissenhafter Abwägung des Für und Wider für die am Menschenbild des Grundgesetz gemessen einzig vertretbare halte, sonst hätte ich nicht damals die Zeitungsmeldung von 1997 nach ihrem Erscheinen als Beweis des Menetekels darüber eingearbeitet, was mit blutiger Schrift als Prophezeiung eines Ergebnisses des Forscherwahns an die Wand geschrieben worden ist, aber offensichtlich nicht von allen in seiner Tragweite so gesehen wurde. Was aber für die Krankenkassen weiterhin gelten soll – keine »Gen-Spionage« -, scheint für die Lebensversicherer gelockert zu werden: „Gentest für die Versicherung Berlin – Die SPD will Versicherungsunternehmen das Recht einräumen, bei Lebensversicherungen mit hohen Versicherungssummen auch die Ergebnisse von Gentests zu verwerten. In einem Eckpunkte-Papier der SPD für ein Gentestgesetz heißt es, diese Ausnahme könne eingeführt werden, um Missbrauch beim Abschluss von Lebensversicherungen zu verhindern. (rtr)” (HH A 30.04.02) 28 Und wie lange bleibt ein - zunächst - den Lebensversicherungen »ausnahmsweise« erlaubter Zugriff auf Gentestdaten eine Ausnahme, wenn die Dämme erst einmal brechen? Außerdem: Wie soll man sich einen Missbrauch vorstellen, vor dem die Lebensversicherer durch einen (angeblich) geschäftsnotwendigen Zugriff auf Gentestdaten (angeblich) geschützt werden müssten? Schließt jemand, der eine Lebensversicherung mit einer hohen Versicherungssumme und den dementsprechend hohen Prämien abschließen will, einen solchen Vertrag nur darum ab, weil er sich zuvor privat erst einen Gentest hat erstellen lassen, der dann ungünstig ausgefallen ist und er nun für irgend jemanden etwas mit seinem kurzen »Rest-Leben« »verdienen« will – oder wird ein solcher Vertrag nicht deshalb abgeschlossen, um ein bestimmtes Risiko, z.B. eines Hauskaufes oder einer Geschäftsgründung, als Voraussetzung für den Erhalt eines Bankkredites abzudecken? Politik ist die Kunst der Zukunftsgestaltung. Und da das oft durch Gesetze geschieht, müssen wir bei uns im ganz direkten Wortsinn »frag-würdig« erscheinenden Gesetzesvorhaben den demokratischen Widerstand organisieren, damit wir uns nicht vorwerfen müssen, was die Großkirchen mit zurück gewandtem Blick auf das Entstehen des Nationalsozialismus später als ihr Versagen reuevoll bekannt haben: „Wir haben zu wenig widerstanden!“ Darum muss die Tagespolitik hinsichtlich sich abzeichnender gravierender rechtlicher Neuerungen ständig wach verfolgt werden - dabei hilft z.B. eine gute Tageszeitung -, und es muss notfalls möglichst rechtzeitig durch z.B. lautes Protestgeschrei oder/und Besuche von Abgeordneten-Sprechstunden reagiert werden! Inzwischen scheint die Bundesregierung auch in die hier vertretene Richtung zu tendieren, denn es wurde über die Nachrichtenmedien verbreitet, dass man, ähnlich wie in Österreich, eine gesetzliche Regelung anstrebe, der zufolge gesetzlich verboten werden solle, Gentests „zu verlangen, zu verbieten oder zu verbreiten“. Nur der Betroffene dürfe für sich Gentests erstellen lassen. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte scheint inzwischen in die hier vertretene Richtung gehen zu wollen: „Datenschutz bei Gentests Berlin – Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar fordert ein neues Gesetz für Rechtssicherheit bei Gentests. Arbeitgeber dürften von Bewerbern oder Arbeitnehmern nicht verlangen, dass sich diese einem Gentest unterziehen. Das neue Gentest-Gesetz müsse zudem heimliche Genom-Analysen verbieten. (afp)” (HH A 14.04.04) Nach einem der vielen Sexualverbrechen an einem Mädchen war dagegen von dem rechtspolitischen Sprecher der CSU-Fraktion im Bundestag, Geis, die Forderung erhoben worden, in einer zentralen Datenbank die Daten der zwangsweise vorzunehmenden Gentests aller männlichen Einwohner der BRD zu sammeln und ein Leben lang aufzuheben, um im Falle eines erneuten Mädchenmordes den Täter durch einen Vergleich mit den an der jeweiligen Mädchenleiche immer auffindbaren Spuren sofort dingfest machen zu können. Dieses Verbrechen der Mädchen- und Frauenmorde wird mit Sicherheit nie aussterben. Wenn etwas gewiss ist, dann ist es das, denn der Mensch ist auch durch seine Triebkraft Sexualität bestimmt, die nicht alle unter Kontrolle haben. Es wird immer Männer mit Angst vor einer erwachsenen Frau als Partnerin und nicht ausreichender Selbstkontrolle geben, die irgendwann mit Vorliebe Mädchen oder auch junge erwachsene Frauen überfallen, missbrauchen und anschließend ermorden werden. Soll nun nach möglicher Erfassung aller schon lebenden Männer von jedem männlichen Baby gleich nach der Geburt im Zuge der sowieso vorzunehmenden Untersuchungen ein Gentest erstellt werden, weil einige von ihnen später irgendwann mit Sicherheit einmal Sexualverbrecher werden? Diese Frage fällt weg, wenn, wie manche Evolutionsbiologen es kommen sehen, von jedem Neugeborenen und seinen Eltern im Verlauf des 21. Jahrhunderts routinemäßig Gentests erstellt werden, damit zunächst einmal die Verwandtschaftsverhältnisse zweifelsfrei geklärt sind und von jedem die auf ihn durch die Zeugung anfallende Kindersteuer erhoben werden kann.6 Dann lägen die entsprechenden Daten ja vor, wenn nicht nur bestimmte Abschnitte der Minisatelliten-DNA zum Abstammungsabgleich untersucht werden, die in ihrem nicht-codierten Bereich, der 90 % des Genoms eines Menschen ausmacht, keinen Aufschluss über Genschäden ermöglichen. 2004 wurde von einer von der EU-Kommission eingesetzten Expertengruppe in einem Gentest-Memorandum angeregt, europaweit an allen Neugeborenen nicht nur das bisher schon angewandte biochemische Verfahren als Suchtest gegen bestimmte Krankheiten wie z.B. eine Schilddrüsenunterfunktion vornehmen zu lassen, sondern in Erweiterung der Suchtests nach früh zu behandelnden Krankheiten ein genetisches „Screening“ vorzunehmen, um die Kinder auf genetische Defekte hin untersuchen zu lassen. Die Mediziner erhoffen sich neue Behandlungschancen. So gilt es etwa bei schweren Immundefizienzen als nachgewiesen, dass Gentherapien helfen können. Ein erster Nachweis gelang Anfang der neunziger Jahre für die ADA-Defizienz. Bei dieser 6 U.a. Baker, R.: Sex im 21. Jahrhundert – Der Urtrieb und die moderne Technik, 2000, S. 34 ff 29 Krankheit ist das Immunsystem nicht funktionsfähig, weil ein einziges Gen fehlt, das für die Herstellung des Enzyms Adenosin-Desaminase (ADA) entscheidend ist. Ähnlich verhält es sich bei der Immunschwächekrankheit X1-SCID . Bei an dieser Krankheit Erkrankten fehlt ein Protein, das für die Bildung körpereigener Abwehrzellen notwendig ist, so dass jeder an sich harmlose Keim im Körper der von dieser Krankheit Betroffenen eine lebensbedrohliche Infektion auslöst. Betroffene müssen sich deshalb stets in einer möglichst keimfreien Umgebung aufhalten. Die Kinder müssen von der Geburt an unter einem sterilen Plastikzelt leben. (Der Fotobericht im STERN über die unsäglichen Lebensumstände einer betroffenen Frau, die auf Grund ihrer Krankheit weder Besuch von Familienangehörigen noch Bekannten empfangen, noch die mit Folie ausgekleidete Wohnung verlassen konnte, war äußerst eindrucksvoll!) Für u.a. diese seltenen Erkrankungen erhoffen sich EU-Forscher nach ersten Gentherapie-Erfolgen bis spätestens 2010 entsprechende GentherapieZulassungen von den zuständigen US- und EU-Zulassungsbehörden, da bei vier an ADA-Defizienz erkrankten Kindern, für die kein HLA-identischer Stammzellenspender zur Verfügung stand, mit einer Gentherapie der ADA-Gendefekt in Blut-Stammzellen so weit korrigiert werden konnte, dass die Heranwachsenden ein normales Leben ohne Medikamente führen können. Die Wissenschaftler aus staatlichen Forschungsinstituten, Industrie und Medizin hatten in Brüssel nach einjähriger Arbeit 25 Empfehlungen zu den ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen von Gentests beim Menschen vorgelegt. Die Expertengruppe kam zu dem Schluss, dass Gentests einen Fortschritt für das Gesundheitswesen darstellen und Chancen für neue Entwicklungen in der Präventivmedizin und der Arzneimittelentwicklung eröffnen. Gentests müssten jedoch der freien Entscheidung der Betroffenen vorbehalten bleiben. "Von hoher Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen individuellen genetischen Tests und genetischem Screening", betont Ludger Honnefelder von der Universität Bonn. So bedürfe es einer Definition dessen, was Krankheit und Krankheitsdisposition und was bloße Disposition sei. Der Bonner Ethikprofessor warnte vor einer Gleichsetzung genetischer und medizinischer Daten. Auch wenn ein genetisches Screening an Freiwilligkeit gebunden werde, könne sie in der medizinischen Routine zur Aushöhlung der individuellen Freiheit führen. EU-Forschungskommissar Philippe Busquin soll sich die Forderung nach einem genetischen Screening zunächst angeblich „uneingeschränkt zu Eigen“ gemacht haben. Er wurde in der Presse mit dem Satz zitiert: "Es ist wichtig, dass die Empfehlung für Gentests an Babys in den Mitgliedsstaaten umgesetzt wird." In der EU werden inzwischen jährlich über 700.000 Gentests durchgeführt, die mit Kosten von 500 Millionen Euro verbunden sind; ein großer Markt für Pharmafirmen und Tester also. Allein in Deutschland werden bereits jährlich rund 90.000 Gentests durchgeführt. "Es muss dringend ein Validierungssystem für Gentests geschaffen und eine europäische Gendatenbank aufgebaut werden", sprach sich Busquin für die Bildung eines Europäischen Netzwerkes für Gentechnik im Rahmen des 6. EU-Forschungsrahmenprogramms aus. Er bestritt aber später seine Befürwortung, als ihm wohl die Brisanz dieses Unterfangens aufgegangen war. Sollte es zu einem solchen Massenscreening kommen, dann stellen sich einige Fragen. Auf der persönlichen Ebene: Wer will von klein auf wissen, dass bei ihm mit etwa 40 Jahren die unheilbare, genetisch bedingte Huntington-Krankheit ausbrechen könnte? Neben der psychischen Belastung könnten solche Personen auch bei der Arbeitssuche und in Versicherungsfragen benachteiligt werden. So können genetische Daten zu großen Belastungen für den Betroffenen führen und die Gefahr einer sozialen, ethischen oder eugenischen Diskriminierung beinhalten. Darum wird vorgeschlagen, dass sich die angeregten Tests ausschließlich auf therapierbare Krankheiten beziehen dürften. Ungeklärte Fragen auf der gesellschaftlichen Ebene: Wer soll auf diesen Datenpool Zugriff haben? Konkret: Auch die Polizei, wenn sie einen Sexualstraftäter sucht? Soll die männliche Hälfte der Bevölkerung unter Generalverdacht gestellt werden? Obwohl wegen der abartigen Natur mancher Männer durch Zwangsgentests Mädchen- und Frauenmorde als »Erstmorde« nicht zu verhindern sein werden, hat der Gedanke der sofortigen Aufklärung zunächst etwas Bestechendes für sich, weil Mädchen- und Frauenmörder oft Wiederholungstäter sind. Und diese nachfolgenden Morde könnten verhindert werden, wenn ein solcher potentieller Wiederholungstäter nach dem ersten Mord „lebenslang“ (bis ins Greisenalter) weggesperrt würde, denn das ist die sich daran anschließende ergänzende Forderung, die von Befürwortern einer solchen Regelung erhoben wird. Es würde dann aber kommen, wie es immer kommt: die Schraube würde bei nächst passend dünkender Gelegenheit weitergedreht werden. Das sahen wir z.B. bei der Propagierung von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung, wo zur Rechtfertigung von Gewalt zunächst zwischen der gegen Sachen und der gegen Personen einzusetzenden unterschieden wurde, bis sie dann auch gegen Personen angewandt wurde – bis hin zu deren Ermordung. Beim Klonen wurde eine Zeit lang bei der Forderung nach Freigabe des Klonens zur politisch leichteren Durchsetzbarkeit dieser Forderung semantisch zwischen therapeutischem und reproduktivem Klonen unterschieden, obwohl die dazu angewandten Techniken größtenteils die gleichen sind: Immer wird eine (Spender-)Eizelle und das komplette Erbgut des Lebewesens benötigt, das geklont werden soll. Weil sich Frauen zum »Ernten« der von ihnen benötigten Eizellen bislang einer zu diesem Zweck ethisch umstrittenen und 30 physisch unangenehmen Hormonbehandlung unterziehen mussten, wird schon mit der Einpflanzung menschlichen Erbgutes in tierische Eizellen experimentiert. Unabhängig davon, woher die verwandte Eizelle stammt, wird ihr Genmaterial bei der Kerntransplantation im nächsten Schritt unter dem Mikroskop entnommen und - mitunter Behinderungen verursachend - entweder nach der Honolulu-Methode mittels einer Hohlnadel oder nach der Dolly-Methode mittels eines Stromstoßes von 3.000 Volt durch das Genmaterial aus der Körperzelle des Spenders ersetzt, für den, z.B. zur Gewinnung eines körpereigenen Ersatzorgans, körpereigene Stammzellen gewonnen werden und so geklont werden soll, wie es mit menschlichen Zellen zuerst in Korea und dann in Großbritannien gemacht worden ist. Nach der Fusion von entkernter Eizelle und dem eingeschleusten Genmaterial muss der bedarfsgerecht konstruierte Embryo stimuliert werden, sich wie ein von Mutter Natur geschaffener zu verhalten und sich zu teilen. Das gleiche gilt für das Klonen in Form der Embryonenteilung. Dazu wurden in Tierversuchen bislang chemische und mechanische Aktivierungen erprobt. Wenn das gelingt, entsteht aus dem zunächst amorphen Zellhaufen nach einigen Teilungen die als Blastozyste bezeichnete Hohlkugel, in deren Innerem sich die pluripotenten Stammzellen für den Aufbau des gesamten Körpers bilden. Verfolgte man das Ziel des »reproduktiven« Klonens – z.B. um nach den abstrusen Vorstellungen der Raelianer mit woher auch immer besorgtem Chromosomensatz Hitler zu klonen und den »Klon-Hitler«, der in seinem jungen Leben nichts Böses getan haben muss, nach Erreichen des Erwachsenenalters für die Untaten seines Klon-Ursprungs vor Gericht zu stellen, eine Idee, die noch abstruser ist als die von Papst Pius XII., der fest daran glaubte, dass Hitler vom Satan besessen sei und darum über FernExorzismus eines kirchlich zugelassenen Teufelsaustreibers versuchte, Hitler den Teufel austreiben zu lassen -, würde der Klon in diesem Stadium einer »Leihmutter« zum Austragen der nicht eigenen Leibesfrucht binnen der üblichen neun Monate Schwangerschaft eingepflanzt. Verfolgt man hingegen entsprechend den Geboten der helfenden und heilenden Ethik als Ziel das »therapeutische« Klonen, so würde die konstruierte Blastozyste des geplanten Embryos nach Bildung der Stammzellen im 64- bis 128-Zellstadium in einem von Gegnern des therapeutischen Klonens als »Abtreibung in der Petrischale« bezeichneten Vorgang zerstört und es würden die so gewonnenen Stammzellen in Stammzelllinien zur Bildung der begehrten Ersatzorgane angeregt. „STAMMZELLEN-FORSCHUNG Britische Forscher dürfen Embryonen klonen In Großbritannien dürfen menschliche Embryonen erstmals zu Forschungszwecken geklont werden. Die zuständige Behörde für Menschliche Fortpflanzung und Embryologie genehmigte einen entsprechenden Antrag. Wissenschaftler der Newcastle University wollen mit Hilfe von Stammzellen geklonter Embryonen Behandlungsmöglichkeiten für Diabetes, Parkinson und Alzheimer erforschen. Für die Erzeugung der Embryonen wollen sie die gleiche Methode verwenden, die benutzt wurde, um das Schaf ’Dolly’ zu klonen. Kritiker halten das so genannte therapeutische Klonen für unethisch. ’Diese Forschung überschreitet zum ersten Mal eine wichtige ethische Grenze’, sagte der Molekularbiologe David King. Großbritannien hatte das Klonen menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken 2001 legalisiert. Das Klonen von Embryonen zur menschlichen Fortpflanzung ist weiterhin strafbar. (Spiegel Online 11.08.04) GENTECHNIK "Dolly"-Schöpfer darf menschliche Embryos klonen Der Schöpfer des Klonschafs "Dolly" darf jetzt auch menschliche Embryos zu Forschungszwecken klonen. Die zuständige britische Aufsichtsbehörde erteilte dem Team um Ian Wilmut die entsprechende Erlaubnis. London - Es ist erst das zweite Mal, dass die britischen Behörden das Klonen menschlicher Embryos zu Forschungszwecken gestatten. 2001 hatte Großbritannien die Prozedur als weltweit erster Staat legalisiert und im August 2004 erstmals Forschern der University of Newcastle upon Tyne eine Erlaubnis erteilt. Jetzt hat die zuständige Behörde für Menschliche Fortpflanzung und Embryologie (Human Fertilization and Embryology Authority) zum zweiten Mal das Klonen menschlicher Embryos genehmigt. Die Profiteure sind keine Unbekannten: Ian Wilmut und sein Team gelangten 1996 zu Weltruhm, als sie das weltweit erste lebensfähige Säugetier klonten. Das Schaf "Dolly" ist im Februar 2003 im Alter von sechs Jahren gestorben. Beim therapeutischen Klonen wird einer menschlichen Eizelle der Kern entnommen und durch den Kern der Körperzelle eines Patienten ersetzt. Das Ei wird künstlich stimuliert, sich zu einem Embryo weiter zu entwickeln. Die Forscher wollen dann Stammzellen entnehmen, die die Fähigkeit besitzen, 31 sich in jeden Zelltyp des menschlichen Körpers zu verwandeln. Wilmut vom Roslin Institute bei Edinburgh und Christopher Snow vom Institute of Psychiatry in London wollen Zellen von Patienten mit der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) klonen, unter der beispielsweise der britische Physiker Stephen Hawking leidet. An den aus diesen Zellen hergestellten Embryos will Wilmut erforschen, wie sich die Krankheit entwickelt. SPIEGEL ONLINE 08.02.05 Der mühsam konstruierte, aber nur semantische Unterschied zwischen des »reproduktivem« und »therapeutischen« Klonen wurde jedoch aufgehoben, als ein Reproduktionsmediziner erklärte, für ihn sei reproduktives Klonen bei Unfruchtbarkeit eines Ehepaares ein therapeutisches Klonen. Zu befürchten ist nach aller bisherigen Erfahrung mit zunächst einschränkenden Sicherheitsklauseln: Ist erst einmal eine Gendatenbank für einen kleinen Personenkreis, wie es sie bereits seit 1998 mit bisher über 100.000 Einträgen von Tätern aus Sexualdelikten, schwerer Körperverletzung, Raub und Erpressung gibt, erstellt, wird sie auch für einen größeren Personenkreis gefordert und für andere Zwecke genutzt werden! In seinem Volkszählungsurteil hat das BVerfG aus dieser Einsicht heraus das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbalisiert und wegen der mit einer umfangreichen Datenerfassung gesehenen Gefahren eines Orwell’schen Überwachungsstaates für die Selbstbestimmung des Bürgers das Gesetz verboten: Das Menschenbild des Grundgesetzes wolle nicht den »gläsernen Menschen«; ein Beispiel dafür, dass die Maßstäbe der jeweils in einer Gesellschaft geltenden Ethik dem Recht vorgelagert sind, die Grundlagen des Rechts sich aus den in einer Gesellschaft geltenden ethischen Normen ergeben. Der Datenschutz wurde vom BVerfG als ein so hochrangiges Prinzip beurteilt, dass die in meinen Augen vergleichsweise harmlosen Fragen der Volksbefragung nach z.B. Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnungsgröße, Eigenheim oder Mietobjekt, ... wegen ihrer in der Kombination der Antworten gemutmaßten Ausforschungsmöglichkeiten nicht zugelassen wurden. Darum hat das BVerfG dem befürchteten potenziellen Ausforschungsdrang von Anfang an einen Riegel vorgeschoben. Mich hätte es nicht gestört, wenn die Volkszählungsdaten so erhoben worden wären, wie das Parlament es in dem Gesetz einstimmig beschlossen hatte. Ich hatte da nichts zu verbergen und fühlte mich in meiner Blauäugigkeit von keiner der streng vorgegebenen Fragen weder ausgeforscht noch in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt oder gar bedroht, weil ich keine mich tangierende Missbrauchsmöglichkeit zu erkennen vermochte. Aber wenn jetzt von allen (zunächst nur) männlichen Bürgern Daten über ihre Genstruktur und ihre möglichen Gendefekte erfasst werden sollten, dann schaudert es mich doch vor den sich daraus ergebenden Missbrauchsmöglichkeiten! Gläserner als durch das Erfassen seiner Genstruktur kann ein Mensch ja nicht gemacht werden, solange Gedankenkontrolle à la (des echten) Big Brother(s) technisch nicht realisierbar ist. Bei der Qualität, die dem Datenschutz beigemessen wird, ist es mir nicht denkbar, dass das BVerfG dem nach CSUArt wohl mehr aus populistischen Erwägungen heraus gemachten Vorschlag seinen verfassungsrechtlichen Segen erteilen und eine solch einschneidende Datenerfassung ohne jeglichen Anfangsverdacht zulassen könnte. Das verstieße auch gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dem jegliches staatliche Handeln unterliegt. Das BVerfG müsste dazu die Prinzipien seiner gesamten bisherigen Rechtsprechung aufgeben! Das weiß der rechtspolitische Sprecher der CSU-Fraktion als ausgebildeter Jurist aber auch selber; trotzdem brachte er diesen Vorschlag in die politische Tagesdiskussion. Die neueste Version einer von Kritikern so gesehenen alle Bürger betreffenden Ausforschungsmöglichkeit ist der Medikamenten- oder Arzneimittel-Pass auf einer Chipkarte, dessen Einführung einen Monat nach dem LipobayDebakel im August 2001 in einer Vereinbarung zwischen der Gesundheitsministerin einerseits und Krankenkassen-, Ärzte- und Apothekenvertretern andererseits grundsätzlich beschlossen wurde. Man hofft, durch einen solchen Chipkarten-Pass, auf dem die durch welchen Arzt auch immer vorgenommene individuelle Medikation des jeweiligen Passinhabers dokumentiert werden soll, zum Tode führende Unverträglichkeitsreaktionen zwischen Wirkstoffen aus verschiedenen Medikamenten, die von verschiedenen Ärzten ohne Wissen von der Anordnung des Kollegen vorgenommen wurde, weitgehender als bisher ausschließen zu können, indem die fachkundigen Apotheker die dann auf der Chipkarte gespeicherten Verordnungen aller den Patienten behandelt habenden Ärzte auf Unverträglichkeiten hin überprüft werden. Von Seiten der Krankenkassenvertreter scheinen außerdem zunächst auch abrechnungstechnische Wirtschaftlichkeitsüberlegungen eine Rolle zu spielen, bis die Krankenkassenvertreter dann umschwenkten. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes sprach sich sofort gegen einen solchen Arzneimittel-Pass aus: Durch die Dokumentation der verordneten Arzneimittel sei immer ein Rückschluss auf den bisherigen Gesundheitsverlauf möglich und Missbrauch dieser Information durch unbefugte Dritte nie auszuschließen. Diesem Argument hielt die Gesundheitsministerin - mit sicher weniger Fachwissen um die Missbrauchsmöglichkeiten EDV-gestützter Datenerfassung als sie der Datenschutzbeauftragte hat – entgegen, dass sich „... Daten so sichern lassen, dass eine Missbrauchsmöglichkeit ausgeschlossen ist. Der Patient muss seinen Pass nur sicher verwahren.“ Warum 32 wird Frau Schmidt dann nicht zur Datenschutzbeauftragten des Bundes ernannt, wenn sie glaubt, sich anheischig machen zu können, über größeres EDV-Fachwissen als der Datenschutzbeauftragte zu verfügen? Ist das nur der Unterschied in der Bezahlung des Postens? Doch wohl eher fehlendes Sachwissen im EDV-Bereich! Davon abgesehen sind durch das Zusammenwirken des den Cholesteringehalt des Blutes senkenden und allein verordnet lebensrettenden Medikamentes Lipobay mit einem anderen Medikament aus einer bestimmten Wirkstoffgruppe auf Grund der Unverträglichkeit der in dem jeweils anderen Medikament enthaltenen Hauptwirkstoffe weniger als ein Hundertstel – letzte Schätzungen rechnen zurzeit mit rund 50 mit Lipobay in Zusammenhang bringbaren Toten auf Grund von durch die Nebenwirkungen der beiden Mittel verursachter Muskelschwäche - so viele Leute gestorben wie nach der Einnahme des Potenzmittels Viagra. Und das wird weiter rasend gekauft. Bei der zunehmenden Vergreisung der westlichen Industriegesellschaften und den damit verbundenen Potenzproblemen wird es mit Sicherheit auch weiterhin mindestens so zahlreich gekauft werden wie bisher, ohne dass irgend jemand wegen der mit der Einnahme des Potenzmittels verbundenen wesentlich höheren Lebensgefahr eine Schadensersatzklage angestrengt hätte. So wird letztlich das BVerfG die Gefahren aus möglichen Medikamentenunverträglichkeiten mit der durch die Einführung eines Arzneimittel-Passes verbundenen Gefahr für das aus Art. 1 GG abgeleitete - aber nicht schrankenlos - gewährleistete Recht auf informationelle Selbstbestimmung abzuwägen haben. Einschränkungen des Individualrechts auf informationelle Selbstbestimmung muss jeder Bürger dann hinnehmen, wenn Gründe des überwiegenden Allgemeininteresses als diesem Recht entgegenstehend angesehen werden. Diese Gründe sind gesetzlich zu regeln. Aus dem entsprechenden Gesetz müssen die Voraussetzungen für die Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und ihr an dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messender Umfang klar erkennbar sein. Das alles ist im zuständigen Senat des BVerfGs nach ganz individueller Sichtweise des einzelnen Verfassungsrichters abzuwägen. Als (vorläufiges) Recht gilt dann immer, was das BVerfG – teilweise nur mit Stimmengleichheit der acht Richter ablehnend – entscheidet. Solange ein demokratisch zustande gekommenes Gesetz gilt, muss es von uns, auch wenn wir uns durch seine Anwendung benachteiligt wähnen oder es tatsächlich auch sind, im Prinzip (eher mehr als minder) befolgt werden, um der zwingenden Macht des ansonsten momentan gerade Stärkeren oder der sonstigen Willkür eines gesetzlosen Zustandes vorzubeugen. Nur ganz selten wird ein von der gesellschaftlichen Entwicklung als überholt angesehenes Gesetz vor seiner Abschaffung ausnahmsweise nicht mehr angewandt. Im Falle der damals auslaufenden früheren rigorosen Strafbarkeit der Abtreibung ging es teilweise so weit, dass sogar eine größere Anzahl von Strafrichtern die damals noch nicht geänderten Bestimmungen über die Strafbarkeit der Abtreibung nicht mehr anwandten, weil sie sie als nicht mehr dem »Recht« entsprechend empfanden. Das war ein einmaliger Vorgang! Es bleibt denjenigen, die sich durch eine bestimmte gesetzliche Regelung über Gebühr belastet fühlen, unbenommen, auf den nach den Spielregeln unserer Verfassung dafür vorgesehenen, oft mühseligen Wegen für eine Änderung einer als ungerecht empfundenen gesetzlichen Regelung zu kämpfen - die für den Kämpfenden selbst dann oft zu spät kommt! »Recht« und »Gesetz« sind keine anbetungswürdigen Götzen, sondern Instrumente zur Gestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens mit teilweise (zu) starken Beharrungstendenzen. Dann muss notfalls gekämpft werden. Mit dem durch die Lektüre des Buches hoffentlich erworbenen Gespür für Recht und Gesetz werden nach der Grundlegung Ausblicke auf einige künftig zu regelnde Bereiche vorgenommen, von denen mir einer der wichtigsten der Bereich Recht und Biologie/Medizin zu sein scheint. Können Sie sich vorstellen, dass als bislang »neuester Schrei« der biomedizinischen Forschung 2003 eine Möglichkeit entdeckt wurde, Kinder zu erzeugen, deren Mütter nie geboren wurden? Damit Sie wegen dieser Andeutung nicht an Ihrem Verstand irrewerden, bevor Sie das Kapitel Recht und Medizin lesen konnten, hier die Auflösung: Israelische Forscher entwickelten eine Methode, Babys aus den Eizellen abgetriebener Embryos zu züchten. Die biologische Mutter so erzeugter Babys ist nie geboren worden! So eine sich andeutende Entwicklung muss rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen! Weil man Neues am besten einordnen kann, wenn man Bezugspunkte zu schon Bekanntem hat, wurden viele Zeitungsartikel abgedruckt, die jeder Normalbürger so oder ähnlich in einer guten Tageszeitung hätte gelesen haben können, wie sie mir als regionale Tageszeitung im »Hamburger Abendblatt« (HH A), dem die meisten Meldungen entnommen sind, zur Verfügung stand. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, als gutwilliger Leser dieses Buches nicht gleich mit teilweise sehr unverständlich abgefassten Paragraphen und Fachartikeln konfrontiert oder »erschlagen« zu werden. (Ohne Anführungszeichen wäre es eine im Buch „Einführung in das Strafrecht der 33 Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten“ abzuhandelnde Straftat.) Dieses Buch soll ja möglichst allgemeinverständlich bleiben. Es wurde nicht zum Weglegen geschrieben - dafür hat es wirklich zu viel jahrelang aufgewandte Mühe gekostet, es zu schreiben und über die Jahre aktuell zu halten -, sondern zum Lesen, Informieren und eventuell sogar ein bisschen zum Lernen. Die meisten sozialen Phänomene können von verschiedenen Seiten gesehen werden. Die jeweilige Sichtweise spiegelt sich dann natürlich auch in den Zeitungsmeldungen wider. Die verwendeten Zeitungsmeldungen sollen darum u.a. auch die unterschiedlichen Argumente und Sichtweisen deutlich machen. Wer allerdings schon allein ein sich informierendes Befassen mit dem Problem und der Bedeutung des »Rechts« für eine Gesellschaft für genau so interessant hält, wie Farbe beim Trocknen zuzuschauen, wäre der falsche Leser. Vielen Dank, dass Sie weiterlesen wollen. Vielleicht haben Sie ja auch einige der in diesem Buch wiedergegebenen Meldungen »damals« mit einem Achselzucken überflogen, weil Sie sie nicht richtig einordnen konnten. Das kann an dem manchmal verkürzenden und dann jeder Sachlogik widersprechenden oder juristisch unqualifizierten Geschreibsel des Nachrichtenredakteurs gelegen haben. Der Sachlogik widerspricht z.B. die Meldung: „Kranken verloren dpa Neapel – Ein 81 Jahre alter Italiener ist in Neapel auf dem Weg ins Krankenhaus aus einem Ambulanzwagen gestürzt. Bei einem Bremsmanöver hatte sich die hintere Tür geöffnet. Der Patient fiel samt Trage aufs Pflaster und starb.“ (HH A 14.12.00) Nach meinen inzwischen sehr rudimentären Physikkenntnissen – meine Schulzeit liegt inzwischen mehr als 40 Jahre zurück - geht das gar nicht! Beim Bremsen drängt die abgebremste Masse nach vorne. Deshalb wurde ja die Gurtpflicht eingeführt. Durch den angelegten Gurt werden die beim Abbremsen nach vorne schießenden Insassen zurückgehalten, damit sie nicht z.B. mit Tonnengewicht durch die Scheibe geschleudert werden! Die Physik gilt aber gleichermaßen für Autoinsassen auf Sitzen wie auf Tragen! Beim Bremsen kann sich somit gar nicht eine hintere Tür geöffnet haben, der Verletzte kann gar nicht beim Bremsen nach hinten rausgefallen sein! Einen solchen Fall könnte man darum auch nicht in der vorstehenden Form in das Buch »Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten« als Beispielsfall für eine fahrlässige Tötung aufnehmen. Ich müsste in diesem Falle die Meldung dafür erst sachdienlich umschreiben in: „... Beim Wiederanfahren nach einem Bremsmanöver ...“, verwende in meinen Büchern die Fälle aber nach Möglichkeit gerne so, wie sie mitgeteilt wurden. Als studierter Historiker mache ich zu meiner diesbezüglichen Exkulpation eine Anleihe bei dem „Relata refero“ meines Kollegen Herodot, der in seinem Geschichtswerk (7/152) schrieb: „Ich bin darauf angewiesen, Berichtetes zu berichten; aber ich brauche es nicht in allem zu glauben.“ Neben sachlogischen Fehlern gibt es auch noch juristische Fehler in der Berichterstattung, die ein Verstehen unmöglich machen, wenn man eine solche »Falschmeldung« für wahr nimmt: „Bruder gerächt afp ULM – Aus Rache für den Tod seines Bruders (21) hat ein Mann (22) einen Ulmer Staatsanwalt (54) in seinem Büro zusammengeschlagen. Er erlitt Prellungen und Platzwunden. Hintergrund: Der Staatsanwalt hatte den 21jährigen wegen Mordes verurteilt. Er nahm sich in der Zelle das Leben.“ (HH A 09.11.95) Ähnlich juristisch falsch: „Daniel Kübelböck: Anklage des Landshuter Gerichts zugelassen“ (Überschrift einer Meldung der sternshortnews vom 25.05.04) Na, den juristischen Falschmeldungen aufgesessen oder die Fehler gleich gefunden? Man überliest sie sehr leicht. Und damit Sie nicht aus diesem Grund erst mein anderes Buch »Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten« durcharbeiten müssen, hier die Auflösung: Ein Mensch kann zwar u.a. auch durch die öffentliche Meinung »verurteilt« werden, und auch das kann seelisch äußerst schmerzhaft sein, aber im juristischen Sinne verurteilen, d.h., mit einer Kriminalstrafe belegen, das kann nur der (Straf-)Richter „im Namen des Volkes“ auf Grund der ihm von dem »das Volk« 34 repräsentierenden Staat dazu verliehenen Rechtsmacht. Die Aufgabe des Strafverfolgungsorgans Staatsanwaltschaft hingegen ist es, einen ausermittelten Lebenssachverhalt, wenn für den bearbeitenden Staatsanwalt darin strafwürdiges Verhalten, Kriminalunrecht, enthalten zu sein scheint, bei einem Gericht zur Anklage zu bringen. Ein Staatsanwalt beurteilt einen zu Aktenpapier geronnenen Lebenssachverhalt und reicht ihn bei Gericht in Form einer Anklageschrift zur Aburteilung des von ihm so gesehenen Straftäters ein, aber nur ein Richter kann einen Menschen, der sich ihm vielleicht auch nur irrtumsbefangen - als Straftäter dargestellt hat, verurteilen. Solche juristisch falschen Meldungen erschweren natürlich das aufkeimende Rechtsverständnis von Nichtjuristen: Sei es, dass Sie den Fehler einer Meldung gar nicht erkannt haben, dass Sie intuitiv das eigentlich Gemeinte richtig aufgenommen haben und sich nun beim Lesen der Meldung irritiert fühlen oder weil Sie mit einer Zeitungsmeldung nichts anfangen konnten, da Ihnen das für die Einordnung der Zeitungsmeldung als Fehler notwendige Sachwissen fehlte. Mir fehlt z.B. die Sachkenntnis zu beurteilen, ob die nachfolgende Meldung stimmt: „Siebenfacher Mord afp Auxerre – Vor 20 Jahren verschwanden sieben junge Frauen in Frankreich. Jetzt hat der Fahrer ihres Behindertenbusses gestanden, sie ermordet zu haben. Der Triebtäter (66) kann aber nur noch wegen Freiheitsberaubung bestraft werden. Die Morde sind verjährt.“ (HH A 16.12.00) Eine solche Meldung soll richtig sein? Da stutze ich: Mord soll in Frankreich schneller verjähren 7 als Freiheitsberaubung? Das kann ich einfach nicht glauben! Ich glaube zunächst einmal lieber meinem kritischen Verstand und verbuche diese Meldung bis zum Beweis des Gegenteils für mich darum in der Kategorie »juristische Falschmeldung«. Eine weitere Meldung juristischen Gehaltes, die für so bedeutend angesehen wurde, dass sie abgedruckt wurde, die aber selbst ich als Jurist wegen ihrer verkürzten Darstellung nicht einordnen kann, ist die nachfolgende: „Prostituierte muß Geld zurückzahlen Karlsruhe – Eine Prostituierte, die von einem betrügerischen Beamten aus der Staatskasse bezahlt wurde, muss 8200 Euro zurückzahlen. Der Bundesgerichtshof bestätigte ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Az.: III ZR 38/04). (dpa)“ (HH A 22.10.04) Vor 50 Jahren musste ich als Schüler Aufsätze mit der Beantwortung u.a. der Standardfrage schreiben: „Was hat der Autor uns damit sagen wollen?“ Diese Frage stellt sich bei dieser verkürzten Meldung wieder: Wegen welchen juristischen Gehaltes ist die Meldung gedruckt worden? Das OLG antwortete nicht auf meine diesbezügliche Nachfrage. Natürlich ahne ich als Jurist die »juristische Ecke«, in die die Meldung zielt. Es wird § 935 II BGB sein. Doch bevor ich mit meiner Erklärung ansetzen kann und Sie anschließend zum Mitdenken und Wundern auffordern werde, müssen Sie zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass der Gesetzgeber des BGB bei der Regelung des Sachenrechts sehr genau zwischen „Eigentümer“ und „Besitzer“ unterscheidet. Das macht auch Sinn, denn wer z.B. eine Wohnung mietet, wird damit längst nicht Eigentümer dieser Wohnung. Er ist »nur« Besitzer; allerdings in einer so starken Rechtsposition, dass er den Eigentümer während der Zeit der vereinbarten Mietdauer vom Gebrauch und der Nutzung der Mietsache ausschließen kann: der Eigentümer kann nicht nach Belieben einfach kommen und das Bade- oder Schlafzimmer inspizieren – oder gar benutzen! Für eine aus sachlichen Gründen angebrachte Inspektion muss er sich anmelden. Der Besitzer ist also berechtigter Nutzer der Mietsache auf Zeit, aber er ist und wird durch den Abschluss des Mietvertrages nicht »Eigentümer auf Zeit«, denn dann brauchte er ja anschließend keinen „Mietzins“, wie die Juristen die monatliche Mietpreiszahlung nennen, zu zahlen. Das man von einem Eigentümer eine Sache erwerben kann, ist klar. Das macht man bei jedem Brötchen- oder Autokauf. Brötchen sind meist nicht ganz so wichtig wie ein schickes Cabriolet. Darum ist ein Brötchenkauf unproblematischer abgewickelt. Bein Autokauf hingegen gibt es einen Kfz-Brief – ich spreche nicht von dem Kfz-Schein – in den der jeweilige Eigentümer eingetragen wird. Wenn z.B. ein Käufer den Wagen nicht aus seinem Ersparten bezahlt, sondern zur Finanzierung des Traumwagens bei einer Bank einen Kredit aufnimmt, um den Kauf mit Fremdmitteln zu finanzieren, dann behält die Bank für die Zeit der Darlehensgewährung den KfzBrief als Eigentumsnachweis des ihr zur Besicherung des Darlehens abgetretenen Kfzs ein. Der bei ihr zum Kauf 7 Siehe dazu auch die Zeitungsmeldung „Geständnis“ in Punkt „2.10.7 Rechtssicherheit und Verjährung im Strafrecht“, in der mitgeteilt wird, dass die Verjährungsfrist für Mord in Frankreich von vormals 15 Jahren heraufgesetzt worden sei. Auf eine »krumme« Jahreszahl unter 20, 16-19 Jahre? Das kann ich mir nicht vorstellen. 35 des Wagens einen Kredit aufnehmende Kunde erhält nur den Kfz-Schein und hat damit die Vermutung auf seiner Seite, dass er das Kfz berechtigterweise nutzt. Soweit zum Erwerb einer Sache vom Eigentümer. In den §§ 929-934 BGB wird nun zunächst geregelt, dass ein gutgläubiger Erwerb einer Sache von einem Dritten, der nicht Eigentümer ist, sondern die Sache nur in Besitz hat, grundsätzlich auch möglich sein soll. Ein Beispiel für eine der im 3. Buch des BGB „Sachenrecht“ unter „Erwerb und Verlust des Eigentums an beweglichen Sachen“ geregelten Konfliktfälle: Jemand leiht einem anderen etwas – und der Mistkerl verhökert die Sache unerlaubterweise unter der Hand weiter. Soll der bisherige Eigentümer, ohne dass er es wollte, sein Eigentum verlieren und ein gutgläubiger Käufer, der den Veräußerer für den rechtmäßigen Eigentümer hält und halten durfte, die Sache behalten dürfen, oder muss der Käufer die Sache trotz seiner Gutgläubigkeit wieder rausrücken und meist auch noch den Kaufpreis abschreiben, weil von solchen Leuten üblicherweise eh nichts zu holen ist? Sinn der Regelung des grundsätzlich möglichen gutgläubigen Erwerbs: Man muss nicht bei allen Sachen, die man von jemandem kauft, unbedingt nachforschen, ob der Verkäufer auch wirklich der Eigentümer ist, muss sich nicht von allen Sachen, die man z.B. auf einem Flohmarkt kauft, den Kaufbeleg vorlegen lassen. Das würde den Rechtsverkehr zu sehr erschweren. Diesen Konflikt des fraglichen gutgläubigen Erwerbs durch den Käufer lösten die Verfasser des BGB dahingehend, dass sie überlegten: Wer ist in dieser Fallkonstellation schutzbedürftiger, der Eigentümer, der ja denjenigen kennt, dem er eine Sache ausleiht oder der Käufer, der nur die Ware sieht und den Charakter des Verkäufers nicht unbedingt einzuschätzen vermag. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass es in einer solchen Fallkonstellation am fairsten sei, wenn bei gutgläubigem Erwerb der Käufer in seinem guten Glauben geschützt werde. Der gutgläubige Erwerb einer Sache wird darum rechtlich grundsätzlich auch dann zugelassen, wenn der Kaufgegenstand nur in den Besitz des Verkäufers gelangt ist, z.B. durch Übergabe vom Eigentümer an ihn, ohne dass der Besitzer auch Eigentümer wurde. Und wenn nun die verkaufte Sache ungewollt aus dem Besitz des Eigentümers gelangt ist, wenn er sie nicht dem Besitzer übergeben hat und gar nicht weiß, dass der die Sache in seinem Besitz hat? Wie soll dieser Konflikt dann entschieden werden? Klar ist die Sachlage natürlich, wenn man eine Sache nicht in einem staatlich konzessionierten Pfandhaus, sondern bei einem Hehler kauft: da weiß man, dass die zum Erwerb lockende Sache geklaut worden und deshalb unrechtmäßig in dessen Besitz gelangt ist. Ähnlich wurde die Konfliktsituation nach dem Motto: „Trau’ schau’ wem“ für den Fall gelöst, dass der Eigentümer die Sache freiwillig aus seinem Verfügungsbereich herausgegeben hatte: selbst Schuld, wenn er seine Sachen einem unsicheren Kantonisten gibt! Anders wird die Sachlage beurteilt, wenn ein Eigentümer eine Sache z.B. verloren hat, jemand sie findet und sie dann unredlicherweise verkauft, anstatt sie zur Polizei oder zum Fundbüro zu bringen. Da wird die Konfliktlage nach dem »Näher-dran-Prinzip« zu Gunsten des Eigentümers entschieden: der Eigentümer weiß bei Verlust nicht, welcher dubiose Mensch sein Eigentum findet. Der einzige, der die Möglichkeit eines abschätzenden Blicks auf den unrechtmäßigen Verkäufer hat, ist der Käufer; darum wird dem das juristische und damit letztlich das finanzielle Risiko des vielleicht fraglichen Eigentumerwerbs aufgebürdet. War der (nicht immer dubios auftretende) Verkäufer nicht der Eigentümer, muss selbst der gutgläubige Käufer dem Eigentümer die Sache zurückgeben und ist sein Geld los; es ist seine Sache zu sehen, ob er es von dem unrechtmäßigen Verkäufer zurückerlangen kann. Das Gesetz hält den Eigentümer für schutzwürdiger als selbst einen gutgläubigen Erwerber! Weil insbesondere ein bösgläubiger Käufer nicht geschützt werden muss, regelt § 935 I BGB, dass es keinen gutgläubigen Erwerb von Sachen geben soll, „… wenn die Sache dem Eigentümer gestohlen worden, verlorengegangen oder sonst abhanden gekommen war. …“ Ein gutgläubiger Käufer kann höchstens ein gutgläubiger Besitzer auf Zeit werden! Soweit die »Ouvertüre«. § 935 II BGB führt nun noch ein anderes Motiv in das Kunstwerk „Recht“ ein. Die neue Melodie lautet: „Diese [im Gesetz vorgenannten; der Verf.] Vorschriften finden keine Anwendung auf Geld, Inhaberpapiere sowie auf Sachen, die im Wege öffentlicher Versteigerung veräußert werden.“ Das geschieht aus Gründen des Verkehrsschutzes u.a. zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs: Man soll z.B. bei den völlig identischen Geldscheinen nicht prüfen müssen, wer der rechtmäßige Besitzer des jeweiligen Geldscheins mit der Seriennummer XYZ ist! Da wird der Erwerber neuer Eigentümer. Und nun lesen Sie noch einmal die meine vorstehenden luziden Ausführungen auslösende Zeitungsnotiz und wundern sich mit mir: „Prostituierte muß Geld zurückzahlen Karlsruhe – Eine Prostituierte, die von einem betrügerischen Beamten aus der Staatskasse bezahlt wurde, muss 8200 Euro zurückzahlen. Der Bundesgerichtshof bestätigte ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Az.: III ZR 38/04). (dpa)“ (HH A 22.10.04) Da scheint der BGH ja geradezu »contra legem«, gegen den eindeutigen Wortlaut des Gesetzes entschieden zu 36 haben! Zwar hatte schon das Reichsgericht, der Vorläufer des BGH, in der Sache RG 103/288 entschieden, dass die Bestimmung des § 935 II BGB obsolet sei – damit meinen die Juristen, dass eine entscheidungserhebliche Bestimmung in einer bestimmten Fallkonstellation nicht angewandt werden dürfe -, wenn auf Seiten des Erwerbers Bösgläubigkeit vorliege; aber ich weiß im Moment des Tippens ohne eine Möglichkeit des Nachschlagens in einer juristischen Bibliothek nicht, ob sich die Entscheidung damals vielleicht auf „Inhaberpapiere oder auf Sachen, die im Wege öffentlicher Versteigerung veräußert werden“ bezog. Jedenfalls verblüfft es, wenn jetzt das OLG Karlsruhe entschieden hat, dass eine »Gunstgewerblerin« - auch so ein schickes juristisch um „political correctness“ bemühtes umständliches Wort – einen bestimmten (Teil-?)Betrag zurückzahlen muss, die die Entlohnung für ihre hoffentlich schönen und erfolgreichen Bemühungen um Kundennähe von einem „betrügerischen Beamten aus der Staatskasse“ erhalten hat: Wer geht denn zu einer Dame des horizontalen Gewerbes und gibt ihr Geld – die Damen verlangen ja immer Vorkasse; damit kein falsches Gerücht aufkommt: das weiß ich nur aus meiner Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft und als Strafverteidiger(!) – und sagt ihr, bevor er sie auffordert, »die Beine breit zu machen« oder sich sonst wie um ihn zu bemühen: „Das Geld, das du von mir erhalten hast, habe ich geklaut, um, notgeil wie ich bin, von dir eine Triebabfuhr zu erhalten, weil ich einen Krampf in der Hand habe“ oder es mir aus sonst welchen anderen Gründen nicht selbst machen will. Die Männer, die dorthin gehen, lassen doch eher den »großen Macker raushängen« - selbst wenn der in Wirklichkeit recht klein geraten sein sollte! Da muss eine solche Zeitungsmeldung erstaunen. Leider werden die zum Verständnis erforderlichen Hintergrundinformationen nicht mitgeliefert. Ohne den Hinweis auf den „betrügerischen“ Beamten hätte man vermuten müssen, dass es sich um eine vom Gesetzgeber so genannte „Schlechtleistung“ gehandelt haben könnte, die zur Erstattung verpflichtet, weil die Dame die ausgehandelte Leistung nicht „in mittlerer Art und Güte“ erbracht habe. Ich kann also teilweise auch aus zu geringem juristischen Wissen heraus nicht alle mir interessant erscheinenden Meldungen und Berichte aus Tageszeitungen oder anderen Publikationen, in den letzten Jahren darüber hinaus verstärkt aus dem Internet, vor Ihnen ausbreiten, um Sie, wie ein routinierter Angler, mit einem guten Köder anzufüttern, damit Sie bei der Lektüre Ihrer Zeitung auch bei Artikeln mit juristischem Hintergrund nach Wissensbeute schnappen. Aber die Artikel, die ich ausgewählt habe, weil sie in den Kontext dessen passen, was ich Ihnen durch dieses auf meinem PC ständig wachsende Buch nahe bringen möchte, sollten möglichst schon etwas herausragend skurril sein, damit Sie sich die Problematik besser einprägen können. Natürlich hätte ich die von mir verwandten Zeitungsmeldungen auch selbst umschreibend und nicht im Originalwortlaut mitteilen können. Aber dann wäre der Stoff teilweise nicht so plastisch darzustellen gewesen und vor allen Dingen hätte ich dann mein anderes vorrangiges Ziel nicht erreicht, Ihnen die Vorbehalte oder gar Angst gegenüber Zeitungsartikeln mit juristischem Gehalt zu nehmen, wie es mir nach der Lektüre des Buches hoffentlich gelungen ist! Zu tief dringe ich selbstverständlich auch nicht in die jeweilige juristische Materie ein. Sie sollen beim Lesen des Buches ja kein Fernstudium in Juristerei absolvieren, sondern möglichst vergnüglich in die Materie des Rechts eingeführt werden: nicht mehr, aber auch nicht weniger! Hoffentlich können auch Sie nach der Lektüre dieses Buches freudig erleichtert ausrufen: „Mami, Mami, er hat gar nicht gebohrt!“ Um unterhaltsam zu sein und Sie auch mit Hintergründen, Entwicklungslinien und Auswirkungen bekannt zu machen, die nur noch entfernt etwas mit der heutigen Juristerei zu tun haben, habe ich teilweise auch ein wenig jenseits der manchmal trockenen Juristerei geplaudert. Wenn ich z.B. den historischen Hintergrund des Falles Galilei ausführlich dargestellt habe, so geschah das nicht, weil der Historiker in mir mit mir durchgegangen wäre – ich hätte mich durchparieren und streng an die Kandare nehmen können -, sondern um u.a. an diesem Beispiel deutlich zu machen, welchen Einfluss »die Religion« mittels des Rechts auf die wissenschaftliche Erkenntnis und die konkrete Ausgestaltung der Lebensumstände genommen hat – damit Sie dafür sensibilisiert werden, wie und dass auch heute noch »die Religion« insbesondere in »letzten« Entscheidungen und deren juristischer Ausgestaltung bei z.B. der künstlichen Befruchtung, dem Klonen, in der Frage der Abtreibung, der Homo-Ehe, der Sterbehilfe, … eine gewichtige Rolle spielt oder sie unangemessenerweise zu spielen versucht. Nun werden in diesem Buch solche in Zeitungen gesammelten Meldungen und Berichte ein bisschen aufbereitet und dadurch in einen juristischen Zusammenhang gestellt, der ihr Verstehen erleichtern soll. Allerdings birgt meine Art des Vorgehens bei der Abfassung dieses Buches die grundsätzlich mögliche Fehlerquelle, dass ich das Geschehen, über das in einer Meldung berichtet wird, für wahr unterstelle, unterstellen muss. Ich kann dabei aber auch ohne weiteres einer »Ente« aufgesessen sein. Das sehen Sie mir dann bitte nach. Ganz ohne Paragraphen und Gesetzesartikel - die in einem juristischen Text herumschwirren können wie die Fliegen in einem Kuhstall: vielleicht ganz sinnvoll, aber für den nur erste Orientierung und maximal einen groben 37 Überblick suchenden Leser sehr lästig – geht es nicht, wenn man sich in juristische Überlegungen einarbeiten will. Weil es aber unzumutbar wäre, sich all die angesprochenen Gesetze als Begleitlektüre bereitzulegen, wurden die jeweils einschlägigen Bestimmungen in den Text eingearbeitet; doch zusätzlich der Text unserer Verfassung wäre schon ganz hilfreich. Der Lehrer, der zunächst sich selber informieren und dann als »Multiplikator« anhand dieses Buches seine Schüler in den Bereich des Rechts einführen möchte - und dabei Hilfestellung zu geben, ist ein weiteres vordringliches Anliegen dieses Buches - sollte die mitabgedruckten Quellen als Materialsammlung ansehen. Sie sind durchaus als Arbeitsmaterialien einsetzbar. Als Beispiel seien die "Erklärung der Menschenrechte" oder die Zeitungsmeldungen über Vorstellungen von »Recht« in anderen Kulturkreisen genannt. Das manchmal angegebene Fazit sollte bei Verwendung der Materialien im Unterricht durch von den Schülerinnen und Schülern zu bearbeitende Fragen von ihnen selbst erarbeitet werden. Es weist auf wesentliche Grundeinsichten hin, deren Anzahl ständig erweitert werden kann und muss. Um aufzeigen zu können, dass viele Rechtsgedanken und viele Gedanken zum Recht teilweise Jahrtausende altes, bis auf »die alten Griechen« zurückgehendes gemeinsames abendländisches Kulturerbe der sich in länderübergreifender geistiger Auseinandersetzung gegenseitig angeregt habenden, vom »abendländischen Geist« geprägten Philosophenschulen und Vertretern aller philosophischer Denkrichtungen sind, sozusagen zur »europäischen Leitkultur« mit gemeinsamen Leitwerten gehören - gegen die dann in den vielen untereinander ausgefochtenen Kriegen auf diesem und den anderen Kontinenten, in all den religiös oder ideologisch geprägten Barbareien und all der Gier nach fremdem Land und fremdem Reichtum von den Kreuzzügen über die Inquisition, in Glaubenskriegen, Eroberungen anderer Erdteile mit Zwangschristianisierung, Versklavung und Ausrottung der dort zuvor ansässigen Bevölkerung in Amerika, Afrika und Australien bis zu den vielen Judenpogromen über alle Länder Europas mit zuletzt der durch Nazi-Deutschland industriell betriebenen Judenvernichtung permanent verstoßen wurde -, arbeitete ich aus einer Weltgeschichte der Philosophie in ComicForm die zentralen Aussagen der dort erfassten Denkschulen und einzelnen Philosophen hier mit ein. Immer wenn nach Überwindung einer großen Barbarei ein geistig-kultureller Neuanfang gesucht wurde, griff man auf diese teilweise schon seit Jahrtausenden gedachten und weiterentwickelten Gedanken zu den Grundzügen des Rechts zurück. Um die Lesbarkeit des juristischen Gehaltes dieses Buches - und hoffentlich damit die Freude an ihm - zu erhöhen, wurden nicht nur über lange Jahre gesammelte Aussprüche, Zeitungsmeldungen und –artikel verwandt, sondern ich kaufte mir zur Schlussüberarbeitung auch zwei Zitatenhandbücher, um dort nachschlagen zu können, was (andere) kluge Menschen zu den hier behandelten grundsätzlichen juristischen Problemen durch gründliches, tiefes Nachdenken an Einsichten gewonnen haben und welche schönen Formulierungen ihnen durch Geistesblitze dazu eingefallen sind. So kann und so soll deutlich gemacht werden, dass die Entwicklung des Rechts eine Jahrtausende alte, von vielen Generationen getragene und weiterentwickelte Kulturleistung ist, von der sich niemand – auch nicht durch eine die bis dahin geltenden Werte umstürzende Revolution, und das heißt immer auch von allen Werten der bis dahin geltenden Rechtsordnung - gänzlich abkoppeln kann. Wenn mir etwas bedenkenswert oder zutreffend und darüber hinaus schön formuliert dünkte, flickte ich es – wie auch alle während der Abfassung des Buches neu aufgetretenen und für erwähnenswert gehaltenen Fakten und Problemstellungen, wie z.B. Medizin und Recht hinsichtlich der uns in ihrer Entwicklung überrollenden Möglichkeiten der Gentechnologie - an der mir am passendsten dünkenden Stelle ein. Das kann hin und wieder zu kleineren Verwerfungen geführt haben, hat aber hoffentlich zu keinem Bruch in der Darstellung des mit dem Tagesgeschehen wachsenden Manuskriptes geführt. Neuere Vorkommnisse in ein lange fertiges Manuskript einzuflicken, ist – wie jeder eingesetzte Flicken – immer etwas problematisch. Das Buch ist nicht mehr aus einem Guss gefertigt, sondern in all den Jahren zu einem über Jahrzehnte gewachsenen »Organismus« der Gedanken zu immer neuen Aspekten der menschlichen Kulturleistung »Recht« geworden. Wenn Sie die Zitate des Gedankengutes längst verblichener Geistesgrößen stören sollten, dann bitte ich dafür um Nachsicht, denn es sollten auch andere mit ihren Einsichten zu Worte kommen. Durch die Zitate wollte ich nicht meine gegenüber den großen europäischen Philosophen dürftigeren eigenen Gedanken und Einsichten zu den Phänomenen »Gesetz«, »Recht« und »Gerechtigkeit« unter dem schmückenden Mantel von Geistesheroen verbergen und sozusagen mit einem Krönungsmantel umgeben. Mit diesen Hinweisen bezüglich eines Teiles der Zitate möchte ich gleich zu Anfang dem unberechtigten Eindruck vorbeugen, dass ich so umfassend belesen und gebildet sei, dass ich alle verwandten Zitate jederzeit aus meinem »Lesewissen« hervorkramen könnte und daraus auch hervorgekramt hätte. Ich habe nur, ach, auf Grund der Teilung Deutschlands 20 Semester u.a. Geschichte, Politik, Pädagogik und dann noch einmal Jura 38 studiert mit durchaus heißem Bemühen und bin als Lehrer, Fachlehrer für Politik und Rechtsanwalt beruflich tätig gewesen. Eine solche Doppelausbildung hilft zwar für die hier versuchte interdisziplinäre Zusammenschau dieser Wissensgebiete, nicht aber für den Erwerb eines solchen, durch die relative Vielzahl der verwandten Zitate vielleicht vermuteten Einzelfaktenwissens. Das ist pure Mimikry. Hilfreich ist da zuletzt die Website „www.aphorismen.de“ gewesen, die ich im Internet entdeckt habe, als ich noch immer keinen Verlag zum Publizieren gefunden hatte und in den Jahren des Suchens der zwischenzeitlich erreichte technische Fortschritt auch an mir und meinen Arbeitsmöglichkeiten nicht mehr vorbei gegangen war. Auf dieser dankenswerterweise nach einem sehr differenzierten Schlagwortkatalog gegliederten Website mit Suchfunktion können Sie einen Teil der Bekannten wiedertreffen, die ich Ihnen hier vorstellen werde. Eine mich als Lehrer-Referendar anleitende Schulleiterin fragte mich vor 35 Jahren einmal: „Hören Sie die Vorlesungen von Prof. Wencke?“ „Ja.“ „Was fällt Ihnen daran auf?“ Weil ich im Unterrichten noch ziemlich unbeleckt war, war mir gar nichts aufgefallen, außer, dass seine Vorlesungen für mich sehr interessant waren. Aber die Schulleiterin klärte mich – pädagogisch – auf: „Sie werden, wenn Sie einmal darauf achten, feststellen, dass irgendwo in der Mitte der Vorlesung immer eine Stelle zum Lachen ist. Und wenn man sich durch das Lachen von der Anspannung des mitdenkenden Lernens etwas erholt hat, kann man dann viel besser weitermachen.“ Dieses pädagogische Prinzip habe ich dann auch in dem von mir gegebenen Unterricht anzuwenden versucht. Und ich gab den später von mir angeleiteten Referendarinnen mit auf den Weg: „Ein guter Lehrer muss auch ein guter Kaspar sein: Die Bande kommt morgens in die Schule und will unterhalten sein!“ Bei der Gestaltung des Buches behielt ich das »Lach-Prinzip« bei. Darum ist die Auswahl der Zeitungsmeldungen manchmal zusätzlich auch unter diesem Gesichtspunkt vorgenommen worden, denn etwas ins Abstrusere Gehendes bleibt länger im Gedächtnis haften als etwas, das nicht zum Lachen oder Kopfschütteln reicht. Wer mit meiner durch die getroffene Auswahl teilweise offenbar werdenden Art des Humors nichts anzufangen weiß, den bitte ich im Voraus um Entschuldigung für die von ihr oder ihm so empfundene geistige Belästigung. Das wollte ich vorsichtshalber noch als »salvatorische Klausel« - ein im Buch näher erklärter juristischer Fachbegriff – angeführt haben. Es ist eine hohe Kunst, etwas Kompliziertes einfach darzustellen. Ich bin mir bewusst, an manchen Stellen in diesem Vorhaben gescheitert zu sein, weil ich wiederholt der Gedanken Fülle nicht in einen kurzen Satz pressen konnte. Durch den (jedenfalls zur Zeit meiner juristischen Ausbildung) in Anklageschriften obligatorisch zu verwendenden wirklich seitenlangen, teilweise 15 und mehr Seiten langen »Indem-Satz«-Bau, durch den alles über den oder die Angeklagten, die auf ihre Verletzung hin zu untersuchenden gesetzlichen Tatbestände und das ermittelte, zur Anklageerhebung geführt habende Geschehen in einem einzigen Satz formuliert werden musste(!), habe ich mir meinen früheren kurzen, knappen Schreibstil leider verdorben. Trotzdem viel Erfolg beim informierenden, lernenden Lesen – und hoffentlich fühlen Sie sich auch noch gut unterhalten! Wenn nicht, so hoffe ich, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches wenigstens die Toleranz aufbringen, die von Lessing in die Worte gefasst wurde: „Muss man, wenn man sich schwingt, stets adlermäßig schwingen? Soll nur die Nachtigall in unsern Wäldern singen? Der nebelhafte Stern muss auch am Himmel stehn.“ Schließlich habe ich mich bemüht, seine Mahnung zu beachten: „Nicht jeder, der den Pinsel in die Hand nimmt und Farben vergeudet, ist ein Maler.“ Sein Fazit: „Es kommt wenig darauf an, wie wir schreiben, aber viel, wie wir denken.“ Die Freifrau Ebner-Eschenbach meinte, dass das aus einem guten Buch ersichtlich werde: „In einem guten Buche stehen mehr Wahrheiten, als sein Verfasser hineinzuschreiben meint.“ Ich habe mich über viele Jahre ehrlich bemüht, ein solches Buch zu schreiben. Falls Sie sich beim Lesen - wider Erwarten - nicht gut genug unterhalten gefühlt haben, dann können Sie den Ausspruch von John Osborne auf meine jahrelangen schriftstellerischen Bemühungen beziehen: „Auch das schlechteste Buch hat eine gute Seite: die letzte!“ Hans-Uwe Scharnweber 39 I. TEIL DAS VERHÄLTNIS VON »RECHT« UND »GESETZ« »Recht« und „Gesetz« Was ist »Recht«, was »Gesetz« zunächst einmal in einem vorjuristischen Verständnis? Sind diese Begriffe deckungsgleich oder sinnlos verdoppelnde Redeweisen wie »runder Kreis«, »schwarzer Rabe«? Ausgangspunkt der ersten Überlegungen zur Annäherung an diese zentralen Begriffe sei die gesetzliche Regelung des Artikels 20, Absatz 3, Satz 1, 2. Halbsatz Grundgesetz (Kurzschreibweise: Art. 20 III 1, 2. HS GG): "... die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden." Doch was ist zunächst einmal das »Grundgesetz«, dass eine so zentrale Bestimmung in ihm enthalten ist? Bevor wir uns den nicht nur für unsere, sondern für jede Rechtsordnung zentralen Begriffen »Gesetz« und »Recht« zu nähern versuchen, soll zunächst erst einmal klargestellt werden, was das Grundgesetz für die Rechtsordnung unseres Staates und damit die rechtliche Organisation unseres eigenen Lebens bedeutet. Danach soll versucht werden, die in dem Grundgesetz verwandten Begriffe »Gesetz« und »Recht« genauer zu fassen. 1 Das »Grundgesetz« (GG) als unsere »Verfassung« Das »GG« als unsere »Verfassu ng" Unsere Verfassung heißt nicht »Verfassung«, sondern »Grundgesetz«, ist aber trotz dieser z.B. im Gegensatz zur »Verfassung der Frankfurter Nationalversammlung« von 1849 oder der »Weimarer Verfassung« von 1919 bewusst anders getroffenen Wortwahl unsere Verfassung. Die Weimarer Verfassung hatte offiziell bis zum Zusammenbruch der Nazi-Diktatur 1945 bestanden. Weil sie als eine »Republik ohne Rechtsschutz« (Schönhoven) auf Grund der in ihr enthaltenen juristischen Konstruktionen und Regelungen das scheinlegale Hinübergleiten der ersten deutschen Republik, der Weimarer Republik, in die Nazi-Diktatur ermöglicht hatte, wurde die Weimarer Verfassung nach 1945 nicht einfach in revidierter Form erneuert. Sie hatte ja schließlich ermöglicht, dass in Deutschland und den von ihm während des Zweiten Weltkrieges zeitweilig beherrschten Teilen Europas neben den »normalen« viele unmenschliche Gesetze galten oder gar ein gesetzloser Raum entstehen konnte, dadurch letztlich »das Recht« als Richtschnur und Schutz des einzelnen aus dem Leben der Deutschen und dem der später dem Nazi-Regime unterworfenen Ausländer verschwunden war - jedenfalls aus dem Leben der politischen Gegner der Nazis, der Europäer jüdischen Glaubens, derer die Nazis habhaft werden konnten, desgleichen der Zeugen Jehovas, der Sinti und Roma, und schließlich großer Teile der Slawen, um nur die größten Gruppen derjenigen zu nennen, die teilweise gesetzlos, aber auf jeden Fall rechtlos bis hin zu ihrer Ermordung staatlich verfolgt wurden. Darum schuf der Parlamentarische Rat 1949 nach diesen einschneidenden Diktaturerfahrungen als Reaktion auf den nationalsozialistischen Unrechtsstaat unter dem Schock der bedingungslosen Kapitulation und des totalen staatlichen Zusammenbruchs auf Grund des Erlebnisses einer abwehrschwachen Demokratie, die in ihrer zu großen Liberalität ihren „legalen Mördern auch noch das Schwert zur Beseitigung dieses Staates in die Hand gedrückt hatte“ (Haffner), für den westlichen Teil Rest-Deutschlands ein weitgehend neues Verfassungswerk. Dabei wurde dann die Bezeichnung „Grundgesetz“ bewusst gewählt, um den vorläufigen Charakter dieser Verfassung, in der die philosophische und juristische Weisheit von Generationen verarbeitet ist, für die Übergangszeit bis zur angestrebten Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung (Präambel a.F. und Art. 146 a.F. GG) auch schon sprachlich hervorzuheben. Nach dem Beitritt der DDR wurde diese Bezeichnung „Grundgesetz“ - gegen den Wunsch einer gar nicht so kleinen Minderheit - beibehalten, weil das zunächst als Verfassungsprovisorium gedachte Grundgesetz sich bewährt und in den bis dahin schon 40 Jahren seines Bestehens eine eigene, zutiefst demokratische Rechtstradition entwickelt hatte. (Vorangegangene Verfassungen hatten wesentlich kürzere Verfallszeiten!) Als weiteres Argument wurde vorgebracht: Man dürfe das „Fenster der Gelegenheit“ zur Wiedervereinigung nicht durch eine langwierige Verfassungsdebatte zufallen lassen! Das Grundgesetz ist die für uns Bürger Deutschlands freieste Verfassung, die je auf deutschem Boden Geltung erlangt hat. Eine solche gute Rechtstradition wird nicht leichten Herzens durch eine neu zu schaffende 40 Verfassung beendet, die in den größten Teilen dem Grundgesetz entsprechen würde, ja sogar entsprechen müsste, um uns Bürgern einen gleich großen Freiraum zur Gestaltung unseres Lebens zu eröffnen. Nach all dem kann festgehalten werden: Die Unterscheidung in der Wortwahl zwischen "Grundgesetz« und »Verfassung« hat nur eine sprachlich-politische sowie eine auf unsere kümmerliche demokratische Tradition abzielende, aber keine (staats-)rechtliche Bedeutung. Das Grundgesetz ist, wie ein Blick in das Inhaltsverzeichnis sofort offensichtlich macht, in die Präambel und 14 große Abschnitte (I – XI, teilweise mit einem Unterbuchstaben) eingeteilt. Die für den einzelnen Bürger wichtigsten Abschnitte sind die Abschnitte "I. Die Grundrechte" und "IX. Die Rechtsprechung"; letzterer deswegen, weil darin in den Artikeln 101-104 die sogenannten »justiziellen Grundrechte« geregelt sind, die als Grundrechte eigentlich auch in den Abschnitt I. gehörten. Das Grundgesetz ist nicht »in Granit geschlagen«. Nicht einmal in seinem Grundrechtsteil! Wegen seiner hohen Regelungsdichte ist das Grundgesetz von 1949 bis zum Jahre 2002 mit zuletzt der Einfügung des Tierschutzes als Staatsziel in Artikel 20 a 51-mal geändert worden: Je höher die Regelungsdichte in einer Verfassung, desto öfter muss sie anpassend geändert werden. Aus dieser Einsicht hatte der französische Staatsmann Talleyrand zur Zeit der Französischen Revolution die Maxime aufgestellt, dass eine Verfassung am besten kurz und unklar sein sollte. Andere Länder ändern ihre Verfassung wesentlich seltener; die Verfassung der USA z.B. erhielt seit 1787 nur 27 Zusätze. 1.1 Präambel Präambel Die angesprochene Vorläufigkeit des Grundgesetzes wurde aus seiner Präambel a.F. (1989) deutlich, die bis zur Wiedervereinigung mit folgendem Wortlaut Geltung hatte: "Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden." Artikel 146 a.F. GG Diese vorläufige Form der Präambel – in der seit 1989 geltenden neuen Form haben die Deutschen „in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“ - wurde ergänzt durch den Artikel 146 a.F. (bis 1989) "Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist." Eine »Grundgesetz« genannte Verfassung mit eingebautem – allerdings unbestimmten - Verfallsdatum also. Eigenartigerweise klingt die Neufassung des „Art. 146 GG Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Selbstbestimmung beschlossen worden ist.“ immer noch so, als wenn das Grundgesetz weiterhin seinen vorläufigen Charakter beibehalten habe, immer noch eine neue Verfassung geplant sei. Nichts falscher als das! 41 1.1.1 Gott als in der Präambel herausgehobener Bezugspunkt staatlichen Handelns Gott als in der Präambel herausgehobener Bezugspunkt staatlichen Handelns Vor allen im Grundgesetz getroffenen Regelungen steht als Vorspruch die Präambel - mit Gott als herausgehobenem Bezugspunkt, was bei den Beratungen über die Neuformulierung des Grundgesetzes nach dem Beitritt der ostdeutschen Länder zu einer Diskussion führte: "... 'Gott steht nicht zur Disposition'. ... Die leidenschaftliche Diskussion in der Verfassungskommission ... hatte sich an einem Antrag von MdB Wolfgang Ullmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) entzündet, der in der Präambel des Grundgesetzes die Bezugnahme auf Gott radikal streichen und durch die Formulierung ‘im Bewußtsein seiner Verantwortung vor der deutschen Geschichte und gegenüber künftigen Generationen' ersetzen wollte." (Das Parlament 18.06.93) "Der Streit um das Grundgesetz Scholz: Anrufung Gottes beibehalten epd Bonn - Die Anrufung Gottes in der Präambel des Grundgesetzes soll nach Ansicht des Vorsitzenden der Verfassungskommission, Rupert Scholz (CDU), beibehalten werden. Befürchtungen, hierdurch könnte sich ‘durch die Hintertür' ein Stück Kirchlichkeit in das Staatswesen einschleichen, seien unbegründet. Der ostdeutsche Abgeordnete und Kirchenhistoriker Wolfgang Ullmann (Bündnis 90/Grüne) hatte in der Kommission zur Grundgesetzreform beantragt, ‘in der Verfassung auf Gott zu verzichten'. Mit dieser Forderung stehe der ostdeutsche Abgeordnete allein, sagte Scholz gestern. Dessen Vorschlag lasse sich damit erklären, daß Ullmann aus der ehemaligen DDR komme. Dort habe ein anderes Verhältnis von Staat und Kirche bestanden, ..." (HH A 18.03.93) "Gott bleibt im Grundgesetz Theologe Ullmann wollte die Präambel ändern - er stand allein Bonn - Gott bleibt im Grundgesetz. In einer mehrstündigen Debatte der Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat über die Präambel des Grundgesetzes zeichnet sich ab, daß eine große Koalition an den Einleitungsworten des Grundgesetzes ‘Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ...‘ festhält. Der ostdeutsche Theologe und Bundestagsabgeordnete Wolfgang Ullmann (Bündnis 90/Grüne), der eine völlige Neuformulierung der Präambel vorschlug und dabei auf Gott verzichten will, stand mit diesem Bestreben weitgehend allein. Lediglich der PDS-Bundestagsabgeordnete Uwe-Jens Heuer unterstützte die Ullmann-Initiative. Für die CDU meinte deren Rechtspolitiker Horst Eylmann zu dem Ullmann-Antrag, er sei bestürzt, wie wenig Gefühl darin der Haltung und dem Ethos der Mütter und Väter des Grundgesetzes entgegengebracht werde. Die Bezugnahme auf Gott, die seit 1949 das Grundgesetz einleitet, sei durch die Abkehr von dem atheistischen Regime der Nazis motiviert gewesen. An dem Gottesbezug in der Präambel will auch der FDP-Politiker Burkhard Hirsch nicht rütteln. Dies sei eine ‘erhabene' Formulierung, wie man sie nicht besser machen könne. Respekt für die Meinung Ullmanns und dessen theologische Argumente für die Streichung Gottes aus dem Grundgesetz bekundete der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel. In einem sehr persönlichen Votum legte er jedoch dar, warum er an der Verankerung der ‘Verantwortung vor Gott‘ in der Präambel festhalten will. Vor dem Hintergrund der Herrschaft der Nationalsozialisten werde mit dem Gottesbezug daran erinnert, daß der Mensch nicht allmächtig und letzte Instanz sei. ..." (HH A 24.04.93) Nicht nur wir, aber insbesondere wir Deutsche haben aller Welt den Beweis dafür geliefert, dass Wissenschaft dem Menschen zwar Wissen liefert, aber nicht zwangsläufig damit verbunden auch Gewissen. Darum muss Recht Grenzen setzen, dessen Wertmaßstab letztlich aus einem religiösen Rückbezug gewonnen werden kann – aber seit Kant nicht mehr aus der Religion gewonnen werden muss -, wenn der religiöse Wertmaßstab den Menschenrechten entspricht. Gegenbeispiel: Ajatollah Khomeini qualifizierte aus seinem Islamverständnis heraus die Menschenrechte als „von Zionisten ausgedachte Regelsammlung“ ab, die „alle wahren Religionen zerstören will“ (SPIEGEL 29.09.03). Vielleicht hatte die katholische Kirche das zunächst ähnlich gesehen, denn nach einer Bemerkung des renommierten katholischen Universitätslehrers der Universität Tübingen Hans Küng 42 im DLF vom 22.12.04 sind die Menschenrechte von der katholischen Kirche erst durch das Zweite Vatikanische Konzil (Vaticanum II) 1962-1964 anerkannt worden! Die von ihrem Ansatz her mit Anspruch auf universelle Geltung gedachten, allgemeinen Menschenrechte sind mit Sicherheit der wichtigere Bezugspunkt als ein religiöser Rückbezug, denn sie sind auf Toleranz gegründet. Dagegen gibt es zu viele Religionen mit sich gegenseitig ausschließenden Ausschließlichkeitsansprüchen. Und da »Religion« – oft auf Grund behaupteter göttlicher Eingebung - von Menschen zur Rettung ihrer Seele oder zur Verfolgung ihrer Instinkte und Triebe, nicht aber zur Gestaltung eines möglichst konfliktfreien Zusammenlebens mit Andersgläubigen »gemacht« und von ihnen teilweise hemmungslos gelebt wurde und wird, ist Toleranz kein Wesensmerkmal für Religionen! Auch bei der Schaffung der Verfassung Europas versuchten christliche Kräfte – in Deutschland CDU und CSU , in der geplanten Präambel einen Gottesbezug zu verankern, was aber in dem zwar überwiegend katholischen Frankreich an dessen strikt laizistischer Tradition scheiterte. So gab es in dem Entwurf stattdessen einen Bezug auf die 2.000-jährige Tradition Europas. Das ließ jedoch die katholische Kirche, bei der ihre zumindest unterschwellige Frontstellung zu den anderen christlichen Religionen, insbesondere aber zu den nichtchristlichen Religionen immer mitgedacht werden muss, nicht ruhen: Papst: EU-Verfassung muss sich auf Christentum beziehen Das Christentum ist nach Ansicht von Papst Johannes Paul II. Hauptgarant für Frieden in Europa. Deshalb müsse es auch in der EU-Verfassung entsprechend erwähnt werden, meint er. Nach der Auffassung von Papst Johannes Paul II. sind christliche Werte eine Garantie für die Zukunft des europäischen Kontinents. Das Christentum stehe für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in Europa, sagte der Papst am Sonntag beim Angelusgebet in seiner Sommerresidenz in Castelgandolfo bei Rom. Eine ausdrückliche Erwähnung der christlichen Wurzeln des Kontinents in der künftigen EU-Verfassung sei daher dringend notwendig, forderte er. Mit einem solchen Schritt könne das Gemeinwohl sowohl für Gläubige als auch für Nichtgläubige geschützt werden, betonte er. Zur Begründung führte der Papst an, dass das Christentum über Jahrhunderte hinweg als einigendes Element für die europäischen Völker gewirkt habe. Noch heute stelle es eine unerschöpfliche Quelle für Spiritualität und Werte dar, die beim Aufbau der Europäischen Union unersetzlich seien, sagte er. Die Europäische Verfassung soll noch in diesem Jahr in Rom unterzeichnet werden. (nz) (netzzeitung 24.08.03) Eine Präambel ist kein hehres aber letztlich »unwesentliches Geplapper«. Würde der christliche Ursprung Europas als verpflichtende Tradition für alle Staaten der EU in der zu schaffenden Verfassung der EU festgeschrieben, würde damit die Tür Europas für die Türkei und Marokko, von dem auch immer wieder geschrieben wird, dass es – warum eigentlich? – ein Aufnahmekandidat für die EU sei, automatisch geschlossen. Natürlich richtet sich darum eine solche Stellungnahme wie die des Vatikans unausgesprochen, aber ganz explizit, gegen eine Mitgliedschaft der muslimischen Türkei in der EU, die der Türkei laut Radiomeldungen zwei Wochen zuvor – unverschämter- weil unzuständigerweise - von den USA(!), nicht jedoch von der EU, für den Fall versprochen worden sein soll, dass die Türkei 2003 Truppen für die militärische Verwaltung des Iraks zur Verfügung stellen sollte. Da stellt sich die Frage: Was ist Europa? Was macht seine Identität aus? Erst wenn diese Frage hinlänglich beantwortet ist, erhalten wir den meist nur dumpf gefühlten Maßstab für die Beurteilung der Frage, welche Länder zu Europa gehören – und welche eben nicht! Nur ein solcher Maßstab bewahrt uns vor einer unsere Identität als Europäer berührenden oder gar treffenden geographischen, von einigen gleichwohl politisch gewollten Überdehnung dessen, was »Europa« ist. Es kann nicht als Maßstab dienen, dass aus der islamischen Welt heraus eine Terrorwelle den ganzen Globus überzieht. Wenn verübter Terrorismus ein Ausschlusskriterium wäre, hätte Deutschland in den Zeiten der RAF nicht zu Europa gehört, dürften Großbritannien mit dem Bombenterror in Nordirland und Spanien mit dem ETA-Terror im Baskenland nicht zu Europa gehören. Man könnte den Gehalt dessen, was das »geistige Europa« ausmacht, vielleicht schon an der Musik festzumachen versuchen: Wer mal an einem Tag von einem islamisch geprägten arabischen oder türkischen Land nach Hause gekommen ist, wird das vielleicht auch dann empfunden haben, wenn er nicht morgens Mozart, mittags Beethoven und abends Bach zu hören pflegt. Das sind so offensichtlich andere Musikkulturen, die nichts miteinander gemeinsam haben. Aber viele europäische »Musik« wird (wohl nicht nur von mir) als so störend empfunden, dass über den Bereich 43 der Musik vermutlich kein verlässlicher Maßstab dafür zu gewinnen ist, was »Europa« ausmacht. Wir brauchen einen anderen Maßstab. Und wenn es um die Frage der europäischen Identität geht, dann kann das nicht so sehr ein geographischer, sondern muss eher ein geistiger Maßstab sein, der an die Jahrhunderte der europäischen Geistesgeschichte und -entwicklung, der an die europäische Identitätsbildung angelegt wird. Europa ist ganz entscheidend vom Christentum geprägt worden. Der Aufbau Europas im Mittelalter wurde zu großen Teilen insbesondere durch die vorbildliche Arbeit der Klöster christlicher Orden im Zuge der Christianisierung Europas und der Ostkolonisation geleistet. Der europäische Urwald, der zuvor nur entlang der großen Flüsse durchquert werden konnte, wurde gerodet, das Land urbar gemacht. Schriftlichkeit, Voraussetzung jeder Hochkultur, wurde durch die Klöster bewahrt und verbreitet. Es gab nichts anderes Verbindendes im zerrissenen, sich untereinander - meist aus Glaubensabgründen - teilweise bis aufs Äußerste befehdenden christlichen Abendland als das in seiner Auslegung heftig umkämpfte Christentum. Und es stimmt darüber hinaus, was kaum jemand anzusprechen für opportun hält: Der christliche Grundkonsens Europas wurde in dem Abwehrkampf gegen den Islam mit geschaffen: durch die gemeinsame Abwehr des zunächst von Westen über Spanien eindringenden Islam seit dessen Einfall in Europa mit der Überquerung der Meerenge von Gibraltar 711 n.Chr., der Doppelschlacht von Tours und Poitiers 732 n.Chr., die während des Mittelalters im Rolandslied in Frankreich, England und Deutschland gedichtete und viel besungene Abwehr der „Sarazenen“ (als Sinnbild der Araber, Muselmanen und aller anderen Nichtchristen, gegen die das Kreuz gepredigt wurde), weiter über die Rückeroberung Spaniens von den Mauren (die 1492 abgeschlossene „Reconquista“, die in Spanien noch heutzutage in Volksfesten gelebte Geschichte ist) und dann nach dem Fall des 1.000-jährigen oströmischen Reiches mit seiner Hauptstadt Konstantinopel 1453 das Eindringen der aus der Mongolei auf einem langen Treck nach Westen eingedrungenen Turkvölker und mit ihnen des Islam von Osten in den Bereich Ostroms über den Balkan bis zur zweifachen Belagerung Wiens 1529 und 1683 durch die muslimischen Heere der osmanischen Hohen Pforte, von wo sie letztlich durch eine gesamteuropäische Kraftanstrengung der von Papst Innozenz XI. initiierten Heiligen Liga von 1684 (bestehend aus dem Heiligen Stuhl, den direkt angegriffenen Habsburger Landen und den anderen Teilen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Polen und Venedig) zurückgeschlagen wurden, zwischen den beiden Belagerungen Wiens 1571 in der Seeschlacht von Lepanto/Naupaktos (Griechenland), der letzten Galeerenschlacht und mit 50.000 Toten der bisher größten und opferreichsten Seeschlacht der Kriegsgeschichte, und dann die Zurückdrängung der osmanischen Truppen vom Balkan im 18. und 19. Jahrhundert bis zu dem von anderen europäischchristlichen Ländern bei aller sonstigen Gegensätzlichkeit unterstützten Freiheitskampf der Griechen 1821-29 gegen die Türken. Die Bannung der „Türkengefahr“ wurde wegen ihrer ernsthaften Bedrohung der christlich-abendländischen Staatengemeinschaft von vielen europäischen Mächten über Jahrhunderte als abendländische Gemeinschaftsaufgabe verstanden und wahrgenommen und wurde so auch mit identitätsstiftend für »Europa«. Die zunächst im »finsteren Mittelalter« von den islamischen Wissenschaftlern – insbesondere der MaurenGebietsherrschaften in Spanien, nicht der Türkei - geistig befruchteten europäischen Gelehrten entwickelten in der Neuzeit, insbesondere in der der Renaissance mit dem Humanismus als geistiger Hauptströmung folgenden Zeit der Aufklärung, die den Aberglauben und den verkündeten Glauben mehr und mehr durch das erforschte Wissen ersetzte, unter Beschreitung auch vieler Irrwege Geistes-, Staats- und damit auch Rechtsideen, an denen weder der arabische Islam noch die Türkei teilhatte – und nach Vermutung des VG Köln in dem Abschiebungsverfahren Kaplan, einem der 16 von ihm gegen seine Abschiebung betriebenen Verfahren, die Türkei selbst im Jahre 2003 nicht teilhatte: Anders ist es nicht zu erklären, dass der fundamentalistische „Kalif von Köln“, Kaplan, der 1992 wegen drohender Verfolgung in der Türkei als Asylberechtigter anerkannt worden war – nach seiner Verurteilung wegen der Anstiftung zum Mord wurde die ihm 1992 gewährte Asylberechtigung aber widerrufen, seine Frau bleibt jedoch weiterhin asylberechtigt -, nach Verbüßung seiner mehrjährigen Gefängnisstrafe zunächst nicht dem Wunsch der Bundesregierung und der Türkei folgend in die Türkei abgeschoben werden durfte, weil ihm dort ein Hochverratsverfahren wegen „bewaffneten Versuchs zum Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung” droht, weil er sich 1995 zum Kalifen ausgerufen hatte, 1997 den "Anatolischen Föderalen Islamischen Staat" gegründet und das in einem Brief den türkischen Abgeordneten mitgeteilt hatte - als Beweis dafür, dass Kaplan versucht haben soll, die Türkei zu spalten, dient ein Artikel aus dem Organ seines Islamstaats - und er 1998 zum 75. Jahrestag der Gründung der Republik Türkei auf das Mausoleum Atatürks, wo sich die ganz Staatsspitze versammelt hatte, einen Anschlag mit einem Flugzeug geplant haben solle. Ein weiterer Anschlag sei auf eine Moschee geplant gewesen. Die Verwaltungsrichter der ersten Instanz nahmen an, dass der Prozess nicht in rechtsstaatlichen Bahnen verlaufen werde, obwohl die Türkei die Todesstrafe abgeschafft und als Voraussetzung für eine Auslieferung Kaplans der Bundesregierung die Durchführung eines rechtsstaatlich einwandfreien Verfahrens schriftlich zugesagt hatte! Ohne diese Garantie eines rechtsstaatlichen Verfahrens in der Türkei wäre die mühsam 44 erkämpfte Abschiebung Kaplans unzulässig gewesen. Aber die Verwaltungsrichter des VG Köln sahen die sehr reale Gefahr, dass in den Hochverratsprozess gegen Kaplan zuvor unzulässig erlangte »Beweismittel« eingebracht werden könnten, die durch die Folterung von Kaplans Anhängern erlangt worden waren, als die 1998 ein Flugzeug (angeblich) für ein Attentat auf das Atatürk-Mausoleum in Ankara hatten entführen wollen. Ähnlich sah es das OVG Düsseldorf 2003 in dem Auslieferungsverfahren Kaplan. Wörtlich heißt es in dessen Urteilsbegründung: Die Anhänger Kaplans, die im Verfahren gegen ihn als Belastungszeugen vorgesehen waren, seien von türkischen Sicherheitskräften "hauptsächlich mit groben Schlägen, Aufhängen an den Schultern, Behandlung mit heißem, kaltem und unter Druck gesetztem Wasser, Quetschung der Hoden und deren Mißhandlung durch Stromstöße" gefoltert worden. Der türkischen Menschenrechtsorganisation IHD sind ausreichend andere Fälle von Folterungen in türkischen Gefängnissen bekannt, so dass einen auf Grund von Zusicherungen für die Durchführung eines rechtsstaatlichen Verfahrens unter Verzicht auf Folterung an die Türkei ausgelieferten „Kalifen“ nur sein Prominentenstatus schützen könnte. An den Schultern aufgehängt zu werden und dann mit verdrehten Armen hängend die Hoden gequetscht oder mit Stromstößen malträtiert zu bekommen, macht beflissen gesprächsbereit! Das kann jeder Leser an sich selbst ausprobieren (lassen), ohne zusätzlich unter der Decke zu hängen. Da erzählt man alles, was die Vernehmenden hören wollen – wenn nur der Schmerz aufhört! Nachdem die Türkei durch u.a. auch eine Strafrechtsreform erreicht hatte, dass die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen bezüglich einer EU-Mitgliedschaft begonnen werden sollen, sie weiß, dass sie unter verschärfter Beobachtung steht und u.a. auch der Prozess gegen Kaplan wegen Hochverrats und versuchten Umsturzes als einer der vielen erforderlichen Lackmustests auf ihre Demokratiefähigkeit angesehen werden wird, ist der Hassprediger Kaplan trotz geltend gemachter inlandsbezogener Abschiebungshindernisse in Form einer Prostata-Krebserkrankung, die eine Abschiebung angeblich unmöglich mache und darüber hinaus in der Türkei nicht (richtig) behandelt würde, mit Billigung des BVerwGs in Leipzig trotz weiterlaufender Revisionsverhandlung gegen ein Urteil des OVGs Münster und weiteren Verbleibs seiner Familie in Deutschland Ende 2004 zum Abschluss des sechzehnten(!) diesbezüglichen Verfahrens an die Türkei ausgeliefert worden. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Auf Grund der Tatsache, dass die Geschichte des Abendlandes auch die Geschichte der gemeinsamen Abwehr des Okzidents gegen den Islam ist und dass die Türkei an der europäischen Geistesentwicklung der Neuzeit nicht teilhatte, gehört selbst die heutige Türkei nach den 1920 eingeleiteten Atatürkschen Reformen und der seit ca. 2000 inzwischen eingeleiteten Hinwendung zu demokratischen Staatsstrukturen weder aus historischen noch aus kulturellen Gründen mit zu Europa! Es gibt nach meinem Dafürhalten kein einziges historisches oder kulturelles Argument, das die Zugehörigkeit der Türkei zu Europa zu stützen in der Lage wäre. Es reicht nicht, dass die Türkei einst auf dem Balkan große Gebiete Europas beherrscht hatte. Das Fehlen historisch-kultureller Argumente für eine mir unmöglich erscheinende Zugehörigkeit der Türkei zur EU kann auch nicht dadurch geheilt werden, dass dort möglicherweise irgendwann einmal die Menschenrechte bis in die abgelegenste Polizeiwache Geltung erlangt haben könnten und die Gerichte sie beherzigen sollten: Dass die Europäer durch die vor Wien geschlagenen Türken als Beute deren Kaffe kennen gelernt haben und sich daraus die Wiener Kaffeehauskultur entwickelt hat, reicht nicht als tragfähiges kulturelles Argument. Zählte das als Argument, müsste auch China zu Europa gehören, denn wir tragen – wenigstens ab und zu – auch mal Seidenhemden. Und freundschaftliche diplomatische Beziehungen begründen auch nicht die Zugehörigkeit eines Landes zu Europa; die haben wir schließlich auch zu Australien und Ozeanien. Wenn alle außereuropäischen Randstaaten, und dazu muss man die Türkei trotz ihres dreiprozentigen europäischen Gebietszipfels rechnen, in die EU aufgenommen werden sollten: wo wäre da die Grenze? Am Irak? In Nord-Afrika, da auch Marokko in die EU drängte? Was sollte das einigende historisch-kulturelle Band einer solchen Europäischen Union sein? Gibt es vielleicht in Ermangelung historisch-kultureller andere durchschlagende Gründe für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei? Politische? „Eine demokratische Türkei wäre ein Aushängeschild für die gesamte arabische Welt“, lautet ein Argument des Ministerpräsidenten Luxemburgs, Junkers. Das kann schon sein: Aber muss deswegen die Türkei in die EU aufgenommen werden? Dann müssten ja alle anderen autoritären Staaten z.B. der SEATO, die wie die Türkei mit den USA einen Ring von Staaten um die damals aggressiv ausgreifende UdSSR gelegt hatten, zum Erlernen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in die Europäische Union aufgenommen werden! Was wäre an der EU dann - aber außer ihrem Ursprung - noch europäisch? Junkers sieht in der EU darüber hinaus „keinen Christenverein“ und die Türkei seit dem 16 Jahrhundert als „europäische Macht“ (Interview im DLF am 03.09.03). Es hätten in Europa schon immer Völker mit unterschiedlicher religiöser Ausprägung zusammen gelebt. Sicher, deswegen hatten wir ja auch so viele Religionskriege in Europa! Und das nur unter denjenigen, die sich als Christen - mit dem sie an sich verpflichtenden zentralen Gebot des Christentums: der Feindesliebe - begriffen. Religiöse Toleranz herrscht 45 unter den Christen erst, seitdem die Religion offiziell zur Privatsache geworden ist. Aber das ist im Islam nach dessen Grundannahme, dass Religion und Staat eins zu sein hätten, nicht möglich! Was sollen wir uns mit noch mehr islamistischen Fundamentalisten belasten, die in der Türkei ihr teilweise mörderisches Unwesen treiben, um die Vorrangstellung des Korans in ihrer dem 7. Jahrhundert zugewandten Blickrichtung vor jeglicher zivilen Regelung herbeizubomben? Beispiele gab es zu Hauf, dass Andersdenkende umgebracht wurden, indem z.B. Parlamentsangehörige umgebracht wurden, ein Hotel angezündet wurde, in dem dann viele der dort versammelten kritischen Schriftsteller verbrannten. Eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU wird sehr stark von den USA aus deren geostrategischen Interessen heraus »gepuscht«. So wurde der Türkei von den USA unverschämterweise eine Mitgliedschaft in der EU versprochen, um sie in den Krieg gegen den Irak Saddam Husseins zu locken. Unverschämt finde ich daran, dass die USA Versprechungen zu Lasten Dritter macht, denn sie hat die die sich daraus ergebenden Probleme ja nicht auszubaden. Die USA würden es sich höchlichst verbitten, wenn die EU Mexiko eine Angliederung an die USA verspräche, um das Problem der mexikanischen Wanderarbeiter auf diese Weise zu lösen! Und das katholische Mexiko steht den religiös christlich-bigotten USA kulturell wesentlich näher als der EU die islamische Türkei! Was im geostrategischen Interesse der USA liegt, muss längst nicht im Interesse der EU liegen! Die Befürworter eines Beitritts der Türkei zur EU werfen den konservativen Gegnern eines Türkei-Beitritts vor, eine hilflose und längst überholte Debatte zu führen: Die Türkei, so heiße es in hauptsächlich konservativen Kreisen, passe nicht ins christliche Europa und gehöre geografisch gar zu Asien. Beide Argumente zielen nach Meinung der Befürworter ins Leere: Nicht einmal der EU-Konvent habe es für angebracht gehalten, einen Bezug zum Christentum im Entwurf der EU-Verfassung festzuschreiben. Und mit dem Assoziierungsvertrag von 1963 und der Verleihung des Status eines Beitrittskandidaten 1999 habe die EU die Türkei als europäisches Land (angeblich) akzeptiert. Die politischen Fakten würden jetzt in absehbarer Zeit den rechtlich abgesicherten Status einer Vollmitgliedschaft erzwingen – weil man damals aus politischer Feigheit die erforderliche Diskussion um die andere ausschließende Identität Europas nicht hat führen wollen und sich darauf verlassen hat, dass sich der – ehemalige?1 - Folterstaat Türkei nicht demokratisch wandeln werde und somit unter Hinweis auf die politischen und gesellschaftlichen Defizite ein Beitritt jederzeit abgelehnt werden könnte. Nun wandelt sich die Türkei rapide; und das unter einer konservativen, dezidiert islamischen Führung! Aber ehe die Türkei Mitglied der EU wird, müsste z.B. Israel Mitglied in diesem Staatenbund werden! Israel? Sicher: Wenn historisch-kulturelle Argumente bei der dann auch juristisch zu fixierenden Bestimmung dessen, was Europa ausmacht, ausmachen soll, zählen, dann hätte die einzige Demokratie des Vorderen Orients auf Grund ihrer Staatsform und angesichts der Tatsache, dass der Staat Israel von europäischen Juden - mit ihren Wurzeln auch in der europäischen Geistesgeschichte und ihrer jahrhundertelangen Teilhabe an der Herausbildung des »europäischen Geistes« - gegründet und entscheidend geprägt worden ist, dann hätte Israel am ehesten von allen weiteren in die Diskussion gebrachten Bewerbern ein Anrecht auf eine Mitgliedschaft in der EU! Da das Christentum das Ideenfundament Europas ist, wäre es trotz der Kirchenferne des weit überwiegenden Teiles der Bevölkerung Europas nicht unangebracht, wenn man – nicht nur dem Wunsch des Vatikans folgend diese gemeinsame Wurzel in der ansonsten säkularen Verfassung Europas in deren Präambel durch eine angemessen moderate Formulierung zum Ausdruck brächte. Damit vergäbe man sich nichts, denn so sind ja die historischen Fakten. Warum schamhaft verschweigen? Trotzdem wird dieser historische Bezug auf die jüdischchristlichen Wurzeln des mehrtausendjährigen europäischen Geisteslebens wegen des Drucks vieler EUPolitiker im Europäischen Parlament und einiger Länderchefs unterbleiben. Das spricht aber nicht gegen die Richtigkeit der christlichen Wurzel Europas und den Kampf um die Befreiung des europäischen Geistes aus den Fesseln der katholischen Kirche. Weil der Außenminister der BRD seine »grünen« Parteigenossen via Telekonferenz auf ihrem Parteitag Ende 2003 aufforderte, sich „nicht feige wegzuducken und die Aufnahme der Türkei in die EU offensiv zu vertreten“, ist die Frage der Aufnahme der Türkei in die EU für mich das entscheidende Kriterium, einer Partei, die die von mir aus den vorstehend dargelegten Gründen abgelehnte Mitgliedschaft der Türkei in der EU herbeiführen will, bei der anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament meine Stimme zu verweigern! „Ich stehe hier, ich kann nicht anders!“ 1 Im September 04 sprach die türkische Menschenrechtsorganisationen Human Rights Foundation mit Sitz in Ankara noch von systematisch angewandter Folter in der Türkei in 597 dokumentierten Fällen, als der EU-Erweiterungskommissar Verheugen die Türkei vor Abgabe seines Fortschrittsberichts bezüglich der möglichen Aufnahme von Beitrittsverhandlungen besuchte. Dann setzte die Regierung Erdogan im Zuge der Angleichung des türkischen Strafgesetzbuches an den EU-Standard eine Strafbarkeit der Folter mit einer Strafdrohung bis zu zehn Jahren Gefängnis durch. 46 Es ist so, wie der Papst es auch sieht und sagt, dass Europa ganz entscheidend vom Christentum geprägt worden ist. Nur das macht Europas historische und geistige Identität aus! 1.1.2 Text der Präambel als Auslegungsregel für das GG Präambel als Auslegun gsregel für das GG Weil die Juristen als Freunde des gespaltenen Haares nach dem Motto: "Nur keinen Streit vermeiden!" keinen rechtlichen Streit auslassen, war die Präambel (das »Vorangehende«, der Vorspruch in Verfassungsurkunden oder Staatsverträgen) im Verlauf der Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik in einer Gesamtbewertung ihrer Bedeutung als »Vor-Wort« zunächst überwiegend als rechtlich bedeutungslos eingestuft worden, bis sich in vielen Aufsätzen die jetzt herrschende Lehre durchsetzte, dass die Präambel Bestandteil der Verfassung sei und grundsätzliche Auslegungsregeln für die bestehende und Richtlinien für die künftige staatliche Ausgestaltung enthalte. Bei dieser Sicht der Stellung und des rechtlichen Gewichts der Präambel ist es dann auch zweitrangig, ob die von mehr als 400 Abgeordneten des Bundestages geforderte Aufnahme des Programmsatzes in unsere Verfassung: "Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn aufgerufen“, an entweder Art. 2 GG oder die Präambel angebunden wird. Und gleich eine wohlgemeinte Warnung aus eigener leidvoller Erfahrung eines sich über siebeneinhalb Jahre hingezogen habenden Rechtsstreites als Anmerkung zu solchen hehren Sätzen - außerhalb oder in rechtlichen Regelungen -, vor denen man sich gar nicht genug hüten kann: Wichtiger als so ein unverbindlicher Programmsatz kann - auf jeden Fall für den einzelnen, der so »blöd« ist, solch einen Satz mit so hehren Zielen für bare Münze zu nehmen - da schon die Frage sein: "Wie schützt man die zum Engagement für diesen Staat bereiten Bürger vor eben diesem Staat?" (Vgl. dazu den später detaillierter dargestellten Fall: "Würdest Du eine Bonner Sekretärin heiraten?" Wer Gemeinsinn bis zur Bereitschaft zur Selbstaufgabe gezeigt hatte, indem er seine Beamtung auf Lebenszeit aufgeopfert und sich unter dem Risiko langjähriger Haft in DDR-Gefängnissen dem bundesrepublikanischen Verfassungsschutz gegenüber auf dessen(!) Wunsch hin bereiterklärt hatte, als Agent gegen das MfS zu arbeiten, um dessen Machenschaften in der Bundesrepublik nach besten Kräften vereiteln zu helfen, konnte, wenn er abgeschaltet worden war, im Extremfall vom Staat bedenkenlos um seine bürgerliche Existenzgrundlage gebracht werden. Und einige Gerichte haben dabei mitgespielt!) Bei solchen erhabenen Formulierungen mit Aufforderungscharakter sollte man sich zur eigenen Vorsicht lieber an das von dem Bundeskanzler Willy Brandt gern gebrauchte Wort erinnern: „Haben Sie es nicht eine Nummer kleiner?“ 1.2 »Grundgesetz« oder »Verfassung«? »Grundg esetz« oder »Verfass ung«? Das Grundgesetz hatte zunächst nur für das in der Präambel a.F. aufgeführte »Alt-Alt-Bundesgebiet« ohne das von Frankreich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges - wie schon nach dem Ersten Weltkrieg - erneut annektierte Saarland, nach Anschluss des Saarlandes an das Bundesgebiet am 01.01.1957 als 10. Bundesland dann für das »Alt-Bundesgebiet« Geltung gehabt; auch für Bayern, obwohl der Bayerische Landtag mit Beschluss vom 20.05.49 das Grundgesetz (wegen nach bayerischer Meinung zu geringer Beachtung der Länderkompetenzen) als einziges Landesparlament abgelehnt, gleichwohl aber dessen Rechtsverbindlichkeit für Bayern anerkannt hatte, wogegen die Bayernpartei mehr als 40 Jahre später 1991 in Wiederholung alter Schlachten vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof vergeblich geklagt hatte. (Nach der Hauptstadtentscheidung des Deutschen Bundestages für Berlin forderte die Bayernpartei, die Selbstständigkeit Bayerns zu fördern, was über Artikel 6 der Landesverfassung möglich wäre und erreicht werden sollte, in dem bisher ohne das dazu notwendige Ausführungsgesetz - eine eigene bayerische Staatsbürgerschaft vorgesehen ist, die durch "Geburt, Legitimation, Eheschließung und Einbürgerung" erworben werden kann. Bayerische Staatsbürgerschaft contra EG-Bürgerschaft, wo doch § 1 der Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit seit dem 05.02.1934 bestimmt: § 1 (1) Die Staatsangehörigkeit in den deutschen Ländern fällt fort. (2) Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit. 47 Wir werden noch öfters Gelegenheit haben zu bestaunen, zu welchen Zwecken das Instrument des Rechts eingesetzt werden soll!) Berlin hatte nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Wiedervereinigung auf der Grundlage der »2+4 Verträge« unter der gemeinsamen Verwaltung der vier alliierten Siegermächte gestanden. Es war - trotz zwischenzeitlich ergangener anderslautender, die Rechtstatsachen verdrehender Urteile des BVerfGs - bis zuletzt kein Bundesland der Bundesrepublik gewesen und war darum z.B. auch nicht in der Präambel unter den dort aufgeführten Ländern erwähnt worden. Für Berlin war die Geltung des Grundgesetzes vom Anfang des staatlichen Neubeginns der Bundesrepublik an bis zur Ratifizierung der »2+4-Verträge« und der erst auf dieser Grundlage erfolgten Wiedervereinigung durch die Besatzungsrechte der drei Alliierten im Westteil eingeschränkt und im Ostteil der Stadt durch die UdSSR verhindert worden. So hatten z.B. die Westberliner Abgeordneten im Bundestag kein Stimmrecht. Gleiches galt übrigens die meisten Jahre der SED-Herrschaft auch für die Ostberliner Abgeordneten in der Volkskammer. Erst durch die »2+4-Verträge« sind alle bis dahin noch in Kraft gewesenen Besatzungsrechte aufgehoben worden, hat das wiedervereinte Deutschland alle durch die bedingungslose Kapitulation Hitler-Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkrieges verlorenen Souveränitätsrechte (wegen der Gebietsverluste Polens an die UdSSR zur Kompensation dieser Gebietsverluste an Polen abgetretenen Gebiete in einem gegenüber 1937 um ca. ein Viertel kleineren Staatsgebiet) uneingeschränkt zurückerhalten. Die Bezeichnung »Grundgesetz« statt »Verfassung« hatte also den räumlich und zeitlich vorläufigen Charakter der bundesdeutschen Verfassung sowie das durch fortgeltende Siegerrechte bedingte Fehlen voller rechtlicher Freiheit zu souveräner eigenständiger Verfassungsgebung für den dem Westen zugehörenden Teil Rumpfdeutschlands deutlich machen sollen. Nach der überraschend erlangten Wiedervereinigung hatte die SPD im Februar 1992 - die Verfassung war als Anpassung an die neue Rechtslage schon in einer ganzen Anzahl ihrer Bestimmungen und insbesondere in der Präambel und dem Art. 146, aber erstaunlicherweise nicht in „Art. 144 GG (1) Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die Volksvertretung in zwei Dritteln der deutschen Länder, in denen es zunächst gelten soll." [Wieso jetzt noch "zunächst"? Das GG gilt ja in allen nunmehr 16 Ländern der Bundesrepublik. Die Präambel stellt in ihrem letzten Satz ausdrücklich fest: „Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“ Auf Grund der "2+4-Verträge" ist außerdem der alte Art. 23 GG mit dem darin teilweise aus illusionärem Wunschdenken angeordneten räumlichen Geltungsbereich ("GroßBerlin"!) aufgehoben worden und sowohl Präambel als auch Art. 146 GG sind geändert worden, um deutlich zu machen, dass keine weiteren - noch weiter östlich gelegenen ehemaligen deutschen Länder mehr der Bundesrepublik beitreten können sollen. Insbesondere sollen nach der Zwangsaussiedlung der Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges keine Gebietsansprüche mehr gegen die Republik Polen auf Rückgabe der zur Kompensation für an die UdSSR verlorenen Gebiete erworbenen ehemaligen deutschen Länder bestehen, wie sie z.B. aber von der UNO für die durch Israel besetzten palästinensischen Gebiete bejaht werden!] geändert worden - folgerichtig den Vorschlag unterbreitet, das zu der Zeit schon durch die Gemeinsame Verfassungskommission des Bundestages und des Bundesrates in Überarbeitung befindliche »Grundgesetz« künftig als »Bundesverfassung« zu bezeichnen. Damit wäre z.B. an die demokratische Tradition der "Verfassung der Frankfurter Nationalversammlung von 1849" und der "Verfassung des Deutschen Reiches von 1919" (»Weimarer Verfassung«) angeknüpft worden. Und bei so grundlegenden Staatsakten wie einer Verfassungsgebung oder -überarbeitung ist Tradition ein üblicherweise sehr starkes Argument. Das ist in solchen Fällen demokratisches Hartgeld. Da gibt man sich nicht geschichtslos! CDU/CSU hatten diesen von der SPD in die Diskussion gebrachten Vorschlag, kaum unterbreitet, umgehend rundweg abgelehnt: Es solle bei "Grundgesetz" bleiben, denn das Grundgesetz habe sich in den bis dahin mehr als 40 Jahren seines Bestehens als Verfassung des westlichen deutschen Teilstaates bewährt. 1.2.1 Der räumliche Geltungsbereich des GG Der räumliche Geltungsbe reich des GG Der neue räumliche Geltungsbereich des GG ergibt sich aus der Präambel n.F. Ein Vergleich zwischen alter und neuer Fassung der Präambel lohnt sich nicht nur für einen Historiker, weil die dort angegebene Länderaufzählung wegen des im Einigungsvertrag vorgesehenen und nach einer negativ verlaufenen Volksabstimmung auf eventuell später verschobenen projektierten Zusammenschlusses der jetzt noch getrennten Länder Brandenburg und Berlin möglicherweise auch schon bald überholt sein könnte - wenn nicht aus finanziellen Erwägungen wegen der Zahlungen in und der Leistungen aus dem Länderfinanzausgleichsfonds eine Änderung dieses Vorhabens eintritt. (Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe rechnet auch nach der ersten, negativ verlaufenen Volksabstimmung immer noch mit einem Zusammenschluss dieser beiden Länder in baldiger Zukunft. Der neue Regierende Bürgermeister von Berlin, Wowereit SPD, gab dieses Ziel als von ihm für 2009 angestrebt an.) "Chronik der Woche Montag, 18. Januar Berlin und Brandenburg wollen von der geplanten Länderfusion Abstand nehmen, wenn sie dadurch im neuen Bund-Länder-Finanzausgleich schlechter gestellt werden als bei getrennter Finanzverteilung. Dies hätten die Regierungschefs beider Länder dem Bundeskanzler mitgeteilt, sagt der Berliner Finanzsenator Elmar Pieroth (CDU) vor der Presse in Bonn. Zugleich fordert er übergangsweise bis 1995 weitere Leistungen und die Obhut des Bundes für Berlin." (Das Parlament 29.01.93) 1.2.2 GG und Länderneugliederung Ursprünglich lautete „Art. 29 I GG Das Bundesgebiet ist unter Berücksichtigung der landsmannschaftlichen Verbundenheit, der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und des sozialen Gefüges durch Bundesgesetz neu zu gliedern. Die Neugliederung soll Länder schaffen, die nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können." Der 1976 geänderte Art. 29 I GG lautet nunmehr: "Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, dass die Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, die wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten sowie die Erfordernisse der Raumordnung und der Landesplanung zu berücksichtigen." Der zum besseren Verständnis durch Schrägdruck kenntlich gemachte unterschiedliche rechtliche Gehalt der beiden gegenübergestellten Fassungen des Art. 29 GG besteht darin, dass aus dem strikten Verfassungsauftrag "... ist ... neu zu gliedern", also einer »Muss«-Vorschrift nunmehr eine »Kann«-Vorschrift geworden ist. Die Politiker sind das ihnen lästige Problem damit zunächst durch eine gemäß Art. 79 I GG vorgenommene Verfassungsänderung losgeworden. Das Problem geistert aber als einer der bundesdeutschen politischen Untoten immer wieder durch die politische Landschaft und durch Politiker-Diskussionen. "Stoiber: Hamburg soll verschwinden o Der CSU-Innenminister will höchstens 10 Bundesländer o Nordlichter stärker zur Kasse bitten/ Curilla kontert o "Dann dürfte es Bayern schon längst nicht mehr geben" Ozapft is? Die bayerische Staatsregierung will das Bundesland Hamburg von der Landkarte radieren. Innenminister Edmund Stoiber (CSU) denkt laut darüber nach, nachdem das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Mittwoch Hamburg beim Länderfinanzausgleich um 148 Millionen Mark entlastet hat. `Mit kleinen oder finanzschwachen Ländern wie dem Saarland, 49 Bremen und Hamburg wird es nicht gelingen, den Föderalismus zu stärken', schimpfte Stoiber. In München macht man schon Planspiele über eine Zusammenlegung Hamburgs mit Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Hamburgs Finanzsenator Wolfgang Curilla (SPD) kontert: Wenn Stoiber recht hätte, wäre Bayern längst weg. Stoiber will die Zahl der Bundesländer von 16 auf neun oder zehn senken: `Es schwächt das Gewicht der Länder insgesamt, wenn allein nicht lebensfähige Länder auf Dauer am Tropf der reicheren Länder und des Bundes hängen.' Mittels des Länderfinanzausgleichs sollen regionale Unterschiede beim Steueraufkommen gemildert werden - reiche Länder zahlen ein, arme kassieren. Stoibers Ziel: Wenn ab 1995 die bitterarmen ostdeutschen Länder in den Finanzausgleich einbezogen werden, sollen die Nordlichter stärker zur Kasse gebeten werden. Bayern wolle nicht allein dastehen, wenn es um die Lasten der Einheit gehe, hieß es gestern aus dem bayerischen Innenministerium. In der [Hamburger] Finanzbehörde am Gänsemarkt kommt Oktoberfeststimmung auf: `Wir zahlen die Zeche, und Herr Stoiber will auch noch das Trinkgeld kassieren.' Seit 1970 habe jeder Hamburger 4430 Mark in den Finanzausgleich gelöhnt, während jeder Bayer 348 Mark einstrich. Finanzsenator Curilla: `Hamburg hat bislang 13 Milliarden eingezahlt, Bayern hat über 6,6 Milliarden Mark kassiert. Nach der Logik von Herrn Stoiber dürfte es Bayern als eigenständiges Bundesland schon längst nicht mehr geben.' ‘In der Diskussion ist alles erlaubt', schwächte der Sprecher des bayerischen Innenministeriums gestern die Anti-Hamburg-Aktion seines Dienstherrn ab. ..." (Morgenpost 03.06.92) „Geschichte ohne Wahrheit ist wie ein Gesicht ohne Augen“ (Polykrates). Der historischen Wahrheit halber, zu der gehört, dass Hamburg bis heute eines der Geberländern ist, sei aus einer Gesamtbilanz aus dem STERN vom 08.01.98 (S. 109) über Nettoerlöse aus dem Länderfinanzausgleich über die Jahre 1950 (Einführung des Finanzausgleichs) bis 1996 zitiert: „Länderfinanzausgleich Erst kassieren, dann lamentieren Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) läßt keine Gelegenheit aus, gegen angebliche Ungerechtigkeiten im Finanzausgleich zwischen den Bundesländern zu wettern. Erfolgreiche Länder würden »bestraft«, klagt er, andere dagegen hätten »überhaupt keinen Anlaß, sich besonders anzustrengen«. Was Stoiber verschweigt: Sein Freistaat hat vom bestehenden System selbst kräftig profitiert. Das zeigt eine Gesamtbilanz aller Zahlungen seit 1950 - dem Jahr, als der Finanzausgleich eingeführt wurde, um wirtschaftlich schwachen Bundesländern auf die Beine zu helfen. Bayern hat von 1950 bis 1996 aus dem Finanzausgleich exakt 6,69 Milliarden Mark bekommen, bislang aber nur 6,18 Milliarden eingezahlt - ein Plus von rund 500 Millionen Mark. Ohnehin zahlen die Bayern erst seit 1989. Bis 1986 ließen sie sich ohne Unterbrechung von anderen Ländern unter die Arme greifen. ...“ Fünf Jahre später hat sich das Missverhältnis der unverhältnismäßig hohen Zahlungen Hamburgs noch immer nicht geändert: „Finanzausgleich: Hamburger zahlen am meisten Hamburg musste noch nie so viel Geld in den Länderfinanzausgleich einzahlen wie in diesem Jahr. Insgesamt zahlt die Stadt 500 Millionen Euro – das sind pro Bürger 281 Euro. Damit nimmt die Hansestadt – bezogen auf die Einwohnerzahl – den Spitzenplatz ein. Zum Vergleich: NordrheinWestfalen zahlt 1,8 Millionen Euro – rund 10 Cent pro Einwohner. ...“ (HH A 07.11.03) Hamburg gibt, Berlin nimmt … Sven Kummereincke Hamburg musste 2003 mit 654 Millionen Euro so viel Geld in den Länderfinanzausgleich zahlen, wie nie zuvor. Eine gute Nachricht oder eine schlechte? Beides zugleich. Gut, weil es ein Zeichen der wirtschaftlichen Stärke Hamburgs ist. Und schlecht, weil das Gels fehlt, um die gewaltige Finanzierungslücke im eigenen Haushalt (1,5 Milliarden Euro allein in diesem Jahr) zu verkleinern. Politisch problematisch wird die Sache wegen des Falls Berlin. Die bankrotte Hauptstadt bekommt mehr als fünf Milliarden Euro Hilfe, je rund zur Hälfte vom Bund und von den anderen Bundesländern. Doch offenbar hat Berlin noch Geld genug, um Hamburger Unternehmen mit 50 üppigen Subventionsversprechungen an die Spree zu locken. Wenn Berlin aber mit Hamburger Geld Hamburger Firmen weglockt, dann wird der Gedanke des Länderfinanzausgleichs ad absurdum geführt. Hamburg, seit jeher ein Geberland, hätte also durchaus das Recht, sich zu beschweren. Andere Länder sollten da zurückhaltender sein. Bayern etwa hat jahrzehntelang kassiert und fing just in dem Moment an, das System in Frage zu stellen, als es selber vom Nehmer- zum Geberland wurde.“ (HH A 17.02.04) In diesem Zusammenhang wurde die folgende Aufstellung mit abgedruckt: WER GIBT, WER NIMMT? ZAHLERLÄNDER Land € je Einwohner Hamburg 378 Hessen 308 Baden-Württemberg 203 Bayern 150 Nordrhein-Westfalen 3 Betrag in Mio. € 654,3 1.873,9 2.165,8 1.858,0 49,5 EMPFÄNGERLÄNDER Land € je Einwohner Betrag in Mio. € Berlin 777 2.636,6 Bremen 524 347,1 Mecklenburg-Vorpommern 226 392,1 Sachsen 215 933,4 Thüringen 209 498,1 Sachsen-Anhalt 205 518,6 Brandenburg 194 500,8 Saarland 100 106,5 Rheinland-Pfalz 64 258,9 Niedersachsen 49 393,0 Schleswig-Holstein 6 16,2 Bei der Sachlage kann man das Lamentieren der bayrischen Staatsregierung und deren Klage vor dem BVerfG schon fast als degoutant empfinden! Aber die Geberländer ärgert neben den wegen ihrer erfolgreichen Wirtschaftspolitik ständig gestiegenen Ausgleichszahlungen an die ärmeren Bundesländer u.a. auch das Stadtstaatenprivileg - obwohl Hamburg ebenfalls zu den Geberländern gehört -, demzufolge die Einwohner eines Stadtstaates wegen der von diesem geleisteten Metropolfunktion für das sie umgebende Umland anderer Bundesländer höher bewertet werden als die Einwohner anderer (kleinerer) Städte, bei denen innerhalb des jeweiligen Bundeslandes ein interner Ausgleich vorgenommen werden kann. Doch das Umland leistet sich nicht z.B. Theater und Opern von Weltniveau und keine Hochleistungskrankenhäuser, die von den „SpeckgürtelBewohnern“ mit genutzt werden. Die von der Großstadt in den „Speckgürtel“ gezogenen und nun im Umland in einem Eigenheim lebenden Neuzugänge der Flächenstaaten haben weiterhin ihre Arbeitsplätze in den Stadtstaaten, erwirtschaften dort ihr Einkommen und sind auf diese Arbeitsplätze angewiesen, schicken teilweise ihre Kinder weiterhin auf die Schulen des von ihnen wegen des Eigenheimbezuges verlassenen Stadtstaates, zahlen aber nach einer gravierenden juristischen Änderung, der Änderung der Steuererhebung von der Arbeitsplatz- auf die Wohnsitzbesteuerung1, ihre Steuern nicht mehr dort, wo sie ihr Gehalt erwirtschaften, sondern machen den Wohnsitz-Flächenstaat reich, ... . So ist das Stadtstaatenprivileg cum grano salis berechtigt, demzufolge bei der Berechnung des Länderfinanzausgleichs davon ausgegangen wird, dass z.B. für Hamburg jeder Einwohner wie 1,35 Einwohner von Flächenstaaten gezählt werden. Gäbe es die Stadtstaatenwertung nicht, müsste Berlin 4,1 Mrd., Hamburg 1,6 Mrd. und das inzwischen hoch verschuldete, nach der Änderung des Steuererhebungsprinzips ausgeblutete Bremen - dem es so lange wirtschaftlich blendend ging, wie die Arbeitsplatzbesteuerung galt, bevor die die Stadtstaaten benachteiligende Wohnsitzbesteuerung eingeführt worden ist - 750 Mill. mehr in den Länderfinanzausgleich zahlen. Der bis vor das BVerfG getriebene juristische 1 Das für den Arbeitsplatz zuständige Finanzamt war auch für die Abgabe der Steuererklärungen der Arbeitnehmer zuständig, gleichgültig, wo sie wohnten. Dorthin mussten die individuellen Steuern abgeführt werden, die somit den Stadtstaaten zuflossen, die ja auch die Arbeitsplätze in ihrer Gebietskörperschaft schufen und durch ihre Infrastrukturmaßnahmen irgendwie auch »vorhielten«. 51 Kampf um das so behauptete eigene »Recht« insbesondere der süddeutschen Geberländer geht jetzt neben einem erhöhten Selbstbehalt auf Grund durch eigene Anstrengungen gestiegenen Steueraufkommen u.a. um die Quote, mit der die Stadtstaatenbürger Berlins, Hamburgs und Bremens in die anzustellenden Berechnungen einbezogen werden sollen. Und das ist für jeden der Stadtstaaten eine nach „Recht und Gesetz“ zu regelnde Frage der nackten Existenz!. Um die Daumenschrauben anzusetzen, forderte Bayern zu Anfang der Diskussion in gewollter (und wie aus den vorstehenden Auszügen aus Zeitungsartikeln ersichtlich: schon fast verlogener) Verkennung der Realitäten und mit der gleichen mit unredlichen Argumenten vorgebrachten, wegen ihrer alle anderen Regierungschefs nervenden Penetranz dann aber letztlich erfolgreichen Attitüde der ehemaligen britischen Premierministerin »Tina« Margaret Thatcher auf EG-Ebene – „I want my money back!“ - eine generelle Abschaffung des Stadtstaatenprivilegs. Bayern weiß aber die Metropolfunktion seiner Landeshauptstadt München innerhalb des eigenen Landes durchaus angemessen zu honorieren; so erhält München eine »innerstaatliche« Einwohnerwertung von 1,85 Einwohnern! (Und z.B. Düsseldorf wird von seinem Bundesland mit 1,75 gewertet. Auch Stuttgart erfährt von seinem Bundesland eine höhere Wertung, als sie den Stadtstaaten zunächst abgesprochen wurde.) Was aber die drittgrößte Stadt der Bundesrepublik für ihr süddeutsches Umland ist, das ist die zweitgrößte Stadt der Bundesrepublik für ihr norddeutsches Umland. Ich vermag da keinen hinreichend plausiblen juristischen Differenzierungsgrund zu erkennen! Die Stadtstaaten wehren sich mit Gutachten. Nach einem solchen Gutachten von Anfang 2001 könnte Berlin im Vergleich zu 100 Einwohnern eines Flächenstaates eine Verrechnung mit mindestens 144 Einwohner beanspruchen, Bremen bis zu 147 und Hamburg eine Einwohnerwertung von 139 bis 141. Sogar eine höhere Wertung wäre nach dem aktualisierten Gutachten der Professorin Hummel möglich. Angesichts der Vergleichszahlen für den innerstaatlichen Ausgleich, den die jeweiligen Landesmetropolen für ihre Leistungen für ihr Umland von ihren jeweiligen Ländern erhalten, erscheinen die bisher den Stadtstaaten zur »Einwohnerveredelung« zugestandenen Bemessungszahlen ausgesprochen maßvoll angesetzt! Neben den eben genannten Faktoren als Leistung ihrer Metropolfunktion für die angrenzenden Gebiete der Flächenstaaten haben sie höhere Aufwendungen für Sozialhilfeempfänger zu tragen, in den größeren Städten herrscht ein höheres Preisniveau als in den meisten Gebieten der Flächenstaaten, ... Am 24.06.01 gab es in der Frage des Länderfinanzausgleichs dann doch noch einen Kompromiss, dessen Annahme die Bundesregierung durch zusätzliche Zahlungen ermöglichte. Nach diesem Kompromiss, der als „Sieg des Föderalismus“ ausgerufen wurde und mit dem die Diskussion um Länderneugliederungen erst einmal (wieder) auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben wurden, gelten für die Jahre 2005 bis 2020 nunmehr u.a. folgenden Regelungen: Die Pro-Kopf-Einnahmen der finanzschwachen Länder werden durch Ausgleichszahlungen aus dem Länderfinanzausgleichsfonds auf 95 % des Mittelwertes der Einkünfte aller Länder angehoben. Die Bundesländer Saarland und Bremen erhalten wegen ihrer desolaten Finanzstruktur darüber hinaus Ergänzungszuweisungen des Bundes. Die Geberländer dürfen durch ihre Zahlungen nicht mehr unter 100 % dieses Mittelwertes der Einkünfte aller Länder sinken. Ein Geberland muss künftig von seinen überdurchschnittlichen Steuereinnahmen nicht mehr als 72,5 % abführen. Das Stadtstaatenprivileg wird weiterhin anerkannt. Ihm wird dadurch Rechnung getragen, dass die Einwohnerzahlen von Berlin, Hamburg und Bremen jeweils zu 135 % bewertet werden. GG und Länderne uordnung Würde aber eine Neugliederung des Bundesgebietes in andere Länder nicht vielleicht gegen die zurzeit geltende Bestimmung des Art. 79 III GG "Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder ... berührt werden, ist unzulässig." verstoßen? Ist somit eine Neugliederung des Bundesgebietes mit dem Ziel der Schaffung von in etwa gleich leistungsfähigen Ländern blockiert? Zur eigenen Meinungsbildung und als Argumentationshilfe sei zunächst auf Art. 118 GG verwiesen. So gehen die Juristen auch vor. Auflösung: Schon allein die Lektüre der alten Fassung der Präambel des Grundgesetzes macht deutlich, dass vor der Wiedervereinigung einige der ursprünglichen Bundesländer weggefallen waren und statt dessen durch Zusammenschluss der dann weggefallenen ursprünglichen Länder das Bundesland Baden-Württemberg 52 entstanden war. Weitere an sich sinnvolle und in der ursprünglichen Regelung des Art. 29 GG zunächst als Verpflichtung aufgegebene, dann nach einer geschwinden Verfassungsänderung nur noch als möglich zugelassene Zusammenschlüsse bisher zu kleiner Länder zu sinnvollen wirtschaftlichen Einheiten scheiterten bisher an landsmannschaftlichen Eifersüchteleien insbesondere der Parteien und Politiker, die dann zum Teil die Macht in einem Bundesland und insbesondere ihre Ministerposten und/oder Abgeordnetensitze in den bisherigen, aber dann aufzulösenden Landesparlamenten verlieren würden. Da gäbe es dann u.a. zwangsläufig auch weniger Startlöcher für das bisher alle vier Jahre stattfindende Rennen um die Kanzlerschaft mit Kandidatur und Gegenkandidatur! Eine Neugliederung des Bundesgebietes ist also durch Art. 79 III GG nicht blockiert, denn der spricht nur grundsätzlich von der Gliederung des Bundes in Länder. Es gibt aber keine grundgesetzliche Bestandsgarantie für ein bestimmtes Bundesland. (Das Land Bremen hat allerdings als kleinstes Bundesland und darum das Bundesland mit den größten Befürchtungen um seine Eigenstaatlichkeit eine niederrangigere Bestandsgarantie ausgehandelt.) Die Bestandsgarantie des Art. 79 III GG bezieht sich also nur auf das Föderalismusprinzip, nicht aber auf die Existenz eines jeden Bundeslandes. Das Fehlen einer grundgesetzlichen Bestandsgarantie für ein bestimmtes Bundesland ergibt sich als Umkehrschluss aus Art. 118 GG, der ebenfalls von Anfang an in der Verfassung stand und die Neugliederung des Landes Baden-Württemberg ausdrücklich vorsah. Eine große Chance, wirtschaftlich tragfähige Ländereinheiten zu bilden, ist bei der Schaffung der ostdeutschen Bundesländer 1990 erst einmal vertan worden, als sich entgegen allem Rat der Wirtschafts- und Finanzexperten die neu zu bildenden Länder in den Grenzen etablierten, in denen sie vor Auflösung durch die DDR bis 1950 existiert hatten. Darauf bestanden sie 1990 - mochte die Kleinstaaterei aus vordringlich wirtschafts- und raumordnungspolitischen Gesichtspunkten heraus auch noch so sinnlos(!) sein - als ihrem so geglaubten guten »Recht«. Wer mochte gegen solche Befindlichkeiten die sinnvollere Lösung eines großen Wurfes durchsetzen? Niemand! Schließlich ist ja jedes der ostdeutschen Bundesländer größer und bevölkerungsreicher als der kleinste westdeutsche Flächenstaat, das Saarland, das allerdings durch den historischen Sonderfall einer zunächst erfolgten erzwungenen Abtrennung durch Abtretung an Frankreich und späteren Wiedervereinigung nach positiv verlaufener Volksabstimmung entstanden war. (Aber was kostet das an Mehrfachem für die Gehälter der Ministerpräsidenten, Minister, Spitzenbeamten, Beamten, Parlamentarier, von denen es insgesamt rund 2.000 geben soll, Mehrkosten für Gebäude, ... !) Es kam erneute Bewegung in die Diskussion der Länderneugliederung, weil einer der beiden Vorsitzenden des "Gemeinsamen Verfassungsausschusses des Deutschen Bundestages und des Bundesrates" zur Erarbeitung einer neuen Verfassung, Prof. Scholz, die Bildung einer "Neugliederungs-Kommission" zur Zusammenlegung von Bundesländern angeregt hat, um "das Grundgesetz für die europäische Einheit fit zu machen, weil die deutsche 16-Länderstruktur noch nicht ausreichend lebensfähig" sei (HH A 12.02.92). Diese Anregungen eines der beiden Kommissionsvorsitzenden verpufften - bis auf eine Verärgerung der Betroffenen – völlig wirkungslos, weil ihre Konkretisierung außer der Neubildung eines Nordstaates u.a. auch vorsah, Niedersachsen mit Sachsen-Anhalt und "das reiche Hessen mit dem schwierigen Thüringen zusammenzutun". Wäre ernsthaft erwogen worden, diese letzteren Vorschläge politisch umzusetzen, hätten sich die Ostdeutschen in ihrer Befindlichkeit ja noch mehr "vereinnahmt" oder "abgewickelt" gefühlt, wenn ihre Länder z.T. in westdeutschen Ländern aufgegangen wären. Das war politisch nicht machbar. Dieser Teil des Vorschlages war aus den vorgenannten Gründen politisch instinktlos! (Das hätte auch der ehemalige »Kurzzeit«-Verteidigungsminister Scholz und jetzige Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages wissen und bei seinen Äußerungen in Rechnung stellen müssen, wenn er nicht das Ansehen der von ihm mitgeleiteten gemeinsamen Bundestags- und Bundesratskommission zur Neuformulierung der Verfassung hätte beschädigen wollen!) Sinnvoll könnte in Ostdeutschland nur ein Zusammenschluss zu kleiner ostdeutscher Länder untereinander sein - wie es diese Überlegungen für das Gebiet der westdeutschen Bundesländer seit Jahrzehnten, z.B. durch das Gutachten der Günther-Kommission, gibt. (Ein Stichwort hierzu war der »Nordstaat«, ein weiteres ist ein »Südwest-Staat«.) Das Thema wird immer ein politischer Dauerbrenner bleiben – der vorläufig letzte Beitrag kam von der Landeschefin der Hamburger Grünen, die sich Ende 2001 gegen die die ganze Region schwächende „norddeutsche Kleinstaaterei“ und für die Schaffung zweier Nordländer aus einerseits Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern und andererseits Niedersachsen und Bremen aussprach - und es werden die unterschiedlichsten Lösungsvorschläge für den Papierkorb erarbeitet werden, z.B.: „Zu viele Länder? ADN Bonn - Bis zu zehn Milliarden Mark an Steuergeldern könnten jährlich gespart werden, wenn 53 die 16 Länderparlamente und -regierungen reduziert und der Bundestag verkleinert würden. Dies hat der Deutsche Beamtenbund (DBB) ausgerechnet. Zusammenschließen sollten sich: SchleswigHolstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern; Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen; Berlin, Brandenburg und Sachsen; Hessen und Thüringen; Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg.“ ( HH A 28.12.95) 1998 forderte der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf eine Reduzierung der Zahl der Bundesländer auf sieben: nur Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sollten in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. Auch die (jetzt) reichen Bundesländer strebten nach Meinung einiger Beobachter mit der 1998 beim BVerfG eingereichten und von ihm 1999 angeordneten Neuordnung des Länderfinanzausgleichs angeblich neben einer schon auf „sehr eigennützige“ (heuchlerische) Argumente gestützten Zahlungsentlastung ebenfalls eine Umgestaltung der Struktur der Bundesländer in annähernd gleich große und an Wirtschaftskraft gleich starke Länder an. Wir werden sehen - eine solche Länderumgestaltung aber wohl eher nicht erleben. Politische Traditionen stehen dagegen. Und die sind meist sehr zäh! 2003 wurde parteiübergreifend(!) von Politikern aus der CDU, der FDP und den Grünen ein neuer Anlauf zur Reduzierung der 16 Bundesländer auf 11, nach einem noch weitergehenden Vorschlag auf 9 2 neu zuzuschneidende Länder unternommen. Später forderte der baden-württembergische Ministerpräsident Teufel, den Föderalismus auf nur noch 8 leistungsfähige Länder zu begrenzen. Deutschland könne sich die teure und ineffiziente Lösung mit 16 Bundesländern nicht mehr leisten. So solle ein „Nordstaat“ oder „Küstenstaat“ aus den bisherigen Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen, wahlweise mit oder Mecklenburg-Vorpommern, gebildet werden. Die in der nach der Wiedervereinigung erfolgten Neufassung der Präambel nunmehr genannte Aufgliederung des Bundesgebietes in Bundesländer kann schon bald durch den trotz zunächst erfolgter Ablehnung durch die Bevölkerung von den Parteien weiterhin projektierten Zusammenschluss der Länder Berlin und Brandenburg von der neuesten Entwicklung überrollt werden. Doch wie immer, so auch 2003: Spätestens wenn es zum Schwur kommt, setzen sich wieder die Leute mit den kleinsten geistigen Karos und den größten landsmannschaftlichen Bedenken oder Vorurteilen durch: „Same procedure as every time!“ Vielleicht wird das 2006 ja anders, und die Brandenburger überwinden ihre Abneigung gegen die Hauptstädter. Anzunehmen ist das meiner Meinung nach aber nicht: bei der Kassenlage des nach der Berliner Bankenpleite und der damit ausgelösten finanziellen Verpflichtungen Berlins ist das eher unwahrscheinlich! Für die 2006 wieder anstehende Befragung der Bürger von Brandenburg und Berlin nach einem Zusammenschluss dieser Länder wurde auch schon statt „Berlin-Brandenburg“ die Wiederauferstehung des Namens „Preußen“ für das neue Gebilde vorgeschlagen, obwohl der Alliierte Kontrollrat das Land Preußen 1947 als „Träger des Militarismus und der Reaktion“ aufgelöst hatte. Neu ist allerdings das mit dem Vorstoß zum Aufbau größerer und - so erhofft - leistungsfähigerer Bundesländer zeitgleiche vereinzelte Bemühen zu einer noch weitergehenden staatlichen Zersplitterung Deutschlands: “Abspaltung Rügen denkt an eigenen Staat von n-tv-Reporter Jörg Jelinnek Ein eigener Inselstaat Rügen. Die Verwaltung der Ostseeinsel hat ein solches Vorhaben in Erwägung gezogen. Dabei wurde geprüft, ob eine Abspaltung von Deutschland wirtschaftliche Vorteile bringen könnte. Landrätin Kerstin Kassner erläutert: "Im Zuge von Diskussionen in Brüssel wurde die Idee geboren, ob die Insel allein lebensfähig ist. Ein positives Beispiel ist dabei die Isle of Man. Und da haben wir gedacht, wir können ja mal schauen, ob vielleicht so ein Vorhaben für uns schlüssig ist." Im Klartext: Außenpolitisch würde zwar Deutschland die Insel vertreten. Innenpolitisch hätte der Inselstaat einen hohen Grad an Eigenverantwortung. So könnten eigene Euros geprägt werden, ebenso Briefmarken. Sammlerobjekte also, die dem Staat viel Geld einbringen könnten. Auch der 2 Angedacht sind folgende, teilweise neue, Gebietseinheiten: Schleswig-Holstein + Hamburg + Mecklenburg-Vorpommern / Bremen + Niedersachsen + Sachsen-Anhalt / Brandenburg + Berlin / Nordrhein-Westfalen / Hessen + Thüringen / Sachsen / Rheinland-Pfalz + Saarland / Baden-Württemberg / Bayern. Strittig ist die dabei u.a. die dann erforderliche neue Stimmengewichtung im Bundesrat. 54 Tourismus könnte davon profitieren. "Wenn man sich die anderen Inseln ansieht, die einen unabhängigen Status haben, dann fällt einem auf, dass sie alle Vorteile davon haben. Denn viele Touristen sind neugierig, die Unabhängigkeit kennenzulernen. Wie die Kanalinseln oder die Isle of Man könnte auch die schöne Insel Rügen von einer solchen Neugier profitieren“, erklärt TourismusVerbandssprecher Raymond Kiesbye. Einige Urlauber haben kein Verständnis für die Unabhängigkeitsbestrebungen der Insel. Anderen ist es egal. Sie würden sowieso Rügen besuchen - als größte Insel Deutschlands oder als unabhängige Republik. Ihnen gefällt die Insel. ’Da spielt es keine Rolle, ob sie nun zu Deutschland gehört oder nicht. Die Insel ist einfach eine Reise wert.’ Finanzexperten aus Mecklenburg Vorpommern halten den Plan für nicht finanzierbar. Denn 30 Prozent der Einnahmen erhält die Insel vom Land und vom Bund. Diese würden bei einer Unabhängigkeit Rügens fehlen. Der Finanzbeamte Udo Knapp kann seine Ironie nicht im Zaune halten: ’Da könnte sich Frau Kassner ein Kriegsschiff kaufen und auf dem Schweriner See das Schloss belagern, um damit die Zuschüsse zu erpressen. Vielleicht fahren sie ja auf der Spree zum Bundeskanzleramt und beschießen es.’ Er glaubt, dass viele Rügener mit der Abspaltung von Deutschland vor allem drohen wollen. Denn die Landesregierung in Schwerin bereitet eine radikale Verwaltungsreform vor, die in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden soll. Die Rügener befürchten Nachteile, da sie gemeinsam mit Landkreisen vom Festland verbunden wären und damit ihre Eigenverwaltung der Vergangenheit angehören würde. Das Finanzministerium rät aber den Insulanern, lieber an der Spitze der Kreisgebietsreform zu marschieren und die eigenen Interessen zu sichern.“ (n-tv.de Freitag, 10. Januar 2003) Im Zuge der Föderalismusdiskussion um eine entzerrende Neuregelung der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern hat Bundeskanzler Schröder 2004 - wieder einmal - eine Diskussion über eine Neuordnung der Bundesländer angemahnt: es müsse die Frage thematisiert werden, „ob wir wirklich 16 Bundesländer brauchen“. So befürwortet der Kanzler z.B. die Bildung eines Nordstaates – ohne zu sagen, welcher der schon lange angedachten vielen Varianten er dabei den Vorzug geben würde. 1.3 Das GG als oberste rechtliche Norm unseres Staates für insbesondere staatliches, eingeschränkt aber auch privates Handeln Das GG als oberste rechtliche Norm unseres Staates für insbesonder e staatliches, eingeschrän kt aber auch privates Handeln Das »Grundgesetz« ist als unsere Verfassung unsere oberste rechtliche Norm, an der sich alles staatliche - und wesentlich eingeschränkter auch das private - Handeln auszurichten hat. Wohlgemerkt: (zunächst einmal vorrangig) alles staatliche Handeln. So verbietet z.B. der in seiner Aufzählung der Verbotsgründe anschauliche (spezielle) Gleichheitssatz des Art. 3 III GG „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." zunächst einmal vorrangig und unmittelbar dem Staat eine sachfremde Benachteiligung von einzelnen Bürgern oder Bevölkerungsgruppen aus einem der angeführten Verbotsgründe. Diese Einsicht gilt nur für die letzten Millisekunden der von (nicht nur) rechtlicher Ungleichheit geprägten Menschheitsgeschichte – und auch für diese Millisekunden nicht uneingeschränkt: Als in Kambodscha ab ca. 1975 die Roten Khmer unter Führung von Pol Pot, des "Bruders Nr. 1", die Herrschaft an sich gerissen hatten und ihren »Steinzeitkommunismus« der Bevölkerung oktroyierten, erschlugen sie vor rund 30 Jahren sofort jeden, der eine Brille trug, denn er konnte, so wurde vermutet, lesen - und galt damit als subversiv. Auch andere Lesekundige, die sich nicht verstellt hatten, auf jeden Fall die Leute mit höherer Schulbildung, sind allein ihrer intellektuellen Fähigkeiten wegen entweder gleich umgebracht worden oder sie wurden, um Munition zu sparen, in den „killing fields“ auf den Reisfeldern entweder mit Spaten erschlagen oder durch überharte Arbeit vernichtet, damit sie dem System, das ca. ein Drittel der Bevölkerung getötet hat, nicht gefährlich werden konnten: „Die Macht des Volkes errichten heißt, die Bourgeousie zerstören.“ 55 Ein anschauliches historisches Beispiel für die rechtliche Ungleichbehandlung der Geschlechter liefert die Theologieprofessorin Ranke-Heinemann mit ihrem Hinweis auf das jüdische Eheverständnis zu Lebzeiten Jesu: „Das Eheverständnis der Jünger wurde durch Jesu Wort auf den Kopf gestellt. »Du sollst nicht ehebrechen«, bei diesem Verbot der Zehn Gebote verstanden die Juden für Männer und Frauen etwas Verschiedenes: Für den Mann ist nur der Verkehr mit der Frau eines anderen Ehebruch, für die Frau ist jeder Ausbruch aus der eigenen Ehe Ehebruch. Der Mann kann nur eine fremde Ehe brechen, die Frau dagegen auch die eigene. Für den Mann ist Ehebruch nur Einbruch in eine fremde, für sie ist Ehebruch jeder Ausbruch aus ihrer eigenen Ehe. Das liegt daran, daß die Frau nicht als Partnerin, sondern als Besitz des Mannes gewertet wird. Die Frau mindert durch Ehebruch den Besitz ihres eigenen Mannes. Der Mann dagegen mindert durch Ehebruch den Besitz eines anderen Mannes. Ehebruch ist eine Art Eigentumsdelikt. Verkehr mit einer unverheirateten Frau bedeutet darum für den Mann keinen Ehebruch. Laut Jesu Lehre von der Bedeutung des Ein–Leib-Werdens als einer unzertrennlichen Einheit ist diese privilegierte männliche Auffassung von Ehebruch aufgehoben. Aufgehoben ist auch die Vielehe der Männer, die dem Judentum als von Gott gestattet erschien. Galten die Wünsche eines Ehemannes nämlich einer anderen, nicht verheirateten Frau, so konnte er sie neben seiner schon vorhandenen Ehefrau heiraten. Das Judentum zur Zeit Jesu – außer der Qumransekte – bejaht die Polygamie. Das heißt: Ein Ehemann kann seine eigene Ehe nie brechen. Die Frau gehört ihrem Mann, der Mann gehört aber nicht seiner Frau. Jesu Art, den Schöpfungsbericht zu deuten, machte das alles zunichte, was patriarchalische Sicht aufgebaut hatte. Kein Wunder, daß die Jünger meinen, wenn das so ist, heiratet man am besten gar nicht. Solche Ehe ist nicht nach ihrem Sinn.“3 Den Glauben an die Geltung unserer heute aktuell geltenden Gesetze verlor der seit zehn Jahren als Goldschmied in Rheinland-Pfalz lebende, unbezweifelt deutschstämmige Togolese Liebl, der 2001 im Vertrauen auf diese grundgesetzliche Regelung nach einer anfänglichen Stellung eines Asylantrages die Anerkennung als deutscher Staatsbürger beantragte: Sein Großvater war ein bayrischer Kolonialarzt gewesen, der in Togo eine togolesische Prinzessin geheiratet hatte. In § 4 I des seit einiger Zeit auf der politischen Agenda zur Änderung anstehenden Reichs- und Staatsbürgerschaftsgesetzes4 hieß es zum Zeitpunkt der Antragsstellung über den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft: § 4 [Geburt] (1) Durch die Geburt erwirbt die Staatsangehörigkeit 1. das eheliche Kind, wenn ein Elternteil Deutscher ist, 2. das nichteheliche Kind, wenn seine Mutter Deutsche ist. (2) ... Der schwarzhäutige Nachfahre des deutschen Arztes vermutet nun in der Ablehnung seiner Anerkennung als Deutscher – weil auf irgendeinem Papier die Unterschrift des Kaisers fehlen soll - einen Verstoß gegen den speziellen Gleichheitssatz des Art. 3 III GG. Vielleicht wird irgendwann das BVerfG mit diesem Fall befasst sein, weil sich der Antragsteller auf Grund rassistischer Bestimmungen aus der Kolonialzeit diskriminiert fühlt. Wenn Spitzensportler im Wege des weltweit praktizierten „Sportler-Shoppings“ aus so verstandenem nationalen Interesse u.a. auch bei uns eingebürgert werden, warum dann keine Anerkennung als Deutscher für einen schwarzhäutigen Nachfahren eines Deutschen? GG und Zivilrecht 1.3.1 GG und Zivilrecht 1.3.1.1 Grundsätzliche Vertragsfreiheit im Bereich des Zivilrechts und (meist nur) eingeschränkte »mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte 3 4 Ranke-Heinemann, Uta: Eunuchen für das Himmelreich Katholische Kirche und Sexualität, Hamburg 1988, S. 38 f Seit 2000 wird die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr nur durch das Abstammungsprinzip begründet, sondern auch durch das jus soli, den Grundsatz, dass die deutsche Staatsbürgerschaft an das Territorium (Territorialprinzip) gebunden ist und nicht mehr an die Blutverwandtschaft (Abstammungsprinzip). 56 Grundsätzliche Vertragsfre iheit im Bereich des Zivilrechts und (meist nur) eingeschrä nkte »mittelbare Drittwirku ng« der Grundrecht e Das dem Staat auferlegte Benachteiligungsverbot gilt für den Privatmann aber nicht so direkt und so umfassend. Der Grund ist die unter Privatleuten eingeschränkte Geltung der Grundrechte. Im privaten Bereich haben die zunächst einmal als Abwehrrechte gegen die Übermacht des Staates gerichteten Grundrechte nur eine »mittelbare Drittwirkung«, was z. B. einige »Blaublüter« sogar im Wortsinne beklagen, weil sie enterbt worden sind, da sie unter ihrem in der Verfassung ihres Hauses vorgesehenen Stand geheiratet haben. Sie sehen sich wegen der Abstammung der nach der Meinung ihrer Clans nicht sorgfältig genug ausgewählten jeweiligen Ehefrauen diskriminiert. Eine diesbezügliche Klage wurde vor längerer Zeit beim BVerfG rechtshängig gemacht; da man aber nichts mehr davon hörte, kann man davon ausgehen, dass das Begehren erfolglos verlaufen war. Ein Vermieter kann nicht jederzeit die von seinem Mieter bezogene Wohnung inspizieren. Einen Mieter schützt über die in der Generalklausel des § 242 BGB normierte Verpflichtung zur Erbringung jeglicher vertraglichen Leistung nach dem Grundsatz von »Treu und Glauben« als eines der mit dieser Bestimmung geöffneten »Einfallstore der Grundrechte in das Privatrecht«, als »mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte, das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13 I GG. Durch die von Lehre und Rechtsprechung entwickelte »mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte kann also - in beschränktem Umfang - eine Grundrechtsbindung sogar zwischen Privaten entstehen, obwohl die Grundrechte zunächst einmal die Beziehung zwischen Individuum und Staat betreffen. Auch wenn selbstverständlich nicht alles in einer Verfassung geregelt ist, gar nicht alles geregelt sein kann, weil zukünftige Entwicklungen nicht absehbar sind, so kann die Rechtsprechung trotzdem über vorhandene Generalklauseln den Zeitgeist auffangen und mit den Wertungen des Grundgesetzes in Übereinstimmung bringen. Unstrittig kann hingegen ohne mittelbare Drittwirkung z.B. ein privater Vermieter bei der Auswahl seiner Mieter ohne Verstoß gegen das Grundgesetz nach jedem ihm gut dünkenden Gesichtspunkt differenzieren und seine Wohnung z.B. nur an Einheimische oder kinderlose Ehepaare vermieten. Er braucht nicht Fremde oder Eltern mit lärmenden Bälgern, die vielleicht dann noch in unmittelbarer häuslicher Gemeinschaft mit ihm wohnen und ihm so seine Mittagsruhe rauben würden, zu berücksichtigen. Für ihn gilt das das Zivilrecht beherrschende Prinzip der grundsätzlichen Vertragsfreiheit, was sowohl die Freiheit umfasst, einen Vertrag zu schließen, wie auch die Freiheit, einen Vertrag nicht zu schließen. Ein zwar privatwirtschaftlich organisiertes Versorgungsunternehmen hingegen, das aber als Monopolist die Einwohner eines Wohngebietes allein mit Gas, Wasser oder bis 1999 auch mit Strom versorgt(e), dürfte nicht die Belieferung mit seinem Produkt verweigern, weder gegenüber z.B. einem erwiesenen Atomkraftgegner, noch gegenüber einem Ausländer. Wer ein Monopol innehat, steht unter Abschluss-/»Kontrahierungs-« und Lieferzwang. Alles andere dazwischen ist juristische Grauzone und wird nach tatsächlichen und Zumutbarkeitsgesichtspunkten gemäß § 242 BGB unter Berücksichtigung des Grundsatzes von »Treu und Glauben« innerhalb der durch das BGB vorgegebenen Strukturen entschieden: Ein Einzelhändler, der sich darüber geärgert hatte, dass eine bestimmte Kundin bei ihm immer nur Sonderangebote gekauft, die teuren Waren dagegen liegen gelassen und ihr deswegen Hausverbot erteilt hatte und daraufhin von der pfennigbewussten Hausfrau mit dem Hinweis auf die erst in ca. 4 km Entfernung gelegene nächste Einkaufsmöglichkeit auf Verkaufszwang aus (behaupteter) Monopolstellung heraus verklagt worden war, obsiegte in dem ihm von der sparsamen Hausfrau aufgenötigten Prozess. 4 km seien eine noch zumutbare Entfernung für Einkäufe, entschieden die Richter, da könne noch nicht von einer Monopolstellung gesprochen werden. Das Hausverbot wurde vom Gericht nicht aufgehoben. (Für die entstandenen und von ihr als verlierende Prozesspartei nun zu zahlenden Rechtsanwalts- und Gerichtskosten hätte sie jahrelang teuer einkaufen können. Das kommt davon, wenn man sich im »Recht« glaubt, ohne es jedenfalls nach Meinung des den Prozess entscheidenden Richters - zu sein!) Kritischer wird es mit der»grundsätzlichen«5 Vertragsfreiheit des Zivilrechts, abgesehen von der aufgehobenen Vertragsfreiheit bei Monopolstellung von Versorgungsunternehmen, vielleicht bei folgendem Sachverhalt: 1.3.1.2 Privates Hausrecht überwindet das Diskriminierungsverbot des (speziellen) Gleichheitssatzes aus Art. 3 III GG "Diskotheken Ausländer werden ausgegrenzt 5 Wenn ein Jurist »grundsätzlich« sagt, dann bedeutet das, dass es mindestens eine juristisch relevante Ausnahme gibt, bei der es dann nicht so ist wie in dem aufgestellten Grundsatz; daher das Sprichwort: "Keine Regel ohne Ausnahme", das seinerseits auch nur grundsätzliche Geltung hat, denn: „Alle Menschen müssen sterben!“, und davon gibt es keine Ausnahme. 57 Türsteher verlangen Ausweise mit Arbeitsnachweis Mit den Worten `Ausländer kommen hier nicht rein' verweigern die Türsteher vieler Hamburger Diskotheken ausländischen Jugendlichen den Zutritt. Abendblatt-Mitarbeiterin Petra Neumann versuchte am Wochenende, gemeinsam mit Ciro (24) aus Italien, seiner deutschen Freundin Sabine (22) und den türkischen Studenten Halis (24) und Ersel (23) zum Tanzen zu gehen. Um 23.30 Uhr vor dem `Posemuckel' an der Bleichenbrücke hat Ciro, ein 24 Jahre alter Italiener aus Mailand, noch gute Laune. Der hochgewachsene junge Mann, der seit vier Jahren als Koch in einem italienischen Restaurant arbeitet, will zusammen mit seinen Freunden in der Diskothek in seinen Geburtstag hineinfeiern. Die Jugendlichen haben sich schick für die Szene gemacht. Ersel, ein 23 Jahre alter GermanistikStudent und seit sieben Jahren in Hamburg, trägt sogar einen dunklen Anzug. Doch aus der Geburtstagsfeier wird nichts. `Ausländer lassen wir nur mit Clubausweis rein,' sagt der Türsteher des `Posemuckel'. `Die Frauen können durch, aber ihr müßt erst Ausweise beantragen.' Es dauere allerdings sechs Wochen, bis der Antrag bearbeitet sei, auf dem neben einer Fotokopie des Passes und der Aufenthaltsgenehmigung auch der Name des Arbeitgebers angegeben werden muß. `Wir hatten viel Ärger mit Türken und können keine Ausnahme machen', heißt es zur Begründung. `Sehen wir denn aus wie Verbrecher?' fragt Halis, der in Istanbul geboren wurde und seit sechs Semestern in Hamburg Erziehungswissenschaften studiert. Daß Ausländer - und nur sie - eine Clubkarte brauchen, habe die Polizei angeordnet, sagt der Türsteher. So könnten Ausländer nach Schlägereien leichter ermittelt werden. Der Polizei ist allerdings von solchen Absprachen nichts bekannt. `Das wäre extrem ungewöhnlich', sagt Polizeisprecher Ralf Stahlberg. Nächste Station auf der Suche nach einer Diskothek ist der `Fürstenhof' an der Bramfelder Straße. Es ist mittlerweile 1 Uhr. Die Abweisung vor Hamburgs ältester Diskothek ist unverhohlen und schroff: `Wir dürfen keine Ausländer reinlassen', sagt die Kassiererin. Der Türsteher bestätigt: `Anordnung vom Chef.' `Fürstenhof'-Chef Ernst Utesch will so etwas jedoch nie gesagt haben. `Ausländer dürfen natürlich in den `Fürstenhof'. Wir haben da auch Schwarze', sagt er. `Vielleicht waren die Abgewiesenen in diesem Fall nicht gut angezogen. Wer direkt vom Sportplatz zu uns kommt, darf natürlich nicht rein.' Es ist kurz vor zwei Uhr, als die Gruppe vor dem `Madhouse' am Valentinskamp steht. Aus der Disco dröhnt Musik, Jugendliche kommen und gehen. Doch auch hier werden Ersel, Halis und Ciro abgewiesen. `Einlaß nur mit Einladungskarte', lautet die `Madhouse'-Formulierung, um unliebsame Besucher fernzuhalten. Aus der Disco kommende deutsche Jugendliche versichern uns, daß sie weder Stammgäste noch Besitzer einer Einladungskarte seien. `Was soll's', sagt Ciro resigniert. `Große Lust, meinen Geburtstag in einer Hamburger Disco zu feiern, habe ich mittlerweile sowieso nicht mehr." (HH A 11.01.93) Die Verbitterung über diese (vermutlich von den Chefs der Diskotheken angeordnete) Aussortierpraxis der Türsteher kommt auch in dem Satz des als einer der 11 von 88 für Deutschland bei der LeichtathletikWeltmeisterschaft 1999 in Sevilla gestarteten farbigen Athleten Charles Friedek nach dem Gewinn der Goldmedaille im Dreisprung zum Ausdruck: „Mit meiner Hautfarbe komme ich nicht in die Discos rein, aber Gold für Deutschland darf ich holen.“ Genau so sieht es der Weitspringer Xavier Naidoo, der sich darum mit anderen in der Kampagne »Rock gegen rechte Gewalt« engagierte. Hätten die Jugendlichen Einlass in ein staatliches Jugendzentrum begehrt, hätten sie nicht abgewiesen werden dürfen. Dem Staat wäre eine (diskriminierende?) Einlasspraxis nach der Nationalität der Besucher verwehrt, wenn nicht vielleicht gerade z. B. ein Nationalitätenfest oder Ähnliches als geschlossene Gesellschaft gefeiert würde. Doch dem Privatunternehmer wird die Freiheit des „Aussortierens“ zugestanden: Selbst wenn es sich um die einzige privatwirtschaftlich betriebene Diskothek in einem weiten Umkreis handelt, beständen für klagende ausländische Jugendliche vor Gericht wohl kaum Chancen, Einlass durch ein stattgebendes Urteil zu erzwingen, da Disko-Besuche nicht zu den lebenswichtigen Gütern gehören. Wenn aber viele Discotheken existieren, die mit sogar noch unterschiedlicher Begründung Ausländern den Zutritt verweigern, dann wird da außer ein bisschen Imponiergehabe von Seiten einer für Jugendbelange zuständigen Behörde juristisch nichts zu machen sein. Die ausländischen Jugendlichen können (nach meiner unmaßgeblichen juristischen Einschätzung) jedenfalls nicht unter Berufung auf Art. 3 III GG den Zutritt zu den in dem Zeitungsartikel genannten Hamburger Diskotheken durch ein stattgebendes Gerichtsurteil erzwingen. 58 Privates Hausrech t überwindet das Diskrimi nierungs verbot des (spezielle n) Gleichhe itssatzes aus Art. 3 III GG "Jugendschutz reagiert auf Diskriminierung von Ausländern Klage gegen Disco-Betreiber? Disco-Betreiber, die Ausländern generell den Zutritt verweigern, müssen sich möglicherweise vor Gericht für ihre diskriminierende Praxis verantworten. Wolfgang Hammer, Leiter des Referates Jugendschutz, will Inhaber, die nur Deutsche in ihre Disco lassen, wegen `Anstachelung zum Rassenhaß' anzeigen. `Unsere Rechtsabteilung prüft zurzeit, welche strafrechtlichen Sanktionen gegen dieses ausländerfeindliche Verhalten möglich sind,' sagt Wolfgang Hammer. `Es kann nicht angehen, daß durch dieses Geschäftsgebaren jungen Ausländern ein wesentlicher Freizeitbereich verwehrt wird.' Hammer will außerdem zusammen mit Jugendorganisationen wie dem Landesjugendring eine Kampagne gegen die Diskriminierung ausländischer Jugendlicher starten. Wie berichtet, kommen zum Beispiel in den Fürsthof und in das Posemuckel Ausländer entweder gar nicht oder nur nach Vorlage des Reisepasses und eines Beschäftigungsnachweises hinein. Wolfgang Hammer selbst erhielt kurz nach Erscheinen des Berichts Anrufe, in denen anonym gedroht wurde: `Wir werfen dir Molotow-Cocktails ins Büro, wenn du dich weiter gegen kanakenfreie Discos einsetzt.'" (HH A 15.01.93) Mit seiner Drohung der Erstattung einer Strafanzeige wegen "Aufstachelung zum Rassenhass" gemäß § 131 StGB schlägt der Herr Hammer vor der ihn interviewenden Presse natürlich nur wie ein Pfau ein großes publizistisches Rad ohne jeden weiteren Effekt, damit die ausländischen Jugendlichen glauben, ihnen würde von Behördenseite wirkungsvoll geholfen. Doch schon die Suche nach einem Hebel aus dem Bereich des Strafrechts zur Lösung eines zivilrechtlichen Problems zeigt, wie wenig aussichtsreich ein Unterfangen der Behörde in diesem Zivilrechtsstreit gewesen war, als es noch nicht das Antidiskriminierungsgesetz gab. Ehrlicher wäre es gewesen einzugestehen, dass von staatlicher Seite in diesem Fall nicht geholfen werden konnte. Die Erzwingung von Einlass für Ausländer in eine Disco ist eher ein marktwirtschaftliches, genauer: ein betriebswirtschaftliches, aber bestimmt kein (straf-)juristisches Problem! Da muss jemand die Marktlücke des Disco-Angebotes für Ausländer oder Ausländer und ihre deutschen Freunde erkennen und durch das Angebot der Eröffnung einer Disco "Multi-Kulti" wahrnehmen. (Der Staat kann dabei vielleicht durch Bereitstellung eines geeigneten Grundstücks oder Gebäudes unterstützend tätig werden.) Aber wenn man unter Hinweis auf § 131 StGB in Discotheken den Zutritt für Ausländer erzwingen zu können vorgab, dann gab man sich der Lächerlichkeit preis! Das zeigt ein Blick in das Gesetz - und ein Blick in das Gesetz behebt manchen Zweifel: "§ 131 StGB Verherrlichung von Gewalt; Aufstachelung zum Rassenhaß (1) Wer Schriften (...), die Gewalttätigkeiten gegen Menschen in grausamer oder sonst unmenschlicher Weise schildern und dadurch eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrücken oder die zum Rassenhaß aufstacheln, 1. verbreitet, 2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder 4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, in den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder daraus auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk verbreitet. (3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. (4) Abs. 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt." Losgelöst von den vielen unterschiedlichen im "Tatbestand" (Gesetzeswortlaut) des § 131 StGB aufgeführten Tatmodalitäten einer möglichen Verhetzungshandlung muss irgend etwas mit Schriften oder ihnen gleichgesetzten Verbreitungsweisen unternommen worden sein, das zur Verherrlichung von Gewalt anregte oder zum Rassenhass aufstachelte. Ist das nicht der Fall, so kann die jeweilige (straf-)gesetzliche Bestimmung nicht angewendet werden. Das beinhaltet die in Art. 103 II GG u.a. geregelte und später noch genauer zu besprechende "Garantiefunktion" der strafgesetzlichen Tatbestände. 59 Art. 103 II GG „Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde." Da die Türsteher keine Schriften verbreitet, sondern nur gesagt hatten: "Du kommst hier nicht rein!", kann die von dem Leiter des Hamburger Referates Jugendschutz wohl nur zu Pressezwecken bemühte Strafnorm gar nicht einschlägig sein! Der Anwalt des Diskothekenbetreibers wird sich bei einer Strafanzeige völlig entspannt zurücklehnen! (Das müsste die Rechtsabteilung des Bezirksamtes dem Leiter des Referates Jugendschutz gesagt haben - und wird es wohl auch getan haben!) Aber die Hamburger Jugendbehörde blieb verbissen - und wohl mehr auf Medienwirksamkeit bedacht - am Ball: "Klage gegen Disco-Betreiber? Kein Zutritt für Ausländer - Jugendbehörde prüft rechtliche Schritte Betreiber von Discotheken, die ausländischen Jugendlichen keinen Einlaß gewähren (das Abendblatt berichtete), könnten sich bald auf der Anklagebank wiederfinden: Jugendbehörde und Landesjugendring prüfen, ob juristische Schritte möglich sind. `Wir haben mehrere Rechtsanwälte mit der Prüfung beauftragt', sagt Klaus Groß-Weege, Geschäftsführer des Landesjugendrings. Juristen halten Klagen gegen `ausländerfeindliche' Disco-Betreiber auf strafrechtlicher und zivilrechtlicher Ebene für möglich. `Vor einem Zivilgericht könnte man wegen Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes, der sich aus Artikel 3 des Grundgesetzes ergibt, klagen', so der Hamburger Rechtsanwalt Frank Vogler. Voraussetzung sei eine eindeutige Diskriminierung. Die diskriminierten Jugendlichen könnten aber auch Anzeige wegen Beleidigung oder Volksverhetzung erheben. Folge für die Betreiber könnte der Entzug der Konzession sein, so Vogler. Der Erfolg der Klagen ist unklar. Professor Reinhard Bork, Zivilrechtler an der Universität Hamburg: `Bei diesem Problem greift der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Er gilt in unserem Rechtssystem als sehr hohes Gut. Ob Gerichte solchen Klagen entsprechen, ist daher sehr unsicher.' Rechtsanwalt Falk Vogler ist optimistischer: `Der Gleichheitsgrundsatzes aus dem Grundgesetz gilt nicht nur gegenüber dem Staat, sondern mittelbar auch gegenüber Privatleuten.' Es sei daher durchaus möglich, daß ausländische Jugendliche sich auf ihn berufen könnten, wenn sie diskriminiert würden. Deutsche Jugendliche, die sich über die Türsteher vor Hamburgs `In'-Discos ärgern, weil auch sie draußen bleiben müssen, haben allerdings keine Chance, den Eintritt mit Hilfe eines Gerichts zu erzwingen. Der Dicotheken-Besitzer hat das Hausrecht. Wenn sein Laden voll ist, ein Gast nach Randale aussieht oder sonst seinen Vorstellungen nicht entspricht, kann er ihn abweisen', sagt Rechtsanwalt Vogler. Einzige Ausnahme sind auch hier eindeutige Diskriminierungen. `Aber die wird man fast nie beweisen können.' Zivilrechtler Bork: `Krawattenzwang ist keine Diskriminierung.' Die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Madeleine Göhring will unterdessen in einer Kleinen Anfrage wissen, warum die Jugendbehörde erst jetzt gegen `ausländerfeindliche Disco-Betreiber' vorgehen will. Der Senat schöpfe seine rechtlichen Möglichkeiten offenbar nicht aus." (HH A 15.02.93) Frau Göhring: Der Senat hat gar keine! Darum ist er ja auch gar nicht "vorgegangen". Er schlägt nur, wie ein Pfau, der Presse gegenüber das große Rad. Da helfen nur „Türken-Discos“. Zwölf Jahre später versuchte Ende 2004 die rot-grüne Regierungskoalition mit einem projektierten Anti-Diskriminierungsgesetz eine rechtliche Möglichkeit für ein Eingreifen zu schaffen. (Näheres siehe im übernächsten Kapitel 1.3.2.1.1) Die Verweigerung des Zutritts zu einer Disco durch den Türsteher ist Madonna in New York laut einer Pressemeldung auch passiert. Sie konnte aber drohen: "Wenn ich hier nicht gleich reingelassen werde, dann kaufe ich den Laden, und Du fliegst." Das half! Die ausländischen Jugendlichen in Hamburg und Madonna in New York sind nicht die einzigen, denen der Zutritt zu einer Lokalität verwehrt wurde. Das passiert hunderten, tausenden deutschen Jugendlichen jedes Wochenende, ohne dass einer der Einlass Begehrenden die Chance hätte, mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung den Eintritt zu erzwingen. Wieso soll dann ausländischen Jugendlichen rechtlich gestattet werden, was deutschen Jugendlichen rechtlich versagt wird? Schon allein diese Kontrollüberlegung zeigt die Schwäche des (behaupteten) strafjuristischen Argumentes der Hamburger Jugendbehörde! Und in anderen Ländern Europas ist das ebenso. Die Problematik gilt übrigens nicht nur für Jugendliche und Discotheken. So habe auch ich einmal Lokalverbot 60 in einem meinem Haus sehr nahe gelegenen und von einem Deutschen geführten Restaurant erhalten - nachdem ich ein zu zähes Steak hatte zurückgehen lassen -, ohne dass die Chance bestände, dieses Verbot gerichtlich für ungültig erklären zu lassen. Ich hätte halt gleich ins Block-House gehen sollen! Nun gehe ich noch mehr als vorher zu Chinesen, Griechen, Indern, Italienern, Jugoslawen und Spaniern essen. Und wenn bei nachmittäglichem Vorstadtbummel ein griechischer Gastwirt in seinem völlig leeren Lokal ganz untypischerweise das Ausschenken von je einem Glas Wein an meine Frau und mich verweigerte, weil wir nicht gleichzeitig auch Essen mitbestellten, sondern - in Erinnerung eines wunderschönen Segeltörns durch den Dodekanes von Samos nach Rhodos - nur einfach den Wein trinken wollten, dann besteht für den unfreundlichen Wirt, der sicher kein Nachfahre der für ihre Gastfreundschaft heute immer noch berühmten Philemon und Baucis gewesen sein kann, auch kein »Kontrahierungszwang«. Da muss man sich dann einen anderen Griechen suchen. Gedacht, getan - gefunden. Wie gesagt: Dem Staat ist eine sachfremde Benachteiligung von einzelnen Bürgern oder Bevölkerungsgruppen aus einem der im speziellen Gleichheitssatz des Art. 3 III GG angeführten Verbotsgründe untersagt. Dabei kann im Einzelfall immer strittig sein, inwieweit eine Benachteiligung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe sachfremd ist - oder auch nicht. Dieses zuvörderst dem Staat aufgegebene Benachteiligungsverbot gilt für den Privatmann aber nicht so umfassend. "Unerwünschte Gäste ap Karlsruhe - Spielbanken dürfen Kunden ohne Begründung den Zutritt verweigern. Das hat der Bundesgerichtshof im Falle eines Ehepaares entschieden. Es spielte 18 Jahre im Kasino Travemünde und lebte von den Gewinnen." (HH A 26.08.94) 1.3.2 Grundrechte und ihre Bedeutung am Beispiel des allgemeinen und des speziellen Gleichheitssatzes von Art. 3 GG 1.3.2.1 Allgemeiner Gleichheitssatz des Art. 3 I GG Bisher war nur von dem speziellen Gleichheitssatz des Art. 3 III GG die Rede, um das Wesen der Grundrechte zu erklären. Die Formulierung »spezieller« Gleichheitssatz legt die Vermutung nahe, dass es auch einen »allgemeinen« Gleichheitssatz geben muss, denn sonst wäre die Formulierung ja unsinnig. (Rückschlüsse auf den Sinn einer Formulierung zu ziehen, ist bei ungenau formulierten Gesetzen eine wichtige juristische Tätigkeit!) Der allgemeine Gleichheitssatz lautet: Allge meiner Gleich heitssa tz des Art. 3 I GG „Art. 3 I GG Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich." (Wohlgemerkt: „vor dem Gesetz“; nicht unbedingt im privaten Bereich, z.B. vor einem den Einlass in eine Disco recht willkürlich regulierenden Türsteher, wie wir ihn im letzen Kapitel kennen gelernt haben!) Den in Art. 3 I GG zum Ausdruck gebrachten allgemeinen Gleichheitssatz erklärte Gerhard Branstner mit den Worten: „Die Objektivität der Gesetze besteht darin, daß sie sich nicht bestechen lassen.“ Humorvoller und darum eingängiger formulierte Germund Fitzhum: „Das Auge des Gesetzes zwinkert nicht!“ Das große Ziel des allgemeinen und des zur notwendig erachteten Klarstellung zusätzlich speziell normierten Gleichheitsgebotes in Art. 3 ist die Verwirklichung von „Gerechtigkeit“. Eine von den Gedanken und Forderungen der Französischen Revolution inspirierte Demokratie muss allen ihren politischen Vorstellungen und Maßnahmen den Gleichheitssatz (in welcher Ausprägung auch immer) zu Grunde legen! Vor dem Gesetz dürfen nicht einige Bürger »gleicher« sein als wir anderen: Der Staat darf keinen Bürger ungerechtfertigt und damit willkürlich benachteiligen oder bevorzugen. Natürlich beziehen immer einige Gruppen Leistungen, die 61 andere nicht beziehen. Will man feststellen, ob z.B. eine nicht begünstigte Gruppe unberechtigt schlechter und damit ungleich behandelt wurde, dann muss geprüft werden, ob sie ohne sachlich vertretbaren Grund und damit willkürlich effektiv schlechter gestellt wurde als die Vergleichsgruppe. 1.3.2.1.1 Gleichheitssatz des Art. 3 GG als »Willkürverbot« Dieses Grundrecht auf Gleichbehandlung aller Bürger ohne sachfremde Differenzierung in der Form von Bevorzugung oder Diskriminierung bindet als »Willkürverbot« alle staatlichen Gewalten. Es verlangt nach dem schon von dem größten Gelehrten der Antike mit Wirkung in die Neuzeit, Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), aufgestellten Gleichheits- oder Gleichbehandlungsgrundsatz, wesentlich Gleiches rechtlich gleich und wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend rechtlich ungleich zu behandeln. Andersherum ausgedrückt ist es dem Staat also verboten, wesentlich Gleiches willkürlich ungleich und wesentlich Ungleiches willkürlich gleich zu behandeln. Damit ist dem Staat eine willkürliche, d. h. sachfremde, sich zum Vorteil des Einen oder einer Benachteiligung des Anderen auswirkende Differenzierung verboten. Wenn sich der Staat in einer bestimmten Problemlage für eine bestimmte rechtliche Vorgehensweise entschieden hat, dann darf er in den nächsten gleichgelagerten Fällen grundsätzlich nicht davon abweichen und muss sie analog den zuvor entschiedenen behandeln – wenn er nicht mit seiner anders gelagerten Entscheidung aus wohl erwogenen und eventuell vor den Verwaltungsgerichten zu rechtfertigenden Gründen eine andere Verwaltungspraxis beginnen will, an die er sich dann (erst einmal) zu halten hat. Es tritt somit auf Grund des Gleichheits- oder Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Selbstbindung der Verwaltung durch vorgängiges Verwaltungshandeln ein. Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz und die sich daraus ergebende Selbstbindung der Verwaltung ist auch anderen Rechtssystemen nicht fremd: Der britische Thronfolger Prinz Charles hatte in Anwesenheit seiner Mutter, der Queen, auf Schloss Windsor seine zweite Trauung mit seiner Dauerliebe, der nach der Terminologie der unter diesem Verhältnis zerbrochenen ersten Ehefrau des Thronfolgers, Lady Diana, als „Rottweiler“ beschimpften Camilla Parker Bowles, vornehmen lassen wollen. Die Rechtsberater der Queen hatten jedoch übersehen, dass nach einem britischen Gesetz ein Ort, der einmal die Trauungslizenz erhält, für drei weitere Jahre danach allen anderen Kandidaten offen stehen muss, die an gleicher Stelle den Bund fürs Leben schließen wollen. Erschreckt ob der Aussicht, dass eine Heerschar von Heiratswilligen sich demnächst zur Trauung auf Schloss Windsor würde anmelden wollen, war die Queen „not amused“! Die Familie machte einen Rückzieher und entschied sich für die standesamtliche Trauung in der Guildhall von Windsor auf dem Standesamt, wobei sich ein weiteres juristisches Problem auftat, denn ein Thronfolger ist ja nicht so jemand wie Sie und ich: Der Lordrichter Charles Falconer hatte zwar erklärt, die Regierung befinde die standesamtliche Trauung von Prinz Charles und Camilla Parker Bowles für legal. Andere Rechtsexperten führten demgegenüber an, dass für Mitglieder des Königshauses ausschließlich eine kirchliche Eheschließung erlaubt sei: Als 1836 per Gesetz die zivile Trauung in England und Wales eingeführt worden war, waren die Mitglieder der königlichen Familie ausdrücklich davon ausgeschlossen worden! Als das Gesetz 1949 aktualisiert worden war, blieb die Ausnahme für die Royals bestehen. Darum durfte Prinzessin Maregret, die Schweseter der Queen, in den 50er Jahren auch nicht den geschiedenen Peter Townsend heiraten. Und Charles’ Schwester Anne ehelichte Tim Laurence 1992 in zweiter Ehe in Schottland, wo andere Gesetze gelten. Weil aber Charles und Camilla (wegen ihrer ehebrecherischen Beziehung zueinander) geschieden sind, verbietet die anglikanische Kirche eine kirchliche Trauung! Ein juristisches Dilemma, aus dem es nach britischem Recht eigentlich keinen Ausweg gab! Und trotzdem heirateten sie in Windsor und der Erzbischof von Canterburry vollzog den kirchlichen Ritus, nachdem beide die früheren ehelichen Verfehlungen ihrer Liebesbeziehung bekannt hatten. Das war nur möglich, weil Großbritannien sieben Jahre zuvor der Europäischen Menschenrechtskonvention beigetreten war, und nach der sind alle Menschen gleich, auch ein Kronprinz und seine frühere Geliebte! Simmel hat wieder einmal Recht mit seinem schönen Buchtitel: „Gott schützt die Liebenden!“ Dem so abstrakt formulierten Grundsatz, wesentlich Gleiches rechtlich gleich und wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend rechtlich ungleich zu behandeln, kann man zustimmen. Er hört sich nicht unbillig an und darum wurde der von Aristoteles formulierte Gleichheitssatz vom BVerfG aufgegriffen und seiner Rechtsprechung zu Grunde gelegt. Dabei kann allerdings im Einzelfall durchaus strittig sein, wann etwas »gleich« und wann etwas anderes »ungleich« ist! Zum bloßen Wundern, da in der Presse ohne nähere Begründung mitgeteilt: „Unterschiedliche Bezahlung verfassungsgemäß Gefangenenlohn Es verstößt nicht gegen das Grundgesetz, dass Strafgefangene etwas mehr Lohn für ihre Arbeit 62 erhalten als Untersuchungshäftlinge. Diese Entscheidung hat am Mittwoch eine Kammer des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe veröffentlicht. Das Gericht nahm die Verfassungsbeschwerde eines Untersuchungsgefangenen mangels Erfolgsaussicht nicht zur Entscheidung an. (AP)“ (Die Welt 13.05.2004) Für Aristoteles ergab sich auf Grund der ihm offensichtlichen biologischen Ungleichheit der menschlichen Körper – wobei der weibliche, (unter den Menschen) allein Leben spendende nicht als der vollkommenere, sondern aus auf Hippokrates’ »Erkenntnissen« fußender männerzentrierter Sicht als der wesenhaft unvollkommene weil menstruierende Körper angesehen wurde, der nicht im Stande sei, Unreinheiten über den Schweiß auf sanfte und anmutige Weise auszuscheiden und darum zu seiner Reinigung auf die Menstruation angewiesen sei - aus dem von ihm formulierten Gleichheitssatz z.B. zwingend, dass Männer untereinander gleich, Frauen6 und Sklaven im Vergleich zu jenen aber ungleich und somit von den Staatsbürgerrechten auszuschließen seien: Weil Frauen menstruieren, seien sie juristisch als minderwertig zu behandeln! Und was galt dann aber für Frauen nach ihrer Fruchtbarkeitsphase? Da wurden ihnen keine Rechte neu eingeräumt. Männerlogik, auch in der das Geistesleben der Antike und des gesamten Mittelalters prägender »aristotelischer Vollkommenheit«: Nein danke! Solch eine gravierende rechtliche Benachteiligung musste - wenigstens dem äußeren Schein nach - mit irgendeinem und wenn auch noch so flauen (Schein-)Argument begründet werden; und wenn die (Schein-)Begründung ideologisch auch noch so weit hergesucht wurde. Aber amüsant-interessant ist sie noch heute. Dahinter steckte u.a. der Streit, was bei der Entstehung neuen Lebens wichtiger ist: die (weibliche) Eizelle oder der (männliche) Samen? Auf Autofahrerniveau veranschaulicht: Der Motor oder der Starter. Die meinungsbildenden Männer des alten Griechenlands wie Aristoteles waren selbstverständlich der Meinung: der Samen. Das verwundert nicht, insbesondere da die Eizelle erst 1827 entdeckt wurde, der Samen hingegen von Anbeginn an offensichtlich, so oder so in aller Munde war. Bis zur Entdeckung der Eizelle, bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts also, glaubte man, dass vom Mann ein klitzekleiner Mensch in das „Gefäß“ Frau ergossen werde und „Homunkulus“ – so wurde er genannt – dort zu Babygröße heranwachse. Interessant ist jedoch die Begründung, mit der von den »alten Griechen« die Rechte der Frauen beschnitten wurden: Wie ja jeder (göttergläubige Grieche) »wisse«, sei in früher Vorzeit die Göttin Athene ohne Mutter geboren worden, da sie im Hirn des Zeus entstanden (und als Kopfgeburt darum später als Göttin mit dem Referat „Weisheit“ betraut) und dem Haupte des Zeus direkt entsprungen sei (nachdem der zuvor seine mit Athene schwangere Geliebte vorsichtshalber gefressen hatte, weil ihm, ähnlich wie später dem König Laios, dem Vater von Ödipus, orakelt worden war, dass er für seinen Vatermord an Kronos von einem eigenen Sohn vom Götterthron gestürzt werden würde, so er denn einen Sohn zeugen würde). Also, schlussfolgerten gelehrte Griechen spitzfindig auf Grund der angeblichen göttlichen Kopfgeburt der Göttin durch Göttervater Zeus – was den irdischen Männern nicht möglich war, war also dem obersten der Götter möglich: ohne Zwischenschaltung einer Frau als »Gefäß« Leben zu spenden –, also folgerten die für die rechtliche Benachteiligung der Frauen juristische Scheinargumente suchenden griechischen Männer als weitere männliche, aber dieses Mal irdische männliche Kopfgeburt, sei der mütterliche Teil für die Entstehung neuen Lebens nicht ausschlaggebend. Folglich seien die Männer wichtiger, darum ständen ihnen mehr Rechte zu als den Frauen. Eine sophistische Spitzfindigkeit! Und eines Aristoteles nicht würdig - zumal 150 Jahre früher von anderen Griechen die soziale Gleichstellung der Frauen mit den Männern als gesellschaftlicher Alternativentwurf zu der praktizierten Realität schon gedacht worden war. Strathern erzählt in „Pythagoras & sein Satz“, dass von den dem Glauben der Wiedergeburt in jeglicher lebender Gestalt und Form anhängenden Pythagoräern nicht nur die Sklaven (trotz ihrer nicht durch Freilassung aufgehobenen Sklavenstellung), sondern auch sogar(!) die Frauen als 6 Frauen wurden von den frühen griechischen Anatomen und »Körper«-Philosophen - insbesondere Hippokrates (460 – 377 v.Chr.) und darauf fußend Galen/Galemos (131 – 201 n. Chr.), dessen Schriften die gesamte antike Heilkunde zusammenfassten und das ganze Mittelalter hindurch die medizinische Lehrgrundlage waren, - als „umgekehrte Männer“ angesehenen. Laqueur fasst in seinem Buch „Auf den Leib geschneidert. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike bis Freud“ die damaligen »phallozentrischen Vorstellungen« der Männer in den Worten zusammen: „Frauen [waren] im Grunde genommen Männer ..., bei denen ein Mangel an vitaler Hitze – an Perfektion – zum Zurückbehalten von Strukturen im Inneren des Leibes geführt hat[te].“ Vgl. und zitiert nach Angier, N.: Frau - Eine intime Geographie des weiblichen Körpers, S. 75 f Und so »phallozentrisch« definierte gravierende körperliche Mängel bedingten Rechtsmängel: Es war nach dem Gleichheitssatz des Aristoteles nur »gerecht«, dass »Mangel-Männer« selbstverständlich den ihnen von den »vollendeten« Männern zudiktierten staatsbürgerlichen Rechtsmangel hinzunehmen hatten! 63 gleichberechtigt behandelt wurden: „Diese Toleranz erstreckte sich sogar auf Frauen. (Aufmüpfige Männer, denen es schwerfiel, sich mit diesem unerhörten Sachverhalt abzufinden, wurden daran erinnert, daß ihre Seele in einem früheren Leben den Körper einer Frau bewohnt haben oder in einem zukünftigen zu einem solchen Schicksal verurteilt sein könnte.)“ 7 Hätte Pythagoras’ (565 – 490 v.Chr.) zahlenmystische Religionsphilosophie eine größere und andauerndere Bedeutung erlangt, wäre die Gleichberechtigung der Frauen möglicherweise viel früher und viel leichter durchsetzbar gewesen. Aber gegen Aristoteles’ überragende Bedeutung für die Zeitspanne von der Antike bis zur beginnenden Neuzeit und gegen seine Vorurteile konnte sich der Gedanke der Gleichberechtigung der Geschlechter nicht durchsetzen. Das wäre vermutlich anders gewesen, wenn nicht Christus, sondern eine als Religionsstifterin gewirkt habende Christa ans Kreuz geschlagen worden wäre! Lysistratas und ihrer Geschlechtsgenossinnen Kampfmittel („Liebe Männer, ihr dürft es euch so lange selber besorgen, bis ihr vernünftig werdet!“) konnte auch keine allzu große Durchschlagskraft gegen die aristotelischen Ansichten und Vorurteile entwickeln, da die gesellschaftlich tonangebenden griechischen Männer dem Ideal der Knabenliebe ganz praktisch frönten! Aber nicht nur Männer spinnen - damals und heute! Auch manche Frauen spinnen: damals und heute. Denn als solches empfinde ich es, wenn - weil die Initiatorin dort beschäftigt war - über die „Hamburger Landeszentrale für politische Bildung“ Zettel verteilt wurden, aus deren Text nachfolgender Schwachsinn auszugsweise zitiert wird: „GARTEN DER FRAUEN Eine letzte Ruhestätte nur für Frauen und ein musealer Ort für alte Grabsteine von Gräbern bekannter Frauen WAS IST DER GARTEN DER FRAUEN? Der Garten der Frauen ist ein Ort, auf dem Frauen ihre letzte Ruhestätte finden können, die auch im Tod gern unter Frauen sein wollen. ... WER FINDET IM GARTEN DER FRAUEN EINE LETZTE RUHESTÄTTE? Frauen, die sich gut vorstellen können, inmitten von Frauen ihre letzte Ruhestätte zu finden. Vielleicht haben sie zu Lebzeiten ... und, und, und, oder empfanden zu Lebzeiten die Gesellschaft mit Frauen als angenehm, so dass sie dies im Tod fortführen möchten.“ Ich versichere, in dem vorstehenden Zitat - wie bei allen anderen auch: ich übernehme als gelernter Historiker sogar die Rechtschreibfehler der Ursprungstexte (baue höchstens aus Versehen selber welche ein) - keinen Buchstaben des mir hirnrissig erscheinenden Textes geändert und nur weggelassene Wörter durch die üblichen drei Punkte kenntlich gemacht zu haben! Mit dem Gleichheitssatz im Hinterkopf sollte man sich zwei Satzteile noch einmal vergegenwärtigen: „... Frauen ..., die auch im Tod gern unter Frauen sein wollen“ „... empfanden zu Lebzeiten die Gesellschaft mit Frauen als angenehm, so dass sie dies im Tod fortführen möchten.“ Eigenartiger Friedhofsfeminismus! Und ich dachte immer: „Leiche ist Leiche“, wenn es nur um das Bestatten geht. Und erst recht gilt das nach meinem Dafürhalten für die Asche aus einer Feuerbestattung. Nach dem Gleichheitssatz würde ich auf einem Friedhof Asche wie Asche und Leiche wie Leiche behandeln. Aber das scheint selbst einer promovierten Frau wie der Initiatorin nicht zu vermitteln zu sein. Die emanzenhaft verschrobene Frau und ich, wir müssen einen sehr unterschiedlichen Biologie- und Chemieunterricht erteilt bekommen haben! Der Hamburger Senat beugte sich der Pression von »Emanzen-Seite«, richtete den geforderten „Garten der Frauen“ ein und behandelt damit nach meiner Ansicht - andere mögen es anders sehen - Gleiches ungleich, da auf den Friedhöfen der Freien und Hansestadt Hamburg keine Geschlechtertrennung über den Tod hinaus vorgenommen wird. Und warum auch? Warum sollten meine Überreste nach Verwendung meines Körpers zu medizinischen Zwecken in der Ärzteausbildung, wozu ich ihn freigeben möchte, nicht neben der dort schon lange ruhenden Asche meiner Frau beigesetzt werden? Doch sollen an dieser Stelle nicht alte oder neue Schlachten geschlagen werden. Nur weil es sich anbot, sollte an 7 Strathern, P.: „Pythagoras & sein Satz“, S. 54 64 dieser Stelle an dem historischen Beispiel der Ungleichbehandlung von Frauen im alten Griechenland en passant anschaulich gemacht werden, wie teilweise hergesucht, fadenscheinig und damit äußerst fragwürdig juristische Machtfragen begründet wurden (und werden!), um zu eigenem Nutz und Frommen Vorrechte weiterhin aufrecht zu erhalten. Das kann wachsam machen und den Blick für die Jetztzeit schärfen, der wir uns nun wieder zuwenden wollen. Versuchen wir dabei, das jeweilige Argument hinter einer juristischen Entscheidung zu erkennen und zu bewerten. Ein x-beliebiger Fall für eine Abwägung nach dem Gleichheitsgrundsatz: Nachdem schon vor Jahren in einigen Bundesländern und im Ausland Menschen, insbesondere Kinder, von sogenannten »Kampfhunden« (die sich mit Vorliebe Zuhälter hielten, um die Tiere durch Abrichtung zu Kampfmaschinen ohne Beißhemmung u.a. für die Kämpfe um die Aufteilung der Damen, der Gebiete und für Hundewettkämpfe in ihrem Wesen zu pervertieren) angefallen und teilweise zerfleischt worden waren, verschärfte damals Hamburg - wie andere Bundesländer auch - die Hundehaltung durch die Schaffung einer sogenannten "Kampfhundeverordnung". In ihr wurde den Haltern von Kampfhunden u.a. auferlegt, ihre Befähigung zur Haltung der dort aufgeführten Hunderassen durch Erwerb eines »Kampfhund-Führerscheins« nachzuweisen (der nach der Intention der Innenbehörde Zuhältern verweigert werden sollte) und ihre Tiere stets angeleint zu halten. Hiergegen klagte ein betroffener Hundehalter. Damit stand die erlassene "Kampfhundeverordnung" auf dem juristischen Prüfstand. Durften den Besitzern von Kampfhunden Beschränkungen auferlegt werden, die anderen Hundehaltern erspart blieben? (Man darf dabei ja nicht nur an Dackelhalter denken!) Das Hamburger VG gab dem Kläger Recht: Nach Ansicht der Richter verletzte die Verordnung (VO) in der ursprünglichen Form willkürlich den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung. Es sei nicht erwiesen, dass Hunde der Rassen Pitbullterrier, Bandog oder Mastino Napoletano gefährlicher seien als z.B. Schäferhunde. Den richterlichen Erwägungen lag die (nur eingeschränkt brauchbare) Statistik zugrunde, derzufolge in Hamburg pro Jahr etwa 500 Bisswunden bei den Bezirksämtern gemeldet werden, von denen nur 5 % von Kampfhunden stammen. 50 % der Fälle gingen dagegen auf das Konto von Schäferhunden oder Schäferhundmischlingen, je 8 % entfielen auf Boxer und Rottweiler. (Die Richter setzten die Zahl der Bissverletzungen durch Kampfhunde aber nicht in Relation zu der Prozentzahl der Kampfhunde am gesamten Hamburger Hundebestand! Das ist ein schwerer Fehler in ihrer Argumentation. Es könnte ja theoretisch sein, dass die aus der Statistik herausgelesenen 5 % Kampfhunde alle schon gebissen hätten. Das wären dann 100 % der Kampfhunde, was sicher die Aufnahme dieser Rassen in die Kampfhundeverordnung gerechtfertigt hätte.) Weil der Behörde in der bewussten Hundeverordnung die Differenzierung nach Kampfhundearten gerichtlich untersagt worden ist, sie andererseits aber für potenziell gefährliche Hundearten den Leinenzwang aufrechterhalten wollte, erwog sie, die VO umzuformulieren, so dass jetzt alle »gefährlichen« Hunde einem Leinenzwang unterliegen sollten. Sie musste dazu aber mit einem "unbestimmten Rechtsbegriff" arbeiten - welche Hunde sind als potenziell gefährlich einzustufen und in einer Liste auszuweisen? -, der sicher wieder Anlass zu gerichtlichen Auseinandersetzungen hätte geben können. Nachdem im Jahre 2000 erneut ein kleiner Junge von Kampfhunden totgebissen wurden war, waren die Verwaltungsrichter der Hamburger Verwaltung bei der neuen Hundeverordnung aber nicht mehr in den Arm gefallen! Ein Blick über den Zaun: In den Niederlanden gibt es ein "Gesetz zur Abschaffung von Pitbullterriern", in vielen großen amerikanischen Städten, wie z.B. Denver, Cincinnati und San Francisco, ist das Halten und Züchten von American Pitbullterriern total verboten. Angetroffene Kampfhunde werden beschlagnahmt und eingeschläfert. Gleichhei tssatz des Art. 3 GG als »Willkürv erbot« Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz hat sich - weil allgemein befriedend, da das empörte Gerechtigkeitsgefühl der meisten beruhigend - als sehr segensreich für die Ausgestaltung unseres politischen Zusammenlebens erwiesen. Als übergeordneter Grundsatz für eine »gerechte(re)« Ausgestaltung der Lebensverhältnisse wird diese aristotelische »Gerechtigkeits-Elle« für staatliches Handeln immer unverzichtbar bleiben! Und immer wieder angewandt werden: 2005 entschied das Sozialgericht Düsseldorf in einer einstweiligen Anordnung (AZ S 35 SO 28/05 ER) auf die Klage einer arbeitslosen Frau hin, die bei einem berufstätigen Mann lebt, dass entgegen der Meinung der Bundesagentur für Arbeit – nach Rechtsauffassung der Bundesagentur hätte der Mann die unverheiratet mit ihm zusammenlebende Frau zu unterstützen, sein Einkommen müsste bei der 65 Bedarfsberechnung mit herangezogen werden, weil die beiden eine Bedarfsgemeinschaft bildeten – die Anrechnung von Partnereinkommen bei unverheiratet zusammenlebenden heterosexuellen Paaren, von denen ein Partner einen Antrag auf den Bezug von Arbeitslosengeld II gestellt habe, gegen das Grundgesetz verstoße und damit - möglicherweise - verfassungswidrig sei, weil diese Anrechnung bei außerhalb der Bindungen einer legalisierten homosexuellen Partnerschaft zusammenlebenden gleichgeschlechtlichen Paaren nicht vorgesehen sei. Bei denen läge, wenn sie nicht in der Form einer eingetragenen Partnerschaft zusammenleben, keine Bedarfsgemeinschaft in Form einer nicht legalisierten "eheähnliche Gemeinschaft" vor, bei zusammenlebenden Heterosexuellen hingegen wird sie als "wilde Ehe" unwiderleglich vermutet. Die Schlechterstellung unverheirateter heterosexueller Partnerschaften gegenüber insoweit bevorzugten homosexuellen Partnerschaften verstoße damit gegen den Gleichheitsgrundsatz. Deshalb wollte das Sozialgericht das Gesetz nicht mehr anwenden; was es aber nicht so einfach darf. Da ein Fachgericht kein Gesetz für verfassungswidrig erklären oder einfach ignorieren darf, muss die Sache dem BVerfG vorgelegt und von ihm entschieden werden. Sollte sich die Auffassung das Sozialgerichts durchsetzen, wären hunderttausende Bescheide unrechtmäßig ergangen und letztlich würde der Staat wegen des Gleichheitssatzes über die Transferleistungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Ader gelassen. Die über den staatlichen Bereich hinausgehende Anwendung der aristotelischen »Gerechtigkeits-Elle« auch im nichtstaatlichen Bereich wurde durch ein spezielles Antidiskriminierungsgesetz angestrebt, dass Ende 2004 zum zweiten Mal in den Gesetzgebungsgang gebracht wurde, nachdem vier Jahre zuvor die damalige Justizministerin mit der von ihr begonnenen Umsetzung von vier EU-Richtlinien mit unterschiedlichem Regelungsbereich gescheitert war. Inzwischen war Eile geboten, weil Deutschland als letztes Land in der EU hinterher hinkte, die EU-Kommission schon Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland beim EuGH eingereicht hatte und unserem Land wegen Versäumens der schon abgelaufenen Umsetzungsfrist mehrere Millionen Euro pro Tag an Strafgeldern drohten. Die Gesetzgebung komplizierte sich dadurch, dass die von der rot-grünen Regierung geplanten Regelungen als Herzensvorhaben der Grünen – auch gegen den Widerstand führender Sozialdemokraten in Bund und Ländern - über die EU-Vorgaben teilweise hinaus gingen. Es wurde von allen Seiten an dem Gesetzesentwurf gezerrt. Seine Behandlung im politischen Raum macht anschaulich deutlich, wie ein Gesetz entsteht, und wird darum in einem kleinen Pressespiegel nachgezeichnet: Künftig sollten dem Gesetzentwurf zufolge im Arbeits- und Privatrecht Benachteiligungen wegen der sechs Kriterien a) Rasse oder ethnischer Herkunft, b) Geschlecht, c) Religion oder Weltanschauung, d) Behinderung, e) Alter und f) sexueller Identität grundsätzlich verboten sein. Im Privatrecht schreibt die EU in einer ihrer Richtlinien nur den Ausschluss von Diskriminierungen wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft sowie wegen des Geschlechts vor. Die Regierung will aber auf Drängen des kleineren Koalitionspartners Benachteiligungen umfassend in allen Bereichen durch ein alle Diskriminierungen zusammenfassend regelndes Gesetz verhindern. Auch soll, was durchaus Sinn macht, nur eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet werden. Arbeitgeber wie auch Betreiber von Gaststätten, Wohnungsvermieter oder Versicherungen sollen nunmehr Beschäftigte und Kunden nicht mehr auf Grund von Rasse oder ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Identität und auch nicht auf Grund des Geschlechts benachteiligen dürfen. Andernfalls könnten die Benachteiligten Schadenersatz und Schmerzensgeld gerichtlich geltend zu machen versuchen: Anti-Diskriminierungsgesetz Rot-Grün verständigt sich auf Gesetz gegen Diskriminierung Keiner soll wegen Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion oder Behinderung benachteiligt werden / Konflikte in der Auslegung absehbar Nach langen Kontroversen hat Rot-Grün sich auf ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz verständigt. Das Gesetz soll im Beruf und im Alltag vor Benachteiligung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion oder Behinderung schützen VON VERA GASEROW Berlin · 11. November · Noch gibt es zwar keinen abgestimmten Entwurf der Koalition für das lang versprochene Antidiskriminierungsgesetz (ADG). Doch Olaf Scholz, der für die SPD die Verhandlungen koordiniert, ist optimistisch: ’Wir sind uns zu 99 Prozent einig’. ’Die Einigung ist so gut wie perfekt’, heißt es auch bei den Grünen. Möglicherweise könnte eine abschließende Koalitionsrunde schon an diesem Freitag den endgültigen Entwurf für das Gesetz unter Dach und Fach bringen. Bis Ende des Jahres soll das ADG auf dem parlamentarischen Weg sein. Über die Details des schwierigen Projekts, das in der vorigen Legislaturperiode vor allem am 66 Widerstand der Wirtschaft und der Kirchen gescheitert war, schweigen die rot-grünen Unterhändler noch eisern. Nach Informationen der FR stehen aber zumindest die groben Linien fest. Wer anhand von Tatsachen glaubhaft machen kann, dass er etwa allein wegen seiner ausländischen Herkunft, seines Geschlechts oder seiner geistigen Behinderung benachteiligt wurde, soll sich künftig gegen diese Diskriminierung wehren können, lautet der Kerngedanke des ADG. Wer also nicht in die Disco gelassen wird, weil er eine dunkle Hautfarbe hat oder wer wegen seiner Behinderung von einem Hotel abgewiesen wurde, der könnte dann auf Unterlassung dieser Ausgrenzung klagen - und auch Schadenersatz einfordern. Disco-Betreiber oder Reisebüro müssten dann ihrerseits nachweisen, dass es andere Gründe für die Abweisung gab. Schützen soll das Gesetz künftig auch ältere Menschen, wenn ihnen mit Hinweis auf ihre Lebensjahre etwa ein Kredit oder eine Versicherung verweigert wird. Allerdings will das Gesetz hier Ausnahmen machen. Das einklagbare Diskriminierungsverbot soll nur für ’Massengeschäfte’ gelten, nicht für den kleinen individuellen Handel. Auch Mieter, die Anhaltspunkte dafür haben, dass sie etwa wegen ihrer ausländischen Herkunft, ihres Glaubens, oder ihrer homosexuellen Veranlagung eine Wohnung nicht bekommen haben, sollen klagen können. Auch hier will das Gesetz aber Ausnahmen erlauben. Im persönlichen Nahbereich, bei der Untervermietung in der eigenen Wohnung etwa oder im Privathaus müssen Vermieter nicht jeden Bewerber akzeptieren. Dort könnten sie durchaus sagen: ich will nur mit einem Deutschen oder nur mit einer Frau Tür an Tür wohnen. Lange umstritten war, ob das Gesetz auch die Ungleichbehandlung aufgrund der Religionszugehörigkeit ahnden sollte. Besonders die Kirchen hatten sich gegen die Aufnahme der Konfession in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale gesperrt. Sie fürchteten um die Autonomie ihrer konfessionellen Einrichtungen. Nach den Plänen von Rot-Grün soll das Gesetz nun zwar ausdrücklich auch vor einer Benachteiligung aufgrund der Religion schützen. Die Kirchen sollen aber weiterhin das Recht haben, nur Mitarbeiter ihrer eigenen Konfession einzustellen. Auch dürfen sie weiterhin Plätze in ihren sozialen Einrichtungen wie Kindergärten oder Altenheimen nur an eigene Konfessionsangehörige vergeben. In der parlamentarischen Beratung und später in der praktischen Auslegung dürfte das Gesetz noch für allerhand Konflikte sorgen. Koordinator Scholz meint dennoch ‚Ich glaube, dass das ein sehr schönes Gesetz wird, mit dem sich die meisten anfreunden werden.’" (FR 12.11.04) Ein Gesetz, das Bauchschmerzen verursacht Kommentar Von Maike Röttger Die Regierung hat sich mit einer Ausarbeitung des Antidiskriminierungsgesetzes, das jetzt erst nach mehr als drei Jahren auf dem Tisch liegt, sehr schwer getan. Zu Recht. Denn man muß sich wirklich fragen, wie sich ein plakativ angepriesener Bürokratieabbau mit einem zusätzlichen Regelungswust verträgt. Eigentlich gar nicht. Diskriminierung ist zweifellos eine häßliche und schädliche Sache, und jedermann, der sie betreibt oder unterstützt, gehört dafür zur Rechenschaft gezogen. Die Richtlinien der EU dagegen, die jetzt von den europäischen Staaten umgesetzt werden müssen, wollten in der europaweit fremdenfeindlichen Welle der 90er Jahre genau darauf eine Antwort geben. Daß diese noch wesentlich strenger und strikter in die Freiheiten eingreifen kann als künftig in Deutschland, läßt sich derzeit in Frankreich studieren. Fraglich ist jedoch, ob tatsächlich Gesetze verhindern können, Arbeitsplatz-Bewerber - wie in Frankreich - allein wegen ihres ausländischen Namens abzulehnen. Im Zweifel folgt ein aufreibender Gerichtsprozeß, in dem letztlich nur die Anwälte mit hohen Rechnungen gewinnen - ohne daß sich tatsächlich in den Köpfen etwas wandelt. Justizministerin Brigitte Zypries, die das Gesetz offenbar nur mit Bauchschmerzen auf den Weg gebracht hat, glaubt, daß es auch anders gehen kann. "Die Freiheit für Bürgerinnen und Bürger in einem liberalen Staat besteht auch und gerade darin, Unterschiede zu machen und ungleich behandeln zu dürfen", hat sie richtigerweise gesagt. Doch wo die Ministerin eine zu große Regelungswut verhindern wollte, sah der grüne Koalitionspartner mit heftigem Rückenwind der EU aus Brüssel sogar eine Regelungspflicht. Zypries gelang es, diesen Spagat zu meistern. Dafür haben wir bald schon wieder ein Gesetz mehr. (HH A 16.12.04) Wer diskriminiert wird, kann Entschädigung einklagen 67 Gesetzentwurf: Vermieter, Arbeitgeber, Gastwirte müssen aufpassen, wen sie warum ablehnen ... Von Maike Röttger Hamburg - Ein Arbeitgeber, der künftig beim Bewerbungsgespräch einen Behinderten abblitzen läßt, wird vielleicht später vor Gericht nachweisen müssen, daß dies rein gar nichts mit dessen körperlicher Verfassung zu tun hatte. Ein Diskothekenbesitzer wird vielleicht erklären müssen, warum er den Türken nicht hineingelassen hat. Nicht mehr der, der sich diskriminiert fühlt, sondern der mutmaßliche Verursacher wird in der Pflicht stehen, das Gegenteil zu beweisen. So steht es in dem Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes (ADG), auf den sich die rot-grüne Koalition gestern geeinigt hat. Damit macht die Regierung ihre europäischen Hausaufgaben und setzt drei EURichtlinien um. Kritiker fürchten eine Klagewelle. Künftig soll niemand im Privat- oder Arbeitsleben wegen Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexueller Ausrichtung benachteiligt werden. Sonst kann er auf "angemessene Entschädigung" klagen und wird von einer Antidiskriminierungsstelle (Kosten: 5,6 Millionen Euro jährlich) unterstützt. Während es für die Grünen "höchste Zeit" für ein entsprechendes Gesetz ist, fürchtete Justizministerin Brigitte Zypries bisher immer eine unnötige Bürokratisierung und einen zu starken Eingriff in die Privatautonomie. Es sind deswegen diverse Ausnahmeregeln eingebaut. Die Sorge, man werde nicht "die Kraft haben, alle erforderlichen Ausnahmen durchzusetzen", habe sich nicht bestätigt, sagt der Hamburger SPD-Abgeordnete Olaf Scholz, der an dem Entwurf mitgearbeitet hat, gestern dem Abendblatt nicht ohne Stolz. Das Gesetz müsse so funktionieren, daß die 95 Prozent der Deutschen, die sich völlig korrekt verhalten, das Gesetz gar nicht bemerken. Bestimmte Unterschiede, die als Diskriminierungen ausgelegt werden könnten, sind ja auch durchaus gewollt: Parkplätze für Frauen, Cafés nur für Lesben und Schwule, günstigeres Essen und Eintritt für Senioren und Studenten. Soll der Staat einem Wohnungseigentümer verbieten, seine Räume lieber an eine ältere Dame als an einen jungen Mann zu vermieten? Soll er nicht. So werden die Antidiskriminierungs-Regelungen nur bei "Massengeschäften" gelten, womit Verträge zwischen Privatpersonen ausgenommen wären. Wer also unbedingt meint, er wolle sein Auto keinem Schwulen verkaufen, dürfe das weiterhin tun. Die Einliegerwohnung darf an wen auch immer vermietet werden. Die Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund lehnt dennoch auch diesen Entwurf strikt ab. Private Vermieter würden grundsätzlich dem Risiko einer Schadenersatzpflicht ausgesetzt. "Die Folge wird eine Flut von Klagen und Prozessen vor den heute schon völlig überlasteten Gerichten sein", sagt der Präsident der Gemeinschaft, Rüdiger Dorn. Auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeber (BDA) fürchtet höhere Belastungen für die Wirtschaft durch häufigere Schadenersatzforderungen. Der Verband hält die bisherigen Regelungen für einen ausreichenden Diskriminierungsschutz. Dorn nennt die Regierung sogar "anmaßend", weil sie auf die EU-Richtlinie sogar noch draufgesattelt habe. Die gibt als Diskriminierungsgründe nämlich nur ethnische Herkunft und Rasse vor. Die Erweiterung der Gründe wird als ein Zugeständnis der SPD an die Grünen gesehen. Ilja Seifert hat für die brüske Ablehnung der Wirtschaft und Eigentümerverbände hingegen überhaupt kein Verständnis. Der stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland empfindet täglich noch ganz andere Diskriminierungen. Wenn etwa Treppen wie Barrieren vor ihm stehen. Wo sei die Gerechtigkeit, wenn Häuser nicht behindertengerecht gebaut werden? "Ist das keine Diskriminierung?" (HH A 16.12.04) Gleiches Geld für gleiche Arbeit Gesetzentwurf mit großen Folgen für Firmen und Vermieter: Klagen kann, wer sich wegen Religion, Nationalität oder Geschlecht benachteiligt sieht. Hamburg - Wer wegen seines Geschlechts, der ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexueller Identität, Alters oder einer Behinderung benachteiligt wird, soll künftig auf Schadenersatz klagen können. Das sieht der Entwurf zum Antidiskriminierungsgesetz (ADG) der Koalitionsfraktionen vor, der gestern in Berlin vorgestellt wurde. Die rot-grüne Regierung setzt damit nach jahrelangem Streit drei EU-Richtlinien um. Der Gesetzentwurf, der im Januar in den Bundestag kommen soll und vom Bundesrat nicht mehr blockiert werden kann, sieht unter anderem vor: Wohnungseigentümer dürfen Ausländer, Muslime oder Behinderte nicht mehr als Mieter 68 ablehnen. "Anzeigen wie: ,Juden und Behinderte zwecklos' sind dann verboten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck. Als Ausnahme gilt, wenn ein Hausbesitzer im selbstbewohnten Haus eine Wohnung vermietet. Versicherer sollen künftig ausführlich begründen, warum sie ihre Leistungen etwa nach dem Geschlecht oder der sexuellen Identität differenzieren. "Daß Krankenversicherer Homosexuellen den Versicherungsschutz verweigern, weil sie eine zu hohe Risikogruppe für HIV seien, wird es nicht mehr geben", sagte Beck. Frauen sollen für die gleiche Arbeit in einem Betrieb nicht schlechter bezahlt werden dürfen als Männer. Dieser Grundsatz wird durch das ADG noch einmal verstärkt. Sollte die schlechtere Bezahlung generelle Firmenpolitik sein, kann jede Frau eine Gleichbehandlung einklagen. Für Kirchen gibt es Ausnahmen: Katholische Kindergärten zum Beispiel dürfen weiterhin Kinder oder Mitarbeiter anderer Konfession ablehnen. Gaststätten- und Hotelbesitzer dürfen Ausländer, Behinderte oder Homosexuelle nicht abweisen. "Die Lösung bietet Betroffenen einen wirksamen Schutz vor Diskriminierung, ohne den privaten Wirtschaftsverkehr mit bürokratischen Regeln zu überziehen", sagte Justizministerin Brigitte Zypries (SPD). Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände warnte dagegen mit Blick auf Schadenersatzforderungen vor einer unnötigen Mehrbelastung der Wirtschaft. mai/dpa (HH A 16.12.04) Antidiskriminierungsgesetz (ADG) Deutsche sollen vor Diskriminierung geschützt werden Rot-Grün einigt sich auf Gesetzentwurf - Bürger, die sich benachteiligt fühlen, dürfen auf Schadenersatz klagen - Prozeßflut droht von Ansgar Graw Berlin - Olaf Scholz, Berichterstatter der SPD-Fraktion, ist mit dem "smarten" Entwurf zufrieden, und Irmingard Schewe-Gerigk, frauen- und altenpolitische Sprecherin der Grünen, auch. Aber bei der Vorstellung des Antidiskriminierungsgesetzes (ADG) drängt sich der Eindruck auf, die beiden Koalitionspolitiker sprechen von unterschiedlichen Projekten: Während Scholz versichert, daß sich "95 Prozent der Bürger und 95 Prozent der Betriebe anständig benehmen" und daher mit dem Gesetz niemals konfrontiert würden, nennt Schewe-Gerigk ganz andere Zahlen: So stellten 60 Prozent der Betriebe niemanden ein, der älter als 50 Jahre sei, und bei gleichwertiger Qualifikation bekämen Frauen rund 30 Prozent weniger Gehalt. Die Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse und der Ethnie fordert seit Juni 2000 eine EUAntirassismus-Richtlinie, und jetzt sollen die Deutschen gleich gegen sechs weitere Diskriminierungsgründe geschützt werden - nämlich zusätzlich gegen Benachteiligungen wegen des Geschlechtes, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der sexuellen Identität. Rot-Grün wolle "natürlich keine Prozeßflut", sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck. Tatsächlich ist das federführend vom Familienministerium betreute Prestigeprojekt der Grünen gegenüber älteren Entwürfen verbessert. Doch die Bestimmungen zum Arbeits- und zum Zivilrecht dürften nach wie vor zu Klagen einladen. Nach dem Gesetz ist benachteiligt, wer wegen einem der genannten Gründe "eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde". Wie aber läßt sich feststellen, ob der Vermieter einem Türken die Wohnung verweigerte, weil er keine Ausländer mag - vielleicht erschien ihm der andere Interessent solventer? Und hat der Arbeitgeber die Bewerberin abgelehnt, weil sie Frau ist - oder weil der männliche Anwärter "irgendwie" geeigneter wirkte? Können der verhinderte Mieter oder die abgelehnte Bewerberin "Tatsachen glaubhaft" machen, die eine Diskriminierung "vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, daß (...) sachliche Gründe" ausschlaggebend waren. Das ist zumindest eine partielle Beweislastumkehr. Kompliziert wird das Gesetz auch durch den Mix aus europäischen Vor- und nationalen Zugaben. So gelten die sechs zusätzlichen Diskriminierungsmerkmale im Zivilrecht nur für "Massengeschäfte", während bei sonstigen zivilrechtlichen Schuldverhältnissen lediglich Benachteiligungen wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft unzulässig sind. Darum könnte ein Homosexueller klagen, wenn er eine entgangene Beförderung auf seine sexuelle Orientierung zurückführt. Wegen einer ihm verweigerten Wohnung kann er hingegen nur klagen, wenn er sie von einer Wohnungsgesellschaft ("Massengeschäft") mieten wollte, aber nicht, wenn es sich um einen Privateigentümer handelt. Ein 69 Ausländer wiederum könnte in beiden Fällen vor Gericht ziehen - allerdings nicht bei einer verweigerten Mietwohnung in der direkten Nachbarschaft des Vermieters, weil in diesem Fall die Privatsphäre besonders geschützt bleibt. Wer eine "vorsätzliche oder grob fahrlässige" Diskriminierung durch den Arbeitgeber gerichtsfest machen kann, hat Anspruch auf Entschädigung und Schadenersatz für den Vermögensschaden und für den Nichtvermögensschaden (Schmerzensgeld). Das ADG sieht "wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen" vor. "Positive Diskriminierung" bleibt hingegen erlaubt, so daß etwa kirchliche Kindergärten in der Personalauswahl frei bleiben. Auch "Frauenparkplätze, Kinder- und Seniorenteller" werde es weiter geben, sagt Scholz. Und Barbesitzer müssen keine 50-jährigen Barmädchen einstellen. Das nicht zustimmungspflichtige Gesetz sei eben "wirklich gut gelungen". (DIE WELT 16.12.04) „KOMMENTAR: ANTIDISKRIMINIERUNG Zangengeburt VON VERA GASEROW In der Medizin nennt man so etwas eine Zangengeburt. Geschlagene sechs Jahre ist es her, dass die rot-grünen Koalitionäre den gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung auf die Liste der eigenen Vorzeigeprojekte setzten. Doch aus dem einstigen Wunschkind nicht allein der Grünen wurde eine leidige Dauerschwangerschaft. Mal sperrte sich die Versicherungslobby gegen ein Antidiskriminierunsgesetz, mal die Touristikbrache. Mal witterten Hausbesitzer Ungemach, mal fürchteten die Kirchen um Pfründe. Eine ganze Phalanx unterschiedlicher Interessengruppen legte dem Antidiskriminierungsgesetz so eifrig Steine in den Weg, bis Rot-Grün das Projekt lange auf Eis legte. Dort würde es womöglich noch jetzt selig schlummern, wenn nicht Vorgaben der Europäischen Union Berlin Beine gemacht hätten. Denn Deutschland klappert beim Schutz vor Diskriminierung bislang peinlich hinterher. Auch jetzt ist das Gesetz nicht unter Dach und Fach. Aber zumindest der Grundkonsens scheint gefunden und der Zeitplan fixiert. Damit ist die unendliche Geschichte gewiss nicht beendet. Denn das Gesetz ist vor allem ein Experiment. Sein Lackmustest ist ohnehin die Praxis. Dort werden sich Schwachstellen zeigen, Unstimmigkeiten, Auslegungsstreitigkeiten zuhauf. Aber Stolpern ist in diesem Fall besser als Nichtstun. Wer allzu lange zögert, Neuland zu betreten, riskiert halt Probleme beim Laufenlernen. (FR 12.11.04) Gegen den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen machen die Wirtschaftsverbände vehement Front. Es dürfe nicht nutzlose und zusätzlich Bürokratie beim Staat und bei den Unternehmen aufgebaut werden: Die totale Diskriminierung Jeder, der sich benachteiligt fühlt, kann künftig klagen. Mißbrauch ist programmiert. Die Wirtschaft fürchtet unkalkulierbare Kosten von Stefan von Borstel und Christoph B. Schiltz Claudia Roth hatte einen Traum. Niemand soll wegen Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, Behinderung und sexueller Orientierung benachteiligt werden können. Homosexuelle, denen pauschal eine Lebensversicherung verweigert wird. Alte, die keine Konsumentenkredite mehr bekommen. Frauen, die höhere Beiträge zur Lebensversicherung bezahlen müssen als Männer. Behinderte, die keinen Tisch im Restaurant bekommen. Junge Araber, die an der Disko-Tür abgewiesen werden. Sie alle sollen sich künftig per Gesetz gegen Diskriminierung wehren können. Aus diesem Traum ist Wirklichkeit geworden: Das deutsche Antidiskriminierungsgesetz. Gestern wurde der Gesetzentwurf in erster Lesung im Bundestag beraten. Und nichts, so scheint es jedenfalls, kann ihn mehr aufhalten. Für Grünen-Chefin Roth ist das Gesetz ein "wichtiger Baustein der gesellschaftlichen Demokratisierung". Für die Opposition ist es eine Kampfansage an die Freiheit, für die Wirtschaft ein "Beschäftigungsprogramm für Juristen". Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen. In den Jahren 2000 und 2002 verabschiedete die EU drei Richtlinien, die in Europa für Gleichheit zwischen den Rassen und Geschlechtern sorgen sollten. Die Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement und Familienministerin Renate Schmidt (beide SPD) wollten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen, aber auf keinen Fall zusätzliche Regeln aufnehmen. Doch sie hatten die Rechnung ohne die grünen Gutmenschen gemacht. Claudia Roth, 70 Volker Beck und Teile der Grünen-Fraktion sorgten dafür, daß aus der schlichten Umsetzung dreier EU-Richtlinien ein Gesetz wurde, daß jedem in Deutschland die Tür öffnet, sich einmal so richtig diskriminiert zu fühlen. Für Arbeitgeber, Vermieter, Wohnungsgesellschaften, Versicherungen und Gastwirte kann das neue Gesetz teuer werden. Jeder, der sich diskriminiert fühlt und dies glaubhaft machen kann, kann sie künftig vor Gericht zerren. Dort müssen sie dann beweisen, daß sie nicht diskriminiert haben. Im Deutsch der Juristen heißt das "Umkehr der Beweislast". Beispiel: Ein abgewiesener Bewerber könnte behaupten, er sei nicht eingestellt worden, weil der Arbeitgeber Ausländer diskriminiere. Als Indiz für die ausländerfeindliche Gesinnung des Arbeitgebers nennt er die unterdurchschnittliche Ausländerquote im Unternehmen. Der Arbeitgeber müßte dann vor Gericht beweisen, daß er den ausländischen Bewerber nicht wegen seiner Herkunft abgelehnt hat. Dazu muß er auch die Bewerbungsunterlagen aufbewahren. Das ist nicht so einfach: Allein die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport erhält im Jahr 16 000 Bewerbungsmappen. Auch Vermieter müssen in Zukunft umfangreiche Dokumentationspflichten erfüllen, um Mietverhältnisse jederzeit nachweisbar begründen zu können. Versicherungen wiederum müssen unterschiedliche Tarife - so sieht es der Gesetzestext vor - mit einer auf "genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung" belegen. Dem Arbeitgeber drohen aber nicht nur Klagen, wenn er selbst seine Arbeitnehmer diskriminiert haben soll. Auch wenn Dritte, etwa Kunden oder Lieferanten, diskriminieren, soll er haften. In der Praxis könnte das so aussehen: Ein Kunde kommt in eine Bank und weigert sich, von einer Frau in Gelddingen beraten zu werden. Laut Gesetz wäre dies eine Diskriminierung der Frau aufgrund ihres Geschlechts. Der Arbeitgeber muß die Frau nun vor Diskriminierung schützen. "Realitätsfern" nennt Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt diese Regelung, die in den europäischen Richtlinie auch gar nicht gefordert wird. Zudem sieht der Gesetzentwurf eine Art Verbandsklagerecht für Betriebsräte und Gewerkschaften vor - selbst gegen den Willen des Arbeitnehmers. Der Betriebsrat als Sittenpolizei? Neben Gewerkschaften und Betriebsräten sollen künftig auch "Antidiskriminierungsvereine" Ansprüche einklagen können, die der Arbeitnehmer an sie abgetreten hat. "Diese Vereine werden medienwirksam gegen die Arbeitgeber zu Felde ziehen - und ganz nebenbei viel Geld damit verdienen", vermutet Unionsfraktionsvize Karl-Josef Laumann. "Unkalkulierbare Prozeßrisiken" sieht Arbeitgeberpräsident Hundt auf die Wirtschaft zurollen und verweist auf das "wenig ermutigende Beispiel" der Abmahnvereine. Auch für die Kirchen birgt das Gesetz Risiken. Zwar sieht es Gesetz ausdrücklich eine "zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung" vor. Doch die Kriterien dafür sind schwammig formuliert. Niemand weiß, wie sich die Kulturrevolution auf dem Papier in der Praxis auswirken wird. Wird ein Arbeitnehmer, der sich diskriminiert fühlt, in Zeiten großer Jobangst auch wirklich gegen seinen Arbeitgeber klagen? Werden die Richter mit den "sachlichen Gründen", die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen, klug umgehen? Ein Volk von rechtskräftig Diskriminierten ist derzeit nicht in Sicht. Aber dem Mißbrauch des Diskriminierungsvorwurfs sind mit diesem Gesetz Tür und Tor geöffnet. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irmingard Schewe-Gerigk, versucht zu beruhigen: "Der Kinderteller, das Seniorenticket und die Frauensauna bleiben trotz Antidiskriminierungsgesetz erhalten." (DIE WELT 22.01.05) Bei Diskriminierung droht Schadenersatz 15. Dezember 2004 Im Arbeitsleben und bei „Massengeschäften” des Alltags darf künftig niemand mehr aus einer Reihe von Gründen benachteiligt werden. Auf den Entwurf für ein entsprechendes Antidiskriminierungsgesetz haben sich die Bundestagsfraktionen von SPD und Bündnisgrünen nun endgültig verständigt. Damit sollen vier EU-Richtlinien umgesetzt, aber auch deutlich erweitert werden (F.A.Z. vom 30. November). Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) sagte am Mittwoch in Berlin, es sei ein „tragfähiger Kompromiß” gefunden worden. Dieser biete den Betroffenen wirksamen Schutz, „ohne den privaten Wirtschaftsverkehr mit bürokratischen Regeln zu überziehen”. Reihe von Ausnahmen sollen die Regelungen entschärfen Verbotene Unterscheidungsmerkmale sind danach Rasse und ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexuelle Identität. Die Vorgaben aus Brüssel verlangen eine solche Bandbreite jedoch nur für das Arbeitsrecht; im allgemeinen Zivilrecht 71 beschränken sie sich dagegen auf die Merkmale Ethnie und Geschlecht. Für Beruf und Beschäftigung erstreckt sich das Verbot etwa auf Einstellungen und Kündigungen, Beförderungen und die Bezahlung, und zwar sowohl in der Privatwirtschaft wie im öffentlichen Dienst. Ansonsten sind vor allem Verträge mit Lieferanten, Dienstleistern und Vermietern sowie private Versicherungen, Hotels, Gaststätten und Kaufhäuser betroffen. Eine Reihe von Ausnahmen sollen die Regelungen entschärfen. So sei im Berufsleben nicht jede unterschiedliche Behandlung eine verbotene Benachteilung, sagte Zypries. Erlaubt sei etwa „die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes”. Auch besondere Fördermaßnahmen für Frauen und Behinderte seien zulässig. Einen Zwang zu „Unisex-Tarifen” für Versicherungen gebe es nicht, wenn Risiken auf „statistisch gesicherter Grundlage” kalkuliert würden. Der „gesamte private Lebensbereich” bleibe ausgenommen, etwa beim Verkauf eines Privatwagens oder der Vermietung einer Einliegerwohnung. Wo dieser „persönliche Nähebereich” endet, definiert das Gesetz allerdings nicht. „Antidiskriminierungsstelle” wird eingerichtet Vorgesehen sind zudem Beweiserleichterungen für Kläger, die sich benachteiligt glauben. Auch Verbände, Betriebsräte und Gewerkschaften können für sie vor Gericht ziehen. Wer diskriminiert worden ist, hat Anspruch auf Schadensersatz, beispielsweise für die „Mehrkosten für eine Ersatzbeschaffung” oder als „Entschädigung für die Würdeverletzung”. Sofern noch möglich, muß das Gericht den Abschluß des gewünschten Vertrags erzwingen. Damit sieht die Regierung die Maßgabe der Europäischen Union erfüllt, einen „abschreckenden” Schadensersatz einzuführen. Auch eine „Antidiskriminierungsstelle” des Bundes wird eingerichtet. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck und Irmingard Schewe-Gerigk, sprachen von einem „weiteren Meilenstein rot-grüner Gesellschaftspolitik”. Beck zeigte sich zufrieden, daß es gelungen sei, die „Zweifler in der SPD in einem zähen Überzeugungskampf” zur Zustimmung zu bewegen. Der rechtspolitische Sprecher von CDU/CSU, Norbert Röttgen, kritisierte dagegen, das geltende Verfassungsrecht und Zivilrecht enthalte bereits ein umfassendes Verbot von Diskriminierungen. Röttgen warnte vor „Prozeß- und Kostenlawinen”. Bei dem Gesetzentwurf gehe es darum, „weit über die EU-Vorgaben hinaus Bürger in ihrer wirtschaftlichen Lebensgestaltung staatlich zu bevormunden”. (FAZ 15.12.04) „Rot-Grün stoppt Diskriminierung Gesetz: Wer etwa als Behinderter im Restaurant abgewiesen wird, soll bald vor Gericht Schadenersatz einklagen können. Berlin - Ein Behinderter wird an der Hotelrezeption abgewiesen, eine türkische Familie geht bei der Wohnungssuche leer aus: Die Fälle von Benachteiligungen sind vielfältig. Das Antidiskriminierungsgesetz der rot-grünen Koalition, das am Freitag in den Bundestag eingebracht wurde, will damit Schluß machen. Wer benachteiligt wird, soll auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld klagen können. Die Regelung, die auch eine Antidiskriminierungsstelle bei der Bundesregierung vorsieht, benötigt nicht die Zustimmung des Bundesrats. Das Gesetz, das noch dieses Jahr in Kraft treten soll, setzt EU-Richtlinien zur Antidiskriminierungspolitik um, geht aber im Fall der Behinderten über die darin definierten Anforderungen hinaus. Beispiele für den neuen Schutz vor Diskriminierung: Ethnische Herkunft Bislang kann ein Vermieter einen Wohnungsinteressenten wegen ausländischer Herkunft oder seiner Hautfarbe ungestraft abweisen. Diese Praxis soll nun verboten werden. Ausgenommen ist hier lediglich der private Nahbereich, also etwa dann, wenn Vermieter und Mieter oder deren Angehörige Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Religion Bislang können sich Händler ihre Kunden nach religiösen Kriterien aussuchen. Ein islamischer Metzger etwa darf die Bedienung von Frauen verweigern, die kein Kopftuch tragen. Nach dem neuen Gesetz kann er dies nur dann beibehalten, wenn er darlegen kann, daß seine Religion ihm diese Auswahl gebietet. Allerdings dürfen Religionsgemeinschaften weiter von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen, etwa wenn ein katholischer Kindergarten nur Kinder aufnimmt, die dieser Glaubensrichtung angehören. Alter 72 Daß eine Bank zum Beispiel einem 70jährigen den Dispo-Kredit wegen seines Alters streicht, soll künftig per Gesetz verboten sein. Denn die Neuregelung sieht vor, daß Menschen nicht auf Grund ihres Alters beim Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen benachteiligt werden dürfen. Weiter erlaubt sind Vergünstigungen für jüngere oder ältere Kunden - wie etwa der Seniorenteller im Restaurant. Behinderung Bislang können Gastwirte und Hotelbesitzer Behinderte unter Hinweis auf ihr Hausrecht abweisen. Das soll verboten werden. Nach dem Antidiskriminierungsgesetz dürfen Versicherungsunternehmen eine Behinderung nur dann berücksichtigen, wenn sich das zu versichernde Risiko erhöht. Pauschale Ablehnungen werden damit unterbunden. Sexuelle Identität Bislang kann etwa ein Hotel die Aufnahme gleichgeschlechtlicher Paare verweigern. Nach dem Antidiskriminierungsgesetz ist dies nicht mehr möglich. Versicherungen konnten bisher Vorbehalte gegen Homosexuelle - etwa wegen erhöhten Aids-Risikos - ohne Begründung kaschieren. Nach dem Gesetz müßten Unterscheidungen wegen der sexuellen Identität gerechtfertigt werden. Arbeitswelt Einem Bewerber darf eine Stelle nicht mehr wegen seines Alters verwehrt werden, Frauen haben Anspruch auf das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. So bleibt der Tendenzschutz erhalten, den etwa kirchliche Arbeitgeber genießen. Sie können damit weiterhin Mitarbeiter auf Grund ihrer Homosexualität entlassen. afp/HA“ (HH A 22.01.05) Kusch kritisiert Gesetz Roger Kusch (CDU) hat das Anti-Diskriminierungsgesetz der rot-grünen Bundesregierung scharf kritisiert. Bei ohnehin „dramatisch vielen Arbeitslosen“ errichte es zusätzliche Einstellungshürden für Unternehmen. Hamburg hat deshalb gemeinsam mit Baden-Württemberg eine Bundesratsinitiative gegen das Gesetz gestartet. dpa HH A 07.02.05 Auch der sich zu der Zeit im Wahlkampf befunden habende SPD-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hatte angekündigt, dass sein Land dem nicht zustimmungspflichtigen Gesetzesvorhaben - gegen das der Bundesrat zwar (praktisch als bloßer Anstoß zum nochmaligen Überdenken) Einspruch einlegen kann, der dann aber von der rot-grünen Bundestagsmehrheit zurückgewiesen werden kann - in der vorgelegten Form im Bundesrat mit den CDU-geführten Ländern zusammen nicht zustimmen werde: das Gesetz sei insbesondere in der schwierigen wirtschaftlichen Lage der BRD eine „Job-Vernichtungsmaschine“. Es dürfe nicht nutzlose und zusätzliche Bürokratie beim Staat und bei den Unternehmen aufgebaut werden, betonten als Opposition innerhalb der Regierung die drei Bundesminister des Inneren, für Wirtschaft und die Familienministerin vor dem Hintergrund von auf über 5 Mill. gestiegener Arbeitslosenzahlen, der die vorgeschlagenen Regelungen zu weit gingen – womit ein Argument der CDU/CSU und der FDP aufgenommen wurde, die bemängelten, dass SPD und Grüne bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung des Guten zuviel getan und Regelungen draufgesattelt hätten, die nach den EU-Vorgaben nicht erforderlich gewesen wären. Das deutsche Zivil- und Arbeitsrecht würde zu stark verändert. Ein Verzicht auf das Gesetz "wäre ein echter Beitrag zum Bürokratieabbau". "Es geht zunächst um die Garantie der Grundrechte, dass alle Menschen uneingeschränkten Zugang im Berufsund Privatleben haben", hielt die Verbraucherschutzministerin den Kritikern des vorgelegten Gesetzentwurfes entgegen. Unter Verweis auf Benachteiligungen etwa am Arbeitsplatz oder auf dem Wohnungsmarkt sagte die Grünen-Politikerin, man könne nicht "mit dem Ruf der Ent-Bürokratisierung loslegen, um damit als Folge vorhandene Diskriminierung zu rechtfertigen". DGB-Chef widerspricht Kusch Hamburgs DGB-Chef Erhard Pumm (SPD) hat das neue Anti-Diskriminierungsgesetz begrüßt. "Anders als Justizsenator Kusch halten die Gewerkschaften das Gesetz für erforderlich und richtig, weil Benachteiligungen nach wie vor Alltag sind", so Pumm. Mit dem Gesetz sollen Diskriminierungen wegen des Alters, Geschlechts, wegen Behinderung, sexueller Orientierung, ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung verhindert werden. "Dieser umfassende Ansatz ist nötig, damit Diskriminierung im öffentlichen Bewußtsein als Problem erkannt und abgestellt 73 wird", so Erhard Pumm. jmw HH A 24.02.05 Diskriminierung darf nicht toleriert werden Ansichtssache Von Christa Goetsch * Mustafa Y. steht am Sonnabend vor einer In-Disco auf dem Kiez. "Sorry", sagt der Türsteher, "aber Türken kommen hier nicht rein." Barbara R. ist eine erfahrene Ingenieurin, auf der Suche nach einer neuen Anstellung. "Unser Unternehmen xy.com sucht einen zeitlich flexiblen Ingenieur mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung", liest sie in der Stellenanzeige. Fünf Jahre Berufserfahrung hat sie. Zeitlich flexibel ist sie auch. Ein Mann ist sie nicht. Erna P., 65 Jahre alt, sitzt vor dem Kundenberater ihrer Sparkasse. "Tut mir leid, Frau P., ab 65 vergebenwir grundsätzlich gar keine Kredite mehr." Diskriminierung ist alltäglich in Deutschland. Das heißt nicht, daß sie toleriert werden darf. Schutz vor Diskriminierung bedeutet nicht Privilegien für bestimmte Gruppen, sondern Anspruch auf Respekt und gleiche Chancen. Mit dem Antidiskriminierungsgesetz (ADG) setzt die Bundesregierung nun EURichtlinien gegen Diskriminierung maßvoll in deutsches Recht um. Das Gesetz tritt Benachteiligungen auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen Identität, des Alters oder auf Grund einer Behinderung wirksam entgegen. Es legt ein Diskriminierungsverbot fest im Berufsbereich und beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wie z. B. Versicherungen. Derartige Antidiskriminierungsgesetze gibt es in vielen europäischen Ländern, z. B. in Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Skandinavien. Sie haben sich in der Praxis bewährt, sind kein Anschlag auf die Vertragsfreiheit und keineswegs belastend für die Wirtschaft. Ein solches Benachteiligungsverbot ist im Übrigen auch in Deutschland nichts Neues. Artikel 3 des Grundgesetzes benennt die Gleichheit vor dem Gesetz und verbietet Ausgrenzungen wegen bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Einige beschwören nun das Ende des Wirtschaftsstandortes Deutschland herauf. Wenn jeder nach dem ADG einfach behaupten könne, er wäre in einem Bewerbungsverfahren benachteiligt worden, stünden die deutschen Unternehmen vor einer riesigen Klagewelle, prophezeit die CDU. Das gleiche hatte sie auch bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit behauptet. Die Klagewelle ist aber ausgeblieben. Tatsächlich haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den meisten Fällen einvernehmlich geeinigt. Die Beschwörung einer Klagewelle ist Panikmache, die durch nichts belegt ist. Weder die britische noch die französische oder die niederländische Wirtschaft ist in den Ruin getrieben worden. In Großbritannien werden im allgemeinen sogar deutlich bessere Bedingungen für Investitionen ? auch in Arbeitsplätze ? gesehen. Schadet es dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht eher, wenn ein latent ausländerfeindliches Klima herrscht, das Investoren aus dem Ausland abschreckt und Migranten behindert, die hier unternehmerisch tätig sind? Und auch mit der Beweislastumkehr ? nicht der Arbeitnehmer muß die Diskriminierung beweisen, sondern der Arbeitgeber das Gegenteil ? ist das nicht so einfach, wie die CDU glauben machen will: Es reicht eben nicht zu behaupten, man wäre diskriminiert worden, man muß es glaubhaft machen. Das ist rechtlich ein entscheidender Unterschied, mit dem die Gerichte in Deutschland gut vertraut sind. Ein Bewerber um eine Stelle kann schlecht beweisen, daß er diskriminiert wurde, schließlich kennt nur der Arbeitgeber alle Unterlagen. Natürlich bleiben spezielle Anforderungen an bestimmte Jobs oder in besonderen Situationen weiterhin zulässig, wenn sie sachlich zu begründen sind. Ein Frauenhaus darf weiterhin nach einer Mitarbeiterin suchen. Ein indisches Restaurant darf indische Köche bevorzugen. Private Vermieter dürfen sich ihre Wohnungsnachbarn weiterhin nach Sympathie aussuchen. Der Kinderoder Seniorenteller darf weiterhin auf der Speisekarte stehen. Und für das Bundespräsidentenamt muß man oder frau weiter mindestens 40 Jahre alt sein. Arbeitgeber, Vermieter, Unternehmer, die nicht diskriminieren, haben nichts zu befürchten. Sie notieren jeweils kurz, warum sie sich wie entschieden haben. Wer aber immer schon lieber Männer angestellt hat, weil es einfacher und toller ist, nur mit Kerlen zusammenzuarbeiten, der wird es künftig schwerer haben. Gut so. Wir wollen nämlich, daß Diskriminierung bald nicht mehr alltäglich ist in Deutschland. * Christa Goetsch antwortet hier auf einen Artikel von Justizsenator Roger Kusch (CDU) im Abendblatt vom 18. Februar. 74 Christa Goetsch (52) ist Vorsitzende der GAL-Bürgerschaftsfraktion. Zuvor arbeitete sie als Lehrerin für Chemie und Biologie. (HH A 25.02.05) Angst vor dem Jobkiller Wer künftig einen Bewerber ablehnt, muß nachweisen, daß er ihn nicht diskriminiert hat. Wie das gehen soll, weiß niemand. Die Wirtschaft fürchtet eine Prozeßlawine - und unkalkulierbare Kosten von Stefan von Borstel Alle sollen sie künftig besser gegen Diskriminierungen geschützt werden: Behinderte, die keinen Tisch im Lokal bekommen - obwohl Platz genug ist. Junge Türken, die vom Türsteher der Diskothek abgewiesen werden. Die libanesische Familie, der beim Wohnungsbesichtigungstermin gesagt wird: "Die Wohnung ist schon vermietet." Homosexuelle, denen pauschal eine Lebensversicherung verweigert wird. Mit einem Gesetz zum Schutz vor Diskriminierungen soll ihnen geholfen werden. Ziel des Antidiskriminierungsgesetzes (ADG) ist es, so heißt es im ersten Paragraphen, "Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung , des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen." Das Ziel ist ehrenwert - dennoch stößt das Gesetz nicht auf ungeteilte Zustimmung, wie die Expertenanhörung am Montag vor dem Familienausschuß zeigte. Während manche Rechtsexperten von einem "längst überfälligen Schritt" sprechen und das Gesetz ausdrücklich begrüßen, warnen andere vor einem "inakzeptablen Eingriff in das Grundrecht auf Vertragsfreiheit" und bezweifeln grundsätzlich, ob der Gesetzgeber mit dem Antidiskriminierungsgesetz einen fairen Umgang mit Minderheiten von seinen Bürgern erzwingen kann. Vor allem in der Wirtschaft schlagen die Wellen der Empörung hoch: Die Unternehmen fürchten eine Welle der Bürokratie und warnen vor einem neuen Jobkiller. Im Mittelpunkt der Kritik steht die so genannte Umkehr der Beweislast. Danach kann jeder, der sich diskriminiert fühlt und dies "glaubhaft" machen kann, vor den Kadi ziehen. Es ist dann am beklagten Gastwirt, Vermieter oder Arbeitgeber, zu beweisen, daß er nicht diskriminiert hat. So könnte ein abgewiesener Stellenbewerber behaupten, er sei nicht eingestellt worden, weil der Arbeitgeber Ausländer diskriminiere. Als Indiz für die ausländerfeindliche Gesinnung des Arbeitgebers nennt er die unterdurchschnittliche Ausländerquote im Unternehmen. Der Arbeitgeber müßte dann vor Gericht beweisen, daß er den Ausländer nicht wegen seiner Herkunft abgelehnt hat. Dazu müßte er sämtliche Bewerbungsunterlagen aufbewahren und das Bewerbungsgespräch protokollieren - oder aber es auf die Verurteilung und Schadensersatz ankommen lassen. "Ein mittelständischer Einzelhändler für Damenunterwäsche muß doch künftig schon bei der Stellenanzeige einen Rechtsanwalt einschalten, um sicher zu sein, daß er sich bei der Suche nach der "jungen, dynamischen Verkäuferin mit guten Deutschkenntnissen" nicht gleich dreifach der Verfolgung durch graue Panther, Männerschutzverbände und durch die Vertreter ethnischer Minderheiten aussetzt", schreibt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag bissig in seiner Stellungnahme. Vor allem die kleinen Mittelständler dürften unter dem ADG leiden. Sie werden sich im Zweifel gegen Diskriminierungsvorwürfe kaum zur Wehr setzen können, fürchtet der Gaststättenverband Dehoga. "Weil das Bewerbungsgespräch nicht unter Zeugen, sondern lediglich zwischen Betriebsinhaber und Bewerber geführt wurde, weil kein Jurist die Formulierung der Stellenanzeige unterstützt hat oder weil der Arbeitsvertrag aus einem veralteten Musterhandbuch entnommen wurde." Doch nicht nur bei der Stellenausschreibung und dem Bewerbungsgespräch, bei jeder Zielvereinbarung, Gehaltserhöhung und Beförderung im Betrieb greifen die Paragraphen der Antidiskriminierung - und droht Schadensersatz. Eine Obergrenze für etwaige Schadensersatzzahlungen ist im Gesetz nicht vorgesehen. Und so fürchtet sich die Wirtschaft vor "amerikanischen Verhältnissen". In den USA haben Konzerne schon dreistelligen Millionensummen wegen "Rassendiskriminierung" oder "sexueller Belästigung" zahlen müssen. Die Befürworter des Gesetzes verweisen dagegen darauf, daß deutsche Richter solche Auswüchse wohl verhindern würden. Über drei Monatsgehälter oder das, was heute bei Beleidigungsklagen üblich sei, dürfte der Schadensersatz kaum hinausgehen, hieß es bei der Anhörung. Auch die Furcht vor einer Prozeßwelle sei maßlos übertrieben. Die Kritiker des Gesetzes sehen das anders. Sie fürchten "ein Eldorado für Rechtsanwälte", wie Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt sagt. Zumal die vermeintlichen Diskriminierungsopfer ihre Ansprüche an "Antidiskriminierungsvereine" abtreten können. Diese Vereine werden dann medienwirksam zu Felde ziehen - und damit eine Menge Geld verdienen. 75 Den Arbeitgebern drohen aber nicht nur Klagen, wenn er selbst seine Arbeitnehmer diskriminiert haben soll. Auch wenn Dritte, etwa Lieferanten oder Kunden, diskriminieren, soll er haften. Dieser Fall kann schnell eintreten. Was ist, wenn ein Mann in der Technikabteilung eines Kaufhauses nicht von einer jungen Frau bedient werden will? Muß der Arbeitgeber dann der Mitarbeiterin eine Entschädigung für diese "Diskriminierung" zahlen, fragt sich der Handelsverband BAG. Und was ist mit der Kellnerin, die sich bei einer feuchtfröhlichen Bierrunde anzügliche Bemerkungen der Gäste anhören muß? "Die Grenzen zwischen bloßen Witzeleien und Belästigungen oder echten diskriminierenden Äußerungen sind fließend und situationsabhängig", schreibt der Gaststättenverband Dehoga. "Der Arbeitgeber kann keine Verantwortung für das Verhalten Dritter tragen, es ist für ihn nicht kontrollier- und steuerbar." Besonders betroffen sind auch die großen Wohnungsunternehmen und die Versicherungswirtschaft. Die Wohnungsgesellschaften müssen nicht nur Millionen von Mietverträgen gerichtssicher dokumentieren. Sie können auch nicht mehr gezielt vermieten, um zum Beispiel Ausländerghettos zu verhindern. Und die Versicherer dürfen ihre Prämien nur noch differenzieren, wenn sie dies auch mit verläßlichen Daten begründen können. Die gibt es aber kaum, klagt die Versicherungswirtschaft. Sie fürchtet um den Versicherungsstandort Deutschland. Aber auch auf die Tarifpartner und den Gesetzgeber selbst kommen Probleme: Denn ältere Arbeitnehmer werden bei einer Kündigung und bei der Bezahlung in Tarifverträgen und auch Gesetzen vielfach bevorzugt behandelt - und die Jüngeren damit "diskriminiert". Selbst die Altersgrenze von 65 Jahren wackelt. "Extreme Rechtsunsicherheit" konstatieren Experten, der DIHK warnt vor einem juristischem Minenfeld: "Wahrscheinlich wird erst nach Jahren durch die Rechtsprechung einigermaßen klar umrissen sein, was genau verboten ist und was noch zulässig ist." (DIE WELT 08.03.05 Vermieter wollen diskriminieren dürfen Die SPD streitet um das Antidiskriminierungsgesetz. Die Gegner erhalten Auftrieb bei einer Bundestagsanhörung BERLIN taz Das geplante Antidiskriminierungsgesetz entzweit die SPD weiter. Nun zeigte sich auch Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck skeptisch - Peer Steinbrück aus NordrheinWestfalen kritisiert die Vorlage schon länger. Ohne ihre Stimmen würde das Gesetz im Bundesrat scheitern. Schon letzte Woche hatten diverse SPD-Kabinettsmitglieder erkennen lassen, dass sie das geplante Antidiskriminierungsgesetz nicht mehr unterstützen. Dazu gehörten Finanzminister Eichel, Wirtschaftsminister Clement und Innenminister Schily. Auch Kanzler Schröder gilt nicht als Freund des Antidiskriminierungsgesetzes. SPD-Chef Müntefering hingegen verteidigte das Vorhaben. Auch die Grünen halten daran fest, sind jedoch zu Einzelkorrekturen bereit. Die Opposition ist sowieso dagegen. Gestern wiederholte CDU-Chefin Merkel, dass der zu erwartende bürokratische Wust "aktiv zur Vernichtung von Arbeitsplätzen beitragen" würde. Das Antidiskriminierungsgesetz wird sich jedoch nicht vollständig vermeiden lassen - sind doch vier EU-Richtlinien umzusetzen. Allerdings weicht der rot-grüne Gesetzesplan an einigen Stellen von der europäischen Vorgabe ab. Dort ist nur für das Arbeitsrecht vorgesehen, dass Benachteiligung nach acht Kriterien verboten ist: Rasse, Ethnie, sexuelle Identität, Alter, Weltanschauung, Religion, Behinderung und Geschlecht. Für das Zivilrecht hingegen sollen nur zwei Kategorien wichtig sein: Ethnie und Geschlecht. Im deutschen Entwurf gelten hingegen auch dort alle acht Kriterien. Seither tobt der Streit. Gestern lud der zuständige Familienausschuss im Bundestag zu einer Expertenanhörung. Die Meinungen waren erwartungsgemäß geteilt. Die Sachverständigen der Regierungsparteien betonten das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes - daher müssten im Zivilrecht dieselben Kategorien wie im Arbeitsrecht gelten. Doch auch die Experten der Opposition kannten die Verfassung und zitierten immer wieder die Vertragsfreiheit. Dissens gab es auch im Detail. So müssen die acht Kategorien im privaten Rechtsverkehr nur berücksichtigt werden, wenn es sich um ein "Massengeschäft" handelt. Bei einem Abschluss wie der Kreditvergabe, wo es sehr stark auf die Bonität des einzelnen Kunden ankommt, würde das Gesetz nicht gelten. Besonders die privaten Versicherungen sind alarmiert, die als "Massengeschäft" zählen und daher alle acht Kategorien befolgen müssen. Ihre Experten wandten ein, dass man Behinderung, Alter oder geschlechtliche Orientierung nicht immer sauber von einem Krankheitsrisiko trennen könne. Wenn etwa Homosexuelle nicht versichert würden - dann doch nicht weil sie schwul seien, sondern weil sie 76 ein erhöhtes Risiko für Aids oder Hepatitis mitbrächten. Die Versicherer streben daher an, dass sie wie die Kreditinstitute nicht länger als "Massengeschäft" gelten. Genau das wollen auch die großen Wohnungsunternehmen für sich erreichen, die ebenfalls nicht alle acht Kriterien befolgen möchten. Sie argumentierten gestern, dass sie ihre Mieter stets sehr sorgsam und persönlich auswählen - ob sie etwa in die Nachbarschaft passen. Und schließlich: Wie wird eigentlich eine Diskriminierung nachgewiesen? Die Arbeitgeber fürchten eine "Beweisumkehr" - dass sie künftig darlegen müssten, dass sie nicht diskriminiert haben. Diese Sorgen konnten die Regierungsexperten nicht teilen: In den EU-Richtlinien sei nur eine Beweiserleichterung festgeschrieben. Ohne konkreten Anfangsverdacht ließe sich aber kein Gericht überzeugen, einen Diskriminierungsfall überhaupt anzunehmen. " ULRIKE HERRMANN (taz 08.03.05) Der Kanzler schien – zu Recht - über das schlechte Regierungsmanagement ungehalten zu sein: „Schröder rüffelt Clement und Schily Kanzler verteidigt Antidiskriminierungsgesetz - ... Berlin - Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich auf der Kabinettssitzung in den koalitionsinternen Streit um das Antidiskriminierungsgesetz eingeschaltet. Grundlegende Änderungswünsche von Innenminister Otto Schily und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (beide SPD) an dem Gesetz lehnte Schröder nach WELT-Informationen ab. Die Ministerien hätten den Fraktionen bei dem Gesetzentwurf zugearbeitet. Im nachhinein könne man sich jetzt nicht hinstellen und dies selbst kritisieren. Mehrere Minister hatten moniert, das Gesetz gehe über die EU-Vorgaben hinaus, schaffe unnötig Bürokratie und sei in Teilen zu wirtschaftsfeindlich. Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Volker Beck sagte zu der Kritik, der arbeitsrechtliche Teil des Gesetzes sei vollständig im Wirtschaftsministerium ausgearbeitet und von den Regierungsfraktionen übernommen worden: "Es ist schon seltsam, daß mancher jetzt nicht mehr wissen will, was er uns da reingeschrieben hat." Beck signalisierte aber Kompromißbereitschaft bei Details. Demnach sollten Wohnungsgesellschaften ihren bisherigen Handlungsspielraum behalten, wonach sie in Großsiedlungen auf eine ausgewogene Mischung von Mietern achten können. Ferner schlug Beck vor, Klagen gegen Diskriminierung nur in einer bestimmten Frist zuzulassen. Er kann sich zudem vorstellen, entgegen den ursprünglichen Plänen keine kostspielige Antidiskriminierungsstelle einzurichten, sondern die Aufgabe bei der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung anzusiedeln. Sein SPD-Kollege Wilhelm Schmidt erklärte, das Gesetz solle noch im April im Bundestag verabschiedet werden. Er sei zuversichtlich, daß die Koalition dann auch die SPD-regierten Länder an ihrer Seite habe. Die Abstimmung über das umstrittene Gesetz im Bundesrat sei für den 27. Mai geplant - fünf Tage nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Peer Steinbrück (SPD) hatte damit gedroht, sein Land werde dem vorliegenden Gesetzentwurf in der Länderkammer nicht zustimmen. Der Bundesrat kann das Gesetz mit einer Zweidrittelmehrheit kippen, da es sich um ein Einspruchsgesetz handelt. ...“ (DIE WELT 10.03.05) Grundsätzliche Bedenken gegen ein Antidiskriminierungsgesetz bringt der Politologe Leggewie vor (FR 09.03.05): Antidiskriminierungspolitik verleitet Individuen dazu, sich in "ihrer" Minderheit zu verschanzen und den sozialen Partikularismus zu verschärfen, statt die konkrete Benachteiligung im Rahmen einer menschenrechtlich fundierten Ordnung aufzuheben. Und sie ermöglicht selbst ernannten Advokaten und politischen Unternehmern, sich schützend vor Minderheiten zu stellen, nicht immer zu deren Vorteil und auch hier wieder mit der Tendenz, ethnische und andere Unterschiede festzuschreiben statt sie aufzuweichen. Zudem erlaubt dieses Eingraben in der eigenen Gruppenidentität, innere Kritiker mundtot zu machen und die Meinungsfreiheit, ein allemal überzuordnendes Gut, zu beschädigen. Gerade religiöse Gruppen berufen sich jetzt auf Antidiskriminierung, um auf diesem Weg Bigotterie und Unterdrückung in eigenen Reihen unantastbar zu machen. Ein fundamentalistischer Moslem, Christ oder Hindu kann jederzeit auf Beleidigung oder Blasphemie klagen, um die Klage über tatsächlich 77 begangene Diskriminierungen, von Frauen und Mädchen, so genannten Häretikern und Außenseitern abzuwehren. Doch die teilweise erbittert geführten Auseinandersetzungen um die Verabschiedung des Antidiskriminierungsgesetzes stellten sich dann im Mai 2005 als vergeblich aufgewandte Energie im politischjuristischen Bereich heraus, weil der Bundeskanzler der bis dahin rot-grünen Bundestagsmehrheit nach der für diese Parteienkonstellation verlorenen Landtagswahl im »SPD-Stammland« NRW angekündigt hatte, über den holprigen verfassungsrechtlichen Weg des Art. 68 GG (Stellung der Vertrauensfrage mit selbst organisierter Abstimmungsniederlage) die Auflösung des Bundestages zu betreiben und vier Monate später Neuwahlen anzustreben. Die Regierungskoalition hatte nach der verloren gegangenen NRW-Wahl nicht einmal mehr die Geschäftsordnungsmehrheit im Vermittlungsausschuss. So konnte die bürgerliche Opposition das Thema von der Geschäftsordnung absetzen und vertagen. Das Gesetz fiel damit der in § 125 der Geschäftsordnung des Bundestages geregelten zeitlichen "Diskontinuität" anheim. Der Diskontinuitätsgrundsatz bedeutet, dass die am Ende einer Wahlperiode nicht mehr abschließend beratenen Gesetzesentwürfe schon allein durch diesen Fristablauf erledigt sind. Um sie weiterzuverfolgen, müssten sie erst von dem neugewählten Bundestag wieder aufgenommen werden - der dann die Antidiskriminierungsregeln leicht auf den von ihm gewünschten Mindestumfang zusammenstutzen könnte, um gerade noch der EU-Richtlinie in ausreichendem Maße nachgekommen zu sein. Juristisch interessant war in dem Zusammenhang des Antidiskriminierungsgesetzes und der grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit, insbesondere des Art. 4 II GG „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“, die von der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Schavan zuvor 2004 in die öffentliche Diskussion gebrachte Forderung, dass in den damals rund 2.500 in Deutschland gelegenen Moscheen nur noch Deutsch gepredigt werden dürfe, um den in arabisch oder türkisch predigenden islamischen Hass-/Dschihadpredigern - leichter auf die Schliche kommen zu können – womit man aber höchstens das religiöse Vorfeld der „Bomben-Muslime“/ “Islam-Bomber“ ins Visier nehmen könnte, religiöse Selbstmordattentäter schotten sich auch von ihren nicht (so) fanatischen Glaubensbrüdern ab: „Imame sollen in Deutsch predigen Moscheen: Türkische Gemeinde und Zentralrat der Muslime unterstützen Forderung aus der CDU Von Maike Röttger Hamburg - Angesichts der nicht abreißenden Anschläge gegen muslimische und christliche Einrichtungen in den Niederlanden haben auch deutsche Politiker vor gefährlichen Parallelgesellschaften gewarnt. Baden-Württembergs Kultusministerin Annette Schavan (CDU) forderte deswegen eine Pflicht für Imame, in Deutsch zu predigen. "Wir dürfen nicht weiter zulassen, daß in Moscheen in Sprachen gepredigt wird, die außerhalb der islamischen Gemeinde nicht verstanden werden", sagte sie. Andernfalls würden kulturelle Abgrenzung und Skepsis gefördert. Geistliche Führer, die in Arabisch oder anderen Sprachen predigten, setzten sich dem Verdacht von Hetzreden gegen Andersgläubige aus. Vorstellbar sei eine entsprechende Gesetzesinitiative Baden-Württembergs. …“ (HH A 15.11.04) Die Forderung von Anette Schavan war eine wohlfeil in den politischen Raum gestellte populistische Forderung - und wohl eher ihren damaligen Ambitionen auf den Stuhl des/der baden-württembergischen Ministerpräsident/in geschuldet, um in der parteiinternen Mitgliederbefragung zu punkten. „Law made simple“, oder: wie sich die kleine Annette »das Recht« vorstellt. Natürlich hat der Gedanke Schavans auf den ersten Blick etwas Bestechendes. Jeder juristisch Unbeleckte - und dazu gehört Schavan: darum sind ihre diesbezüglichen Äußerungen mehr peinlich als ärgerlich - glaubt sofort, dass Schavan mit ihrer eingängigen Forderung für das Hass-/Dschihadprediger-Problem das „Ei des Kolumbus“ gefunden habe. Aber mit einem bisschen Nachdenken, das man von einem/einer herausragenden Politiker/in verlangen kann, hätte sie selber darauf kommen müssen(!), dass sie ihren Vorschlag „in die Tonne treten“ sollte; und wenn sie es nicht macht, dann wird es das Bundesverfassungsgericht machen, dessen bin ich absolut sicher, denn Art. 4 II GG regelt: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Zur Freiheit des kultischen Handelns gehört nach heutigem Verständnis, 78 dass der/die Gottesdienstbesucher/in auch verstehen können müsse, was sein/ihr Prediger ihm/ihr sagt. Auch demjenigen, der keine ausreichenden Deutschkenntnisse besitzt, sichert unser Grundgesetz als eines der wenigen in unserer Verfassung vor gesetzlichem Eingriff geschützten Rechte eine „ungestörte Religionsausübung“ zu. Das Recht der freien Religionsausübung wird innerhalb der Schranken der durch das Grundgesetz konkretisierten Wertordnung vorbehaltlos gewährt. Wir leben nicht mehr in der Zeit von vor einigen hundert Jahren, als in der katholischen Kirche der Gottesdienst ausschließlich auf Latein abgehalten wurde und die Glaubensschäfchen teilweise erst im Beichtgespräch die Konkretisierung dessen erfuhren, was ihnen ihr Priester in einer ihnen fremden Sprache im Gottesdienst verkündet hatte. Und wie sollte es mit dem in Art. 3 GG normierten Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren sein, wenn muslimische Prediger gezwungen würden, in einer ihren Gläubigen teilweise unverständlicher Sprache zu predigen – wobei hinzu kommt, dass z.B. die vom türkischen Religionsministerium geschickten Imame nicht unbedingt Deutsch sprechen können oder, wenn sie vielleicht ein wenig Deutsch können, nicht über für die Besorgung von Alltagsgeschäften hinausgehende deutsche Sprachkenntnisse verfügen – und orthodoxe Pfarrer einer russisch-orthodoxen Gemeinde oder katholische Priester einer polnischen Gemeinde ihren Gottesdienstbesuchern in der ihnen vertrauten und teilweise allein verständlichen Sprache die Segnungen ihrer Mutterkirche zukommen lassen können? BEERDIGUNG IN WOLFSBURG Ergreifender Abschied von Nowak Unter großer Anteilnahme ist am Samstag der ehemalige Bundesliga-Profi Krzysztof Nowak beigesetzt worden. Rund 1500 Trauergäste, darunter viele ehemalige Mitspieler, nahmen Abschied vom polnischen Nationalspieler und Mittelfeldregisseur des VfL Wolfsburg. Wolfsburg - Nowak war vor zehn Tagen im Alter von 29 Jahren an den Folgen der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gestorben. Er hinterlässt Ehefrau sowie zwei Kinder (vier und neun Jahre). Die Beisetzung fand auf dem Wolfsburger Waldfriedhof statt. Zuvor hatten rund 600 Menschen beim Requiem in der St. Christophoros Kirche Nowak die letzte Ehre erwiesen. Sowohl das Requiem als auch die Beisetzung fanden in deutscher und polnischer Sprache statt. ... Die Krankheit ALS zerstört Nervenzellen, die für die Kontrolle der Muskeln zuständig sind, was zu einer zunehmenden Lähmung des ganzen Körpers und schließlich meist zum Tod der Patienten führt. Der wohl bekannteste Patient ist der britische Astrophysiker Stephen Hawking. Auch der deutsche Maler Jörg Immendorf leidet an ALS. Pro Jahr erkranken etwa 1 bis 2 von 100.000 Menschen an der Krankheit. (SPIEGEL ONLINE 06.06.05) Ein allein auf die Moscheen zielendes Gesetz, wäre – auch wenn durch einschlägige Vorkommnisse veranlasst – ein die islamische Religionsausübung diskriminierendes Gesetz. Das grundgesetzlich geschützte Recht der „ungestörten Religionsausübung“ kann Schavan den des Deutschen teilweise unkundigen Muslimen nicht nehmen! „Die Gerichtssprache ist deutsch.“, heißt es in § 184 Gerichtsverfassungsgesetz; die »Religionssprache« ist nicht ebenso verbindlich geregelt, und aus grundgesetzlichen Erwägungen heraus kann man das auch nicht machen – wie man das bei der Gerichtssprache trotz der genannten eindeutigen gesetzlichen Regelung anscheinend noch näher konkretisieren muss: GESETZESENTWURF Schöffen sollen Deutsch können Von Sebastian Fischer Das rheinland-pfälzische Kabinett hat eine Gesetzesinitiative gestartet, die Selbstverständliches garantieren soll: Schöffen an deutschen Amts- und Landgerichten müssen die deutsche Sprache beherrschen. Berlin - Die Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Mainz geriet ins Stocken. Schnell musste eine Dolmetscherin herbeigeschafft werden. Doch es war nicht etwa der Angeklagte, der der Verhandlung nicht mehr folgen konnte - es war die ehrenamtliche Richterin. Die Deutsch-Rumänin, Anfang des Jahres gerade erst auf vier Jahre zur Schöffin bestellt, verstand kein Wort. Im rheinland-pfälzischen Justizministerium schrillten die Alarmglocken: "Es kann nicht sein, dass Angeklagte von Schöffen verurteilt werden, die gar kein Deutsch verstehen", so der zuständige Minister Herbert Mertin. In Windeseile ließ er einen Gesetzesentwurf für den Bundesrat formulieren. Am Dienstag beschloss ihn das Kabinett unter Ministerpräsident Kurt Beck. Rheinland-Pfalz will den Entwurf nun am 17. Juni in den Bundesrat einbringen - und ist sich der 79 Unterstützung gewiss: "Die anderen Länder werden diese Problematik erkennen, wir gehen davon aus, dass sie unserem Entwurf zustimmen", sagt Fabian Scherf, Sprecher des Justizministers. Dolmetscher für die Übersetzung der Eidesformel Die Problematik ist seit Jahren bekannt. Zum Beispiel im Stadtstaat Hamburg: Im März 2001 musste am Amtsgericht Altona ein Prozess abgebrochen werden, weil der Hilfsschöffe als Russlanddeutscher des Deutschen nicht mächtig war. Für die Übersetzung der Eidesformel musste ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Bisher kann das Ehrenamt des Schöffen von jedem deutschen Staatsangehörigen ausgeübt werden. Die Schöffen wirken als gesetzliche Richter im Sinne des Grundgesetzes an der Entscheidungsfindung mit. Im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) sind zur Zeit nur einige wenige Beschränkungen der Schöffenberufung geregelt. So sollen die Laienrichter über 25, aber unter 70 Jahre alt sein, mindestens seit einem Jahr in der entsprechenden Gemeinde wohnen und nicht wegen einer strafbaren Handlung zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. Wie wird man Schöffe? Die Auswahl der Schöffen erfolgt über eine Vorschlagsliste, die von der Gemeindevertretung mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen werden muss. Auf der Liste sollen alle Gruppen der Bevölkerung repräsentiert sein. Über Aufrufe und Anzeigen finden die Gemeinden Kandidaten, die sich selbst melden. Möglich sind auch Nominierungen durch Parteien, Religionsgemeinschaften oder Vereine. Die von der Gemeindevertretung beschlossene Vorschlagsliste wird eine Woche lang öffentlich ausgelegt. Jeder hat das Recht, gegen die Kandidaten Einspruch einzulegen. Von den Amts- und Landgerichten wird dann die erforderliche Anzahl an Laienrichtern von den Listen ausgewählt. In Bayern wurde im Jahr 2001 der Fall einer nicht deutsch sprechenden Hilfsschöffin ans Justizministerium gemeldet. Man habe die Sache damals "pragmatisch gelöst", sagt Ministeriumssprecherin Beate Ehrt. Nach einem Gespräch mit der Schöffin sei diese zurückgetreten. Der Freistaat Bayern schickte in der Folge ein Rundschreiben an die deutschen Landesjustizministerien, um deren Praxiserfahrungen abzufragen. Das Ergebnis war Uneinigkeit: "Die einen sagten, man müsse das regeln, die anderen sahen das nicht als dringlich an", so Sprecherin Ehrt. Eine Gesetzesinitiative im Bundesrat habe sich deshalb aus bayerischer Sicht damals nicht gelohnt. Kleine Verzögerung durch anstehende Neuwahlen In diesem Jahr aber sei das Thema wieder auf die politische Agenda des Justizministeriums geraten: Weil am 1. Januar 2005 bundesweit die neuen Schöffen auf vier Jahre gewählt worden sind, laufe in Bayern derzeit eine "Praxisabfrage". Trotz bayerischen Problembewusstseins sieht der Freistaat seine Zustimmung zur rheinland-pfälzischen Gesetzesinitiative im Juni nicht als schon im Vorhinein gegeben an: "Manchmal ist weniger Bürokratie besser, wir sehen zur Zeit Schwierigkeiten darin, die Deutschkenntnisse von potentiellen Schöffen zu prüfen", so Ehrt. Außerdem müsse man auch die Signale bedenken, die man damit an die nicht deutschstämmigen Bürger sende Rheinland-Pfalz will mit seiner Gesetzesinitiative nun "Personen, die nicht über hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen" vom Schöffenamt ausschließen, so der vorgelegte Neuformulierungsvorschlag für Paragraph 33 GVG. Außerdem, so Justizsprecher Fabian Scherf, "sollen mit Hilfe des Gesetzes in Zukunft auch bereits gewählte, aber nicht deutsch sprechende Schöffen abberufen werden können, ohne dass es Folgen für den Prozessverlauf hat". Eine kleine Verzögerung müssen die schnellen Rheinland-Pfälzer noch hinnehmen: Zwar kann der Bundesrat das Gesetz im Falle einer Mehrheit für das sozialliberal regierte Bundesland schnell durchwinken, doch wird sich die Lesung im Bundestag durch die wahrscheinlich im Herbst anstehenden Neuwahlen verzögern. "Das macht aber nicht viel aus", sagt Scherf, "wir würden das Gesetz dann eben sofort in den neu konstituierten Bundestag einreichen". (SPIEGEL ONLINE 01.06.05) In dem undurchdachten »Bauch-Vorschlag« der Ministerin steckt ein weiterer Grundrechtsverstoß, nämlich gegen den mit Verfassungsrang ausgestatteten, vom Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aller den Bürger belastenden staatlichen Maßnahmen: der Staat soll nicht mit Kanonen auf uns Spatzen schießen dürfen! Auf das Problem der Predigtsprache in Moscheen angewandt, gäbe es eine die Gläubigen weniger belastende Maßnahme staatlicher Kontrolle: von den vielen eingedeutschten Türken arbeitet ein Teil als Polizist – und kann deswegen ohne weiteres zum dienstlichen Predigtbesuch in einer Moschee abgestellt werden; da braucht nicht den des Deutschen nicht ausreichend Kundigen das Verstehen der geistlichen Labsal unmöglich gemacht zu werden! Außerdem stehen die als »problematisch« erkannten Moscheen bereits 80 unter ständiger Beobachtung der Verfassungsschutzbehörden. Ein Rat in Frau Dr. Schavan: Schon die »alten Römer« wussten: „Si tacuisses, philosophus mansisses!“ [„Wenn Du geschwiegen (und kein dummes Zeug geredet) hättest, hätte man dich weiterhin für einen Philosophen halten können!“] Die juristische Ahnungslosigkeit von Frau Schavan wurde von ihrem Parteikollegen Schönbohm, dem damaligen Innenminister des Landes Brandenburg, noch übertroffen; und es ist ärgerlich, dass ein Innenminister so eine eklatante Ahnungslosigkeit gegenüber den Grundrechten offenbart, die zu verteidigen als Aufgabe seines Amtes auch ganz speziell mit in seinen Amtsbereich fällt: Der Ex-General hatte mit einem politischen Schnellschuss nach Cowboy-Manier aus der Hüfte heraus die Forderung erhoben, dass Hasspredigern die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden sollte. Das setzt natürlich voraus, dass ein Hassprediger Inhaber der deutschen Staatsbürgerschaft ist; andernfalls könnte man ihn ja leichter aus der BRD hinauskomplimentieren. Und da der deutsche Staat Mehrfachstaatsbürgerschaften grundsätzlich unterbindet und von z.B. Türken, die sich hier hatten einbürgern lassen wollen, bisher verlangt/e, dass sie zuvor ihre türkische Staatsbürgerschaft aufgeben, würden solche Leute ja staatenlos werden. Das aber nicht zu tun, hat sich die BRD durch Ratifizierung internationaler Konventionen, u.a. der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte8, verpflichtet. Und nun kommt Art. 16 I 1 GG ins Spiel, der ganz eindeutig regelt: „Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden.“ Punkt! Aber man darf sie natürlich freiwillig durch ordnungsgemäßen Antrag aufgeben, wie es z.B. der ehemals deutsche Soziologe und jetzige Brite Lord Dahrendorf gemacht hat. Das ist in § 26 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz so geregelt. Nicht freiwillig verliert man die deutsche Staatsangehörigkeit durch die - aber grundsätzlich nicht erlaubte „Entziehung“. Die „Entziehung“ ist ein Staatsakt, durch den jemand ohne oder gegen seinen Willen seine Staatsangehörigkeit verliert, d.h. laut BVerfG ein „Verlust, den der Betroffene nicht beeinflussen kann.“ Mit dem so schlicht klingenden Verbot der Entziehung der deutschen Staatsangehörigkeit durch alle drei staatlichen Gewalten, insbesondere den Gesetzgeber, ist jede einseitige Wegnahme der Staatsangehörigkeit durch eine hoheitliche Maßnahme durch Gesetz, Richterspruch oder Verwaltungsakt auf Grund der historischen Erfahrung mit der Ausbürgerungspolitik des NS-Staates9 „aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen“ (Art. 116 II 1 GG) und der daran gekoppelten Vermögenskonfiszierung durch das Reich (und später der Ausbürgerungspolitik der DDR) nunmehr grundsätzlich grundgesetzlich verboten. Die zuständige Regierungsbehörde kann grundsätzlich nicht durch eine hoheitliche Einzelfallmaßnahme einen ihr missliebig gewordenen deutschen Staatsbürger ausbürgern, keinen Hassprediger - und noch nicht einmal einen Terroristen. Kein Deutscher darf durch die Entziehung der Staatsbürgerschaft staatenlos werden. Das würde der Schutzpflicht des Heimatstaates widersprechen. Könnte einem unserem Staat missliebig gewordenen deutschen Staatsbürger die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden, müsste man u.a. um das für das Funktionieren einer Demokratie fundamentale Recht der freien Meinungsäußerung aus Art. 5 GG fürchten, wenn jeder scharfe Kritiker bundesrepublikanischer Missstände, die immer einmal wieder zu Tage treten, kujoniert werden, ihm sogar seine Staatsangehörigkeit entzogen und er dann des Landes verwiesen werden könnte, denn das ist ja letztlich das Ziel der Entziehung einer Staatsbürgerschaft, wie manche Staaten das machen, z.B. Saudi-Arabien mit Osama bin Laden. Und nun fordert der »Verfassungsschutzminister«, wie sich die Innenminister inoffiziell gerne nennen und nennen lassen, dass gegen das Grundgesetz verstoßen werden sollte! „Da haben Herr General mit seiner Forderung, durch Eindeutschung zu deutschen Staatsbürgern gemachten Hasspredigern die verliehene deutsche Staatsbürgerschaft wieder zu entziehen, einen ziemlichen Bock geschossen!“ Bewusst war bei der Erörterung der „Entziehung“ der Staatsangehörigkeit gerade wieder einmal das in 8 9 Art. 15 2., 1. HS.: „Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen … werden, …“ Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit. Vom 14. Juli 1933 und die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit. Vom 26 Juli 1933. In letzterer hieß es keine sechs Monate nach der „Machtübernahme“, drei Jahre vor den Olympischen Spielen in Berlin und sechs Jahre vor dem Überfall auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg in Gang gesetzt wurde, u.a.: „Ein der Treuepflicht gegen Reich und Volk widersprechendes Verhalten ist insbesondere gegeben, wenn ein Deutscher der feindseligen Propaganda gegen Deutschland Vorschub leistet oder das deutsche Ansehen oder die Maßnahmen der deutschen Regierung herabzuwürdigen gesucht hat.“ 81 juristischen Zusammenhängen bedeutungsvolle Wörtchen »grundsätzlich« benutzt worden, das andeutet, dass es mindestens eine juristisch relevante Ausnahme von der grundsätzlich geltenden Regelung gibt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit nicht – wieder - entzogen werden könne. „Weil er an exponierter Stelle in der PKK mitgearbeitet haben soll, hat das Regierungspräsidium (RP) Gießen einem gebürtigen Türken die deutsche Staatsbürgerschaft wieder aberkannt. Der Mann habe im Vorstand eines der PKK nahe stehenden Vereins mitgearbeitet und an ’PKK-nahen Aktivitäten’ teilgenommen, teilt die Behörde mit. Damit habe er ’Bestrebungen verfolgt, die gegen die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gerichtet sind’. Daraus folgert das RP, dass sein anlässlich der Einbürgerung im Sommer 2002 abgegebenes Bekenntnis zur freiheitlichen Grundordnung (Loyalitätserklärung) falsch war. Denn das Bundesinnenministerium habe die Organisation im Jahr 1993 verboten. RP-Regierungsdirektor Manfred Becker: ’Das Verbot in Artikel 16 des Grundgesetzes (Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden) gilt nach einheitlicher Rechtsauffassung nicht für erschlichene, unter falschen Voraussetzungen zustande gekommene Einbürgerungen.’ Diese Entscheidung habe der Verwaltungsgerichtshof Gießen im Mai 2004 bestätigt. Vorwurf: Falsche Loyalitätserklärung zur fdGO anlässlich der Einbürgerung.“ (FR 04.01.05) „Wer ins Grundgesetz schaut, könnte über den Fall zunächst verwundert sein, heißt es doch in Artikel 16: ’Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden.’ Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung, die im Fall des hessischen Kurden angewandt wurde. ’Der Verlust der Staatsangehörigkeit’, heißt es im Grundgesetz, dürfe ’gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird’. Dies aber ist bei dem Deutschkurden nicht der Fall. Seine türkische Staatsbürgerschaft hatte er auch nach seiner Einbürgerung in Deutschland behalten dürfen. Jetzt sei er wieder ’nur noch Türke’, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums gestern, und müsse seine Aufenthaltserlaubnis bei der Ausländerbehörde neu beantragen. ’Doppelpass’-Besitzer wie der hessische Kurde haben schlechte Karten. Aber auch wer nach seiner Einbürgerung vorerst nur noch Deutscher ist, kann sich nicht in Sicherheit wiegen. Über die Auslegung der Schutzbestimmungen des Grundgesetzes gab es in der Vergangenheit verschiedene Gerichtsurteile. Während das Berliner Verwaltungsgericht vor zwei Jahren entschied, eine Einbürgerung könne nicht rückgängig gemacht werden, urteilte das hessische Oberverwaltungsgericht schon 1996, die grundgesetzlich garantierte Unentziehbarkeit der Staatsbürgerschaft sei ’bei einer erschlichenen Einbürgerung wegen der fehlenden Schutzwürdigkeit des Eingebürgerten ausgeschlossen’. Im Bezug auf ’Scheinehen’ befand das Bundesverwaltungsgericht Ende 2003: ’Eine erschlichene Einbürgerung, die durch eine vorsätzliche Täuschung der Einbürgerungsbehörde erreicht wurde, darf keinen Bestand haben.’" (taz 05.01.05) Juristisch ähnlich zu bewerten ist der Fall, dass jemand nach der seit 2000 geltenden Gesetzeslage § 85 AuslG Einbürgerungsanspruch für Ausländer mit längerem Aufenthalt; Miteinbürgerung ausländischer Ehegatten und minderjähriger Kinder (1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, ist auf Antrag einzubürgern, wenn er sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bekennt und erklärt, daß er keine Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, oder glaubhaft macht, daß er sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat, eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzt, den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruchnahme von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe bestreiten kann, seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert und nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist. 82 ... die deutsche Staatsbürgerschaft unter der Verpflichtung erworben hat, seine bisherige Staatsbürgerschaft aufzugeben, er das weiß und tut - und sich dann, weil er um das Verbotene seines Handelns weiß, aus teilweise nachvollziehbaren Gründen (erbrechtliche Ansprüche wahren, Immobilienerwerb im Ursprungsland) heimlich wieder seine alte Staatsbürgerschaft zusätzlich verschafft. Nicht hinnehmbar ist es für unser Land, wenn ihn sein Ursprungsland dabei durch Verschleierungsmaßnahmen auch noch komplizenhaft unterstützt: „50 000 Türken beschafften sich illegal den Doppelpaß Union: Regierung unterschätzt das Problem von Ansgar Graw Berlin - Die Union hat die Bundesregierung aufgefordert, von der türkischen Regierung eine Liste mit den Namen von rund 50 000 türkischstämmigen Personen mit illegaler doppelter Staatsangehörigkeit zu verlangen. Die Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (CDU) und Hartmut Koschyk (CSU) sagten vor Journalisten, die Bundesregierung unterschätze offenkundig die Probleme, die mit dieser Frage zusammenhingen. Zuvor hatte die Bundesregierung in der Beantwortung einer Kleinen Anfrage der Union unter Berufung auf offizielle Angaben aus Ankara die Zahl der türkischstämmigen Personen, die sich nach Erlangung der deutschen Staatsangehörigkeit erneut einen zusätzlichen türkischen Paß beschafft hatten, auf etwa 50 000 beziffert. Das Verfahren widerspricht dem am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, nach dem Deutsche ausländischer Abstammung, die sich wieder die ursprüngliche Staatsangehörigkeit beschaffen, automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Obwohl diese Rechtslage bekannt war, hat die türkische Regierung nach Darstellung der Union per Runderlaß vom 10. September 2001 alle Gouverneursämter angewiesen, die in Deutschland verlangten Registerauszüge zu manipulieren und so den Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit gegenüber deutschen Behörden zu verschleiern. "Der Vorgang ist ein unfreundlicher Akt", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bosbach, der zugleich betonte, es gehe nicht darum, die betroffenen Türken einzuschüchtern oder ihnen Sanktionen etwa hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatus anzudrohen. Sie hätten sich durch den Wiedererwerb des türkischen Passes bislang nicht strafbar gemacht, daher sollten sie sich freiwillig melden und unter Verzicht auf die türkische Staatsangehörigkeit den Prozeß zur deutschen Einbürgerung erneut durchlaufen - "ohne Bonus und ohne Malus, wie jeder andere Türke auch, der einen deutschen Paß haben möchte", so Koschyk, der innenpolitischer Sprecher der Fraktion ist. Bosbach sagte, die Bundesregierung ignoriere bislang, welche Fragen mit der Staatsangehörigkeit zusammenhingen. So hätten Deutsche die Möglichkeit der Verbeamtung, das Recht auf diplomatischen Schutz im Ausland und seien in Fragen des Familiennachzuges privilegiert. Von allen diesen Rechten dürften Inhaber der türkischen Staatsangehörigkeit keinen Gebrauch machen. Sollten sie dies dennoch tun, könnten sich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Tatbestand bekannt würde, beispielsweise "immense Rückzahlungsforderungen" ergeben. Dies gelte, so Koschyk, beispielsweise, wenn Hartz-Bezüge gezahlt worden seien, die für einen Deutschen höher sein könnten als für einen Ausländer mit Duldungsrecht. Koschyk wies zudem auf das Problem der Teilnahme an Wahlen hin. So habe die SPD bei der Bundestagswahl 2002 nur um 6027 Stimmen vor der Union gelegen. Der CSU-Politiker forderte dazu auf, eine solche unklare Situation bereits vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai zu vermeiden. Bosbach wie Koschyk erklärten allerdings, es gehe nicht um eine Anfechtung zurückliegender oder künftiger Wahlen.“ (DIE WELT 10.03.05) Faruk Sen, der Direktor des Zentrums für Türkeistudien (ZfT), hatte schon vor der Landtagswahl in NordrheinWestfalen auf die Bedeutung der 180.000 wahlberechtigten türkischen Migranten hingewiesen (DIE WELT 07.04.05). Er forderte sie auf, die Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsrechts zu achten, das spätestens seit der ab 2000 geltenden Neuregelung eine doppelte Staatsbürgerschaft bei Erwerb der deutschen ausschließt. Es müsse akzeptiert werden, wenn die Landesregierung Doppelstaatler aufdecken wolle, um die Legitimität der Wahl nicht zu gefährden. Das galt und gilt genau so für die kommenden Bundestags- und Europawahlen! Die SPD hatte die Bundestagswahl 2002 vor der CDU/CSU mit einem Zweitstimmenvorsprung von nur 6.027 Stimmen gewonnen. Da können zehntausende von Türken unberechtigt abgegebene Stimmen das Wahlergebnis ohne weiteres verfälschen! Da die türkischen Einwanderer bisher zu rund 60 % zur SPD und zu 9-14 % zur CDU tendierten 83 (SPIEGEL 04.10.04) und sich dieses Wahlverhalten noch deshalb verstärken wird, weil SPD und Grüne für eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU eintreten, die CDU/CSU aber nur eine „privilegierte Partnerschaft“ zulassen will, könnten durch die Staatsbürgerschaftsmanipulationen der Türken die Siegchancen der in den Umfragen vorne liegenden CDU/CSU entscheidend geschwächt werden. Neben der freiwilligen Aufgabe und der - grundsätzlich nicht erlaubten - Entziehung gibt es noch den „Verlust“ als automatischen Wegfall der deutschen Staatsbürgerschaft durch dauerhaften Aufenthalt in einem anderen Land, wo dann irgendwann die Staatsbürgerschaft des Aufenthaltslandes beantragt und kein gleichzeitiger Antrag auf Entlassung aus der deutschen Staatsbürgerschaft gestellt wird. Diese Fälle sind gemeint mit Art. 16 I 2 GG: „Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.“ Diese Fälle sind in § 25 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz näher geregelt. Die eingangs dieses Kapitels angesprochene aristotelische »Gerechtigkeits-Elle« der Geltung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes für jedes staatliche Handeln hat selbstverständlich auch Geltung für die Regelung von Fragen, die bei der Schaffung des Grundgesetzes gar nicht in Erwägung gezogen worden sind. Beispiele aus jüngerer Zeit: Als im Zuge der Parteispendenaffäre der CDU, und insbesondere ihres langjährigsten Vorsitzenden, des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, dessen MfS-Akten auftauchten, in der viele natürlich illegal mitgeschnittene Telefongespräche gesammelt sind, beanspruchte der Bürger Kohl von der »Gauck-Behörde« eine ihn privilegierende Ungleichbehandlung gegenüber der bislang anderen MfS-Opfern gegenüber geübten Behördenpraxis: Obwohl – so die von den meisten Juristen angenommene Intention des Gesetzgebers - das von allen Parteien des Bundestages beschlossene Stasiunterlagengesetz von 1991 in bewusstem Gegensatz zum Bundesarchivgesetz der Pressefreiheit zum Zwecke der Aufklärung der Öffentlichkeit Vorrang vor dem Persönlichkeitsrecht eines Bürgers eingeräumt habe, soweit es dessen öffentliche Tätigkeit angeht - der Privatbereich soll auch durch dieses Gesetz geschützt bleiben -, verhinderte der ehemalige Bundeskanzler Einblicke in seine Akte durch den wegen seines Schweigens eigens zur Untersuchung der Spendenaffäre eingesetzten Untersuchungsausschuss des Bundestages oder durch Journalisten. Der Leiter der »GauckBehörde« und seine Nachfolgerin wiesen in mehreren Interviews auf die nach Meinung des Amtes eindeutige Gesetzeslage hin, die eine solche Privilegierung gegenüber anderen von dem MfS/Stasi10 bespitzelten Personen nicht zuließe: Wenn auf Grund der bewussten Entscheidung des Bundesgesetzgebers andere »prominente« (meist ostdeutsche) MfS-Opfer Einblick in die sie betreffenden Akten durch Parlamente und Journalisten hätten hinnehmen müssen - ohne dass die CDU aufgeschrieen hatte -, dann müsste das bis zu einer immer möglichen Änderung der Gesetzeslage auch für einen überaus prominenten westdeutschen Politiker gelten, wenn dessen Wirken in der Öffentlichkeit untersucht werde. Dessen ungeachtet bleibe es dem Untersuchungsausschuss völlig unbenommen, für seine Arbeit die Akten zu verwerten oder auf deren Verwertung zu verzichten, aber nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz habe die Behörde nach derzeit gültiger Gesetzeslage, wie sie von den Juristen der »Gauck-Behörde« interpretiert wurde, dem in dem Stasiunterlagengesetz als berechtigt aufgeführten Personenkreis die Akten - unter für unsere Rechtsordnung selbstverständlichem Schutz der Privatsphäre - zur Verfügung zu stellen: Bei Prominenten der Zeitgeschichte solle das Aufklärungsinteresse der Öffentlichkeit an dem öffentlichen Wirken des Ausgespähten und Ausgehorchten seinem Opferstatus vorgehen. Eine, wie mir scheint, auf unserem Grundgesetz fußende juristisch völlig einwandfreie Argumentation, wenn das die Intention des Gesetzgebers war! Keiner solle gleicher als gleich sein. Das mit der Klage Kohls befasste Verwaltungsgericht Berlin gab jedoch dem Kläger in erster Instanz Recht, machte sich dabei aber eine Interpretation des Gesetzes zu eigen, die eine Arbeit der Behörde im bisherigen Umfang unmöglich machte: Der Schutz der Opfer des MfS-Überwachungsapparates für „Betroffene oder Dritte“ 10 Es ist zwar üblich, „die Stasi“ als Meta-Chiffre für die Chiffre „die Staatssicherheit“ zu sagen, womit aber immer das „Ministerium für Staatssicherheit“ oder der Staatssicherheitsdienst gemeint war. So ist die Begriffsbildung „die Stasi“ falsch, denn gemeint ist immer „der Staatssicherheitsdienst“, und dann muss es – gleichgültig ob üblich, oder nicht – „der Stasi“ heißen. Beispiel: Die Erfordernisse der Staatssicherheit der DDR vor dem Klassenfeind geboten nach Ansicht des Politbüros die Einrichtung des Staatssicherheitsdienstes. 84 habe nach § 32 I Stasi-Unterlagengesetz, so wie er von der Kammer dieses Gerichts interpretiert wurde, Vorrang vor allen anderen Zielen. Damit wurde eine zehnjährige Praxis der Gesetzesauslegung und -anwendung als unrechtmäßig eingestuft. Die Vorab-Begründung des Vorsitzenden Richters gegenüber insbesondere ostdeutscher Kritik: „Es kommt nicht darauf an, wie die Praxis bislang war, sondern wie sie (nach der Gesetzeslage) sein muss.“ Darin kann man dem Richter nur Recht geben - auch wenn das für manche ostdeutsche Kritiker nicht nachvollziehbar zu sein scheint. Die Frage ist aber, ob das erkennende Gericht mit der von ihm vorgenommenen wörtlichen Auslegung des Gesetzestextes das Gesetz richtig angewandt hat, denn es gibt neben der wörtlichen auch andere Auslegungsgesichtspunkte. Doch die nächste Instanz entschied genau so: Die ausschließliche Intention des Stasiunterlagen-Gesetzes sei gewesen, das Täterunrecht des MfS zu entlarven. Dabei zufällig gewonnene Erkenntnisse über Opferunrecht dürfe deswegen nach bestehender Gesetzeslage nicht mitverwertet werden, auch dann nicht, wenn es sich um Personen in öffentlichen Funktionen handelt, da diese Erkenntnisse durch Verletzung des durch Art. 10 GG geschützten Post- und Fernmeldegeheimnisses zustande gekommen sind. Das BVerwG machte sich 2002 genau diese, von der Rechtsauffassung der „Gauck-Behörde“ abweichende einschränkende Interpretationsmöglichkeit des Stasiunterlagen-Gesetzes zu Eigen. Es räumte dem Recht auf Privatheit und Datenschutz eines durch Bespitzelung betroffen Gewesenen auch in seinem öffentlichen Wirken den grundsätzlichen Vorrang gegenüber dem Interesse der Öffentlichkeit an der Aufarbeitung der letzten Diktatur auf deutschem Boden ein. Das BVerwG untersagte die Einsicht in die Akten ohne Einwilligung eines Betroffenen. Die Verbrechen des MfS können nunmehr detailliert letztlich nur noch im Rahmen der Einwilligung eines durch das Schnüffel-Vorgehen des MfS jeweils Betroffenen aufgedeckt werden. Nur er erhält das Einsichtsrecht in die Manipulation seines Lebens durch den Überwachungsapparat der SED; und das auch nur mit teilweisen Schwärzungen, wenn andernfalls die Involvierungen Dritter aus den ihn betreffenden Unterlagen ersichtlich würden. (Rückschlüsse auf denjenigen, der ihn an das MfS verraten haben könnte, kann ein Betroffener so nur indirekt ziehen, indem er überlegt, wem er wann was erzählt haben könnte: Wenn es nur der eigene Ehepartner war, dann lag für manchen Bespitzelten schon der Schluss nahe, dass er von dem dann gemutmaßten »Feind im eigenen Bett« verraten worden sein muss – wenn das MfS nicht »Wanzen« in seiner Wohnung installiert und so mitgehört hatte.) Da es weder eine begünstigende noch eine belastende »Gleichbehandlung im Unrecht« gibt, müsse sich der Kläger nicht so behandeln lassen, wie es vor ihm alle anderen widerspruchslos hingenommen hatten. Die Verwertung von unrechtmäßig erlangten »Zufallsfunden« durch die Presse als Vertreter der Öffentlichkeit wurde entgegen bisher geübter jahrelanger Praxis unterbunden: Opferschutz vor Medien- und Forschungsinteressen. Nur das Parlament könnte, wenn überhaupt, durch eine Gesetzesänderung – innerhalb der durch das BVerwG aufgezeigten engen Grenzen - dafür sorgen, dass dem Interesse der Öffentlichkeit an Aufklärung ein größeres Gewicht eingeräumt werde. Aber keiner wusste, wie die Änderung ausfallen müsse. Die Verwaltungsjuristen waren am Grübeln! Die nach diesem heftigem Grübeln durch die parlamentarischen Instanzen gebrachte Gesetzesänderung veranlasste das BVerwG jedoch nicht zu einer Revidierung seiner diesbezüglichen Rechtsprechung, denn bei der Ende 2002 erfolgten Novellierung des Stasiunterlagengesetzes wurde dessen § 5 nicht geändert. Die das Gesetz vorbereitenden Juristen des Deutschen Bundestages und des Bundesministeriums der Justiz hielten das nicht für erforderlich. Sie passten nur den § 32 an die Klarstellungsintention des Gesetzgebers an. Das reichte den Richtern des BVerwGs in Leipzig aber immer noch nicht. Nach ihrer Meinung dürfen bei dieser Gesetzeslage "personenbezogene Informationen über Betroffene oder Dritte", die illegal erworben wurden, (weiterhin) nicht zum Nachteil dieser Personen verwendet werden. Informationen über Kohl, zu denen die Stasi bekanntermaßen auf illegalem Wege kam, dürften nicht herausgegeben werden. Paragraph 32 des Stasiunterlagengesetzes erlaube zwar, dass von der Behörde "personenbezogene Informationen" über "Personen der Zeitgeschichte, Inhaber politischer Funktionen oder Amtsträger" weitergegeben werden dürften, soweit sie "ihre zeitgeschichtliche Rolle, Funktions- oder Amtsausübung" betreffen. Voraussetzung für eine Verwertung sei jedoch, dass die Informationen nicht unter Verletzung von Menschenrechten durch IM, Stasi-Offiziere oder wen auch immer gesammelt worden seien. Da Geheimdienste aber insbesondere nie das Post- und Fernmeldegeheimnis beachten, sondern es bewusst brechen, können die auf diesem Wege beschafften Informationen bei Beibehaltung dieser Rechtsprechung nicht verwendet werden. Das betrifft so gut wie alle interessanten bis brisanten Informationen. Ebenso wie das BVerwG entschied 2004 das in dieser Grundrechtsfrage als höchste Instanz letztinstanzlich angerufene BVerfG. Es wurden daraufhin rund 1.300 Seiten Kohl-Akten von der Birthler-Behörde herausgesucht, den Anwälten Kohls im gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren mitgeteilt und als der Alt-Bundeskanzler seine zunächst erhobenen Einwände zurückzog, 2005 an sieben interessierte Journalisten und zwei Historiker herausgegeben. 6.000 Seiten bleiben unter Verschluss. Aus den jetzt letztlich vorliegenden 85 Akten werde ausschließlich das Schnüffel-Vorgehen des MfS ersichtlich. Journalisten, die einen Skandal um das Verhalten Kohls in der Parteispendenaffäre und einigen anderen delikaten Punkten seines Regierungshandelns zu entdecken hofften, würden enttäuscht sein, ließ die Behördenchefin verlauten, da weder Unterlagen zu der Regierungstätigkeit Kohls als Bundeskanzler noch gar Hinweise in Sachen Parteispendenaffäre in dem zusammengestellten und abgesegneten Konvolut enthalten seien. Weitere, relativ beliebig aus alltäglichen Zeitungsnotizen zusammengestellte Anwendungsfälle für das Gleichbehandlungsgebot aus neuerer und neuester Zeit; und diese Beliebigkeit - die Entscheidungen, in die das Gleichbehandlungsgebot hinein strahlt, sind Legion, jede Auswahl kann nur zufällig sein - soll ja gerade die Ausstrahlungsbreite dieser Grundrechtsnorm zeigen, damit ihre manchmal unvermutete Wichtigkeit für unser Alltagsleben erahnbar wird und bei Ihnen die entsprechende gedankliche juristische Schublade geöffnet wird, wenn Sie solche Meldungen lesen: Noch zehn Jahre nach der Wiedervereinigung erhielten ostdeutsche Kriegsinvaliden des Zweiten Weltkrieges eine geringere Kriegsinvalidenrente als die durch Zufall oder Flucht im Westen des ehemaligen Deutschen Reiches wohnenden Kriegsinvaliden. Warum? Man wird schamrot, wenn man sich das Handeln der Politiker betrachtet. Worin soll die innere Berechtigung für diese bis zum Jahre 2000 verweigerte Gleichbehandlung zu sehen gewesen sein? Ich weiß nicht, was die jeweilige Regierung an Gründen vorschob, um Geld zu sparen. Waren es angeblich niedrigere Lebenshaltungskosten in den östlichen Bundesländern? Das Argument müsste sich ja inzwischen als Legende erwiesen haben: Das Mietniveau des Jahres 2000 ist in Ostfriesland bestimmt nicht höher als in Berlin, Dresden oder Leipzig, die Reisekonzerne haben keine nach Ost und West gestaffelten Tarife für einen Urlaub in der Karibik, und in Ost- und Westdeutschland muss beim Einkauf bei Aldi oder anderen Lebensmittelketten das Gleiche gezahlt werden. Warum dann diese Ungleichbehandlung bei staatlichen Versorgungsleistungen, die auf gleichen Voraussetzungen beruht11? Ein im Krieg an einer der Fronten für das Vaterland verlorenes Bein ist in Ost- wie in Westdeutschland ein »abbes« Bein! Die Ungleichbehandlung wurde darum auch von dem BVerfG gekippt: Da alle deutschen Männer gleichermaßen ihre Knochen für denselben Staat hingehalten haben und daran beschädigt wurden, stehe ihnen die mit der Kriegsinvalidenrente verbundene Genugtuungsfunktion in gleicher Höhe zu. Wie gut, dass wir das BVerfG haben, damit es – nicht nur bei verlorenen Invalidenbeinen! - den Politikern notfalls Beine macht, wenn sie zu »gerechtigkeitsblind« sind; jedenfalls »gerechtigkeitsblinder« als das BVerfG – denn freisprechen von dem Vorwurf partieller »Gerechtigkeitsblindheit« kann ich auch das BVerfG, wie Sie gleich lesen werden, nicht immer! Verheiratete männliche Beamte haben Anspruch auf einen Tag bezahlten Sonderurlaub, wenn ihre Frau ein Kind zur Welt bringt. Die Ehe ist aber selbst unter Beamten nicht die einzige Form einer Partnerschaft. Darum beantragte ein in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebender Beamter die gleiche Vergünstigung, als die Zeit heran kam, dass seine ihm nicht angetraute Lebens(abschnitts?)partnerin ihr Kind gebären sollte. (Im Gegensatz zu Maria und Josef waren sie sich aber einig, dass es ihr gemeinsames Kind sei, und der Staat scheint auch keine diesbezüglichen Zweifel geäußert zu haben.) Das Begehren des Petenten muss abschlägig beschieden worden sein, denn zum Schluss landete der sich daran entzündet habende Rechtsstreit beim BVerfG. Und das entschied - meiner Meinung nach falsch! -, dass der Dienstherr nicht verpflichtet sei, eine einem Verheirateten zustehende Vergünstigung in Form eines Sonderurlaubes zur Teilnahme an der Geburt seines eigenen Kindes auch einem Ledigen zu gewähren. Ist in dieser Sache Ungleiches - hier einerseits: verheirateter Vater, dagegen andererseits: unverheirateter Erzeuger - sachgerecht ungleich entschieden worden, was nicht nur zulässig, sondern dann sogar geboten wäre oder Gleiches ungleich - beide Male werdender Vater in einer stabilen Dauerbeziehung -, was letztlich einen in Verkennung einer Grundrechtsnorm durch das BVerfG begangenen Verfassungsverstoß begründen würde? Wie war zuvor die Abgrenzung bei der Gruppenbildung zur Bestimmung von Gleichem oder Ungleichem sachgerecht(!) vorzunehmen, um dann die Elle des Artikels 3 GG an die präjudizierend(!) so vorgenommene Gruppenbildung zur Beurteilung des Falles anzulegen? Wer sich mit dem BVerfG anlegt, muss gute Gründe auf seiner Seite glauben oder wissen. Ich kenne leider weder die Einzelheiten des Falles, noch die tragenden Gründe, die zu der in einer Zeitungsnotiz vom 18.04.98 mitgeteilten Entscheidung geführt haben. Vermutlich hat sich unser höchstes Gericht dahingehend entschieden, dass laut Art. 6 I GG die Ehe unter dem besonderen Schutz des Staates stehe. Aber ich kritisiere die 11 Für betriebliche Lohnzahlungen ist diese Argumentation aber nicht so zwingend, denn die ostdeutschen Betriebe würden bei gleicher Lohnzahlung ihren Kosten- und Standortvorteil im gesamtdeutschen Wettbewerb verlieren, müssen aber erst noch mit kostengünstig produzierten Produkten um ihre Platzierung im Wettbewerb kämpfen, um überleben zu können. 86 Entscheidung in der mitgeteilten Form (unter dem Vorbehalt, dass es möglicherweise mir nicht bekannte Differenzierungsgründe geben sollte: so könnten die Eltern z.B. gar nicht zusammengelebt haben) als grundgesetzwidrig, weil sich jede Entscheidung teleologisch (zielgerichtet)12 auf den Schutzzweck der jeweils entscheidungserheblichen Norm beziehen muss: Zu der Geburt ihres Kindes werden die Väter deswegen Sonderurlaub bekommen, um dieses auch für ihr Leben einschneidende Ereignis teilweise sogar im Wortsinne hautnah miterleben zu können. Die sich anbahnende Vater-Kind-Beziehung soll auf einer möglichst tiefen emotionalen Basis gründen. „Neue Väter braucht das Land!“, wird uns straßauf, straßab zugerufen. Nach der Zeitungsmeldung hat das BVerfG seine Entscheidung aber mit dem unterschiedlichen Personenstandsstatus zwischen Vater und Mutter begründet, und nicht mit einer tatsächlich bestehenden oder vielleicht nicht bestehenden Lebensgemeinschaft. Das Vater-Kind-Verhältnis scheint in der Entscheidung überhaupt nicht zum Tragen gekommen zu sein. Da es aber in Art. 6 I GG heißt: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates.“ dürfte man meiner unmaßgeblichen Meinung nach einem werdenden Vater auch dann nicht den Sonderurlaub zum Miterleben der Geburt seines Kindes versagen, wenn er mit der Mutter seines Kindes nicht verheiratet ist, sondern (»nur«) in einer „wilden Ehe“ lebt; auch die ist mit der Geburt des Kindes eine Familie! So betrachtet stellt sich mir die Entscheidung als ein willkürlicher Verstoß gegen das Gleichheitsgebot dar. Maßstab sei dabei die Definition des Begriffes „Familie“, wie sie das BVerfG in seiner Entscheidung BVerfGE 10/59,66 selber formuliert hat: „Ehe ist auch für das Grundgesetz die Vereinigung eines Mannes und einer Frau zu einer grundsätzlich unauflöslichen Lebensgemeinschaft und Familie ist die umfassende Gemeinschaft von Eltern und Kindern, in der den Eltern vor allem Rechte und Pflichten zur Pflege und Erziehung der Kinder erwachsen. Dieser Ordnungskern der Institute ist für das allgemeine Rechtsgefühl und Rechtsbewußtsein unantastbar.“13 Damit ist mit „Ehe“ die „Hetero-Ehe“ eines Mannes und einer Frau festgeschrieben – ohne dass die Singularisierung extra betont worden war. Das war für das BVerfG damals – vor der Zeit der Millionen Muslime in Deutschland – einfach selbstverständlich, ist es aber inzwischen nicht mehr, wie eine Entscheidung des BVerwGs mit multikulturellem Verständnis zeigt: „Zweitfrau darf bleiben Koblenz – Die Zweitehefrau eines in Deutschland lebenden Irakers kann hier für sich eine Aufenthaltsbefugnis verlangen. Das OVG Koblenz entschied, es sei für die Zweitfrau unzumutbar, in die Heimat geschickt zu werden, während der Gatte mit seiner ersten Frau bleiben dürfe (Az.: 10 A 11717/03). (ap)“ (HH A 30.03.04) Um aber nun den Ausgangsfall für die Veranschaulichung des Gleichheitsgrundsatzes weiterzuspinnen - als kreativer Mensch kann man seine Gedanken ja nicht anhalten -, denken wir uns die Fallkonstellation etwas abgewandelt, und zwar so, dass die nicht gebärende Partnerin in einer »Lesben-Ehe« die Geburt des Kindes der Lebenspartnerin miterleben möchte und dafür Sonderurlaub beantragt (um den Jahresurlaubsanspruch zu schonen, falls sie noch welchen hatte). Im Unterschied zum Miterleben der Geburt eines eigenen Kindes durch den nichtehelichen, in einer Lebenspartnerschaft mit der werdenden Mutter lebenden Vater liegt in diesem umgebildeten Fall keine eigene »Vaterschaft« vor, so dass nach dem von mir zur Gruppenbildung vorgeschlagenen Kriterium nun eine Ungleichbehandlung zwischen dem Miterleben der Geburt eines eigenen leiblichen oder eines fremden Kindes sachdienlich ist. Dieser von mir vorgetragene Gedanke ist einige Jahre später von dem schleswig-holsteinischen Landesparlament anders gesehen worden: 12 Vielleicht wird die Notwendigkeit einer allgemeinen teleologischen Arbeitsweise - nicht nur bei der Systematik und Auslegung gesetzlicher Tatbestände - ganz gut durch einen Witz kenntlich gemacht, der nahe legt, sich auch im Alltagsleben zielorientiert zu verhalten: Ein Kunde fragt im Baumarkt in „körperlicher Bedrängnis“: „Wo sind denn hier die Toiletten?“ Antwortet der Verkäufer: „Da hinten im Regal links!“ 13 Zitiert nach Hesselberger, D.: Das Grundgesetz / Kommentar für die politische Bildung 1995 9 S. 97 87 „Mehr Rechte für Homosexuelle Kiel - Schleswig-Holsteins Landtag hat Regelungen zur Ehe auf eingetragene Lebenspartnerschaften Homosexueller erweitert. Zum Beispiel kann eine Beamtin künftig Sonderurlaub bekommen, wenn ihre Lebensgefährtin niederkommt. epd“ (HH A 17.12.04) Vielleicht wurde als gleich zu beurteilendes Kriterium die Ankunft eines neuen Familienmitgliedes angesehen. Ich hatte in meiner Auseinandersetzung mit der von mir kritisierten und für falsch gehaltenen Entscheidung des BVerfGs in meinen vorgetragenen damaligen Überlegungen als unterscheidungserhebliches Kriterium ausschließlich auf die eigene Elternschaft abgestellt und gemeint, man müsste im Falle zweier Lesben, die durch die Hilfe der modernen Biomedizin mittels Entkernens einer Eizelle und Einpflanzens eines neuen Kernes, der von der nichtgebärenden Partnerin stammt, ein gemeinsames Kind erwarten, den Sachverhalt analog der Regelung bei einer eigenen Vaterschaft eines Ehepaares bewerten; was dann natürlich eine Freistellung vom Dienst bei nicht eigener Elternschaft ausschließt. Aber wenn der Landtag des Landes Schleswig-Holstein großzügiger sein und die mit der Geburt neu eingetretene Situation im Zusammenleben der (eingetragenen?) Lebenspartner unterstützen will, so ist dagegen nichts einzuwenden. Die von mir aufgestellte Freistellungsforderung ist ja eine in Konfrontation zum Urteil des BVerfGs aufgestellte Minimalforderung. Ein wenig Aufmerksamkeit, aber keine große Erregung, lieferte der Fall, dass die Bundeswehr 1999 einen homosexuellen Zeitsoldaten im Range eines Feldwebels wegen von ihr befürchteten möglichen Autoritätsverlustes nicht als Berufssoldat übernehmen wollte. In diesem ablehnenden Verwaltungsakt (VA) sah das Lüneburger VG einen Verstoß gegen das Willkürverbot oder Gleichbehandlungsgebot und verurteilte die Bundeswehr zur Übernahme dieses Mannes trotz seiner speziellen Männerneigung. Dabei ist nach meiner zweijährigen Erfahrung als Zeitsoldat Anfang der 60-er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Befürchtung der Dienststelle wegen eines möglichen Autoritätsverlustes gar nicht so abwegig: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diesem Feldwebel in der nicht unbedingt auf gesellschaftlichen Schliff hin angelegten Männergesellschaft der Bundeswehr im Konfliktfall durch einen renitenten Untergebenen seine sexuelle Präferenz mit der abschätzigen Kampfansage: „Von einem Arschficker lasse ich mir gar nichts sagen!“, entgegengeschleudert werden könnte! (Pardon! In der - jedenfalls bis 1999 - reinen Männergesellschaft drückte man sich meistens nicht sehr fein aus.) Und alle anderen stehen dabei und feixen! Das zieht, auch wenn der renitente Soldat bestraft wird, unweigerlich einen – bleibenden - Autoritätsverlust nach sich! Die Geschichte einer solchen Auseinandersetzung wird perpetuiert werden, unter Garantie. Ich war lange genug beim Militär, um das genau zu wissen! Die drei letzten von mir gleich angesprochenen innerstaatlichen Fälle zur Gleichbehandlungsproblematik zielen nicht auf den Geschlechterunterschied, sondern haben ganz im Gegenteil die Gleichheit des betroffenen Geschlechts zur Voraussetzung. Es geht im ersten und zweiten der drei Fälle um die Stellung und bisherige Ungleichbehandlung von verheiratet gewesenen aber dann geschiedenen gegenüber unverheirateten Müttern und um den Unterhaltsanspruch gegen den ehelich verbunden gewesenen oder den bewusst nie mit ihnen verheiratet gewesenen Vater ihrer Kinder: „Wilde Ehen vor Gericht Werden uneheliche Kinder vom Gesetzgeber benachteiligt? Karlsruhe soll darüber entscheiden, ob mehr als eine halbe Million betroffene Väter zu wenig Alimenten bezahlen. Deutschlands meistgekaufte Zeitung nannte es vor drei Jahren den "Steffi-Graf-Trend" - das Kinderkriegen ohne Trauschein. Da nichteheliche Kinder ehelichen gleichgestellt seien, "muss also nicht geheiratet werden, damit das Kind versorgt ist", warb "Bild". Den Trend hatte das Blatt richtig erkannt: Während bis dato noch jedes fünfte Kind nichtehelich geboren wurde, ist es heute schon jedes vierte. In den neuen Ländern werden sogar mehr als die Hälfte aller Babys in "wilden Ehen" gezeugt. Tennisstar Steffi Graf indessen heiratete doch noch, vier Tage vor der Geburt des Sprösslings. Ein kluger Schritt: Denn die Absicherung von Mutter und Kind ist ohne Heirat eben doch längst nicht so gut wie mit Trauschein. Die Alimente, die Väter für nichteheliche Nachkommen zu zahlen haben, sind zwar gleich hoch wie für eheliche, die für ihre ledigen Mütter sind es aber mitnichten. Drei Jahre nach der Geburt eines unehelichen Kindes erlischt der Unterhaltsanspruch der Mutter gegenüber dessen Vater; es sei denn, das Kind wäre etwa schwer behindert. Geschiedene dagegen haben Anspruch auf Unterhalt, bis das jüngste Kind 15 Jahre alt ist. So lange 88 soll eine Ex-Gattin den Nachwuchs persönlich betreuen können - die ersten acht Jahre voll, weitere sieben gilt ein Teilzeitjob als zumutbar. Diese gesetzliche Ungleichbehandlung von Müttern sei schlicht "verfassungswidrig", befand jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Hamm. Allerdings nicht wegen etwaiger Diskriminierung von Frauen, sondern weil sich nichteheliche Trennungskinder im Gegensatz zu jenen aus Ehen ab dem dritten Geburtstag Fremdbetreuung gefallen lassen müssten. "Aus Sicht des Kindes", so der Richterspruch, könne es aber "keine Rolle spielen, ob seine Eltern miteinander verheiratet waren oder nicht". Das OLG hat den Fall der Klägerin Heike Preuß, Mutter zweier nichtehelicher Kinder, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Die höchste Instanz hatte die Oberlandesrichter zu dieser Radikalentscheidung ermuntert, als sie im Februar der Verfassungsbeschwerde der Sozialhilfeempfängerin auf Prozesskostenhilfe zur Klärung ihres Falls stattgab. "Die Verfassungsmäßigkeit der unterschiedlichen Ausgestaltung" des Unterhalts je nach Familienstand im Hinblick auf die im Grundgesetz geforderte Gleichbehandlung aller Kinder, stellte Karlsruhe damals fest, sei "fraglich". Die Zweifel der Juristen am geltenden Recht sind in Berlin offenbar als Warnschuss angekommen. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) bereitet eine Reform des Unterhaltsrechts vor, von der auch nicht verheiratete Mütter profitieren. Der Gesetzentwurf soll noch dieses Jahr vorgestellt werden. Die bisherige Schlechterstellung bei den finanziellen Lasten trägt in hohem Maß Vater Staat. Wenn es Müttern nicht gelingt, für sich selbst zu sorgen, beantragen sie Sozialhilfe. So wie Klägerin Preuß aus dem westfälischen Isselburg: "Ich verlange von den Vätern meiner Kinder keinen Cent mehr als vom Sozialamt", argumentiert sie. "Sie sollen ihren Kindern nur das Dach über dem Kopf zahlen." Etwa ein Drittel der unverheirateten Mütter wirtschaftet auf Sozialhilfeniveau - laut einer Studie von 1997 doppelt so viele wie geschiedene. Von den rund eine Million Kindern, die Stütze beziehen, leben knapp 600 000 bei Alleinerziehenden. Die Armut der Betroffenen sei auch der Grund, glaubt der Anwalt der Klägerin, Eckhard Benkelberg aus Emmerich, warum diese relativ selten gegen ihre offenkundige Benachteiligung zu Felde zögen. Der Jurist hat sich darauf kapriziert, die Gleichstellung der geschiedenen mit den ledigen Müttern zu erlangen. Und Benkelberg zeigt sich zuversichtlich: Neben dem Verfassungsgericht hat auch der Bundesgerichtshof (BGH) die Verfahren zweier seiner Mandantinnen angenommen. Im Dezember muss der BGH über die Rechtmäßigkeit einer weiteren Ungereimtheit im Nichtehelichen-Recht befinden: Warum hat ein lediger unterhaltspflichtiger Vater Anspruch auf einen höheren Selbstbehalt als ein verheirateter? Denn: Je mehr er von seinem Einkommen behalten darf, desto weniger bleibt für Mutter und Kind. Eine berechtigte Frage, finden auch Experten wie die Vorsitzende der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstags, die Hamburger OLG-Richterin Jutta Puls. "Kinder fallen nicht vom Himmel", sagt Puls - "und auch die ohne Trauschein nicht." Durch das seit 1995 geltende Gesetz sind in den Augen der Familienrechtlerin keineswegs nur die betroffenen Kinder benachteiligt. Auch zwischen den Eltern sei das Risiko "schief" verteilt: "Der Vater zahlt und macht weiter Karriere, während die Mutter das Kind als Klotz am Bein hat. Selbst im Alter wird sie noch dafür bestraft. Denn der Vater eines nichtehelichen Kindes muss für keinen Rentenausgleich bei der Mutter sorgen." Leidtragende, die bisher gegen diese Benachteiligung klagten, fanden kein Gehör: Das OLG Nürnberg verweigerte einer Mutter, die arbeitslos wurde, weil sie die Unterbringung ihres Kleinkindes und den Job nicht vereinbaren konnte, das Recht auf Unterstützung vom Vater. Begründung: Der Gesetzgeber habe "in Kauf genommen, dass die Notwendigkeit der Betreuung eines gerade drei Jahre alten Kindes eine Mutter in größte Schwierigkeiten bringt, ihren angemessenen Unterhalt selbst zu verdienen". Im vergangenen Jahr urteilte das OLG Koblenz, eine allein erziehende Krankenschwester, die sich mit Familie und Job überfordert sah, könne ja Nachtdienste schieben. Währenddessen könne ihr 15jähriger Sohn das uneheliche Kleinkind beaufsichtigen. Führende Familienrechtler wie der Kölner Experte Helmut Büttner sympathisieren mit der Entscheidung des OLG Hamm, das geltende Unterhaltsrecht als verfassungswidrig einzustufen. Was es aber in der Praxis bringt, wenn Karlsruhe vom Gesetzgeber zu Gunsten der nichtehelichen Kinder Verbesserungen beim Mütterunterhalt einfordert, bleibt einstweilen offen. Betroffene sind skeptisch. "Die Väter sind als Zahlesel überfordert", warnt Peggi Liebisch vom Verband allein erziehender Mütter und Väter. Denn selbst wenn die über eine halbe Million getrennt 89 lebenden Väter unehelicher Kinder mehr zahlen müssten, sei nicht gesagt, dass sie dies auch täten. "Mütterunterhalt wird auch nach Scheidungen in nur zwölf Prozent aller Fälle wirklich geleistet", weiß Liebisch. Die Forderungen der Alleinerziehenden-Lobbyistin: mehr Kindergeld, mehr öffentliche Kinderbetreuung - und diese, bitte schön, "zum Nulltarif". Was nützten schließlich Kindergärten, wenn die Mütter sie nicht bezahlen könnten? ANNETTE BRUHNS“ (Spiegel 11.10.04) Gleicher Unterhalt für Ledige und Geschiedene Karlsruhe - Unverheiratete Mütter dürfen beim Unterhalt für sich nicht besser gestellt werden als Geschiedene. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Danach bekommen Mütter in jedem Fall vom Vater des gemeinsamen Kindes nicht mehr als die Hälfte seines Einkommens. Die Richter stellten damit nicht-eheliche Eltern geschiedenen Eltern gleich (Az: XII ZR 121/03). Laut Unterhaltsrecht hat neben dem Kind auch die Mutter Anspruch auf Unterhalt, wenn sie in den ersten drei Lebensjahren des Kindes nicht arbeitet. dpa (HH A 17.12.04) Der dritte der von mir anzusprechenden und uns noch längere Zeit beschäftigenden Gleichbehandlungsfälle, dieses Mal nur innerhalb des männlichen Geschlechts, betrifft das Problem der Wehrgerechtigkeit mit der Frage der Beibehaltung der Wehrpflicht oder ihrer Abschaffung und die Ersetzung der bisherigen Wehrmachtsstruktur durch die Einführung einer Berufsarmee: Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Blocks, der dadurch verursachten Beendigung des Kalten Krieges, der Aufnahme osteuropäischer Staaten in die NATO und zuletzt der Erweiterung der EU um zunächst neun mittel- und osteuropäische Staaten liegt die BRD in der Mitte der EU und ist rundherum von befreundeten und mit ihr verbündeten Staaten umgeben. Von Freunden umgeben zu sein, kann tödlich enden: das musste schon Caesar erfahren, und Parteipolitiker insbesondere der CDU beklagten ebenfalls ihre politische »Ermordung« durch Parteifreunde aus nächster Nähe. Aber für die Sicherheitslage eines Staates ist solch eine Konstellation nur von Vorteil; damit kann man nicht nur gut mit dem Hinweis auf die uns umgebenden sicheren Drittstaaten den Asylantenstrom abwehren. Die Bedrohungslage der BRD hat sich mit dem politischen Umbau Europas grundlegend zum Positiven verändert. Es ist nicht mehr von der Notwendigkeit einer Landesverteidigung mit großen Panzerverbänden und vielen Infanteriedivisionen auszugehen, die sich in der norddeutschen Tiefebene, im „Kassel-gap“, hereinbrechenden Panzertruppen der Sowjetunion und ihrer im Warschauer Pakt mit ihr Verbündeten entgegenstellen müssten. Im Zuge der Umstrukturierung der Bundeswehr von einer Landesverteidigungs- zu einer weltweit einsatzfähigen Eingriffsarmee – weil die Freiheit Deutschlands (angeblich) am Hindukusch verteidigt werden müsse wurde die Truppenstärke um fast 15 % zurückgefahren. Seitdem braucht man nicht mehr alle zur Verfügung stehenden Wehrpflichtigen: Wer muss nun weiterhin mit seiner Einberufung rechnen und dem Vaterland dienen, wenn – aber diese Zahl ist vermutlich eher der politischen Agitation geschuldet – nach lauthals propagierter Ansicht der Grünen angeblich nur noch 10 % der Wehrpflichtigen überhaupt eingezogen werden können, weil damit die Aufnahmekapazität der Bundeswehr erschöpft sei? Gleichgültig, welche Gründe für oder gegen die Abschaffung der Wehrpflicht aus militärischen und militärpolitischen Erwägungen sprechen – sie sollen an dieser Stelle nicht untersucht werden -, steht nach dem in Art. 3 GG in verschiedenen Variationen zum Ausdruck gebrachten Gleichheitsgrundsatz und insbesondere nach dem 1978 ergangenen klarstellenden Urteil des BVerfGs die „Pflichtgleichheit“ aller (männlichen) Staatsbürger unter dem Gebot des Gleichheitsgrundsatzes des Grundgesetzes. Das BVerfG betonte schon damals ausdrücklich, dass eine Freistellung von der Wehrpflicht durch Nichteinberufung, die sich am jeweiligen Personalbedarf orientiert, gegen den zu beachtenden Gleichheitsgrundsatz verstößt, weil die Wehrgerechtigkeit nicht gewahrt ist, wenn nur eine Minderheit der an sich Wehrpflichtigen der den betroffenen Einzelnen erheblich belastenden Wehrpflicht nachkommen müsse. Die Wehrgerechtigkeit verlange wegen des erheblichen Eingriffs in die persönliche Lebensführung und in die berufliche Entwicklung, dass bei der Erfüllung der Wehrpflicht nicht willkürlich oder ohne sachlich zwingenden Grund unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Die Wehrpflicht dürfe nicht zur Lotterie werden! 90 Unterschi edliche Geltung des Gleichheit ssatzes im öffentlichrechtliche n Bereich von Kirche und Staat 1.3.2.1.2 Unterschiedliche Geltung des Gleichheitssatzes im öffentlich-rechtlichen Bereich von Kirche und Staat Ein Beispiel für die nur bedingte Geltung der Grundrechte bezüglich des Gleichheitssatzes, des Ausgangspunktes unserer Betrachtung, im öffentlich-rechtlichen aber nichtstaatlichen Bereich: Die großen Kirchen müssen in der Bundesrepublik selbst unter der (grundsätzlichen) Geltung des Grundgesetzes nicht Gläubige einer anderen Konfession als der eigenen in ihre Dienste aufnehmen. Das ist nur zu verständlich bei seelsorgerischer Tätigkeit, könnte aber etwas großzügiger gesehen werden, wenn es sich um nichtseelsorgerische Tätigkeit handelt, z.B. bei Psychologen in kirchlichen Beratungsstellen, Lehrern an Schulen konfessioneller Träger, Sozialpädagogen in kirchlichen Sozialeinrichtungen, ... . Anderes, noch augenfälligeres Beispiel: Dem Staat wäre es nicht erlaubt, nur Männer in seinen Dienst aufzunehmen, die katholische Kirche aber verweigert Frauen bislang den Zugang zum Priesterberuf. 1.3.2.1.3 Art. 33 GG als den Staat verpflichtende spezielle Ausgestaltung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes Im Gegensatz zu den Großkirchen muss aber der Staat unter der Geltung des „Art. 33 GG (1) Jeder Deutsche hat in jedem Land die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. (2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. (3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. ..." und der Geltung des schon zitierten Art. 3 III GG einen Deutschen evangelischen, katholischen, jüdischen, islamischen oder buddhistischen Glaubens in gleicher Weise bei einer Bewerbung berücksichtigen und darf nur nach den im Grundgesetz in Art. 33 II genannten Gesichtspunkten "Eignung, Befähigung und fachliche Leistung" seine Auswahl treffen, wobei alle Bewerber die Gewähr dafür bieten müssen, dass sie für die »fdGO«, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, einstehen. Und daran hapert es bei fundamentalistischen Islamisten, die ihren Nachwuchs in der BRD in Koranschulen, in Internaten des Verbandes der islamischen Kulturzentren in der BRD (VIKZ) oder dem Internat der saudiarabisch-islamischen Fachd-Akademie in Bonn heranziehen (Panoramabericht 02.10.03) und die Kopftücher ihrer Frauen als Flagge in ihrem Kampf um die Abschaffung der Trennung von Staat und Religion in einem durch die islamische Religion dominierten Gottesstaat, um die Abschaffung der staatlichen Toleranz zu Gunsten ihrer religiösen Intoleranz, benutzen. Nach der Verfassungstheorie geht es, auf der vorausgesetzten Basis der »fdGO«, also nur um "Eignung, Befähigung und fachliche Leistung". Die Verfassungswirklichkeit sieht natürlich anders aus, denn sonst gäbe es in den Beamtenapparaten nicht immer wieder u.a. die Erscheinungen, die mit dem Schlagwort "Parteienfilz" zu Recht gegeißelt werden. Da werden dann fachliche Gründe vorgeschoben, um politisch nicht genehme Bewerber ablehnen und politisch genehme um sich scharen zu können; was in Spitzenpositionen allerdings berechtigt ist: Ein Minister muss sich darauf verlassen können, dass z.B. sein Staatssekretär seine politische Linie vertritt! Relevanz und öffentliche Aufmerksamkeit über brodelnde Stammtische hinaus erlangte Art. 33 GG in Fragen der Beschäftigung deutscher Frauen muslimischen Glaubens als Lehrerin, wenn sie vor ihren Klassen mit Kopftuch auftreten wollten. Diese zunächst politisch und dann letztlich juristisch zu entscheidende Frage hat sich als eine große Herausforderung für die deutsche Leit- und Rechtskultur herausgestellt: „Soll eine muslimische Lehrerin im Unterricht an einer staatlichen, bekenntnisfreien Schule ihr Haupt in ein Kopftuch gehüllt lassen dürfen? ... Es geht um die Frage, wie religiös der weltliche Staat westeuropäischer Prägung werden darf, ohne seine Identität zu verlieren. Richter Hassemer [Vizepräsident des BVerfGs und Vorsitzender des mit der Entscheidung in dieser Frage befassten Senats; d. Autor] hat schon Recht, wenn er feststellt, ’dass diese Frage Staat und Gesellschaft von Grund auf beschäftigt und auch weiter beschäftigen wird ...’“ (SPIEGEL 29.09.03). In der BRD ist es – im Gegensatz zu z.B. Frankreich und der muslimischen Türkei - klar und (inzwischen) völlig unbestritten, dass der Staat als Ausbildungsmonopolist für den Lehrerberuf diesen »Kopftuch-Lehrerinnen« bis zum Ende ihrer Ausbildung, d.h., bis zur Beendigung des Referendariates, einen Ausbildungsplatz zur 91 Verfügung stellen muss, damit die zweiphasige Lehrerausbildung - mit der ersten Phase des Studiums an einer Universität oder pädagogischen Hochschule und der anschließenden praktischen Phase im Vorbereitungsdienst ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann. Aber was danach? Soll eine solche »Kopftuch-Lehrerin« in den öffentlichen Schuldienst übernommen werden wegen ihres guten Examens sogar übernommen werden müssen, bevor Lehrerinnen mit schlechteren Examensnoten und somit nachgewiesener geringerer fachlicher Eignung und Befähigung eingestellt werden dürfen -, wo wegen des Toleranzgebotes und der aus den Artikeln 4 I, 3 III, 33 III und 140 GG i.V.m. den entsprechenden Artikeln der Weimarer Verfassung folgenden Neutralitätspflicht des Staates der Unterricht ohne jede Art - oder gar latente Gefahr - einer Indoktrination insbesondere kleinerer Kinder weltanschaulich und religiös neutral zu erteilen ist, wie zuletzt in dem 1995 ergangenen »Kruzifix-Urteil« des BVerfGs erneut festgestellt wurde? Allerdings ging es in dem Verfahren um die Kruzifixe in jedem bayrischen Klassenzimmer vorrangig um die Neutralitätspflicht des Staates auf der einen und die Freiheitsrechte von Eltern und Schülern auf der anderen Seite. Zur vorherigen Klarstellung: Die vom BVerfG wiederholt festgestellte weltanschauliche Neutralitätspflicht des Staates bezieht sich auf alle Aspekte staatlichen Handelns, nicht nur auf die in katholisch geprägten Bundesländern lange üblich gewesene Bildung mancher deutscher Landeskinder unter dem Kruzifix: „Recht auf Prozess ohne Kruzifix Saarbrücken – An saarländischen Gerichten darf gegen den Willen nicht christlicher Beteiligten keine Verhandlung mehr unter dem Zeichen des Kruzifixes geführt werden. Das entschied das Landgericht Saarbrücken (Az.: 1 Qs 137/01). (HH A 05.09.01) Das empfindet ein Heutiger in einer - wenigstens in den Städten - zunehmend multikulturell geprägten Gesellschaft als ein angemessenes Urteil. Einen Juristen hingegen muss nicht das Urteil, sondern der Umstand, dass es so gefällt werden musste, erstaunen und empören, denn schon mehr als eine Generation zuvor hatte das BVerfG genau so entschieden! Schwierigkeiten könnten sich für Polizistinnen ergeben, wenn sie wegen der Neutralitätspflicht des Staates »unanständig« gekleidet gegen konservative muslimische Männer vorgehen müssen. Aber Kopftücher tragende Polizistinnen hätten bei den sich oft als »Machos« gebärdenden Konservativen auch kein wesentlich größeres Ansehen. Mit der nicht nur auf Schulen beschränkten grundsätzlichen Neutralitätspflicht des Staates – derentwegen Kruzifixe auch von Richtertischen oder aus Gerichtssälen entfernt werden mussten und z.B. das Justizministerium des Landes Niedersachsen nach dem vom BVerfG ergangenen »Lehrerinnen-Kopftuchurteil« im November 2003 seine Richterinnen und Staatsanwältinnen anwies, dass während des Dienstes kein Kopftuch getragen werden dürfe - soll u.a. eine mit staatlichem Korsett ausstaffierte öffentliche Zur-Schau-Tragung von Religiosität verhindert werden. Für das BVerfG und das BVerwG war bei seinem »Lehrerinnen-Kopftuchurteil« ausschlaggebend, dass Schüler in Fragen von Weltanschauung und Religion nicht zwangsweise mit etwas konfrontiert werden sollen, was sie oder ihre Eltern nicht wollen. Es gilt in dem »Sonderrechtsverhältnis« Schule das vom BVerwG in seiner Entscheidung so genannte „Überwältigungsverbot“: Wer missionieren wolle, habe an öffentlichen Schulen nichts zu suchen. Im Fall der »Kopftuch-Lehrerinnen« kommt aber zusätzlich zu den vorgenannten Gesichtspunkten die grundgesetzlich geschützte Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der einer strengen Islaminterpretation – im Falle der afghanisch gebürtigen Klägerin Ludin, die in »Backfisch«-Jahren in Saudi-Arabien zum Kopftuch bekehrt wurde und später ihren deutschen Ehemann zum Islam bekehrt hat: aus dem Dunstkreis der als potentiell verfassungsfeindlich eingestuften Organisation Milli Görüs - anhängenden muslimischen Lehrerinnen aus Art. 4 GG mit ins Spiel! Hat eine »Kopftuch-Lehrerin« durch Art. 33 III GG „... die Zulassung zu öffentlichen Ämtern ... sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit ... zu einem Bekenntnis ... ein Nachteil erwachsen.“ und Art. 4 I GG „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ 92 möglicherweise sogar einen Rechtsanspruch auf Übernahme als Beamtin? Baden-Württemberg verneinte das mit der Begründung, dass der Koran und damit der Islam nicht zwingend das Tragen eines Kopftuches vorschreibe. Zwar gäbe es in den die Frauen grundsätzlich unterdrückenden Ländern Saudi-Arabien und dem Iran einen strengen Kopftuch-Zwang in der Öffentlichkeit, um die Ehrbarkeit und »Reinheit« einer Frau zu demonstrieren und damit sie nicht als Lockmittel des Teufels auf Männer sexuelle Reize ausübe – „Weil die Muslime ihre Triebe nicht in den Griff bekommen, muss ich ein Kopftuch tragen“, schimpfte in Deutschland eine aufmüpfige türkische Schülerin in einem SPIEGEL-Artikel, weil sie dagegen rebelliert, von ihren Eltern und der Großfamilie zum Tragen eines Kopftuches gezwungen zu sein - , in den meisten arabischen Ländern aber bestehe dieser Zwang nicht; in der durch Atatürk säkularisierten, gleichwohl stark muslimisch geprägten Türkei ist es sogar generell verboten, in öffentlichen Räumlichkeiten ein Kopftuch zu tragen, denn dort wird das Tragen eines Kopftuches als politische Äußerung gewertet. (Schon Atatürk hatte den Türken aufs Haupt geschaut und das Tragen des Fes’ als Symbol für die »alte« Türkei verboten. Nun hat das Kopftuch den Fes als Symbolkleidungsstück der »Ewig-Gestrigen«, der Gottesstaat-Verfechter, abgelöst.) Eine Frau, die in der Türkei gegen das Kopftuch-Verbot verstößt, wird bestraft, muss z.B. die Universität verlassen und ihre akademische Ausbildung abbrechen. Die sich den Gerichten aus dieser Sachlage aufdrängende Schlussfolgerung: Das Tragen eines Kopftuches gehöre also nicht zu den religiösen Pflichten einer Muslimin. Im Koran werde es nicht verlangt. Es gibt, wie in der Sure 33/59, in den religiösen Schriften nur Hinweise, dass Frauen sich außerhalb des Hauses „ehrbar“ kleiden sollten. Überwiegend werde von muslimischen Frauen in deren Heimatländern jedoch kein Kopftuch getragen, wenn sie nicht durch Ehemänner und traditionell geprägte Familien(oberhäupter), religiöse Sittenwächter oder staatliche Strafsanktionen bis hin zur Tötung dazu gezwungen würden. Das Tragen eines Kopftuches (aus behaupteten religiösen Gründen) gehöre nicht zwingend zum Islam! Dem islamischen Fundamentalismus zuneigende Frauen würden aber ein solches Tuch (mehr oder minder) freiwillig tragen. Für sie, so argumentierte die Klägerin Ludin14 in ihren jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit dem 14 Alice Schwarzer in der Frankfurter Rundschau vom 28.5.2003 (gekürzt) „Alice Schwarzer: Der Fall Ludin Die junge Frau kommt aus einer großbürgerlichen afghanischen Familie. Ihr Vater war vor den Sowjets und den Taliban Innenminister, ihre Mutter eine unverschleierte Lehrerin. Im Exil in Riad erschien das Mädchen als 13-Jährige zur Überraschung der eigenen Eltern plötzlich mit Schleier zuhause - der Einfluss in der saudi-arabischen Schule hatte das Seine bewirkt. Mit 18 heiratete Fereshta, die nun mit ihren Eltern in Deutschland lebte, den fünf Jahre älteren Raimund Proschaska, einen zum Islam konvertierten Lehrer. Ab 1993 studiert Ludin dann Pädagogik an der Hochschule in Schwäbisch Gmünd, wo die vom Verfassungsschutz inzwischen verbotene islamistische Milli Görüs besonders präsent ist. In den "Fortbildungskursen", die die muslimische Studentin Ludin für Lehrerinnen gab, dozierte sie, laut einer Teilnehmerin, "deutsche Frauen seien unrein, nur muslimische Frauen seien rein". Ab etwa 1995 weigert Ludin sich, Männern noch die Hand zu geben. 1997 reist sie mit ihrem Mann nach Pakistan. Nach ihrer Rückkehr weigert die Uhland-Schule sich, die verschleierte Lehrerin in die Klasse zu lassen. Seither kämpft Ludin, unterstützt von der als "links" geltenden Lehrergewerkschaft wie von der als "verfassungsfeindlich" verdächtigten Milli Görüs, gegen "das Berufsverbot für praktizierende Muslimas". Die gebürtige Afghanin tut das in einer Zeit, in der in ihrer Heimat Frauen, denen die Burka verrutscht, totgeschlagen werden wie die räudigen Hunde, und Ärzte auch eine todkranke Afghanin nicht behandeln dürfen, weil ein Mann keine Frau anfassen darf. In Deutschland aber wird keine Frau gesteinigt, wenn sie kein Kopftuch trägt. Und seit mindestens 20 Jahren ist der Schleier keine Frage von Tradition oder Glauben mehr, sondern - eine politische Demonstration. Er ist die Flagge des islamistischen Kreuzzuges, der die ganze Welt zum Gottesstaat deformieren will. Wehret den Anfängen! Das lässt sich in diesen Zeiten leider nicht sagen. In Zeiten, in denen muslimische Schülerinnen mitten in Deutschland mit Einverständnis der Schulleitungen von Sportunterricht und Ausflügen suspendiert werden; und es niemanden irritiert an Hamburger Hochschulen, wenn arabische Studenten Frauen nicht mehr die Hand geben.“ Wie solche willkürlichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit der Frauen religiös begründet werden? Für die theologisch verbrämte Missachtung der Rechte der Frauen sind nur ein paar diffamierende Grundannahmen Voraussetzung, dann ergibt sich der religiöse (Trug-)Schluss fast zwangsläufig. Der Islam lehrt, dass Allah Mann und Frau mit einer je eigenen Natur (fitra) geschaffen habe, und dass nur der Islam dem Menschen eine Ordnung anbiete, in der er in Einklang mit seiner jeweiligen Fitra leben könne. Ein Verstoß gegen die Fitra bedeutet eine Versündigung gegen Gott. Weiter ist der islamischen Orthodoxie zufolge die Frau emotional, willenlos und leicht beeinflussbar - obwohl das von der Frau des Propheten und auch von seiner Tochter Fatima nicht gesagt werden kann! Eine seelisch gesunde Frau verlange nach einem Mann, dem sie gehorchen kann und muss. Nach traditionell männlich-islamischer Überzeugung müssen die Frauen mit einem Gen der Unterwerfung geboren sein. Da die "Frauen die Fangschlingen des Teufels sind" (Y. Anwar), ist der Umgang zwischen den Geschlechtern außerhalb der Familie zum Wohle von Mann und Frau nicht erlaubt. Der angemessene Lebensbereich der Frau sei das Haus, ihre Erfüllung finde sie in Ehe und Mutterschaft. Aufgrund seiner überlegenen Fitra soll nun der Mann seine Frau ver- 93 Land Baden-Württemberg, sei das Tragen eines Kopftuches ein wichtiger Ausdruck ihres Glaubens und weiter: Man könne einer Frau nicht ihre demokratische Einstellung und Emanzipation nur deswegen absprechen, weil sie ein Kopftuch trage. Dass dem nicht so sei, beweise ja ihr langjähriger Rechtsstreit durch alle Instanzen. Ohne Emanzipation hätte sie die Entscheidung des Oberschulamtes Stuttgart hingenommen; eine durchsichtige, schwache Argumentation. Man kann auch andersherum argumentieren: Wenn eine Frau nicht emanzipiert ist, dann fügt sie sich starken familiären, gesellschaftlichen und religiösen Pressionen und lässt sich von islamischen Fundamentalisten als Werkzeug in einem jahrelangen juristischen Kampf für deren letztlich auf die Errichtung eines auf Intoleranz ausgerichteten Zieles, den alles Weltliche dominierenden islamischen Gottesstaat, instrumentalisieren. Die Verwaltungsgerichte bis rauf zum BVerwG teilten nicht die Ansicht der Klägerin Ludin: Wer in einem freien Land trotz der dazu nicht bestehenden Pflicht als Symbol seines Glaubens auf dem Tragen eines Kopftuches bestehe, wolle damit etwas ausdrücken, etwas demonstrieren. Durch das Tragen eines Kopftuchs aus religiösen Gründen werde mit aggressivem Geltungsanspruch eine kulturelle Extremposition betont, die unserem auf die Gleichheit der Geschlechter ausgerichteten Verständnis der Frauen in der Gesellschaft widerspreche. Als Beleg kann auf Allah selbst verwiesen werden, der Mohammed durch seinen Erzengel Gabriel als vierte Koransure offenbarend diktiert habe: „Die Männer gehen vor den Weibern, weil Gott ihnen den Vorzug gab, und auch weil sie das Vermögen aufbringen. Ehrbare Frauen sind gehorsam und bewahren das Geheimnis, weil Gott sie bewahrt. Doch wenn ihr bei ihnen Ungehorsam fürchtet, vermahnt sie und scheidet euer Lager von dem ihren und schlagt sie.“ Dieser auf Grund der durch das Tragen eines Kopftuches symbolisierten kulturellen Extremposition bestehende Vorbehalt des Staates wiege schwerer als die Religionsfreiheit der (angeblich) aus (rein) religiösen Gründen auf dem Tragen eines Kopftuches vehement bestehenden Lehrerinnen. Das demonstrativ getragene Kopftuch sei nach Meinung der baden-württembergischen Kultusverwaltung als ein Symbol kultureller Abgrenzung, verweigerter Integration, als Fanal eines intoleranten, die westliche Kultur ablehnenden Islam zu werten und verstoße wegen seiner – von konservativen muslimischen Verbänden vehement bestrittenen - Signalwirkung gegen das manchmal als »Verfassungsfolklore« bespöttelte oder diffamierte Toleranzgebot, auf dessen Einhaltung Schüler und Eltern in unserem Land ein Anrecht haben. Individuelle religiöse wie politische Einstellungen dürften an einer Schule nicht quasi als Monstranz vorangetragen werden. Eine solche Lehrerin einzustellen habe nichts mit Toleranz, sondern mit Pseudo-Toleranz zu tun. Die Verwaltungsgerichte bis rauf zum BVerwG gaben dem Land Baden-Württemberg recht: Die durch ein Kopftuch zum Ausdruck gebrachte Glaubensüberzeugung einer Lehrerin könne Kindern zwischen 4 und 14 Jahren „durchaus vorbildhaft und befolgungswürdig erscheinen.“ Baden-Württemberg habe die Übernahme der »Kopftuch-Lehrerin« in den Schuldienst im Rahmen seines Ermessensspielraumes ablehnen dürfen. Das in solchen Fragen liberalere Hamburg hat hingegen eine kopftuchtragende Lehrerin verbeamtet, NRW ebenfalls einige wenige eingestellt. Das BVerwG entschied 2002 in seinem Grundsatzurteil, dass seiner Ansicht nach das von einer muslimischen Frau im Unterricht getragene Kopftuch ein „deutlich wahrnehmbares Symbol ihrer muslimischen Religion“ sei, das in einer Schule selbst dann nichts zu suchen habe, wenn die Klägerin keine missionarischen Absichten damit verbinde. Die aus Afghanistan stammende, seit 1995 in Deutschland eingebürgerte Lehrerin wurde nicht damit gehört, dass es für sie einer »Entblößung« gleichkäme, wenn sie ohne Kopftuch vor eine Klasse treten müsste: „Die Pflicht zu strikter Neutralität im Bereich der staatlichen Schule wird verletzt, wenn eine Lehrerin im Unterricht ein Kopftuch trägt.“ Wegen der pädagogisch prägenden Funktion, die eine Lehrerin an Grund- und Hauptschulen ausübe, und die die ihr anvertrauten Kinder auch in Opposition zu ihren Eltern treiben könne, dürfe sie den in ihrer Persönlichkeit noch nicht gefestigten Schülern keine bestimmte Glaubensüberzeugung ständig und unübersehbar vor Augen führen. In einer immer mehr von multikulturellen Einflüssen geprägten Gesellschaft gelte das Gebot der Neutralität gegenüber unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen in staatlichen Pflichteinrichtungen umso mehr. Alle Schüler und ihre Eltern haben auf Grund ihrer Religionsfreiheit einen Anspruch darauf, vom Staat nicht dem Einfluss einer fremden Religion, und wenn auch »nur« in Gestalt eines von Menschen ständig vermittelten Symbols, ausgesetzt zu werden. Die Eltern religionsunmündiger Schüler könnten verlangen, dass der Staat sich in religiösen und weltanschaulichen Fragen neutral verhalte, da Art. 6 II 1 GG ausdrücklich bestimme: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ ständnisvoll ertragen und ihre Eigenheiten mit Nachsicht hinnehmen. Dahinter steht ganz nackt das männliche Dominanzstreben. 94 Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Keskin, kommentierte die Entscheidung der Behörden und des BVerwGs als „richtig“: „In der Tat hat das Kopftuch einen Symbolcharakter.“ Man bringe dadurch eine bestimmte – »traditionelle«, politisch »fundamentalistisch« ausgerichtete – religiöse Orientierung zum Ausdruck, die von dem Orientforscher Hans-Peter Raddatz in seinem Buch „Allahs Schleier – Die Frau im Kampf der Kulturen“ mit den Worten charakterisiert wurde: „ Es ist der umfassende Dienst am Mann, der durch Schleier und Verhüllung seinen uniformen Ausdruck erhalten soll.“ Darum dürfe diese gegen den in unserer Verfassung als Grundrecht abgesicherten Gleichheitsgrundsatz verstoßende „islamspezifische“ Haltung nicht ohne weiteres akzeptiert und toleriert werden. Sollte man in staatlichen Schulen ausschließlich das Tragen eines Kopftuches verbieten – und damit alle Muslima unter den Generalverdacht einer fundamentalistisch ausgerichteten Religionsausübung stellen? Was die doch meistens bestreiten und darauf hinweisen, dass sie ja gerade dadurch, dass sie sich durch ihre Berufsausübung dem hiesigen Leben öffnen, zeigen, dass sie einen weltoffenen Islam leben, ihren muslimischen Glauben mit westlicher Lebensart verbinden möchten; woran sie teilweise von ihren »traditionell« eingestellten Familien oder Ehemännern gehindert und zum Tragen des Kopftuches gezwungen werden. Muslime in der CDU gegen Kopftuch-Verbot Union diskutiert über ihr Verhältnis zum Islam. Leitsätze gefordert In der Union kommt die Diskussion über die Rolle der Muslime in Deutschland neu in Gang. Das Deutsch-Türkische-Forum in der CDU verabschiedete "Leitsätze einer christlich-demokratischen Islampolitik für Deutschland". Darin lehnt das Forum unter anderem ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ab. Die CDU-Spitze in Berlin wollte sich zu den Leitsätzen nicht äußern. Bislang hat sich die CDU klar für ein Kopftuch-Verbot zum Beispiel für Lehrerinnen ausgesprochen. Die baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan sieht das Kopftuch als politisches Bekenntnis. Es sei ein "Symbol kultureller Abgrenzung und Teil der Unterdrückungsgeschichte der Frau". Auch CDU/CSU-Fraktionsvize Friedrich Merz akzeptiert "das Tragen von Kopftüchern aus religiösen Gründen" an Schulen nicht. Das Deutsch-Türkische Forum stellt sich also gegen die bisherige Parteilinie. Das Forum ist bislang auf Nordrhein-Westfalen begrenzt. Zum Jahresende wird daraus die Deutsch-Türkische Union entstehen, in der dann bundesweit Türken Mitglied werden können. Rund 2000 türkischstämmige Deutsche sind derzeit Mitglied der CDU. Ziel der Union ist es, künftig die muslimischen Wählerschichten besser zu erschließen. … (DIEWELT 29.08.04) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied 2001 im Fall einer klagenden schweizerischen Lehrerin ebenfalls gegen diese »Kopftuch-Lehrerin« und billigte die ablehnende Haltung der Schweizer Behörden. Ich habe aber noch nie gehört, dass ein an einer Halskette getragenes Kreuz hätte abgenommen werden müssen. Die in den meisten Bundesländern Deutschlands geltende, alle Religionen und Religionsausprägungen umfassende Neutralitätspflicht15 des Staates kennt heutzutage - jedenfalls außerhalb Baden-Württembergs und Bayerns - keinen christlichen Kulturbonus, der – im Gegensatz zum Kulturmalus einer beim Unterrichten aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragenden Muslimin - das Tragen christlicher Symbole durch Lehrer oder deren demonstratives Zeigen in Klassenräumen für Schüler hinnehmbar oder hinnehmbarer machen würde, weil diese Religion bei uns schon seit mehr als einem Jahrtausend heimisch ist und unsere Kultur entscheidend geprägt hat. Ähnlich verhält es sich mit dem Davidstern: Ich habe noch nie gelesen oder gehört, dass einer jüdischen Lehrerin ihre diesbezügliche Busenzierde mit einem Hinweis auf die nach dem Beamtenrecht ihr obliegende Neutralitätspflicht verboten worden wäre. Und so nehmen die Bundesländer, die eine gesetzliche Regelung anstreben, die grundsätzliche Position ein: Jesus am Kreuz zwischen den wogenden Brüsten oder ein Davidstern als kleiner Schmuck oder diskretes Bekenntnis an Hals oder Handgelenk: ja; Mohammed auffallender, da auf dem Kopf: nein! Diskrete Zugehörigkeitssymbole zu einer Religion: ja; ostentativ bis provokativ zur Schau gestellte Religionssymbole hingegen: nein. 15 Einige »katholischere« Länder sehen das anders; Baden-Württemberg z.B. hat, wie auch viele andere Landesverfassungen ab 1945, nach der entmenschlichten Gewaltausübung der Nazis zum staatlichen Neuanfang auf dezidiert christlicher Basis als Schutz gegen ideologisch verbrämte menschenmordende Inhumanität »expressis verbis« in seiner Landesverfassung das Postulat einer Erziehung zu christlichen Werten aufgestellt und – im Gegensatz zu den anderen Bundesländern - bislang beibehalten. Art. 12 I LV B-W: „Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe ... zu erziehen.“ 95 Einige Bundesländer haben Schwierigkeiten mit dieser Position und wollen dem Christentum wegen seiner jahrtausende langen Verwurzelung in unserem Kulturkreis Sonderrechte zugestehen und außerhalb des Religionsunterrichts Mönche in Kutte, Nonnen im Habit und Juden mit der Kipa trotz des für staatliche Schulen geltenden Neutralitätsgebotes weiterhin bekleidet mit einem Kleidungsstück unterrichten lassen, das ihre Religionszugehörigkeit sehr augenscheinlich deutlich macht. Diese Position ist aber fragwürdig und wird in Karlsruhe - wenn überhaupt - nur sehr schwer durchzuhalten sein! Wo soll für muslimisch gekleidete Lehrerinnen die Grenze sein? Schon beim Kopftuch? Oder erst beim Tschador – nicht wesentlich verhüllender wie der Habit einer Nonne - oder gar erst bei der Burkha, die aus »religiösen« Gründen in der Schule zu tragen eine in Deutschland unterrichtende Muslimin ja ebenfalls beanspruchen könnte, wenn die Bekleidung frei wählbar wäre? Oder selbst bei einer religiös motivierten Ganzkörperverhüllung nicht? Auch wenn dahinter ein für uns nicht akzeptables Bild von der Gesellschaft steckt? Wir haben aber durch die Geschehnisse während der Weimarer Republik gelernt, dass es keine schrankenlose Freiheit geben darf, die von Feinden der Freiheit zur Abschaffung der Freiheit genutzt werden kann und auch genutzt worden war! So hatte der spätere Reichspropagandaminister Goebbels fünf Jahre vor der dann erst 1933 erfolgten „Machtübernahme“ schon 1928 als Herausgeber des „Angriff“ geschrieben und als NSDAP-Gauleiter von Berlin gesagt – und jeder hatte es lesen und hören können, viele hatten es gelesen und gehört und daraufhin nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen die NSDAP gewählt: „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit deren eigener Gesinnung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. … Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf in eine Schafherde einbricht, so kommen wir.“ Das soll nie wieder möglich sein! Darum gilt jetzt als äußerste Schranke der bei uns zulässigen demokratischen Freiheit die im Grundgesetz geregelte und ihm immanente »fdGO«, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Gemeinwesens. Wie sollen in unserer vom GG vorgegebenen Wertordnung der „wehrhaften Demokratie“ mit u.a. der Geltung des Gleichheitssatzes die religiösen Bekleidungssymbole einiger durch eine entsprechende Regelung bevorrechtigter Religionsgemeinschaften juristisch unangreifbar zugelassen werden und andere nicht? Es wäre doch nur Wortklauberei, wenn man zur bevorrechtigten Abgrenzung der eigenen Religion und damit gleichzeitig verbundenen Ausgrenzung der anderen Glaubensüberzeugungen in seit fast 1.500 Jahren hier beheimatetes christliches »Brauchtum« einerseits und neu hinzugekommene »religiöse Symbole« anderer Religionen unterscheiden wollte! Eine solche Differenzierung wäre nicht jedem verständlich zu machen; am wenigsten hoffentlich den „Richterkönigen“ des BVerfGs. Eine solche Differenzierung ist unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes äußerst angreifbar, sie ist wohl nicht zu halten! Darum muss man, wenn man sie trotzdem per Gesetz durchzusetzen versucht, sich um eine irgendwie geartete (Schein-)Rechtfertigung mühen. Die bayerische Kultusministerin sprach von einem „Verbot von Symbolen, die sich gegen die Wertordnung des Grundgesetzes und die Bayerische Verfassung richten oder geeignet sind, den Schulfrieden zu stören“. Und: „Die Kirchen haben sich immer eindeutig zum Grundgesetz bekannt. Kopftücher aber sind in einigen Ländern im Unterricht verboten, weil sie als Symbol einer fundamentalistischen Grundhaltung gelten.“ BAYERN Landtag verbietet Kopftuch für Lehrerinnen München · 11. November · dpa/kna · Muslimischen Lehrerinnen in Bayern wird zum Jahresbeginn 2005 das Tragen eines Kopftuches an öffentlichen Schulen verboten. Der Landtag beschloss mit den Stimmen der CSU-Mehrheit eine Änderung des Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. Das Gesetz verbietet nicht ausdrücklich das Kopftuch, sondern religiöse Symbole und Kleidungsstücke, die als eine "mit den verfassungsrechtlichen Grundwerten unvereinbare Haltung" verstanden werden könnten. Die Kopfbedeckung katholischer Nonnen ist laut CSU nicht davon betroffen, weil die christlichen Kirchen fest zu den Grundwerten der Verfassung stünden. Bislang gab es in Bayern keinen einzigen Fall einer muslimischen Lehrerin, die ein Kopftuch trägt. (FR 12.11.04) „Von der Türkei lernen, heißt siegen lernen!“, ist man geneigt, in Abwandlung des ehemals in der DDR 96 bezüglich des großen Bruders Sowjetunion meist gebrauchten Mottos zu formulieren. Mit dieser Begründung der bayerischen Kultusministerin würden dezidiert christliche Erscheinungsformen wie das Kruzifix in jedem Klassenzimmer, wenn niemand dessen Entfernen ausdrücklich verlangt, und im Habit (Ordenstracht mit großem Kreuz an einem auffällig großen Rosenkranz) unterrichtende Nonnen von der als Verteidigungswall gegen islamische Einflüsse hochgehaltenen Neutralitätspflicht ausgenommen. Kopftücher aber sind des Teufels. Wir sehen: Es kommt immer darauf an, wer die Definitionsmacht hat und wie sie genutzt wird, damit nicht »einer usrer Leit« in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Saarland will ein entsprechend ablehnendes Gesetz formulieren und assistiert den bayerisch-regierungsamtlichen Begründungen: „Kopftücher sind eine bewusste Abkehr von den Werten, auf denen unsere Demokratie beruht und ein Zeichen der Intoleranz.“ Das lässt sich, wenn man will, ohne weiteres nachvollziehen - hebelt aber nicht eine strenge Neutralitätspflicht aus, die bisher in überwiegend katholischen Bundesländern durch dezidiert christliche »Überwältigung« verletzt wurde: Nicht ohne Grund gibt es den diesen Missstand charakterisierenden Witz, dass der Vater des kleinen Fritzchens von Berlin nach Süddeutschland versetzt wird und die Berliner Göre nun einem sehr katholisch geprägten Umfeld ausgesetzt ist. Als die Biologielehrerin in einer Stunde fragt: „Was ist das: Es ist braun, hat einen großen buschigen Schwanz und hüpft von Baum zu Baum?“, meldet sich die hellwache Großstadtpflanze und berlinert: „Ick würd ja sajen, det is ’n Eichhörnchen, aber wie ick den Laden hier inzwischen kenne, is det dat liebe Jesulein.“ Ohne den gut erfundenen Witz wurde die dezidiert christliche »Überwältigung« in insbesondere den Vorkommnissen deutlich, die zu dem „Kruzifix-Urteil“ des BVerfGs geführt hatten. Aus Gründen der Neutralitätspflicht war - auch in dem großstädtisch-liberalen Hamburg - bisher nur gegenüber Bhagwan-Jüngern, die die roten Jacken und Halsketten ihrer indischen Sekte im Unterricht getragen hatten, ein Bekleidungsverbot ergangen. Ein »liberal« eingestelltes oder in täglichen Auseinandersetzungen mit sich nicht unbedingt nach der »deutschen Leitkultur« verhaltenden Ausländern »gehärtetes« Bundesland wird durch das Urteil des BVerwGs nicht verpflichtet, seine »gewährendere« Haltung aufzugeben. Das BVerwG hat nur durch Urteil festgestellt, dass eine im Unterricht ein Kopftuch tragende Lehrerin ihre Anstellung nicht erzwingen könne. Das ist ein Unterschied! Mit der Entscheidung des BVerwGs war nunmehr der Rechtsweg zum BVerfG eröffnet. Und u.a. das Land Hamburg mit einer beamteten, im Unterricht ein Kopftuch tragenden Muslimin wartete erst einmal ab, ob und wie der Rechtsstreit weiterging, bevor es bezüglich seiner mit einem Syrer verheirateten und daraufhin zum Islam konvertierten deutschen Lehrerin entscheiden wollte, wie es weitergehen solle. Ein Richter des BVerfGs stellte in der dem Urteilsspruch vorangehenden Anhörung die Frage: „Wie viel fremde Religiosität glauben wir uns in unserer Gesellschaft leisten zu können?“ Das ist der Kern des Problems! Und man kann ja nicht sagen, dass der in unserem Land gelebte Islam immer harmlos sei! Dafür muss man nicht unbedingt auf die selbsternannten „Kalif(en) von Köln“ verweisen. Auch unterhalb der Schwelle von religiös gegründeten Straftaten wirkt der Islam durch manche seiner Interpreten ausgesprochen aggressiv: Dem SPIEGEL vom 29.09.03 verdanken wir den Hinweis auf ein in Deutschland ergangenes »Kamel-Fatwa«: Ohne männlichen Anstandswauwau dürfe sich eine muslimische Frau nur 81 Kilometer von ihrer Wohnung entfernen, das ist genau die Strecke, die eine Kamelkarawane(!!) in 24 Stunden zurücklegen kann. Diese Regelung wurde nicht in einem erzkonservativen islamischen Land wie Saudi-Arabien oder dem Iran getroffen, dieses Fatwa wurde als Verhaltensmaßregel für unter uns lebende muslimische Frauen vom Islamgelehrten Amir Zaidan, dem ehemaligen Vorsitzenden der Islamistischen Religionsgemeinschaft in Hessen, erlassen! Solche Leute üben mit ihren Ansichten den gesellschaftlichen Druck aus, der auch bei uns viele Musliminnen zum Kopftuch greifen lässt oder zum Tragen eines Kopftuches zwingt. Und eine sehr bewusst auf dem religiös motivierten Tragen eines Kopftuches bestehende Muslimin begehrte durch alle ihr möglichen Gerichtsinstanzen ihre Verbeamtung als Lehrerin in Baden-Württemberg. Schließlich war der Rechtsstreit nach fünf Jahren beim BVerfG rechtshängig. Das BVerfG war dann in seiner Entscheidung vom 24.09.03 gespalten. Mit fünf gegen drei Stimmen erkannte es für Recht, dass das Land Baden-Württemberg die Religionsfreiheit der ihre Einstellung in den Staatsdienst begehrenden Muslimin verletzt habe, da bislang eine - von der Mehrheit der Richter für erforderlich gehaltene hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage für eine solche Ablehnung fehle. Das Tragen eines Kopftuchs stehe laut dem im Urteil zum Ausdruck kommenden Mehrheitsvotum unter dem Schutz der Religionsfreiheit der Klägerin. Weiter müsse nach dem Grundgesetz der Zugang zu öffentlichen Ämtern unabhängig von der 97 Religionszugehörigkeit gewährt und gewahrt werden. Andererseits müssten sich Staat und Schulen – anders als Privatleute - in religiös-weltanschaulichen Dingen neutral verhalten. Schließlich müsse das Erziehungsrecht der Eltern und die negative Religionsfreiheit von Eltern und Schülern beachtet werden, von religiösen Kulten und Symbolen verschont zu werden. In diesem "unvermeidlichen Spannungsverhältnis" der Abwägung der Grundrechte der Betroffenen sei es nach unserem föderalistischen Staatsaufbau mit der grundsätzlichen Gesetzgebungskompetenz und der Kulturverwaltungshoheit bei den Ländern – O-Ton BVerfG: "Das Grundgesetz lässt den Ländern im Schulwesen umfassende Gestaltungsfreiheit", „wieweit der Gesetzgeber auf die gewachsene religiöse Vielfalt reagiert, bleibt ihm überlassen“ - Aufgabe des jeweiligen Landesgesetzgebers, in einem hoch komplizierten Abwägungsprozess unter Beachtung der verfassungsimmanenten Schranken16 "einen für alle zumutbaren Kompromiss zu suchen". In der zunehmenden religiösen Pluralität in unserem Staat sei der Streit um das aus religiösen Gründen getragene Kopftuch Anlass für eine Neubestimmung des "zulässigen Ausmaßes religiöser Bezüge in der Schule", forderte das Gericht. Und diese Klärung könne nach dem Urteilsspruch keine Sache von Gerichten oder Behörden sein, sondern gehöre in die Parlamente. Der Landesgesetzgeber dürfe dabei innerhalb eines "Gestaltungsspielraumes im Blick auf besondere kulturelle Traditionen" unter Berücksichtigung der Schultradition, der konfessionellen Zusammensetzung der Bevölkerung und ihrer mehr oder minder starken religiösen Verwurzelung unterschiedliche Regelungen vorgeben, die, wie das Gericht ausdrücklich betonte, von der Ablehnung des Tragens von Kopftüchern aus religiösen Gründen bis zu ihrer Gestattung reichen könne. Würde - was jedes Bundesland für sich tun könne und rund die Hälfte aller Bundesländer zu tun angekündigt hat17 - eine solche gesetzliche Grundlage geschaffen, durch die das unvermeidliche Spannungsfeld zwischen der Glaubensfreiheit einer Lehrkraft und der staatlichen Pflicht zu weltanschaulich-religiöser Neutralität geregelt wird, wäre auch eine Ablehnung des religiös motivierten Tragens von Kopftüchern rechtens. Der "Gesetzesvorbehalt" der Verfassung verlange nur, dass der Repräsentant des Souveräns, das Parlament, einen so schwierigen gesellschaftlichen Konflikt behandle. Die »Richter-Könige« des BVerfGs gaben aber – leider? – keinerlei konkrete Hinweise, was in einem solchen »Kopftuch-Gesetz« geregelt werden solle und welche Grenzen außer den immer geltenden „verfassungsimmanenten Schranken“ dabei zu beachten seien. Bei den vermutlich sehr unterschiedlichen landesgesetzlichen Regelungen, die nun wohl ergriffen werden, ist eine Klageflut vor zunächst die Landesverfassungsgerichte und das BVerwG und zuletzt abermals vor das BVerfG abzusehen, die das BVerfG durch sachdienliche Hinweise von vornherein hätte eindämmen können; und wegen des absehbaren weiteren Verlaufs dieses Rechtsstreites hätte eindämmen sollen. Gesetzgeber können nicht über die Verfassungsgemäßheit der von ihnen beschlossenen Gesetze bestimmen. Eine solche Interpretation muss ausschließlich - unser oberstes Gericht vornehmen. Darum hätte es das gleich tun sollen. Nach Meinung der in der Abstimmung unterlegenen Richter war die Sache entscheidungsreif und eine Entscheidung wäre sachdienlich gewesen: Wenn auf Grund der nun zu schaffenden Landesgesetze eine Muslimin vor dem BVerfG wegen Verletzung ihres Grundrechtes klagt, kann sich Karlsruhe nicht mehr wegducken, sondern muss entscheiden. Da hätte man gleich die Leitlinien für die zu schaffenden Gesetze aufzeigen und so heraufziehende Klagen eventuell verhindern können. Die »Minderheitsrichter« zerpflücken in ihrem Sondervotum die Argumente der »Mehrheitsrichter«, u.a. weil diese die verfassungsrechtliche Grundsatzfrage nach der staatlichen Neutralität im Bildungs- und Erziehungsraum der Schule unentschieden gelassen haben. Nach der Meinung der »Minderheitsrichter« sei das von der Klägerin "begehrte kompromisslose Tragen des Kopftuchs" mit dem "Mäßigungs- und Neutralitätsgebot eines Beamten nicht vereinbar", betonten die drei von der Senatsmehrheit abweichenden Richter in ihrem Minderheitsvotum. Der zu der Zeit amtierende Bundestagspräsident Thierse schloss sich dieser Meinung in einer für sein hohes Amt befremdlichen Wortwahl an: Er schimpfte das Urteil „enttäuschend und eigentümlich feige“; andere Kritiker des Urteils sprachen von einer „Rechts-“ oder einer „Entscheidungs-Verweigerung“ durch das Zurückspielen des 16 Die meisten Grundrechte unterliegen in ihrer Ausübung einem Gesetzesvorbehalt und sich daraus ergebenden gesetzlich fixierten Beschränkungen, nur sehr wenige werden ohne in der Verfassung formulierte oder vorgesehene Einschränkungen »vorbehaltlos« gewährt. Dazu gehört u.a. die Religionsfreiheit. Trotzdem werden auch die bei unbefangener Betrachtung für schrankenlos gewährt gehaltenen Grundrechte nicht schrankenlos gewährt: »Forschung und Lehre« und die »höchstrichterliche Rechtsprechung« haben herausgearbeitet, dass es auch für die in der jeweiligen Formulierung schrankenlos gehaltenen Grundrechte Schranken gibt, die sich aus der Gesamtschau und Gesamtwürdigung der Verfassung ergeben, die also „verfassungsimmanent“ sind. Diese schwierige juristische Konstruktion ist auch sinnvoll, denn sonst könnte unter Hinweis auf die in Art. 4 GG schrankenlos formulierte Bekenntnis- und Religionsausübungsfreiheit z.B. der Sati-Brauch der Witwenverbrennung praktiziert werden. 17 Ein gesetzliches Kopftuch-Verbot erwogen daraufhin: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und das Saarland. Der Meinungsbildungsprozess ist aber noch nicht überall abgeschlossen. 98 juristischen Balles in den politischen Raum. Der Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofes, der vielleicht bald in dieser Frage auf Landesebene zu entscheiden hat, wenn in NRW ein entsprechendes Gesetz geschaffen und dagegen geklagt werden sollte, meinte: Das Karlsruher Urteil verdiene als Urteil unseres obersten Gerichts Respekt, aber keine Zustimmung, weil es kein Wort zur „religiös begründeten Degradierung der Frau“ wage; ein unvorsichtiges, ein keckes Wort für einen Richter, der wegen solcher frühen vorlauten Äußerungen im Vorfeld einer von ihm später möglicherweise zu entscheidenden Frage dann, wenn es zum diesbezüglichen Verfahren kommen sollte, problemlos als befangen abgelehnt werden kann – oder sich selbst für befangen erklären muss! Nun muss jeder Landesgesetzgeber für sich die Gretchenfrage: „Wie hältst du es mit der Religion?“, beantworten. Weil die Diskussion in unserem Land bezüglich des Problems der »Kopftuch-Lehrerinnen« mit diesem Urteil und seinem Verweis auf mögliche Länderregelungen erst begonnen hat und das Sondervotum in der nun aufbrechenden politischen Diskussion einige bedenkenswerte Gesichtspunkte dazu enthält, nachfolgend ein zusammengekürzter Auszug daraus: „Wer Beamter wird, stellt sich in freier Willensentschließung auf die Seite des Staates. Der Beamte kann sich deshalb nicht in gleicher Weise auf die freiheitssichernde Wirkung der Grundrechte berufen wie jemand, der nicht in die Staatsorganisation eingegliedert ist. In Ausübung seines öffentlichen Amtes kommt ihm deshalb das durch die Grundrechte verbürgte Freiheitsversprechen gegen den Staat nur insoweit zu, als sich aus dem besonderen Funktionsvorbehalt des öffentlichen Dienstes keine Einschränkungen ergeben. Der beamtete Lehrer unterrichtet auch im Rahmen seiner persönlichen pädagogischen Verantwortung nicht in Wahrnehmung eigener Freiheit, sondern im Auftrag der Allgemeinheit und in Verantwortung des Staates. Beamtete Lehrer genießen deshalb bereits vom Ansatz her nicht denselben Grundrechtsschutz wie Eltern und Schüler: Die Lehrer sind vielmehr an Grundrechte gebunden, weil sie teilhaben an der Ausübung öffentlicher Gewalt. Der freiwillige Eintritt in das Beamtenverhältnis ist eine vom Bewerber in Freiheit getroffene Entscheidung für die Bindung an das Gemeinwohl und die Treue zu einem Dienstherren, der in der Demokratie für das Volk und kontrolliert durch das Volk handelt. Wer Beamter werden will, darf deshalb das Gebot der Mäßigung und der beruflichen Neutralität nicht ablehnen, weder generell noch in Bezug auf bestimmte, vorweg erkennbare dienstliche oder außerdienstliche Konstellationen. Mit diesen Pflichten ist jedenfalls nicht zu vereinbaren, dass der Beamte den Dienst im Innenverhältnis prononciert als Aktionsraum für Bekenntnisse, gleichsam als Bühne grundrechtlicher Entfaltung nutzt. Die ihm übertragene Aufgabe besteht darin, dem demokratischen Willen, d.h. dem Gesetzeswillen und dem der verantwortlichen Regierung fachlich, sachlich, nüchtern und neutral zur Wirksamkeit zu verhelfen und als Individuum dort zurückzustehen, wo seine Ansprüche auf Verwirklichung der Persönlichkeit geeignet sein können, Konflikte im Dienstverhältnis und damit Hindernisse für die Verwirklichung demokratisch gebildeten Willens zu erzeugen. Wer Beamter werden will, muss sich mit dem Verfassungsstaat in wichtigen Grundsatzfragen und bei der Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben loyal identifizieren, weil umgekehrt auch der Staat durch seinen öffentlichen Dienst repräsentiert und deshalb mit dem konkreten Bediensteten identifiziert wird. Von dieser Idee der Gegenseitigkeit und der Nähe sind alle Grundsätze des Berufsbeamtentums beherrscht. Grundrechtliche Freiheitsansprüche eines Beamten oder des Bewerbers um ein öffentliches Amt sind deshalb von vornherein nur insoweit gewährleistet, als sie mit diesen Sachgesetzlichkeiten vereinbar sind. Die Eignungsbeurteilung im Rahmen des speziellen Gleichheitsrechts aus Art. 33 Abs. 2 GG darf nicht mit einem Eingriff in die Freiheitssphäre des Art. 4 Abs. 1 GG verwechselt werden. Voraussetzung und gleichsam Normalfall klassischer Freiheitsrechte ist ein Eindringen der öffentlichen Gewalt in die Sphäre des Bürgers. Davon weichen diejenigen Konstellationen ab, in denen der Bürger auf den Staat zugeht, von der Allgemeinheit Leistungen einfordert oder ihr seine Dienste anbietet. Nicht die öffentliche Gewalt dringt hier in die Gesellschaft ein, sondern Grundrechtsträger suchen die Nähe zur staatlichen Organisation, erstreben deren Handeln, suchen eine Rechtsbeziehung. Verbietet der Staat jemandem das zumindest auch religiös motivierte Tragen des Kopftuches auf einem öffentlichen Platz, greift er zweifellos in das Grundrecht der Religionsfreiheit ein. Möchte der 99 Art. 33 GG als den Staat verpflicht ende spezielle Ausgestaltung des allgemein en Gleichheit sgrundsat zes Beamte dagegen in einem bereits von der Verfassung als neutral bestimmten Bereich - hier im Unterricht einer staatlichen Pflichtschule - und als Repräsentant der Allgemeinheit religiös begriffene Zeichen setzen, so übt er nicht eine ihm als Individuum zustehende Freiheit im gesellschaftlichen Raum aus. Die Freiheitsentfaltung des Beamten im Dienst ist von vornherein durch die Sachnotwendigkeiten und vor allem die verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Amtes begrenzt - anders würde die Verwirklichung des Volkswillens an einem Übermaß an Freiheitsansprüchen der Repräsentanten des Staates scheitern. Bei der Wahrnehmung des Schuldienstes hat der Lehrer die Grundrechte der Schüler und ihrer Eltern zu achten, er steht nicht nur auf der Seite des Staates, der Staat handelt durch ihn. Wer den Beamten, abgesehen von Statusfragen, als uneingeschränkt grundrechtsberechtigt gegenüber seinem Dienstherren sieht, löst die um der Freiheit von Kindern und Eltern willen gezogene Grenze zwischen Staat und Gesellschaft auf. Er nimmt damit in Kauf, dass die Durchsetzung demokratischer Willensbildung erschwert wird und ebnet stattdessen einer schwer kontrollierbaren juristischen Abwägung zwischen Grundrechtspositionen von Lehrern, Eltern und Schülern den Weg. Wer ein öffentliches Amt erstrebt, sucht im status activus die Nähe zur öffentlichen Gewalt und begehrt - wie die Beschwerdeführerin - die Begründung eines besonderen Dienst- und Treueverhältnisses zum Staat. Diese besondere, durch Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich abgesicherte Pflichtenstellung überlagert den grundsätzlich auch für Beamte geltenden Schutz der Grundrechte (vgl. BVerfGE 39, 334 <366 f.>), soweit Aufgabe und Zweck des öffentlichen Amts dies erfordern. Dementsprechend gewährt auch der aus Art. 33 Abs. 2 GG folgende staatsbürgerliche Anspruch gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern nur, wenn der Bewerber die Tatbestandsvoraussetzungen des grundrechtsgleichen Rechts - Eignung, Befähigung, fachliche Leistung - erfüllt. Der Dienstherr ist befugt und von Verfassungs wegen verpflichtet, die Eignung eines Bewerbers für ein öffentliches Amt festzustellen (Art. 33 Abs. 2 GG). Die im Rahmen der Ermessensentscheidung vorzunehmende Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ist ein Akt wertender Erkenntnis, der vom Gericht nur beschränkt darauf zu überprüfen ist, ob die Verwaltung der Beurteilung einen unrichtigen Sachverhalt zu Grunde gelegt und ob sie den beamtenrechtlichen und verfassungsrechtlichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat. Im Übrigen ist die Nachprüfung, da es keinen Anspruch auf Übernahme in das Beamtenverhältnis gibt, auf die Willkürkontrolle beschränkt (vgl. BVerfGE 39, 334 <354>). Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Eignung erfordert eine Prognoseentscheidung, wobei der Dienstherr die Gesamtheit der Eigenschaften, die das jeweilige Amt von seinem Inhaber fordert, umfassend zu bewerten hat (vgl. BVerfGE 4, 294 <296 f.>; BVerwGE 11, 139 <141>). Hierbei hat der Dienstherr auch zu prognostizieren, ob der Bewerber zukünftig seine Dienstpflichten in dem angestrebten Amt erfüllen wird. Zur Eignung zählt nicht nur die Gewähr, dass der Beamte den fachlichen Aufgaben gewachsen ist, sondern auch, dass er in seiner Person die grundlegenden Voraussetzungen erfüllt, die für die Wahrnehmung eines übertragenen öffentlichen Amtes unabdingbar sind. Zu diesen Voraussetzungen, die Art. 33 Abs. 5 GG mit Verfassungsrang schützt, rechnet die Gewähr für eine neutrale Wahrnehmung der dienstlichen Aufgaben des Beamten. Welches Maß an Zurückhaltung und Neutralität vom Beamten im Einzelfall verlangt werden darf, bestimmt sich nicht nur aus allgemeinen Grundsätzen, sondern auch aus den konkreten Anforderungen des Amtes. Der Staat und seine Organe sind nach Art. 4 Abs. 1 GG sowie aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1, Art. 33 Abs. 3 und Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 136 Abs. 1, 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV verpflichtet, sich in Fragen des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses neutral zu verhalten und nicht den religiösen Frieden in der Gesellschaft zu gefährden (BVerfGE 105, 279 <294>). Auch deshalb muss der Beamte bereits beim Zugang zum öffentlichen Dienst von Verfassungs wegen die persönliche Gewähr für ein neutrales, nicht provozierendes oder herausforderndes Verhalten im Rahmen der künftigen Amtsführung bieten (Art. 33 Abs. 5 GG). Die allgemeine Neutralitätspflicht gilt in besonderem Maße für Beamte, die das Amt des Lehrers an öffentlichen Schulen ausüben. Lehrer erfüllen den Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates (Art. 7 Abs. 1 GG). Sie haben dabei die unmittelbare pädagogische Verantwortung für den Unterricht und die Erziehung der Schüler. Auf Grund ihrer Funktion werden sie in die Lage versetzt, in einer den Eltern vergleichbaren Weise Einfluss auf die Entwicklung der anvertrauten Schüler zu nehmen. Damit verbunden ist eine Einschränkung des grundrechtlich garantierten Erziehungsrechts der Eltern (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG), die nur hingenommen werden kann, wenn sich die Schule um größtmögliche Objektivität und Neutralität nicht nur im politischen, sondern auch im religiösen und weltanschaulichen Bereich bemüht. Dies gilt auch deshalb, weil den Eltern nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 100 GG das Recht zur Kindererziehung auch in religiöser und weltanschaulicher Hinsicht zusteht und diese für falsch empfundene Glaubensüberzeugungen grundsätzlich von ihren Kindern fern halten können (vgl. BVerfGE 41, 29 <48>; 41, 88 <107>). Die Beachtung dieser Rechte gehört zu den wesentlichen bereits vom Grundgesetz geforderten Aufgaben der Schule; sie bestimmen zugleich spiegelbildlich die von den Lehrern zu beachtenden Dienstpflichten. Eine Lehrerin an einer Grund- oder Hauptschule verstößt gegen Dienstpflichten, wenn sie im Unterricht mit ihrer Kleidung Symbole verwendet, die objektiv geeignet sind, Hindernisse im Schulbetrieb oder gar grundrechtlich bedeutsame Konflikte im Schulverhältnis hervorzurufen. Das von der Beschwerdeführerin begehrte kompromisslose Tragen des Kopftuchs im Schulunterricht ist mit dem Mäßigungs- und Neutralitätsgebot eines Beamten nicht zu vereinbaren. Die Schulverwaltung hat ausweislich des Protokolls der Eignungsgespräche und nach den Bekundungen in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht durchaus Verständnis für die Glaubensüberzeugung der Beschwerdeführerin gezeigt; die Beschwerdeführerin hat umgekehrt aber ersichtlich dem Neutralitätsanliegen des Dienstherren kein Verständnis entgegengebracht. Sie hat sich - abgesehen von Extremfällen wie unmittelbar drohender Gewalt außer Stande gesehen, auf ein Symbol von starker religiöser und weltanschaulicher Aussagekraft im Dienst zu verzichten. Abgesehen davon, dass diese Rigidität Zweifel an der vorrangigen Loyalität der Beschwerdeführerin zu den politischen Zielen des Dienstherren und der Werteordnung des Grundgesetzes auch in einem möglichen Konflikt mit religiösen Überzeugungen des Islam hervorruft, sind damit bereits bei der Eignungsbeurteilung Umstände bekannt geworden, die eine allseitige Verwendung der Bewerberin im Schuldienst erheblich erschweren würden und die Landesstaatsgewalt in heute bereits voraussehbare Konflikte mit Schülern und deren Eltern, aber womöglich auch mit anderen Lehrern brächten. Das von der Beschwerdeführerin getragene Kopftuch ist dabei nicht abstrakt oder aus der Sicht der Beschwerdeführerin zu beurteilen, sondern im konkreten Schulverhältnis. Zu den Anforderungen des Amtes einer Grund- und Hauptschullehrerin zählt die Pflicht, objektiv ausdrucksstarke politische, weltanschauliche oder religiöse Symbole für ihre Person zu vermeiden. Im Schuldienst hat der Lehrer die Verwendung solcher signifikanter Symbole zu unterlassen, die geeignet sind, Zweifel an seiner Neutralität und professionellen Distanz in politisch, religiös oder kulturell umstrittenen Themen zu wecken. Dabei kann es nicht darauf ankommen, welchen subjektiven Sinn der beamtete Lehrer mit dem von ihm verwendeten Symbol verbindet. Entscheidend ist vielmehr die objektive Wirkung des Symbols. Eine solche Wirkung in konkret wechselnden Lagen jeweils einzuschätzen, ist grundsätzlich Sache des Dienstherren und kann von Gerichten nur in eingeschränktem Umfang auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft werden. Für die Einschätzung ist die fachlich kompetente Verwaltung am besten geeignet, die Konkretisierung der Dienstpflichten ist traditionell eine Domäne des Dienstherren. Dabei hat er auf wechselnde Lagen zu reagieren. Die Verwendung von Symbolen verändert sich ebenso im Laufe der Zeit wie die Heftigkeit der durch sie hervorgerufenen Resonanz: mal stehen politische Plaketten (z.B. "Stoppt Strauß", "Atomkraft - nein danke"), mal religiös hergeleitete Zeichen wie die orangefarbene Kleidung der Bhagwan(Osho)-Anhänger im Vordergrund (BVerwG, NVwZ 1988, S. 937). Die die angegriffenen Entscheidungen tragende Annahme, dass bei einer Einstellung der Beschwerdeführerin in einer allgemeinen Grund- oder Hauptschule in Baden-Württemberg Beeinträchtigungen des Schulfriedens zu besorgen sind, ist nachvollziehbar. Auch die Senatsmehrheit geht davon aus, dass eine Lehrerin, die das Kopftuch als islamisches Symbol dauerhaft im Unterricht trägt, jedenfalls eine "abstrakte Gefahr" hervorruft. In der Tat ist ein von der Lehrerin getragenes – gegenwärtig – ausdrucksstarkes Symbol mit objektiven religiösen, politischen und kulturellen Sinngehalten geeignet, in die negative Religionsfreiheit von Schülern und Eltern und in das Erziehungsrecht der Eltern (Art. 6 Abs. 2 GG) einzugreifen. Gerade das Tragen eines Kleidungsstücks, das eindeutig auf eine bestimmte religiöse oder weltanschauliche Überzeugung eines Lehrers an öffentlichen Schulen hinweist, kann auf Unverständnis oder Ablehnung bei andersdenkenden Schülern oder deren Erziehungsberechtigten stoßen und diesen Personenkreis in seinem Grundrecht negativer Bekenntnisfreiheit treffen, weil sich die Schüler einer solchen Demonstration religiöser Überzeugung nicht entziehen können. Unterricht 101 und Erziehung an öffentlichen Schulen sind staatliche Leistungen, deren Inanspruchnahme den Kindern zur gesetzlichen Pflicht gemacht ist. Für Kinder und ihre Eltern ist deshalb die Teilnahme am Schulunterricht grundsätzlich unausweichlich. Zudem hängen vom Leistungsniveau und von der Fähigkeit schulischer Einrichtungen sowie ihrer Praxis zu sachgerechter Förderung und Erziehung die Lebenschancen der Kinder maßgeblich ab. Weder den Eltern noch dem Staat ist es deshalb zuzumuten, angesichts einer schon im Einstellungsgespräch erkennbaren künftigen Konfliktlage abzuwarten, ob und wie sich Konflikte im Einzelfall entwickeln. Überdies liegt nahe, dass einige Eltern von einem Protest absehen werden, weil sie deswegen Nachteile für ihr Kind befürchten. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Schulfriedens ist im Fall der Beschwerdeführerin im Übrigen auch schon konkret geworden, wie Erfahrungen im Vorbereitungsdienst und die ablehnende Reaktion von anderen Lehrerinnen zeigen. Lehrerinnen und Lehrer prägen als Person und als Persönlichkeit - gerade in der Grundschule und in der Funktion des Klassenleiters - die Kinder maßgeblich. Trägt eine Lehrerin auffällige Kleidung, ruft dies Eindrücke hervor, gibt zu Fragen Anlass und spornt zur Nachahmung an. Der Sachverständige Professor Bliesener hat in der mündlichen Verhandlung dazu ausgeführt, dass das Lehrerverhalten die Kinder zur Nachahmung anregt: dies geschähe auf Grund der oft engen emotionalen Bindung der Grundschülerinnen und Grundschüler, die von der Lehrkraft aus pädagogischen Gründen auch angestrebt werden soll, sowie der eindeutigen Ausrichtung der kindlichen Aufmerksamkeit auf die Lehrkraft und der ebenfalls wahrgenommenen Autorität der Lehrkraft im Kontext der Schule. Die Erklärung der Beschwerdeführerin, sie würde durch das Kopftuch ausgelöste Fragen wahrheitswidrig beantworten und wider ihrer Glaubensüberzeugung behaupten, es handele sich nur um ein Modeaccessoire, ist nicht geeignet, einen Grundrechtskonflikt zu vermeiden. Denn auch Kinder wissen um die religiöse Bedeutung eines ständig, also auch in geschlossenen Räumen getragenen Kopftuchs. Überdies interagieren Schulkinder nicht nur mit der Lehrerin, sondern auch mit ihren Eltern und einem weiteren sozialen Umfeld. Eltern, die im Rahmen ihrer Erziehungsvorstellung Fragen ihrer Kinder wahrheitsgemäß beantworten, werden nicht umhin können zu erläutern, die Lehrerin trage das Kopftuch, weil sie anders ihre Würde als Frau in der Öffentlichkeit nicht wahren könne. Damit ist aber bei Schülern mit nichtislamischen, möglicherweise auch bei islamischen Eltern, die nicht von einem Verhüllungsgebot der Frau in der Öffentlichkeit ausgehen, ein Konflikt mit ihren Wertvorstellungen angelegt. Die objektive Reizwirkung eines auch politisch-kulturellen Symbols kann sich über Reaktionen im sozialen Umfeld leicht auf das Kind übertragen und es zu der Frage führen, ob es sich in einem Wertedisput, den es nicht beurteilen kann, auf die Seite der Lehrerin oder auf die Seite eines das Kopftuch dezidiert ablehnenden sozialen Umfeldes schlägt, zu dem auch die Eltern rechnen können. Der Sachverständige Bliesener hat in der mündlichen Verhandlung insoweit auf die mögliche emotionale Überforderung der Kinder im Grundschulalter hingewiesen, die eintreten könne, wenn sich zwischen der Lehrkraft auf der einen Seite und der Elternschaft oder einzelnen Eltern auf der anderen Seite ein dauerhafter Konflikt entwickelt. Durch die Verwendung signifikanter Bekleidungssymbole erscheint ein Konflikt in nachvollziehbarer Weise als möglich oder sogar naheliegend, weil das Kopftuch offenkundig - das zeigen bereits die öffentlichen Reaktionen auf die von der Beschwerdeführerin angestrengten gerichtlichen Verfahren - jedenfalls auch als Symbol des politischen Islamismus mit starkem Symbolgehalt aufgeladen ist und entsprechende Abwehrreaktionen zu erwarten sind. Zu diesem objektiven Aussagegehalt gehört auch die Betonung eines sittlichen Unterschieds zwischen Frauen und Männern, die geeignet ist, Konflikte mit denjenigen hervorzurufen, die ihrerseits die Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit und gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern (Art. 3 Abs. 2 GG) als hohen ethischen Wert vertreten. Die Einschätzung, dass das beständige Tragen eines Kopftuchs im Schulunterricht mit der Pflicht zur weltanschaulichen und religiösen Neutralität des Beamten unvereinbar ist, wurde durch alle drei verwaltungsgerichtliche Urteile überzeugend als fehlerfrei gekennzeichnet. Das Kopftuch als religiöses und weltanschauliches Zeichen für die Notwendigkeit der Verhüllung der Frau in der Öffentlichkeit ist jedenfalls zurzeit objektiv geeignet, Widerspruch und Polarisierung hervorzurufen. Die Beschwerdeführerin hat bekundet, sie fühle sich in ihrer Würde verletzt, wenn sie sich mit unbedecktem Haupthaar in der Öffentlichkeit zeige. Auch wenn die Beschwerdeführerin sich nicht 102 ausdrücklich entsprechend eingelassen hat, so liegt doch im Umkehrschluss nahe, dass eine Frau, die sich nicht verhüllt, sich ihrer Würde begibt. Eine solche Unterscheidung ist objektiv geeignet, Wertkonflikte in der Schule hervorzurufen. Dies gilt schon im Verhältnis der Lehrer untereinander, aber erst recht im Verhältnis zu Eltern, deren Kinder gerade in der Grundschule erfahrungsgemäß eine besondere Beziehung zu ihrer Lehrerin aufbauen. Das Kopftuch, getragen als kompromisslose Erfüllung eines von der Beschwerdeführerin angenommenen islamischen Verhüllungsgebotes der Frau, steht gegenwärtig für viele Menschen innerhalb und außerhalb der islamischen Religionsgemeinschaft für eine religiös begründete kulturpolitische Aussage, insbesondere das Verhältnis der Geschlechter zueinander betreffend. Immerhin wurzelt auch nach Meinung wichtiger Kommentatoren des Korans das Gebot der Verhüllung der Frau - unabhängig von der Frage, ob es überhaupt ein striktes Gebot in diese Richtung gibt - in der Notwendigkeit, die Frau in ihrer dem Mann dienenden Rolle zu halten. Diese Unterscheidung zwischen Mann und Frau steht dem Wertebild des Art. 3 Abs. 2 GG fern. Es kommt insofern nicht darauf an, ob eine solche Meinung innerhalb der islamischen Glaubensgemeinschaft allein gültig oder auch nur vorherrschend ist oder ob die im Verfahren vorgetragene Auffassung der Beschwerdeführerin, das Kopftuch sei eher ein Zeichen für das wachsende Selbstbewusstsein und die Emanzipation islamisch gläubiger Frauen, zahlenmäßig stark vertreten wird. Es ist ausreichend, dass die Auffassung, eine Verhüllung der Frauen gewährleiste ihre Unterordnung unter den Mann, offenbar von einer nicht unbedeutenden Zahl der Anhänger islamischen Glaubens vertreten wird und deshalb geeignet ist, Konflikte mit der auch im Grundgesetz deutlich akzentuierten Gleichberechtigung von Mann und Frau hervorzurufen. Das Grundgesetz achtet - in der Sphäre der Gesellschaft - auch solche religiösen und weltanschaulichen Auffassungen, die ein mit der grundgesetzlichen Wertordnung schwer zu vereinbarendes Verhältnis der Geschlechterbeziehungen dokumentieren, solange sie nicht die Grenzen der staatlichen Friedens- und Rechtsordnung überschreiten. Das Wertesystem des Grundgesetzes einschließlich seines Verständnisses der Gleichheit von Mann und Frau schließt sich nicht vor allen Veränderungen ab, es stellt sich Herausforderungen, reagiert und bewahrt die Identität im Wandel. Diese Offenheit und Toleranz geht aber nicht soweit, solchen Symbolen Eingang in den Staatsdienst zu eröffnen, die herrschende Wertmaßstäbe herausfordern und deshalb geeignet sind, Konflikte zu verursachen. Die grundsätzliche Offenheit und Toleranz in der Gesellschaft darf nicht auf das staatliche Binnenverhältnis übertragen werden. Es ist vielmehr von Verfassungs wegen geboten, die innere Organisation der staatlichen Verwaltung von der ersichtlichen Möglichkeit solch schwerwiegender Konflikte frei zu halten, damit - im konkreten Fall - Schulunterricht und schulische Erziehung störungsfrei erfolgen können und allgemein, weil der Staat handlungsfähig bleiben und mit einem Minimum an Einheitlichkeit auftreten können muss.“ Zur Illustration der vom BVerfG angesprochenen sittlichen Ungleichwertigkeit zwischen Männern und Frauen im Islam kann auf Sure 4/Vers 34 (in der mir vorliegenden Übersetzung): „Die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie (von Natur vor diesen) ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen gemacht haben. Ehrbare Frauen sind gehorsam und bewahren das Geheimnis, weil sie Gott bewahrt. Doch wenn ihr bei ihnen Ungehorsam fürchtet, vermahnt sie und scheidet euer Lager von dem ihren und schlagt sie. Denn Gott ist erhaben und mächtig.“ verwiesen werden und darauf hingewiesen werden, dass - neben allen rituellen Hintansetzungen der Frauen - als Ausfluss dieser im Koran und in der Scharia religiös verbrämten Ungleichwertigkeit Frauen u.a. viel weniger als Männer erben, ihr Zeugnis vor Gericht nur halb so viel wie das von Männern zählt, Muslime auch Christinnen und Jüdinnen als Mitglieder von Buchreligionen heiraten dürfen, es hingegen einer Muslimin verboten ist, einen Nichtmuslim zu heiraten, Männer laut Sure 4/3 bis zu vier (Haupt-)Frauen haben dürfen, wenn sie ihnen gerecht werden, d.h. sie ernähren, können, eine Frau aber nur einen Mann haben darf, den sie sich eventuell sogar mit anderen Frauen teilen muss, ein Mann seine Frau verstoßen kann, wenn er ihrer überdrüsig ist: „Talaq, talaq, talaq“ („Ich verstoße dich, ich verstoße dich, ich verstoße dich!“), einer Frau dieses Recht aber nicht zusteht, sie 103 auch im Vergleich zu den Möglichkeiten des Mannes eingeschränktere Scheidungsmöglichkeiten hat. Bundeskanzler Schröder (Jurist) und die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Vollmer (Pfarrerin), forderten im Verlauf der durch das BVerfG angestoßenen »Kopftuch-Diskussion« ein Verbot von Kopftuch tragenden Lehrerinnen an öffentlichen Schulen: Das Kopftuch sei ein politisches Symbol der islamistischen Bewegung und ihrer gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen, die die Frau dem Manne unterordne. Das Grundgesetz verlange aber die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Diesem Grundrecht entgegenstehende Dominanzansprüche seien somit grundgesetzwidrig und dürften nicht auch noch durch ein »religiöses Kampfsymbol« in Schulen zum Ausdruck gebracht werden. Der damalige Bundespräsident Rau (Jurist und bekennender Christ) sprach sich in dem Kopftuchstreit für eine Gleichbehandlung der Religionen aus. Die Haltung der Länder müsse konsequent und in sich stimmig sein: „Wenn das Kopftuch in Schulen verboten wird, muss das auch für Mönchskutte und Kruzifix gelten.“ (Rau im ZDF und HH A 29.12.03). Rau betonte in der "Welt am Sonntag" (04.01.04), die Verfassung fordere eine Gleichbehandlung der Religionen im öffentlichen Raum, somit auch in den Schulen. Bei einem Verbot des Kopftuches als religiöses Zeichen an Schulen könne man "die Mönchskutte nur schwer verteidigen. Damit wird ja nicht unser christliches Erbe infrage gestellt." (Wie sich ein Jahr später herausstellte, sah das BVerwG das genau so!) Gegen die rechtliche Gleichsetzung von Kreuz und Kopftuch wandte sich der protokollarisch zweite oder dritte Mann im Staat, Bundestagspräsident Thierse. Er fuhr dem Bundespräsidenten in die Parade: Zwar habe der Staat grundsätzlich die Pflicht zur Neutralität gegenüber allen Religionen. Der Unterschied zwischen Kreuz und Kopftuch bestehe seiner Meinung nach aber darin, dass ein in Deutschland von Frauen getragenes Kreuz kein Zeichen von Unterdrückung sei, das von muslimischen Frauen getragene Kopftuch hingegen sei jedoch kein bloßes religiöses Symbol, sondern für viele dieser Frauen sehr wohl ein Zeichen für ihre Unterdrückung durch reaktionäre Familien- oder Gruppenmitglieder! Daher verbiete sich eine rechtliche Gleichbehandlung von Kreuz und Kopftuch. Aber da irrt Herr Thierse, da er nicht die hier vertretene Meinung teilt, die auch das BVerwG für Recht erkannt hat: „URTEIL Auch Nonnen müssen jetzt oben ohne Im Streit um die Kopftücher muslimischer Lehrerinnen sind nun christliche Nonnen im Schuldienst die Leidtragenden. Laut Bundesverwaltungsgericht müssen auch sie in Baden-Württemberg zukünftig ablegen, bevor sie das Klassenzimmer betreten. Berlin - Aus der schriftlichen Begründung des jüngsten Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zum baden-württembergischen Kopftuchverbot, die jetzt vorliegt, geht hervor, dass die Ordensfrauen ihr Habit ablegen oder den Schuldienst quittieren müssen. Die baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan (CDU) hatte versucht, mit einer Novelle des Schulgesetzes zwar das Tragen islamischer Kopftücher durch Lehrerinnen zu verbieten, christliche Symbole aber weiterhin zuzulassen - im katholisch geprägten Schwarzwald erteilen auch Ordensschwestern im Habit staatlichen Unterricht. Das Verbot religiöser Bekundungen, so die Leipziger Richter nun aber, müsse auf Grund des Gesetzes in Baden-Württemberg für alle Religionen gelten. "Ausnahmen für bestimmte Formen religiös motivierter Kleidung in bestimmten Regionen", so das Urteil, "kommen daher nicht in Betracht." Schavans Gesetzesautor und Prozessvertreter, der Tübinger Juraprofessor Ferdinand Kirchhof, hält dagegen, beim Nonnen-Habit handle es sich um eine "Berufstracht", die als solche von dem Verbot religiöser Kleidung nicht erfasst sei.“ (SPIEGEL ONLINE 09.10.04) „NONNEN AN SCHULEN Nicht ohne meine Kutte Auch Nonnen müssen laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ihre Ordenstracht im Klassenzimmer ablegen. Baden-Württembergs Kultusministerin sieht das anders: Diese "Berufskleidung" sei weiterhin erlaubt, glaubt die Katholikin Annette Schavan - eine windige Argumentation. Für Annette Schavan war es eine gute Nachricht: Am Freitag erklärte die muslimische Lehrerin Fereshta Ludin, dass sie im zähen Rechtsstreit um das Kopftuchverbot an staatlichen Schulen BadenWürttembergs aufgibt. "Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem ich dem gerichtlichen Weg ein Ende setzen möchte", so Ludin. Kultusministerin Schavan (CDU) reagierte erfreut: "Frau Ludin hat 104 nun offenbar eingesehen, dass eine Verfassungsbeschwerde keinen Sinn haben würde", sagte Schavan. Sie begrüßte den Rückzug als "Bestätigung unserer Vorgehensweise und des badenwürttembergischen 'Kopftuch-Gesetzes', das mit großer Mehrheit des Landtags verabschiedet worden ist und abschließende Klarheit geschaffen hat". Abschließende Klarheit? Nun ja. Das Gesetz hat so seine Tücken. Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe meldet, müssen auch Ordensfrauen ihr Habit ablegen oder den Schuldienst quittieren; das gehe aus einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Kopftuchstreit hervor. Das Verbot religiöser Bekundungen, so die Leipziger Richter, müsse auf Grund des Gesetzes in BadenWürttemberg für alle Religionen gelten. "Ausnahmen für bestimmte Formen religiös motivierter Kleidung in bestimmten Regionen", so das Urteil, "kommen daher nicht in Betracht." Gesetz könnte auf das Land zurückfallen Mit ihrer Gesetzesnovelle hatte die katholische Kultusministerin versucht, zwar das Tragen islamischer Kopftücher durch Lehrerinnen zu verbieten, christliche Symbole aber weiterhin zuzulassen - im katholisch geprägten Schwarzwald erteilen auch Ordensschwestern im Habit staatlichen Unterricht. Mit der strikten Neutralität des Staates und dem Verbot aller religiösen Symbole ist es in BadenWürttemberg nicht weit her. Auch andere Bundesländer haben Gesetze verabschiedet, die Kopftuchtragen vereiteln, aber zugleich die Vermittlung "christlicher und abendländischer Kulturwerte" weiter zulassen sollen. Dieser Balanceakt könnte rechtlich unangenehme Folgen haben. Annette Schavan aber hält das Tragen einer Nonnentracht im öffentlichen Schuldienst weiterhin für möglich. Das baden-württembergische Kopftuchverbot stimme "völlig mit dem Grundgesetz überein", sagte Schavan. Über das "Tragen einer Berufskleidung von Ordensschwestern" habe das Bundesverwaltungsgericht "nicht ausdrücklich entschieden, weil diese Frage nicht Ausgangspunkt des Prozesses war". Die Darstellung christlicher Traditionen als historische Wurzeln des Landes" sei erlaubt, dazu zähle "nach Auffassung des Landes das Tragen einer Ordenstracht". Bumerangeffekt wahrscheinlich Auch Schavans Gesetzesautor und Prozessvertreter, der Tübinger Juraprofessor Ferdinand Kirchhof, hatte argumentiert, beim Nonnen-Habit handle es sich um eine "Berufstracht", die als solche vom Verbot religiöser Kleidung nicht erfasst sei. Das Bundesverfassungsgericht hatte nicht einfach das Kopftuchverbot abgelehnt oder durchgewinkt, sondern die Landesparlamente aufgefordert, erst einmal eine Gesetzesregelung zu verabschieden. Damit hat sich Baden-Württemberg besonders beeilt. Und wie andere Länder versucht, bei gleichzeitiger Verbannung muslimischer Symbole die christlichen Traditionen zu wahren. Nach Auffassung der Kopftuchgegner ist Ordenskleidung nicht gleichzusetzen mit einer Kopfbedeckung, die neben einer rein religiösen Haltung auch andere Botschaften transportiere und etwa Zustimmung zum muslimischen Fundamentalismus signalisiere. Juristisch indes ist die Interpretation einigermaßen verwegen, die Kluft der Nonnen sei keine religiös motivierte Kleidung, sondern "Berufskleidung" - wie etwa der Overall eines Automechanikers, eine Kochmütze oder die Schutzweste eines Straßenarbeiters. Früher oder später dürfte sich das Bundesverfassungsgericht abermals damit beschäftigen.“ (Jochen Leffers SPIEGEL ONLINE 14.10.04) „SCHULE Unterricht ohne Haube Der Kopftuch-Streit geht in die nächste Runde - damit könnten auch lehrende Nonnen Opfer des baden-württembergischen Verbotsgesetzes werden. Es ist ja nicht so, dass niemand sie gewarnt hätte. Doch die baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan ließ sich bei ihrem Vorhaben, muslimischen Lehrerinnen das Tragen eines Kopftuchs an der Schule per Gesetz zu verbieten, von niemandem beirren - nicht einmal vom ehemaligen Verfassungsrichter Ernst-Gottfried Mahrenholz, der prophezeite: "Wenn Sie das Kopftuch nicht in Kauf nehmen, dürfen Sie auch nicht die Nonnentracht dulden." Jetzt sieht es so aus, dass die "Amtsaskese", die die Katholikin Schavan muslimischen Lehrerinnen verordnet hat, zum Bumerang wird und Bekennende aller Glaubensrichtungen trifft. Und das nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern, Hessen und im Saarland, wo ähnliche Gesetze verabschiedet oder vorbereitet worden sind. Denn das Leipziger Bundesverwaltungsgericht hat in der jetzt nachgereichten schriftlichen Begründung seines Kopftuchverbot-Urteils die "strikte Gleichbehandlung" der Religionen verordnet 105 und "Ausnahmen für bestimmte Formen religiös motivierter Kleidung" ausgeschlossen. Kein Wunder also, dass Maria Bernadette Hein, Äbtissin des Zisterzienserklosters im BadenBadener Stadtteil Lichtenthal, beunruhigt ist. Die Grundschule im altehrwürdigen Kloster im Nordschwarzwald ist eine von zwei staatlichen Schulen in Baden-Württemberg, an denen Nonnen im Habit normalen Unterricht erteilen - noch. Die Äbtissin glaubt fest daran, dass das so bleibt: "Die Ministerin hat sich eindeutig geäußert, dass unsere Schwestern die Ordenstracht nicht ausziehen müssen", sagt Hein. "Sie hat uns das versprochen." Dieses Versprechen zu halten dürfte schwer fallen: "Auch Frau Schavan muss sich an die Rechtsprechung halten", fürchtet Klaus Hälbig, Sprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Tatsächlich ist das "Ende des Kopftuch-Rechtsstreits", das Schavan nach dem Rückzieher der Klägerin Fereshta Ludin per Pressemitteilung ausrufen ließ, noch lange nicht in Sicht. Zwar sieht die aus Afghanistan stammende Lehramtsbewerberin, an deren Fall sich die Kopftuch-Debatte entzündet hatte, von weiteren gerichtlichen Schritten ab. Doch schon in Kürze könnte ein weiterer Rechtsstreit mit einer Kopftuch tragenden Lehrerin die Ministerin zwingen, mit der Gleichbehandlung der Religionen Ernst zu machen. Es geht um die Lehrerin Doris G., die an einer Grund- und Hauptschule in Stuttgart unterrichtet. Seit 1973 ist Doris G. Lehrerin, seit 1978 Beamtin auf Lebenszeit. 1984 konvertierte sie zum Islam, seit 1995 trägt sie im Schuldienst ein Kopftuch, allerdings bedeckt sie nur locker die Haare. Doris G. erklärte im März 2000 im Ludin-Verfahren, auch sie trage ihr Kopftuch aus religiösen Gründen, ohne dass sie von der Schulaufsicht behelligt worden wäre. Diesem Bekenntnis folgten prompt mehrere "Personalgespräche", danach kam die Order des Oberschulamts, "ihren Dienst immer dann ohne Kopfbedeckung zu versehen, wenn sie in Kontakt mit Schülern ist". Doris G. klagte vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Dort ließ man die Sache bis zum Abschluss des Falls Ludin ruhen - jetzt soll es im Dezember zur Verhandlung kommen. Sollten Schavans Beamte darauf bestehen, dass Doris G. ihr Kopftuch abnimmt, könnten auch lehrende Nonnen ein Problem bekommen. Denn dann, so der Freiburger Staatsrechtler und ExVerfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde, könne Doris G. "einwenden, dies sei eine unzulässige Diskriminierung", die das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes verletze. Schavan wäre in der Zwickmühle: Entweder geht sie auch gegen die Nonnen vor - oder sie lässt das Verdikt gegen Doris G. fallen. Verzweifelt sucht die Ministerin nach Argumenten, die einseitige Praxis zu retten - und richtet damit weiteren Flurschaden an. Die Behauptung, der Nonnenhabit falle als "Berufstracht" nicht unter das Verbot religiös motivierter Kleidung, empört die Gottesfrauen. Äbtissin Hein fühlt sich durch solch eine Verkürzung beleidigt. Der Habit sei "ein Zeichen der Religiosität und der Beziehung zu Gott", findet auch die Vorsitzende der Vereinigung der Ordensoberinnen in Deutschland, Aloisia Höing. Um ihre katholische Klientel zu befrieden, lenkte Schavan vergangene Woche ein: Ob die Ordenstracht nur ein Berufskleid oder ein religiöses Zeichen sei, spiele "keine Rolle". Sie verbiete das Kopftuch wegen seiner "politischen Mehrdeutigkeit", und die sei dem Habit nicht zu unterstellen. Verfassungsrechtler Mahrenholz sieht als einzigen Ausweg für Schavan, eine Einzelfallprüfung ins Gesetz aufzunehmen, für Nonnen wie für Muslima. Dass genaues Hinsehen sinnvoll sein kann, zeigt ein Fall an einer Grundschule in NordrheinWestfalen: Dort war eine Kopftuch tragende Lehrerin, die sogar in Sachen Kopftuch politisch aktiv war, lange Jahre als Konrektorin tätig. Erst als sie Schulleiterin werden wollte, musste sie auf die Bedeckung ihres Hauptes verzichten. DIETMAR HIPP, CAROLINE SCHMIDT“ (SPIEGEL ONLINE 20.10.04) Das BVerwG hat nicht nur entschieden, dass Lehrer „… in der Schule keine Kleidung oder sonstigen Zeichen tragen dürfen, die ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft erkennen lassen. … Ausnahmen für bestimmte Formen religiöser Kleidung in bestimmten Regionen kommen nicht in Betracht.“ Bei einer so klaren kann Aussage kann man sich nur über den Bundestagspräsidenten und andere Ignoranten wie die baden-württembergische Kultusministerin und ihre Rechtsberater wundern! Dieses unsere Gerichte und nun manche Länderparlamente beschäftigende Grundsatzproblem der Abwägung zwischen einerseits der Religionsfreiheit der ein Kopftuch tragenden Lehrerinnen und andererseits der Neutralitätspflicht des Staates besteht auch in anderen Ländern der EU und wird unterschiedlich gelöst: In der laizistischen Republik Frankreich mit ihren rund 4 Mill. Muslimen und 600.00 Juden ist die Frage seit fast 106 einem Jahrhundert durch das Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche von 1905 entschieden – aber, wie die Spannungen in den Vorstädten und der »Kleinkrieg« in den Schulen zwischen Schülern verschiedener religiöser Bekenntnisse zeigt: nicht gelöst. Insbesondere in den Kämpfen islamischer Schüler gegen jüdische spiegeln sich die Spannungen des Nahen Ostens wider. Der Staatsrat erklärte 1989 das Tragen religiöser Zeichen als "nicht vereinbar mit der religiösen Neutralität öffentlicher Schulen" und verbot "diskriminierende, den Unterricht störende oder prahlerisch-angeberische religiöse Zeichen". Doch kein Gesetzgeber kann den Übergang vom neutralen Zeichen zum "prahlerisch-angeberischen" oder "offenkundigen" zweifelsfrei definieren. Darum wurden die Bestimmungen neu gefasst und verschärft. So ist es nunmehr allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst während der Ausübung ihrer öffentlichen Funktion und den Schülern in den staatlichen Schulen untersagt, irgendwelche Zeichen ihrer jeweiligen religiösen Zugehörigkeit zu tragen. Muslimische Lehrerinnen mit Kopftuch gibt es deshalb in Frankreich nicht, und Schülerinnen mit Kopftuch werden auch nicht (mehr) geduldet. Der strikte Laizismus18, seit der Französischen Revolution von 1789 einer der Pfeiler der französischen Staatsphilosophie, soll gewährleisten, dass der Staat sich aus jedem religiösen Streit heraushält. KOPFTUCHVERBOT IN FRANKREICH Schülerinnen vom Unterricht ausgeschlossen Das Verbot religiöser Symbole an Frankreichs Schulen beginnt zu greifen. Nun sind erstmals fünf muslimische Schülerinnen des Unterrichts verwiesen worden, weil sie sich weigerten, ihr Kopftuch abzulegen. Unterdessen klagen Sikhs gegen die brisante Vorschrift, die auch Turbane erfasst. Erstmals seit Inkrafttreten des Kopftuchverbots an französischen Schulen sind mehrere muslimische Mädchen des Unterrichts verwiesen worden. Nach einer Anhörung schlossen Schulen im elsässischen Mulhouse (Mülhausen) am Mittwoch zwei 17-Jährige aus, weil sie sich weigerten, ihr Kopftuch abzulegen. Eine weitere Schülerin in Flers, Normandie, darf ebenfalls nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Bereits am Dienstag wurden in Mulhouse zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen der Schule verwiesen. Das im Februar erlassene Gesetz, das an Frankreichs staatlichen Schulen "Symbole und Kleidungsstücke" verbietet, die "ostentativ die Religionszugehörigkeit der Schüler zur Schau stellen", ist hoch brisant. In der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend auf ein Kopftuchverbot verkürzt, hat es nicht nur zu Protesten muslimischer Schüler geführt, sondern auch zu einem außenpolitischen Problem für die Regierung in Paris. Die Entführer, die im Irak die beiden französischen Journalisten Georges Malbrunot und Christian Chesnot als Geiseln genommen haben, begründen ihre Tat mit dem französischen Gesetz und fordern dessen Abschaffung. Zwar haben sich die meisten muslimischen Verbände in Frankreich mittlerweile demonstrativ hinter die Bemühungen um eine Freilassung der beiden Journalisten gestellt. Auch unterstützen viele islamische Vereine den in der Verfassung vorgeschriebenen strikten Laizismus. Doch in der Praxis führt das Gesetz dennoch zu handfesten Problemen im Schulbetrieb. Sikhs klagen So waren zu Beginn der Woche landesweit 72 Schülerinnen und Schüler vom Schulverweis bedroht. Das Erziehungsministerium gab den Schulbezirken grünes Licht, gegen die Betroffenen vorzugehen. Meist handelt es sich dabei um muslimische Schülerinnen, die sich weigern, ihr Kopftuch abzulegen. Betroffen sind aber auch einige Sikhs. Deren Religionsgemeinschaft reichte vor einem Pariser Verwaltungsgericht im Fall von drei Schülern Klage ein, die seit Beginn des Schuljahres nicht am 18 Den in Frankreich an sich sehr strikt gehandhabten Laizismus sahen manche seiner Verfechter in Frage gestellt, als zum Tod des Papstes Johannes Paul II. Trauerbeflaggung angeordnet worden war: „Die Trauerbeflaggung zu Ehren des toten Papstes hat in Frankreich eine hitzige Debatte ausgelöst. Kritiker werfen der Regierung vor, mit zweierlei Maß zu messen: Während muslimische Kopftücher in Schulen verboten seien, werde die Trennung von Kirche und Staat bei der Trauer um Johannes Paul II. ignoriert. ... ’Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr vorsichtig mit der genauen Trennung von Kirche und Staat sind, besonders nach dem Erlass eines Gesetzes, das religiöse Symbole aus Schulen verbannt hat’, sagte der sozialistische Senator Jean-Luc Melenchon. Andere Kritiker warfen der französischen Regierung Scheinheiligkeit vor und forderten eine strikte Einhaltung der 100-jährigen Säkularismus-Tradition. ... Innenminister Dominique de Villepin rechtfertigte die öffentliche Trauerbekundung mit der Tradition des Landes. Auch beim Tod vorherige Päpste seien die Fahnen auf halbmast gesetzt worden. Für die Beisetzung des Papstes ist erneut Trauerbeflaggung angeordnet. Auch in der Schweiz gibt es derweil öffentlichen Streit um die Staatstrauer. Der Kanton Genf hat aus seiner calvinistischen Tradition heraus eine Trauerbebeflaggung abgelehnt. Man werde die geltende Regel nicht brechen, die besage, dass die Fahnen nur beim Tod eines Schweizer Bürgers auf halbmast gesetzt würden, sagte eine Sprecherin des Kantons.“ (SPIEGEL ONLINE 08.04.05) 107 Unterricht teilnehmen dürfen, weil sie einen Turban tragen. Eine Entscheidung wird am Freitag erwartet. Das Gesetz verbietet neben dem muslimischen Kopftuch unter anderem auch die jüdische Kippa und auffallende christliche Kreuze. Künftige Konflikte um das umstrittene Gesetz sind programmiert. Bildungsminister Francois Fillon bezifferte am Dienstag die Streitfälle zu Beginn des Schuljahres im September auf rund 600. Die Mehrzahl habe aber in Gesprächen mit den betroffenen Schülern beigelegt werden können. Reibungen im Schulbetrieb Dass sich die Fälle der ausgeschlossenen Schüler jetzt häufen, geht auf eine Anweisung der Regierung zurück. Offenbar mit Rücksicht auf die entführten Journalisten hatte die Regierung in Paris das Verbot bislang nur sehr zurückhaltend durchgesetzt. Wenn Schüler sich dem Gesetz aufgrund ihres Glaubens nicht beugen wollen, sind sie mit weitreichenden Schwierigkeiten konfrontiert, die ihren Ausbildungsweg erschweren können. Zwar können sie bei der Schulaufsicht Beschwerde einlegen, doch verspricht dies kaum Erfolg. Sind sie unter 16 Jahre alt, müssen sie ihre Ausbildung an Privatschulen oder per Fernunterricht fortsetzen und dies nachweisen, um die Schulpflicht zu erfüllen. (SPIEGEL ONLINE 22.10.04) Trotz der kompromisslos durchgesetzten religiösen Neutralität des Staates im Schulwesen ist die französische Gesellschaft mit ihrem relativ hohen Bevölkerungsanteil an Muslimen nicht frei von (teilweise nicht mehr nur) unterschwelligen Spannungen, die sich aber meist in den muslimischen Ghettos der Vorstädte großer Bevölkerungsmetropolen abspielen: Im Frühling 2003 gab es nun einen viel beachteten Aufstand junger Frauen in Paris. Sie brachen das Gesetz des Schweigens. Darüber, dass sie in den mehrheitlich islamischen Vorstädten von ihren Vätern, Brüdern und Nachbarn terrorisiert und aufgeteilt werden in "Heilige oder Huren", als lebten sie in Kabul. Durchgesetzt wird das islamische Gesetz der islamischen Männer mit Gewalt: Gruppenvergewaltigungen seien an der Tagesordnung, und jüngst wurde die 17-jährige Sohane Benziane bei lebendigem Leibe verbrannt.19 Nach der Ermordung des niederländischen Filmemachers van Gogh 2004 wurde nun auch international bekannt, dass in den Niederlanden auf den Straßen „herumhängende“, in ihren jeweiligen Ethnien „versäulte Niederländer“, wie der Mörder van Goghs meist aus voll integrierten Familien marokkanischer Herkunft stammend, unter Anleitung radikalisierter islamischer Brigaden anstreben, dass in »ihren« Vierteln nicht mehr die niederländischen Gesetze, sondern die »ihren« gelten; es gebe „No-go-areas“ und Stadtviertel mit einem erschreckend niedrigen Bildungsniveau marokkanisch- und türkischstämmiger Kinder und Jugendlicher, denen in den dortigen Ghettos die Lehren des Ibn Taimija, eines der Urväter des puristischen Islam, der den „heiligen Krieg“ als Lebensart predigte, beigebracht werden. In diese Stadtviertel mit regelrecht marodierenden Jugendbanden, wo die Gegengewalt zu groß sei und Puppen mit den Namen von Polizisten an Bäumen und Laternenpfählen aufgehängt seien, traue sich selbst die Polizei nicht mehr rein (ARD Presseclub 14.11.04). Diese radikalisierten Muslime sehen es als »tugendhaft« an, wenn sie mit Todesdrohungen Kritiker und Gegner des Islams zum Schweigen bringen. Hilft die Drohung nicht, erfolgt notfalls der Vollzug; wie bei van Gogh. Nach dem Mord an dem Filmemacher, der wegen des mit van Gogh zusammen gedrehten und über das Fernsehen ausgestrahlten Films über Gewalt islamischer Männer gegenüber Frauen auf die ehemals muslimische, dann aber zum Christentum konvertierte somalischstämmige niederländische Parlamentsabgeordnete Ali zielte – in van Goghs Leiche steckte ein Messer mit einer diesbezüglichen Botschaft an Ayaan Hirsi Ali -, brannten in den Niederlanden Moscheen und von Muslimen besuchte Schulen; und als darauf antwortende Gegengewalt christliche Kirchen. Nun war Holland in Not. Der Luftraum über Den Haag wurde gesperrt: Die Feuerzeichen des Menetekels einer gescheiterten Multikulti-Parallelgesellschaft waren im ganzen Land zu sehen. Beängstigend für die Niederländer ist, dass auf Grund der wesentlich höheren Geburtenrate der muslimischen Staatsbürger – Mohammed ist schon 2004 der häufigste Vorname der in Amsterdam geborenen Babys gewesen – in sechs bis acht Jahren in den vier größten Städten der Niederlande 19 Gruppenvergewaltigungen zur Disziplinierung islamischer Mädchen zur Wahrung der so empfundenen Familienehre scheint keine nur in Frankreich praktizierte Vorgehensweise zu sein. So berichtete der SPIEGEL vom 29.09.03 von einem in dritter Generation in Deutschland lebenden 18-jährigen türkischen Mädchen, das bis zu ihrem 14. Lebensjahr außer zur Schule nur in Begleitung eines Bruders oder der Mutter aus dem Haus durfte. Als ihr Onkel sie vergewaltigt hatte, schwieg sie aus Scham. Der Vergewaltiger machte ihr das Leben danach weiterhin zur Hölle, indem er der Mutter immer wieder erzählte, er habe ihre Tochter mit Jungs herumstehen sehen. „Die Mutter glaubte es und drohte, wenn ihre Tochter nicht aufhöre, ihr Schande zu machen, hole sie ’fünf Männer, die vergewaltigen dich dann, und ich selbst werde dabei deine Hände festhalten.’“ 108 eine muslimische Bevölkerungsmehrheit zu erwarten ist; das schreit geradezu nach rechtlichen Regelungen gegen Einwanderung aus insbesondere Marokko, weil von dieser Bevölkerungsgruppe den Niederländern die größten Schwierigkeiten erwachsen. Und die Niederlande sind in dieser Beziehung kein europäischer Einzelfall, denn ein französischer Minister griff diesen Punkt auf und tat nach dem zweiten Attentat in den Niederlanden ebenfalls Ende 2004 kund, dass es in Frankreich in großen Städten rund 500 »eurabische«20 Stadtviertel gebe, in denen faktisch nicht mehr die französischen Gesetze gelten würden! In diesen nicht mehr kontrollierbaren Parallelgesellschaften gelte nur die Scharia (ARD Presseclub 14.11.04)! In diesen Vierteln stellt sich für die Bewohner schon (fast) gar nicht mehr die Frage des mit allen(!) gesetzlich zugelassenen Mitteln durchzusetzenden staatlichen Gewaltmonopols! Für alle anderen Franzosen hingegen stellt sich die Frage des islamistischen Gebietsbeherrschern gegenüber mit allen(!) Mitteln durchzusetzenden staatlichen Gewaltmonopols ausgesprochen dringlich – selbstverständlich unter demokratischer Zügelung! In der Schweiz war einer seit 1990 im staatlichen Schuldienst unterrichtenden Lehrerin nach ihrem 1991 erfolgten Übertritt zum Islam und dem damit verbundenen späteren Tragen eines Kopftuches 1996 von den Behörden das demonstrative Tragen des Kopftuchs im Unterricht verboten worden. Das Schweizer Bundesgericht bestätigte 1997 die Entscheidung der Behörde. Eine daraufhin von der Muslimin beim Europäischen Gerichtshof eingereichte Klage wurde 2001 dort ebenfalls abschlägig beschieden. Das behördliche Verbot verstoße weder gegen die Religionsfreiheit noch gegen das Diskriminierungsverbot. Aus allen anderen Ländern der EU sind bisher keine die Bekleidung für öffentlich Bedienstete einschränkenden Regelungen bekannt. In dem Vereinigten Königreich von Großbritannien darf man auf dem Haupte tragen, was man will, gleichgültig ob Muslim oder Sikh; es gibt keinen Kopftuch- oder Turbanerlass. Das wird als Ausfluss der – von manchen überdehnten - Religionsfreiheit gesehen. ENGLISCHE SCHULEN Muslimin darf bodenlanges Gewand tragen Britische Schüler tragen normalerweise Schuluniform. Das kann gegen die Menschenrechte verstoßen, entschieden Richter im Fall von Shabina Begum, 16. Die Schülerin kämpft für das Recht, mit einem Umhang ihren Körper bis auf Hände und Gesicht ganz zu bedecken. Ihre Anwältin: Cherie Blair, die Frau des Premierministers. Seit über zwei Jahren prozessiert Shabina Begum dafür, dass sie in einem traditionellen Gewand in den Unterricht kommen darf. 2002 wurde sie nach Hause geschickt, weil sie die Kleidungsregeln der Denbigh High School in Luton nicht befolgte. Anschließend ging die britische Muslimin nicht mehr zur Schule. Jetzt hat das zweithöchste britische Gericht in einem Musterverfahren entschieden, dass die 16-Jährige den "Dschilbab" tragen darf. Dieses Gewand reicht bis auf den Boden und lässt nur Gesicht und Hände unbedeckt. Nach Auffassung der Richter wurde Shabina Begum das Recht verweigert, sich durch die Kleidung zu ihrer Religion zu bekennen; sie hätte nicht vom Unterricht ausgeschlossen werden dürfen. Über dem Berufungsgericht stehen nur noch die Lordrichter des Oberhauses. Der Richter forderte das Bildungsministerium auf, für mehr Klarheit zu sorgen, wie die Schulen mit ihren Verpflichtungen unter Menschenrechtsaspekten umgehen sollen. In vielen Ländern Europas ist umstritten, welche Kleidung in den Schulen getragen werden darf, um religiöse und möglicherweise auch politische Überzeugungen auszudrücken. So gibt es in Deutschland eine anhaltende Debatte über Kopftücher muslimischer Lehrerinnen. Frankreich hat Kopftücher, Kippas und Turbane auch für Schülerinnen und Schüler verboten, ebenso wie große christliche Kreuze in den Schulen; die Türkei hält religiöse Symbole ähnlich strikt aus den Schulen und Universitäten fern. 20 Der Ausdruck „Eurabien“ wurde von der italienischen Journalistin und Schriftstellerin Oriana Fallaci geprägt, die mit ihren polemischen Bestsellern „Die Wut und der Stolz“ (1990) und "Die Kraft der Vernunft" (2004) Europa aufzurütteln und vor der ihm durch den Islamismus drohenden Gefahr zu warnen versucht. 109 Schutz vor fundamentalistischem Druck Gebums Fall sorgt in Großbritannien seit Jahren für Aufsehen und dürfte nach dem neuen Urteil zu weiteren Streitigkeiten an anderen Schulen führen. In erster Instanz hatte die Schule noch Recht bekommen. Damals verwies der Richter darauf, dass 79 Prozent der insgesamt 1000 Schüler an der Denbigh High School Muslime seien und diese sich nicht diskriminiert fühlten; zudem seien auch Kopftücher bereits erlaubt. Die Schule hatte argumentiert, das Gewand sei ein Gesundheits- und Sicherheitsrisiko. Außerdem könne es zu Spannungen kommen, weil Schüler mit dem traditionellen Gewand als "bessere Muslime" angesehen werden könnten. Nach Darstellung der Schule berücksichtigen ihre Kleidungsregeln alle Glaubensrichtungen und Kulturen. Erlaubt seien beispielsweise Kleider oder weite Hosen und eine Tunika. Auch Shabina Begum hatte diese Form islamischer Kleidung zunächst an der High School getragen, bis sie sich im Dezember 2002 für den bodenlangen "Dschilbab" entschied und dies - gemeinsam mit ihrem Bruder Shuweb Rahman - der Schulleitung mitteilte. Die Direktorin Yasmin Bevan sagte, es gehe bei den Kleidungsregeln auch darum, die Kinder vor den Rekrutierungsbemühungen extremistischer muslimischer Gruppen zu schützen. Unterstützt wurde sie dabei vom Verband britischer Schuldirektoren, der ebenfalls fundamentalistischen Druck auf die Schüler befürchtet. Ein "Sieg für alle Muslime"? In Großbritannien können die Schule ihre Bekleidungsregeln selbst festlegen. Die meisten setzen auf die traditionellen Schuluniformen, manche multikulturell geprägte Schulen lassen ihren Schülern größeren Spielraum. Welche Kleidungsregeln jeweils vernünftig und angemessen seien, müsse den Schulen überlassen bleiben, argumentierte der Verband. Beim Berufungsverfahren berief sich Shabina Begum auf die europäische Menschenrechtskonvention. Artikel 9 garantiert die "Freiheit, die eigene Religion oder den Glauben auszudrücken". Vertreten wurde die Schülerin von Cherie Blair, der Frau des britischen Premierministers. Es gehe um "grundsätzliche Fragen" der Bildung und der Religionsfreiheit, trug Cherie Blair dem Berufungsgericht bei einer Anhörung im Dezember vor. Einer Schulleitung stehe es nicht zu, sich die ihr genehmen religiösen Überzeugungen "herauszupicken". Nach der Gerichtsentscheidung am Mittwoch sagte Begum, das Vorgehen der Schule sei die "Folge einer Atmosphäre, die nach den Anschläge vom 11. September 2001 in den westlichen Gesellschaften entstand, einer Atmosphäre, in der der Islam im Namen des 'Anti-Terror-Krieges' kriminalisiert wurde". In ihrer vorbereiteten Stellungnahme sprach sie von einem "Sieg für alle Muslime, die ihre Identität und Werte trotz aller Vorurteile und Borniertheit bewahren wollen". Es sei "erstaunlich", dass sie in der "so genannten freien Welt für ihr Recht auf diese Kleidung kämpfen" müsse. Die Dachorganisation Muslim Council of Britain begrüßte das Urteil. Inzwischen besucht Shabina Begum, deren Vater und Mutter tot sind, eine andere Schule. Dort ist der "Dschilbab" erlaubt. (SPIEGEL ONLINE 03.03.05) 2004 hatte das BVerwG über die Rechtmäßigkeit der ersten »Landeskopftuchgesetze« zu entscheiden, u.a. in der nächsten Runde der Sache der Klägerin Ludin gegen das Land Baden-Württemberg. Bei der Verhandlung in Leipzig ging es nun vor allem darum, ob die Änderung des baden-württembergischen Schulgesetzes rechtmäßig ist. Baden-Württemberg verbietet darin "politische, religiöse, weltanschauliche oder ähnliche äußere Bekundungen", die "geeignet sind, den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden". Allerdings werden christliche und abendländische Symbole davon ausgenommen, weil sie dem "Erziehungsauftrag der Landesverfassung" entsprächen. Die Leipziger Richter erklärten das baden-württembergische Kopftuchverbot für rechtens. "Dieses Gesetz entspricht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und bietet eine ausreichende Rechtsgrundlage, die Unterrichtserteilung mit Kopftuch zu untersagen", hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichts. Es enthalte trotz der Erwähnung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte keine Bevorzugung christlicher 110 Religionen - meinten die Richter. Es biete eine ausreichende Grundlage, um das Tragen eines Kopftuches in der Schule zu untersagen, sagte der Senatsvorsitzende Hartmut Albers. Weiter argumentierten die Richter durchaus fragwürdig: Da die Klägerin nicht bereit sei, dem Kopftuchverbot nachzukommen, fehle ihr die für die Einstellung als Beamtin erforderliche Eignung. Hätte die Klägerin Ludin ihre zunächst erwogene Absicht in die Tat umgesetzt – sie gab gut einen Monat nach der Entscheidung des BVerwGs seelisch ermüdet auf und wollte nicht ein zweites Mal vor dem BVerfG klagen, aber es wird mit Sicherheit irgendwann eine andere Muslimin ein ihrem (auf jeden Fall angeblichen) religiösen Bedürfnis entgegenstehendes Landesgesetz wegen des Kopftuchverbots mit einer Verfassungsbeschwerde angreifen – und sollte dann in dieser Sache das BVerfG die Ansicht der Klägerin teilen und die entsprechende Bestimmung im baden-württembergischen oder einem anderen ähnlich lautenden Landesschulgesetz mit Blick auf die Religionsfreiheit der Klägerin als nicht ausreichend für die vorgenommene Einschränkung ansehen, dann verfügt die jeweilige Klägerin plötzlich doch wieder über die ihr vom BVerwG aus grundsätzlichen Erwägungen heraus höchstrichterlich abgesprochene und für eine Einstellung als Beamtin erforderlich angesehene Eignung, ohne dass sie sich geändert hätte! In Baden-Württemberg ist das Tragen von Kopftüchern und anderen religiösen Symbolen trotz des Leipziger Urteils nicht generell untersagt. Bei der Verhandlung in Leipzig räumte der Prozessvertreter des Landes ein, es könne "regionale Ausnahmen" für Kopftuchträgerinnen geben: In einer Stadt mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil etwa könne die Prognose, ob das Kopftuch einer Lehrerin den Schulfrieden störe, anders ausfallen als im katholisch geprägten Schwarzwald. Dies gelte allerdings nur für Lehrerinnen, die bereits in den Schuldienst eingestellt seien. Hintergrund ist, dass in Baden-Württemberg an einigen Schulen Ordensschwestern im Habit »normalen« Unterricht geben, das Bundesverfassungsgericht aber auf einer Gleichbehandlung der Religionen bestehen wird. Das Gesetz sei "bewusst abstrakt" gehalten, um auch den "Turban von Sikhs" bei Lehrern in öffentlichen Schulen zu verhindern, betonte der Vertreter des Landes Baden-Württemberg. Ordenstrachten von Nonnen hingegen seien eine "Berufsbekleidung für einen religiösen Beruf". Eine mehr als gewagte Behauptung! „NONNENTRACHT AN SCHULEN ’Eindeutig religiös motivierte Kleidung’ Baden-Württemberg hat Kopftücher bei Lehrerinnen verboten, will Nonnen aber weiter in ihrer Tracht unterrichten lassen - das sei nur ’Berufskleidung’, so die eigenwillige Definition von Kultusministerin Schavan. Ein ehemaliger Verfassungsrichter widerspricht energisch. Und Deutschlands oberste Ordensschwester ebenfalls. Der Streit um die Reichweite des Kopftuchverbots in Baden-Württemberg spitzt sich zu. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde vertritt im Gegensatz zum Land die Auffassung, dass das Verbot sich auch auf die Nonnentracht erstrecke. Das inzwischen schriftlich vorliegende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Juni, das der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin den Zugang zum Schuldienst des Landes verwehrte, sei in dieser Frage ’eindeutig’, betonte Böckenförde am Mittwoch: ’Es trifft das Kopftuch und das Ordensgewand, das Kreuz am Revers und die jüdische Kippa’, so Böckenförde in der ’Süddeutschen Zeitung’. Der Versuch des Landes Baden-Württemberg, das Ordensgewand als ’Berufskleidung’ zu deklarieren, tue ’allen Nonnen einen Tort an’, sagte der Staatsrechtler weiter. Wer das Ordenskleid zur Berufskleidung umdeute und ihm damit ’den Charakter des religiösen Bekenntnisses nehmen’ wolle, beleidige alle Nonnen: ’Der sollte sich mal über den Ritus der Einkleidung informieren, wenn die Ordensschwestern ihre Gelübde ablegen und ihren Ordenshabit überreicht bekommen, als Zeichen dafür, dass sie ihr Leben in besonderer Weise Gott widmen.’ Auch die oberste Ordensschwester in Deutschland bewertet das Ordensgewand anders als das Land. Die Nonnentracht sei ’eindeutig eine religiös motivierte Kleidung’, sagte die Vorsitzende der Vereinigung der Ordensoberinnen Deutschlands (VOD), Schwester Aloisia Höing, im thüringischen Heiligenstadt. Die Auffassung vom Habit als ’Berufskleidung’ sei hingegen ‘zu eng’ und ‘etwas komisch’. ‘Land muss sein eigenes Gesetz befolgen’ Kultusministerin Annette Schavan (CDU) hatte am Montag Darstellungen zurückgewiesen, wonach das Kopftuchverbot auch Nonnen trifft. Das Bundesverwaltungsgericht habe zwar den Grundsatz der 111 strikten Gleichbehandlung der Religionen betont. Über das Tragen einer ‘Berufskleidung’ von Ordensschwestern habe es aber nicht ausdrücklich entschieden, da diese Frage nicht Ausgangspunkt des Prozesses gewesen sei. Böckenförde verwies jedoch auf eine Urteilspassage, in der es heißt: ‘Ausnahmen für bestimmte Formen religiös motivierter Kleidung in bestimmten Regionen’ kämen ‘nicht in Betracht’. Der Jurist sieht das Land jetzt in einem Dilemma. ‘Befolgt es sein eigenes Gesetz so, wie es nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verfassungsrechtlich nur Bestand haben kann, muss es den Nonnenhabit verbieten’, sagte er. Ansonsten nähme das Land ‘sein eigenes Schulgesetz nicht ernst’. Eine muslimische Lehrerin, der das Kopftuch verboten werde, könne nun gerichtlich durchsetzen, dass Nonnen in der Schule den Schleier ausziehen müssen. Höing sagte, wenn man an Schulen ‘generell jede Religiosität ausblenden’ wolle, wäre auch ein Verbot des christlichen Ordensgewands nur folgerichtig. Sie könne sich aber ‘nicht vorstellen, dass dies in unserer Gesellschaft stillschweigend hingenommen’ würde. Höing, die Generaloberin der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel (SMMP) ist, betonte, dass Nonnen das Ordenskleid auch privat tragen. Es sei ‘ein Lebenskleid’. Der Habit sei ‘ein Zeichen der Religiosität und der Beziehung zu Gott’. Die Tracht verweise auf ‘eine Lebensform in Gelübden’. Die VOD vertritt knapp 28.000 Ordensfrauen aus mehr als 300 verschiedenen Gemeinschaften. Als Lehrerinnen sind nach Angaben Höings 693 Nonnen tätig, die meisten jedoch nicht an staatlichen, sondern an ordenseigenen oder kirchlichen Schulen. Von Norbert Demuth, ddp“ (SPIEGEL ONLINE 13.10.04) Vor dem BVerwG war gleichzeitig die Klage einer niedersächsischen muslimischen Lehrerin verhandelt worden. Niedersachsen hatte ähnlich der Formulierung in dem baden-württembergischen Gesetz zunächst auch an eine Formulierung gedacht, die dezidiert christliche Bekleidung oder Symbole von der Neutralitätspflicht freigestellt hätte, dann aber die Ausnahmeklausel wegen verfassungsrechtlicher Bedenken wieder gestrichen. Dort heißt es im Schulgesetz nun: "Das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften in der Schule darf, auch wenn es von einer Lehrkraft aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen gewählt wird, keine Zweifel an der Eignung der Lehrkraft begründen, den Bildungsauftrag der Schule überzeugend erfüllen zu können." Deswegen konnte die gegen das Land klagende Lehrerin Iyman Alzayed nicht obsiegen. Sie zog während der Verhandlung die Klage zurück, sicherte zu, dass sie in der Schule kein Kopftuch tragen würde und erhielt auf Grund dieser »negativen Bekleidungszusage« noch im Gerichtssaal eine Einstellungs- und Verbeamtungszusage. Den Ausschlag für ihren »Teilerfolg durch Aufgabe« gab laut "Focus" ihre finanzielle Situation: Die Klägerin ist keine Einwanderin, sondern gebürtige Deutsche. Sie hieß früher Iris Pörtge, wurde in Hamburg geboren und wuchs in einem Dorf nahe Hannover auf. Nach ihrem Studium der Pädagogik für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen sattelte sie noch Waldorfpädagogik und Arabistik drauf. Später heiratete sie einen Syrer und konvertierte 1990 vom evangelischen zum islamischen Bekenntnis. Alzayed unterrichtete an einer Privatschule für verhaltensgestörte Kinder, an Waldorfschulen und an der Volkshochschule. 1999 schien ihr eine Stelle an einer staatlichen Grundschule in Soltau in der Lüneburger Heide bereits sicher. Der Personalrat beschrieb sie als "kompetente, offene und sehr aufgeschlossene Pädagogin, die rasch unsere Herzen gewann", trotz Kopftuch. Und auch der Schulleiter sagte, Alzayed sei "hervorragend für die Arbeit an unserer Schule qualifiziert". Im Stundenplan war sie bereits für die Klasse 3b eingeteilt, durfte die Stelle dann aber nicht antreten, weil die Lüneburger Bezirksregierung wegen ihres Wunsches, im Unterricht ein Kopftuch tragen zu können, gegen sie entschieden hatte. Die Eltern bangten um den geregelten Unterricht. Mitsamt den Drittklässlern reisten Mütter und Väter nach Hannover, wo die Schüler sich Kopftücher aufsetzten und vor dem Kultusministerium demonstrierten. Die Proteste fruchteten nicht. Obwohl es keine Indizien dafür gab, dass Alzayed den Schulfrieden gefährdete, stellte das Land sie vor die Wahl "Kopftuch oder Klassenzimmer". Die Muslimin wehrte sich gegen das "Berufsverbot" und kämpfte für ihr "Recht auf Unterricht". Ob sie Kopftuch trage oder barhäuptig unterrichte, hält sie für ihre Privatsache: "Ich habe immer nur positive Resonanz von Seiten der Eltern und Schüler erhalten und nie versucht zu indoktrinieren. Das Kopftuch ist einfach meine Art mich zu kleiden. Dass ich meine Haare nicht zeige, ist selbstverständlich religiös und nicht politisch motiviert." Nach der Scheidung kämpfte sie um das materielle Überleben, schlug sich bis dahin als Honorarkraft durch und hatte mit 46 Jahren - einem Alter, in dem seit einigen Jahren in der Privatwirtschaft schon viele mehr oder minder rücksichtslos aus dem Berufsleben ausgemustert werden - wegen ihrer auf Grund der vom Land verweigerten Anstellung weiterhin unsicheren Berufsaussichten nicht mehr die Kraft für weitere grundsätzliche Kämpfe: "Ich bin sehr glücklich, dass ich den Schlussstrich unter das Verfahren gezogen habe", sagte sie, "ich bin nun sehr gespannt darauf, wie es sich anfühlt, ohne Kopftuch in die Schule zu gehen. Die Umstellung wird 112 mir sicher nicht leicht fallen." Zwar lasse das niedersächsische Gesetz viele Deutungen zu, "aber ich habe nicht mehr die Kraft, die genaue Interpretation durch sämtliche Gerichte prüfen zu lassen". Obwohl in diesem Fall der Grundsatzstreit irgendwann bis zur letztmöglichen Instanz gerichtlich geklärt werden muss, um genau zu wissen, was fürderhin „Sache sein soll“, wird an dem persönlichen Schicksal der Klägerin die Tendenz von Behörden, Versicherungen und großen Firmen andeutungsweise deutlich, einen Rechtsstreit möglichst so lange hinzuziehen, bis dem armen Würstchen auf der Gegenseite die Luft zum Atmen, das Stück Brot zum Überleben fehlt; das kann keiner bis hinab auf den abgrundtief ängstigenden Grund der Seele verstehen, der nicht selber eine ähnliche Situation hatte durchleiden müssen – wie sie auch der Autor in seinem siebeneinhalbjährigen juristischen Kampf gegen das Land Hamburg nach durch Landesverrat im Bundesamt für Verfassungsschutz durch den „Fall Tietge“ verursachter Beendigung seiner Doppelagententätigkeit gegen das MfS und für das Land Hamburg um seine Wiedereinstellung als Lehrer selber jahrelang hatte durchleiden müssen (SPIEGEL 39/85 S. 103).21 Unter Muslimen herrsche nach dem Leipziger Urteil zunächst große Enttäuschung, die sich aber nach zwei Monaten legte und in erneute Begeisterung umschlug: „Eine deutsche Heldin des Islam aus Hannover Fünf Jahre kämpfte Iyman Alzayed vergeblich für das Recht auf Kopftuch in deutschen Klassenzimmern. Nun wandert sie aus - nach Österreich von Till-R. Stoldt Furchtbar waren Iyman Alzayeds Nächte zwischen dem 13. und dem 16. August. Immer wieder wachte die deutsche Muslima schweißgebadet auf. Schlief sie wieder ein, kamen sofort die unruhigen Träume, in denen es stets um eine Frage ging: Durfte sie das Kopftuch ablegen, um eine Stelle als Lehrerin in ihrer Heimatstadt Hannover zu bekommen - oder sollte sie nach Wien auswandern, wo sie mit Kopftuch lehren dürfte? Nun hat sich die Deutsche, die vor 15 Jahren zum Islam konvertierte und vor ihrer Ehe mit einem Syrer Pörtge hieß, für Wien entschieden. Seitdem gilt sie unter Muslimen als Heldin der islamischen Sache. Im Juni war das noch anders. Gemeinsam mit der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin wartete sie im Leipziger Bundesverwaltungsgericht auf das vorerst letzte ‘Kopftuch-Urteil’. Die Richter hatten über zwei Schulgesetze zu entscheiden, denen zufolge muslimische Lehrerinnen entweder aufs Kopftuch oder aufs staatliche Klassenzimmer verzichten müssen. Das in Baden-Württemberg erlassene Gesetz betraf Frau Ludin, das niedersächsische Frau Alzayed. Nachdem das württembergische Schulgesetz für rechtens erklärt worden war, kam Alzayed an die Reihe. Die 46-Jährige hatte mit ihrem Anwalt auf der Sitzbank gegenüber den Richtern Platz genommen, neben ihr saßen die Prozessvertreter Niedersachsens. Plötzlich erhob sie sich und sagte, sie habe nie beabsichtigt, geltendes Recht zu missachten. Anders als Frau Ludin sei sie bereit, ohne Kopfbedeckung zu lehren, ihr Fall müsse nicht verhandelt werden. Die überraschten Mienen der Prozessteilnehmer dürften nicht in allen Fällen spontan gewesen sein, schließlich hatte Alzayed ihren Entschluss dem Kultusministerium zuvor schriftlich mitgeteilt. Noch im Saal versprach ihr der Vertreter Niedersachsens daraufhin eine Anstellung. Die deutsche Muslima freute sich über die späte Aussicht auf eine Beamtenstelle, steckte sie doch nach der Scheidung von ihrem syrischen Mann in einer finanziellen Notlage. Und: Sie war des Streitens müde. Die anderen Muslime im Gerichtssaal, zum Beispiel Ali Kizilkaya, Vorsitzender des deutschen Islamrats, waren indes enttäuscht von der kapitulierenden Kopftuch-Kämpferin. Dennoch: ‘Von dem Moment an’, erzählt Alzayed, ‘waren alle bemüht, mir entgegenzukommen.’ Umgehend bekam sie die Stelle an einer Hauptschule in Hannover angeboten. Die Vorstellungsgespräche mit den Schulleitern wurden auf den Nachmittag gelegt - wenn nur wenige Menschen die Schule bevölkerten und Alzayeds offenes Haar sehen konnten. Denn zu diesen Gesprächen musste sie schon ohne Tuch erscheinen. ‘Es war ein ziemlich befremdliches Gefühl, nach 15 Jahren unbedeckt durch die Öffentlichkeit zu laufen’, erinnert sie sich. Die Kollegen in spe waren freundlich und einfühlsam, niemand ließ Zweifel aufkommen, ob die neue Lehrerin willkommen sei, und keiner sprach sie auf ihr Kopftuch an. Durfte sie die Chance ausschlagen? Zumal die studierte Orientalistin, Deutsch- und Kunstlehrerin Erfolge in Sachen Integration vorweisen kann. So bewegte sie schon manch muslimisches Elternpaar, ihre Tochter selbst entscheiden zu lassen, ob die das Kopftuch tragen wolle. ‘Denn der 21 Näheres zu dem Fall, in den vier Gerichtszweige mit teilweise jeweils mehreren Instanzen eingebunden waren, siehe 7.16 Gerichtswesen. 113 Gott des Islam verwirft jeden Zwang in Glaubensfragen’, argumentierte Alzayed mit Koran und Propheten-Worten. Sie konnte mit einem Moslem-Bonus arbeiten. Was lag da näher, als diese Arbeit fortzusetzen? Doch zur gleichen Zeit spürte sie leisen Widerwillen aufsteigen gegen den Traumjob ohne Kopftuch. Wenn sie früh morgens ihren blauen Gebetsteppich auf den beigen Holzboden des Wohnzimmers legte, zum Gebet niederkniete und Zwiesprache mit ihrem Schöpfer hielt, beschlich sie eine Sorge: ‘Werde ich ohne Kopftuch mein Glaubensleben weiterführen? Wird es verfallen? Werde ich dann eine andere?’ Auch wurde ihr zusehends klarer, dass sie nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch auf Schulfahrten, auf dem Schulhof oder bei Elternbesprechungen ihre Haare würde lüften müssen. Je näher der Tag ihrer Beamten-Vereidigung rückte, umso unbehaglicher war ihr zu Mute. Doch dann, am Freitag, den 13. August, klingelte das Telefon. Es meldete sich ein Politiker aus Österreich, dessen Namen Alzayed nicht nennen möchte. Er schlug ihr vor, bei der Islamischen Akademie für Religionspädagogik in Wien zu arbeiten. Dort werde ein Abteilungsleiter bei der Ausbildung islamischer Religionslehrer gesucht. Alzayed war hin und her gerissen. Binnen zwei Tagen musste sie entscheiden, am Montag stand die Vereidigung an. Hektische Telefonkonferenzen mit ihrer Mutter und ihrer Tochter begannen. ‘Kind, sei nicht dumm, nimm die Beamtenstelle an’, riet die 81-jährige Mutter Alzayeds. ‘Ich freue mich auf die Besuche in Wien’, jubelte dagegen ihre Tochter. In den Telefonpausen saß Alzayed auf ihrem bunt bepflanzten Balkon und wog Argumente ab. Vor allem ein Gedanke kam ihr dabei in den Sinn: Fünf Jahre lang hatte sie durch mehrere Instanzen prozessiert, seit ihr die Stelle an einer öffentlichen Schule wegen des Kopftuchs verweigert worden war. Fünf Jahre war sie bei Podiumsdiskussionen und Fernseh-Talk-Shows (unter anderem mit Alice Schwarzer) als verklemmt oder reaktionär verunglimpft worden, wurde ihr Verfassungs- und Frauenfeindlichkeit, Naivität oder gleich alles zusammen unterstellt. Fünf Jahre kämpfte sie für das Recht auf Kopftuch im Klassenzimmer und für eine Botschaft, die sie damit einhergehen sah: dass Deutschland eine gute Heimat auch für gläubige Muslime sei, und ‘dass integrationswillige muslimische Frauen eine berufliche Chance bekommen, auch wenn sie ihrer Religion treu bleiben wollen.’ Nach all dem sollte sie selbst nun ohne Kopftuch lehren? Am Tag der Vereidigung trat sie vor den Direktor der Hauptschule, der sie in bester Laune empfing, und sagte ab. ‘Aber der Direktor wurde nicht im geringsten wütend oder unwirsch’, erzählt Alzayed, während sie an ihrem vielleicht 15 Zentimeter niedrigen arabischen Wohnzimmertisch auf dem Boden sitzt und ziemlich gerührt in ihren Café schaut. ‘In dem Moment stiegen mir wirklich Tränen in die Augen’, sagt sie. Und während sie das ausspricht, steigen ihr die Tränen gleich noch einmal hoch. Es hat sie beeindruckt, wie wohlwollend eigentlich alle auf Seiten der ‘Kopftuch-Gegner’ waren - ob in der Schule, in der Bezirksregierung oder im Kultusministerium. Diesen Mittwoch wird sie vieles, das ihr lieb ist, hinter sich lassen: Familie, Freunde, ihre schöne Wohnung mit den zwei kleinen Balkons und ihre Heimatstadt, an der sie ‘jämmerlich hängt’, wie sie sagt. Dann fliegt sie nach Wien, um den Vertrag zu unterschreiben und ihre Bleibe, die Wohnung einer Freundin, zu besichtigen. Nun gilt sie wieder als Heldin der Gläubigen. Auf manchen islamischen Websites wird ihr Umzug gar als ‘kleine Hidschra’ gefeiert. ‘Hidschra’ heißt die Auswanderung des Propheten Mohammed, der 622 aus seiner Heimat Mekka floh, weil er dort wegen seines Glaubens verfolgt wurde. Alzayed will von diesem Vergleich allerdings nichts wissen. Was ihr Prophet erlebt habe, sei ‘doch etliche Nummern größer.’ Dabei könnte ihr die Geschichte des Propheten Mut spenden: Mohammed kehrte acht Jahre später zurück in seine Heimatstadt - im Triumphzug.“ (DIE WELT 29.08.04) Nach dem Urteil des BVerwGs hatte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland noch erklärt, christliche und jüdische Traditionen würden privilegiert, die islamische Religionsausübung benachteiligt. Das ist aber ausweislich des nächsten Falles nicht immer so ist: Zweit- und Drittfrauen kostenlos mitversichert Kritik an Regelung für Moslems … Hamburg - Von der Familienversicherung der gesetzlichen Krankenkassen profitieren nicht nur der Ehepartner und alle Kinder, auch Zweit- und Drittfrauen sind kostenlos mitversichert. Frauen, die mit einem moslemischen Mann nach nicht-deutschem Recht wirksam in polygamer Ehe verheiratet seien, hätten auch einen Unterhaltsanspruch gegenüber dem Ehemann, heißt es laut dem 114 Nachrichtenmagazin "Spiegel" in einer Stellungnahme des Gesundheitsministeriums für den Petitionsausschuß des Deutschen Bundestags. Es sei daher rechtlich nicht zu beanstanden, wenn diese Frauen beitragsfrei familienversichert sind. Um wie viele Fälle es sich handelt, ist unbekannt. Kritik an der Praxis übte der FDPBundestagsabgeordnete Volker Wissing. Die Ehe mit mehreren Harems-Frauen sei mit westlichen Werten unvereinbar. Die Bundesregierung müsse darauf achten, diese nicht über den Umweg der Sozialversicherung zu stützen. … (HH A 18.10.04) Allerdings können sich solche Leute keinerlei Hoffnung darauf machen, dass ihrem Antrag auf Einbürgerung in Deutschland stattgegeben wird. Sie müssen sogar in Kauf nehmen, dass sie ihre irgendwann irgendwie erworbene deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie in (nur) vom Koran erlaubter Vielehe leben: „Wer Doppelehe führt, darf nicht Deutscher sein Lüneburg - Eingebürgerte Ausländer verlieren bei Doppelehe die deutsche Staatsangehörigkeit. Das hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden (Az.: 14 LA 58/04). Es ging um einen 1998 eingebürgerten Mann, der zu der Zeit in Niedersachsen mit einer Deutschen und in Pakistan mit einer Pakistani verheiratet war. Das OVG: Dem Mann fehle die ’Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse’. dpa“ (HH A 02.11.04) Der Zentralrat der Muslime in Deutschland sieht eine einseitige Erlaubnis zum Tragen christlicher oder jüdischer Symbole zu Recht als verfassungswidrig an. Inzwischen bat die Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission um nähere Auskünfte. Die EU-Kommission äußerte die Sorge, dass die Anti-Kopftuch-Gesetze verschiedener Bundesländer mit dem Diskriminierungsverbot des europäischen Rechts unvereinbar sein könnten. Grundlage dafür seien drei Gleichbehandlungs-Richtlinien der EU sowie die Europäische Konvention der Menschenrechte. Nun steht für die Klägerin Ludin der nächste Gang nach Karlsruhe vor das BVerfG an; vielleicht wird dann zusätzlich der Europäische Gerichtshof in Straßburg angerufen – und dann könnte sich bei gegensätzlichen Urteilsaussprüchen erneut das spannende juristische Problem auftun: Welche Rechtsprechung hat in Grundrechtsfragen in Deutschland Vorrang: die des BVerfGs oder die des EuGH? Zum Schluss dieses Kapitels noch ein albernes Beispiel, das deutlich machen soll, dass der in mehreren Grundrechtsartikeln geregelte, den Staat verpflichtende Gleichbehandlungsgrundsatz im reinen Zivilrecht zwischen Privatpersonen nicht immer gilt, auch gar nicht immer gelten kann: Wenn ein Mann eine attraktive Frau durch eine Heiratsannonce kennen gelernt hat, so kann er nicht von ihr verlangen, dass sie ihn heiraten müsse, weil er der erste passable Bewerber gewesen und ihr wegen der Geltung des speziellen Gleichheitssatzes eine Differenzierung verboten sei. U.a. in diesem Bereich des Privatrechts kann Art. 3 GG keine Geltung beanspruchen. Da gilt die »Vertragsfreiheit« uneingeschränkt: Man kann sich aussuchen, wo man »Haussklave« sein, wen man als »Haussklaven« um sich haben möchte. Für die genaueren Bedingungen, unter denen man »Haussklave« oder frau »Haussklavin« sein möchte hingegen, gilt die »Vertragsfreiheit« in Eheverträgen nicht uneingeschränkt. Die Gerichte der USA scheinen da eine größere »Vertragsfreiheit« zu akzeptieren als bei uns, denn die Latino-Diva Jennifer Lopez wollte sich von ihrem Zukünftigen Ben Affleck per Ehevertrag vier Mal pro Woche Sex versprechen lassen und für jeden Seitensprung fünf Millionen Dollar. Ob solche Sex-Klauseln in Deutschland wirksam wären, ist umstritten. Der BGH hat bereits vor Jahren entschieden, selbst der „Gebrauch empfängnisverhütender Mittel“, mit denen einer Schwangerschaft und den damit verbundenen Unterhaltszahlungen im Falle des Scheiterns der Ehe von vornherein vorgebeugt werden sollte, sei „einer rechtsgeschäftlichen Regelung nicht zugänglich“.22 In Amerika scheint das mit der Geltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Zivilrecht anders zu sein. Da scheint eine staatliche Institution die Rechtsmacht zu haben, anordnen zu können, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz auch im Zivilrecht außerhalb des Monopolbereiches zwischen völlig willkürlichen Vertragspartnern zu gelten habe: 22 SPIEGEL 08.12.03 115 „Gleichberechtigung SAD New York – Steigen die Preise für Herrenhaarschnitte beim Friseur und für Oberhemden in der Reinigung jetzt auf Damen-Niveau? Die Stadt New York hat jedenfalls per Gesetz verboten, daß Frauen beim Haar-Stylisten und für die Säuberung ihrer Blusen mehr bezahlen müssen als Männer.“ (HH A 14.01.98) Was meinen Sie: Wurde da von dem Gesetzgeber gemäß dem dort wohl auch zum Tragen kommenden Gleichbehandlungsgebot wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich behandelt? Ich habe da so meine Zweifel: Hinsichtlich der Blusen vermag ich die Gleichbehandlung so zu sehen, aber wie wenige Frauen sind bei ihrem Friseur nach spätestens einer Viertelstunde wieder draußen, wie ich? Wenn allerdings eine Frau eine sportliche Kurzhaarfrisur trägt wie viele andere Männer außer mir, dann vermag ich ebenfalls keine Berechtigung für abzockende überhöhte Preise zu erkennen. Und noch ein »obiter dictum«: Ich würde als Arbeitgeber nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit an Männer und Frauen zahlen. Welcher Mann muss schon z.B. hinreißend schöne Spitzen-BHs, Nagellack, teure Dessous und Lippenstifte kaufen und rund fünffach so teure Friseurrechnungen bezahlen? Von den Kosten für die Anti-BabyPille und andere periodisch notwendige Aufwendungen fast zu schweigen. Ich finde, dass Frauen wegen ihres erhöhten »Renovierungsaufwandes«, der dann uns Männer verstohlen oder offen bewundernd hinschauen lässt, bei gleicher Arbeit einen »Frauenzuschlag« für »Kunst am Bau« bekommen müssten! Die in Art. 3 II GG angeordn ete Gleichber echtigung von Frau und Mann als Konkretis ierung des allgemein en Gleichhei tssatzes 1.3.2.2 Gleichberechtigungsproblematik 1.3.2.2.1 Die in Art. 3 II GG angeordnete Gleichberechtigung von Frau und Mann als Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes Nach der an dem letzten Beispiel für ein relativ unwichtiges juristisches Problemfeld exemplarisch aufgezeigten Bedeutung des allgemeinen Gleichheitssatzes des Art. 3 I GG nun zu dessen als Konkretisierung angesehenem Absatz 2. Der auf Vorschlag der Sozialdemokratin Selbert nach zwei Abstimmungsniederlagen doch noch in das GG gebrachte und bis 1994 ausschließlich so formulierte Art. 3 II GG "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." ist eine (zur stärkeren Betonung der immer noch nicht voll verwirklichten juristischen Gleichberechtigung der Frauen) der Neuformulierung unterliegende Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes für das spezielle Gebiet der rechtlichen Behandlung der beiden Geschlechter: Dem »kleinen Unterschied« soll unter der Geltung des Grundgesetzes grundsätzlich keine rechtliche Bedeutung mehr zukommen, obwohl es Unterschiede auch weiterhin geben wird: Ein Mann, der nur mit einem Mantel bekleidet ist und ab und zu »etwas« blicken lässt, kann gemäß „§ 183 StGB Exhibitionistische Handlungen (1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.“ strafrechtlich verfolgt werden. Wenn aber Frauen nicht nur in tief ausgeschnittenen Kleidern ohne BH, sondern im Sommer 1999 vorzugsweise »slipless« rumliefen und auf Grund äußerst kurzer Kleidchen bewusst tiefe Einblicke nehmen ließen, dann war das in dem Sommer Zeitschriften zufolge eine von den USA auf Europa rüberschwappende Modewelle, die aber nicht strafbewehrt ist. Der Gesetzgeber mochte den Frauen nicht unter die Röcke kucken. Als aber die bauchfreie Mode und das Tragen der Tanga-Strings überhand nahmen, erließ 2004 in den USA ein Bundesstaat ein Gesetz gegen zu knappe Hüfthosen, aus denen die Unterwäsche ansatzweise hervorlugt. Ein anderer Bundesstaat folgte: 116 „Zu knappe Jeans – erstes Verbot? Washington – Tief sitzende Hosen werden im US-Bundesstaat Louisiana möglicherweise bald strafbar. Mehrere Abgeordnete wollen Hosen, die Slips herausragen lassen, per Gesetz verbieten. Geplante Strafe: 175 Dollar. (afp)“ (HH A 13.05.04) Also doch slippless: Dann spart man nicht nur das Geld für die ansonsten fällige Strafe. (Und weniger infizierend als ein zwischen den Schamlippen besonders tief einschneidender Tanga-String soll diese gewollt mangelhafte Be- oder besser: Entkleidung einer 2004 veröffentlichten medizinischen Untersuchung zufolge auch noch sein!) Aber nicht alle us-bundesstaatlichen Gesetzgeber waren so prüde wie die in Sachen Bekleidungsmoral vorpreschenden: „Tangas dürfen weiter blitzen Washington - Teenager im US-Staat Virginia dürfen ihre Hüfthosen weiter so tief tragen, daß sie den Blick auf Shorts und Tangas erlauben. Das Parlament wollte das, wie berichtet, wegen "Unzüchtigkeit" unter Strafe stellen (50 Dollar). Doch der Senat kippte den Entwurf. ap“ (HH A 12.02.05) Die Männer der Königinnen von Großbritannien, Dänemark und die inzwischen verstorbenen Ehemänner der Königinnen der Niederlande sind in diesen Adelsstand erhobene Prinzen. Der französischstämmige dänische Prinzgemahl äußerte darum gegenüber Reportern mehrfach sein Unverständnis - und wohl auch ein bisschen seinen Unwillen: vielleicht auch, weil dänische Staatsrechtler seine Rolle im dänischen Staatsgefüge einmal als die eines „nichtexistierenden Gastes“ definiert hatten - darüber, dass eine Frau durch Heirat mit einem Regenten zur Kaiserin oder Königin wird, er und seine Leidensgenossen jedoch nur zu Prinzen ernannt worden seien. Aber in Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden gilt halt nicht das Grundgesetz. Aber auch dort gelten Antidiskriminierungsgesetze, wie einer anderen Zeitungsmeldung zu entnehmen ist: Mediziner sagt Jetzt können auch Männer schwanger werden SAD London - ... Für Lord Robert Winston (58), Professor an der Londoner Universitätsklinik Hammersmith Hospital, sind schwangere Männer keine Utopie mehr. Mit der von ihm entwickelten Methode ... werden Männer zu Müttern. ... Und so funktioniert es: ... Es gibt sogar schon Freiwillige, die sich dieser revolutionären Behandlung, die die Evolution der Menschheit auf den Kopf stellt, unterziehen wollen. ... Tim Hedgley, Direktor der britischen Gesellschaft für Fruchtbarkeitsbehandlungen, zeigte sich erfreut: ‘Das ist keineswegs pervers. Schon unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung wäre es nicht möglich, einen Mann daran zu hindern, so etwas zu tun – das wäre Diskriminierung.‘“ (HH A 22.02.99) Trotz der eindeutigen Regelung im GG gibt es in unserer Gesellschaft Konservative, denen die ganze Richtung der Gleichberechtigung nicht passt. Damit ist nicht der Ehemann der folgenden Meldung gemeint: „Rotlichtposse Ehemann traf Frau im Bordell ddp Aachen – Dumm gelaufen: Einem 37-jährigen Aachener wird sein jüngster Bordellbesuch wohl in dauerhafter Erinnerung bleiben. Der Mann hatte ein einschlägiges Etablissement in der Kaiserstadt aufgesucht. Dabei traf er zu seiner großen Überraschung auf seine 30-jährige Ehefrau, die als Gelegenheits-Prostituierte ihr Haushaltsgeld aufbesserte. ...“ (HH A 26.05.01) Das kommt davon, wenn Mann zu knickerig ist und seine Frau zu knapp hält! Aber gemeint waren eben Konservative der nachfolgend zum Ausdruck kommenden (Un-)Geisteshaltung: „Konservative Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Rolf Hille, hat bekräftigt, daß eine 117 Unterordnung von Frauen unter ihre Ehemänner ‘von der Schöpfung her begründet‘ sei. Es bestehe ein ‘Gefälle‘ in der Rangordnung zwischen Mann und Frau. ...“ (HH A 05.01.96) Damit steht er nicht nur national, sondern auch international nicht allein: Im niederländischen Parlament gab es 2004 eine christliche Partei, in der Frauen qua Satzung keine öffentlichen Ämter übernehmen dürfen. Solche Leute können zur Begründung ihrer frauenfeindlichen Haltung zwar - für sie: ärgerlicherweise - auf kein diesbezügliches Jesus-Wort verweisen, da Jesus eine solche diffamierende Geisteshaltung nicht eigen war. Es wäre für sie natürlich am schönsten, da am »beweiskräftigsten«, wenn ein »Gotteswort« ihre verquere Argumentation stützen könnte! Doch in der sich durch das Fehlen eines »Gotteswortes« auftuenden Argumentationsnot helfen Bibelstellen mit Aussagen des Heidenapostels Paulus als Begründer des erst durch seine Missionsreisen über den jüdischen Kulturkreis hinausgreifenden Christentums als beginnende Weltreligion. Der nur in seiner Glaubensausrichtung, nicht aber in seiner sonstigen Geisteshaltung vom Judentum zum Christentum gewandelte Saulus verkündete und schrieb (laut älterer, inzwischen sprachlich ein wenig abgemilderter Bibelübersetzung ) als Paulus, die Weiber sollen den Männern „untertan sein, wie auch das Gesetz sagt“ (1. Korinther 14/34) – wobei unklar bleibt, ob der aus streng pharisäischer Familie stammende römische Bürger Saul/us das damals geltende römische Gesetz meinte, das dem „pater familias“ (Plural, da Vater der - ihm untergeordneten - Familien) als Familienoberhaupt absolute Gewalt über die seinem Willen und seiner Willkür unterstellten anderen Familienangehörigen, auch in den Familien seiner Nachkommen(!), einräumte, oder das jüdische Gesetz, von dem er das Christentum ja abgelöst hat. „Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei“ (1. Timotheus 2/12). „Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt; der Mann aber ist des Weibes Haupt ...“ (1. Korinther 11/3). „Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom Manne. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes Willen, sondern das Weib um des Mannes willen“ (1. Korinther 11/8 und 9), „denn Adam ist am ersten gemacht, darnach Eva. Und Adam ward nicht verführt; das Weib aber ward verführt und hat die Übertretung eingeführt“ (1. Timotheus 2/13 und 14). Weil es in der Thora im 1. Buch Moses („Genesis“) in Kapitel 2 so steht, dass Gott als ersten Menschen Adam geschaffen habe, der Herr dann befand: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei“ (1. Moses 2/18), er unter dem Getier nichts Passendes fand und deswegen dem in tiefen Schlaf versetzten Adam eine Rippe entnahm und daraus als seine „Gehilfin“ Eva formte, wurde daraus Jahrtausende lang - und von einigen Unverbesserlichen bis in unsere heutige Zeit - eine rechtliche Minderwertigkeit der Frauen gegenüber den Männern abgeleitet! Diese kirchlich geprägte Haltung der Frauendiffamierung und die darauf fußende Jahrtausende lange Benachteiligung der Frauen hat in der christlichen Kirche eine sehr lange zölibatär veranlasste Tradition, wobei sich die Verfechter dieser unchristlichen Geisteshaltung, einige Versatzstücke – teilweise ohne Rücksicht auf den Zusammenhang oder nachfolgende Sätze zu berücksichtigen – als Scheinargument aus dem Bibeltext23 herausgreifen. Ranke-Heinemann weist in ihrem verdienstvollen Buch „Eunuchen für das Himmelreich - Katholische Kirche und Sexualität“ durch belegte Zitate nach, wie Frauen durch Kirchenlehrer diffamiert und der Bibeltext zu diesem Zweck teilweise verfälscht wurde. So wird die Frau Junia, von Paulus in Römer 16/7 als „berühmt unter den Aposteln“ charakterisiert, sogar in meinem von der Deutschen Bibelstiftung Stuttgart 1975 als auf der Übersetzung Martin Luthers fußender „Revidierter Text“ herausgegeben, in den Worten Ranke-Heinemanns „... durch transsexuelle Manipulation zu einem Mann namens Junias umfunktioniert. Aber die alte Kirche wußte es besser. Für Hieronymus und Chrysostomus († 407) z. B. ist es ganz selbstverständlich, daß Junia eine Frau war. Chrysostomus schreibt: »Was muß das für eine erleuchtete Tüchtigkeit dieser Frau gewesen sein, daß sie des Titels eines Apostels würdig erachtet wurde, ja sogar unter den Aposteln hervorragend war« (... [Belegstelle; der Autor]). Bis in das späte Mittelalter hinein gab es keinen einzigen Ausleger, der in Römer 16,7 einen Männernamen gesehen hätte (...). Aber in dem anhaltenden Frauenverdrängungsprozeß der Kirche ist dieser Frauenname inzwischen von den Männern vereinnahmt. Die Geschichte des Christentums ist auch eine Geschichte des fortschreitenden Totschweigens und Entmündigens der Frauen. Und wenn diese Entmündigung sich heute im christlichen Abendland nicht mehr fortsetzt, so nicht dank, sondern trotz der Kirche und schon gar nicht in der Kirche. Der Frauendiffamierung in der Kirche liegt die Idee zugrunde, daß Frauen dem Sakralen als etwas Unreines entgegenstehen. Frauen waren nach klerikaler Einschätzung Menschen zweiter Klasse. Clemens Alexandrinus († vor 215) schreibt: Bei der Frau »muß schon das Bewußtsein von dem eigenen Wesen 23 Vgl. dazu Ranke-Heinemann, Uta: Eunuchen für das Himmelreich Katholische Kirche und Sexualität, Hamburg 1988, insbesondere S. 131 ff 118 Schamgefühl hervorrufen« ...“24 Diese von Clemens postulierte Wesensschande der Frauen, die in der frühen christlichen Kirche in rechtliche Form gegossen wurde und sich dann wegen der christlichen Leitwerte Europas für die Frauen in Europa und der von Europa beeinflussten oder beherrschten Welt zu einer nicht nur kirchlichen, sondern auch staatlichen Leidkultur - bis zum Wahnsinn der abergläubischen Hexenverbrennungen - auslebte, die sich in der Bundesrepublik Deutschland über die Schaffung des Grundgesetzes hinaus bis zum 31.03.1953 in den zahlreichen offenen rechtlichen Benachteiligungen der Frauen niedergeschlagen hat – die über diese vom BVerfG gesetzte Datumsfrist hinaus noch Jahrzehnte weiterhin fortlebenden Benachteiligungen der Frauen, z.B. im Ehegattennamensrecht, sollen einen Augenblick unberücksichtigt bleiben -, wurde von christlichen Theologen, u.a. im von den fanatischen deutschen Dominikanern Institoris und Sprenger 1487 publizierten „Hexenhammer“, der sich als Kommentar der „Hexenbulle“ des Papstes Innozenz VIII. von 1484 verstand und als Anleitung für die Folterungen im Namen der Inquisition die Grundlage für die sadistischen und perversen Frauenverfolgungen der Zeit der Hexenverfolgungen bildete, als diffamierendstes, von Frauen weder biologisch noch theologisch entkräftbares Totschlagsargument damit begründet, dass Gott selbst das männliche Geschlecht ganz offensichtlich bevorzugt habe und damit die Bevorzugung der Männer gottgewollt sei, weil Gott, wie jeder gläubige Christ im Glaubensbekenntnis anerkennt, in Jesus als Mann habe wiedergeboren und leiden wollen, das auch so getan und dieser Art die Sünden der Welt auf sich genommen habe, um so die Menschheit von ihrer Erbsünde zu befreien. Der Mann sei der Frau ganz offensichtlich auf göttlichen Willen hin auch deswegen übergeordnet, weil Gott in Adam zunächst einen Mann geschaffen habe, für den er dann aus dessen Körper eine Gefährtin moduliert habe, damit sie ihm diene. Außerdem ergebe sich die Minderwertigkeit der Frau gegenüber dem Mann aus ihrer lateinischen Bezeichnung „femina“: »Das Wort femina nämlich kommt von fe und minus. Fe = fides, Glaube, minus = weniger, also femina = die weniger Glauben hat; ...«“25 Das letztere, jahrhundertelang nicht mit einem Augenzwinkern, sondern wirklich ernsthaft vorgebrachte Argument setzt allem die Dornenkrone auf. Es ist ein schönes Beispiel für einen diabolisch-sophistischen, schnöden juristischen Scheinbeweis, mit dem etwas zur Wahrung des äußeren Scheins zu rechtfertigen versucht wird, was keine innere Rechtfertigung besitzt und auch nie erlangen kann, aber aus nacktem Machtinteresse heraus trotzdem durchgesetzt werden soll: die Unterdrückung der Frauen durch in ihrem Urgrund ängstliche Männer, die vor der Weiblichkeit und der ihr innewohnenden Kraft erzittern! „Von allen zeitbedingten Anordnungen des Neuen Testaments hat die katholische Kirche diejenigen, die sich auf eine Minderstellung der Frau beziehen, am sorgfältigsten bewahrt und noch aufgestockt.“26 Als ein Beleg für die unbiblisch-repressive Haltung der katholischen Kirche unter vielen wird darauf verwiesen, dass die Synode von Elvira am Anfang des 4. Jahrhunderts bestimmte, Frauen dürften im eigenen Namen weder Briefe schreiben noch empfangen. „Frauen hatten in der Kirche nach dem Willen ihrer geistlichen Hirten still zu sein, so still, daß sie nur tonlos die Lippen bewegen durften. ... Auch im Osten, auf einer persischen Synode in Nisibis 485, verboten der Metropolit Barsamus und seine Bischöfe den Frauen das Betreten des Baptisteriums und das Zuschauen bei der Taufe, weil daraus Unzuchtvergehen und unerlaubte Heiraten entstanden seien. ... Frauen dürfen nicht in der Kirche singen, bestimmten die Synodalstatuten des hl. Bonifazius († 754)“ (die im Hinblick auf den Frauengesang in der katholischen Kirche erst von Pius XII. 1958 vorsichtig geöffnet wurden, wenn die Frauen außerhalb des dem Priester und seinen männlichen Helfern vorbehaltenen Presbyteriums oder der Altarschranke singen; es stehen halt keine in z.B. der Sixtinischen Kapelle noch zu Beginn des 20 Jahrhunderts eingesetzte Kastraten mehr für die Sopran- und Altstimmen zur Verfügung, da braucht man für manche kirchlichen Gesänge nun doch Frauen). Wurde in den katholischen Kirchen das Singverbot für Frauen in Erinnerung an die männermordenden (weiblichen) Sirenen und die Versuchung des Odysseus propagiert und ausgesprochen? Dieses Verbot wurde noch 1903 von Pius X. bekräftigt, weil die Sänger in der Kirche ein liturgisches Amt bekleiden.27 Der 263. Papst Johannes Paul II. hat 1980 in einer Instruktion mit dem Titel »Das unschätzbare Geschenk« angeordnet: „Frauen sind nicht die Funktionen eines Meßdieners gestattet.“28 „Nimmt man die Repressionen gegen die Frauen, ihre Zurückdrängung, Diffamierung und Verteufelung alles in allem, so bedeutet die ganze Kirchengeschichte eine einzige lange Kette männlicher bornierter Willkürherrschaft über die Frau.“29 Wenn es nicht das von Hitler mit dem Apostolischen Stuhl geschlossene Konkordat und in religiösen Belangen 24 ebenda S. 132 f ebenda S. 245 f 26 ebenda S. 135 27 ebenda S. 137 ff 28 Vgl. ebenda S. 139 29 ebenda S. 140 25 119 den Rückgriff auf die Weimarer Verfassung gäbe, wäre das alles in Deutschland nach meinem Dafürhalten ganz offensichtlich und ohne jede weitere juristische Argumentationsnotwendigkeit grundgesetzwidrig! Nun wird aber in Art. 140 GG bestimmt, dass einige genau genannte Artikel aus der Weimarer Verfassung (WV) Bestandteil des Grundgesetzes seien. Art. 140 GG ist wie ein "Mantel-Gesetz" zu sehen, das alles von ihm Umhüllte ohne (nochmalige) nähere Ausführung auch im Grundgesetz zur Geltung bringt. Deswegen gilt u.a. "Art. 137 III WV Jede Religionsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde." Da jedoch in der Bundesrepublik das Grundgesetz für alle gilt und in Art. 3 II 1 steht: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." habe ich keinerlei juristische Schwierigkeiten damit, eine solche, die Frauen diskriminierende päpstliche Anordnung und kirchliche Praxis trotz des über Art. 140 GG mit Rückgriff auf Art. 137 III WV zugestandenen Rechtes, die kirchlichen Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde zu verleihen, als grundgesetzwidrig anzunehmen, da durch päpstliche Anordnung und kirchliche Praxis das Grundrecht, in diesem Fall der Frauen, aus Art. 3 II 1 GG nicht gewahrt ist! Und Grundrechte sind die höchsten juristischen Normen in unserem Staat. Außerdem wurde durch die Übergangsregelung des Art. 117 I GG bestimmt, dass dem Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 II GG entgegenstehendes (niederrangiges) Recht bis zum 31.03.1953 angepasst zu sein habe. Da müsste die Bundesrepublik im Vatikan vorstellig werden, dass das Konkordat den Forderungen des Grundgesetzes angepasst werden müsste, weil es sonst wegen seines Grundrechtsverstoßes einseitig von der Bundesrepublik Deutschland als nichtig erklärt werden müsste. Aber dieses Rückgrat hat keine Bundesregierung! In der evangelischen Kirche gibt es von den zuständigen Gremien gewählte Bischöfinnen! Wie soll da bei solchen gegensätzlichen Auffassungen eine Ökumene zwischen Protestanten und Katholiken gelebt werden? Die von Ranke-Heinemann sehr eindringlich nachgewiesene kirchlich veranlasste und über fast zwei Jahrtausende erfolgte repressive Frauendiffamierung und dann darauf gegründete Entmündigung der Frauen hat sich selbstverständlich in den eineinhalb Jahrtausenden seiner Praktizierung an Sonn- und kirchlichen Festtagen, von denen es in früherer Zeit wesentlich mehr gab, auch in dem Bewusstsein der Männer, die die Gesetze machten, festgesetzt und zu der die Männer viele, viele Jahrhunderte lang bevorzugenden Gesetzgebung geführt! Wir sehen wieder einmal: Letztlich waren und sind Gesetze oft (auch) durch religiöses Bewusstsein gegründet, auch heute noch, gleichgültig, ob es sich um Abtreibungsregelungen, das Embryonenschutzgesetz oder ... handelt. Und mein Gerechtigkeitsempfinden packt die kalte Wut auf die die Frauen diffamiert habenden - und die, wie aus der vorstehenden Zeitungsnotiz über den Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz ersichtlich, die Frauen immer noch diffamierenden - Männer, wenn ich mir das Wissen erarbeite, dass die Sozialdemokratin Selbert bei der Schaffung des Grundgesetzes 1948/49 zwei Abstimmungsniederlagen hinnehmen musste, bevor die Männer - wenigstens mehrheitlich - nachgaben und im Grundgesetz stehen konnte: Art. 3 II GG "Männer und Frauen sind gleichberechtigt." Was »be-recht-igt(e)« die Männer zu einer dem Wortlaut entgegenstehenden, die Frauen benachteiligenden Haltung? Wie kann es sein, dass ein solcher Mann mit einer solchen, in den Jahren seines gesellschaftlichen „Aufstiegs“ bestimmt nicht verheimlichten, sondern sicher offensiv vertretenen „Denke“ auf Grund einer solchen Geisteshaltung an die Spitze des von ihm vertretenen Verbandes gewählt und Rolf Hille als Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz 1996, nach 50 Jahren der Geltung des Grundgesetzes, solche „bekräftigende“ Frauendiffamierung absondern konnte, ohne noch am selben Tag von seinem Amt zurücktreten zu müssen? Was tummelt sich da selbst in der evangelischen Kirche noch für ein an seit Jahrtausenden veraltetem Denken orientierter Verband und wagt es, heute noch mit solchen grundgesetzwidrigen Verlautbarungen an die bundesrepublikanische Öffentlichkeit zu treten? Eine Unterordnung von Frauen unter ihre Ehemänner sei „von der Schöpfung her begründet. Es bestehe ein Gefälle in der Rangordnung zwischen Mann und Frau“. KirchenMacho! Ich gebe allerdings auch zu, gleichermaßen Schwierigkeiten mit den religiös gebundenen Feministinnen zu 120 haben, die - in psychologisch nachvollziehbarer Überreaktion auf die Jahrtausende lang praktizierte Zurücksetzung - beten: „Vater und Mutter unser, ...“ und die „Heilige Geistin“ anrufen; was die katholische Kirche im Mai 2001 für ihren Bereich ausdrücklich verbot. Und selbst in den USA, wo man so sehr auf »political correctness« achtet und sie selbst im nicht-öffentlichen Bereich durch horrende Strafgelder auch erzwingen kann, werden aus übergeordneten Gesichtspunkten Abweichungen vom Grundsatz der Gleichberechtigung vorgenommen: „Der König hört nicht auf Frauen Washington – Saudische Vertretet haben im Vorfeld des US-Besuchs von Kronprinz Abdullah den Flughafen von Waco aufgefordert, Frauen aus dem Tower zu verbannen, damit das Flugzeug nicht von Frauen angesprochen wird. Der Bitte sei entsprochen worden. (afp)” (HH A 23.04.02) Doch wenden wir uns wieder der Gleichberechtigungsproblematik des Grundgesetzes zu. "Neutrale Sprache ddp Bonn - Der Bundestag hat sich dafür ausgesprochen, geschlechtsspezifische Formulierungen in der Rechtssprache künftig zu vermeiden. Bezeichnungen wie Vertrauensmann oder Lehrherr sollen durch neutrale Begriffe ersetzt werden." (HH A 16.01.93) Und damit kann man sich schwer tun: Nebenwirkinnen Hamburg · 13. März · dpa · Die Bundesregierung will die Pharmaindustrie zwingen, die Gleichstellung von Mann und Frau auch bei der Reklame für Arzneimittel zu beachten. Mussten die Pillenhersteller den Verbrauchern bislang anraten, den "Arzt oder Apotheker" zu befragen, soll es künftig nach einem Bericht des Magazins Der Spiegel den "geschlechtergerechten" Hinweis geben: "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, holen Sie ärztlichen Rat ein und fragen Sie Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker." Arzneifirmen und Werbewirtschaft gefalle der neue Text überhaupt nicht, schreibt das Magazin: Der Warneffekt gehe verloren, wenn der Satz noch länger werde. Befürchtet werde zudem, Drogistinnen und Drogisten könnten ebenfalls verlangen, erwähnt zu werden. (FR 14.03.05) Das kann man aber auch übertreiben und ins Groteske übersteigern. Dabei hat sich die Stadt Buchholz in der Nordheide hervorgetan und das Kind gleich mit dem Bade ausgeschüttet: "Die Bürgermeisterin ist ein Mann Buchholz will künftig ausschließlich weibliche Amtstitel benutzen Die Stadt Buchholz schafft die männlichen Formen im Behörden-Deutsch ab. Die Ratsmitglieder beschlossen mit klarer Mehrheit, künftig nur noch die weiblichen Formen für Amtsbezeichnungen zu benutzen - zumindest in der Gemeindeverfassung. Bisher kamen in dem Schriftstück Frauen nicht vor. Bürgermeister, Ratsherr, Stadtdirektor, Beamter - in der Sprache der Satzung waren die Männer unter sich. In Zukunft fehlen sie. Von der niedersächsischen Landesregierung kam zuvor die Empfehlung, in Rechts- und Verwaltungsvorschriften beide Geschlechter zu benennen. So schlug Stadtdirektor Andreas Bendt in der Sitzung vom 22. November eine `Schrägstrich-Regelung' vor, also zum Beispiel `Beamter/Beamtin'. Doch dieser Vorschlag wurde von der CDU mit dem Argument, solche Schreibweisen seien zu umständlich und schwerfällig, abgelehnt. Daraufhin stellte der FDP-Ratsherr Jürgen Kempf den Antrag, künftig nur noch die rein weibliche Form in der Hauptsatzung zu verwenden. Von den 30 Ratsmitgliedern stimmten 24 dafür. Bürgermeister Joachim Schleif, der auf dem Papier nun `Bürgermeisterin' heißt, ist von dem Beschluß nicht begeistert, er stimmte dagegen: `Ich gehe nicht davon aus, daß weibliche Ratsmitglieder sich beleidigt fühlen, nur weil in der Satzung Ratsherr steht. Diese ganze Vokabeldiskussion halte ich nicht für sehr förderlich.' Dennoch unterschrieb er die Hauptsatzung: `Dagegen kann ich nichts machen, es war eine eindeutige Entscheidung.' 121 Die Frauenbeauftragte Martha Vogelsang wehrt sich gegen den Vorwurf, das Ganze sei ein Jux. Es sei ein Signal für alle Männer, sich einmal über die diskriminierende Behandlung von Frauen in der Sprache Gedanken zu machen. Derzeit wird die Hauptsatzung von der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung in Winsen juristisch überprüft. `Wir haben von denen aber telefonisch schon grünes Licht bekommen', sagte Rathaus-Sprecherin Ingrid Fischer. Wird das Schriftstück dann im `Amtsblatt für den Kreis Harburg' veröffentlicht, tritt die Verfassung offiziell in Kraft. Dann können Männer, die sich durch die neue Regelung eventuell diskriminiert fühlen, zumindest juristisch nichts mehr einwenden. ... (HH A 08.12.94) Sicher haben auch Sie sich schon wiederholt über die »vermännlichte« Sprache geärgert, die Frauen sprachlich nicht ausreichend berücksichtigt - eine Spracheigentümlichkeit, die z.B. im sprachlich ausgesprochen machohaften Spanischen noch wesentlich ausgeprägter gegeben ist und manch kämpferische Frauen in Spanien und Hispano-Amerika in die Nähe zum (hoffentlich nur geistig bleibenden) Amok-Lauf treibt. Da ist mit mancher Maria oder Carmen ob dieser sprachlichen Benachteiligung der Frauen nicht mehr zu spaßen! Betrachten Sie es als (Ihnen möglicherweise nicht hinreichend erscheinenden) Ausgleich - und von mir als von meiner Mutter vor über 60 Jahren mit durchaus passablem Erfolg angelerntem „Frauenversteher“, der »Frauen« mag und den charmanten unter ihnen keinen Wunsch abschlagen kann, verabreichten Trost - , dass das Gesetz, wenn es eine strafbar handelnde Person nicht ganz allgemein als „Wer“, sondern nur noch ziemlich allgemein bezeichnet, immer nur von »dem alten Adam« spricht: Z.B. in § 211 StGB „Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mörder ist, wer ...“ oder in § 212 StGB „Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.“ Als wenn »Frauen« nicht töten oder gar morden würden! Sie machen es zwar seltener, aber auch, und dann bevorzugt lieber »weicher« und diskreter: mit Gift. Hoffentlich ist es mir mit diesem Hinweis gelungen, Sie ob der sprachlichen Ungerechtigkeit ein wenig getröstet zu haben. 1.3.2.2.2 Benachteiligung von Frauen unter der Geltung des GG seit 1949 im niederrangigeren Recht trotz Art. 3 II GG und allmähliche rechtliche Angleichung Die volle rechtliche Gleichstellung der Frauen ist aber in der gesellschaftlichen Wirklichkeit noch längst nicht verwirklicht, obwohl das GG seit 1949 in Kraft ist. Zwar ist es inzwischen nicht mehr so, dass das Vermögen einer Frau bei Heirat automatisch dem Ehemann zufällt, der Ehemann ein von seiner Ehefrau eingegangenes Arbeitsverhältnis nach eigenem Belieben kündigen kann, die Antibabypille ausschließlich verheirateten Frauen erst dann verschrieben wird, wenn zuvor die Einverständniserklärung ihres Ehemannes vorliegt, oder dass der Vater in Sachen der Kinder den sogenannten »Stichentscheid« hat: Konnten sich die beiden Eltern über ein Erziehungsproblem nicht einigen, so wurde gemacht, was Vatern sagte. (Das wurde natürlich nur rein rechtlich, nicht aber unbedingt tatsächlich so gehandhabt. Im privaten Bereich gilt eher das Wort von Oscar Wilde: „Männer, die behaupten, sie seien die uneingeschränkten Herren im Haus, lügen auch bei anderer Gelegenheit.“) Die juristische Benachteiligung der Frauen hatte selbstverständlich auch einen schönen juristischen Namen: „Letztentscheid des Vaters“. Diese gesetzliche Regelung des BGB ist erst 1959 durch BVerfGE 10/59 für grundgesetzwidrig erklärt worden, obwohl Art. 117 1 GG von Anfang an bestimmt hatte: Art. 117 GG „(1) Das dem Artikel 3 Abs. 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953. ..." Doch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik vollständig durchgesetzt war die Gleichberechtigung damit noch längst nicht. So wurden nach dem stringenten Beamtenrecht Frauen bis 1953, wenn sie heirateten, aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Bis dahin hatte z.B. eine Lehrerin „Fräulein“ zu bleiben – was auch für den privaten Lebenswandel galt: Es wurde zwar nicht als Einstellungsvoraussetzung überprüft, ob sie noch eine »virgo intacta« sei, aber wenn ruchbar wurde, dass ein Mann ihrem schönen Leib nach Meinung ihres Dienstherrn zu nahe gekommen war, dann konnte sie bei einem bei ihrem Dienstherrn Anstoß erregenden Lebenswandel disziplinarisch bestraft und notfalls sogar aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden! Es galt kein gleiches Recht für alle: Es ist mir nicht bekannt, dass ein Kollege, der den Lockungen des schönen Leibes einer Kollegin nicht hatte widerstehen können, disziplinarisch belangt, jedenfalls nicht aus dem 122 Benachteili gung von Frauen unter der Geltung des GG seit 1949 im niederrangi geren Recht trotz Art. 3 II GG Beamtenverhältnis entfernt worden wäre! Und wenn es das gegeben haben sollte, dann bestimmt nicht so häufig wie bei Frauen. Im Bereich der Politik z.B. gab es erst im 4. Kabinett Adenauer mit Elisabeth Schwarzhaupt im November 1961 die erste Bundesministerin, nachdem die Frauen innerhalb der CDU lange in dieser Richtung ihre Forderung angemeldet hatten und mit Hinweis auf den übergroßen Frauenstimmenanteil der CDU bei Wahlen, der der CDU erst die überragenden Wahlerfolge beschert hatte, eine Repräsentantin mit Ministerrang einforderten. Das Bundesgesundheitsministerium erschien dann lange Jahre unbedeutend genug, die den Männern innerhalb der CDU mit der Zeit doch lästigen Quengeleien der Frauen mit einem Leckerli resignierend abwürgen zu können - wie Eltern seufzend nachgeben, wenn ihre Kleinen vor der Kasse des Supermarktes etwas von der dort ganz bewusst aufgebauten „Quengelware“ erbetteln. Es gibt immer noch genügend zu tun, wenn die Gesellschaft der Bundesrepublik ihre „human resources“ zum gesellschaftlichen Gesamtnutzen weiter ausschöpfen will: "Gesetz-Entwurf ein `Treppenwitz' `Der Entwurf des Gleichstellungsgesetzes von Frauenministerin Angela Merkel wird als Treppenwitz in die Frauengeschichte eingehen', sagt Christa Randzio-Plath, Vorsitzende der Hamburger Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Hier werde den Arbeitnehmerinnen 'mal wieder `die Möglichkeit vorgegaukelt, berufliche Chancen per Gesetz zu verbessern.' Randzio-Plath fordert Frauensenatorin Traute Müller auf, `dazu beizutragen, daß die Gleichberechtigung keine Leerformel bleibt.'" (Morgenpost 19.01.93) Nun soll eventuell in Art. 3 II 1 GG die Reihenfolge der Nennung der Geschlechter „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ geändert und es sollen dadurch die Frauen vor den Männern genannt werden, um dem Gesetzgeber das zwar schon seit langem grundgesetzlich aufgetragene aber noch immer nicht voll durchgesetzte Gleichberechtigungsgebot auch deklaratorisch vor Augen zu stellen. Welcher Kavalier sollte etwas dagegen haben? Außerdem ist Art. 3 II GG 1994 durch den Satz 2 erweitert worden: "Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Auf jeden Fall ist nun durch die vorstehende Formulierung in Art. 3 II 2 GG die Reihenfolge der Geschlechternennung im Gegensatz zu dessen Satz 1 umgestellt worden. Vielleicht bleibt es in Art. 3 II GG ja nun dabei: ein schlicht, ein kraus. In manchen Bundesländern sind zur Beseitigung der Benachteiligung von Frauen und zu ihrer prozentual angemessenen Repräsentation auch in höheren und Spitzenpositionen des Öffentlichen Dienstes spezielle Quotenregelungen durch Gesetze beschlossen worden. Bis zur Erfüllung der Quote seien Frauen bevorzugt bei Stellenbesetzungen zu berücksichtigen. Dagegen haben männliche Bewerber geklagt, wenn sie bei gleicher Befähigung „nur“ wegen ihres Geschlechts unterlegen waren. Lag ein Verstoß gegen die Euro-Richtlinie 76/20/EWG „zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen“ aus dem Jahr 1976 vor? Die 15 obersten (männlichen) europäischen Richter des Europäischen Gerichtshofes haben solche gesetzlichen Bestimmungen gekippt, in denen die Bevorzugung von Frauen „absolut und. unbedingt“ ohne eine Härtefallregelung für Männer vorgesehen gewesen waren, wie z.B. die rigide Regelung 1995 in Bremen. Das Grundrecht eines einzelnen auf Gleichbehandlung dürfe nicht verletzt werden, um zurückliegende Benachteiligungen einer Gruppe zu bekämpfen. War das Ziel der ausgleichend bevorzugenden Frauenförderung wie im Frauenförderungsgesetz von NRW im Gesetz nur als Absicht formuliert, die auch ein Abweichen zuließ, wurde die Bevorzugung von Frauen bis zur Erreichung einer angemessenen Repräsentanzquote als mit der EUGleichheitsrichtlinie vereinbar angesehen, wenn die objektive Beurteilung jedes Bewerbers gewährleistet und die Beförderung eines Mannes nicht von vornherein ausgeschlossen ist. In der nordrhein-westfälischen Bestimmung heißt es in einer Härteklausel, dass Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung bis zur Erreichung einer 50-%-Quote bevorzugt befördert werden sollen, solange sie unterrepräsentiert sind, falls nicht „in der Person eines Mitbewerbers liegende schwerwiegende Gründe überwiegen“. Welch ein ungeheurer Weg ist durch mühseligste Kämpfe der "Blaustrümpfe" gegen die ignorante Männerwelt schon zurückgelegt worden! Ein Blick zurück belegt das: 123 "Bestimmend Das Landrecht von 1794 machte den Ehemann zum gerichtlichen Vormund, `schuldig und befugt, die Person, die Ehre und das Vermögen seiner Frau in und außer Gerichten zu verteidigen'. Dasselbe Landrecht wies Mütter an: `Eine gesunde Mutter ist ihr Kind selbst zu säugen verpflichtet. Wie lange sie aber dem Kinde die Brust reichen solle, hängt von der Bestimmung des Vaters ab!" (HH A) Das „Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten“ von 1796 mit seinen zwei Teilen, 43 Titeln und rund 19.000 Paragraphen ist das erste moderne Gesetzbuch Deutschlands. Es galt (in weiten Teilen Deutschlands) bis zu der Einführung des BGB zum 01.01.1900.30 Bis dahin war ein Ehemann also »Vormund« seiner Frau, wie es bis vor kurzem die Eltern gegenüber ihren noch minderjährigen Kindern waren (nun sind sie „Sorgeberechtigte“) - oder es ein Amtsvormund gegenüber einem Geisteskranken ist. Wenn eine vor der Heirat schon volljährige Frau zunächst voll rechtsfähig gewesen war und durch die Heirat ihr nunmehriger Ehemann zu ihrem Vormund geworden ist, dann muss durch den Akt der Eheschließung zwangsläufig eine rechtliche Entmündigung der Frau eingetreten sein! Das kann auch ich als Mann empörend empfinden. Es gab keinen Grund für eine solche dümmliche zivilrechtliche Regelung außer reinem Machodenken! Und auch das Strafgesetz ordnete für eine Frau, die heiratete, einen erheblichen Rechtsverlust an: Vor dem Eingehen einer Ehe war eine Frau in ihrem sexuellen Selbstbestimmungsrecht durch Strafnormen vollständig geschützt, durch Eheschließung ging sie plötzlich eines Teiles dieses Schutzes verlustig. Durch das "Ja-Wort", das vor dem Standesbeamten und eventuell auch dem Pfarrer abgegeben worden war und sich nur auf den Willen zur Eheschließung bezog, soll eine »Nunmehr-Ehefrau« automatisch auch ihr Einverständnis zu Vergewaltigungen in der ehelichen Lebensgemeinschaft durch den »Nunmehr-Ehemann« gegeben haben, denn die Möglichkeit einer Vergewaltigung durch einen Ehemann wurde in § 177 StGB tatbestandlich ausgeschlossen. Durch diese Strafnorm war eine Frau ab Eheschließung nur noch gegen erzwungenen außerehelichen „Beischlaf“ geschützt. (Wenn der Ehemann der Täter war, wurde das außerhalb der Ehe als einschlägig angenommene Verbrechen der Vergewaltigung zu dem Vergehenstatbestand einer - sexuellen Nötigung herunterformuliert. Der BGH belehrte noch 1966 eine Ehefrau dahingehend, dass die Ehe die Gewährung des Geschlechtsverkehrs „in Zuneigung und Opferbereitschaft“ und „ohne Gleichgültigkeit und Widerwillen“ verlange - auch wenn die Ehe schon nicht mehr prickelnd war, die Frau ihren Mann inzwischen vielleicht schon hasste wie die Pest und ein Scheidungsverfahren lief. Natürlich war Gewalt gegenüber einer physisch meist Schwächeren nicht so ganz in Ordnung, aber als ein Verbrechen mochte es der Gesetzgeber nicht werten. Ein bisschen Gewalt gegenüber einer unwilligen Ehefrau wurde - unausgesprochen - vielleicht wie eine Art Notwehrrecht gegen die Verweigerung von „natürlicher und legitimer Befriedigung“ angesehen.) Erst 1995 bahnte sich nach über 20-jährigem Bemühen insbesondere der SPD in diesem Punkt eine Besserung an. Nach Rückzugsgefechten um die Ausgestaltung einer »Verzeih-Klausel«, mit der der durch eine Anzeige der vergewaltigten Ehefrau angeworfene Justizmotor vor Ausspruch eines Urteils "mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren" noch wieder hätte abgewürgt werden können, wurde in einem Entwurf auch eine Vergewaltigung durch den Ehemann durch Streichung nur eines Wortes - „durch Gewalt ... zum außerehelichen Beischlaf nötigt“ unter Strafe gestellt. So einfach kann Rechtsgüterschutz sein; wenn Mann nur will! Inzwischen wurde „Vergewaltigung“ im Verlauf der parlamentarischen Beratung völlig umdefiniert: Unter Vergewaltigung versteht man jetzt nicht mehr nur die weitestgehende Einschränkung, eine Frau zum außerehelichen Beischlaf zu zwingen, auch nicht nur, eine Frau überhaupt zum Beischlaf zu zwingen, sondern erweiterte den Rechtsgüterschutz auf das unerlaubte Eindringen mit irgend etwas in den Körper eines anderen mit der Konsequenz, dass jetzt nicht nur von ihnen ungewollte »Fingerspiele« an Frauen durch diese Strafnorm miterfasst sind, sondern nunmehr auch Männer strafrechtlich relevant vergewaltigt werden können, wie es in Gefängnissen durch Analverkehr oder das Reinrammen von Gegenständen in den Anus ja schon öfters passiert war, ohne dass den männlichen Opfern wegen der bisherigen, die Männer ausschließenden Legaldefinition im vormaligen § 177 StGB der Rechtsgüterschutz des Vergewaltigungsparagraphen mit seiner Mindeststrafdrohung von zwei Jahren Freiheitsstrafe zur Seite gestanden hätte. „Fünf Jahre Haft für Vergewaltiger Itzehoe – Das Landgericht Itzehoe hat einen 17-Jährigen wegen Vergewaltigung und räuberischer Erpressung zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Er hatte in Heide zwei Jungen (13) ausgeraubt und in einen Müllcontainer gesperrt und einen von ihnen sexuell missbraucht. (dpa)“ (HH A 24.03.04) 30 In anderen Teilen Deutschlands galten bis zum 31.12.1899 andere Gesetze. In Thüringen und Anhalt wurde durch die Einführung des BGB der um 1224 geschaffene Sachsenspiegel abgelöst: Fast 700 Jahre Geltung des Sachsenspiegels in Teilen Deutschlands! 124 »Vergewaltigung« wird nicht in jeder Gesellschaft gleich gesehen, gleich definiert und rechtlich gleich gewertet. Als Beispiel dafür, dass die jeweilige Definition eines Straftatbestandes die Strafbarkeit in einer Weise begründet, wie wir sie nicht kennen, sei ein berühmter Fall aus Amerika angeführt, der bei uns nicht unter die Strafbestimmung einer „Vergewaltigung“ im Sinne des § 177 StGB gefallen wäre: VERBOTENE LIEBE Lehrerin und ihr Ex-Schüler träumen von Hochzeit Als 34-jährige Lehrerin hatte Mary Letourneau Sex mit einem Sechstklässler - und musste wegen Vergewaltigung hinter Gitter. Kaum ist sie wieder frei, hat das Gericht die lebenslange Kontaktsperre aufgehoben. Mit 21 ist Vili Fualauu immer noch verrückt nach Mary, und sie denkt sogar an ein weiteres gemeinsames Kind. Mary Letourneau ließ sich auf eine Affäre mit ihrem zwölfjährigen Schüler Vili Fualauu ein, und die ganze Welt schaute zu. Nach siebeneinhalb Jahren Haft wurde sie am letzten Donnerstag aus einem Frauengefängnis entlassen. Nur wenige Stunden später reichte der Anwalt von Fualauu einen Antrag auf Aufhebung des Kontaktverbotes ein, das 1997 das Gericht verhängt hatte. Die Entscheidung fiel schnell, die beiden dürfen wieder "uneingeschränkten Kontakt" miteinander haben. Die einzige Basis für die Anklage sei das Alter des Schülers gewesen, schrieb Anwalt Scott Stewart in seinem Antrag: "Mr. Fualauu ist jetzt 21 Jahre alt, er hat keine Angst vor Mary L. Letourneau." Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf einen Einspruch; es gebe "keine Rechtsbasis", das Kontaktverbot aufrecht zu erhalten. So sah es auch Linda Lau - dieselbe Richterin, die Letourneau zuvor verurteilt hatte. Aus der Beziehung zwischen Mary Letourneau, inzwischen 42, und Vili Fualauu entstanden zwei Töchter, die fünf und sieben Jahre alt sind. Letourneau hat vier weitere Kinder aus ihrer früheren Ehe. Die Affäre zwischen der Lehrerin und ihrem Schüler hatte in den neunziger Jahren weltweit für Schlagzeilen gesorgt und zu einem spektakulären Prozess geführt. 1997 wurde Letourneau zunächst wegen "Vergewaltigung eines Kindes in einem leichteren Fall" zu sechs Monaten Haft verurteilt. Nach ihrer Freilassung traf sie sich trotz Verbots sofort wieder mit dem Jungen - und nur einen Monat später wurden die beiden beim Sex im Auto erwischt. Die Lehrerin, im sechsten Monat schwanger, musste daraufhin abermals ins Gefängnis, wo sie eine Tochter zur Welt brachte. Er habe lange auf die Freilassung von Letourneau gewartet, sagte Fualauu dem Sender NBC: "Ich möchte sehen, wer sie ist und ob sie der gleiche Mensch ist, in den ich mich verliebt habe - und ob sie meine Gefühle erwidert. Wenn wir uns noch lieben, werden wir heiraten." Sich mit gleichaltrigen Frauen zu treffen, habe ihn nicht glücklich gemacht. Er habe alle Mädchen oder Frauen mit Mary verglichen und immer nur an sie gedacht, so Fualauu. Nun wolle er bis Ende des Monats herausfinden, ob die Beziehung eine Zukunft hat. Fualauu ist derzeit arbeitslos und lernt für den Abschluss an einer weiterführenden Schule. Mary Letourneau musste sich unmittelbar nach ihrer Haftentlassung als Triebtäterin bei den Behörden registrieren lassen. Sie hatte stets betont, es handele sich um eine romantische Beziehung, um wahre Liebe. Über ihre Zukunftspläne hat Letourneau bisher wenig verraten. Dem Sender Komo-TV sagte sie nur, ihr Hauptziel sei eine "Wiedervereinigung" ihrer Familie. Auch ein weiteres Kind mit Fualauu hält sie für möglich: "Wenn wir das Glück haben, eine Beziehung fortsetzen zu können, und wenn es das ist, was er will, dann würde ich es für ihn tun", sagte Letourneau in einem Interview noch vor ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Inzwischen wohnt sie bei einem Ehepaar in einem Haus in der Nähe von Seattle. Reporter setzten sich sogleich auf ihre Fährte. Der Medienrummel um das ungleiche Paar ist ohnedies ungebrochen, die moralische Bandbreite der öffentlichen Kommentare enorm - die einen bedauern Letourneau und Fualauu für ihre unglückliche, romantische Liebe, die anderen sehen die Beziehung ein schlichtes Verbrechen mit lebenslangen Folgen. So beschreibt die Kolumnistin Susan Payntner den Fall in der Zeitung "Seattle Post" als klassischen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung. Kapital schlagen können beide daraus allemal. Bereits während ihrer Haft hatte Letourneau gemeinsam mit Fualauu ein Buch veröffentlicht ("Einziges Verbrechen: Liebe"). Über die beiden entstanden auch eine Biographie ("If Loving You Is Wrong") sowie ein Fernsehfilm. Eine Hollywood-Verfilmung scheint angesichts der drehbuchtauglichen Geschichte ziemlich naheliegend. Die Kinderschutzorganisation "Team Amber Alert" hat die Filmindustrie bereits davor gewarnt: Amerika werde jeden Film boykottieren, wenn es um die Verherrlichung des Falles gehe, in dem 125 eine 35-jährige Frau einen zwölfjährigen Jungen verführe und später eine glücklich vereinigte Familie gezeigt werde. (Spiegel Online 10.08.04) 2005 haben die zu dem Zeitpunkt 37-Jährige und der 21-Jährige geheiratet. Ein anderes Beispiel für eine gesetzlich so definierte »Vergewaltigung«, das außerdem zeigt, dass es notwendig ist, dass der Gesetzgeber bei der Formulierung eines Straftatbestandes sehr sorgfältig nach allen Seiten hin abwägen und möglichst alle denkbaren Fallvarianten im Blick haben muss, war der Presse zu entnehmen, als es vor dem BVerfG um die Rechtmäßigkeit der Auslieferung eines Deutschen an ein anderes EU-Land auf Grund eines dort ergangenen europäischen Haftbefehls ging. In der Anhörung fragte der Richter am BVerfG Udo da Fabio den Sachverständigen der Bundesregierung: "Wenn ein Deutscher im Kölner Karneval einer Holländerin einen Zungenkuss aufnötigt, gilt das in den Niederlanden als vollendete Vergewaltigung. Ist es richtig, dass ein Deutscher, der das nicht wusste, in den Niederlanden vor Gericht gestellt wird?" Die Antwort fiel ausweichend aus. Wenn man »Vergewaltigung« als ungewolltes In-denKörper-Eindringen definiert, dann werden davon nicht nur u.a. die in Altersheimen sich wiederholt ereignenden gravierenden Fälle erfasst, „97jährige von Heim-Mitarbeiter sexuell mißbraucht Köln Eine 97jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Köln ist von einem leitenden Mitarbeiter des Heims sexuell mißbraucht worden. Der 43jährige sei durch eine DNA-Probe überführt worden, berichtete die Kölner Polizei am Montag. Auf die Spur des Verbrechens war die Polizei gekommen, als bei einer routinemäßigen Untersuchung im Urin der alten Dame Spermien gefunden wurden. Der Gesundheitszustand der Seniorin ließ eine Befragung nicht zu. Eine Altenpflegerin gab dann den Hinweis auf den Stationsleiter, in dessen Obhut sich die Seniorin befand. Eine Speichelprobe des Tatverdächtigen zeigte, daß die DNA des 43jährigen mit dem genetischen Fingerabdruck der Spermien übereinstimmte, wie die Polizei mitteilte. AP“ (DIE WELT 19.04.05) sondern auch ein in Karnevalslaune aufgenötigter Zungenkuss. Aber dafür dann ebenfalls eine Mindeststrafe von zwei Jahren Freiheitsstrafe? 1.3.2.2.3 Art. 3 II GG und Ehenamensrecht Wie die Überschrift deutlich macht, geht es in diesem Kapitel nicht um das Recht der Vornamensgebung, das wesentlich mehr Freiräume lässt als das Recht der Ehenamensfindung. Im Bereich des Vornamensrechts können sich die Eltern in fast schrankenloser Willkür austoben – und ihr Kind hat dann ein Leben lang darunter zu leiden: das Vornamensrecht ist zu oft die Lieblingsspielwiese spinnert ausgelebter elterlicher Willkür! „Standesamt: Kinder dürfen Keanu-Neo, Pumuckl, Fanta und Gneisenauette heißen Eltern aus Halle haben vor einigen Tagen vom Standesamt die Erlaubnis bekommen, ihren Sohn Keanu-Neo zu nennen. Der Name ist zurückzuführen auf den Schauspieler Keanu Reeves, welcher im Film 'Matrix' 'Neo' darstellt. Doch es gibt weitere Namen, die Eltern ihren Kindern geben dürfen. Bei den Jungen sind es beispielsweise Pumuckel, Rasputin sowie Leonardo da Vinci Franz. Mädchen hingegen dürfen Fanta, Gneisenauette und Pepsi-Carola genannt werden. Auf der Liste der nicht erlaubten Namen für Jungen stehen unter anderem Atomfried, Bierstübl und Crazy Horse. Bei Mädchen wurden die Namen Nagina, Gift, Emma-Tiger sowie Pfefferminze verboten.“ (stern shortnews 08.02.05) Früher bremsten Standesbeamte allzu willkürliche Vornamensfindungen und -gebungen ziemlich rigoros. Doch dann gestand das BVerfG den Eltern sehr weitgehende Rechte zu, sogar auf erfundene, selbst konstruierte Namen, wenn sie denn männlichen oder weiblichen Anklang haben. Allerdings bekräftigten die Verfassungsrichter am 20.02.2004, dass es Willkürschranken gebe: „Der Staat hat die Pflicht, das Kind als Grundrechtsträger vor verantwortungsloser Namenswahl durch die Eltern zu schützen.“ Das BVerfG schränkte außerdem das Recht der Eltern auf die Vergabe einer beliebigen Anzahl von Vornamen ein; es handelt sich ja schließlich nicht um Mitglieder des britischen Königshauses. Fünf Vornamen wurden für ausreichend erachtet, 126 als eine Mutter aus Nordrhein-Westfalen, die in ihrer Jugend offensichtlich zu viele Indianergeschichten gelesen hatte, ihrem Kind die zwölf Vornamen geben wollte: Chenekwahow Tecumseh Migiskau Kioma Ernesto Inti Prithibi Pathar Chajara Majim Henriko Alesandro. Art. 3 II GG Im Gegensatz zu der fast schrankenlosen Namensgebungsfreiheit im Vornamensrecht ist in Deutschland im und Ehenamensrecht - im Gegensatz zu den entsprechenden gesetzlichen Regelungen in anderen Staaten wie z.B. Ehenamens Großbritannien, wo die Eheleute bei der Eheschließung völlig frei einen Ehenamen wählen können, der sogar recht keinem der bisher geführten Nachnamen entsprechen muss - die Wahl des Ehenamens seit dem Ende des 18.Jahrhunderts wesentlich reglementierter; bis dahin brauchten die Eheleute in Deutschland keinen gemeinsamen Ehenamen zu führen und ihre Kinder nicht diesen (nicht vorhandenen) Ehenamen zu übernehmen, so dass Harry alias Heinrich Heine (* 1797) mit dem Nachnamen seiner Mutter einen anderen Nachnamen führte als seine Brüder, die den Nachnamen ihres Vaters angenommen hatten. Das deutsche Ehenamensrecht ist ein anderes Beispiel für die bis in unsere Tage gültig gewesene Ungleichbehandlung der Frauen durch den Bundesgesetzgeber, sprich die (männliche) Mehrheit der Parlamentsabgeordneten. Das Ehenamensrecht war wegen seiner rigiden Reglementierung bis zu seiner vom BVerfG in mehreren Entscheidungen angeordneten jetzigen relativen Wahlfreiheit auf den jeweiligen Etappen der gesetzlichen Neuregelung aus ideologischen Gründen und auf Grund des starken Einflusses der Vereinigung der Deutschen Adelsverbände sehr umkämpft. In der aktuellen Diskussion war die x-te erneute Neuregelung des Ehenamensrechts, bei dessen Neufassung auch in der vor dem Erlass des Verfassungsgerichtsurteils gültigen, schon mehrfach geänderten Form des „§ 1355 BGB (1) Die Ehegatten führen einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen). (2) Zum Ehenamen können die Ehegatten bei der Eheschließung durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Geburtsnamen des Mannes oder den Geburtsnamen der Frau bestimmen. Treffen sie keine Bestimmung, so ist Ehename der Geburtsname des Mannes. Geburtsname ist der Name, der in die Geburtsurkunde der Verlobten zur Zeit der Eheschließung einzutragen ist. ..." bisher von dem in Art. 3 II GG geregelten Diskriminierungsverbot keine ausreichende Notiz genommen worden war. "Urteil zum Namensrecht - Ein Richter sagt: Ein Stück des Obrigkeitsstaates ist abgeschafft Von Christian Bommarius Ohne das Bundesverfassungsgericht wäre die Ehe vermutlich noch immer Männersache. Die Zerstörung des Leitbildes von der Hausfrauenehe, in der die Frau die Schlüsselgewalt, der Mann jedoch die Bankvollmacht hat - die Realisierung also des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebots ist vom Bonner Gesetzgeber immer wieder verschleppt, erst vom Karlsruher Gericht vorangetrieben worden. In keinem anderen Bereich wird dies deutlicher als im Ehenamensrecht. Seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 189631 galt auf unterschiedliche Weise: Der Name des Mannes hat Vorrang, die Frau in der Regel das Nachsehen. Obwohl seit 1949 in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) verbindlich vorgeschrieben, hat sich die Gleichberechtigung auf diesem Gebiet erst jetzt mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts durchgesetzt. Die Diskussion um das Ehenamensrecht spiegelt die Geschichte der Diskriminierung und der einsetzenden Emanzipation der Frau. Von 1896 bis zum Erlaß des Gleichberechtigungsgesetzes vom 18. Juni 1957 erhielt die Frau bei der Eheschließung automatisch den Namen des Mannes. Doch auch die neue Regelung - die nur nach ungeduldigem Drängeln der Karlsruher Richter zustande kam - wollte von einer vollständigen Gleichstellung der Frau nichts wissen. Die Frauen bekamen lediglich das Recht, ihren Mädchennamen dem gemeinsamen Familiennamen anzufügen. Erst 21 Jahre später stellte das Bundesverfassungsgericht am 31. Mai 1978 fest, daß auch das Gleichberechtigungsgesetz mit dieser Regelung gegen Artikel 3 Absatz 2 verstieß. Doch schon kurz vor diesem Verdikt hatte sich der Bonner Gesetzgeber zu einer Reform des Ehenamensrechts aufgeschwungen. Dieses erhielt die Fassung, die nunmehr wiederum vom 31 Das BGB ist 1896 im Reichstag verabschiedet worden und dann, nach 4jähriger Vorlauf- und Vorbereitungszeit, zum 01.01.1900 in Kraft getreten. 127 Karlsruher Gericht für verfassungswidrig erklärt wurde: Zwar war die Wahl des Ehenamens den Partnern freigestellt, doch sollte stets dann der Name des Mannes dazu werden, wenn die Gatten keine Bestimmung trafen. Auf vielen tausend Seiten haben - überwiegend männliche - Juristen diese Benachteiligung der Frauen mit angeblich soziologischen Unterschieden gerechtfertigt. Vor allem die geringere Berufstätigkeit der Frauen war herangezogen worden, um `objektive funktionale Unterschiede zwischen den Geschlechtern' zu begründen. Das hieß im Klartext: Der Name zählt nur im Berufsleben - und dort stehen vor allem Männer. Ganze elf Seiten benötigten die Richter (nur), um diesen juristischen `Nominalismusstreit' zu entscheiden. Zwar seien tatsächlich weniger Frauen als Männer berufstätig, erkannten sie, doch das beruhe wohl eher auf einer `traditionell typischen Arbeitsteilung', die das Grundgesetz `gerade nicht verfestigen will'. Auch die geringere Präsenz von Frauen in höheren beruflichen Positionen sei `teilweise selbst das Ergebnis ungerechtfertigter Benachteiligung'. Alles in allem - es gibt keinen Grund, warum der Name der Frau im Fall der Ehe hinter dem des Mannes zurückstehen sollte. Die Karlsruher Entscheidung ist nicht nur ein Triumph der Frauen, sondern auch ein Erfolg der Hartnäckigkeit des Tübinger Amtsrichters Udo Hochschild. Hätte er nicht die verfassungswidrige Benachteiligung im Ehenamensrecht erkannt und zwei Fälle dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt, wären gewiß noch Jahre bis zur Entscheidung vergangen. So aber konnte Hochschild schon 41 Jahre nach Einführung der Gleichberechtigung von Mann und Frau feststellen: `Mit dieser Entscheidung wurde ein Stück obrigkeitsstaatlicher Bevormundung abgeschafft.'" (HH A 15.03.91) Der Tübinger Amtsrichter konnte auf Antrag einer Kieferorthopädin, die sich gegen den gesetzlichen Zwang gewehrt hatte, den Namen ihres Mannes vollständig oder zumindest hinter dem Bindestrich zu übernehmen, so verdienstvoll rechtsfortbildend tätig werden, weil durch Art. 100 I GG „Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich ... um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. ..." und dem darauf fußenden § 13 Nr. 11 BVerfGG das sogenannte "konkrete Normenkontrollverfahren" eröffnet ist. Hätte der Amtsrichter die zwei Sachen nicht vorgelegt, hätte das BVerfG nicht seine die Verfassung zur Geltung bringenden Entscheidungen fällen und die grundgesetzwidrigen rechtlich tieferrangigen weil einfachgesetzlichen, mit einfacher parlamentarischer Mehrheit änderbaren Regelungen des BGB und seiner Nebengesetze wegen Verstoßes gegen die höherrangige Norm des GG verwerfen können, denn das BVerfG hat nicht die Möglichkeit, analog den Strafverfolgungsbehörden bei ihm bekannt werdenden Verfassungsverstößen eine Sache von sich aus zu verfolgen, an sich zu ziehen und für Abhilfe zu sorgen. Es muss warten, bis es angerufen wird und dann die Vereinbarkeit der mit dem Rechtsmittel angegriffenen niederrangigeren mit unserer obersten rechtlichen Norm, den im GG getroffenen Bestimmungen, prüfen. (Ein anderes Rangverhältnis rechtlicher Normen ist in Art. 31 GG: "Bundesrecht bricht Landesrecht“ geregelt. Ein solcher Normenkonflikt, z.B. bezüglich der in der hessischen Verfassung trotz der letzten, 2002 in Kraft getretenen Verfassungsänderung in Artikel 21 I 2 noch immer nicht gänzlich getilgten Erwähnung der Todesstrafe, bedarf nach der in Art. 31 GG getroffenen eindeutigen Regelung nicht mehr der Klärung durch das BVerfG.) Nun war der Gesetzgeber gefordert, ein neues »Ehenamen-Recht« zu verabschieden. "Die Männer verzögern das neue Namensrecht Von ULRIKE BRENDLIN Bonn - Mit Nachdruck drängt Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) darauf, daß das von ihrem Ministerium entworfene neue Namensrecht nun rasch in den zuständigen Bundestagsausschüssen beraten wird. `Ich habe den Rechtsausschuß gebeten, er möge den Gesetzentwurf gleich Anfang des Jahres auf seine Tagesordnung setzen', sagte die Ministerin dem Hamburger Abendblatt. Bislang aber verzögern die Männer in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Verabschiedung des neuen Namensrechts. Sie ließen erst kürzlich die Beratung im Ausschuß für Frauen und Jugend absetzen. 128 Ebenso wie die FDP wollen auch die Frauen der CDU/CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion den Gesetzentwurf unverändert lassen. `Demzufolge dürfen beide Eheleute nach der Heirat ihren jeweiligen Geburtsnamen weiterführen', sagte die Justizministerin. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diesen Vorschlag gebe es nicht: `Denn das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber ein weites Ermessen eingeräumt.' Der Gesetzentwurf des Justizministeriums sieht weiter vor: Bei der Geburt eines Kindes muß sich das Ehepaar über dessen Familiennamen verständigen. Können sie sich nicht einigen, bekommt das Kind beide Namen, also den der Mutter und den des Vaters. Über die Reihenfolge des Doppelnamens soll der Standesbeamte durch Los entscheiden. Gegen diese `Willkür' regt sich - wie es heißt - bei den männlichen Unions-Abgeordneten `erheblicher Widerstand'. Das bisherige Namensrecht, das den Geburtsnamen des Mannes als gemeinsamen Familiennamen eindeutig bevorzugte, war vom Bundesverfassungsgericht am 5. März 1991 für unvereinbar mit dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes erklärt worden. Bereits der erste Entwurf für ein neues Namensrecht war von Unions-Seite heftig kritisiert worden, weil er auf den Zwang zum gemeinsamen Namen verzichtete. Danach wurde die Vorlage in ihre jetzige Form gebracht: Die Formulierung, Eheleute `können' einen gemeinsamen Familiennamen tragen, wurde in `sollen' geändert. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger geht nunmehr davon aus, `daß der Entwurf in den Ausschüssen zügig beraten wird und alsbald in Kraft treten kann. Der Rechtssicherheit wäre damit ein großer Dienst erwiesen.'" (HH A 02.01.93) Man hätte ja ein bisschen über den Zaun blicken können - so etwas weitet den geistigen Horizont -, wie partnerschaftlich andere Länder das Problem gelöst haben. Und ich bin sicher, dass das auch in den Expertenanhörungen zur Sprache gebracht worden sein wird. Wir bringen uns auf den im Ausschuss sicher erarbeiteten Sachstand durch (auszugsweise) Lektüre der nächsten beiden Zeitungsartikel: "Namensrecht in Europa: Um eine Nasenlänge voraus Das Bundesverfassungsgericht hatte das deutsche Namensrecht vor zwei Jahren als patriarchalisch und unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz gerügt. ... Um so erstaunlicher muten die Argumente an, erlaubt man sich einen Blick auf das Namensrecht in den anderen Staaten Europas: Er nämlich zeigt, daß - was bei uns jetzt angekündigt ist - fast überall schon Praxis ist. Und das selbst in Ländern, deren Standard in Sachen Gleichberechtigung von deutscher Seite gemeinhin als unterentwickelt wahrgenommen wird. Daß in Skandinavien jeder Ehepartner seinen Geburtsnamen behalten, ebenso aber auch einen gemeinsamen Ehenamen wählen kann, mag noch niemanden sonderlich verwundern, zumal sich der Norden Europas immer schon besonderer Progressivität rühmte. Daß aber auch die Südländer Deutschland in puncto Namensrecht voraus sind, dürfte erstaunen: Rechtlich gilt in Frankreich ebenso wie in Griechenland, Portugal und Spanien das Trennungsprinzip, d.h., die Eheschließung bleibt ohne Auswirkung auf die Nachnamen der Beteiligten. Im praktischen Leben bleibt dies jedoch dem Beobachter zumeist verborgen: Kraft Gewohnheitsrecht nämlich ist es `Madame Boucher', der Gattin von `Monseur Grande', gestattet, sich in der Gesellschaft `Madame Grande' zu nennen - und damit allen deutlich zu bekunden, daß sie eben nicht bloß eine `Lebensabschnittsgefährtin', sondern die gesetzlich angetraute Ehepartnerin ist. Was die Tatsache, daß sie vor dem Gesetz und möglicherweise auch etwa am Arbeitsplatz weiter unter ihrem Mädchennamen firmiert, keinesfalls berührt. Die Alternative, zwischen dem Trennungsprinzip und einem gemeinsamen Familiennamen wählen zu können, gab und gibt es selbst in den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes, dort also, wo der Staat in jeden Bereich reglementierend eingreift. Eine Ausnahme bildete die DDR: Hier galt es, sich für einen gemeinsamen Nachnamen - den des Mannes oder der Frau - zu entscheiden. ..." (Das Parlament 07.05.93) "In der vergangenen Woche hat der Bundestag das neue Namensrecht verabschiedet. Die Chance zum Neubeginn wurde verspielt. Im Namen der Bürokratie Von Christoph J. Partsch ... Das jetzt vom Bundestag verabschiedete Namensrechtsänderungsgesetz erfüllt nur das Minimum 129 dessen, was das Verfassungsgericht forderte. Die im April ausgetüftelte Koalitionsabsprache bleibt selbst hinter dem ursprünglichen Regierungsentwurf weit zurück. Der hatte noch die Bildung von echten Doppelnamen vorgesehen, die als Ehenamen daher auch auf die Kinder übergehen konnten. Doch diese Doppelnamen waren der Koalition nicht geheuer. Sie malte bereits das Schreckgespenst des Vierernamens in der nachfolgenden Generation an die Wand - ein Schreckgespenst, mit dem im übrigen Spanier und Portugiesen schon seit Jahrhunderten problemlos leben. Die Spanier etwa lassen sich im täglichen Leben mit ihrem ersten Namen anreden, während ihr Ehename aus je einem Namensteil der Elterndoppelnamen zusammengesetzt wird. Auf Visitenkarten und Briefumschlägen führen viele aber auch Vierernamen. Neuerdings dürfen die Spanier sogar wählen, welcher Teil des Vaternamens und welcher Teil des Mutternamens zum neuen Kindesnamen zusammengefügt wird. ... So gibt es in Dänemark die Möglichkeit, den nicht übernommenen Namen als Mittelnamen zu erhalten; in den USA wird er oft zum neuen Vornamen. ... Das Wall Street Journal machte sich denn auch über die deutsche Namensbürokratie lustig: Selbst Hillary Rodham Clinton dürfte in Deutschland nicht so heißen. ... In Preußen wurde ein fester Familienname erst 1816 eingeführt - zur besseren Erfassung für die frisch eingeführte Wehrpflicht. Davor konnte man sich tatsächlich nennen wie man wollte. ... Die jetzt beschworene Tradition des Namensrechts entstand erst mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch zur Jahrhundertwende - und mit den Gesetzen zur Namensänderung der Nazizeit. ... 1938 verboten die Nazis, den Namen der Frau als Kindesnamen zu wählen. Nur wenn der Familienname ausstarb oder ein Hof übernommen wurde, gestatteten sie eine Ausnahme. Namensänderungen durften nur noch auf wichtigen Grund hin erfolgen, etwa wenn der Vor- oder Familienname jüdisch oder slawisch klang, der Namensträger aber `arisch' war. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Bestimmung über die jüdischen Namen schamhaft gestrichen, alle anderen Traditionen aber 1957 übernommen. ... Der erzwungene, von allen Familienmitgliedern getragene, aus dem Mannesnamen gebildete Familienname stigmatisiert nichteheliche Kinder oder solche aus geschiedenen Ehen, die aus achtbaren Gründen ihren Namen fortführen wollen. Der Dichter Heinrich Heine nannte sich nach seiner Mutter, der Bruder nach dem Vater. Auch dieses ist heute nicht mehr möglich und soll es nach dem neuen Gesetz auch nicht werden. Völlig widersinnig werden dann aber die Kinder verschiedener Staatsangehöriger behandelt. So zwang der Bundesgerichtshof 1990 ein deutsch-spanisches Ehepaar, ihrem dritten Kind einen anderen Familiennamen zu geben, als dessen älteren Geschwistern, obwohl alle drei in Spanien geboren worden waren. Die Rechtsprechung habe sich geändert, so stellte das Gericht lapidar fest, es sei nunmehr deutsches Namensrecht auf das Kind anzuwenden. Ob den Deutschen doch noch wieder mehr Freiheit, etwa bei der Vornamensbildung oder in Form des Doppelnamens zugetraut wird, darf bezweifelt werden. Daß echte Doppelnamen einer eigenständigeren Rolle der Frau eher gerecht werden, daß sie sich im Ausland seit Jahrhunderten bewährt haben, ja daß selbst die Germanen sie kannten, wird im Namen obskurer Traditionen und Ordnungsprinzipien beiseite gewischt. ..." (Die Zeit 05.11.93)32 Es war also in dem zuständigen Parlamentsausschuss ein neues, das Diskriminierungsverbot des Bundesverfassungsgerichts achtendes Ehenamensrecht zu entwickeln. Die Bandbreite dafür war, wie die vorstehenden Artikel zeigen, sehr groß. Doch so etwas geht nicht nüchtern, nicht ohne ideologische Grabenkämpfe ab. Als Lehrstück, wie ein Gesetz entsteht, wird der Artikel aus FR 17.09.93 wiedergegeben: "Frau Zimmerfrau - eine Groteske mit viel Schall und Rauch Seit zweieinhalb Jahren tobt in Bonn der Kampf um den Ehenamen, zuweilen über die Grenze der Lächerlichkeit hinaus Von Charima Reinhardt (Bonn) ... Vor zweieinhalb Jahren, am 5. März 1991, hat das Bundesverfassungsgericht das seit dem Ehereformgesetz 1976 geltende Namensrecht für unvereinbar mit dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes erklärt, weil im Zweifel der Name des Mannes zum Zuge kam. Seitdem tobt in den zuständigen Ausschüssen des Bundestages ein erbitterter, bisweilen grotesker Streit um ein neues Gesetz, das die derzeit geltende Übergangsregelung des Verfassungsgerichts ablösen soll. ... 32 Die in dem Artikel angesprochene Befürchtung hinsichtlich einer Vierernamensregelung kann – wie das spanische Beispiel zeigt, wo »nur« der erste Vater- und der erste Muttername zur Nachnamensbildung für die Kinder verwendet werden – leicht ausgeräumt werden. Es muss nicht zu einer solchen, von einigen als Schreckgespenst ausgemalten, massierten Namensteilanhäufung kommen. 130 Bereits am 24. Juli 1991 legt das FDP-geführte Justizministerium einen Gesetzentwurf vor. Doch dessen Inhalt erregt konservative Gemüter derart, daß sie das `Ende der Familie' nahen sehen. Nachgerade erschüttert reagiert die Union im Rechtsausschuß des Bundestages auf die in ihren Augen allzu liberale Auslegung des Verfassungsgerichtsurteils im zu beratenden Entwurf: Mann und Frau können nach der Heirat den jeweils eigenen Namen beibehalten. Das darf nach Meinung der Union nicht sein. Paare sollen sich gefälligst auf einen Ehenamen verständigen, sonst muß der Standesbeamte die Eheschließung verweigern, empfehlen Konservative allen Ernstes. `Wer sich nicht auf einen gemeinsamen Namen einigen kann, braucht eigentlich gar nicht erst zu heiraten', findet der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Hermann Freiherr von Stetten immer noch. `Wir hätten am liebsten im Gesetz drinstehen gehabt, daß Eheleute einen gemeinsamen Familiennamen haben müssen.' Zum Glück scheitert die Union an sich selbst. Monatelang zermartern sich Unionspolitiker das Hirn, wie ein gemeinsamer Familienname auch dann hinzukriegen ist, wenn das Paar selbst sich nicht einigen kann. CDU-Familienministerin Rönsch schlägt vor, der Standesbeamte soll entscheiden. Die FDP wirft ihr daraufhin ein `antiquiertes Eheverständnis' vor, wenn sie den Ehenamen durch `autoritäre Fremdbestimmung' regeln wolle. Folgende weitere Vorschläge werden ernsthaft geprüft: Der ältere des Paares bestimmt den Ehenamen. Das wird als unzumutbar für die in der Regel jüngeren Frauen verworfen. Der an einem geraden Tag geborene Partner entscheidet. Aber was, wenn beide an einem ungeraden Tag geboren sind? Die alphabetische Reihenfolge ist ausschlaggebend. Doch dann, so die Befürchtung, stirbt irgendwann der letzte Buchstabe des Alphabets in der Namensgebung aus, und alle heißen Adam. Das Los entscheidet. Aber wie? Würfeln? Kegeln? Streichholz ziehen? Weniger ernst gemeinte Vorschläge lauten: Preis-Schafkopf oder Elfmeterschießen. `Irgendwie war das alles ziemlich lächerlich', gesteht CDU-Mann von Stetten. ... Die (Union) sieht besonders dann Probleme, wenn ein Ehepartner sich scheiden läßt, erneut heiratet und den alten Ehenamen auf die neue Ehe überträgt: `Das darf nicht sein, daß der geschiedene Ehename auf das corpus delicti, nämlich den Scheidungsgrund übertragen werden kann', empört sich von Stetten stellvertretend für seine Fraktionskollegen. `Es geht doch nicht, daß der Gehörnte seinem eigenen Namen begegnet', schickt er hinterher. Dem offensichtlich in diesem Punkt nicht ganz einsichtigen Vorsitzenden des Rechtsausschusses, seinem Parteifreund Horst Eylmann, versucht von Stetten die ganze Tragweite an einem Beispiel zu verdeutlichen: `Stell dir vor, deine Frau läßt sich wegen eines Studenten, mit dem sie ein Verhältnis hat, von dir scheiden, und der nimmt dann bei einer Heirat mit ihr deinen Namen an!' Die Sache mit der Übernahme des Namens aus einer geschiedenen Ehe hat einen weiteren Haken: Der deutsche Adel befürchtet eine wundersame Vermehrung von Adelstiteln. Daß eine geschiedene Baronin den Titel auf einen popeligen Herrn Meier übertragen kann, muß verhindert werden! Gehörnte und Adelige können aufatmen: Im Falle einer Wiederheirat muß der oder die Geschiedene den Namen aus der Altehe aufgeben. ..." Die wichtigsten Ergebnisse der auf Grund der vielen divergierenden Interessen teilweise erbittert geführten Auseinandersetzung über das bis 2005 geltende Namensrecht gibt nachfolgend der zusammenfassende Artikel wieder: "Namensrecht geändert Eheleute müssen künftig nicht mehr einen gemeinsamen Familiennamen als Ehenamen führen. Sie können demnach nach der Heirat ihre jeweiligen Namen beibehalten. Treffen sie eine Bestimmung über den Familiennamen, so können sie nur jeweils einen der jeweiligen Geburtsnamen zum Ehenamen wählen. Geschiedene oder verwitwete Ehegatten können demnach einen in einer Vorehe ‘erheirateten‘ Namen nicht zum Ehenamen in einer neuen Ehe bestimmen. ... Das Gesetz sieht darüber hinaus vor, daß die Bestimmung eines Ehenamens bis zum Ablauf von fünf Jahren nach der Eheschließung nachgeholt werden kann. Eine Kombination beider Namen mit dem Resultat eines Doppel- oder Mehrfachnamens ist nicht möglich. Bestimmen die Ehegatten einen gemeinsamen Ehenamen, kann der `verlierende Teil' seinen Geburtsnamen oder den aktuell geführten Namen dem Ehenamen voranstellen oder anfügen. Besteht der hinzuzufügende Name aus mehreren Namen, muß er sich nach dem Gesetz für einen entscheiden. Eheliche Kinder sollen den Ehenamen der Eltern als Geburtsnamen erhalten. Führen die Eltern keinen Ehenamen und können sie sich über den Familiennamen des Kindes binnen eines Monats nach der Geburt nicht einigen, muß das Vormundschaftsgericht das Bestimmungsrecht einem Elternteil übertragen." (Das Parlament 131 03.12.93) Es wurde vergessen hinzuzufügen: Übt der Elternteil, dem vom Vormundschaftsgericht die Bestimmung des Geburtsnamens des Kindes übertragen wurde, dieses Recht nicht binnen eines Monats aus, so wird nach Ablauf der Frist der Name dieses Ehegatten automatisch zum Geburtsnamen des Kindes. Eltern, die sich nicht auf einen gemeinsamen Ehenamen einigen konnten oder wollten und ihren Kinder die Addition ihrer beiden Nachnamen zukommen lassen wollten, klagten mit Hilfe des Amtsgerichts gegen diese Regelung des Namensrechts vor dem BVerfG. Das AG hatte in dem geltenden Namensrecht eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Kindes und des Elternrechts in solchen Fällen für möglich gehalten. „Den Eltern müsse die Möglichkeit gegeben werden, die Verwandtschaft ihres Kindes zu beiden Elternteilen mit Hilfe des Namens zu dokumentieren.“ Ein nachvollziehbares Argument. Das BVerfG sah das aber anders. Es befürchtet »Namensketten« und entschied darum am 30.01.02: Der Gesetzgeber habe das Namensrecht in verfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Weise geregelt. Nach dieser Regelung seien Doppelnamen für Kinder aus den beiden Namen der Eltern ausgeschlossen. Durch Namensketten würde der Nachname seinen Sinn als „identifikationsstiftender Bezugspunkt“ verlieren. Die spanische Lösung, dass jedes Kind den ersten Nachnamen des Vaters und der Mutter als neuen Doppelnamen erhalte und so die Herkunftslinien im Namen erhalten bleiben, wurde nicht zugelassen. Wir sehen an dem vorstehenden Beispiel, dass das GG als oberste staatliche Norm - eventuell erst unter Zuhilfenahme des BVerfGs als "Wächter des Grundgesetzes" - selbst den Gesetzgeber, das Bundesparlament (konkret: die Parlamentsmehrheit der Regierungspartei oder der Regierungskoalition) zu einem bestimmten, an den im GG getroffenen Wertentscheidungen, Regelungen und ihrer Interpretation durch das BVerfG ausgerichteten gesetzgeberischen Verhalten zwingen kann. Das BVerfG kann sogar mit seiner in § 31 II 1 BVerfGG "In den Fällen des § 13 Nr. 6, 11, 12 und 14 hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft." geregelten »Verwerfungskompetenz mit Gesetzeskraft« von der Legislative beschlossene Gesetze verbieten. (Das große Bevölkerungsteile aufwühlendste Urteil in dieser Hinsicht war bisher das am 25.02.75 ausgesprochene Verbot der - von der Parlamentsmehrheit unter Zurückweisung des Einspruchs des Bundesrates beschlossenen - Fristenregelung im Bereich des § 218 StGB.) In dem die Entscheidung des BVerfGs auslösenden Fall des Ehenamensrechts, dessen Prüfung nach Vorlage durch den Tübinger Amtsrichter vom BVerfG im Zuge eines konkreten Normenkontrollverfahrens nach § 13 Nr. 11 BVerfGG vorgenommen worden ist, ist die trotz mehrfacher Änderungen die Frauen bis zuletzt immer noch diskriminierende Regelung des § 1355 BGB auch gegen den Widerstand konservativer Abgeordneter abgeschafft worden. "Künftig kann man anhand des Familiennamens nicht mehr zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren unterscheiden. Denn jetzt dürfen nicht nur Männer ihren Mädchennamen behalten." (Aus dem ‘Gießener Anzeiger', aufgespießt in den ‘Fundsachen' des STERN vom 12.03.92.) Das ist eine Auswirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 I GG in seiner auf den kleinen Unterschied abzielenden Konkretisierung in Art 3 II GG. Erstaunlich ist, dass bei den jahrelangen Beratungen der Änderung des Ehenamensrechts eine solche Panne oder ist es vielleicht doch keine, sondern eine gewollte diskriminierende Entscheidung? -, wie aus der nachfolgenden Pressenotiz ersichtlich, möglich war: „Namenswirrwarr Mehrere Elternpaare haben beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht, weil ihre Kinder unterschiedliche Nachnamen tragen müssen. Hintergrund: Seit einem 1991 in Kraft getretenen Gesetz dürfen Ehepaare einen Doppelnamen führen, mithin auch ihre Kinder: Das 1994 geänderte Gesetz bestimmte, daß weitere Kinder entweder den Namen des Vaters oder der Mutter tragen. Der eineinhalbjährige Julian aus Freiburg heißt beispielsweise Rößler - nach dem Namen der Mutter, seine vierjährige Schwester Melanie dagegen Rößler-Weis. Manche Kinder haben überhaupt keinen Nachnamen, etwa der einjährige Jasper aus Tübingen. Eine Geburtsurkunde kann nicht 132 ausgestellt werden - die Eltern streiten sich mit dem Vormundschaftsgericht über den Nachnamen. Bundesweit sind schätzungsweise 1000 Kinder vom Namenswirrwarr betroffen.“ (STERN 03.04.96) Mir fallen viele gute pädagogische, aber auch juristische Gründe ein, Kindern zu ermöglichen, so zu heißen, wie ihre Geschwister. Hoffentlich vermag auch das BVerfG in der momentanen gesetzlichen Regelung einen Grundgesetzverstoß zu erkennen, wenn schon der Gesetzgeber zu blöd dazu ist! Zum Abschluss der in Deutschland bis 2005 gültig gewesenen gesetzlichen Regelung einige statistische Werte über die Auswirkung der Änderung des Ehenamensrechts: Zehn Jahre nach der Liberalisierung des Ehenamensrechts entschieden sich im Jahr 2000 noch immer 80 % der Paare auf dem Standesamt für den Namen des Mannes, 4 % wählten den der Frau und 16 % behielten ihren Geburtsnamen bei. Aber nicht allen Frauen wird der Name des Mannes als Ehename genehmigt: Eine Dame aus Mühlhausen hatte im Frühjahr 01 im amerikanischen Reno den Indianer Ed Walkinstik-Man-Alone geheiratet, so dass ihr neuer Familienname zu deutsch: „das Hermelin, das alleine läuft“, heißt. Trotz erfolgtem Namenseintrag im Pass machte das Standesamt neun Monate später einen Rückzieher, um die rechtliche Zulässigkeit überprüfen zu lassen. Als Begründung wurde angegeben, dass es sich um einen Eigennamen handle, der erfunden sein könne. Und so etwas dürfe in Deutschland kein Familienname sein. Nun hat das Familiengericht zu entscheiden. Und damit wir nicht vor der neuen gesetzlichen Regelung des Namenrechts in Ehrfurcht erstarren und die nunmehr getroffene Regelung zwingend als der Weisheit letzten Schluss ansehen, sollten wir zum Abschluss dieses Punktes noch einen kurzen Blick über den Zaun zu zwei europäischen Nachbarn werfen, ohne dass wir deren jeweilige Regelung anstreben müssten. Aber ein Blick über den Zaun auf andere rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten weitet den gedanklichen Horizont: „Menschlich gesehen ... Kristjan Kr istj ansso n ist der Sohn des isländischen Kapitäns Kristjan Oskarsson und verbrachte die ersten Jahre seines Lebens auf Frachtschiffen. Kristjansson ist kein Künstlername, sondern Brauch: Der Nachname von Kindern wird in Island aus dem Vornamen des Vaters abgeleitet. ...“ (HH Abendblatt 17.02.00) Und in Spanien, das war in den Zeitungsartikeln zuvor nicht ganz klar herausgekommen, gilt das Trennungsprinzip derart, dass eine Frau auch nach der Heirat ihre beiden Nachnamen behält, von denen der erste vom Vater, der zweite von der Mutter ererbt wurde. Entsprechend erhalten die gemeinsamen Kinder als ersten Nachnamen den ersten Nachnamen des Vaters und als zweiten Nachnamen den ersten Nachnamen der Mutter. Halbgeschwister können demzufolge nur dann den gleichen Namen haben, wenn rein zufällig bei Wiederverheiratung die jeweiligen Mütter und die Väter den gleichen ersten Nachnamen haben. Früher war das auch in Deutschland selbst bei vollbürtigen Geschwistern vielleicht unüblich, aber rechtlich nicht unmöglich. So nannten sich (im 19. Jahrhundert) in der Familie von Heinrich Heine die Kinder teils nach der Mutter, teils nach dem Vater – ohne dass dadurch das deutsche Rechtssystem zusammengebrochen oder der Untergang der deutschen Rechtskultur eingeläutet worden wäre. Dieses geschichtliche Beispiel der Ehenamensbildung in Deutschland als von den damaligen männlichen Gesetzgebern ganz selbstverständlich, fast mit naturrechtlicher Unabdingbarkeit beanspruchtes (Vor-)Recht, ausschließlich den Mannesnamen als Ehenamen weiterzugeben, zeigt sehr schön, dass man keineswegs bestehende rechtliche Regelungen in einem nach dem – teils unerfindlichen - Ratschluss des Gesetzgebers dann eintretenden Denkverbot fraglos hinzunehmen hätte. Der Papst kann auf Grund des zu seiner Machterhaltung ausgedachten und beinahe 2000 Jahre nach der Gründung des Stuhles Petri erst 1870 in das katholische Kirchenrecht eingeführten Unfehlbarkeitsdogmas nach dem Motto handeln: „Roma locuta, causa finita!“33 Dieses Motto kann aber nicht für staatliche Rechtschöpfung in einer Demokratie gelten – was zu sein die römisch-katholische Kirche auch nie beansprucht hat! Gesetze sind keine Glaubensdogmen! Sie verpflichten uns nicht unter Androhung von Höllenqualen, das für richtig zu halten, was sich eine relativ zufällige Zusammensetzung eines Gesetzgebungsorgans ausgedacht hat. Ein Blick auf rechtliche Regelungen gleicher gesellschaftlicher Problemfelder in anderen Ländern bewahrt vor geistiger Einseitigkeit, denn er zeigt, dass es durchaus auch anders gehen könnte, in anderen Ländern - oftmals durchaus mindestens genau so gut - auch anders geht. Irgendwann getroffene gesetzliche Regelungen sind nicht eo ipso sakrosankt, nicht unabdingbar 33 „Rom (= der Papst) hat gesprochen, damit ist die Rechtssache (letztgültig) entschieden.“ 133 geschweige denn eo ipso »gerecht«, nur weil irgendwann ein Rechtssatz geschaffen wurde. (Das wird später noch durch Verweis auf die Nazi-Unrechts-Gesetzgebung exemplarisch verdeutlicht.) Es lohnt sich durchaus, bei sich einstellendem rechtlichen Unbehagen eine als anstößig empfundene rechtliche Regelung auf ihren – an welcher »rechtlichen Elle« auch immer zu messenden - Gerechtigkeitsgehalt hin zu hinterfragen! Und das tat das BVerfG bei nächst sich bietender Gelegenheit. Doch bevor Sie den nächsten Zeitungsartikel lesen, sollten Sie noch einmal drei Seiten zurückblättern und an Hand des Artikels aus der FR vom 17.09.93 nachlesen, was der Gesetzgeber – insbesondere in der Person des CDU-Abgeordneten von Stetten - sich bei der Neuregelung des Ehenamensrechts 1993 vorstellen konnte – und was nicht: Keine Weiterreichung des angeheirateten Ehenamens an einen neuen Ehepartner, insbesondere dann nicht, wenn es sich um einen Adelsnamen handelt. Und nun die Entscheidung des BVerfGs 2004: „Neue Ehe im Namen des Ex-Partners Urteil: Geschiedene dürfen erheirateten Namen weitergeben. Wird Ex-Minister Scharping jetzt Graf? Karlsruhe - Geschiedene dürfen ’erheiratete’ Namen aus früheren Ehen künftig auch dem neuen Partner geben, wenn sie einen gemeinsamen Familiennamen wählen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte die bisherige Regelung für verfassungswidrig, wonach als gemeinsamer Name nur die Geburtsnamen der Partner möglich sind (Az.: 1 BvR 193/97). In der Begründung verwiesen die Richter auf die Persönlichkeitsrechte und auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Folge: Der Gesetzgeber muss bis 31. März 2005 eine Neuregelung schaffen, aber auch für zurückliegende Fälle Änderungen möglich machen, wie das Gericht erklärte. In dem zu Grunde liegenden Fall hatte die Designerin Elke Arora Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil sie nach ihrer Heirat 1993 ihren Namen nicht an ihren neuen Mann weitergeben durfte. Arora hatte geltend gemacht, dass sie ihren Namen bereits seit 35 Jahren trage und er ihre Identität bedeute. Standesamt und ein Kammergericht hatten den Wunsch abgelehnt. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries erklärte in Berlin, die Regierung werde dem Auftrag aus Karlsruhe nachkommen. Das Ministerium hatte vor dem Urteil für die Beibehaltung des bisherigen Rechts plädiert - und unter anderem mit dem Schutzbedürfnis der Namensgeber aus einer Vorehe argumentiert. Die Bundesrichter sahen dies anders: Auch ein bei der Heirat angenommener Ehename sei ein eigener und nicht etwa nur ein ’geliehener’ Name. Wenn ein Partner nach der Scheidung den alten Ehenamen behalte, ihn aber in einer neuen Ehe nicht auch zum Familiennamen machen dürfe, komme das einem Entzug des Namensschutzes gleich. ’Ein Recht auf Namensexklusivität enthält die Verfassung nicht’, urteilten die Richter. Zudem habe sich die bisherige Regelung einseitig zu Gunsten des Mannes ausgewirkt, der seinen Geburtsnamen als Ehenamen beibehalten durfte. Ausdrücklich wiesen die Richter Bedenken über eine Missbrauchsgefahr als ’nicht ausreichend’ zurück. Weder die Nutzung ’besonders schöner Namen’ oder von Adelsnamen seien missbräuchlich. Das Justizministerium hatte unter anderem vor Scheinehen gewarnt. Das Urteil betrifft auch die Ehe des ehemaligen Verteidigungsministers Rudolf Scharping (56), der sich nun Graf Pilati nennen könnte, obwohl seine Frau diesen Namen selbst durch Heirat erworben hat. Kristina Gräfin Pilati (55) stellte gestern aber klar, dass dies nie zur Diskussion gestanden habe. ap/dpa“ (HHA 19. Feb 2004) Das Schutzbedürfnis eines Namensgebers aus einer Vorehe wird also geringer gewertet als das sich auch in dem neuen Namen manifestierende Persönlichkeitsrecht des geschiedenen Ehepartners. Die Argumentationskette des BVerfGs lautete: Der Name sei ein Ausdruck der Identität eines Menschen. Die Identität eines Menschen münde in sein Persönlichkeitsrecht. Auch ein neu erheirateter Name könne zu der nun neuen Identität so untrennbar dazugehören, dass sich daraus eine neue Persönlichkeit bilde, die bei einer Ehescheidung nicht aufgegeben werden müsse. Auch diese neue Persönlichkeit unterliege dem grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrecht, so dass der erheiratete Name bei einer erneuten Eheschließung nicht aufgegeben werden müsse, sondern an den neuen Ehepartner weitergegeben werden könne. Die Bundesverfassungsrichter sahen zudem das Gleichbehandlungsgebot deswegen verletzt, weil der erheiratete Name nach geltendem Recht zwar nicht an neue Ehepartner weitergegeben werden konnte, dafür aber durchaus an Kinder mit dem neuen oder anderen Partner weitergegeben werden kann. Das Gericht wertete die bisherige Regelung auch als Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung, da vor allem Frauen bei der Heirat ihren Geburtsnamen aufgeben. Nach bisherigem Recht waren sie bei einer neuen Eheschließung gezwungen, ihren Namen erneut zu ändern - während ihr Exmann eine neue Frau unter seinem gewohnten Namen heiraten 134 konnte. All diese Gesichtspunkte führten dazu, dass das BVerfG die vom Bundesgesetzgeber nach langwierigen Erörterungen 10 Jahre zuvor getroffene Entscheidung als einen Verfassungsverstoß wertete. Da dem Gesetzgeber bei der Abfassung der Gesetze ein Ermessensspielraum zusteht, den das BVerfG dem Parlament nicht einengen darf, wurde darauf verzichtet, an Stelle des Gesetzgebers eine verfassungskonforme Neuregelung zu verkünden. Es wurde aber – aus schlechten Erfahrungen gewitzigt – dem Deutschen Bundestag eine Frist von einem Jahr zur Erledigung der ihm von unseren obersten Richtern oktroyierten Hausaufgabe gesetzt. „Ehepartner bekommt Namen ’geschenkt’ Gesetz: Geschiedene dürfen angeheirateten Namen mit in die neue Ehe bringen Von Wolfgang Janisch Karlsruhe - Der Bundestag hat ein weiteres Kapitel bei der Liberalisierung des Namensrechts abgeschlossen - eine Geschichte, bei der es letztlich um die Gleichberechtigung von Frau und Mann geht. Fortan gilt: Geschiedene, die wieder heiraten, dürfen den angeheirateten Nachnamen des ExPartners auch zum gemeinsamen Familiennamen in der neuen Ehe machen. Und wer bereits in zweiter Ehe verheiratet ist, kann die neue Möglichkeit der Namenswahl nachholen und innerhalb eines Jahres von der Neuregelung Gebrauch machen. Der Bundestag verabschiedete jetzt ein entsprechendes Gesetz und setzte damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um. Vor dem Bundesrat ist es nicht zustimmungspflichtig. Mit der Neuregelung ist nun klargestellt, daß der angeheiratete Name nicht nur ’geliehen’, sondern ’geschenkt’ wird. Das Verfassungsgericht formulierte es so: ’Er ist Teil und Ausdruck der eigenen Persönlichkeit’ geworden. Die Konsequenzen dürften den Adelsverbänden mißfallen, die im Vorfeld vor Titelmißbrauch gewarnt hatten, vor allem aber den verlassenen Ehemännern. Läßt sich nämlich die angeheiratete Frau Meier scheiden, dann darf sie nicht nur "seinen" Nachnamen mitnehmen; sie darf ihn auch, wenn sie wieder heiratet, an den Rivalen ihres Ex-Mannes weitergeben, der dann ebenfalls Meier hieße. Auch Freunde des Doppelnamens profitieren von dem Gesetz. Heiratet Frau Müller-Schulze nach der Scheidung von Herrn Schulze erneut, dann darf der neue Gatte auch Müller-Schulze heißen. Seinen bisherigen Namen muß er aber aufgeben, denn das Gesetz untersagt die Bildung dreigliedriger Ungetüme. Außerdem gilt die Novelle für eingetragene schwule oder lesbische Partnerschaften. Die bisherige Regelung, wonach Geschiedene nur ihren Geburtsnamen an den neuen Ehepartner weitergeben dürfen, war im Februar von den Karlsruher Richtern für verfassungswidrig erklärt worden. Damit beseitigten sie eine faktische Benachteiligung der Frauen: Denn Eheleute steht es zwar längst frei, ihren oder seinen Namen zu wählen, beide zu behalten oder sich für eine Bindestrich-Lösung zu entscheiden. In der Praxis setzen sich aber immer noch die Männer durch. Laut Untersuchungen tragen in etwa vier Fünftel der Fälle Paare einen gemeinsamen Namen, der vom Mann stammt. Der damals in Karlsruhe entschiedene Fall illustriert die Folgen der alten Regelung besonders deutlich. Die Beschwerdeführerin, eine international erfolgreiche Designerin, hatte ihren Namen zwar seit ihrer ersten Heirat im Jahr 1968 mehr als die Hälfte ihres Lebens geführt. Um in der neuen Ehe einen gemeinsamen Nachnamen führen zu können, hätte sie ihn dennoch aufgeben müssen - es sei denn, sie hätte den oftmals ungeliebten, weil sperrigen Doppelnamen in Kauf genommen. Das alte Namensrecht war seit jeher patriarchalisch geprägt. 1896 bestimmte das Bürgerliche Gesetzbuch, daß die Frau mit der Eheschließung nach dem Manne zu heißen habe. 1957 durfte sie immerhin ihren Geburtsnamen per Bindestrich anfügen. Und ab 1976 durften sich die Eheleute einen der beiden Namen aussuchen - wobei der Mann allerdings im Streitfall den Vorrang behielt. Diese Regelung kippte das Bundesverfassungsgericht 1991, und seither gilt freie Namenswahl. Aber nur in vier Prozent der Fälle machen Paare den Geburtsnamen der Frau zum Familiennamen. Heiratet Frau Müller-Schulze nach der Scheidung von Herrn Schulze erneut, darf der neue Gatte auch Müller-Schulze heißen. Nur dreigliedrige Namensungetüme bleiben weiterhin verboten.“ (HH A 13.11.04) 135 "Schwang erschaftsu rlaub" und der Gleichhei tssatz des Art. 3 II GG 1.3.2.2.4 »Schwangerschaftsurlaub« und die Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes in Art. 3 II GG Wenden wir das über die grundgesetzlich geforderte Gleichbehandlung von Mann und Frau bisher Gelernte einmal in einer einfachen Überlegung an: Wie ist es, wenn ein werdender Vater - vielleicht an Stelle seiner Frau, weil ihn das alles mehr mitnimmt als sie - »Schwangerschaftsurlaub« haben möchte, weil nicht nur seine Frau, sondern auch er Familienzuwachs erwartet? Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet, "wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches entsprechend seiner Eigenart ungleich" zu behandeln. Da es nun einmal so ist, dass bestimmungsgemäß grundsätzlich Frauen die Kinder gebären (teilweise müssen: an moslemischen Frauen in Bosnien-Herzegowina wiederholt bis mindestens zur erwarteten Befruchtung begangene Massenvergewaltigungen mit Geburtszwang durch freiheitsberaubende Inhaftierung bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat, damit eine Abtreibung nicht mehr möglich ist), kann der entnervte Vater keinen Schwangerschaftsurlaub erhalten. Der Schwangerschaftsurlaub ist nur zum Austragen der Schwangerschaft vorgesehen - das ist keine sachfremde Differenzierung - und kann von Männern nur im extremsten Ausnahmefall beansprucht werden: "Mutterschutz afp Manila - Edwin Bayron (32) erhält 45 Tage Mutterschaftsurlaub wie eine weibliche Angestellte. Das erklärte das Ministerium in Manila. Der Hermaphrodit `Carlo' ließ sich 1988 operieren, um Kinder zu bekommen. Er ist im siebten Monat schwanger." (HH A 05.06.92) Erziehung surlaub und Gleichhei tssatz des Art. 3 II GG 1.3.2.2.5 Erziehungsurlaub und die Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 II GG Und wie ist es mit dem halben Jahr Erziehungsurlaub nach der Geburt? Weil idealtypisch beide Eltern die Erziehung gemeinsam und einverständlich wahrnehmen sollen, dürfen sie sich den gesetzlich zugestandenen Gesamt-Erziehungsurlaub völlig nach eigenen Vorstellungen einteilen, auch wenn verschiedene Arbeitgeber betroffen sind. Jedes Elternteil kann wie bisher - in Absprache mit dem Ehepartner – den Urlaub ganz für sich allein beanspruchen; der andere Ehepartner arbeitet dann voll weiter. Die Eltern können sich den Erziehungsurlaub aber auch nach eigenem Belieben in einer ihnen genehmen Stückelung aufteilen. Nach einer Anfang 2000 geplanten Gesetzesänderung sollen Eltern den Erziehungsurlaub bald auch gemeinsam nehmen dürfen. 1.3.2.2.6 »Mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte, insbesondere des Gleichheitssatzes, im Arbeitsrecht Es wäre ein zum Schadensersatz verpflichtender Verstoß gegen die Grundrechte, wenn ein Arbeitgeber (noch immer) so dumm wäre, einer Bewerberin zu schreiben, dass ihre Bewerbung um die ausgeschriebene Stelle von ihm trotz gleichwertiger oder sogar besserer Qualifikation nur deswegen abgelehnt werde, weil sie eine Frau sei. Da kämen dann doch die im ersten Abschnitt der Verfassung normierten Grundrechte, die vorrangig den Staat verpflichten, sich aus der Privatsphäre des Bürgers herauszuhalten, auch zwischen Privatleuten diskriminierungshemmend in “mittelbarer Drittwirkung“ zum Tragen. Deswegen werden solche Absagen von Arbeitgebern inzwischen natürlich geschickter formuliert. Die Geltung des Grundgesetzes spricht sich ja auch unter den konservativsten Arbeitgebern herum. Dafür sorgen u.a. die an Art. 3 GG ausgerichteten Urteile des BAG. So war das BAG u.a. angerufen worden, weil (bis 1955) die Entlohnung von Frauen mit der sogenannten »Frauenabschlagsklausel« verbunden war. Nach dieser Klausel erhielten Frauen einen um ca. 25 % geringeren Lohn als mit gleicher Tätigkeit beschäftigte Männer, weil ihre Beschäftigung mit einem größeren Kostenrisiko, z.B. durch den Eintritt einer Schwangerschaft, behaftet ist. Mit dieser Argumentation wurde den Frauen von den Arbeitgebern »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« verweigert, obwohl viele Frauen die einzigen Ernährer ihrer Restfamilie waren, nachdem ihre Männer ihr Leben im Zweiten Weltkrieg gelassen hatten. Dieser ungerechten Entlohnungspraxis versuchte das BAG mit seinem Urteil vom 15.01.55 einen Riegel vorzuschieben, indem es sie für verfassungswidrig erklärte. In den Urteilsgründen heißt es u.a.: 136 »Mittelba re Drittwirk ung« des Gleichhei tssatzes im Arbeitsre cht „Der Gleichberechtigungsgrundsatz und das Benachteiligungsverbot umfassen auch den Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau bei gleicher Arbeit. Der Lohngleichheitsgrundsatz bindet als Grundrecht nicht nur die staatliche Gewalt, sondern auch die Tarifvertragsparteien. Eine Tarifklausel, die generell und schematisch weiblichen Arbeitskräften bei gleicher Arbeit nur einen bestimmten Hundertsatz der tariflichen Löhne als Mindestlohn zubilligt, verstößt gegen den Lohngleichheitsgrundsatz und ist nichtig. Der Grundsatz der Lohngleichheit schließt es aus, daß die Arbeit der Frau mit Rücksicht auf die zu ihren Gunsten erlassenen Schutznormen geringer entlohnt wird. Nur solche Lohndifferenzierungen sind zulässig, die auch bei Männern vorgenommen werden, wenn und soweit es sich um Arbeiten handelt, die in gleicher Weise für Männer und Frauen tariflich vorgesehen sind.“ Ich weiß nicht, ob Sie eben die Begründung des BAG aufmerksam genug gelesen und dann gleich mitgedacht haben; es wäre zwar erfreulich, aber doch verwunderlich, denn schließlich sind Sie ja gerade erst am Anfang dieses Buches und noch nicht auf »juristische Zwischentöne« geeicht: Das BAG sprach von Tarifvertragsparteien, zwischen denen der vom Gleichberechtigungsgrundsatz und dem Benachteiligungsverbot abgeleitete Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau bei gleicher Arbeit zu gelten habe. Über die Entlohnung außertariflich eingestufter Mitarbeiter ist damit überhaupt nichts entschieden worden. Da herrscht darum ein halbes Jahrhundert später immer noch der Grundsatz der Lohnungleichheit: „Bekannter Aufreger Frauen verdienen viel weniger Frauen verdienen einer Studie zufolge trotz gleicher Qualifikation im gleichen Job bis zu 30 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Für die Untersuchung der Vergütungsberatung Personalmarkt im Auftrag des Magazins "stern" seien mehr als 250 000 Gehälter in 22 Berufen analysiert worden. So bekomme ein 45-jähriger Controller durchschnittlich 61 744 Euro brutto im Jahr, eine gleich alte Controllerin aber nur 42 480 Euro, ein Unterschied von 31 Prozent. Eine 40-jährige Ingenieurin verdiene mit knapp 40 000 Euro im Schnitt ein Viertel weniger als ihr Kollege. Eklatant seien die Unterschiede bei Unternehmensberatern: Eine 35- Jährige verdiene durchschnittlich 48 255 Euro, der gleichaltrige Kollege mit 68 850 Euro 30 Prozent mehr. Auch bei Führungsjobs sehe es nicht besser aus: Eine Frau, die mehr als 30 Mitarbeiter leitet, bekomme durchschnittlich ein Drittel weniger als ein Mann mit gleicher Qualifikation im gleichen Job. Eine 45-Jährige erhält 77 464 Euro, ihr gleichaltriger Kollege 113 706. Im europäischen Vergleich der Abstände zwischen den Gehältern von Männern und Frauen lande Deutschland mit 24 Prozent auf den hintersten Rängen. Die Untersuchung zeige auch, dass die Unterschiede beim Eintritt ins Berufsleben noch nicht so groß seien. Aber in fast allen untersuchten Berufen öffne sich ab Mitte dreißig die Gehaltsschere - wenn viele Frauen sich zwischen Kind und Karriere hin- und hergerissen fühlten.“ (n-tv.de 03.11.04) Zurück zum Eingangsfall dieses Kapitels: Die Frauen, die nach der zitierten BAG-Entscheidung gehofft hatten, dass ihre Löhne nun angehoben würden, wurden bitter enttäuscht. Es stellte sich heraus, dass sie nur einen Etappensieg errungen hatten, denn die nach dem Urteil anstehende Erhöhung der Frauenlöhne wurde durch die Einführung neuer Lohngruppensysteme mit Leichtlohngruppen für typischerweise von Frauen verrichtete Arbeiten umgangen. Das gab dem BAG Anlass, seine Grundsatzentscheidung »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit« in weiteren Urteilen zu bekräftigen und auch im Einzelfall durchzusetzen. Ein solcher Fall wird nachfolgend dargestellt. Es werden die wichtigsten auf den Gleichheitssatz des Art. 3 GG bezogenen Urteilserwägungen aus dem Urteil zitiert: Fall: In einem Betrieb wurde in der Abteilung Filmentwicklung in mehreren sich teilweise überschneidenden Schichten gearbeitet. In dem abgeschlossenen Manteltarifvertrag (MTV) wurde als zulagenpflichtige Nachtarbeitszeit die Zeit von 20.00 - 06.00 Uhr vereinbart. In der Spätschicht von 18.00 - 24.00 Uhr arbeiteten fast ausschließlich Frauen, in der Nachtschicht von 22.00 - 06.00 Uhr ausschließlich Männer. 137 Für die Spätschicht zahlte der Arbeitgeber den dort beschäftigten Frauen eine geringe übertarifliche, gestaffelte Zulage von DM 0,42 - 1,42 pro Stunde, für die Arbeit während der Nachtschicht zahlte der Arbeitgeber den dort beschäftigten Männern eine Zulage von DM 0,70 - 2,00 pro Stunde, die im Mittelwert aber mehr als DM 1,50 betrug. Der Arbeitgeber begründete in seiner Stellungnahme vor dem Arbeitsgericht die erhöhte Zulage für die Nachtschicht - und damit nur für die Männer - mit der enormen gesundheitlichen Belastung durch die Nachtarbeit, der insbesondere die Arbeitnehmer ausgesetzt seien, die eine volle Nachtschicht ableisten. Die Frauen aus der Spätschicht begehrten die finanzielle Gleichstellung in der Bezahlung mit ihren männlichen Kollegen für die Stunden von 20.00 - 24.00 Uhr, weil sie laut des abgeschlossenen MTV teilweise ja auch Nachtarbeit leisteten. Wie war zu entscheiden? Das Arbeitsgericht (ArbG) hatte der Klage stattgegeben, das Landesarbeitsgericht (LAG) hingegen hatte in der Berufung die Klage abgewiesen. Die daraufhin von den Klägerinnen eingelegte Revision führte zur Aufhebung des LAG-Urteils und zur Wiederherstellung des ArbG-Urteils. Aus den Gründen des BAG: "I.1. Der Anspruch auf Zahlung einer übertariflichen Zulage in Höhe von DM 1,50 je Arbeitsstunde ist aus dem arbeitsrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung begründet. Dieser wird inhaltlich vom Gleichberechtigungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 2 GG und vom Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 GG geprägt. Art. 3 Abs. 2 und 3 GG verbieten jede Differenzierung nach dem Geschlecht. Aus diesem Verfassungsgebot hat das Bundesarbeitsgericht den Grundsatz der Lohngleichheit von Mann und Frau hergeleitet. Danach darf der Lohn nur nach der zu leistenden Arbeit ohne Rücksicht darauf bestimmt werden, ob sie von einem Mann oder einer Frau erbracht wird (so die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts). 2. ... Der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet es dem Arbeitgeber, bei freiwilligen Leistungen die Leistungsvoraussetzungen so abzugrenzen, daß kein Arbeitnehmer seines Betriebes hiervon aus sachfremden oder willkürlichen Gründen ausgeschlossen bleibt. ... Auch im Schrifttum ist anerkannt, daß der Gleichbehandlungsgrundsatz dem Arbeitgeber zwar die Freiheit läßt, den Personenkreis abzugrenzen, dem freiwillige Leistungen zukommen sollen, er kann also Gruppen bilden; diese Gruppenbildung muß jedoch sachlich gerechtfertigt sein. Eine Differenzierung, die auf der Geschlechtszugehörigkeit beruht, ist nicht zulässig. ... II. 1. In dem Betrieb der Beklagten liegt eine allgemein geltende Zulagenregelung vor. ... Das LAG ist davon ausgegangen, daß eine generelle Zulagenregelung im Betrieb der Beklagten nicht besteht. ... Das LAG hat angenommen, von einer einheitlichen Zulagenregelung könne schon deshalb keine Rede sein, weil die Beklagte allein an die männlichen Arbeitnehmer sieben unterschiedlich hohe Zulagen zwischen 0,70 DM und 2,- DM je Stunde zahle, ... . Die Zulagen an die Männer heben sich deutlich von den Zahlungen an die Frauen ab. Es kann nicht darauf ankommen, ob alle Männer einheitlich hohe Zulagen erhalten. Wolle man darauf abstellen, dann könnte die Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes schon dadurch verhindert werden, daß der Arbeitgeber die Höhe der an eine Gruppe von Arbeitnehmern gezahlten Zulagen staffelt. ... 2. Die von der Beklagten vorgenommene Differenzierung der Zulagen an Männer und Frauen ist sachlich nicht gerechtfertigt. ... ... 4. Nach alledem kann nur davon ausgegangen werden, daß den männlichen Arbeitnehmern Zulagen oder höhere Zulagen deshalb gewährt wurden, weil sie nicht bereit waren, zum Tariflohn zu arbeiten. Dies hat die Beklagte auch selbst eingeräumt. Die Klägerinnen, die für die gleiche Arbeit mit dem Tariflohn oder geringeren Zulagen bezahlt wurden, sind daher allein deshalb ungünstiger behandelt worden, weil ihre Arbeitskraft nicht ebenso bewertet wurde wie die der Männer. Darin liegt gerade die Diskriminierung, die Art. 3 Abs. 2 GG verbietet. III. Da die Klagen schon aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung Erfolg haben, konnte dahinstehen, ob auch andere Rechtsgrundlagen ... den Klageanspruch ebenfalls stützen konnten." (Der Betrieb 2/82 S. 119) Der Gleichheitssatz kommt im Arbeitsrecht natürlich nicht nur dann zum Tragen, wenn es bei gleicher Arbeit um Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen geht. So hat z.B. das OLG Düsseldorf 1999 entschieden, dass Funktaxizentralen ausländische Arbeitnehmer nicht von bestimmten (lukrativen) Touren ausschließen dürfen. Geklagt und gewonnen hatten türkische Fahrer aus Duisburg, von denen einer sogar einen deutschen Pass hatte. Entscheidungsgrundlage kann nur der allgemeine Gleichheitsgrundsatz und seine Anwendung im Arbeitsrecht gewesen sein. 138 Ein weiterer Fall einer »mittelbaren Drittwirkung« der Grundrechte im Arbeitsrecht wurde 2003 vom BVerfG entschieden, als eine türkische muslimische Verkäuferin gegen ihre Entlassung aus dem (privatrechtlich eingegangenen) Arbeitsverhältnis in einem deutschen Kaufhaus klagte: Sie war – ohne zu der Zeit der Aufnahme des Arbeitsverhältnisses ein Kopftuch zu tragen – als Verkäuferin eingestellt und in der Kosmetikabteilung eingesetzt worden. Wie Sie durch Augenscheinseinnahme überprüfen können, werden auf solchen Positionen üblicherweise fast ausschließlich hübsche, zumindest aber meist sehr gepflegt wirkende Frauen eingesetzt. (Wenn es sich um Kosmetik für junge Frauen handelt, können allerdings auch sehr »schräg« gestylte Typen dort beschäftigt sein.) Nach der Baby-Pause brach bei der jungen Türkin eine fundamentalistische Haltung ihrem islamischen Glauben gegenüber durch, so dass sie ab dem Zeitpunkt ihrer Wiederbeschäftigung ein Kopftuch zu tragen begehrte. Das wollte die Arbeitgeberin nicht hinnehmen, weil die Verkäuferin auch Andersgläubige aus dem ländlich-konservativen Umkreis bedienen müsse und die sich beim Kauf hochwertiger Kosmetika von der fundamentalistischen Verkleidung gestört fühlen könnten. Das Tragen des Kopftuches könnte zu Geschäftseinbußen führen. Vom Arbeitgeber wurde wohl so etwas wie eine »Neutralitätspflicht« den Kundinnen gegenüber gesehen und angemahnt, die durch die ostentative äußerliche Glaubensbekundung mittels des demonstrativ getragenen Kopftuches verletzt sei. Die Türkin gab nicht nach, woraufhin ihr gekündigt wurde. Das Kaufhaus obsiegte in der ersten und zweiten Instanz, nicht aber beim BAG. Das ließ das ursprünglich gegen staatliche Eingriffe erkämpfte Grundrecht der Glaubensfreiheit in mittelbarer Drittwirkung auch in dem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis zu Gunsten der Muslimin durchgreifen. Hierzu führte das nach Ausschöpfung des üblichen Rechtsweges wegen der intendierten Grundrechtsproblematik zuletzt angerufenen BVerfG in seinem ablehnenden Beschluss, das Urteil des BAG zu revidieren, aus: „Privatpersonen unterliegen grundsätzlich nicht der Bindung der Grundrechte. Gleichwohl sind die Grundrechte auch in privatrechtlichen Beziehungen von Bedeutung. Sie beeinflussen die Auslegung der zivilrechtlichen Vorschriften, die im Geiste der Grundrechte ausgelegt und angewandt werden müssen, was sich vor allem auf die zivilrechtlichen Generalklauseln und die sonstigen auslegungsfähigen und auslegungsbedürftigen Begriffe auswirkt. Dies gilt auch im Arbeitsrecht.“ Da sich die Verkäuferin auf ihr Grundrecht der Glaubensfreiheit aus Art. 4 GG berief und erklärte, dass das Tragen des Kopftuches für sie eine Glaubensäußerung darstelle, bewirke die »mittelbare Drittwirkung« der Grundrechte im Arbeitsrecht, dass der Arbeitgeber das religiös motivierte Tragen des Kopftuches hinzunehmen habe, auch wenn in einer »Gummi-Klausel« des Arbeitsvertrages ganz allgemein das Tragen „dezenter Kleidung“ vertraglich vereinbart worden war. Da die Türkin aber sicher ganz allgemein als Verkäuferin eingestellt worden sein wird, bestimmt auch mit der Maßgabe, dass sie nach dem Willen der Leitung des Kaufhauses überall eingesetzt werden könne – und nicht ausschließlich als Fachverkäuferin für Kosmetik –, kann sie unter Berufung auf das Direktionsrecht des Arbeitgebers sehr wohl dort eingesetzt werden, wo aus Hygienegründen eine Kopfbedeckung getragen werden muss. Die Verkäuferin könne ja auch weniger exponiert als in der Parfümerieabteilung des Kaufhauses eingesetzt werden: Also ein bisschen mehr Kreativität - und ab in die Fischabteilung! Dann kündigt sie vielleicht von sich aus. Oder zum Verkauf der Fleisch- und Wurstwaren. (Die Arbeitgeberin wird sich ärgern, nicht gleich diesen Weg beschritten zu haben, denn dann hätte sie sich die gerichtlichen Scherereien und all die Kosten gespart.) Schwieriger ist das gleichgelagerte Problem für den Staat im Fall einer zum Islam konvertierten und daraufhin ein Kopftuch tragenden Lehrerin zu lösen, denn die kann der Staat ja nicht als Putzfrau, sondern höchstens als Hauswirtschaftslehrerin einsetzen. Art. 3 II GG schützt auch die Männer 1.3.2.2.7 Art. 3 II GG schützt auch die Männer Trotz der Geltung des in Art. 3 I GG festgeschriebenen Gleichheitssatzes und insbesondere seiner weiteren Konkretisierungen in dessen Absätzen 2 und 3 und der durch ihn gebotenen Gleichbehandlung der Geschlechter sind nicht nur die Frauen, sondern ist auch eine spezielle Gruppe der Männer - vom BVerfG in mehreren Entscheidungen abgesegnet - von staatlichen Stellen, insbesondere den Staatsanwaltschaften und Gerichten, jahrzehntelang aufs Äußerste benachteiligt und verfolgt worden: die männlichen Homosexuellen. Bis zur 4. Reform des Gesetzes zur Änderung des Strafrechts Ende 1973 galt die Homosexualität selbst unter erwachsenen Männern als strafwürdig und wurde mit Gefängnisstrafe, in schweren Fällen gar mit (der mit der 1. Reform des Gesetzes zur Änderung des Strafrechts Ende 1969 abgeschafften) Zuchthausstrafe geahndet. Wo ist aber bitte der qualitative Unterschied, der männliche Homosexualität so schwer bestrafen, weibliche Homosexualität 139 hingegen völlig straffrei ließ? Was war an der männlichen gleichgeschlechtlich gelebten Sexualität soviel »ungleicher«, dass damit im Gegensatz zu praktizierter weiblicher gleichgeschlechtlicher Sexualität eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen gewesen wäre – und zu rechtfertigen ist? Denn der mehrfach neugefasste § 175 StGB bedroht weiterhin einen „Mann, über achtzehn Jahre, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter achtzehn Jahren vornimmt oder von einem Mann unter achtzehn Jahren an sich vornehmen lässt ... mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe.“ Als durch den § 175 StGB geschütztes Rechtsgut wird zwar nicht mehr ganz allgemein die früher als „unsittlich“ betrachtete gleichgeschlechtliche Betätigung unter Männern angegeben, sondern nur noch die ungestörte sexuelle Entwicklung männlicher Jugendlicher: Ein durch einen Älteren verführter Jugendlicher solle nicht »an das andere Ufer« abdriften. Aber was ist mit der ungestörten sexuellen Entwicklung einer weiblichen Jugendlichen? Wenn eine 20-Jährige ihre Lust mit einer 17Jährigen lebt, die durch diese Erfahrungen für die Männerwelt verloren geht, dann bleibt das straffrei! Der Erwerb einer möglicherweise durch Verführung umgepolten sexuellen Neigung ist nicht auf männliche Jugendliche beschränkt! Die Vorschrift des § 175 StGB verstoße aber trotz der nicht in gleicher Weise unter Strafe gestellten lesbischen Betätigung nach Meinung des BVerfGs nicht gegen Art. 3 GG. Egal, welche Argumentationsklimmzüge da gemacht worden sind: Es ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung! Wegen ungefähr eines Teelöffels voll »vergeudeten«, jederzeit wieder reproduzierbaren milchig-weißen männlichen Samens? Dahinter stecken wohl noch die durch Erziehungstradition tief verwurzelten, aus der christlichen Religion und falschem medizinischem Wissen herrührenden religiösen Vorbehalte und damit verbundenen Abneigungen gegenüber männlicher gleichgeschlechtlicher Aktivität: Als weibliche Eizellen noch gänzlich unbekannt waren, hielt man den durch Ejakulation sichtbaren männlichen Samen für die alleinige lebensspendende göttliche Gabe, die in das bloße Gefäß Frau gegossen werde. Und nach jüdischer und dann christlicher Anschauung durfte dieses Göttliche nicht unsachgemäß verschleudert werden. So durfte Onan nicht durch einen coitus interruptus »in der Kurve abspringen« und nicht seinen Samen beim ihm aus jüdischreligiöser Verpflichtung auferlegten Coitus mit seiner verwitweten Schwägerin in den Sand tropfen lassen, wo er verdorrte. Diese Einstellung hat sich im Gegensatz zu ihrer Bewertung in romanischen Ländern in Deutschland erhalten und schimmert noch immer durch die Ungleichbehandlung von männlicher und weiblicher gleichgeschlechtlich praktizierter Sexualität durch. Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 I GG und seine Konkretisierung in Art. 3 II GG schützt aber nicht nur die Rechte der Frauen vor Ungleichbehandlung. Auch die Männer können sich bei sachfremder Ungleichbehandlung auf das Grundrecht der Gleichbehandlung berufen. Das tat z.B. ein Mann, der Hebamme werden und das für Männer (jedenfalls damals) bestehende Zugangsverbot zu dieser Berufsausbildung nicht hinnehmen wollte. Dieser Fall wiederholte sich 1993: "Streit um ‘Hebammer' dpa Oldenburg - Eine Einigungsstelle unter Vorsitz des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts Bremen, Martin Bertzbach, muß über den Wunsch eines Oldenburger Krankenpflegers (36) entscheiden. Er möchte zum ‘Hebammer' ausgebildet werden. Die Leitung der städtischen Kliniken: Das ist den werdenden Müttern nicht zuzumuten." (HH A 26.05.93) Da fragt sich der (nur) logisch denkende Zeitgenosse: "Wieso nicht, da die meisten Gynäkologen (noch) Männer sind?" Und wenn man regelmäßig Zeitung liest und die Reporter an selbst einem kleinen Thema dranbleiben - das ist aber leider nur selten der Fall -, dann kann man manchmal auch noch die Auflösung mitbekommen: "Mann als Hebamme dpa Oldenburg - Endlich darf er Babys zur Welt bringen. Eine Einigungsstelle am Bremer Landesarbeitsgericht bescheinigte einem Krankenpfleger (36) den Anspruch auf einen Ausbildungsplatz an der Hebammenschule der Städtischen Kliniken. Er sei besser qualifiziert als seine Mitbewerberinnen." (HH A 10.06.93) Ein anderer Fall: Das "Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen über Freizeitgewährung für Frauen mit eigenem Hausstand" vom 27.07.48 besagte in seinem § 1 HATG NRW 140 "In Betrieben und Verwaltungen aller Art haben Frauen mit eigenem Haushalt, die im Durchschnitt wöchentlich mindestens 40 Stunden arbeiten, Anspruch auf einen arbeitsfreien Wochentag (Hausarbeitstag) in jedem Monat." Ähnliche gesetzliche Regelungen bestanden zu der Zeit in Bremen, Hamburg und Niedersachsen. M (= Mann), Krankenpfleger im Dienst des Landes NRW, war ledig und wohnte allein in einer Wohnung von ca. 80 qm. Er arbeitete 40 Stunden an 6 Tagen in der Woche. Sein Arbeitgeber lehnte seinen Antrag vom 01.10.77 ab, ihm von Oktober 1977 an einen Hausarbeitstag zu gewähren. Im arbeitsgerichtlichen Verfahren beantragte M daraufhin zuletzt, das Land NRW zu verurteilen, ihm für einen arbeitsfreien Hausarbeitstag eine Abgeltung von DM 120,- brutto zu zahlen. Das Land NRW berief sich in seiner Ablehnung auf den damals schon seit mehr als 29 Jahren unangefochten bestehenden Wortlaut des § 1 HATG NRW, in dem nur "Frauen" als begünstigter Personenkreis aufgeführt waren, und auf die fast drei Jahrzehnte lang geübte Praxis, nur diesem Personenkreis die in der Vorschrift geregelte Vergünstigung zukommen zu lassen. (Als wenn es ein durchschlagendes Argument sein könnte, dass etwas jahre- oder sogar jahrzehntelang lang möglicherweise falsch gemacht worden ist!) M hielt diese Vorschrift für verfassungswidrig, da sie seiner Meinung nach gegen Art. 3 II GG verstoße. Wie war zu entscheiden? Das Arbeitsgericht hat die Klage in Verfolgung der Rechtsprechung des BAG abgewiesen. Nach der in mehreren Prozessen erstrittenen und zwischenzeitlich gefestigten Rechtsprechung des BAG konnten nicht nur die auf Grund der Kriegsbelastung 1943 ursprünglich vorgesehenen verheirateten, sondern auch alleinlebende Arbeitnehmerinnen, die unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen einen eigenen Haushalt führten, einen Hausarbeitstag beanspruchen, aber eben nur Frauen, nicht jedoch Männer. Das an sich oft recht fortschrittlich eingestellte BAG hielt die Vorschrift in dieser Auslegung mit dem Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 II GG für vereinbar. Sie knüpfe an die typische Arbeitsteilung der Geschlechter an und sei als Arbeitsschutzrecht für erwerbstätige Frauen anzusehen. (Wie ein weiblicher Single in seinem Einpersonen-Haushalt eine typische Arbeitsteilung mit einem - von gewissen Stunden vielleicht abgesehen - nicht vorhandenen Mann vornimmt, hatte das BAG aber nicht erklärt!) Das ArbG Köln führte darum in Anlehnung an die BAG-Rechtsprechung aus: Der von dem Kläger geltend gemachte Anspruch finde weder in dem Hausarbeitsgesetz NRW (HATG NRW ) noch in Art. 3 II GG eine Rechtsgrundlage. In § 1 HATG NRW seien als Anspruchsberechtigte nur Frauen genannt. Wenn das Gesetz wegen Verstoßes gegen Art. 3 GG unwirksam wäre, weil es Frauen unzulässig begünstige, habe das nicht die von dem Kläger erhoffte Rechtsfolge, dass Männer die gleichen Rechte erhielten. Es sei Sinn des Gleichberechtigungsgrundsatzes, die Frauen, die bisher rechtlich benachteiligt gewesen seien, auf den Status der Männer anzuheben. Aus Art. 3 GG könne jedoch nicht abgeleitet werden, dass den Männern, wenn der Gesetzgeber in seinem Bestreben, die Frauen den Männern gleichzustellen, über das Ziel "hinausgeschossen" sei und die Frauen "überprivilegiert" habe, die den Frauen gewährten Rechte auch eingeräumt werden müssten. (Hinter diesen Ausführungen des ArbG steht als Überlegung der allgemein anerkannte Grundsatz, dass es keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geben könne.) Diese vorstehend referierte Auslegung des ArbG ist eine Auslegung des § 1 HATG NRW, die starr am Wortlaut dieses Gesetzes orientiert war. Doch wie wir noch sehen werden, brauchen sich Gesetz und Recht nicht zu entsprechen. Darum die Kontrollfrage: War diese Gesetzesauslegung des § 1 HATG NRW durch das Kölner ArbG auch am höherrangigen Grundgesetz und ganz allgemein am Recht - was immer das auch sei; zunächst: was jeder dumpf in sich zu fühlen glaubt - ausgerichtet? Der Rechtsanwalt des Klägers meinte nein und machte die Sache gemäß „Art. 93 GG Das Bundesverfassungsgericht entscheidet ... 4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte ... verletzt zu sein." und des auf Art. 93 GG basierenden, fast wortgleich lautenden § 13 Nr. 8 a BVerfGG bei unserem höchsten Gericht anhängig (BVerfGE 52/369 ff). Er argumentierte: Die Nichtgewährung des Hausarbeitstages an männliche Arbeitnehmer könne mit dem Hinweis auf die 141 traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter nicht gerechtfertigt werden. Zwar werde eine Arbeitsteilung, nach der die Frau den Haushalt führe und der Mann im Berufsleben stehe, noch häufig praktiziert. Als gesellschaftliches Prinzip sei dieser Grundsatz jedoch längst überwunden. Es gelte heute gesellschaftlich keineswegs mehr als anrüchig, wenn eine Frau am Berufsleben teilnehme. Auch sei es nicht mehr typisch, dass die alleinstehende Frau ihren Haushalt selbst führe, während bei dem Mann das Gegenteil der Fall sei. Es sei ausschließlich eine Frage der finanziellen Situation oder der persönlichen Neigung, ob eine alleinstehende Person, gleichgültig ob Mann oder Frau, sich selbst versorge oder gegen Bezahlung durch Dritte versorgen lasse. Entscheide sie sich für die Selbstversorgung, sei die Situation für Mann und Frau gleich. Im übrigen komme dem Gleichberechtigungsgrundsatz eine gewisse korrigierende Funktion hinsichtlich dessen zu, was bisher als typische Rollenverteilung angesehen worden sei. Das BVerfG hatte, wie üblich, alle in die zu entscheidende Rechtsproblematik irgendwie Involvierten für seine anstehenden Beratungen um eine Stellungnahme gebeten. Die Bundesregierung, der Ministerpräsident des Landes NRW und das BAG haben daraufhin aber nur auf die bisherige Rechtsprechung des BAG hingewiesen und im übrigen von Stellungnahmen abgesehen. Und das BAG hatte im zuvor abgehandelten "LohnzulagenFall" doch gezeigt, dass es den Art. 3 GG kennt, ernst nimmt und zur gezielten, am Geist des Grundgesetzes orientierten Rechtsfortbildung einsetzt. Nun erhielten die im Vergleich zu vielen anderen Richtern an sich schon recht fortschrittlich eingestellten obersten Arbeitsrichter der Bundesrepublik eine Nachhilfestunde in richtiger Grundgesetzinterpretation von den hierzu berufenen BVerfG-Richtern: "Die Regelung des § 1 HATG NRW knüpft bei der Bestimmung, welchen Personen der Hausarbeitstag zu gewähren ist, allein an den Geschlechtsunterschied an und nimmt damit eine verfassungsrechtlich unzulässige Differenzierung vor. ... Eine Doppelbelastung durch Berufstätigkeit und Haushaltsführung kann auch bei Männern in Betracht kommen. Dies gilt insbesondere für Alleinstehende, die sich in einer eigenen Wohnung selbst versorgen, da bei ihnen Berufstätigkeit und Haushaltsführung zwangsläufig in einer Person zusammentreffen. Soweit ein alleinstehender Arbeitnehmer die Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt trägt, ist es nicht gerechtfertigt, ihn bei der Gewährung des Hausarbeitstages anders als eine alleinstehende Arbeitnehmerin zu behandeln. ... Der Umfang der zu erledigenden Hausarbeit ist nicht geringer, wenn der Haushalt von einem Mann statt von einer Frau geführt wird. Bei dieser Sachlage kann die Gewährung des bezahlten Hausarbeitstages nur an Frauen mit den biologischen Unterschieden der Geschlechter nicht begründet werden. ... Jedenfalls verletzt die einseitige Hausarbeitsregelung zugunsten der alleinstehenden Frauen den Grundsatz der Gleichberechtigung nach Art. 3 Abs. 2 GG. Diese Frauen unterscheiden sich in keinem wesentlichen Punkt von Männern in gleicher Lage. ... Es verstößt gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz, wenn den privaten Interessen der weiblichen Arbeitnehmer an einer bestimmten außerbetrieblichen Tätigkeit durch eine Ungleichbehandlung Rechnung getragen wird. ... Das BVerfG kann die Vorschrift des § 1 HATG NRW nicht für nichtig erklären, sondern muß sich darauf beschränken, ihre Verfassungswidrigkeit festzustellen, da dem Gesetzgeber verschiedene Wege offenstehen, die von der Verfassung geforderte Gleichheit herzustellen. Das Urteil des Arbeitsgerichts Köln ist aufzuheben, da es auf der für verfassungswidrig erklärten Vorschrift des § 1 HATG NRW beruht (§ 95 Abs. 2 BVerfGG). Die Sache ist an das Arbeitsgericht zurückzuverweisen. ..." Kein Argument des BAG wurde gelten gelassen! Das war eine »6:0-6:0-Höchststrafe« des BVerfGs an das BAG, wie eine überragend spielende Steffi Graf sie in besonders erfolgreichen Spielen an Gegnerinnen austeilte, wenn die »neben sich standen« und sie denen in einem Endspiel Tennisunterricht erteilte. Und drei letzte Meldungen zu dem Problemkreis der Gleichberechtigungsproblematik: Einen rechtskräftig als Mann anerkannten Transsexuellen muss die private Krankenversicherung in den günstigeren Männertarif einordnen (OLG Köln Az. 5 U 80/93). Der wegen seiner Transsexualität im November 1998 von seiner Gemeinde abgewählte Bürgermeister von Quellendorf in Sachsen-Anhalt, Michael/a Lindner, der - wie ca. 300 Personen in der Bundesrepublik jedes Jahr - eine mit DM 40.000 (auf Grund seiner Arbeitslosigkeit durch das Sozialamt) bezahlte Geschlechtsumwandlung hinter sich brachte - „Es war eine Laseroperation. Und die neuen Körperteile funktionieren prächtig. Es ist 142 richtig schön im Bett“, gab er dem STERN zu Protokoll -, will seine Abwahl durch das BVerfG überprüfen lassen. Übrigens hat die Kostenübernahme der Operationskosten durch das Sozialamt auch etwas mit Grundrechten und Gesetz zu tun; aber das soll nicht weiter ausgeführt werden. 1999 verklagte die 22-jährige deutsche Elektronikerin Tanja Kreil vor dem VG Hannover die Bundesrepublik Deutschland, in der Bundeswehr Dienst mit der Waffe - und nicht nur wie 4.340 andere (seit 1975 ) in Sanitätsund 60 (seit 1991) in Musikkompanien - tun zu dürfen. Sie war 1996 mit diesem Begehren von der Bundeswehr abgewiesen worden. An waffentragende Polizistinnen ist man(n) inzwischen gewöhnt. Warum dann - unter dem Gleichbehandlungsgebot des Artikels 3 GG - nicht auch in der Bundeswehr, da in anderen europäischen Streitkräften Frauen Bomber fliegen, Schiffe kommandieren und Panzer steuern? In Österreich z.B. waren die Frauen durch Parlamentsbeschluss mit Zweidrittelmehrheit schon seit dem 01.04.98 zum freiwilligen Dienst beim Heer zugelassen. Ihnen stehen alle Karrierewege - und nicht nur der im Medizinal- und Musikchordienst bis hin zur Generalin offen. Warum ist das in der Bundeswehr nicht möglich? So wohl die Argumentation der Klägerin. Aber eine solche Klage kann sich für ihre Geschlechtsgenossinnen als »Danaer-Geschenk« erweisen, denn sie wirft - da wir im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten (noch?) keine Freiwilligen-, sondern eine Wehrpflichtarmee haben - im Erfolgsfalle dann automatisch die Frage nach einer Wehrpflicht für Frauen auf! Für einen Einsatz von Frauen in Kampftruppen musste dann zunächst einmal Art. 12 a GG geändert werden, der bisher in Abs. I S. 1 bestimmte, dass (nur) Männer zum Dienst in u.a. den Streitkräften verpflichtet werden können, und dessen Abs. IV letzter Satz ausdrücklich bezüglich im Verteidigungsfall dienstverpflichteter Frauen bestimmt: „Sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten.“; bisher ein Berufsverbot mit Verfassungsrang! Das VG Hannover verwies die Klage der Tanja Kreil an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zur Entscheidung, weil außer der Verfassung der Bundesrepublik auch europäisches Recht tangiert war. Seit 1999 ist dem EuGH außerdem mit dem Vertrag von Amsterdam auch die Zuständigkeit für die Wahrung von Grundrechten in der EU übertragen worden und es waren die Grundrechte aus Art. 3 auf Gleichberechtigung und Art. 12 auf Berufsfreiheit betroffen. Von der militärischen Führung wurde während des beim EuGH laufenden Prozesses wegen des befürchteten Obsiegens der Klägerin ein Kompromiss angedacht, da es sich bei dieser Frau um eine Elektronikerin handelte. Sie könnte ja vielleicht innerhalb der Bundeswehr etwas für die Aufklärung tun, ohne dabei eine Handfeuerwaffe in die Hand nehmen zu müssen. Allerdings gibt es keine Bundeswehreinheiten, in denen Soldaten ohne Waffenausbildung und ohne generellen Waffenbesitz Dienst tun wie in den Baukompanien der DDR, wo - weil es in dem Staat kein Recht auf Wehrdienstverweigerung gab - Waffendienstverweigerer zusammengezogen, diskriminiert und schikaniert worden sind. Selbst Sanitätssoldaten der Bundeswehr tragen z.B. im Manöver eine Waffe (Pistole), an der sie zuvor ausgebildet worden sind, um im Notfall ihre Patienten und/oder sich selbst verteidigen zu können. Plötzlich aber überschlugen sich die männlichen Vorstellungskräfte auf der Harthöhe; und die Zeitungsmeldungen: Auf einmal war es denkbar, dass Frauen mit Waffen im Wachdienst eingesetzt werden könnten. Mit Fortschreiten des Prozesses vor dem EuGH schritt auch der Denkprozess in der Spitze des Bundesministeriums der Verteidigung voran und man dachte immer wieder ein Stückchen weiter: Schon im Zweiten Weltkrieg gab es in der Wehrmacht ja z.B. Pilotinnen wie Beate Uhse. Und die Frau verstand was von »Kampfeinsätzen«! (Damit ist sie später sehr reich und berühmt geworden!) Warum sollten Frauen nicht u.a. auch Kampfjets fliegen dürfen? Anfang des Jahres 2000 entschied dann der EuGH zu Gunsten der Klägerin, die damit Rechtsgeschichte schrieb. Auf der Grundlage der „Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen“ vom 09.02.1976 und insbesondere seines „Art. 2 (1) Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Sinne der nachstehenden Bestimmungen beinhaltet, daß keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechts ... erfolgen darf. (2) Diese Richtlinie steht nicht der Befugnis der Mitgliedstaaten entgegen, solche beruflichen Tätigkeiten und gegebenenfalls die dazu jeweils erforderliche Ausbildung, für die das Geschlecht auf Grund ihrer Art oder der Bedingung ihrer Ausübung eine unabdingbare Voraussetzung darstellt, von ihrem Anwendungsbereich auszuschließen. (3) Diese Richtlinie steht nicht den Vorschriften zum Schutz der Frau, insbesondere bei Schwangerschaft und Mutterschaft, entgegen.“ wurde die Ablehnung der Klägerin als rechtswidrig eingestuft: die deutsche Rechtslage (vor Erlass des Urteils) 143 gleiche einem „Berufsverbot für Frauen“. Das Verfahren wurde vom EuGH an das VG Hannover zurück verwiesen, das nunmehr in seiner Entscheidung die Rechtsüberlegungen aus dem EuGH-Urteil zu berücksichtigen hatte. Der Ausgang des zunächst unterbrochenen Verwaltungsgerichtsverfahrens war damit klar, da die Klägerin nicht begehrt hatte, als Kampfschwimmerin ausgebildet und eingesetzt zu werden. (Der Zugang zu dieser Spezialeinheit mit ihren übergroßen physischen Anforderungen wäre ihr vom EuGH eventuell verwehrt worden, wie vor der Klage der Deutschen eine britische Klägerin vom EuGH ablehnend beschieden worden war.) In den Augen konservativer Kritiker, wie des Vorsitzenden des Bundestagsrechtsausschusses Rupert Scholz (CDU), ist das in der Frage der Wehrberechtigung von Frauen ergangene EuGH-Urteil ein „unglaublicher Skandal“. Die Kritiker des EuGH-Urteils bezüglich des Rechts der Frauen auf Dienst in der Bundeswehr auch mit der Waffe weisen darauf hin, dass die EU, laut BVerfG ein "Staatenverbund neuer Art", für Verteidigungspolitik gar nicht zuständig sei. Die Organisation der Bundeswehr sei eine Aufgabe der nicht abgetretenen nationalen Souveränität der Bundesrepublik wie der anderen EU-Staaten, in die sich der EuGH und das Europarecht nicht einzumischen hätten. Der bayerische Ministerpräsident Stoiber kommentierte die Entscheidung sauertöpfisch: „Demnächst wird die Gleichstellungsrichtlinie erzwingen, dass der nächste Bundeskanzler eine Frau ist.“ [Das hatte Stoiber als gemeinsamer Kanzlerkandidat von CDU und CSU bei der Bundestagswahl 2002 schon im Ansatz verhindert, obwohl Angelika Merkel als seine Mitkonkurrentin um die Kanzlerkandidatur der CDU/CSU in einem SPIEGEL-Interview hatte verlauten lassen, dass die deutsche Gesellschaft nach ihrer Einschätzung „im Grundsatz reif für eine Kanzlerin“ sei.] Nach Stoibers Scheitern bei der Bundestagswahl 2002 und dem Desaster der SPD in der nordrhein-westfälischen Landtagswahl mit der daraufhin um ein Jahr auf 2005 vorgezogenen Bundestagswahl – der angeschossene Keiler Schröder brach aus dem Unterholz und nahm seine Jäger direkt an - hat sie sehr gute Chancen, es zu werden. Die Entscheidung des EuGH in dem ihm vorgelegten Einzelfall hinsichtlich des Rechts der Klägerin auf gleichberechtigten Zugang zum Waffendienst in der Bundeswehr bedingte dann auch eine GG-Änderung, um aus Gründen der Gleichberechtigung nunmehr allen Frauen diesen Zugang zu eröffnen. Der Deutsche Bundestag hat mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen seiner gesetzlichen Mitglieder - und damit auch mit den Stimmen von CDU-Abgeordneten - die grundgesetzliche Sperre des Satzes aus Artikel 12 a GG: „Sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten.“ abgeändert in die Formulierung: „Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.“ Ab 2001 konnten Frauen in (fast?) allen Kampfverbänden freiwillig Dienst an der Waffe verrichten, und es wird durch ein seit 2005 geltendes Gleichstellungsgesetz bis 2010 ein Frauenanteil in allen Laufbahnen der Bundeswehr von rund 15 % angestrebt, der dann in etwa dem Frauenanteil in der US-Armee (14 % 34) entspräche. 2003 waren es bei einer Truppenstärke von rund 280.000 »Mann« aber erst 7.734 Frauen: 4.982 Soldatinnen im Sanitäts- und Musikdienst und 2.752 im normalen Truppendienst inklusive dem Militärgeographischen Informationsdienst. Über kurz oder lang wird mit 20 % Frauen in der Bundeswehr gerechnet. Weil man nicht zum Vergnügen zum Bund geht, hat die Truppe mit dem steigenden Frauenanteil zu kämpfen: Wo Menschen sind, menschelt es – besonders zwischen Männern und Frauen in Kampfeinsätzen! Das kann auch nicht die Anlage zur Zentralen Dienstvorschrift 14/3 unterbinden; nur reglementieren, indem sie eine „sexuell neutrale“ Dienstausführung fordert. Aber gegen das Menscheln helfen keine Erlasse, da ist die Natur stärker. Darum gibt es seit Sommer 2004 einen "Kuschelerlaß", der Sex in der Bundeswehr erlaubt - im gegenseitigen Einvernehmen, in der Freizeit und nur dann, wenn es den Dienstbetrieb nicht be- oder verhindert. Natürlich gibt es "Delikte gegen die sexuelle Freiheit", wie sexuelle Übergriffe bei der Bundeswehr genannt werden, bis hin zum Mord wegen verweigerten Geschlechtsverkehrs oder aus Eifersucht. Warum sollte sich das Zusammenleben zwischen Männern und Frauen in der Bundeswehr problemloser gestalten als außerhalb der Kasernenanlagen im »normalen« Leben?! Die Klägerin gehört aber nicht zu den Frauen an der »Geschlechterfront« der Bundeswehr. Im August 2000 zog sie nach gewonnenem Prozess ihre Bewerbung zurück. Mit der Öffnung der Bundeswehr für Frauen zum Dienst mit der Waffe sind weitere Probleme aufgeworfen: 34 Der Frauenanteil in der Armee der USA liegt seit Jahren recht konstant bei rund 14 %, in der britischen bei etwa 7,5 %, in Dänemark bei rund 4 % und in Frankreich bei etwa 5,5 Prozent. 144 Wenn Frauen nun dienen dürfen, aber nicht dienen müssen, warum sollen dann die Männer dienen müssen? Dagegen klagte ein Wehrpflichtiger aus Göppingen - und das auch vor dem EuGH. Er sah in diesem nur Männern gegenüber ausgeübten Zwang einen Verstoß gegen europäisches Recht, woraufhin das LG Stuttgart diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegte, der die Klage aber abwies. Hätte der EuGH dem Kläger Recht gegeben, hätte die Wehrpflicht abgeschafft werden müssen; insbesondere da die Bundeswehr seit 2002 durch einen erhöhten Anteil freiwilliger Zeit- oder Berufssoldaten so umgebaut wird, dass schätzungsweise nur noch die Hälfte bis ein Viertel der zur Wehrpflicht Anstehenden zwangsweise eingezogen werden wird. Zu diesem Zweck muss der Prozentsatz der angeblich Dienstuntauglichen auf 22 % eines Jahrganges willkürlich heraufgestuft werden. Da stellt sich verschärft die Frage der Wehrgerechtigkeit! Soweit zunächst einmal zu Problemen der in Art. 3 II GG angeordneten Gleichberechtigung von Frau und Mann. Mit den beiden angesprochenen EuGH-Entscheidungen sind zwar die beiden Einzelfälle der kampfbereiten Frau und des sich der Wehrhaftmachung verweigernden Mannes erledigt und sogar so grundsätzlich beantwortet worden, dass es im Sinne der Gleichberechtigung hinsichtlich des Rechts der Frauen zum Dienst mit der Waffe zu den erforderlichen Grundgesetzesänderungen gekommen ist. Nicht aber sind alle damit im Zusammenhang stehenden juristischen Probleme gelöst. Gemeint ist das damit im Zusammenhang stehende gravierende juristische Problem der Verbindlichkeit der EuGH-Rechtsprechung in Grundrechtsfragen unter der Geltung des Grundgesetzes! Mit der Entscheidung des EuGH in den eben behandelten Fällen war das grundsätzliche Problem der Geltung der supranationalen EuGH-Rechtsprechung in Grundrechtsfragen für Bundesbürger juristisch noch nicht in trockenen Tüchern: Wessen Rechtsprechung solle gelten, wenn BVerfG und EuGH zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Wer ist dann Platzhirsch und darf in unserem Staat seine Ansichten in der Bevölkerung mit seinen Ergüssen fortpflanzen - und wer muss das Revier räumen? Bis 1986 lernten die Juristen in ihrer Ausbildung, dass entsprechend der Regelung in Art. 25 GG „Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.“ europäisches Gemeinschaftsrecht (nur) einfaches bundesrepublikanisches Gesetzesrecht breche, nicht aber das höherrangige bundesdeutsche Verfassungsrecht. Die diesbezüglichen Urteile des EuGH seien innerhalb der EU für den nationalen Gesetzgeber der Bundesrepublik und alle seine Gerichte unterhalb der Schwelle der Verfassung bindend. Nicht ausdrücklich, sondern nur implizit, war damit gesagt worden: Da der EuGH nur über Recht entscheiden könne, dass sich in der Rangordnung der Gesetze unterhalb der Ebene des Verfassungsrechts befindet, gehe im Zweifelsfall die die Vereinbarkeit von Gesetzen mit dem Grundgesetz kontrollierende Rechtsprechung des BVerfGs vor und damit habe in Fragen einer möglichen Grundrechtsproblematik die Rechtsprechung des BVerfGs Vorrang vor der EuGH-Rechtsprechung. Das hatte das BVerfG 1974 - mit Geltung bis 1986 - u.a. deswegen so entschieden, weil es in seiner juristischen Nachprüfung zu dem Ergebnis gekommen war, dass 1974 der Integrationsprozess der Gemeinschaft in tatsächlicher Hinsicht noch nicht so weit fortgeschritten gewesen sei, „... daß das Gemeinschaftsrecht auch einen von einem Parlament beschlossenen und in Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten enthalte, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat sei.“ 1986 sah das BVerfG durch die inzwischen ergangene EuGH-Rechtsprechung einen grundsätzlich qualitativ gleichwertigen Grundrechtsschutz gewährleistet und entschied darum in seiner (später abkürzend so genannten) „Solange-II-Entscheidung“: Weil „im Hoheitsbereich der EG mittlerweile ein Maß an Grundrechtsschutz erwachsen sei, das nach Konzeption, Inhalt und Wirkungsweise dem Grundrechtsstandard des Grundgesetzes im Wesentlichen gleich zu achten sei“, sei nunmehr der EuGH auch für den Grundrechtsschutz der Bundesbürger zuständig, der sich aus dem sekundären Gemeinschaftsrecht ergebe, „solange“ sich der EuGH an die vom BVerfG in der Entscheidung BVerfGE 73/339 ff (378-381) gemachten Vorgaben halte. [Dahinter stand wieder die „Machtfrage“: Wir Bundesverfassungsrichter räumen euch EuGH-Richtern (nur) solange Entscheidungskompetenz ein, wie wir unseren Primat als Wächter der bundesrepublikanischen Grundrechte nicht durch euch als gefährdet ansehen! Das Grundgesetz verzichte nicht auf „die im letzten Wort der deutschen Verfassung liegende Souveränität“. Auch wenn Rahmenbeschlüsse, EU-Richtlinien und Brüsseler Weisungen schon über die Hälfte unserer Gesetzesvorhaben ausmachen, so gelte trotzdem der Souveränitätsvorbehalt, dass trotzdem das „letzte Wort“ in den Bestimmungen des Grundgesetzes liegen müsse – und damit bei den Karlsruher Verfassungsrichtern!] Der 145 EuGH sei unter den in der Entscheidung genannten Voraussetzungen somit „auch für den Grundrechtsschutz der Bürger der Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Akten der nationalen (deutschen) öffentlichen Gewalt, die auf Grund von sekundärem Gemeinschaftsrecht ergehen, zuständig.“ Vorlagen an das BVerfG zur Überprüfung solchen Rechts seien danach unzulässig, solange die das BVerfG anrufenden Gerichte nicht fundiert im Einzelnen darlegten, dass die europäische Rechtsentwicklung einschließlich der Rechtsprechung des EuGH generell unter den Grundrechtsstandard abgesunken sei, den das GG für die im Hoheitsbereich der Bundesrepublik lebenden Menschen festgelegt hat. Erst dann und nur dann werde das BVerfG im Rahmen seiner weiterhin fortbestehenden, aber nicht mehr ausgeübten Grundrechtsgerichtsbarkeit wieder tätig werden, wenn der EuGH den vom BVerfG vorgezeichneten Grundrechtsstandard verlassen sollte, den der zuständige Senat in seiner Entscheidung festgelegt habe. Insoweit gelte ein Souveränitätsvorbehalt des BVerfGs gegenüber der EuGH-Rechtsprechung – den der natürlich nicht so zu sehen vermag! Das BVerfG hielt sich in dem Rechtsstreit um die Bananenmarktordnung (BVerfGE 89/155) an diese von ihm vorgezeichnete Linie, obwohl die Fruchtimport-Firmen nach einer Abfuhr beim EuGH beim BVerfG eine Verletzung ihres Grundrechts auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb geltend machten. Seit 1999 ist dem EuGH außerdem mit dem Vertrag von Amsterdam u.a die Zuständigkeit für die Wahrung von Grundrechten in der EU übertragen worden. Das BVerfG beansprucht in Grundrechtsfragen der Deutschen aber gleichwohl grundsätzlich immer noch das Recht des „letzten Wortes“. Der latent schwelende Konflikt brach auf, als nach der Änderung des Art. 16 II GG mit seinem bis dahin geltenden Wortlaut „Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden.“ durch einen angefügten Satz 2 Art. 16 II GG seit dem 02.12.00 nunmehr lautet: „Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.“ Bis Ende 2000 bestand, wie gesagt, ein absolutes Auslieferungsverbot: Bis dahin durfte kein Deutscher unter keinen Umständen an einen fremden Staat ausgeliefert werden, wobei man unter Auslieferung die zwangsweise Überführung in den Hoheitsbereich eines fremden Staates auf dessen Ersuchen hin zur dortigen Strafverfolgung versteht. War z.B. ein Deutscher verdächtig, im Ausland eine Straftat begangen zu haben, und der jeweilige Staat hatte einen Auslieferungsantrag gestellt, so konnte die beantragte Auslieferung unter Verweis auf Art. 102 GG als absolutes Auslieferungshemmnis dennoch in keinem Fall stattfinden. Durch Art. 16 II 2 GG wurde eine partielle Auslieferungsverpflichtung zur Strafverfolgung eines Deutschen durch einen anderen Staat eingeführt, derzufolge nunmehr nur noch ein eingeschränktes Auslieferungsverbot an andere Staaten besteht. Nach der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag am 17.07.98, der für die Verfolgung der vier Verbrechen a) Völkermord, b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit, c) Kriegsverbrechen und d) das Verbrechen der Führung eines Angriffskrieges zuständig ist, wenn entweder der Staat, in dem die Tat begangen wurde, oder der Staat, dessen Angehöriger der mutmaßliche Täter ist, Vertragspartei des internationalen Gerichtsstatuts sind, wurde der bisher absolute Schutz der Deutschen dergestalt eingeschränkt, dass sie an den Internationalen Gerichtshof ausgeliefert werden (können). Im Zuge der dafür erforderlichen Grundgesetzänderung wurde auch eine EU-Richtlinie umgesetzt, dass Deutsche ebenfalls an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeliefert werden dürfen, „… soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.“ Durch Art. 16 II 2 GG wurde somit bei Vorliegen eines europäischen Haftbefehls eine partielle Auslieferungsverpflichtung zur Strafverfolgung eines Deutschen durch einen anderen Staat oder ein internationales Gericht eingeführt, derzufolge nunmehr nur noch ein eingeschränktes Auslieferungsverbot an andere Staaten besteht. Der EU-Haftbefehl listet 32 Straftaten auf, bei denen die Mitgliedstaaten "ohne Überprüfung des Vorliegens beiderseitiger Strafbarkeit" ihre Bürger ausliefern. Darunter fallen Terrorismus, Waffen- und Drogenhandel, vorsätzliche Tötung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, aber auch unklare Begriffe wie Betrug, Cyberkriminalität oder Sabotage. Für viele Europa- und Verfassungs- und Strafrechtler ist der europäische Haftbefehl mit der deutschen Verfassung nicht vereinbar, weil er ehernen Rechtsgrundsätzen widerspreche, insbesondere dem fundamentalen Rechtssatz: „Keine Strafe ohne Gesetz“ („nulla poena sine lege“), gegen den während der Nazi-Diktatur so eklatant verstoßen worden war. 146 Die neue Gesetzeslage sollte zum ersten Mal 2004 einem des Terrorismus verdächtigten ehemals syrischen Staatsbürger gegenüber angewandt werden, der 1990 eine Deutsche geheiratet hatte und sich dann auf Grund seiner anschließend irgendwann erfolgten Einbürgerung hier als nunmehr deutscher Staatsbürger vor Auslieferung sicher fühlen konnte. Der nunmehr deutsche Staatsbürger syrischer Herkunft stand im Verdacht, die Terrorpiloten des 11.09.01 unterstützt zu haben, konnte aber nicht an die USA ausgeliefert werden, weil er erstens Deutscher war und zweitens in den USA in 38 Staaten immer noch die Todesstrafe verhängt werden kann. Da die Todesstrafe gemäß Art. 102 GG in Deutschland abgeschafft ist, darf niemand, auch kein Ausländer, von Deutschland an einen Staat ausgeliefert werden, wenn ihm dort die Todesstrafe droht. Eine Auslieferung eines Ausländers war nur dann möglich, wenn der Staat, der die Auslieferung beantragte, zuvor schriftlich versichert hatte, auf die Verhängung der Todesstrafe zu verzichten. Deutsche konnten wegen des in Art. 16 II (a.F.) GG geregelten absoluten Auslieferungsverbotes sowieso nicht ausgeliefert werden. Der eingedeutschte Syrer Darkazanli wurde über die Unterstützung der Terrorpiloten von New York hinaus von Spanien verdächtigt, die Madrider U-Bahn-Terroristen vom 15.03.04 finanziert zu haben. Er galt als Schlüsselfigur von Al Queida in Spanien, Frankreich und der BRD. Als Spanien wegen des Anschlags auf die Madrider U-Bahnen auf Grund der auch von Deutschland umgesetzten EU-Richtlinie mittels eines europäischen Haftbefehls seine Auslieferung beantragte, wurde dem Ersuchen der Auslieferung eines Deutschen zur Strafverfolgung im Ausland durch den I. Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg am 23.11.04 zum ersten Male stattgegeben. Das Hanseatische OLG begründete die von ihm so gesehene Rechtmäßigkeit der Auslieferung in seinem Beschluss mit u.a. den ziemlich apodiktisch vorgetragenen Argumenten: „Da keine Auslieferungshindernisse bestehen, ist dem zulässigen Ersuchen nach § 79 I RG stattzugeben. Die beiderseitige Strafbarkeit im ersuchenden und im ersuchten Staat ist nach § 81 Abs. I Nr. 4 IRG nicht zu prüfen, wenn - wie hier - die dem Ersuchen zugrundeliegende Tat nach dem Recht des ersuchenden Staates eine Strafbestimmung verletzt (vorliegend: Art. 515.2 und 516.2 des spanischen StGB), die den in Art. 2 Abc. 2 des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug genommenen Deliktsgruppen (hier: Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Terrorismus) zugehörig ist. Auf eine Strafbarkeit des Verfolgten nach deutschem Recht kommt es danach nicht an.... Die Auffassung des Beistands, die Vollstreckung einer in Spanien gegen den Verfolgten verhängten Freiheitsstrafe in Deutschland verstoße gegen den ordre public, beruht ausschließlich auf der vom Senat nicht geteilten Prämisse, dass schon die Auslieferung unzulässig sei, weil hier ein deutscher Staatsangehöriger wegen ausschließlich in Deutschland begangener Handlungen, die zur Tatzeit im Inland nicht strafbar waren, nach Spanien überstellt werden soll. Das aber ist hier nicht der Fall. Nach dem im Haftbefehl geschilderten Sachverhalt, dessen Grundlage zu überprüfen der Senat keinen Anlaß hat (§ 10 Abs. 2 IRG), soll der Verfolgte die terroristische Vereinigung u.a. auch im Kosovo unterstützt und zum Zwecke der Förderdung dieser Organisation bei seinen Aufenthalten (u.a.) in Madrid und Granada persönlich Verbindung zu Mitgliedern der Al Qaida-Zelle in Spanien gehalten haben. Soweit der Verfolgte einwendet, daß die Straflosigkeit seines Verhaltens in Deutschland zur Tatzeit wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit dazu führe, daß er vor Strafverfolgung sicher sei, solange er nur die Bundesrepublik Deutschland nicht verlasse, trifft dies in dieser Allgemeinheit nicht zu. Vielmehr kann ein Deutscher auch dann an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeliefert werden, wenn er - wie hier - (auch) außerhalb Deutschlands eine Straftat begangen haben soll und sich dadurch nach dem Recht des ersuchenden Staates strafbar gemacht hat. ... Denn es trifft - wie bereits ausgeführt - nicht zu. daß der Verfolgte als Deutscher wegen einer Tat, die ausschließlich auf deutschem Hoheitsgebiet verübt wurde und die nach deutschem Recht zur Tatzeit nicht strafbar war, ausgeliefert werden soll (vgl. S. 4 Abs. I des Schriftsatzes). Vielmehr soll er seine nach spanischem Recht strafbaren Aktivitäten zur Förderung der terroristischen Vereinigung auch in Spanien und im Kosovo entfaltet haben. Das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG wird durch die Auslieferung - entgegen den Ausführungen unter II. 1. im Schriftsatz der Rechtsanwältin Pinar vom 31. Oktober 2004 - nicht verletzt. Auslieferungsrecht ist Verfahrensrecht, in dem das im materiellen Strafrecht geltende Rückwirkungsverbot grundsätzlich keine Anwendung findet (OLG Stuttgart in NJW 2004, 3437, 3438). Der Verfolgte soll zudem nicht von einem deutschen Gericht wegen einer Tat, deren Strafbarkeit vor ihrer Begehung nicht gesetzlich bestimmt 147 war, bestraft werden. Vielmehr soll er an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union überstellt werden, gegen dessen Strafnormen er im Ausland zu einem Zeitpunkt verstoßen haben soll, als die Tat dort nach dem Recht des ersuchenden Staates strafbar war. Insoweit widerspräche die Auslieferung nicht wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung, die eine solche Rechtshilfe nach § 73 IRG unzulässig machte. ... Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Verfolgten gegen die Neuregelung des Auslieferungsrechts teilt der Senat aus den Gründen seines Beschlusses vom 5. November 2004, an denen er nach nochmaliger Überprüfung festhält, nicht.“ Das sah das BVerfG aber wesentlich kritischer und stoppte die Auslieferung auf Antrag der Anwälte des Beschuldigten im Eilverfahren für zunächst ein halbes Jahr bis zur Behandlung der eingereichten Verfassungsbeschwerde. Der Zweite Senat des BVerfGs plante – Az.: 2. BvR 2236/04 –, nicht nur die justizielle Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer, sondern ganz Europa zur Disposition zu stellen. Für die damit befassten Verfassungsrichter stellt sich neben dem Problem des europäischen Haftbefehls die Grundsatzfrage der demokratischen Legitimation der EU. Die höchsten deutschen Richter befassen sich ganz grundsätzlich mit der Frage, inwieweit nationalstaatliche Kernkompetenzen auf die EU-Ebene verlagert werden können. Die Themen "Schrittweise Entstaatlichung durch Übertragung von Kernkompetenzen" und "Identität des deutschen Verfassungsstaates und sekundäres Unionsrecht" sind auf der Verhandlungsgliederung des BVerfGs ausdrücklich genannt. Es geht u.a. darum, ob europäisches Recht, das von den EU-Regierungen verabschiedet wird, ohne die Möglichkeit der Änderung durch die deutschen Verfassungsorgane in deutsches Recht umgesetzt wird. So geschieht es bei beispielsweise EU-Richtlinien. Es geht um die in ihren Auswirkungen gravierende juristische Frage, ob die EU-weite Zusammenarbeit an der „dritten Säule“ Justiz und Inneres schrittweise zu einem europäischen Superstaat geführt habe, ohne dass die nationalen Parlamente so etwas beschlossen haben, sodass durch den schleichenden Entstaatlichungsprozess insoweit ein Verstoß gegen das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip vorliege: Sind durch den Umfang der schleichend übertragenen Aufgaben und Befugnisse auf die Zentralbehörde in Brüssel, durch die Einräumung von Kompetenz-Kompetenzen auf die EU, die Kontroll- und Entscheidungszuständigkeiten des Deutschen Bundestages so weit ausgehöhlt worden, dass ein Verstoß gegen das über Art. 79 III GG mit einer „Ewigkeitsgarantie“ versehene, aus Art. 20 I 1 GG – „Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ - abgeleitete Demokratieprinzip vorliegt? Rechtsstaats- und Demokratieprinzip des GG verpflichten den Bundesgesetzgeber, wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen und nicht der jeweiligen Verwaltung - sei es der der Länder, des Bundes oder der EU – zu überlassen. Insoweit bestehe ein unbedingt zu beachtender Parlamentsvorbehalt! Ist möglicherweise durch eine schleichende schrittweise europafreundliche Aufweichung des Grundgesetzes dagegen verstoßen worden, sodass wir uns nach dem Willen der »Richterkönige« aus Karlsruhe in weiten Teilen aus der EU verabschieden müssten, wie es der Bundesjustizministerin schwant? Hauptargument: Der Vertrag übertrage der EU zuviel Kompetenz, Europa werde zum Staat. Soviel Macht dürfe der Bundestag nicht abgeben. Darüber müsse das Volk abstimmen. Den Richtern des Bundesverfassungsgerichts stieß aktuell insbesondere sauer auf, dass seit August 04 Deutschland auf Anforderung anderer Mitgliedstaaten eigene Staatsbürger wegen Taten ausliefern muss, die in der Bundesrepublik gar nicht strafbar waren oder strafbar sind. Damit wird gegen das Grundgesetz verstoßen und die Garantiefunktion unseres Strafrechts unterlaufen, die u.a. besagt, dass ein Deutscher nur dann bestraft werden kann, wenn sein Verhalten unter einer deutschen Strafnorm subsumiert werden kann: Verhalten, das keiner deutschen Strafnorm unterfällt, hat damit straffrei zu bleiben! Der Syrer mit inzwischen deutschem Pass soll in Spanien wegen der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung angeklagt werden, eine in Spanien verfolgte Straftat, die bei uns in dem Zeitraum, der von dem spanischen Richter verfolgt wird, aber gegen keine bundesdeutsche Strafnorm verstieß! „Besonders problematisch erscheint solche Rechtshilfe, wenn es um Dinge geht, die der Verdächtige gar nicht in dem Land getan hat, in das er ausgeliefert werden soll. Wenn es möglich ist, so die Verteidiger Darkazanlis, dass ein Deutscher wegen einer in Deutschland begangenen und in Deutschland rechtmäßigen Handlung ohne weitere Prüfung in die Fremde ausgeliefert wird, um dort bestraft zu werden, verliere das Strafrecht seinen Sinn. Denn kein Bürger könne wissen, ob das, was er guten Gewissens tut, nicht irgendwo in einem der 25 EU-Mitgliedsländer strafbar ist. Auch Strafrechtswissenschaftler wie der Münchner Ordinarius Bernd Schünemann kritisieren, dass das ’Prinzip der gegenseitigen Anerkennung’, das dem Europäischen Haftbefehl zugrunde liegt, zu ’einer europaweiten Exekutierbarkeit’ der jeweils schärfsten Strafrechtsnorm führt. Noch gibt es eklatante Unterschiede. So ist beispielsweise das Verwenden einer manipulierten Fotokopie in Deutschland keine Urkundenfälschung, in Großbritannien schon. Und wir hatten zuvor schon das Beispiel des Bundesverfassungsrichters da Fabio anlässlich der Verhandlung um den europäischen Haftbefehl gehört, dass es in den Niederlanden als vollendete Vergewaltigung gelte, wenn ein Mann einer Frau im Karneval einen Zungenkuss aufnötige. ... 148 Die Verfolgung der sogenannten Auschwitz-Lüge, des Leugnens des Holocaust, ist eine deutsche Spezialität. Gerade in heikelsten Fragen der Moral und der nationalen Kultur verbietet sich das Barbieren über den europäischen Löffel: Sterbehilfe gilt in manchen Ländern als Totschlag, in anderen ist es Mildtätigkeit. Abtreibung ist in Teilen Europas ein Tötungsdelikt, in anderen nicht. ’Die Vorstellung, dass die Niederlande künftig ihre Abtreibungsärzte nach Madrid ausliefern würden, hat etwas Beängstigendes’ wendet der DarkazanliAnwalt ein. ... Nicht nur Strafrechtler sehen die staatliche Hoheit bei der Entscheidung über Gut und Böse, Schuld und Strafe, über Freiheit und Eigentum der Bürger als Kernbestand nationaler Souveränität. Wenn ein Staat seine Bürger nicht mehr vor der Verfolgung durch andere Mächte bewahrt, hat die Staatsbürgerschaft ihre zentrale Funktion verloren: als steuerpflichtige Mitgliedschaft in einer schutzgewährenden Vereinigung. Die klassische Staatsidee des durch seine pure Macht die schwachen Menschen schützenden Leviathan ist dann ebenso wenig aufrechtzuerhalten wie das daraus sich rechtfertigende staatliche Gewaltmonopol“ (SPIEGEL 14.03.05). Die Position der Bundesregierung lautet: Der europäische Haftbefehl beruhe auf zwingendem weil vorrangigem europäischen Recht und könne deswegen vom BVerfG nicht überprüft werden. Angesichts des Standes der europäischen Integration sei der Haftbefehl "nicht am Maßstab des deutschen Grundgesetzes zu prüfen". Es gebe keinen nationalen Verfassungsvorbehalt. Das aber sehen die Bundesverfassungsrichter möglicherweise völlig anders! Wir haben schon gehört, dass das BVerfG sich nur solange zurückzunehmen gewillt gewesen war, wie die europäische Rechtsentwicklung einschließlich der Rechtsprechung des EuGH nicht unter den Grundrechtsstandard absinke, den das GG für die im Hoheitsbereich der Bundesrepublik lebenden Menschen festgelegt hat. EU-Recht gelte nur, "solange" die deutschen Grundrechte gewahrt bleiben. Sollte das nicht mehr der Fall sein, und nur dann, werde das BVerfG im Rahmen seiner von ihm so gesehenen weiterhin fortbestehenden, aber nicht mehr ausgeübten Grundrechtsgerichtsbarkeit wieder tätig werden, wenn der EuGH den vom BVerfG vorgezeichneten Grundrechtsstandard verlassen sollte, den der zuständige Senat in seiner Entscheidung festgelegt habe. Mit dem Fall Darkazanli sahen die Richter des BVerfGs den Rubikon als möglicherweise überschritten an. „Die Europäische Union wurde zum Binnenmarkt. Doch zu einem Raum des Rechts wurde Europa nicht. Als EU-Richtlinien gegen Grundrechte verstießen, begann der Dauerclinch zwischen den Verfassungsrichtern aus Karlsruhe und ihren EU-Kollegen in Luxemburg. Erst 1986 urteilten dann die Deutschen: Solange die EU und ihre Gerichte die Grundrechte generell wahren, verzichte Karlsruhe auf das letzte Wort. Doch die europäische Integration erschloß sich immer neue Bereiche. Das Maastricht-Urteil ist durchwoben vom Unbehagen gegen einen Überstaat Europa. Beim Strafrecht, also jenem Rechtsgebiet, das die Freiheit der Bürger am weitesten beschneidet, könnte die Zeit des Zuschauens nun wieder vorbei sein. Vor allem der Strafrechtler im Zweiten Senat, Vizepräsident Hassemer, hat im Vorfeld bereits deutlich gemacht: Eine gerichtliche Vergewisserung sei notwendig, "wo die unverzichtbaren Bestandteile der nationalen Rechtsordnungen liegen". Der Europäische Haftbefehl zum Beispiel höhlt gleich mehrere rechtsstaatliche Grundsätze aus. "Keine Strafe ohne Gesetz" etwa, diese alte Säule des Strafrechts wird brüchig, wie gerade der Fall Darkazanli zeigt. Die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung war in den Jahren, die in seinem Fall eine Rolle spielen, in Deutschland noch nicht strafbar. Jedoch ist "Terrorismus" im Auslieferungskatalog des EU-Rahmenbeschlusses zum Haftbefehl genannt, wie andere schwammige Begriffe, die eher gesellschaftliche Phänomene als klare Straftatbestände beschreiben. Ohnehin sind die gemeinsam nach Straftätern jagenden Europäer oft uneins, was ihnen denn als strafwürdig erscheint. So kann in Deutschland als Betrug gelten, was in anderen Ländern als cleveres Geschäftemachen durchgeht. Sterbehilfe wird in Holland als mildtätig gewertet, andernorts aber als Totschlag. Kiffen ist in Amsterdam erlaubt, Cannabisbesitz in München verboten. ... (DIE WELT 10.04.05) 1.3.2.2.8 Beispiele für den Kampf um Gleichberechtigung in einigen anderen Ländern Frauen-Diskriminierungsverbote gibt es - auch ohne Grundgesetz - ebenfalls in anderen Staaten. Trotzdem werden Frauen immer wieder diskriminiert. Und nicht immer helfen dann die Gerichte wie im nachfolgenden Fall: 149 "Benachteiligt: Frau erhält zehn Millionen dpa Los Angeles - Ein ungewöhnliches Urteil fällte ein Gericht in Los Angeles: Der USMineralölkonzern Texaco muß einer Angestellten zehn Millionen Mark Schadenersatz zahlen. Das ist die höchste Summe, die jemals in einem Diskriminierungsprozess zugesprochen wurde. Janella Martin (48) hatte geklagt, weil sie zweimal wegen ihres Geschlechts bei einer Beförderung übergangen worden war." (HH A 27.09.91) Beispiele für den Kampf um Gleichbe rechtigu ng in einigen anderen Ländern Da lacht das Herz des us-amerikanischen Anwalts, denn im Gegensatz zu unserem Rechtssystem erhalten in den USA Rechtsanwälte üblicherweise ein Drittel der ausgeurteilten Summe, was im Falle der Verurteilung von Tabakwarenkonzernen wegen verharmlosender, bewusst falscher, die Gefahren des Rauchens negierender35, verführender Werbung zu Anwaltshonoraren von bis zu 5 Milliarden(!) Dollar geführt hatte und von einem Teil selbst der US-amerikanischen Öffentlichkeit nicht mehr hingenommen wurde. Die hauptsächlich mit amerikanischen Rechtsanwälten geführten Verhandlungen wegen der Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern zogen sich zuletzt u.a. auch wegen dieser von deutscher Seite befürchteten „Gebührenschneiderei“ in die Länge. Nur durch solche schmerzenden Urteile lernen Machos die Grundprinzipien der Gleichberechtigung - oder das geschicktere Abfassen von Ablehnungen. Eine uns eher zum Schmunzeln reizende, aber auf einem für konservativ eingestellte Japaner sehr ernsten weil religiösen Hintergrund basierende Meldung zu dem Problemkreis der noch längst nicht überall durchgesetzten Gleichberechtigung der Geschlechter: "Mädchen im Sumo-Ring Fall für Regierung Tokio (dpa). Die Siegesserie einer zehnjährigen japanischen Schülerin als Sumo-Ringerin hat jetzt die Regierung in Tokio auf den Plan gerufen. Nach japanischen Presseberichten vom Samstag läßt das Büro von Premierminister Toshiki Kaifu untersuchen, ob der Ausschluß des Mädchens von einem nationalen Nachwuchsturnier eine unzulässige Diskriminierung ist. Sumo-Ringen ist ein uraltes japanisches Ritual, das bislang allein von Männern betrieben wurde. Die Kämpfer, die ein Gewicht von bis zu 150 Kilogramm erreichen, versuchen, sich gegenseitig aus dem Ring zu stoßen oder sich gegenseitig zu Fall zu bringen. Die Frauenbeauftragte der Regierung, Mitsuko Horiuchi, will klären, ob der kleinen Ringerin der Auftritt im Kokugikan-Sumo-Stadion von Tokio aus religiösen Gründen verwehrt wird oder ob es um eine Benachteiligung der Frau geht." (Allgäuer Zeitung 15.07.91) Noch eine Anmerkung zum Sumo-Ringen: "’Der Klops aus Hawaii’. Weil der amerikanische Sumo-Ringer Salevaa Atisanoe mit 262 Kilo Kampfgewicht seine Gegner serienweise niederwalzt und nach dem Titel eines ’yokozuna’ (Großmeisters) strebt, wofür in einer Zweierserie je zwanzig Siege in Folge erforderlich sind, tobt in Japan ein Kulturkampf. Die Traditionalisten wollen ihn laut einiger Drohbriefe am liebsten ’zu Sushi schneiden’ denn mit ihm ist ein ’Keto’, ’ein ausländischer Teufel’ - schlimmer noch: ein amerikanischer - in das Zentrum der japanischen Seele getrampelt. Die ’Yuppies’ dagegen, die ohnehin amerikanischen Moden hinterherlaufen, unterstützen den Ami-Eindringling. An sich hatte ’Konishiki’ (’Kleiner Brokat’), wie sich der Amerikaner in Japan nennt, sein Ziel eigentlich schon erreicht, als er bei seinem letzten Kampf nach 39 Siegen auch dieses Mal seinen Gegner umwarf. Doch der Schiedsrichter, gekleidet wie ein Shinto-Priester, machte aus Konishikis Sieg ein Unentschieden, damit die ausländische Bulette nicht sozusagen Burger King wird. Schließlich erwartet ihn als Großmeister eine besondere traditionelle Ehre: Die jüngeren Sumo-Ringer müssen ihm als Yokozuna nach jedem Stuhlgang den Hintern abwischen.“ (STERN 21.05.92) Letzteres Beispiel für ein durch Leistung erworbenes ehemals anerkanntes Recht, das sich auf Grund 35 Die Zigarettenindustrie hatte jahrelang dem Tabak heimlich suchtsteigernde (u.a. Aceton) und letztlich krebsauslösende Stoffe (zur Versüßung des Rauches hinzugegebener Zucker und hinzugegebene Schokolade verbrennen unter Freisetzung von u.a. krebsauslösendem Acetaldehyd) beigemischt und diese sucht- und krankheitsverursachenden Praktiken vehement bestritten. 150 seines nicht mehr zeitgemäßen, antiquierten Ursprungs heutzutage in ein Vor-Recht verwandelt hat, hinter dem die Mühsal steht, wenn man sich so viele siegnotwendige Kilo angefressen hat, zum Abputzen um den unförmig gewordenen Leib rumlangen zu müssen: Der Leib wird dicker, die Arme wachsen aber nicht mit. Da kann man bei fünf Zentnern schlecht rumfassen. Aber man muss ja nicht jedes Vorrecht ausnutzen. Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang das kluge Wort von Marie von Ebner-Eschenbach: „Der größte Feind des Rechts ist das Vorrecht.“ Vielleicht hängt dieses Recht, das der Zeitungsmeldung zu Folge noch nicht als antiquiertes Vorrecht empfunden wird, auch mit dem mythisch-religiösen Ursprung des Sumo-Ringens zusammen: Zwei Götter, die sich um das japanische Volk stritten, fochten ihren jeweils erhobenen Anspruch in einem Sumo-Ringkampf aus. Wegen dieses mythischen Ursprungs dieses Sports, der auch heutzutage noch von den traditionsbewussten Japanern als religiöser Ursprung empfunden wird, wollte die damalige Frauenbeauftragte der Regierung klären, ob der kleinen Ringerin der Auftritt im Kokugikan-SumoStadion von Tokio aus religiösen Gründen verwehrt wird oder ob es um eine Benachteiligung der Frau gehe. Wegen dieses mythischen Ursprungs ihres Sports - und seiner wenigen sehr einfachen, klaren Regeln - ist das Sumo-Ringen noch heute so populär in Japan. Und die Funktionäre des Sumo-Verbandes sind so traditionsverhaftet, dass sie der Bürgermeisterin einer japanischen Millionenstadt nicht erlaubten, den Ring zu betreten und dort dem Sieger den Pokal zu überreichen, weil sie eine Frau ist! Und noch eine Anmerkung zu dem sehr fülligen Ringer: Er wird es als Wiedergutmachung für alles in Japan vormals erlittenes Wettkampf-Unrecht empfunden haben, dass - nach seiner einige Zeit zuvor vollzogenen Einbürgerung - er es als nunmehriger Großmeister Akebond (in Vertretung für einen erkrankten japanisch gebürtigen Großmeister) sein durfte, dem die ganze Welt zur Eröffnung der letzten Winter-Olympiade in Japan als schwerstgewichtigem Sumo-Ringer im Eröffnungsprogramm bei den rituellen Bewegungen der Reinigungszeremonie der Sumo-Ringer zuschauen durfte. Nun kämpft er als Yokozuna (Großmeister) Musashimaru. Nach dem Fall der japanischen Ringerin nun ein Beispiel für das andere Extrem im Geschlechterkampf: Unsinnig fortschrittlich in puncto Gleichberechtigung scheinen manche Australier zu sein, denn "Mann wurde ‘Miß' ap Sydney - Der 24jährige Surfer Damien Taylor wurde in Queensland zur `Miß Wintersonne' gekürt. Neben Aussehen zählten Persönlichkeit und Allgemeinwissen. Nun will der Kämpfer für die Gleichberechtigung (1,82 Meter, 77-66-88) den Titel `Miß Australia' gewinnen." (HH A 17.06.93) Ob da unter den Juroren ungewöhnlicherweise nur Damen saßen? Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet, wesentlich Gleiches gleich, aber wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich zu behandeln. Und es gibt nun einmal den kleinen Unterschied! Da scheint in dem vorstehenden Fall eine sachfremde Nivellierung vorgenommen worden zu sein: Wozu gibt es neben den jährlichen Wahlen der schönsten Frau der Welt die Wahl zum Mister Universum? Man lässt bei olympischen Wettkämpfen ja auch nicht Damen gegen Herren starten, denn das wäre genau so missverstandene Gleichberechtigung. Es gibt, wie gesagt, nun einmal den kleinen Unterschied – auch wenn manche Frauen ihn nicht gelten lassen wollen: „Frauen auf die Pissoirs! Der norwegische Ombudsmann für Gleichberechtigung hat die Klage einer Frau gegen die Gebühren für die Toilettenbenutzung abgewiesen. Die Zeitung "Dagbladet" berichtete am Dienstag, eine Studentin habe geklagt, dass sie für die Benutzung der Toilette im Zentrum von Trondheim 65 Cent zahlen muss, Männer aber umsonst ans Pinkelbecken treten dürften. Frauen und Männer können gleichermaßen wählen Die Antwort verblüffte nicht nur die Klägerin: Der Hersteller der Unisex-Toilette stellte klar, dass auch Frauen die Urinale benutzen dürften. Dazu müssten sie nur in die Hocke gehen. Es gebe in der Stadt Trondheim nachweislich Frauen, die das auch täten. Der Klageausschuss beim Ombudsmann zusammengesetzt aus vier Frauen und zwei Männer - wies daher die Eingabe der Studentin ab: ’Frauen und Männer können gleichermaßen wählen, ob sie für ihren Toilettenbesuch zahlen wollen 151 oder nicht.’" mdr.de boulevard 29.04.2003 14:02 Uhr 1.3.3 Art. 3 III GG und Asylrecht Art. 3 III GG und Asylrech t Weil dem Staat eine sachfremde Benachteiligung von einzelnen Bevölkerungsgruppen aus einem der in Art. 3 III GG angeführten Verbotsgründe untersagt ist, konnte keine Regierung der (ehemaligen Rumpf-)Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung unter der vor seiner Neufassung in keiner Weise einschränkend formulierten Geltung des Art. 16 II 2 GG „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." bestimmen, dass nur deutschstämmige Asylanten aus z.B. Osteuropa in unserem Staat aufgenommen werden dürften, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes auf Grund der historischen Erfahrungen der NS-Zeit den Wortlaut des Art. 16 II 2 GG bewusst umfassend weit gefasst hatten und es bis dahin mangels der für eine in diesem Punkte an sich zulässigen Verfassungsänderung nicht zu der hierfür erforderlichen Zweidrittelmehrheit gekommen war. Nach der in dem neuen Artikel 16 a GG vorgenommenen einschränkenden Neuregelung des Asylrechts - des einzigen Grundrechts, das schon begrifflich keinem Deutschen zustehen kann - äußerten Kritiker ihre Meinung dahingehend: "Mit dieser Neuregelung ist das Asylrecht trotz seiner weiterhin bestehenden Nennung in Art. 16 a I GG faktisch abgeschafft, denn Asyl kann jetzt nur noch erhalten, wer mit einem Drachen über die Alpen kommt, mit einem Fallschirm über der Lüneburger Heide abspringt oder schwimmend von seinem Land kommend an der Küste angespült wird." Und die Süddeutsche Zeitung kommentierte: "Der bisherige Artikel 16 Absatz 2 war ein kompromißloses Grundrecht. Der Asylkompromiß nimmt dem Asylgrundrecht nicht nur diese Kompromißlosigkeit, sondern damit auch die Grundrechtsqualität. Wenn beschwichtigend von einer bloßen Beschränkung dieses Grundrechts die Rede ist, so führt dies in die Irre. Andere Grundrechte lassen sich einschränken, ohne daß dieses den Grundrechtscharakter verändert: Wird etwa das Grundrecht auf Freizügigkeit beschränkt, so bleibt das Grundrecht als solches prinzipiell erhalten; Menschenwürde, Freiheit, körperliche Unversehrtheit werden nicht berührt - nur die Bewegungsfreiheit begrenzt. Beim Asylgrundrecht ist dies anders: Wird einem politisch Verfolgten, wie das künftig der Fall sein wird, der Aufenthalt in Deutschland von vornherein verweigert, dann handelt es sich für ihn nicht um eine bloße Beschränkung, sondern um eine Vernichtung seines Asylrechts - mit potentiellen Folgen für Leib und Leben. Das künftige Asylrecht nimmt dies in Kauf. Die großen Parteien sollten dies deutlich sagen: Das Asyl steht künftig nur noch aus Gründen der Tradition im Grundrechtsteil der Verfassung. Es wird zu kleiner Münze geschlagen." (SZ 22.01.93) 1995 hat sowohl die damalige Präsidentin des BVerfGs wie auch die (katholische) Deutsche Bischofskonferenz gegen die Neufassung des Asylrechts Front gemacht. Das hat aber gegen u.a. die Überfremdungsängste rechtskonservativer Kreise und Parteien und die Kassenlage der Bundesländer, die für den Unterhalt der Asylsuchenden aufkommen müssen, nichts ausrichten können. Eine Lockerung der einschränkenden Neuregelung ist erst zu erwarten, wenn sich selbst bis zu den Stammtischen die Erkenntnis herumgesprochen haben wird, dass Deutschland nach Berechnungen der UNO für alle wichtigen Industriestaaten wegen der Vergreisung seiner Bevölkerung und der mit Platz 185 von 191 UN-Staaten zu geringen Geburtenrate in einigen Jahren eine jährliche Quote von rund 500.000 Ausländern als Zuwanderungsgewinn benötigt, um nur den jetzigen Stand seiner uns alle absichernden Sozialsysteme bewahren zu können! Eine von der SPD-geführten Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission unter der Leitung der CDUPolitikerin Süssmuth erarbeitete Vorschläge zur Änderung des Asylrechts. Die auf Grund dieser Vorlage erarbeitete Gesetzesänderung wurde im Bundestag mit rosa-grüner Mehrheit beschlossen und in einem Kraftakt der SPD-geführten Länder auch durch den Bundesrat gepaukt, aber die CDU-geführten Länder kündigten dagegen eine Klage vor dem BVerfG an, falls der Bundespräsident das Gesetz unterschreiben werde. So sollte auf unser höchstes Staatsorgan politischer Druck ausgeübt werden. Der Bundespräsident zögert, prüft jedenfalls 152 (ungewöhnlich) lange und bedächtig, voraussichtlich bis zu dem ein halbes Jahr später anstehenden Wahltermin. Bei einem Wahlsieg der CDU/CSU wird eine neue Regierungskoalition das Gesetz in ihrem Sinne ändern - und die angekündigte Klage hat sich dann durch Zeitablauf erledigt. 1.3.4 »Wesensgehaltssperre« bei Grundrechtseinschränkungen und Asylrecht Bezüglich der die Existenz des Asylrechts sehr stark einschränkenden bis faktisch fast abschaffenden Grundrechtsänderung könnte ein Verstoß gegen die »Wesensgehaltssperre« des Art. 19 II GG „In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt eingeschränkt werden." "Wesensg ehaltssper re" bei GREinschrän kungen vorliegen. Dieser Begriff besagt, dass nach der Interpretation des BVerfGs jedes Grundrecht aus einem seinen Wesensgehalt ausmachenden Kernbereich und einem unterschiedlich weit interpretierbaren Randbereich bestehe. Ein Grundrecht dürfe bei Vorliegen hinreichender Gründe nur in seinen den Kernbereich wie eine Hülle umgebenden Randbereichen eingeschränkt werden. Der Kernbereich hingegen, der seinen Wesensgehalt ausmache, müsse immer unangetastet erhalten bleiben, damit der durch dieses Grundrecht angestrebte Grundrechtsschutz erhalten bleibe und das Grundrecht nicht faktisch leer laufe. Selbst von kollidierenden anderen Grundrechten dürfe ein in Frage stehendes Grundrecht nicht in seinem – im Konfliktfall letztlich vom BVerfG zu interpretierenden und damit für alle unter der Rechtsordnung des GG Lebenden rechtsverbindlich festzulegenden - Wesensgehalt verletzt, sondern nur irgendwo in seinem Randbereich einschränkend tangiert werden: Grundrechtsdelle ja, substanzieller Grundrechtsschaden, Grundrechtstotalschaden gar, nein! „Keine Witze mehr über Lisa Loch Forderung nach Berufsverbot für Raab unerfüllt Die Scherze über die 17-jährige Lisa Loch kommen TV-Star Stefan Raab teuer zu stehen. Er musste wegen Beleidigung eine "stattliche Summe" an eine gemeinnützige Einrichtung in München überweisen. Im Gegenzug sei das Ermittlungsverfahren gegen den Entertainer eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft München I mit. Die genaue Höhe der Summe wollte die Behörde nicht nennen. Raab hatte sich in seiner Sendung "TV total" mehrfach über den Namen der Jugendlichen lustig gemacht hatte. So zeigte er zum Beispiel am 8. Mai ein Plakat, auf dem ein Paar Sex hatte und warb damit für die "Lisa Loch Partei". Oberstaatsanwalt August Stern sagte: "Es war ganz eindeutig eine Beleidigung. Das hat mit Satire nichts mehr zu tun." Raab könne sich auch nicht auf die grundgesetzliche Freiheit der Kunst berufen, da der Schutz der Menschenwürde schwerer wiege. Der Bescheid der Staatsanwaltschaft wurde Raab und seinen Anwälten bereits Mitte Dezember zugestellt. Die Zahlung an die nicht näher benannte gemeinnützige Einrichtung erfolgte am Dienstag. Damit war dann das Erfahren offiziell eingestellt. Oberstaatsanwalt Stern begründete seine Entscheidung mit dem nicht so großen öffentlichen Interesse an einer Strafverfolgung. Der Forderung des Anwaltes der Schülerin, Frank Roeser, Raab ganz vom Bildschirm zu verbannen und mit einem Berufsverbot zu belegen, folgte die Staatsanwaltschaft erwartungsgemäß nicht. Dies hatte nach Aussage von Stern nie Aussicht auf Erfolg. Anwalt Frank Roeser hatte argumentiert, Raab missbrauche seine Stellung als Moderator für Straftaten wie Beleidigung, gefährliche Körperverletzung, Verleumdung und Nötigung.“ (N24.de 10. Januar 2003) Das Strafrechtliche ist aber nur die eine Seite der Medaille. Zivilrechtlich musste Raab nach mehreren Instanzen für seine bekannt geschmacklosen bis beleidigenden und ehrverletzenden Späße auf Kosten anderer in dieser Sache (statt der zunächst geforderten 300.000 € schlussendlich) 70.000 € Schmerzensgeld zahlen. Das Grundrecht der Menschenwürde der Diffamierten aus Art. 1 GG steht gegen die Grundrechte Freiheit der Kunst – wenn man eine Raab-Sendung juristisch so einordnen will – aus Art. 5 III GG und die Berufsfreiheit aus Art. 12 I GG des Satirikers. Letztlich müssen sich Freiheit der Kunst und Berufsfreiheit dem obersten Wert unserer Verfassung, der Menschenwürde, unterordnen. Aber das anwaltlich geforderte Berufsverbot schießt weit über das Ziel des Schutzes der Menschenwürde hinaus. Und das muss ein Anwalt wissen – und trotzdem forderte er es (angeblich). Das ist nur als juristische Schaumschlägerei zu werten, mit der wohl versucht werden sollte, den 153 Richter unter Druck zu setzen. Bezüglich der Einschränkung des Asylrechts durch die neugeschaffene „Drittstaaten-Klausel“, die nach der Grundgesetzänderung die Abschiebung eines Asylsuchenden in das Drittland erlaubt, das er – ohne dort Verfolgung zu erleiden, wenn er dort geblieben wäre - durchquert hat, um auf dem größten Arbeitsmarkt der EU mit einem der höchsten Sozialhilfesätze innerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Überlebens- und neue Existenzgrundlage zu finden, müsste aber erst einmal ein Betroffener vor dem BVerfG gegen die Neufassungsregelung klagen. Doch wie sollte er das vom Ausland aus tun? Kritische Verwaltungsrichter kritisieren außerdem, dass durch die Asylgesetzgebung mit der ohne vorheriges Gerichtsverfahren vorgesehenen Abschiebung der Asylbegehrenden in ein sicheres Drittland, aus dem sie in die Bundesrepublik gekommen sind, der Rechtsschutz der "Rechtsweg-Garantie" des Art. 19 IV 1 GG "Rechtsw egGarantie" des Art. 19 IV 1 GG Art. 19 IV 1 GG „Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen." stillschweigend unterlaufen werde. Wer Art. 19 IV 1 GG ändern wolle, der müsse das auch durch eine Verfassungsänderung expressis verbis deutlich zum Ausdruck bringen. 1995 beschwerte sich die damalige Präsidentin des BVerfGs öffentlich, dass das BVerfG mit Eilanträgen gegen drohende Abschiebungen überschüttet werde und auch an Wochenenden tagen müsse, weil der Verfassungsgesetzgeber den Art. 16 a GG mit zu heißer Nadel genäht habe und die unteren Gerichte den neugeschaffenen Asylrechtsartikel nicht verfassungskonform weit genug auslegten. Das BVerfG verkommt so zur unnötigerweise im großen Stil tätig werden müssenden Reparaturinstanz für falsche unterinstanzliche Entscheidungen einfacher Verwaltungsgerichte. 1.3.5 Auslegung von Grundrechtsbestimmungen am Beispiel von Art. 6 GG Ehe und Familie und Art. 16 GG Asylrecht So, wie zuvor am Beispiel der Gleichberechtigungsproblematik von Frau und Mann aufgezeigt, regelt das GG direkt oder indirekt viele Bereiche der in seinem Geltungsbereich Lebenden. Aber die vom Gesetzgeber getroffenen Regelungen sind oder scheinen nicht immer zweifelsfrei, weder im Grundgesetz, noch in anderen Gesetzen. Dann muss »ausgelegt« werden, um den mutmaßlichen Sinn einer gesetzlichen Regelung und deren zweifelhafte Anwendungsmöglichkeit auf den zu entscheidenden Fall auszuloten. Das soll an zwei Fällen zu dem der staatlichen Ordnung in Art. 6 GG als besondere Verpflichtung auferlegten Schutz von Ehe und Familie auch wenn sie zwischen einem 86-jährigen Deutschen und einer 19-jährigen Frau aus Hongkong in Freiburg geschlossen wurde (13.01.00) - aufgezeigt werden. Zunächst der Wortlaut der fallerheblichen Grundgesetzbestimmung: "Art. 6 GG (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern." Eine klar gefasste, in ihrer Handhabung einfach erscheinende Verfassungsbestimmung. Aber interne Behördenrichtlinien versuchen oftmals, den für jeden juristisch Unverbildeten erkennbaren Sinn einer gesetzlichen Bestimmung zu unterlaufen, um Geld zu sparen. Hinzu kann dann auch noch Ignoranz kommen: 154 Auslegun g von Grundrec htsbestim mungen am Beispiel von Art. 6 GG Ehe und Familie und Art. 16 GG Asylrecht "`Misere selbst verschuldet' Nach der Hochzeit: Bezirksamt lehnt Dringlichkeitsschein für größere Wohnung ab Von BIRGIT MÜLLER Normalerweise gibt's zur Hochzeit Glückwünsche und Geschenke. Beim Bezirksamt Mitte ist das anders. Da gilt die Eheschließung zweier Menschen als `selbstverschuldete Misere'. Und aus diesem Grund verweigert das Bezirksamt Peter Rieck (48), der vor anderthalb Jahren eine Frau mit vier Kindern geheiratet hat und in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebt, einen Dringlichkeitsschein für eine größere Wohnung. ... Statt eines Dringlichkeitsscheines bekam Rieck einen Brief vom Bezirksamt. Tenor: Nur der bekommt einen Dringlichkeitsschein, der seine Lage nicht selbst verursacht hat. `Nach Meinung des Einwohneramtes haben Sie Ihre jetzige Wohnmisere eindeutig selbst zu verantworten', stand in dem Schreiben. Die letzten drei Wörter waren gefettet und unterstrichen. `Sie haben eine für sich ausreichend große Wohnung zur Verfügung. Sie haben dann Ihre Familie nach Hamburg geholt, obwohl sie hätten erkennen müssen, daß Ihre gegenwärtigen Wohnverhältnisse für nunmehr sechs Personen nicht ausreichend sein werden.' Dann wird noch einmal belehrt: `Welche Beweggründe Sie auch immer zu diesem Schritt veranlaßt haben, Sie hätten sich über seine Folgen im klaren sein müssen.' ... Hilfe bekam Rieck von der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Birgit Schnieber-Jastram. Sie war empört: `Ist es übliche Praxis, eine Eheschließung als Eigenverschulden zu bezeichnen und eine notwendige Unterstützung bei der Wohnungssuche mit diesem Hinweis zu verweigern?' wollte sie vom Senat wissen. Der antwortete knapp mit nein. Geändert hat sich trotzdem nichts. ..." (HH A) So ein Fall von Behördenbockbeinigkeit sei ein Ausnahmefall? Da hätten Sie regelmäßig die Sendung "Wie bitte?" anschauen sollen! Da verging einem das Lachen - jedenfalls den Betroffenen; aber auch denjenigen, die sich in die ohnmächtige Lage der Betroffenen hineinversetzen konnten. Und ich halte jede Wette, dass RTL der Stoff für diese Alptraum-Sendung nie ausgegangen wäre! Aber der »geistige Dünnschiss« der »Spaßunkultursendungen«36 mit Kreti und Pleti, die als Akteure solcher schwachsinnigen Belanglosigkeiten von denjenigen, denen laut Jesu’ in der Bergpredigt geäußerter Verheißung wegen ihrer geistigen Armut das Himmelreich gehören solle, zu Semi-Prominenten hochgejubelt werden, die sie meist nicht einmal sind, denn ich kenne sie meist nicht, und die so als gut honorierte »Fernsehaffen« allwöchentlich das Karl-Kraus-Wort: „Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge Schatten“ für ein Millionenpublikum erfahrbar personifizieren, die trotz ihres von denselben Zuschauern in einer weiteren Sendung verliehenen Status’ als „nervigste Deutsche“ unerträglicherweise immer wieder zu bestimmten Sendungen herangezogen werden, über die dann auch noch am nächsten Tag in schreiend großen Lettern (z.B. zur Wahl des deutschen Kurienkardinals Joseph Ratzinger zum Papst Benedikt XVI. mit den drei Wörtern: „Wir sind Papst“) in genauso unerträglichen Zeitungen genauso Unerträgliches für die berichtet wird, bei denen sich das einzige, was sich in ihrem Kopf länger als zehn Minuten zu halten vermag, eine Erkältung ist, diese geistige Verarmung in unserer momentan spaßgegeißelten Gesellschaft hat wohl zu der Einstellung der wesentlich gehaltvolleren Sendung "Wie bitte?" geführt. („Wir amüsieren uns zu Tode“ hieß ein alarmierender Buchtitel, der auf die Gefahr einer allseits um sich greifenden geistigen Verarmung aufmerksam machen wollte.) Weitere illustrierende Intermezzi für nicht nachvollziehbare Behördenbockbeinigkeit gefällig? "Der Fährmann und der Fiskus joc/kg Hamburg - Der Fährmann versteht die Welt nicht mehr: Karl-Heinz Büchel (`Käpt`n Kuddel') wurden 900 Liter Diesel aus dem Tank der `Spieker Möwe' gestohlen. Ein Verlust von 360 Mark. Doch es kommt noch schlimmer: jetzt bittet ihn auch noch der Fiskus zur Kasse. Büchel, dessen Fähre von März bis November zwischen Zollenspieker und Hoopte verkehrt, soll Steuern nachzahlen - 558 Mark. Als Gewerbetreibender kauft Büchel Diesel steuerbegünstigt. Deshalb würde die 36 „Das Fernsehen ist eine große Wundertüte. Und zu den erstaunlichsten Mirakeln televisionären Schaffens zählt die verblüffende Fähigkeit, Überflüssiges bis nahezu Schwachsinniges zu produzieren. Ja, einigen nimmermüden Koryphäen der Zunft gelingt es tatsächlich, das kopfschüttelnde Publikum immer wieder dadurch zu faszinieren, dass sie die nieveaulosesten Ergüsse ihrer Kollegen souverän unterbieten.“ (STERN tv-magazin zu einer Schwachsinnssendung am 09.09.04) 155 Oberfinanzdirektion ihre Forderung erst zurückziehen, `wenn der Dieb nachweisen würde, daß er den Sprit gewerblich verwendet'. Büchel ist baff: `So etwas habe ich in 35 Jahren als Schiffsführer noch nicht erlebt.' Den Diebstahl hatte er umgehend der Polizei gemeldet. Die Schwierigkeiten begannen erst, als der Zoll kontrollieren wollte, ob sein steuerbegünstigter Treibstoff gewerblich genutzt wird. Der Zöllner wurde über den Diebstahl informiert, und deshalb muß Büchel nun blechen: `Weil diese Menge nicht der Ihnen bewilligten, steuerbegünstigten Verwendung als Schiffsbetriebsstoff zugeführt wurde', heißt es in der Begründung des Hauptzollamtes St. Annen, einer Unterbehörde der Oberfinanzdirektion. Günther Losse, Hamburger Zoll-Sprecher bestätigte den Sachverhalt: `Wir können nicht mehr feststellen, wer den Sprit wie verwendet hat. Da wir den Dieb nicht kennen, hält sich die Steuer an den Fährmann.' Auch er bedauere, daß Büchel nun doppelt geschädigt werde. Gleichzeitig deutet er einen Ausweg an: `Wenn der Dieb nachweisen würde, daß auch er den Sprit gewerblich verwenden würde ...' In dem Falle sähe wohl alles anders aus. Karl-Heinz Büchel findet kaum Worte: `Das ist ein dicker Hund.' Gegen die `sittenwidrige Forderung' des Fiskus legt er Widerspruch ein." (HH A 09.02.95) „Familie W. will das Gelände ihres Reiterhofes in Brandenburg arrondieren und benötigt für den Kauf eines Grundstücks einen Kredit. Die Bank bewilligt ihn problemlos, zahlt aber nicht aus. Der Grund: Zwei Behörden streiten sich, wie der Kauf im Grundbuch einzutragen sei. Das Amt für ländliche Entwicklung besteht auf der Schreibweise ’Flur 5/9’, die Grundbuchstelle des Amtsgerichts fordert für den Eintrag ’Flur fünf/neun’. Die beiden Behörden ziehen mit ihrem Streit vor das Verwaltungsgericht. Das dauert natürlich – den Bürokraten ist das egal. ... Im bayerischen Degendorf zog ein Bauer mit dem Traktor einen PKW aus dem Graben. Daraufhin schickte ihm das Finanzamt einen Gebührenbescheid über 29 Euro – pro Kilo Traktorgewicht einen halben Cent. Begründung: missbräuchliche Benutzung einer steuerbefreiten landwirtschaftlichen Zugmaschine.“ (STERN 18.09.03) Doch zurück zu unserem Problemkreis Ehe und Asylrecht. Soll ein vom Verfassungsgesetzgeber ohne Gesetzesvorbehalt gewährtes Grundrecht wie das Recht auf Ehe und Familie uneingeschränkt gelten, so dass mit ihm auch Missbrauch getrieben werden kann? „Scheinehe für Döner dpa Nürnberg – Döner auf Lebenszeit hat ein türkischer Gastwirt einem Schüler (18) in Nürnberg für die Heirat seiner in der Türkei lebenden Schwester versprochen. Zudem wollte der 35-Jährige dem jungen Mann den Führerschein bezahlen und einen Urlaub sponsern, teilte die Polizei mit. Der Schüler habe sich darauf eingelassen, aber kurz nach der Heirat ging er zur Polizei. Gegen die Eheleute läuft ein Verfahren.“ (HH A 21.04.01) "Scheinehen: Die erkaufte Sicherheit Immer häufiger werden in Hamburg Scheinehen geschlossen. Der Leiter des Sachgebietes 1 der Ausländer-Behörde, Gerhard Horter, deckt bei seiner Arbeit jede Woche `mindestens' eine Ehe auf, die nur zu dem Zweck geschlossen wurde, daß ein Asylbewerber, dem die Abschiebung droht, in Deutschland bleiben kann. Denn Ausländer, die rechtmäßig mit einem Deutschen verheiratet sind, erhalten automatisch eine fünfjährige Arbeitsgenehmigung. Danach können sie sogar die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Ein Dokument, für das viele Asylbewerber teuer bezahlen. Horter schätzt, daß die deutschen Partner, die meist in Kneipen oder Discos zu dem Deal überredet werden, Beträge von bis zu 10.000 Mark für eine Scheinehe kassieren. `Bei Hamburgs Prostituierten gilt das als beliebte zusätzliche Einnahmequelle', sagt Horter. `Oft heiraten aber auch Drogenabhängige, die ein paar hundert Mark verlangen, mit denen sie den nächsten Druck bezahlen.' Wenn die Ehen dann geschlossen sind, kommen die Schein-Eheleute zur Ausländerbehörde, um die Arbeitserlaubnis zu beantragen. Dort werden sie von Horter und seinen Kollegen in die Pflicht genommen. 156 Die Beamten überprüfen dabei nicht nur, ob die Eheleute einen gemeinsamen Wohnsitz haben. Sie wollen zum Beispiel auch wissen, ob die Eheleute am Vorabend gemeinsam zu Hause waren. Wird dieses bejaht, und die Eheleute geben beispielsweise an, gemeinsam Fernsehen geguckt zu haben, fragt der Beamte die beiden getrennt, welchen Film sie sich angeschaut haben. Kommt es bei dem Interview zu Widersprüchen, ‘geben die meisten deutschen Partner von selbst zu, daß sie nur zum Schein geheiratet haben', berichtet Horter. ‘Sie wissen, daß ihnen sonst eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr droht. Der Asylbewerber wird sofort abgeschoben.'" (HH A 11.02.93) Das GG als "Dealer- und Prostituierten-Geldeinnahme-Schutzgesetz"? Das wäre ja noch schöner! Ausländer, die einer solchen Täuschung überführt werden, können nach dem Ausländergesetz (Paragraph 92) mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden und verlieren ihr Aufenthaltsrecht. Deutsche Staatsbürger machen sich dabei der „Unterstützung eines illegalen Aufenthalts” strafbar, die bis zu einem Jahr Gefängnis eintragen kann. Diese Strafbestimmung wird aber fast nie angewandt, geschweige denn ausgeschöpft. Auf Grund der Strafbestimmungen des Ausländergesetzes § 92 I Nr. 7 Erschleichen von Berechtigungen durch falsche Angaben wird in Verbindung mit §§ 45 und 46 AuslG meist die unverzügliche Ausweisung vorgenommen. Einige Politiker fordern, wie einem Zeitungsartikel vom 11.02.98 zu entnehmen war, unter Berufung auf eine entsprechende in Dänemark geltende gesetzliche Bestimmung ein Heiratsverbot für Asylbewerber, um so einem Betrug mit Scheinehen entgegenwirken zu können. Wenn die Partner des Scheinehen-Deals sich dann aus dieser oft leichtsinnig eingegangenen Verbindung mit u.U. auch Nachteilen für sie selbst bezüglich des Verlustes staatlicher Unterstützungszahlungen, da ja z.B. zunächst einmal der wenn auch aus Deutschland ausgewiesene Ehepartner unterhaltspflichtig ist, bevor "Stütze" und Wohngeld beantragt werden können, lösen wollen, müssen sie sich – wie rund 90.000 andere pro Jahr auch scheiden lassen. Das kostet und dauert! Selbst ein noch in Deutschland sich aufhaltender ausländischer Scheinehen-Partner ist oft nicht auffindbar. In der Zwischenzeit eine wirkliche Ehe einzugehen, wäre strafbare Bigamie und wird nicht nur mit zwei Schwiegermüttern bestraft. Ganz besonders schwierig gestalten sich die Lebensumstände zuvor schon Geschiedener, die durch das Eingehen der angebotenen Scheinehe ganz schnell ca. € 5.000,- zusätzlich verdienen wollten: Nach der Annullierung der Scheinehe lebt der alte Unterhaltsanspruch gegen den vorherigen Ehemann nicht wieder auf! Das ist gesetzlich so festgelegt und nach Billigkeitserwägungen wohl auch rechtens. Das alles spricht für den von der Behörde ausgefochtenen Kampf gegen die Scheinehen mit Ausländern. Andererseits aber wurde in der vorstehenden Zeitungsmeldung berichtet, dass eine Ehe formularmäßig rechtens schon geschlossen worden war: " ... und erkläre Sie hiermit vor dem Gesetz für Mann und Frau." Es waren ja nicht Brautleute in der Zeit des damals noch notwendigerweise zu bestellenden Aufgebotes zum Ausländeramt einbestellt und befragt worden, sondern Eheleute. Und das GG schützt doch an sich die Ehe in Art. 6 GG! Soll dann die Behörde in aus welchen Gründen auch immer geschlossenen Ehen herumschnüffeln dürfen? Ist das kein Verstoß gegen das Grundgesetz? Und es gab schon die Fälle weltberühmter verschwiegen homosexueller Schauspieler, die ihre weibliche FanGemeinde nicht vor den Kopf stoßen konnten oder wollten und deswegen auch eine Scheinehe eingegangen sind. Da wird dann höchstens von der Klatsch-Presse nach dem fraglichen Vollzug der Ehe gefahndet, nicht aber vom Staat. (Aber diese Leute wollten sich mit ihrer Scheinehe auch keine staatlichen Berechtigungen erschleichen.) Und wenn schon geschlossene Ehen offensichtlich nicht immer geschützt werden: Wie soll es dann bei den juristisch viel lockerer gebundenen nichtehelichen Lebensgemeinschaften sein, wo die Partner relativ leicht wieder auseinanderlaufen können? Da müssten doch erst recht Ausweisungen vorgenommen werden dürfen! Auch wenn ein Kind bei der nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit "abgefallen" ist und nicht nur eine Ehe geschlossen, sondern sogar eine Familie gegründet worden sein kann. (Zur Bedienung von Stammtischen: Da könnte sich ja sonst jeder Schwarze an einen weichen weißen Leib heranschmusen und eine Deutsche schwängern, um die Gesetze zu unterlaufen und in Deutschland Bleiberecht zu erhalten.) Jedenfalls die beiden Sätze vor der Klammer dachte die Hamburger Ausländerbehörde im nachfolgenden Fall; nicht ganz zu Unrecht, wie ihr die Verwaltungsgerichte bestätigten - die dabei genau so wenig das Wesen der Familie inhaltlich hinreichend berücksichtigten wie der Hamburger Staat durch seine Ausländerbehörde. Dabei hätte ein Blick in einen Grundrechtskommentar z.B. die Erklärung finden lassen: "Art. 6 umfaßt nicht den Schutz der Generationen-Großfamilie. Familie bedeutet hier die in der Hausgemeinschaft geeinte engere Familie, das sind die Eltern mit ihren Kindern. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat die Familie im Sinne des 157 Art. 6 Abs. 1 GG nur als die umfassende Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern verstanden." Der ghanesische Asylant der nachfolgenden Zeitungsmeldung lebte bis zum Zeitpunkt der Ausweisungsverfügung mit einer Deutschen in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammen und hatte mit ihr ein Kind. Die an sich schon längere Zeit geplante Eheschließung konnte wegen fehlender und aus Ghana nur äußerst mühsam zu beschaffender Papiere nicht vollzogen werden. Der Asylantrag des Ghanaers war zwischenzeitlich rechtskräftig abgelehnt worden. Sämtliche gegen seine Abschiebung angestrengten Verwaltungsprozesse hatte er schon verloren. Nach Ausschöpfung des Rechtsweges konnte der mit seiner deutschen Braut und dem gemeinsamen Kind zusammenlebende Asylant aber noch das BVerfG anrufen: "Aufschub statt Abschiebung Heiratsabsicht: Darf Ghanaer in Deutschland bleiben? Der Ghanaer Sulleimann Ahmed Toloba darf vorläufig in Deutschland bleiben. Das entschied das Bundesverfassungsgericht. Der 28jährige sollte nach der Ablehnung seines Asylantrages abgeschoben werden, obwohl er die Hamburgerin Heike Reimer, Mutter seines 15 Monate alten Sohnes, heiraten will. Wie berichtet, wollen Sulleimann Ahmed Toloba und Heike Reimer seit einem Jahr heiraten. Doch die notwendigen Dokumente aus Ghana wurden von den Behörden bisher nicht anerkannt. Mal galten sie als veraltet, mal gingen sie auf dem Weg von der deutschen Botschaft in Ghana nach Hamburg verloren. Dann kam das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg: Abschiebung - und das, obwohl ein Gutachten der Sozialen Dienste vorlag. Darin wurde bestätigt, daß es sich bei der Familie nicht um eine `Schein-Familie' handele, sondern um eine stabile Gemeinschaft, in der der Vater eine wichtige Rolle spiele. Die Anwältin des Ghanaers, Cornelia Ganten-Lange, wollte das Urteil nicht akzeptieren. Sie rief das Bundesverfassungsgericht an. Sie sah in der Abschiebung trotz Heiratswillens und trotz Familie einen Verstoß gegen den im Grundgesetz verankerten Schutz der Familie. Das Verfassungsgericht gab ihr recht. Dieser Schutz der Familie `verpflichtet die Ausländerbehörde, bei einer Entscheidung über die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung die familiären Bindungen des Aufenthalt begehrenden Ausländers ... in ihren Erwägungen zur Geltung zu bringen'. Auch für einen nichtehelichen Vater gelte der Artikel 6 im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hob das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg auf. Es muß jetzt neu verhandelt werden." (HH A 16.11.92) Da wundert es einen, dass es zu dem der folgenden Meldung zugrunde liegenden Prozess kommen konnte - aber Behörden und selbst höhere Gerichte sind - jedenfalls in Asylsachen - oft verbockt und nicht unbedingt lernwillig. Wenn sie auch nur eine unwesentliche Abweichung in der Fallgestaltung erkennen zu können glauben, versuchen sie zunächst einmal, die für den Betroffenen rigidere Gesetzesauslegung anzuwenden, ohne sich (zu große) Gedanken um den Sinn oder den Schutzzweck einer grundgesetzlichen Norm zu machen: "Bundesverfassungsgericht entschied: Türkischer Vater darf bleiben Weil er mit einer Hamburgerin ein Kind hat, darf ein von Abschiebung bedrohter Türke vorerst in der Hansestadt bleiben. Das entschied das Bundesverfassungsgericht und hob damit eine gegenteilige Entscheidung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts auf (Aktenzeichen: 2 BVR 1542/94). Der Fall: Kerim B. lebt seit 1981 in der Bundesrepublik. 1987 heiratete er eine Deutsche. Die eheliche Lebensgemeinschaft besteht aber nicht mehr, die Scheidung läuft. Seit 6. Juni dieses Jahres hat der 37jährige eine Tochter mit einer Hamburgerin. Seit 19. Juli saß er in Abschiebehaft, weil er sich nach Ansicht der Hamburger Behörden und Richter seit drei Jahren illegal hier aufhält. Die Wende in der juristischen Beurteilung des Falles brachte die neue eheähnliche Beziehung. Zwar hat B. eine Wohnung in Altona, seine Freundin eine in Eimsbüttel. Doch sie verbrächten nahezu jeden Tag gemeinsam, versicherte die Kindesmutter. Der Türke argumentierte in seiner Verfassungsbeschwerde, auch für die nichteheliche Lebensgemeinschaft eines Ausländers mit einer Deutschen und ihrem gemeinsamen Kind gelte der Grundgesetz-Artikel sechs. Artikel sechs lautet: `Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.' Für die Karlsruher Richter hat die Verfassungsvorschrift Vorrang. Kernsatz ihrer Entscheidung: Könne die `Lebensgemeinschaft zwischen einem Ausländer und einem von ihm als 158 Vater anerkannten deutschen Kind nur in der Bundesrepublik stattfinden, weil dem deutschen Kind wegen dessen Beziehung zu seiner Mutter das Verlassen der Bundesrepublik nicht zumutbar ist, so drängt die Pflicht des Staates, die Familie zu schützen, regelmäßig einwanderungspolitische Belange zurück'. Die rechtliche Beurteilung ändere sich auch nicht dadurch, daß der Beschwerdeführer vor Entstehung der zu schützenden Lebensgemeinschaft gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen verstoßen habe. Jedenfalls könne sich auch ein nichtehelicher Vater grundsätzlich auf den Schutz des Artikels sechs berufen, wenn er mit Kind und Mutter zusammenlebe. Das Bundesverfassungsgericht verwies den Fall an das Oberverwaltungsgericht zurück. Das OVG verfügte noch gestern eine Aussetzung der Abschiebung. Gestern wurde Kerim B. auch aus der Haft entlassen. rup" (HH A 17.08.94) Ob der Nachhilfeunterricht des BVerfGs in Sachen Beachtung des Art. 6 GG auch bei von Abschiebung bedrohten Ausländern nun sitzt? Das BVerfG trägt dem geänderten Familienbild Rechnung und definiert „Familie“ als eine „umfassende Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern, in der den Eltern vor allem Recht und Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder erwachsen“ - ohne dass dazu ein Trauschein gehören muss. So sehen das auch die Grünen: „Familie ist da, wo Kinder sind.“ Aber so vermochten es 2002 die katholische Deutsche Bischofskonferenz und konservativere Teile der CDU/CSU immer noch nicht zu sehen, die vor der Bundestagswahl 2002 gemeinsam dagegen Front machten, dass eine 28-jährige ledige Mutter, die mit ihrem Partner in einem „Konkubinat“ – schon allein das Wort ist anstößig! – zusammenlebte und weiterhin unverheiratet ihr zweites Kind bekam, in der CDU/CSU an herausragender Stelle für „Familie“ zuständig sein, eventuell die nächste Familienministerin werden sollte. Und zum Schluss als anwaltlicher Rat für einen von Abschiebung bedrohten Ausländer: Es kommt nur darauf an, sich mindestens neun Monate im Bett einer Deutschen versteckt zu halten und dabei schleunigst mit Fleiß und Freude einen Bleibegrund zu produzieren; zu dem man(n) aber dann auch stehen muss. Das ist praktizierte Juristerei! Und das war vor 10 Jahren, als ich am Manuskript dieses Buches an dieser Stelle schrieb, als juristischer Gag für meine Leser gedacht: Ich hatte nur die sich auftuenden Möglichkeiten juristisch gedanklich durchgespielt und zu Ende gedacht. Aber da ich – zum Glück – kein Privileg aufs Denken besitze, wunderte es mich nicht, dass ich zehn Jahre später im SPIEGEL vom 25.10.04 die Notiz fand, dass Islamisten und ausreisepflichtige Ausländer das liberale Familienrecht in Dänemark ausnutzen würden, um in Sonderburg oder Tondern ohne zeitraubende Formalitäten eine deutsche Frau zu heiraten. Ein anderer, seit der Reform des Kindschaftsrechts 1988 häufig genutzter, viel eleganterer weil straffreier Trick ist die Anerkennung von (angeblich bestehenden) Vaterschaften: (Schein-)Eheschließungen können behördlich angefochten und gerichtlich geahndet werden, Scheinvaterschaften nicht! Wer als ausreisepflichtiger Ausländer die Vaterschaft eines in Deutschland geborenen Kindes anerkennt, dem ist seit der Reform 1988 zumindest ein vorläufiger Aufenthaltstitel sicher. So kommt es, dass in 70 % aller Fälle, in denen Ausländer zwischen April 03 und April 04 Kinder deutscher Frauen anerkannt hatten, die Väter ausreisepflichtig gewesen waren. Diese (angeblichen) Väter konnten so mit dem Hinweis auf den Schutz der Familie ihre Abschiebung umgehen. Nun wird erwogen, eine rechtliche Regelung zu schaffen, dass derartige Vaterschaftsanerkenntnisse von Behörden angefochten werden können. „Trägern öffentlicher Belange soll „ein befristetes Anfechtungsrecht bei Vaterschaftsanerkennungen im Bürgerlichen Gesetzbuch” verschafft werden, das heißt, die Behörden sollen das Recht erhalten, vor Gericht einen DNS-Test zu erstreiten. Die gleiche Forderung hatte die CDU/CSU-Fraktion schon im Oktober in den Bundestag eingebracht. Die Union stellte in ihrem Antrag besonders „die verheerenden Folgen für die betroffenen Kinder” heraus, denen durch den Mißbrauch des Familienrechts das Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung und der Umgang mit dem leiblichen Vater verwehrt werde. Bundestag und Bundesrat haben bisher wenig Neigung gezeigt, sich mit der Sache zu befassen. Die für den 11. November angesetzte Bundestagsdebatte über den Antrag der Union entfiel; die vorbereiteten Reden wurden nur zu Protokoll genommen. Dort riet der GrünenAbgeordnete Winkler den Christlichen Demokraten, sie sollten sich bei diesem Thema „mal an die Weihnachtsgeschichte - in der ja die Frage der Vaterschaftsanerkennung eine wesentliche Rolle spielt - erinnern”, um sich in die verzweifelte Lage einer ausländischen Mutter zu versetzen, „wenn sie die Abstammung ihres Kindes wegen einer Aufenthaltserlaubnis verleugnet”. Die Abgeordneten der Koalition warfen der Union vor, das Phänomen der Scheinvaterschaften aufzubauschen, Ausländer durch einen „Generalverdacht” zu diskriminieren und „vorschnell” nach 159 Gesetzesänderung zu rufen. Vorrang habe in jedem Fall „die Wertentscheidung der Kindschaftsreform von 1998”, heißt es im Redemanuskript der SPD-Abgeordneten Lambrecht, „die ganz bewußt die Rechtsstellung und die Verantwortung der Mutter eines nicht ehelich geborenen Kindes stärkt”. Der Berliner CDU-Abgeordnete Gewalt hingegen gab zu Protokoll, die Gesetzeslücke, die sich durch das Kindschaftsrecht aufgetan habe, sei „so groß wie ein Scheunentor”. Der Bundesregierung sei das Problem seit 2001 bekannt. Dennoch spiele sie es in unverantwortlicher Weise herunter. Nach dem gleichen Schema verlief die Debatte im Rechtsausschuß des Bundestags, der das Thema Scheinvaterschaften schließlich unter Hinweis auf die ausstehende Stellungnahme der Justizminister vertagte. Gelebte Vaterschaften Die Justizministerkonferenz wiederum wird sich nach Auskunft des nordrhein-westfälischen Justizministers Gerhards (SPD) voraussichtlich überhaupt nicht mit den Scheinvaterschaften befassen. Diesen Eindruck hat Gerhards zumindest aus den ersten Reaktionen seiner Justizkollegen auf den Antrag der Innenminister gewonnen. Seiner Meinung nach ist dieser Vorstoß einfach überflüssig: „Man ruft nach dem Gesetzgeber, obwohl man einfach nur die geltenden Gesetze anwenden müßte.” Statt den umständlichen Weg zu beschreiten, Vaterschaften anzufechten, müßten die Ausländerbehörden lediglich den Nachweis verlangen, daß erklärte Vaterschaften tatsächlich gelebt und etwa durch Unterhaltszahlungen glaubhaft gemacht würden. Sei das nicht der Fall, gebe es auch keinen Grund, einen Aufenthalt wegen familienrechtlicher Interessen zu verlängern. „Ich negiere nicht das Problem”, sagte Gerhards dieser Zeitung, „nur die von der IMK vorgeschlagene Lösung.” Senator Röwekamp beharrt indes darauf, daß die Ausländerbehörden auch bei begründetem Verdacht auf eine Scheinvaterschaft keinerlei Handhabe hätten, den Aufenthalt des Betreffenden zu beenden. „In dem Augenblick, in dem beim Standesamt eine Vaterschaft angezeigt wird, kann sie nicht mehr angezweifelt werden. In einem Anfechtungsverfahren dagegen könnte ein DNSGutachten eingeholt und die Fiktion der Vaterschaft durch Gerichtsbeschluß aufgehoben werden.” Röwekamp weicht freilich dem Argument aus, daß die biologische Verwandtschaft nicht die alleinige Voraussetzung für eine Vaterschaftsanerkennung ist. Neben der fehlenden biologischen Verwandtschaft müßte die Behörde weiterhin das Fehlen einer sozialen Vater-Kind-Beziehung nachweisen, um eine Scheinvaterschaft zu enttarnen. Auf dem grauen Markt werden sowohl für die Vermittlung, als auch für die Übernahme von Scheinvaterschaften beträchtliche Summen gezahlt. Der Abgeordnete Gewalt sieht darin bereits einen neuen Geschäftszweig der organisierten Kriminalität. Dem Bundeskriminalamt liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Auch Röwekamp, der für dieses Thema in der Innenministerkonferenz zuständig ist, hat dafür keine Anhaltspunkte. Das könnte sich jedoch ändern, wenn die Politik weiterhin zögert, sich des Problems anzunehmen.“ (F.A.Z. 01.03.05) Auch von Abschiebung bedrohte (logischerweise ausländische) Frauen unterlaufen elegant und völlig risikolos ihre Abschiebung, wenn sie – selbstverständlich gegen (der Behörde nicht bekannt gewordene) Bezahlung – einen pekuniär »nicht ganz momentanen« Deutschen finden, der bereit ist, seine angebliche Vaterschaft an ihrer »in statu nascendi« befindlichen Leibesfrucht anzuerkennen: Eine in Deutschland niederkommende Ausländerin erwirbt ein Bleiberecht, sobald sie für ihr Kind einen deutschen Vater nachweisen kann. Das gilt sogar dann, wenn sie hochschwanger eingereist ist und schon an der Hautfarbe des Kindes zu erkennen ist, dass der zum Vater erklärte Mann nicht der Erzeuger gewesen sein kann, denn die biologische Vaterschaft ist nicht Voraussetzung für die amtliche Anerkennung einer Vaterschaft. Das war bis 1998 noch anders. Vor der Reform des Kindschaftsrechts wurde regelmäßig das Jugendamt zum Vormund nichtehelich geborener Kinder bestellt. Der Amtsvormund befand unter anderem darüber, ob ein von der Mutter als Vater angegebener Mann in seine Vaterrechte eingesetzt wurde. Das wurde zu Recht als Bevormundung der Mütter empfunden und mit der Kindschaftsreform geändert. Seither ist Vater der, der sich dazu bekennt und von der Mutter als solcher anerkannt wird. Dass diese Regelung zu Missbrauch führen könnte, ist damals niemandem in den Sinn gekommen. Dem Staat scheint es neben der Abschaffung der Bevormundung von ledigen Müttern auch darum gegangen zu sein, jemanden zu haben, der rechtlich für den Unterhalt des Kindes einzustehen hat. Die in bürgerlicher Normalität lebenden Abgeordneten, der Gesetzgeber, hatte sich nicht hinreichend in die »Denke« dieser eine Vaterschaft anerkennenden Looser hineinversetzt. Sie waren von ihren Lebensumständen ausgegangen und in denen sind mit einer Vaterschaft mehr Pflichten als Rechte verbunden. Da aber die Randständigen selber von »Stütze« leben, sie den kleinen Zuverdienst für die Anerkennung der angeblichen 160 Vaterschaft geheim halten, da er sonst auf ihre »Stütze« angerechnet würde, verfügen sie auch über keine Einkünfte, aus denen heraus sie für den Unterhalt »ihres« Kindes aufkommen müssten. Das Ergebnis: nun müssen sowohl die ohne vorgeschobene Anerkennung nicht aufenthaltsberechtigte Kindsmutter und ihr/e Kind/der von der aus unseren Steuergeldern aufgebrachten Sozialhilfe durchgebracht werden. Das Elegante dieser äußerst erfolgreichen Methode besteht auch hier darin, dass zwar das Eingehen von Scheinehen strafbar ist, nicht aber die Anerkennung von Scheinvaterschaften! »Looser«, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen Lage nie die wirtschaftlichen Folgen ihrer Anerkenntnis tragen müssen, selber von »Stütze« leben, nie Unterhalt zahlen werden und denen es völlig gleichgültig ist, dass durch ihre Vaterschaftsanerkenntnis die deutschen Sozialkassen ausgeplündert werden, weil die Allgemeinheit über die Sozialhilfe für sowohl die Mütter, die sich auf diesem Wege die Aufenthaltsberechtigung erschleichen, als auch deren Kinder aufkommen muss, »Looser«, denen die Finanzierung ihrer täglichen Alkohol- oder/und Rauschgiftration durch eine heimlich »cash in de Täsch« gewährte Prämie näher liegt, als die berechtigten Belange des Staates, erkennen angebliche Vaterschaften im großen Stil an und bescheißen so unsere sozialen Sicherungssysteme. Das ist das Problem der „Imbissbudenväter“. 2004 sind 1.694 Verdachtsfälle (Fakt 17.01.05) notiert worden. Die Fälle der von deutschen Männern oder bei uns aufenthaltsberechtigten Ausländern durch Geldzuwendungen schwangerer Ausländerinnen anerkannten (Schein-)Vaterschaften, um den Müttern und ihren Kindern den Aufenthalt und den Anspruch auf Sozialhilfe zu ermöglichen, sind in dieser Zahl nicht enthalten. Sie übersteigen die Erschwindelung des Aufenthaltes unter Missbrauch der Möglichkeiten des Familienrechts durch die Männer um einiges. Für den Staat „lassen die Daten eine Dimension erkennen, die eine Vernachlässigung des Problems nicht rechtfertigen”, heißt es in einem Bericht des Bremer Innensenators Röwekamp (CDU) an die Innenministerkonferenz. Volker Koop Realität oder nur Phantome? "Imbissväter" - Diskussion um erneute Reform des Kindschaftsrechts Ein 31 Jahre alter Berliner dürfte derzeit in Deutschland einen wohl einsamen Rekord halten: Er ist Vater von neun Kindern - allerdings nur auf dem Papier. Die Vaterschaft hat er für Kinder anerkannt, deren Mütter, Migrantinnen, vor der Ausweisung standen. Die Kinder bekamen damit die deutsche Staatsangehörigkeit, die Mütter ein Bleiberecht - und der Berliner für jede "Vaterschaft", wie er einräumte, ein gutes Honorar. "Imbissväter" - so heißen im Alltagsjargon die deutschen Männer, die ihre Vaterschaft verkaufen. Gezielt wird an öffentlichen Plätzen eine gewisse Klientel - meist Sozialhilfeempfänger - für eine Vaterschaftsanerkennung gesucht, und dies ist laut Jürgen Gehb kein Zufall. "Denn", so der CDUBundestagsabgeordnete, "aufgrund ihrer besonderen Lage müssen und können diese Männer ihre mit der Anerkennung entstehenden Unterhaltsverpflichtungen für das Kind und selbstverständlich auch für die Mutter nicht tragen. Stattdessen zahlt der Steuerzahler." Eine Handhabe gegen diese "Vaterschaften" gebe es bisher nicht, die rechtliche Anerkennung nicht leiblicher Kinder sei legal. Es sei kein Geheimnis, dass es hierfür regelrechte Tarife gebe: um die 50.000 Euro liege der Lohn für den Scheinvater. Sei die Mutter ausreisepflichtige Ausländerin, sei darüber hinaus mit der Vaterschaftsanerkennung eines deutschen Mannes das Bleiberecht für Mutter und Kind verbunden. Der CDU-Parlamentarier verweist darauf, dass die Innenministerkonferenz davon ausgehe, dass es in nicht unerheblicher Anzahl zu Vaterschaftsanerkennungen komme, die primär der Vermittlung eben dieses Bleiberechtes dienten. Gehb: "Folgerichtig plädieren die Innenminister dafür, dass im Bürgerlichen Gesetzbuch bei Vaterschaftsanerkennungen ein befristetes Anfechtungsrecht für einen Träger öffentlicher Belange geschaffen werden soll." Die Union habe deshalb im Herbst des vergangenen Jahres die Bundesregierung aufgefordert, einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen, passiert sei jedoch noch nichts. Einen solchen Handlungsbedarf sieht der Grünen-Abgeordnete Josef Winkler aus mehreren Gründen nicht. Für ihn ist unklar, wie die Union zu der Einschätzung komme, dass die Zahl von Scheinvaterschaften seit 2001 zunehme, denn eine von der Innenministerkonferenz initiierte Erhebung erfasse nur den Zeitraum Frühjahr 2003 bis Frühjahr 2004. Außerdem handele es sich um Verdachts- und nicht um Missbrauchsfälle. "In der Erhebung der Ausländerbehörden wurde nämlich allein die Zahl der Vaterschaftsanerkennungen erfasst, woraus noch lange nicht die Missbrauchsfälle abzulesen sind." Dass es im Gegensatz zu anderen europäischen Rechtsordnungen eine Anfechtungsbefugnis öffentlicher Stellen noch nicht gebe, liege unter anderem auch am reformierten Kindschaftsrecht. Vor dieser Reform, habe auch ein nichteheliches Kind einer Vaterschaftsanerkennung zustimmen müssen, was aber durch das Jugendamt in Amtspflegschaft erfolgt sei. Diese Bevormundung der Mutter durch den Staat habe man jedoch gerade abschaffen 161 wollen. Winkler: "Die Feststellung der sozialen Beziehung kann nicht wie bei einer Scheinehe an einer familiären Lebensgemeinschaft festgemacht werden. Väter kümmern sich heutzutage häufig auch viel um ihre Kinder, ohne mit ihnen zusammen zu wohnen. Ein Abstellen auf die fehlende Bereitschaft des Vaters, für das Kind zu sorgen, würde zu einer Diskriminierung und zu einem Generalverdacht gegen Sozialhilfeempfänger führen." Der Grünen-Politiker wendet sich strikt gegen ein Zurückdrehen der Kindschaftsrechtsreform. Der Gesetzgeber habe bewusst auf eine behördliche Beteiligung bei der Vaterschaftsfeststellung unehelicher Kinder verzichtet und damit die Rechte der Mütter gestärkt: "Staatliche Stellen haben weder bei ehelichen noch bei unehelichen Kindern von Deutschen das Recht, die Vaterschaft des biologischen oder auch des sozialen Vaters in Zweifel zu ziehen. Gleiches muss auch für die Kinder von ausländischen Vätern oder Müttern und binationale Paare gelten." Auf den erwähnten Bericht der Innenministerkonferenz geht auch Joachim Stünker als rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ein. Die Erhebungen hätten zwar einen hohen Anteil von Fällen ergeben, in denen die Vaterschaftsanerkennung für ein deutsches oder ausländisches Kind mit der Ausreisepflicht der unverheirateten ausländischen Mutter (72 Prozent) zusammengetroffen sei. Mit 83 Prozent sei der Anteil der Vaterschaftsanerkennungen durch deutsche Männer ebenfalls hoch gewesen. Der Bericht räume jedoch ein, dass es sich bei diesen Zahlen nur um ein Indiz handele. Es fehlten Kriterien, anhand derer festgestellt worden sei, ob die Anerkennung "echt" oder nur zur Erlangung von Aufenthaltstiteln beziehungsweise Sozialleistungen vollzogen worden sei. Die Rechtspolitiker der SPD-Bundestagsfraktion plädierten deshalb dafür, sich mit dem Zahlenmaterial sachlich auseinanderzusetzen. Bei der Reform hätten sie sich mit gutem Grund gegen eine behördliche Beteiligung bei der Vaterschaftsfeststellung entschieden. Joachim Stünker: "Es besteht kein Anlass, diesen Grundsatz unüberlegt über Bord zu werfen. Hinzu kommt, dass die geforderten Änderungen Ausländer und Ausländerinnen betreffen. Zur Begründung einer derartigen Gesetzesänderung muss das Zahlenmaterial besonders belastbar sein." Sollten sich die Befürchtungen jedoch bestätigen, werde sich die SPD-Bundestagsfraktion des Themas annehmen und eine Lösung erarbeiten. Unter Verweis auf ein nicht gesichertes Datenmaterial lehnt auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Sibylle Laurischk eine Änderung des derzeitigen Kindschaftsrechtes ab. Die Daten der Innenministerkonferenz wiesen nur nach, wie viele ausreisepflichtige Ausländerinnen einen Aufenthaltstitel erhalten hätten, nachdem ein Deutscher die Vaterschaft für ihr Kind anerkannt habe. "Schon hier von vornherein zu unterstellen, dass diesen Vaterschaftsanerkenntnissen nicht auch eine tatsächliche, biologische oder sozial-familiär vermittelte Vaterschaft zugrunde liegt, ist voreilig." Mit der Reform des Kindschaftsrechtes 1998 sei die Rechtsstellung und Verantwortung der nichtehelichen Mutter gestärkt worden. Für Sibylle Laurischk gilt: "Ein ausländerrechtliches Problem mit den Mitteln des Zivilrechtes lösen zu wollen, ist abwegig, da die Auswirkungen auf in der Mehrzahl legal verlaufende Fälle eine überbordende Schnüffelbürokratie bedeuten würde. Vielmehr sollten die ausländerrechtlichen Instrumente voll ausgeschöpft werden, um im Tatsächlichen zu ermitteln, ob die Vaterschaft auch sozial-familiär oder materiell durch Unterhaltszahlungen gelebt wird und damit der Artikel 6 unserer Verfassung tatsächlich einem Verlassen der Bundesrepublik Deutschland entgegenstünde." Binationale Kinder dürften nicht mit dem Generalverdacht der fehlenden Legitimation belegt werden. (Das Parlament 21.03.05) Mit mehreren tausend Euro sind solche von schwangeren Ausländerinnen erkauften Vaterschaften keineswegs überbezahlt. Die Käuferinnen erwerben damit nicht nur dauerhafte Ansprüche auf Sozialhilfe, sondern nach einer gewissen Zeit auch die Möglichkeit, weitere Familienmitglieder nach Deutschland zu holen. Etwas schwerer hat es ein Ausländer, der sich eine Vaterschaftsanerkennung von einer deutschen Frau kauft. Bei ihm kann die Ausländerbehörde immerhin prüfen, ob er seinen Pflichten nachkommt. Ist das nicht der Fall, erlischt auch sein Bleiberecht als Familienvater, denn in seinem Bleiberecht wird nicht geschützt, wer in Verkennung der Rechtsprechung zwar – tatsächlich oder nur juristsich - einen grundsätzlichen Bleibegrund produziert hat, ihn dann aber für sich selbst als nicht existent betrachtet: Urteil: Vater wird abgeschoben Braunschweig - Ein Kind mit einer Deutschen sichert einem Ausländer nicht in jedem Fall ein Aufenthaltsrecht. Wenn der Vater sich nicht um das Kind kümmert und keinen Unterhalt zahlt, kann er abgeschoben werden, urteilte das Verwaltungsgericht Braunschweig (Az.: 6 B 56/05). dpa 162 HH A 01.03.05 Daran wird die besondere Eleganz der den Frauen offen stehenden juristischen Möglichkeit noch einmal sehr augenfällig: ein deutsche Scheinvater, der sich nach der Anerkenntniserklärung nicht um sein »anerkanntes Kind« kümmert, kann nicht abgeschoben werden und die Mütter mit ihren »anerkannten Kindern« auch nicht. Nach den Vorstellungen des innenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion während der 15. Legislaturperiode, des ehemaligen Verwaltungsrichters und als MdB nebenbei als Rechtsanwalt tätigen Wiefelspütz, soll der Bestandsschutz von Ehe und Familie für nachweislich gefährliche Ausländer selbst dann entfallen, „wenn sie schon jahrelange bei uns leben, eine deutsche Ehefrau und Familie haben.“ Ob das BVerfG das in Ansehung von Art. 6 GG „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates“ so mitmachen wird, wenn ein nichtdeutscher Vater sich um seine Familie kümmert, bleibt abzuwarten! Die vom Verfassungsgesetzgeber im GG getroffenen Regelungen müssen immer neu ernstgenommen, interpretiert und oft auch fortentwickelt werden. U.a. das ist die Aufgabe des hierzu berufenen BVerfGs als "Wächter des Grundgesetzes". Die Hamburger Ausländerbehörde, das Verwaltungs- und das jeweils zuständig gewesene Oberverwaltungsgericht hatten den Wortlaut des Art. 6 GG "Ehe und Familie" wohl als Pleonasmus oder Tautologie, als eine Bezeichnung derselben Sache durch zwei (oder mehrere) gleichbedeutende Ausdrücke, angesehen. Vielleicht kam hier (in der Rechtssoziologie oft untersuchtes) schichtspezifisches Denken der Richter zum Tragen. In ihrer Sozialschicht sind "Ehe" und "Familie" wohl überwiegend deckungsgleich. Das BVerfG sah - und sieht - vermutlich jedes Wort einzeln und erkannte damit einen Unterschied zwischen "Ehe" und "Familie". „Asyl-Urteil: Familie darf getrennt sein ap Karlsruhe – Angehörige einer Familie, die in verschiedenen europäischen Ländern Asyl beantragen, haben keinen Anspruch auf Zusammenleben während der Dauer des Verfahrens. Das Bundesverfassungsgericht entschied, eine solche zeitweilige Trennung verstoße nicht gegen den Schutz von Ehe und Familie (2 BvR 99/97).“ (HH A 13.08.98) 2 »Gesetz« und »Recht« Nachdem wir uns eine schwache Ahnung dazu erarbeitet haben, was das Grundgesetz für unser Leben in der Bundesrepublik bedeutet, wie es - teilweise von uns völlig unbemerkt (z.B. beim „angemessenen“ Länderfinanzausgleich gemäß Art. 107 II GG mit seinen Transfer-Zahlungen von den reichen und reicheren an die ärmeren, armen und ärmsten (LCD-)37Bundesländer zur Sicherung deren nackter Existenz, zur Herstellung annähernd gleicher Lebenschancen in ganz Deutschland oder zur Umgestaltung der Länderstruktur) - unsere Lebenswirklichkeit beeinflusst, wollen wir uns nun wieder unserer ganz zu Anfang aufgeworfenen Eingangsfrage zuwenden: Was ist »Recht«, was »Gesetz« - zunächst einmal ruhig auch nur in einem vorjuristischen Verständnis? Sind diese Begriffe deckungsgleich oder sinnlos verdoppelnde Redeweisen wie z.B. "runder Kreis" oder "schwarzer Rabe"? Sind diese beiden zentralen Begriffe des Rechtslebens neben- oder gegeneinandergestellt? Was sagt das Grundgesetz in Art. 20 III über "Gesetz und Recht"? Wie ist diese Formulierung zu verstehen oder zu interpretieren? Artikel 20 GG wird wegen der darin getroffenen Regelungen bezüglich der tragenden Grundsätze unseres Staatsaufbaus auch als »Verfassung in Kurzform« bezeichnet. Er steht in dem Abschnitt "II. Der Bund und die Länder". Der darin geregelte Absatz 3 lautet: "Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden." »Gesetz« und »Recht« Leider nimmt die vollziehende Gewalt, die Verwaltung oder "Exekutive", mit der der Bürger es vorrangig zu tun 37 Damit Sie sich nicht über diese eigenmächtige Wortbildung wundern: Ich greife den von der UNO für die ärmsten der Entwicklungsländer verwendeten Begriff der „LCDs“ (Least developed countries) auf. 163 hat, das Grundgesetz und die anderen Gesetze selbst trotz eindeutigen Gesetzeswortlauts nicht immer ernst genug - und einer ihrer obersten Repräsentanten, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, stellte sogar sein (angebliches) „Ehren“-Wort über Gesetz und Recht. (Kritisch wurde dazu von dem Finanzier des ersten Parteispenden-Skandals, dem ehemaligen Flick-Manager von Brauchitsch, angemerkt: Es kann keine »Ehre« geben, die über rechtmäßigen Gesetzen und dem Recht steht.) Die Verwaltung interpretiert die ihr grundgesetzlich auferlegte Gesetzesbindung leider zu oft so, dass ihr die zuständigen Gerichte auf die Finger sehen und oft auch hauen müssen. Das kann an leider zu vielen Beispielen belegt werden. Um die dem Bürger wegen ihrer Machtmittel mindestens anfangs überlegene Verwaltung zu zügeln und notfalls in die Schranken zu verweisen, wurde ein eigener Gerichtszweig geschaffen: die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wenn ihre Gerichte in einer Entscheidung die Grundrechte verkennen, muss das BVerfG Nachhilfeunterricht erteilen. Weil uns der in Art. 4 GG geregelte Bereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit – „Jeder soll nach seiner Facon selig werden können“ (Friedrich II., der Große) - und dessen Auswirkung auf die in Art. 12 a GG geregelte allgemeine Wehrpflicht schwerpunktmäßig später noch näher beschäftigen wird, sei für die eben aufgestellte Behauptung, die Verwaltung nehme die Gesetze nicht immer im gebotenen Umfang ernst, unter der Legion möglicher Fälle ein Beispiel aus diesem Bereich gewählt. Zum besseren Verständnis der Problematik zunächst die Wiedergabe der einschlägigen gesetzlichen Normen. Die Artikel 4 und 12 a GG lauten (auszugsweise): „Art. 4 GG (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz." „Art. 12 a GG (1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. (2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. (3) - (6) ..." Eines der Gesetze, die das Nähere der in Art. 12 a normierten Wehr- und Dienstpflicht regeln, ist - z.B. neben dem Zivildienstgesetz - das Wehrpflichtgesetz (WPflG). Dort sind in den §§ 9 – 13 b WPflG die Wehrdienstausnahmen geregelt. In § 11 WPflG heißt es u.a.: „§ 11 WPflG Befreiung vom Wehrdienst (1) Vom Wehrdienst sind befreit 1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses 2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Subdiakonatsweihe empfangen haben, 3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem eines ordinierten Geistlichen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-katholischen Bekenntnisses, der die Subdiakonatsweihe empfangen hat, entspricht, ..." Bei dieser Gesetzeslage ist man erstaunt, die folgende Zeitungsmeldung zu finden: "Kein Wehr- oder Zivildienst für Prediger der `Zeugen Jehovas' KOBLENZ; 7. Februar (dpa). Prediger der Religionsgemeinschaft `Zeugen Jehovas' müssen weder Wehr- noch Zivildienst leisten. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz in einem jetzt veröffentlichten Grundsatzurteil entschieden. Solche Personen seien hauptamtlich tätigen Geistlichen der römisch-katholischen oder evangelischen Kirche gleichzustellen. Das Gericht gab damit der Klage eines jungen Mannes, der Mitglied der Religionsgemeinschaft ist, gegen die Bundesrepublik statt. Es komme nicht darauf an, befanden die Richter, ob es sich um ein Amt der großen 164 Glaubensgemeinschaften handele. Der Gesetzgeber habe auch Geistliche ‘anderer Bekenntnisse' von Wehr- und Zivildienst freistellen wollen. (Aktenzeichen: 2 K 3953/91.) (FAZ 08.02.93) Aber das steht doch so schon wörtlich in § 11 I Nr. 3 WPflG! Da fragt man sich, warum die wie alle anderen Juristen nach dem deutschen Richtergesetz ausgebildeten Juristen der Verwaltung, die den jungen Mann unbedingt einziehen wollten, selbst bei so eindeutiger Gesetzeslage von den Verwaltungsgerichtsjuristen Nachhilfeunterricht im Lesen, Interpretieren und Ernstnehmen von Gesetzen erhalten müssen. Glaubte die wehrfreudige Verwaltung, die Gesetze ignorieren zu können? Dann muss sie von den Verwaltungsgerichten, soweit sie einen Gesetzesverstoß zu erkennen vermögen, eines Besseren belehrt werden. Und wenn die Verwaltungsgerichte »daneben liegen«, muss das BVerfG Nachhilfeunterricht erteilen - und wenn das BVerfG falsch entschieden hat, muss man das hinnehmen. "Rien ne va plus!" Aus ähnlicher gedanklicher Tradition des begründeten Misstrauens der mächtigen Exekutive gegenüber merkte der damals noch nur designierte amerikanische Präsident und Rechtsdozent Clinton anlässlich der von seinem Vorgänger Bush in letzter Minute ausgesprochenen fragwürdigen weil die Aufklärung der Hintergründe verdunkelnden Begnadigung des ehemaligen Verteidigungsministers Weinberger wegen dessen Verstrickung in die "Iran-Contra-Affäre" (und vor seiner nach seiner Interpretation der Buchstaben des Gesetzes angeblich nichtsexuellen Beziehung zu der weltberühmtesten Praktikantin) kritisch an: "Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, die Regierung stehe über dem Gesetz!" Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber nicht jeder Regierungschef sieht das so: „Ein Mann über dem Gesetz? Silvio Berlusconi - Italiens Regierungschef ist Multimilliardär und wegen Bestechung angeklagt. Nun will er die Verfassung ändern. ... Die italienische Justiz glaubt nachweisen zu können, dass Ministerpräsident Silvio Berlusconi ein skrupelloser Verbrecher ist, der zusammen mit seinem bereits verurteilten Staatssekretär und ehemaligen Verteidigungsminister Cesare Prevetti Italien schwer geschadet hat. ... Der Multimilliardär verlangt sogar eine radikale Verfassungsänderung zu seinen Gunsten. ... Italien fragt sich: Steht Silvio Berlusconi über dem Gesetz? ... Das Mailänder Gericht glaubt aber, dass Berlusconi nicht nur einmal, sondern mehrfach einen Richter erfolgreich bestach. ... Prevetti wurde dafür vor einer Woche zu acht Jahren Haft in erster Instanz verurteilt. ... Mit allen Mitteln will Silvio Berlusconi verhindern, dass der Prozess gegen ihn weitergeführt werden kann. Er hat bereits mehrere Gesetze durch das Parlament gepaukt, die die Kompetenzen der Gerichte betrafen und ihm erhebliche Vorteile als Angeklagtem verschaffen. Seine Mindestforderung besteht darin, dass die Verfassung dergestalt geändert werden muss, dass gegen die fünf obersten Repräsentanten Italiens [während ihrer Amtszeit; der Autor] keine Strafverfahren angestrengt werden dürfen. Er will auch noch Staatspräsident werden.“ (HH A 07.05.03) Das Verfassungsgericht erklärte das von Berlusconis Parlamentsmehrheit beschlossene Immunitätsgesetz anschließend aber für verfassungswidrig, sodass die Ermittlungen bis zur Anklageerhebung weitergeführt werden konnten. Und der amerikanische Präsident Bush jun. zeigt durch die von ihm vorgenommene »Guantanamoisierung« des Rechts, dass er ähnlich denkt. Ein solcher Satz, es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, die Regierung stehe über dem Gesetz, kann aber nur für ein demokratisch organisiertes politisches System gelten, das sich den Normen der Menschenrechte grundsätzlich - verpflichtet weiß, denn in Diktaturen erlässt die jeweilige Regierung die ihr gerade ins Konzept passenden Gesetze. Die bewusst vorgenommene Einschränkung „grundsätzlich“ bezieht sich darauf, dass die USA mit der bei ihnen in immer noch 38 Staaten mit Inbrunst zelebrierten Todesstrafe permanent gegen Artikel 3 der Konvention der Menschenrechte verstoßen: „Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ 165 2.1 »Gesetz« und »Recht« in Art. 20 III GG „Gesetz« und »Recht« in Art. 20 III GG Doch wieder zurück zu unserem Eingangsproblem, das wir bisher in seiner Problematik zu erahnen, abzugrenzen und immer weiter einzukreisen versuchten: Was ist unter „Recht«, was unter »Gesetz« zu verstehen? Wir haben die einzige Verfassung der Welt, in der die Begriffe »Gesetz« und »Recht« als zwei verschiedene Fixpunkte verwendet werden. Es handelt sich bei der Begriffsbildung "Gesetz und Recht" nicht um eine sinnlos verdoppelnde Redeweise (Tautologie oder Pleonasmus) wie z.B. bei »alter Greis«. Die vier Mütter und einundsechzig Väter des Grundgesetzes wollten nach den in der Zeit des NS-Terrors gesammelten Erfahrungen mit dem von den Nazi-Richtern ausgeübten Justizterror durch die Formulierung „Gesetz und Recht“ z.B. den Richtern ermöglichen, notfalls gegen ein verfassungswidriges Gesetz »das Recht« zur Geltung zu bringen. Die Verfassung selbst macht es den Richtern zur Pflicht, notfalls ein Gesetz zu Gunsten dessen, was sie als »Recht« ansehen oder diffus fühlen - und das kann sehr subjektiv(!) sein -, beiseite zu schieben. In solchen Situationen gilt in dem Verhältnis von Gesetz und Recht das Wort von Hannah Arendt: „Keiner hat das Recht zu gehorchen.“ In die Alltagssprache übersetzt, kann diese Grundidee des Spannungsverhältnisses zwischen Recht und Gesetz zunächst an einem Beispiel außerhalb der staatlichen Gerichtsbarkeit deutlich gemacht werden: In jedem Wettkampfsport gelten Regeln, um größtmögliche Fairness und Chancengleichheit zu gewährleisten: Der zum Zeitpunkt des Wettstreits objektiv Bessere oder Glücklichere möge gewinnen und nicht die helfende Spritze oder Medizin eines Arztes oder ein objektiver Platzvorteil für eine Seite, wie nur den Gegner oder die gegnerische Mannschaft blendende Sonne oder eine widrige Windrichtung, und was es an sonstigen Widrigkeiten gibt. Darum ist z.B. bei auf einem Spielfeld im Freien ausgetragenen Ballwettkämpfen nach einem bestimmten Zeitablauf die jeweilige Spielfeldseite zu wechseln. Verstöße gegen die vorher feststehenden Regeln werden geahndet. Anders ist Wettkampf nicht möglich. Über die Einhaltung der Regeln, auf deren jederzeitige Geltung sich jeder Wettkampfteilnehmer verlassen können muss, wacht ein Schieds-Richter, notfalls mit sofort zu ergreifenden Sanktionen. Er darf keine Binde vor den Augen tragen, wie Justitia! Es ist noch niemand auf die Idee gekommen, das Symbol eines Schiedsrichters mit Augenbinde darzustellen. Es gilt das Gegenteil! Darum gibt es ja Witze wie den: Nach einem verpfiffenen Spiel, nach dessen Ende der Schiri von Ordnern der gastgebenden Mannschaft zum Schutz gegen »Fan«-Ausschreitungen vom Platz in seine Kabine geleitet werden muss, versucht ein enttäuschter Fan, dem Schiedsrichter wenn nicht tätlich, so doch verbal einen beizupulen: „Wie heißt denn ihr Hund?“, schreit er dem an ihm vorbeigeführten Schiedsrichter zu. Der antwortet perplex: „Ich besitze gar keinen Hund.“ Woraufhin der Fan ätzt: „Ach Gott, wie traurig: So blind, und dann keinen Blindenhund!“ Zur Vermeidung von verleumderischen Nachreden von Prozessverlierern mit zynischen Einsprengseln wie mir sei es hervorgehoben: Aus dem gleichen Grund gelten auch im Bereich der Justiz streng zu beachtende Regeln. Justitia trägt ihre Augenbinde auch nur in Bezug auf die vor ihr stehenden Personen. Sie hat – allein „dem Recht“ und dem Gesetz verpflichtet - ohne Ansehen einer Person zu urteilen. Sie soll aber sehr wohl in genauester Ansehung des Sachverhaltes urteilen, das bedeutet: ohne Augenbinde. Denn es ist ja ihre Aufgabe, nach akkurater bis akribischer Sachaufklärung im Rahmen ihrer (sehr oft eingeschränkten) Erkenntnismöglichkeiten Rechtsfrieden durch Verwirklichung von Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Dazu bedient sie sich der Hilfe von (durchaus fehlbaren!) Richtern; so kommen Fehlurteile zustande. In diesem Ziel der Herstellung von Rechtsfrieden durch Verwirklichung von Einzelfallgerechtigkeit ähneln sich alle Richterämter. Ein Richter hat Streitfälle zu schlichten und nicht nur im Strafrecht, aber insbesondere dort den Rechtsfrieden in einer Gesellschaft wiederherzustellen. Immer dann, wenn sich ein Mensch in Deutschland durch die Staatsgewalt oder durch einen Mitmenschen in seinen Rechten verletzt glaubt, muss der Richter den Sachverhalt unvoreingenommen klären, eine drohende Rechtsverletzung abwehren oder eine bereits eingetretene Verletzung durch Ausgleichsmaßnahmen kompensieren. Als Strafrichter hat er über die Einhaltung der Mindestnormen für ein gedeihliches Zusammenleben zu wachen. Richter gibt es nicht nur im staatlichen Bereich, sondern auch im privaten. Am bekanntesten ist da insbesondere die von den Sportverbänden in Eigenregie wahrgenommene Sportgerichtsbarkeit: Nach Abschluss eines Spiels kann eventuell ein nachträglich einzuberufendes Gremium über die Rechtmäßigkeit eines Schiedsrichter-Urteils befinden: ein von den ordentlichen Gerichten unabhängiges Verbandssportgericht, das nach einem formell eingelegten Protest des sich benachteiligt Wähnenden eine Schiedsrichterentscheidung überprüft. So hatten z.B. zwei der renommiertesten deutschen Fußball-Bundesligatrainer im Eifer eines laufenden Gefechtes mehr als die pro Spiel erlaubten drei eu-ausländischen Fußballer in ihrer Mannschaft eingesetzt. Sie sahen nur ihre Spieler 166 mit deren Möglichkeiten, das Spiel ihrer Mannschaft durch u.a. öffnende Pässe druckvoller zu gestalten, vergaßen aber leider deren staatliche Pässe. Obwohl sie nicht unfair gewesen waren und ihre Mannschaft nicht zeitweise mit zwölf Spielern gespielt hatte – was auch schon vorgekommen ist -, wurde beide mir bekannte Male das siegreiche Spiel wegen des Verstoßes gegen die Regel bezüglich der Zulässigkeit des Höchsteinsatzes von eu-ausländischen Spielern nachträglich als verloren gewertet. So stringent werden die »Fußballgesetze« gehandhabt. Nun passierte es in einem Spiel der obersten italienischen Fußballliga, dass der zwar haar-, aber nicht hirn- und schon gar nicht augenlose italienische Star-Schiedsrichter Pierluigi Collina, der als weltbester Fußballschiedsrichter gilt, nach der Pause des Spiels Foggia gegen Bari Ungleichheit anordnete, nicht die Seiten wechseln ließ und damit gegen die auf Herstellung der Gleichheit der Wettkampfbedingungen und damit auf Gerechtigkeit abzielende an sich eherne Grundregel des Seitentausches bewusst verstieß: Er wollte so verhindern, dass der Torwart von Bari in das Tor musste, hinter dem Hooligans ihn mit Wurfgeschossen attackieren wollten. Die Fifa akzeptierte die ungewöhnliche Maßnahme, obwohl sie eindeutig gegen die Statuten verstößt, die in dieser Hinsicht keinen Ermessensspielraum eröffnen! Der die an sich zwingenden Fußballregeln in dieser Ausnahmesituation mit viel Zivilcourage übergehende Schiedsrichter und anschließend die Berufungsrichter des Sportgerichts sahen in diesem Ausnahmefall das Gesetz nicht als „eiserne Jungfrau“ an, die es der Idee nach grundsätzlich zu sein hat - und wie es leider im Tatsächlichen manchmal auch zum Nachteil des Rechts so angewandt wird. »Das Gesetz« sollte keine »das Recht« folternde eiserne Jungfrau sein, »das Recht« jedoch sollte immer Ungerechtigkeit »foltern«! Der Intention des Art. 20 III GG nach sollten dem Recht entgegenstehende rechtswidrige oder im Einzelfall das Recht konterkarierende Gesetze notfalls außer Acht gelassen werden können; »das Recht« jedoch sollte nie zu Unrecht umgeschmiedet werden. Die Verfassung selbst macht es den Richtern zur Pflicht, notfalls ein Gesetz zu Gunsten dessen, was sie als »Recht« ansehen oder diffus fühlen - und das kann sehr subjektiv(!) sein -, beiseite zu schieben. Das im Einzelfall richtig zu entscheiden, bedarf eines sicheren Instinkts, manchmal eines nicht unerheblichen Maßes an Zivilcourage, auf jeden Fall eines großen Fingerspitzengefühls! „Keine Haftstrafe für gestohlene Milchschnitte Köln – Der Diebstahl einer Milchschnitte darf keine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Ein solches Urteil ist nicht verhältnismäßig und damit rechtswidrig. Mit dieser Begründung hob das Oberlandesgericht Stuttgart eine Entscheidung des Landgerichts Ravensburg auf, das einen vorbestraften Dieb zu einem Monat Gefängnis verurteilte, weil er eine im Laden verzehrte 26-Cent Milchschnitte nicht bezahlt hatte. Die Stuttgarter Richter: ’Weder der Gedanke, weiteren Straftaten vorzubeugen noch die Verteidigung des Rechtsstaates rechtfertigen eine so harte Strafe (Az.: Ss 138/02). (ddp)“ (HH A 09.11.02) Die Richter des Landgerichts hatten nach den Buchstaben des Gesetzes entschieden und diese Entscheidung auf ihr Gewissen genommen, die Revisionsrichter des OLG sahen „das Recht“, wie sie es subjektiv empfanden, als verletzt an. Um auf die Subjektivität des Rechtsempfindens eindrücklich hinzuweisen, sei daran erinnert, dass in einigen Staaten der USA die gesetzliche Regelung besteht, dass jemand bei einer seiner zweiten Verurteilung in gleicher Sache die doppelte Strafe zudiktiert erhält, bei einer dritten Verurteilung lebenslang eingekerkert wird, gleichgültig, wie relativ unbedeutend der dritte Regelverstoß auch ist und ob er mit den vorher begangenen Straftaten in einer inneren Beziehung steht: Wer sich Vorverurteilungen nicht zur Warnung dienen lasse, habe in letzter Konsequenz die volle Härte des Gesetzes zu tragen: „Three strikes, and you’re out!“ Das lebenslange Ausgeschlossensein aus der Gesellschaft wird in alttestamentarischer Strenge von Richtern als das auch von ihnen so empfundene »Recht« verkündet! Hinter einer solchen Sicht der Beziehung zwischen Recht und Gesetz, wie sie in Art. 20 III GG formuliert ist und vom Oberlandesgericht Stuttgart vorbildlich entschieden wurde, leuchtet ein bisschen die (auch germanische) Auffassung vom Recht als einer übernatürlichen Wertordnung durch, die der Verfügungsgewalt der momentan gerade herrschenden irdischen Machthaber entzogen ist, da sie in Gott oder den Göttern gründet. So wird sie auch in Schillers „Wilhelm Tell“ den nächtens auf dem Rütli versammelten Eidgenossen in den Mund gelegt, wenn es dort heißt, dass sie gegen den Statthalter des Tyrannen das „ewige Recht von den Sternen holen“ wollen. So verstanden sind Gesetz und Recht durchaus nicht deckungsgleich. Sie stehen aber in einer Beziehung »sui generis« (»eigener Art«), in der das als unverrückbar angesehene, letztlich nicht manipulierbar geglaubte »Recht« mehr an gute alte Vätersitte, an (oftmals auf religiösen Überzeugungen fußende) Moral, als an das von Menschen möglicherweise zu Missbrauchszwecken degenerierbare »Gesetz« grenzt. 167 Damit aber nicht einer Richterwillkür Tür und Tor geöffnet werde, ist in unserem Verfassungsstaat für den Normalfall eines von einem Richter so gewerteten Auseinanderklaffens von Recht und Gesetz ein besonderes Überprüfungsverfahren vorgesehen. Wie an einem Fall des Ehenamensrechts schon deutlich geworden war, können Richter in einem sogenannten "konkreten Normenkontrollverfahren" gemäß Art. 100 I GG ein von ihnen beanstandetes Gesetz durch die Richter des BVerfGs als die dazu bestellten "obersten Hüter der Verfassung" überprüfen und eventuell aufheben lassen. 2.2 »Gesetz«, »Recht« und »Gerechtigkeit« „Gesetz«, »Recht« und "Gerechtig keit" Doch was ist nun - zunächst einmal ganz unjuristisch - „Gesetz«, was »Recht« und, als weitere Frage ergibt sich dann daraus, was »Gerechtigkeit«? Als 1992 wieder, wie 1963 und 1968, amerikanische Städte brannten, weil in einem Akt von Rassenjustiz eine im angelsächsischen Recht zur Urteilsfindung vorgesehene zwölfköpfige Jury in - bis auf eine Latino-Frau ausschließlich weißer Besetzung in Los Angeles vier weiße Polizisten vom Vorwurf der "Polizeibrutalität" wegen eines Angriffs mit einer gefährlichen Waffe sowie unverhältnismäßiger Anwendung körperlicher Gewalt (entspricht unserer gefährlichen Körperverletzung im Amt) freisprach, die nach vorliegenden, unbestreitbar beweiskräftigen Filmaufnahmen gemeinsam einen einzelnen schwarzhäutigen, nach einer Verfolgungsjagd überwältigten und nun am Boden liegenden US-Amerikaner zusammengeschlagen hatten (der sich, so behaupteten die vier Polizisten, - aus welchen Gründen auch immer - seiner Festnahme widersetzt haben soll), zogen demonstrierende Farbige mit u.a. der auf Pappen gemalten Losung durch die Straßen: "No justice - no peace!" Solche Skandalurteile haben in den USA Tradition, und man wagt in Ansehung solcher Urteile nicht von einem Rechtsstaat zu sprechen: „US-JUSTIZ Lynchmord kommt nach 50 Jahren vor Gericht Von Roman Heflik Der Junge hatte etwas getan, was man nicht tun durfte. Zumindest nicht als Schwarzer: Er hatte einer weißen Frau hinterhergepfiffen. Der Junge wurde gelyncht. Seine Mörder wurden freigesprochen. Doch jetzt rollen FBI und Staatsanwälte das Verbrechen an Emmett Till wieder auf. Die Männer kamen in der Nacht. Sie kamen, um sich zu rächen. Um diesem Schwarzen eine Lektion zu erteilen. Um ihn zu töten. Es war der August des Jahres 1955. Ihr Opfer hieß Emmett Till, ein 14-jähriger Junge. Till war aus dem fernen Chicago nach Money, Mississippi, angereist, um seinen Onkel und dessen Familie zu besuchen. Dass hier im tiefen Süden der USA noch andere Gesetze herrschten, dass hier Schwarze vielerorts noch als vogelfreie SklavenNachfahren betrachtet wurden, wusste der Besucher nicht. Was für Konsequenzen es in dieser Gegend haben konnte, aus der Rolle des demütigen Schwarzen zu fallen, davon hatte der Junge keine Vorstellung. Und so hatte sich Emmett Till an diesem Tag wie immer verhalten, so, wie es viele Halbwüchsige seiner Heimatstadt und seines Alters eben taten: fröhlich und ein bisschen respektlos. Als er zum Einkaufen den Laden der Bryants betrat, stieß er beim Anblick der attraktiven weißen Ladeninhaberin, Mistress Bryant, einen bewundernden Pfiff aus. Bryants Ehemann Roy schäumte vor Wut. Till hatte einen jahrhundertealten Verhaltenskodex gebrochen. Vermutlich in der darauf folgenden Nacht drang Roy Bryant zusammen mit seinem Halbbruder J.W. Millam in das Haus der Familie Till ein und schleppten Emmett aus seinem Bett. Draußen schlugen die Männer solange auf den Jungen ein, bis sein Gesicht nur noch ein blutiger Klumpen war. Als die Leiche drei Tage später gefunden wurde, glaubten viele, der Junge habe einen Schuss mit einer Schrotflinte ins Gesicht bekommen. Später berichtete Millam, er habe dem Jungen mit einer Pistole in den Kopf geschossen. In ihrem Blutrausch wickelten die Männer dem sterbenden Kind Stacheldraht um den Hals, befestigten ein Metallgewicht daran und warfen das blutende Bündel in den Tallahatchie River. Drei Tage später fanden Fischer den verstümmelten Körper. Die beiden Täter wurden zwar von der Polizei verhaftet; ihnen wurde der Prozess gemacht. Doch bereits während der Verhandlung wurde deutlich, dass der Fall die weißen Zuschauer und den 168 weißen Richter eher amüsierte: Im Zuschauerraum wurde geplaudert und gelacht, auf den für die Weißen bestimmten Plätzen wurden wahre Picknicks veranstaltet. Nach fünf Verhandlungstagen und einstündiger Urteilsberatung kam die rein weiße, männliche Jury zu einem Urteil: unschuldig in beiden Fällen. Dabei hatten die Verteidiger der beiden Mörder die Tat gar nicht abgestritten. Sie hatten erklärt, der Schwarze sei noch nicht tot gewesen, als die Angeklagten ihn in den Fluss geworfen hätten. Grinsend verließen Bryant und Millam das Justizgebäude als freie Männer. Das offensichtliche Versagen der Justiz, selbst grausamste Verbrechen an Schwarzen zu ahnden, löste massive Proteste im Süden der USA aus. So wird der Prozess um Emmett Till oft als die eigentliche Geburtsstunde der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung bezeichnet, die sich für die Gleichberechtigung der afroamerikanischen Bevölkerung einsetzte. Drei Monate nach dem Mord machte die Schwarze Rosa Parks Schlagzeilen, als sie sich weigerte, von ihrem für Weiße reservierten Bus-Sitz aufzustehen. Trotz mehrerer Anträge von Tills Mutter sah das US-Justizministerium jahrelang keinen Grund, den Fall oder das Verfahren zu überprüfen. Nach dem Urteilsspruch galten die beiden Halbbrüder als unschuldig und konnten nach dem Gesetz von Mississippi nicht mehr belangt werden - selbst, als Millam sich nach der Verhandlung vor einem Reporter mit seiner Tat brüstete. "Chicago-Boy", habe er dem Kind gesagt, "ich werde an dir ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wo ich und meine Leute stehen." Nun wird die Akte Emmett Till wieder geöffnet - nach fast fünfzig Jahren. Anlass waren Aussagen des Dokumentarfilmers Keith Beauchamp, er habe Hinweise auf weitere Tatbeteiligte. Bei der Recherche für seinen Film "Die nicht erzählte Geschichte von Emmett Louis Till" habe er zahlreiche Augenzeugen befragt. Von ihnen habe er erfahren, dass sich in jener Augustnacht noch sieben andere Männer an der Tat beteiligt hätten. Einige von ihnen sind immer noch am Leben. Daher müsse das Verfahren neu eröffnet werden. Unterstützt wurde Beauchamp bei dieser Forderung von dem Senator Charles Schumer und dem Kongressabgeordneten Charles Rangel aus New York - mit Erfolg. Am Montag gab das Justizministerium bekannt, FBI-Agenten und Bundesanwälte würden in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ermittlungsbehörden den Fall neu untersuchen. "Wir schulden es Emmett Till und uns selbst, zu sehen, ob nach all den Jahren zusätzliche Justizmaßnahmen möglich sind", verkündete Alexander Costa, Staatsanwalt der Bürgerrechtsabteilung des Justizministeriums. Die Behörden von Mississippi sind darum bemüht, die Scharte von damals wieder auszuwetzen: "Wir freuen uns, dass dieser ewige Alptraum dank der Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden untersucht werden kann", antworte Joyce Chiles, zuständiger Staatsanwalt des Bezirks Mississippi, auf die Anfrage aus Washington. Diese Kooperation war es, die die Strafverfolgung überhaupt erst möglich gemacht hat: Denn nach US-Bundesrecht sind die Taten längst verjährt - nicht jedoch nach den Gesetzen des Staates Mississippi. Anders als ihre mutmaßlichen Kumpane müssen die beiden Haupttäter indessen keine Strafe mehr fürchten: Millam starb 1980, sein Halbbruder Roy zehn Jahre später.“ (SPIEGEL online 2004) Die rund 12 % Afro-Amerikaner fühlen sich auf ihrem mühsam-langen Weg von der Sklaverei zur Gleichberechtigung in ihrem Verlangen nach gerichtlicher und sozialer Gerechtigkeit nicht nur überwiegend als Bürger zweiter Klasse, sie waren es auch - und sind es immer noch. Für die farbigen Amerikaner war die Lehre aus dem Skandalurteil, dem eine lange Reihe ähnlicher Unrechtsurteile vorausgegangen (und leider auch nachgefolgt) ist: Polizeibrutalität ist rechtlich nicht verfolgbar, ist nach Meinung der Jury "angemessene Härte", wenn sie gegen Farbige gerichtet ist. Dieses über Jahrhunderte entstandene Unrechts-Erfahrungswissen der farbigen US-Amerikaner brachte den satirischen Spötter Oscar Wilde in Anlehnung an die klassische Demokratie-Definition seines großen Präsidenten Lincoln in dessen berühmter Gettysburger Rede („Gettysburger Address“), Demokratie sei die „Regierung über das Volk durch das Volk für das Volk“ („Government of the people by the people for the people“), zu der bitterbösen Abwandlung: „Demokratie ist nichts anderes als das Niederknüppeln des Volkes durch das Volk für das Volk.“ Wenn es stimmt, dass Demokratie idealtypisch als „politische Form der Menschlichkeit“ (Tomas G. Masaryk) definiert werden kann, dann sind die USA wahrlich nicht das, worauf die US-Amerikaner (dann zu Unrecht) so stolz sind: eine Demokratie. Die farbigen US-Amerikaner fordern zu Recht »Gerechtigkeit«, sowohl vor den Schranken der Gerichte, und das bedeutet die Gleichheit aller vor dem Gesetz ohne Unterschied der Hautfarbe, wie auch - zur Lösung des dem 169 allen zugrunde liegenden wirtschaftlich-sozialen Konflikts - bei der Ausgestaltung der sie bisher grob benachteiligenden Lebensverhältnisse: Schwarze haben in den USA die vergleichsweise schlechtesten Schulabschlüsse. Sie erhalten auch eine schlechtere Berufsausbildung und verdienen weniger - wenn sie überhaupt einen Arbeitsplatz finden; von einem angemessenen ganz zu schweigen. Die meisten Schwarzen erreichen noch nicht einmal das unterste Lohnniveau der Weißen, und jeder zweite unter 30 ist noch nicht einmal »auf dem Arbeitsmarkt«. Die Zahl der Schwarzen, die unter der Armutsgrenze leben, ist prozentual dreimal so hoch wie die der Weißen. Sie haben die kürzeste Lebenserwartung. Für einen Schwarzen im New Yorker Stadtteil Harlem liegt sie bei 46 Jahren. "Keine andere Gruppe", sagte der Historiker Roger Wilkins, "hat unter dem Habgier-Boom der 80er Jahre so gelitten, und die Zukunft sieht noch wesentlich düsterer aus." Die US-Amerikaner haben die Lehre ihres großen Präsidenten Abraham Lincoln vergessen oder verdrängt, der erkannt hatte, dass Ungerechtigkeit der eigentliche Sprengstoff einer Gesellschaft ist und darum formuliert hatte: "Nichts ist dauerhaft geregelt, was nicht gerecht geregelt ist." Danach ist »Gerechtigkeit« das Recht der Schwächeren auf nicht nur lebenserhaltende, sondern auch gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Möglichkeiten. „Ein Mensch fühlt oft sich wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt“ (Eugen Roth). Man kann mit seinen Begründern, ja man sollte die Idee des Kommunismus als Versuch einer Antwort auf die ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit seiner Entstehung im 19. Jahrhundert sehen – und den Untergang der kommunistischen Systeme im 20. Jahrhundert als Folge der durch den historischen Materialismus als Staatsdoktrin neu geschaffenen gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten: „Gerechtigkeit ist das Brot des Volkes“ hieß es denn auch auf Spruchbändern in Leipzig, als die Ostdeutschen ihr kommunistisches System in den Orkus der Geschichte verbannten. Diese Sicht von »Gerechtigkeit« deckt sich mit der des griechischen Philosophen Heraklit (ca. 540 - 480 v.Chr.), der glaubte und lehrte, dass (nur) eine “kosmische Gerechtigkeit“ in der Welt ein Gleichgewicht aufrecht erhalte. Für Platon (427 - 347 v.Chr.) war »Gerechtigkeit« die Kardinaltugend, die alle anderen Tugenden verband; der (Sklaven-)Staat (der attischen »Demokratie« seiner Zeit) wurde von ihm als Verkörperung der Idee der Gerechtigkeit angesehen. Für seinen Schüler Aristoteles (384 - 322 v.Chr.) war die »Gerechtigkeit« keine subjektive Tugend, sondern das objektiv zu sehende Leitprinzip des Rechts. Er formulierte die Erkenntnis, dass das für eine politische Gemeinschaft geltende »Recht« aus einerseits dem natürlichen und andererseits aus dem „gesetzlichen Recht“ bestehe, und letzteres nach aller Erfahrung auch ungerechte Gesetze beinhalte. Kant sah »Gerechtigkeit« als so zentral an, dass er (ungefähr) formulierte: „Ohne Gerechtigkeit lohnte es nicht, dass Menschen auf Erden leben.“ 2.3 Gesellschaftliche Befriedungsfunktion des Rechts Gesellsch aftliche Befriedun gsfunktio n des Rechts Ohne gerichtliche und gesellschaftliche »Gerechtigkeit« kann das verletzte »Recht« – was auch immer sich hinter diesem Begriff, wenn man ihn näher untersucht, im Einzelnen verbergen mag - nicht der ihm zuvorderst obliegenden gesellschaftlichen Befriedungsfunktion gerecht werden! Das gilt für alle Staaten und darum auch für die Bundesrepublik: "Gerechtigkeit verlangt dpa Bautzen - Die DDR-Justiz hat nach Angaben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesjustizministerium, Reinhard Döhner (CDU), insgesamt etwa 150.000 politisch motivierte Strafurteile gefällt. 60.000 hätten Anträge auf Rehabilitation oder Kassation der Urteile gestellt. Er räumte eine noch zu schleppende Bearbeitung der Anträge ein. Die Opfer verlangten schnellste materielle und moralische Entschädigung. Die Zeit dränge, weil zwei Drittel der Betroffenen bereits über 65 Jahre alt seien."38 (HH A 27.04.91) 38 Avenarius, H.: Kleines Rechtswörterbuch, Freiburg 1991, Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung (Bonn) des Herder-Tachenbuches Bd. 1733, Stichwort "Rehabilitierung": "In Art. 17 des Einigungsvertrages haben die Vertragsparteien ihre Absicht bekräftigt, daß unverzüglich eine gesetzliche 170 In diesem Zusammenhang stellten sich einige Fragen, z.B.: Warum soll die Bundesrepublik die Entschädigungsleistungen aufbringen, und nicht die SED-Nachfolgerin PDS mit allem übernommenen und dem zum Teil rausgeschmuggelten oder an frühere Parteimitglieder verschobenen milliardenschweren Parteivermögen der früheren Staatspartei an Immobilien, Firmenbesitz, anderen Geldanlagen und Bargeld - so man die verschobenen Vermögenswerte finden konnte. Und wenn die Bundesrepublik, der dieses staatliche Fehlverhalten der SED-geführten DDR wirklich nicht angelastet werden kann, großzügigerweise eine Entschädigung für das von ihr nicht zu verantwortende Unrecht – die BRD ist nicht die Rechtsnachfolgerin der DDR, wie sie sich als Nachfolgerin des mit den Nazis untergegangenen Deutschen Reiches verstand und darum Entschädigungsleistungen an verschiedene Staaten, insbesondere an Israel zahlte, die ostdeutschen Länder sind der BRD »nur« beigetreten - zu zahlen bereit ist: Wie viel an Ausgleichszahlung wäre angemessen und gerecht? Wie viel davon ist bei der angespannten Haushaltslage – nur(?) - bezahlbar? Kant sah es als Aufgabe der durch »das Recht« gebildeten Rechtsordnung in einer bürgerlichen Gesellschaft an, dass sie dem einzelnen Staatsbürger ein Höchstmaß an - nur durch die Rechte der Anderen begrenzter - Freiheit bescheren solle. Die Garantie dieser Freiheit und ihr Schutz vor Missbrauch sei der Sinn der Rechtsordnung. »Das Recht« habe im gesellschaftlichen Zusammenleben die Funktion der öffentlichen Moral zu übernehmen. Die gesellschaftliche Befriedungsfunktion durch »das Recht«, die auf seiner Allgemeinverbindlichkeit gegenüber jedermann und seiner - ausschließlich durch das Gewaltmonopol des Staates gewährleisteten - Erzwingbarkeit fußt, tritt nur ein, wenn das Recht sowohl den in seinen gesellschaftlichen Möglichkeiten Schwächeren schützt als auch die Staatsmacht begrenzt. Die Geltung des Rechts verhindert einen durch den gerade gesellschaftlich (eventuell auch nur partiell) Stärkeren im Eigeninteresse vorgenommenen Rechtsraub! Ein Rechtsstaat bändigt die natürliche Macht des Stärkeren durch Gesetze: sei es die eines Einzelnen oder die des Staates. In einem Rechtsstaat gibt es keine legitime außergesetzliche Gewalt: kein Faustrecht für Einzelne, wie z.B. durch Warlords in Afghanistan, Somalia, Uganda und vielen anderen Bürgerkriegsstaaten Afrikas, oder nichtstaatliche miteinander verfeindete Stammesgruppen, wie in vielen Staaten Afrikas, und keine Machtusurpation durch staatliche Stellen. Die Überwindung des Faustrechts und die Einführung des durch Gesetze gebändigten Gewaltmonopols des Staates, mit dem durch staatliche Stellen – siehe NS-Staat! - kein Schindluder getrieben werden darf, sind mit die wichtigsten Errungenschaften des modernen liberalen Verfassungsstaates, der Grundlage unserer heutigen Zivilisation. Eigene Maßstäbe mit noch so moralischer Begründung dürfen sich nicht über den Rechtsstaat erheben, so lange er einer ist. Entartet er zu einer Diktatur, stellt sich das Problem des Tyrannenmordes, das der einzelgängerische Kunsttischler Johann Georg Elser ohne Hilfe anderer am 08. November 1939 mit dem ersten aus Gewissensnot auf Hitler verübten Attentatsversuch im Münchner Bürgerbräukeller für sich bejaht hatte. Damit wollte er den von Hitler gerade verbrecherisch vom Zaune gebrochenen Zweiten Weltkrieg beenden. Dafür wurde der Sondergefangene Hitlers am 09.04.1945, einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation Großdeutschlands, im KZ Dachau hingerichtet. Ihm folgten weitere Widerstandskämpfer, von denen z.B. der Leipziger Oberbürgermeister Gördeler durch den geplanten Tyrannenmord ausdrücklich „der Majestät des Rechts zum Durchbruch verhelfen wollte“. Was hier zunächst für die einzelnen Staaten ausgeführt wurde, gilt auch für die Staatengemeinschaft: Die Staatengemeinschaft hat sich in Kapitel VII der UN-Charta darauf geeinigt, dass die vorstehend erläuterten Prinzipien auch für das Verhältnis der Staaten untereinander gelten sollen und ausschließlich die UNO und in ihr Grundlage dafür geschaffen wird, daß alle Personen rehabilitiert werden können, die Opfer einer politisch motivierten Strafverfolgungsmaßnahme oder sonst einer rechtsstaats- und verfassungswidrigen gerichtlichen Entscheidung geworden sind; die R. dieser Opfer des SED-Unrechts-Regimes soll mit einer angemessenen Entschädigungsregelung verbunden werden. ... Nach dem ... Gesetz werden Personen, die wegen einer Handlung strafrechtlich verfolgt wurden, mit der sie verfassungsmäßige politische Grundrechte wahrgenommen haben, rehabilitiert. Die R. bezweckt eine politisch-moralische Genugtuung für den Betroffenen. Sie setzt einen Antrag des Betroffenen oder - nach seinem Tode - der nahen Angehörigen voraus, der bei einem Gericht im Beitrittsgebiet zu stellen ist. ... Das Strafurteil ist aufzuheben, soweit die Voraussetzungen der R. erfüllt sind. Die Rückerstattung oder Rückgabe von Vermögenswerten, die im Zusammenhang mit rechtsstaatswidrigen Strafverfolgungsmaßnahmen dem Betroffenen oder Dritten entzogen worden sind, richtet sich nach dem Vermögensgesetz. Die R. begründet einen Anspruch auf soziale Ausgleichsleistungen; für Art u. Umfang dieser Leistungen gelten sinngemäß die Bestimmungen des Häftlingshilfegesetzes (für die ersten beiden Jahre ungerechtfertigter Strafhaft 80 DM monatlich, danach 270 DM monatlich). Wer durch ein Strafgericht der DDR wegen einer nicht politisch motivierten Straftat rechtsstaatswidrig verurteilt wurde, kann die Aufhebung der Entscheidung im Wege der Kassation beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Entscheidung auf einer schwerwiegenden Verletzung des Gesetzes beruht oder im Strafausspruch gröblich unrichtig ist. ... Vermögensrückerstattung und soziale Ausgleichsleistungen sind für den Fall der Kassation nicht vorgesehen." 171 der Weltsicherheitsrat über das Gewaltmonopol verfügen solle, über die Berechtigung eines Krieges zu entscheiden. Ein Krieg ohne offensichtliche Selbstverteidigungshandlung ist nach dem Völkerrecht ein durch internationale Abkommen geächteter Angriffskrieg, auch wenn er als Präventivkrieg zur Verteidigung gegen eine – angeblich – bestehende Bedrohung des den Krieg führenden Staates ausgegeben wird: Als die USA gegen den Irak ohne ein diesbezügliches Votum des UNO-Sicherheitsrates losschlugen, brachen sie die von ihnen mitgeschaffene internationale Rechtskultur und kehrten zum internationalen Faust»recht« zurück; in diesem Zusammenhang von Recht zu sprechen, ist nur eine euphemistische Bemäntelung des Zwanges durch den Stärkeren – der im Falle der Ermordung tausender muslimischer Albaner durch die katholischen Kroaten und insbesondere durch die orthodoxen Serben vielen Albanern das Leben gerettet hatte, als europäische Mächte unter der Führung der USA ohne UN-Mandat im zerfallenden Jugoslawien einmarschierten, um das Abschlachten der muslimischen Bevölkerung ohne UN-Mandat zu beenden. 2.4 Das »Brett des Karneades« und die Frage nach »Gesetz«, »Recht« und »Gerechtigkeit« Doch zurück zu dem Ausgangsproblem: Was ist »Gesetz«, was »Recht«, und wie stehen diese beiden zentralen Begriffe zu der - woran zu messenden(?) - »Gerechtigkeit«? „Summa ius, summa iniuria!“ („Höchstes Recht bedeutet höchste Ungerechtigkeit“; Cicero), wie die Römer meinten? Dieses Problem wurde von Heinrich von Kleist in seiner bekanntesten Novelle „Michael Kohlhaas“ ausgearbeitet: „Die Welt würde sein Andenken haben segnen müssen, wenn er in seiner Tugend nicht ausgeschweift wäre. Das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder.“ Und wie kommt es zu der negativen Ausprägung von »Gerechtigkeit«, von der Camus schrieb: „Gerechtigkeit ohne Gnade ist nicht viel mehr als Unmenschlichkeit“, so dass von Fridel Marie Kuhlmann die berechtigte Forderung erhoben wurde: „Es darf der Geist der Menschlichkeit im Paragraphen nicht ersticken.“ Das „Brett des Karneades " und die Frage nach »Gesetz«, »Recht« und Gerechtig keit" Das Problembewusstsein zur Beantwortung der Fragen nach »Gesetz«, »Recht« und »Gerechtigkeit« soll zunächst an einer literarischen Vorlage erarbeitet werden, die ein strafjuristisches Problem aufgreift, das seit 2200 Jahren als das „Brett des Karneades" (214 - 129 v.Chr.) durch die Juristenausbildung geistert: Ein Schiffbrüchiger hat sich auf ein Wrackteil gerettet, das - im Gegensatz zu der Planke, auf die Ben Hur den Quintus Arius und sich während der Seeschlacht hochdramatisch rettet - nur einen(!) Menschen zu tragen in der Lage ist. Ein anderer Schiffbrüchiger schwimmt hinzu, stößt, um sich mittels des schwimmenden Holzes selbst retten zu können, den ersteren von dort herunter - wohlwissend, dass er durch diese Handlung den anderen dem sicheren Tod preisgeben werde. (Die Juristen - besonders die Strafjuristen - argumentieren gerne an Extrembeispielen, weil dort die Überlegungen und Abwägungen wie in einem Brennpunkt fokussiert werden.) Die literarische Vorlage, auf deren Grundlage wir das Problem erörtern wollen, stammt von der Dame auf dem letzten deutschen 20-Mark-Schein. Die Vergeltung (Annette von Droste-Hülshoff) Der Kapitän steht an der Spiere, Das Fernrohr in gebräunter Hand, Dem schwarzgelockten Passagiere Hat er den Rücken zugewandt. Nach einem Wolkenstreif in Sinnen Die beiden wie zwei Pfeiler sehn, Der Fremde spricht: "Was braut da drinnen?" "Der Teufel", brummt der Kapitän. Da hebt von morschen Balkens Trümmer Ein Kranker seine feuchte Stirn, Des Äthers Blau, der See Geflimmer, Ach, alles quält sein fiebernd Hirn! Er läßt die Blicke, schwer und düster, Entlängs dem harten Pfühle gehn, Die eingegrabenen Worte liest er: "Batavia. Fünfhundertzehn." Die Wolke steigt, zur Mittagsstunde Das Schiff ächzt auf der Wellen Höhn, Gezisch, Geheul aus wüstem Grunde Die Bohlen weichen mit Gestöhn. 172 "Jesus, Marie! wir sind verloren!" Vom Mast geschleudert der Matros', Ein dumpfer Krach in aller Ohren, Und langsam löst der Bau sich los. Noch liegt der Kranke am Verdecke, Um seinen Balken festgeklemmt, Da kommt die Flut, und eine Strecke Wird er ins wüste Meer geschwemmt. Was nicht geläng der Kräfte Sporne, Das leistet ihm der starre Krampf, Und wie ein Narwal mit dem Horne, Schießt fort er durch der Wellen Dampf. Und immer näher schwankt's heran, Und immer näher treibt die Trümmer, Wie ein verwehtes Möwennest; "Courage!" ruft der kranke Schwimmer, "Mich dünkt, ich sehe Land im West!" Nun rühren sich der Fähren Ende, Er sieht des fremden Auges Blitz, Da plötzlich fühlt er starke Hände, Fühlt wütend sich gezerrt vom Sitz. "Barmherzigkeit! ich kann nicht kämpfen." Er klammert dort, er klemmt sich hier; Ein heisrer Schrei, den Wellen dämpfen, Am Balken schwimmt der Passagier. Wie lange so? - er weiß es nimmer, Dann trifft ein Strahl des Auges Ball, Und langsam schwimmt er mit der Trümmer Auf ödem glitzerndem Kristall. Das Schiff! - die Mannschaft! - sie versanken. Doch nein, dort auf der Wasserbahn, Dort sieht den Passagier er schwanken In einer Kiste morschem Kahn. Dann hat er kräftig sich geschwungen Und schaukelt durch das öde Blau, Er sieht das Land wie Dämmerungen Enttauchen und zergehn in Grau. Noch lange ist er so geschwommen, Umflattert von der Möwe Schrei, Dann hat ein Schiff ihn aufgenommen, Viktoria! nun ist er frei! Armsel'ge Lade! sie wird sinken, Er strengt die heisre Stimme an: "Nur grade! Freund, du drückst zur Linken!" 2. Drei kurze Monde sind verronnen, und die Fregatte liegt am Strand, Wo mittags sich die Robben sonnen, Und Burschen klettern übern Rand, Den Mädchen ist's ein Abenteuer, Es zu erschaun vom fernen Riff, Denn noch zerstört ist nicht geheuer Das gräuliche Korsarenschiff. Und vor der Stadt, da ist ein Waten, Ein Wühlen durch das Kiesgeschrill, Da die verrufenen Piraten Ein jeder sterben sehen will. Aus Strandgebälken, morsch, zertrümmert, Hat man den Galgen, dicht am Meer, In wüster Eile aufgezimmert. Dort dräut er von der Düne her! Welch ein Getümmel an den Schranken! - "Da kommt der Frei - der Hessel jetzt Da bringen sie den schwarzen Franken, Der hat geleugnet bis zuletzt." "Schiffbrüchig sei er hergeschwommen", Höhnt eine Alte, "ei, wie kühn! Doch keiner sprach zu seinem Frommen, Die ganze Bande gegen ihn." Der Passagier, am Galgen stehend, Hohläugig, mit zerbrochnem Mut, Zu jedem Räuber flüstert flehend: "Was tat dir mein unschuldig Blut? Barmherzigkeit! - so muss ich sterben Durch des Gesindels Lügenwort, O, mög die Seele euch verderben!" Da zieht ihn schon der Scherge fort. Er sieht die Menge wogend spalten Er hört das Summen im Gewühl Nun weiß er, dass des Himmels Walten Nur seiner Pfaffen Gaukelspiel! Und als er in des Hohnes Stolze Will starren nach den Ätherhöhn, Da liest er an des Galgens Holze: "Batavia. Fünfhundertzehn." Geschah dem Täter »Gesetz« - wie könnte es lauten? - oder geschah ihm „Recht«; menschliches oder göttliches? Widerfuhr ihm "Gerechtigkeit"? 173 Zur Erörterung dieser Frage brauchen wir aber nicht erst auf das Gedicht "Die Vergeltung" zurückzugreifen. Da genügt auch eine fast alltägliche Zeitungsmeldung, die auch mit dieser Überschrift versehen sein könnte: "Vier Männer vergewaltigten eine Frau - sie hat Aids HA Frankfurt - Sie entführten und vergewaltigten eine 34jährige Frau. Jetzt müssen sie selbst um ihr Leben zittern: Vier bislang unbekannten Tätern droht nach ihrem Sex-Verbrechen ein qualvoller Tod. Grund: Ihr Opfer leidet an Aids in fortgeschrittenem Stadium. Die Männer hatten die junge Frau in Frankfurt in ein Auto gezerrt und in einen Wald im Hundsrück entführt. Dort vergewaltigten sie sie immer wieder. Die vier zwangen ihr Opfer zu Sexualpraktiken, die eine Infektion mit der tödlichen Immunschwäche so gut wie sicher machen - zumal die Frau bei der Vergewaltigung blutige Verletzungen erlitt." Wenn man bis dahin an das (sporadische) Walten einer göttlichen Gerechtigkeit zu glauben geneigt war, so vergeht einem dieser Gedanke an Gottes langsam aber sicher mahlende Mühlen oder eine in unserer Welt waltende göttliche Gerechtigkeit dann doch wieder, und man fällt vom (Irr-)Glauben ab, wenn man noch den letzten Satz der Meldung liest: "Die Polizei befürchtet jetzt, daß die ahnungslosen Sex-Täter auch noch ihre möglichen Partnerinnen oder Ehefrauen anstecken werden." 2.5 Strafrechtliche Prüfung des Falles „Brett des Karneades“ Strafrechtl iche Prüfung des Falles "Brett des Karneades " Unrechtst atbestand erfüllt Vielleicht geschah dem »schwarzen Franken« aus der Ballade „Die Vergeltung“ göttliches Recht, was aber zu bezweifeln ist, wenn man von der Vorstellung eines liebenden (und nicht eines rächenden) Gottes ausgeht. Aber auf jeden Fall geschah ihm durch die falsche Aussage der mitangeklagten Seeräuber nicht menschliches Recht, wenn man für die Abwägung der Schuldfrage die Strafbestimmungen unseres StGB zugrunde legt. Danach hätte er, obwohl er den Tatbestand des § 212 StGB voll erfüllt hat, der lautet: "§ 212 StGB Totschlag Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft." trotz der von ihm an dem kranken Schiffbrüchigen unstreitig begangenen Tötungshandlung straffrei bleiben müssen. Die Strafrechtsprechung kann zwar nicht durchgängig unter dem Motto betrieben werden: "Wer verurteilt, kann irren - wer verzeiht, irrt nie!" Es muss entschieden und wohl auch gestraft werden. Aber der Gesetzgeber trägt dem psychischen Zwang in extremen Notlagen Rechnung. Die Handlung des »schwarzen Franken« wäre zwar nicht gemäß "§ 32 StGB Notwehr (1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. (2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden." gerechtfertigt gewesen. »Gerechtfertigt« bedeutet, dass mit einer Tathandlung kein strafjuristisch definiertes Unrecht begangen worden ist, obwohl der objektive Tatbestand eines Strafgesetzes (z.B. in § 212 StGB: "Wer einen Menschen tötet ...") zunächst einmal erfüllt, das in diesem Straftatbestand geschützte Rechtsgut (z.B. "Leben" in § 212 StGB) verletzt worden ist. Trotzdem kann die geschehene Verletzung eines in einer strafrechtlichen Bestimmung geschützten Rechtsgutes rechtmäßigerweise vorgenommen worden sein, nämlich dann, wenn sie durch einen der möglichen Rechtfertigungsgründe, z.B. durch Notwehr, nicht unbedingt rechtlich geboten - ein Opfer muss sich nicht wehren -, aber erlaubt und damit eben »gerechtfertigt« ist. Für einen Rechtsstaat gilt: "Das Recht muss nicht dem Unrecht weichen!" - kann es aber tun. „Schlägt dir jemand auf die linke Wange, so halte auch die Rechte hin“, lautet dagegen Jesu moralischer Appell. Aber auf dieser extrem erduldenden Basis lässt sich das Zusammenleben in einer staatlichen Gemeinschaft nicht organisieren. 174 Kein Eingreifen von "Rechtfert igungsgründen", insbesond ere kein Unrechtsausschluß durch Notwehr oder rechtfertig enden Notstand Die Notwehrüberlegungen auf die Ballade angewandt ergeben, dass der Kranke den »schwarzen Franken« nicht angegriffen hatte. Eine Notwehrlage, in der sich der schwarze Franke gegen den Kranken bis zu dessen Tötung berechtigt hätte wehren dürfen, war für den schwarzen Franken - anders als für den Kranken - somit nicht gegeben. Der Rechtfertigungsgrund der Notwehr scheidet folglich aus. Aber es gibt ja noch weitere Rechtfertigungsgründe, die zu prüfen sind, ob sie möglicherweise eingreifen könnten, um das zunächst festgestellte Unrecht der Tat, hier der Tötung des Kranken, durch eine Kontrollüberlegung wieder auszuschließen. Die Tat des »schwarzen Franken« wäre auch nicht nach "§ 34 StGB rechtfertigender Notstand Wer in einer anders nicht abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden." gerechtfertigt gewesen, weil das geschützte Interesse seines Lebens in der vom Gesetzeswortlaut des § 34 StGB geforderten Rechtsgüterabwägung nicht das von ihm beeinträchtigte Interesse des Lebens des Kranken überwog. Unter der Geltung des Grundgesetzes darf grundsätzlich nicht Leben gegen Leben abgewogen werden. Man darf z.B. nicht gesundes gegen krankes Leben aufrechnen. (Das war unter den US-Amerikanern1 und den Nazis anders. Diesbezügliche kommerzielle Nützlichkeitserwägungen gegenüber sogenannten "Ballastexistenzen" wurden in der obersten Hierarchieebene erdacht und teilweise bis zu den Kindern im Rechenunterricht der Grundschule weitergegeben!2) Man darf nicht einmal erlaubterweise ein Leben opfern, um zwei oder mehrere 1 2 Edwin Blake beschreibt in seinem Buch “War against the Weak“, dass eine von US-Pferde- und Rinderzüchtern dominierte eugenische Bewegung um den Biologen Davenport aus Furcht vor Überfremdung der von Nordeuropäern aufgebauten USA durch „kleinwüchsige Schwarzhaarige jenseits der Alpen“, Afro-Amerikaner, Mexikaner und Juden ein Eugenik-Programm ersann, das von mehreren Eliteuniversitäten der USA getragen und verbreitet wurde. Mit diesem Programm sollte das randständige Zehntel der us-amerikanischen Bevölkerung u.a. durch letztlich Zwangssterilisation daran gehindert werden, sein als „minderwertig“ eingestuftes Erbgut an Nachkommen weiterzugeben. Der Chef des Statistikbüros des „Eugenics Record Office“ (ERO), Laughlin, ließ durch gezielte Fragen von »Befragern« und die Auswertung der Antworten feststellen, dass „70 bis 80 Prozent aller Schwarzen und Juden Trottel und Idioten“ seien. Der Kampfslogan der Eugeniker lautet: „Einige Amerikaner sind nur geboren, um dem Rest der Gesellschaft zur Last zu fallen.“ Die zu deren Unterhalt aufzubringenden Kosten in Höhe von damals jährlich 100 Mill. $ solle man durch eugenische Maßnahmen einsparen. Viele der von den Befragern als „geistig verwirrt“, „blind“, „schwachsinnig“, „epileptisch“, „verarmt“, unmoralisch“ oder „kriminell“ Katalogisierten, deren (angebliche) „Defekte“ von Ärzten als „erblich“ eingestuft worden waren, wurden in „Kolonien“ mit extrem hohen Todesraten interniert, in „Heilanstalten“ abgeschoben und Tausende wurden mit erschlichener oder ohne Zustimmung der Betroffenen auf der Grundlage von Einzelstaatsgesetzen in 33 Staaten der USA sterilisiert. Zu diesem Zweck hatte Laughlin als Vorlage für die Gesetzgebung ein »Modell«-Gesetz zur Zwangssterilisation von „Geisteskranken“ entwickelt. Hitlers Rassenhygieniker des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP übersetzten das »Modell«-Gesetz ins Deutsche und verwandten Teile daraus für die eigenen eugenischen Gesetze wie insbesondere das “Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ („Erbgesundheitsgesetz“) vom 14.07.1933, das “Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ („Blutschutzgesetz“) vom 15.09.1935 und das „Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes“ („Ehegesundheitsgesetz“) vom 18.10.1935, auf deren Grundlage dann ca. 350.000 Menschen »legal« zwangssterilisiert worden sind. Laughlin erhielt für seine diesbezüglichen »Verdienste« 1936, im Jahr der Olympiade in Berlin, in der die deutschen Sportler mit Abstand die meisten Medaillen holten und so die Überlegenheit der »nordischen Rasse« für die Weltöffentlichkeit sehr augenscheinlich nachgewiesen hatten, 1936 die Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg. Einige der us-amerikanischen Eugenik-Gesetze blieben trotz des Wissens um deren Missbrauch bis etwa 1970 in Kraft. Auf ihrer Grundlage wurde bis zum Schluss u.a. vielen Indianerinnen zur Verhinderung »minderwertigen« Nachwuchses ganz »legal« auf der Grundlage dieser Schandgesetze ihre Gebärmutter herausoperiert – teilweise als Übungsprogramm für angehende (weiße) Gynäkologen. Hitlers Leibarzt Morell hatte im Juli 1939 nach Unterredungen mit Hitler in einer Denkschrift festgehalten: „Es spielt schließlich der Gedanke der Menschenrechte eine Rolle. (...) An dem Gedanken ist etwas Richtiges, als Prinzip ist er falsch. Ein subjektives Recht dieser Art mit uneingeschränktem Eigenbereich gibt es genauso wenig wie beim Eigentum. (...) Die dringenden Bedürfnisse der Gemeinschaft lassen sich aber nicht aus der augenblicklich günstigen Lage entwickeln, sondern sie müssen auf einen längeren Zeitraum abgestellt (werden) und insbesondere auch künftige Möglichkeiten berücksichtigen. 5000 Idioten mit Jahreskosten von je 2000 RM = 10 Millionen jährl. 5 Prozent Verzinsung entspricht das einem reservierten Kapital von 200 Millionen. ... Dabei müssen auch noch das Freiwerden von 175 andere Leben zu retten. Eine solche Handlung wäre gegenüber dem/den jeweiligen Opfer/n nicht gerechtfertigt!3 Weitere Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Damit ist die Tat mit der Rechtsordnung nicht vereinbar. Sie ist somit objektiv rechtswidrig. Schuldtatbe Der "schwarze Franke" war schuldfähig und handelte vorsätzlich. Damit ist nach dem Vorliegen des objektiven stand erfüllt Tatbestandes auch das Vorliegen des subjektiven Tatbestandes zu bejahen. Der Schuldtatbestand ist (wieder nur als Zwischenergebnis) als erfüllt festzustellen. Aber auf eine solche vorsätzlich begangene Handlung wie die des schiffbrüchigen »schwarzen Franken« wird unter bestimmten, extremsten Voraussetzungen trotzdem nicht mit einem Strafausspruch reagiert: Obwohl der »schwarze Franke« eine rechtswidrige Tötungshandlung begangen hat, würde er nicht verurteilt werden, weil sein Handeln in dieser Situation gemäß "§ 35 StGB entschuldigender Notstand Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. ..." zwar als rechtswidrig - denn man darf einen »Nicht-Angreifer« nicht gerechtfertigt umbringen - aber trotzdem als nicht vorwerfbar schuldhaft, als »entschuldigt« eingestuft würde. Niemandem wird zugemutet, tatenlos seinen Tod akzeptieren zu müssen, ohne wenigstens nach dem bewussten Strohhalm - oder eben einem Schiffsbalken - gegriffen zu haben.4 Ausschluss Welcher Paragraph von beiden, ob § 34 oder § 35 StGB, im konkret zu entscheidenden Fall einschlägig ist, ist der zwar für den Betroffenen bei der seinen Strafprozess abschließenden Frage: "Strafe ja oder nein?" gleichgültig, Rechtsschu aber trotzdem ein feiner Unterschied - nicht nur juristisch, sondern vielleicht auch für sein Gewissen! (Er ist in ld durch dem Buch "Rechtskunde - Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Eingreifen Tötungsdelikten" eingehender behandelt.) Der Vergleich des Wortlauts der §§ 34 und 35 StGB ergibt weitere eines Unterschiede bezüglich der geschützten Rechtsgüter und des bevorrechtigten Personenkreises! Das ist wegen der Entschuldi gungsgrund vielen fremden Vokabeln und der dahinter steckenden Bedeutungen für juristische Anfänger schon starker juristischer Toback. Aber allgemein gilt, wenn Gesetzeswortlaut erörtert werden muss, der Stoßseufzer des es vormaligen Bundesjustizministers Kinkel: "Ich kann doch die Gesetze nicht so machen, dass sie jeder versteht." Ein Beispiel einer Gesetzesüberschrift aus dem Beschlussprotokoll der Bremischen Bürgerschaft: "Gesetz zur Nahrungsmitteln eigener Erzeugung und das Sinken gewissen Einfuhrbedarfs bewertet werden.“ (Zitiert nach Aly, G.: „Endlösung“, S. 52 f). Aus dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auf oberster NS-Ebene wurde dann in Rechenbüchern die Rechenaufgaben: "Nach vorsichtigen Schätzungen sind in Deutschland 300.000 Geisteskranke, Epileptiker usw. in Anstaltspflege. Was kosten diese jährlich bei einem Satz von 4 RM? Wieviel Ehestandsdarlehen zu je 1000 RM könnten ... von diesem Geld jährlich ausgegeben werden?" Oder: "Der Bau einer Irrenanstalt erforderte 6 Mill. RM. Wieviel Siedlungshäuser zu je 1500 RM hätte man dafür bauen können?" Später gab es bunt bebildertes Anschauungsmaterial „Ausgaben für Erbkranke – Soziale Auswirkung“ und unter entsprechenden Bildern stand: „Erziehungsheim in E. mit 130 Schwachsinnigen Ausgaben jährlich 104 000 RM – dafür könnte man - 17 Eigenheime für erbgesunde Arbeiterfamilien erstellen“ Und zum Einhämmern der Parole groß und rot hervorgehoben die von den Nazis gewollte Erkenntnis: „Erbkranke fallen dem Volk zur Last!“ Wir wissen aus unserer Ex-post-Betrachtung: Unworten folgen bald ganz schnell Untaten nach! 3 Ein Weichensteller bemerkt, dass zwei Züge mit Höchstgeschwindigkeit aufeinander zu rasen. Es sind viele Tote zu erwarten. Das Unglück könnte nur verhindert werden, wenn der Weichensteller eine Weiche umstellt und einen der Züge über ein Ausweichgleis leitet - an dem eine Gruppe von Gleisbauarbeitern arbeitet, von denen einige voraussichtlich getötet werden. Der Weichensteller darf nicht nach einer kurzen Überschlagsrechnung den Hebel umlegen, um die Zahl der Opfer zu minimieren. Das ist der Unterschied zwischen Unglück und Unrecht. 4 Noch einmal zurück zu dem Weichensteller-Fall: Wenn der Weichensteller weiß, dass in einem der Züge ein Angehöriger von ihm oder "eine andere ihm nahestehende Person" wie z.B. seine Geliebte mitfährt, der Gefahr für ihren von ihm heiß begehrten Leib oder ihr Leben droht, dann kann er die Weiche umstellen, ohne für den von ihm vorausgesehenen und dann auch eingetretenen Tod einiger Gleisbauarbeiter bestraft werden zu können. Strafjuristen, spitzfindig wie sie als Freunde des gespaltenen Haares nun einmal sind, konstruierten folgenden Fall, um zu zeigen, dass es bei einer solchen Handlung nicht auf die Lauterkeit des Handelns ankomme, damit die Handlung als "entschuldigt" eingestuft werde, sondern nur auf die seelisch erlebte Nähe zwischen dem Täter und der von ihm zu retten beabsichtigten Person: Lebemann L nimmt auf eine Kreuzfahrt seine Ehefrau E und - ohne deren Wissen - seine der E unbekannte langjährige Geliebte G mit. Bei einem Schiffsunglück, als alle in die Boote müssen, stößt der schon im letzten Rettungsboot kauernde L die früher beste Ehefrau von allen, E, zurück und reißt G zu sich ins Boot, um sie zu retten, da für ihn seine jüngere Bekanntschaft anregender ist als seine ihm schon zu viele Jahre vertraute Ehefrau. Es tritt der von ihm bei dieser Handlung vorausgesehene, aber ihm nicht unangenehme Doppeleffekt ein: G wird mit ihm gerettet, E findet kein Boot mehr und kommt um. L spart so die Scheidungs- und die viel höheren Scheidungsfolgekosten. 176 Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) und des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (EGOWiG)". Alles klar? Wohl eher nicht! Die grundsätzliche Gegenposition zu dem Stoßseufzer des ehemaligen Bundesjustizministers Kinkel wurde von unserem Bundespräsidenten Herzog formuliert und ist deshalb so bedenkenswert, weil er vor seiner Ernennung zu unserem Staatsoberhaupt als Präsident des BVerfGs der oberste Richter Deutschlands war: „Jedenfalls gilt bei Gesetzen wie überall im Leben: Was nicht zu verstehen ist, kann weder auf Verständnis hoffen noch auf Befolgung. Wie soll der Bürger Spielregeln beachten, die zu verstehen selbst der Experte Mühe hat?“ Aus dieser Einsicht heraus hatte der italienische Staatspräsident Cossiga anlässlich eines Staatsbesuches in der CSFR den Politikern des Gastlandes mit Blick auf deren Staatspräsidenten und Dichter Václav Havel geraten: "Lasst die Verfassung nicht von Juristen schreiben, sonst versteht sie niemand, und es gibt nur Probleme. Ich bin ja auch Jurist, doch ich empfehle einen Künstler, einen Dichter wie Sie ... ." „Die Zehn Gebote sind deshalb so einfach, weil keine Expertenausschüsse daran mitgearbeitet haben“ (Charles de Gaulle). Man hat aber nicht immer gleich einen Goethe, Schiller, Arndt, Claudius, Eichendorff, Heine, E. T. A. Hoffmann, Rückert, Storm, Uhland oder andere „Juristen-Poeten“ zur Hand, die - u.a. wenigstens auch - Juristen und noch erfolgreichere Dichter waren.) 2.6 Annäherung an die »Idee des Rechts« Was ist nun »Recht«? Darauf hat es im Laufe der Jahrtausende von Juristen, Theologen und Philosophen die unterschiedlichsten Antworten gegeben; ein von z.B. Jean Giraudoux lautet: „Das Recht ist die stärkste Schule der Einbildungskraft: Kein Dichter interpretiert die Natur so frei wie der Jurist die Wirklichkeit.“ Da ist etwas Wahres dran, denn Juristen setzen sich, wenn sie ein bestimmtes juristisches Ergebnis erzielen wollen, durch eine „Fiktion“ genannte gedankliche Konstruktion über jede naturwissenschaftlich bekannte oder überprüfbare Naturgesetzlichkeit hinweg! So ordnete das BGB früher z.B. an, dass ein nichteheliches Kind mit seinem Vater als nicht verwandt gelten solle: weil man nicht wollte, dass ein nichteheliches Kind in die Reihe der Erben aufrücke. Nur Ehegatten und Kinder sollten erbberechtigt sein, nicht aber Kegel! Die vorstehende Definition sagt etwas darüber, wie Juristen das Recht mit virtuos gehandhabter Rabulisitik instrumentalisieren können, erklärt aber nicht das Wesen »des Rechts«. Eine andere Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Rechts stammt von Hegel (1770 - 1831), der damit eine Synthese aus früheren Anschauungen der Stoiker und von Rousseau versuchte: Die »Idee des Rechts« muss von der Gesellschaft als ganzer getragen werden. Sie sei nicht abstrakt (wie viele Vorgänger Hegels meinten), weil jeder mit ihr übereinstimmt. Sie sei nicht individuell, weil sie für jeden verbindlich ist. Sie sei „der allgemeine Wille in seiner höchsten Äußerung: dem preußischen Staat“. Das ist natürlich eine ziemliche Fan-Äußerung. Da hat sich Hegel wieder einmal ein bisschen sehr als Hermelinfloh im Pelz des Krönungsmantels der preußischen Könige betätigt – wie die Fans des FC St. Pauli ihren Verein ja auch für den besten aller möglichen halten. Aber die Fans anderer Klubs stehen ihnen da nicht nach. (Das ist schließlich das Vorrecht eines Fans.) Mit einer solchen Definition des »Rechts« als „Wille in seiner höchsten Ausprägung – dem preußischen Staat“ können wir natürlich auch nichts mehr anfangen, denn wenn sie stimmte, dann wäre ja nach dem Untergang des preußischen Staates – was Hegel sich wohl nicht vorstellen konnte – auch die nach dieser Definition an ihn gebundene »Idee des Rechts« mit untergegangen! Annäheru ng an die »Idee des Rechts« Was sich heutzutage für einen juristischen Laien hinter der »Idee des Rechts« verbirgt, kann nicht das Zivilrecht plus das Recht des Kaufmanns sein, plus Strafrecht, plus Baurecht, plus Polizeirecht, plus Gewerberecht, plus Zivil- und Strafprozessrecht, plus Umweltschutzrecht, plus Beamtenrecht, plus Verfassungsrecht, plus ... . Die Aufzählung könnte noch sehr lange fortgesetzt werden, es könnten noch viele weitere Rechtsgebiete genannt werden, die sicher notwendig, aber teilweise so trocken sind, wie z.B. das Zwangsvollstreckungsrecht, dass man aus dem Munde staubt, wenn man davon spricht. Und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile! Deshalb wollen wir unsere Nase nicht vorwitzig in einzelne Rechtsgebiete stecken, zu deren Verständnis man dann doch wieder umfangreiche Rechtskenntnisse benötigt - beispielhaft sei auf das in einer noch folgenden Zeitungsmeldung angesprochene 250-Seiten-Buch allein über das Problem der Neuregelung der Sonntagsarbeit verwiesen -, sondern wir wollen uns ausschließlich der »Idee des Rechts« als der „Kunst des Guten und Gleichen“ asymptotisch anzunähern versuchen; mehr geht nicht. Wenn dabei Beispiele für notwendig gehalten 177 werden, wird nicht so sehr auf traditionelle Rechtsgebiete zurückgegriffen, sondern vorwiegend auf aktuellere Beispiele aus der rechtspolitischen Tagesdiskussion, wie sie letztlich oder zurzeit gerade in der Tagespresse diskutiert wurden oder werden und wie ein interessierter Laie sie darum zur Zeit des Erscheinens dort mitverfolgen konnte oder noch verfolgen kann. So kann jeder juristische Laie an einigen nicht ganz willkürlich herausgepickten Beispielen miterleben, wie in der Öffentlichkeit der Tagespresse dringlich vermisste gesetzliche Regelungen auf gesellschaftlichen Problemfeldern in den Tageszeitungen angemahnt, diskutiert, kommentiert und vielleicht auch Lösungen zugeführt werden, wie es z.B. inzwischen auf dem Gebiet des Ehenamensrechts geschehen ist. Der Leser der Tagespresse konnte oder kann verfolgen, wie ein neues Recht durch u.a. auch eine kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit heranwächst, bis es durch eine gesetzliche Neuregelung geboren ist - oder, weil es sich im Laufe seines Entstehungsprozesses als mit einem gesellschaftlich so gesehenen und bewerteten Geburtsfehler behaftet herausstellt, abgetrieben wird. Dabei muss eine gefundene und durchgesetzte Lösung noch nicht das Ende der öffentlichen Diskussion darstellen; verwiesen sei diesbezüglich auf den rechtspolitischen Streit um die Neuregelung des § 218 StGB, der auch nach der letzten ablehnenden Entscheidung des BVerfGs weiterging, bis eine Neuregelung gefunden worden war, die von einer Parlamentsmehrheit getragen wurde und dabei die Vorgaben des BVerfGs in seiner vorerst letzten Entscheidung einhält. 2.6.1. Widerstreit zwischen menschlichem und göttlichem Gesetz und Recht Die Idee des Rechts und seine praktische Ausgestaltung hat natürlich auch schon vergangene Kulturen bewegt. Jede Kultur hat zur Regelung der Beziehungen der ihr Angehörenden Vorstellungen über rechtliche Grunderfordernisse dieser Beziehungen untereinander entwickelt - die sehr »ungerecht« gewesen sein können. Zu Absicherung der in ihrer Gesellschaft geltenden Regelungen in der allgemeinen Akzeptanz wurden meist die Götter bemüht, weil es für die im Großen und Ganzen Begünstigten viel zweckdienlicher war, auf den göttlichen Ursprung des in der jeweiligen Gemeinschaft zur Geltung gekommenen Rechts verweisen zu können, als die nackten Interessen der jeweiligen Machtelite durchscheinen zu lassen. Aber den Menschen scheint ein – allerdings recht manipulierbares – Gerechtigkeitsgefühl innezuwohnen, und sie entdeckten irgendwann eine »Gerechtigkeitslücke« zwischen dem sie benachteiligenden behaupteten göttlichen Recht und ihrem durch einen Missstand als offensichtlich ungerecht empfundenen Gerechtigkeitsgefühl. Dann begann der Kampf um die Neukonzeption des in der jeweiligen Gemeinschaft in (der nächsten) Zukunft geltenden Rechts. Prägend für das Abendland war in vielen Bereichen die Kultur der Griechen. Darum sei zunächst an sie erinnert. 2.6.2 »Gesetz« und »Recht« in griechischen Tragödien „Gesetz« und »Recht« in griechischen Tragödien Die Griechen sahen es als »tragisch« an und stellten es in auf ihren Sagen fußenden »Tragödien« dar, wenn ein Mensch auf der Suche nach »dem Recht« in die Zwangslage geriet, sich zwischen der Befolgung sich gegenseitig ausschließender göttlicher oder menschlicher Gesetze entscheiden zu müssen und er so unausweichlich nach einer der beiden sich gegenüberstehenden und Gehorsam heischenden Normen schuldig werden musste. Welchem Gesetz war dann Folge zu leisten? Was war dann »Recht«? Aber wir halten zunächst noch schnell als eben kaum bemerktes Zwischenergebnis ganz kurz fest, dass in der so angesprochenen Fallgestaltung die Griechen »das Recht« über »dem Gesetz« stehend ansahen. Und damit die Erörterung um den Konflikt zwischen »Gesetz« und »Recht« bei den Griechen (wie er in vielen anderen Kulturen auch besteht, wenn die Gesetze nicht als von Gott oder den jeweiligen Göttern gegeben angesehen werden) hier nicht als zu blutleer erscheint, zunächst ein Anschauungsbeispiel. Den in diesem klassischen Fall deutlich werdenden Konflikt zwischen »Gesetz« und »Recht« kann man auch als Konflikt zwischen Gesetz und Gewissen ansprechen. Wegen dieser zeitlosen Grundproblematik werden die Tragödien der großen griechischen Dichter heute immer noch aufgeführt. Und dieser grundlegende Konflikt wird immer wieder aufbrechen, auch Jahrtausende nach dem Erlöschen der griechischen Kultur als der Wiege des Abendlandes: Zum Beispiel zur Nazi-Zeit zwischen der Befolgung der Menschenleben vernichtenden Rassegesetze und dem u.a. durch die Zehn Gebote christlich geprägten Gewissen, ein Konflikt, den die Widerständler für das Gewissen entschieden und teilweise mit ihrem Leben bezahlen mussten: "Sie waren bereit, für Menschenwürde und Freiheit, für Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit ihr Leben aufzuopfern. Sie wollten die 178 `Majestät des Rechts' wiederherstellen. ... Es waren nicht viele, aber es waren die Besten!" (Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Gedenkrede zum 50. Jahrestag des Attentatsversuches auf Hitler am 20. Juli 1944.) Und wer Grundlegendes und Packendes zu diesem durch die beginnende Nazi-Herrschaft damals zunächst nur drohenden Konflikt von einem deutschen Dichter hellsichtig vorausahnend literarisch verarbeitet lesen möchte, greife zu der von Stefan Zweig schon 1936 geschriebenen Novelle: "Ein Gewissen gegen die Gewalt. Castellio gegen Calvin", in der zur historischen Verbrämung der auf das NS-Regime zielende Konflikt in den Anfang des 16. Jahrhunderts verlegt wurde. Ein Konflikt in unserer Zeit zwischen Gesetz und Gewissen konnte in den letzten Jahren u.a. in der Auseinandersetzung um das »Kirchenasyl« verfolgt werden, das von manchen Kirchengemeinden abschiebebedrohten Asylanten aus Gewissensgründen unter Berufung auf das Bibelwort: "Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!", gewährt worden war. Für die Mitglieder der Kirchengemeinden stand ihr an göttlichen Geboten (wie sie sie verstanden) ausgerichtetes Gerechtigkeitsgefühl nicht im Einklang mit den staatlichen Gesetzen. In diesem durchlittenen Konflikt zwischen Gesetz und Gewissen entschieden sie sich dem zu folgen, was ihnen ihr Gewissen gebot. Viele in der Verantwortung für unsere staatliche Gemeinschaft stehende Politiker, wie z.B. der Bremer Innensenator Borttscheller 1998, können das nicht akzeptieren und meinen dagegen lapidar, Kirchenasyl zu gewähren sei „keine Heldentat, sondern Rechtsbruch“. 2001 wurde vom AG Papenburg ein katholischer Pfarrer „zu einer Verwarnung mit 4.000 Mark Strafvorbehalt verurteilt, weil er einer neunköpfigen kurdischen Familie Kirchenasyl gewährt hatte“ (HH A 18.05.01). Und im April 2003 ist – als bisher einmaliger Vorgang - im brandenburgischen Tröpitz eine kurdische Familie von der Polizei aus dem bisher immer geduldeten Kirchenasyl herausgeholt und in die Türkei abgeschoben worden. Aber dort ist ja auch der dafür verantwortliche Innenminister ein Ex-General gewesen. „Kirchenasyl – Zwei Pastoren vor Gericht PROZESS Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Haft, weil sie Flüchtlingen helfen Ludger Fertmann Hildesheim Pastor Gerjet Harms (62) hat so gar nichts Lutherisch-Streitbares, aber was er freundlich lächelnd sagt, ist eine Kampfansage an die Justiz: ’Die Verteidigung der Menschenwürde kann nicht strafbar sein.’ Weil das die Staatsanwaltschaft Hildesheim anders sieht, steht Harms von heute an gemeinsam mit Philipp Meyer, dem anderen Pastor der Hildesheimer Matthäus-Gemeinde, vor Gericht. Beide sind wegen Verstoßes gegen das Ausländergesetz angeklagt. Dass gleich zwei Pastoren der Prozess gemacht wird, weil sie Flüchtlingen Kirchenasyl gewähren, hat aus Sicht des Niedersächsischen Flüchtlingsrats eine neue Qualität. Offenbar solle ein Präzedenzfall mit abschreckender Wirkung geschaffen werden, heißt es dort. Bislang seien ähnliche Fälle zumeist eingestellt worden. ... Ämter und Gerichte lehnten ihre Asylanträge ab. Der Niedersächsische Flüchtlingsrat aber ist sicher, dass bei einer Abschiebung [der Kurden; der Autor] dem Vater Folter droht und der Familie politische Verfolgung. Der Hildesheimer Oberstaatsanwalt Berns Seemann betont, dass der Prozess nicht Ausdruck einer neuen harten Haltung zum Kirchenasyl sei. Das Legalitätsprinzip lasse keinen Spielraum, zudem sei Pastor Harms ein Wiederholungstäter. ... Harms’ Argumentation ist nicht zimperlich: Kirchenasyl sei eine Frage der Menschenwürde, die Unterschiede nicht zulasse, sagt er. ’Maria und Josef hat damals auch niemand aufnehmen wollen.’ Zudem falle die Familie dem Staat nicht zur Last. Alle Ausgaben würden aus Spenden bestritten. Weil beide Seiten so grundsätzlich argumentieren, wird das Verfahren wohl einen langen Instanzenweg nehmen, Bis der zu Ende beschritten ist, können noch Jahre vergehen.“ (HH A 31.07.02) Formaljuristisch ist die Gewissensauflehnung gegen (gerade geltendes) »Gesetz« und »Recht« sicher immer ein Rechtsbruch. Gerade deswegen kann sie ja eine Heldentat sein! Doch zurück zu den alten Griechen. 179 Tragödie als Widerstreit zwischen menschlich em und göttlichem Gesetz und Recht Fall ("Ödipus" und "Antigone" von Sophokles): Der Königssohn Ödipus wurde auf Geheiß seines Vaters Laios kurz nach der Geburt nach Durchbohren der Füße5 (daher später „Ödipus“ = "Schwellfuß" genannt) ausgesetzt, weil ein befragtes Orakel dem König Laios von Theben geweissagt hatte, dass sein Sohn ihn später einmal erschlagen werde. Der König hatte daraufhin diese - damals nicht ungewöhnliche - Art der (nur nach menschlichem Ermessen) wahrscheinlichen Tötung seines Sohnes durch Aussetzung gewählt, weil er - nach seinem Verständnis - an dem absehbaren Tod des völlig hilflosen, unschuldigen Kindes nicht (allzu?) schuldig werden, aber andererseits verständlicherweise sein eigenes Leben schützen und nicht fatalistisch auf den Eintritt des Seherspruchs und damit sein gewaltsames Ableben warten wollte. Vielleicht hatte der Seher die Botschaft der Götter ja auch missdeutet? Einen Rest Hoffnung ließ er sich nicht nehmen. Mochten die Götter den Säugling beschützen, wenn sie ihm durch ihn den Tod zugedacht hatten (Zunächst §§ 223 a, 223 b, ev. auch 224; 52 = in Tateinheit begangene gefährliche Körperverletzung mittels eines Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs und Misshandlung von Schutzbefohlenen, eventuell auch schwere Körperverletzung, denn eine solche Handlung ist nicht mehr durch den Erziehungsauftrag gedeckt; dann tatmehrheitlich gemäß § 53 StGB zu den vorgenannten Delikten tateinheitlich begangene Aussetzung gemäß § 221 StGB mit der Strafschärfung des Absatzes II i.V.m. §§ 212, 13, 22, 23; 52 StGB versuchte Tötung als Garantenunterlassen des Vaters. Um das aber inhaltlich zu verstehen und nicht nur auf mein Sachwissen vertrauend hinzunehmen, müssten Sie sich nach der Lektüre dieses Buches auch noch das nicht nur mit meinem Herzblut, sondern dem der Opfer geschriebene Buch „Rechtskunde – Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten“ zu Gemüte führen, in dem fast ausschließlich an Hand von Tötungsdelikten das Strafrecht erklärt wird. Die Beschränkung auf Tötungsdelikte als Grundlage für eine Einführung in das Strafrecht ist spannend, manchmal etwas „unappetitlich“, wenn man sich den Zustand des Opfers beim Auffinden der Leiche mit etwas Phantasie vorstellt, aber hoffentlich nicht zu schlimm, denn ich versuchte das Buch zu schreiben, das ich als Student gerne zur Einführung in das Strafrecht gelesen hätte. Weil ich es nicht fand, musste ich es selber schreiben.) Ein Hirte fand Ödipus und zog den Findling in seiner Familie groß. Der herangewachsene Ödipus tötete später in Vorwegnahme der Zustände auf bundesdeutschen Straßen ("Wie im Dschungel", STERN 12.09.91) irgendwo unterwegs in einem Streit um eine Vorfahrt einen ihm fremden Mann, nicht wissend, dass es sich bei dem Gegner um seinen leiblichen Vater handelte, denn er hielt fälschlicherweise – wie heutzutage rund 10 % der ehelich geborenen Kinder in der Bundesrepublik - seinen sozialen Vater für seinen leiblichen. (Die rechtliche Beurteilung der Tötung des Laios ist unklar, weil nicht überliefert ist, wer bei der ausufernden Vorfahrtrangelei der Angreifer gewesen war. Zu untersuchende Straftaten des Ödipus: § 213 StGB minder schwerer Fall des Totschlags oder § 226 StGB Körperverletzung mit Todesfolge; eventuell gerechtfertigt durch Notwehr gemäß § 32 StGB, wenn z.B. der König für sich eine ihm nicht zustehende Vorfahrt mit Waffengewalt zu erzwingen versucht und - ohne Blick auf die Füße seines Gegners - den Kampf begonnen hatte. Dann ist Notwehr möglich, denn: "Das Recht muss nicht dem Unrecht weichen". Deshalb muss bezüglich der Beurteilung der Frage, ob sich Ödipus des Totschlags an seinem Vater schuldig gemacht habe, zu seinen Gunsten der Grundsatz: "Im Zweifel für den Angeklagten!", durchgreifen.) Nach Befreiung der Stadt Theben von der menschenfressenden Sphinx mit ihrem bis dahin ungelösten Rätsel erhielt er zum Lohn den Thron und die (durch seine Gewalttat) verwitwete Königin Jokaste als Frau, seine leibliche Mutter, mit der er die Kinder Eteokles, Polyneikes, Antigone und Ismene zeugte. „Und während ihn die Rache sucht, genießt er seines Frevels Frucht.“6 (Zunächst bezüglich Thron und Frau als Belohnung ein Fall des § 657 BGB Auslobung. Danach wieder ein Schwenk zu dem von den Griechen in ihren Tragödien bevorzugten Rechtsgebiet, dem Strafrecht: Obwohl der objektive Tatbestand des § 173 StGB Beischlaf zwischen Verwandten erfüllt ist, entfällt eine Straftat gemäß § 16 StGB Irrtum über Tatumstände oder § 17 StGB Verbotsirrtum, weil weder Ödipus noch seiner Mutter - trotz der Narben an den ehemals durchbohrten Füßen ihres um eine Generation jüngeren zweiten Gatten - die strafbegründende Verwandteneigenschaft bewusst gewesen sein soll. Wenn das zutrifft, haben sie nicht vorsätzlich gegen die Strafnorm des § 173 StGB verstoßen. Als in Schweden ein Geschwisterpaar unter widrigen Umständen als Kleinkinder getrennt worden war, sich später rein zufällig als völlig Fremde (wieder)gesehen, sich, was sehr häufig sein soll, wenn sich zwei getrennt aufgewachsene Geschwister im richtigen Alter begegnen7, verliebt – im Gegensatz zu Wachteln, die auch bei getrennter 5 Dieser grausam quälende Umgang mit eigenen Kindern ist kein Privileg alter Mythen. Die Tagespresse liefert - leider reichlich Anschauungsmaterial. Näheres dazu auch in: Scharnweber, H.-U.: Einführung in das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland anhand von Tötungsdelikten 6 Schiller, F. v.: Die Kraniche des Ibykus 7 Vgl. Ridley, Matt: Eros und Evolution Die Naturgeschichte der Sexualität Knaur 1998, S. 390 180 Aufzucht ihre Brüder und Schwestern erkennen8, sind Menschen hierzu nicht in der Lage -, geheiratet, auch Kinder gezeugt hatte und dabei war, sie großzuziehen, waren vom sehr menschlich denkenden und auch so handelnden schwedischen Parlament, als die Verwandteneigenschaft durch irgend einen Zufall oder eine medizinische Untersuchung herausgekommen war, Gesetze so geändert worden, dass die Geschwister als Eheleute weiter straflos zusammenleben konnten - was unter den Pharaonen aus biologisch-religiösen Gründen sogar erforderlich gewesen war, um das der Familie des Pharao von den Göttern - so behauptet und geglaubt verliehene Heil durch die Frauen als Mittlerinnen dieses Heils von Generation zu Generation weiterzugeben. Zum Beispiel war die letzte Pharaonin, die angeblich relativ unschöne aber sehr charmante, geistreiche und darum vielgeliebte Kleopatra, u.a. mit zwei Brüdern verheiratet gewesen, bevor ihr zwei herausragende Römer mehr zusagten.) Als Königs später von ihren unwissentlich begangenen, im griechischen Kulturkreis und darum von Sophokles wohl so bewerteten "Freveltaten" erfuhren, erhängte sich Jokaste. Ödipus konnte nicht in unser erst 1871 n.Chr. als Gesetz beschlossenes, seitdem aber schon mehrfach geändertes StGB und dort in die §§ 15, 16 und 17 blicken, sondern zerstörte sich zur Sühne für seinen unwissentlich begangenen Sittenverstoß das Augenlicht und verzichtete auf den Thron, den sein Schwager Kreon übernahm. Ein Sohn des Ödipus, Polyneikes, fühlte sich in seiner Thronanwartschaft übergangen, putschte gegen seinen Onkel (§ 81 StGB Hochverrat oder § 106 StGB Nötigung des Bundespräsidenten analog) und wurde erschlagen. Der Onkel erließ das Gebot, dass sein Neffe als Staatsfeind unbegraben und damit seine Seele ruhelos bleiben, sein Körper Vögeln und Hunden zum Fraße dienen solle. (Eventuell § 168 I 2. Fall StGB Störung der Totenruhe in der Form des Verübens beschimpfenden Unfugs an Leichen durch König Kreon.) Das war gegen die Götterordnung! Und außerdem nicht verhältnismäßig (verfassungswidriger Verstoß der staatlichen Gewalt gegen das aus Art. 3 GG interpretierte Verhältnismäßigkeitsgebot für jedes staatliche Handeln). Aber Gewaltenteilung mit der Möglichkeit, auch das oberste Machtorgan des Staates zur Rechenschaft ziehen zu können, wurde erst im 18. Jahrhundert "erfunden", und ein Bundesverfassungsgericht gab es in Theben auch nicht. Des Königs Wille war Gesetz! Aber „Wehe dem armen Opfer, wenn derselbe Mund, der das Gesetz gab, auch das Urteil spricht.“ (Schiller) Die Schwester des Erschlagenen, Antigone, musste sich entscheiden, ob sie der Staatsräson in Form des (un-)menschlichen Gesetzes ihres Onkels oder in humanistischer Individualität dem göttlichen Gesetz gehorchen solle. Was war „Recht«? Der immer aktuelle Konflikt. Beide Normen beanspruchten Geltung, schlossen sich aber gegenseitig aus. Antigone entschied sich für die Befolgung der göttlichen Norm, begrub den Bruder (ev. § 168 I 1. Fall StGB Störung der Totenruhe durch Entwendung einer Leiche aus dem Gewahrsam des Berechtigten) und wurde dafür auf Geheiß des Königs, ihres Onkels, lebendig begraben. Ihr geschah nach "Menschen-Gesetz". Aber war ihr auch »Recht« geschehen? In den zeitlosen, fast 2.500 Jahre alten Worten des Dichters Sophokles wird der Konflikt um Macht, Gesetz und Recht so dargestellt: "Kreon: Und wagtest, mein Gesetz zu übertreten? Antigone: Der das verkündete, war ja nicht Zeus, Auch Dike in der Totengötter Rat Gab solch Gesetz den Menschen nie. So groß schien dein Befehl mir nicht, der sterbliche, Dass er die ungeschriebenen Gottgebote, Die wandellosen, konnte übertreffen. Sie stammen nicht von heute oder gestern, Sie leben immer, keiner weiß, seit wann. An ihnen wollt' ich nicht, weil Menschenstolz Mich schreckte, schuldig werden vor den Göttern. Und sterben muss ich doch, das weiß ich, Auch ohne deinen Machtspruch." Schon die Griechen wussten, dass Gesetze durch den jeweiligen Gesetzgeber erlassenes (= legalisiertes; von lat. lex = Gesetz) Unrecht sein können, und von Bismarck stammt das Wort: "Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, der kann nicht mehr ruhig schlafen." Festzuhalten bleibt noch, dass nach der bei Sophokles durchklingenden Vorstellung der Griechen die als über den menschlichen Gesetzen stehend und als göttlich gesetztes Recht empfundenen Gottgebote - im Gegensatz zu den Zehn Geboten der Juden - ungeschrieben waren, aber doch als wandellos begriffen wurden; eine Vorstellung von Recht, die wir Heutigen (mit Ausnahme der islamischen Fundamentalisten) so wohl nicht mehr teilen können. 8 Vgl. Ridley, Matt: Eros und Evolution Die Naturgeschichte der Sexualität Knaur 1998, S. 389 181 Was ist nun aber, etwas genauer untersucht, „Gesetz«, was »Recht« und was "Gerechtigkeit"? Und dazu gehört im Strafrecht die Kontrollfrage: Was ist "Schuld"? Und wie soll darauf reagiert werden? 2.7 »Gesetz« »Gesetz« „Gesetze sind abgekürzte Vorgänge des Lebens“ (Hans Lohberger). Das ist der allgemeinste Definitionsversuch von »Gesetz«, den ich gefunden habe. Und damit der unbrauchbarste. Gesetze sind das traditionell wichtigste Instrument politischer Gestaltung. Sie sollen die Wertordnung des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen schützen. Was »Gesetz« ist, ließe sich unter Verzicht auf alle erhellenden differenzierenden Einzelheiten auch in Anlehnung an Clausewitz‘ berühmte Formel über den Krieg nach meinem Dafürhalten relativ einfach und wertneutral bestimmen: „Gesetz ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“ Eine solche Definition von »Gesetz« wäre fast genau so unbrauchbar wie die zuvor zitierte. Solche zu allgemein gehaltenen Formulierungen sind zwar zutreffend, denn sie schließen nicht aus, dass es auch ungerechte Gesetze gibt: Das Leben ist ja auch nicht fair und »gerecht«. Das kann man nun wirklich nicht sagen! Doch wem wäre mit so allgemein gehaltenen Formulierungen geholfen, wie z.B. der des Demosthenes, der befand: „Gesetze sind die Sehnen der Demokratie“? Plato und Demosthenes definierten: „Gesetze sich die Seele der Polis“, womit die staatliche Stadtstaatengemeinschaft gemeint war. Mit so allgemein gehaltenen Formulierungen lässt sich der Begriff des Gesetzes nicht einsichtig fassen und für eine praktische Anwendung nutzbar machen. Er sagt z.B. nichts aus über den zwingenden Charakter der Gesetze, die Interessegeleitetheit mancher Gesetze, über das Gemeinschaftsfrieden anstrebende, bestenfalls sogar Gemeinschaftsfrieden stiftende oder Entwicklungen steuernde Ziel ihres Erlasses, über gerechte, aber auch ungerechte Gesetze, die NS- oder SED-Terror mit dem Rechtsschein der Legitimität auszustatten suchten. Eine solche Definition sagt nichts aus über den Anspruch, der hinter jedem Gesetz stehen müsste: „Etwas ist nicht recht, weil es Gesetz ist, sondern es muss Gesetz sein, weil es recht ist“ (Charles-Louis de Montesquieu). Platon fasste die Notwendigkeit von Gesetzen in den Ausspruch: „Es soll dabei ganz ähnlich hergehen wie beim Elementarlehrer, der mit dem Griffel den noch nicht schreibfähigen Kindern Linien zieht und sie zwingt, sich mit ihren Schreibversuchen nach diesen Linien zu richten: So hat auch der Staat als Richtschnur die Gesetze aufgestellt.“ Sehr blauäugig blendete er damit aber die Wirklichkeit seiner Sklavenhaltergesellschaft mit ihrem klassengeleiteten Recht der besitzenden Oberschicht und ihren daraus abgeleiteten Gesetzen aus, als er näher umschrieb, was er in diesem Zusammenhang unter dem Staat als Gesetzgebungskörperschaft verstand und als Funktion der Gesetze ansah: „Die Gesetze, glaube ich, sind von den schwachen Menschen und von der großen Masse gemacht. Zu ihren Gunsten und zu ihrem eigenen Nutzen stellen diese die Gesetze auf, sprechen sie Lob und Tadel aus! Die Stärkeren unter den Menschen und diejenigen, die imstande sind, ein Übergewicht zu erlangen, wollen sie einschüchtern.“ Gesetze als im Staat von den Schwachen vorgegebene, von jedermann jederzeit einsehbare Richtschnur zur Einschüchterung und Disziplinierung der Mächtigen? Das kann nach allem, was wir über die damalige Gesellschaftsstruktur wissen, nicht die Wirklichkeit widergespiegelt haben. Aber es ist ein schönes Ziel! Mir als Historiker drängen sich arge Zweifel bezüglich des Ursprungs der Gesetze als (schon) zu der damaligen Zeit „von den Schwachen zur Zähmung der Starken erlassen“ auf! Philosophen nach ihm sahen das ganz anders. Als Beleg dafür brauchen wir nicht auf die Utopien und Ansichten eines Karl Marx zurückzugreifen. Da genügt schon ein Rückgriff auf den bürgerlichen Philosophen Rousseau. Auf Grund der in der Menschheitsgeschichte überwiegend gemachten historischen Erfahrungen – „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ - sah Rousseau (1712-1778) als einer der Vordenker der dann in der Französischen Revolution ausgerufenen bürgerlichen Freiheitsrechte in dem bis dahin von Menschen geschaffenen Gesetz – im Gegensatz zum »natürlichen Gesetz« und dem Naturrecht - eine zweifelhafte Waffe, mit der sich die Starken in ihrem erbarmungslosen Bedürfnis nach Absicherung ihrer Herrschaft und ihres Besitzes gegen die Schwachen bewaffnet hätten. Die Reichen tränken in Frieden das Blut und die Tränen der Armen. Durch den Trick des Abschlusses eines Gesellschaftsvertrages hätten einige wenige Reiche ihren Besitz auf Kosten der großen Mehrheit der Menschen, der Armen, abgesichert. Die Armen mussten auf ihren Anteil an dem gesellschaftlichen Reichtum verzichten, so dass sie dann im Austausch für Frieden und Schutz „auf ihre Ketten zuliefen, im 182 Glauben, ihre Freiheit zu sichern“. Nur durch die kollektive Herrschaft der Bürger über sich selbst, so nahm der Bürger der Stadtrepublik Genf an, sei dieser ungerechte gesellschaftliche Zustand zu überwinden, so dass die Menschheit sich in einem Zustand unbehinderter Freiheit selbst verwirklichen könne. Rousseau legte so die konstitutionellen Grundlagen legitimer politischer Autorität und Herrschaft. Legitime Herrschaft beruhe auf Zustimmung der Beherrschten. Aber Platons Sichtweise der Gesetze als „von den Schwachen zur Zähmung der Starken erlassen“ sollte als Richtschnurfunktion für unsere heutige Gesetzgebung gelten! Aber ein paar tausend Jahre später ist eine moderne Gesellschaft wesentlich ausdifferenzierter, so dass eine so simplifizierende Umschreibung von Gesetzen nicht mehr unsere Wirklichkeit widerspiegelt. Wir müssen uns heutzutage um eine angemessene Definition von »Gesetz« mehr mühen als damals. Mit der vielschichtiger und damit unübersichtlicher gewordenen Lebenswirklichkeit wird auch eine heutige Definition von »Gesetz« unübersichtlicher. Trotzdem muss es versucht werden: »Gesetz« in einer modernen Gesellschaft ist grundsätzlich eine mit Anspruch auf Gehorsam vom hierfür (ernannt oder angemaßt) zuständigen Gesetzgeber im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten verkündete vorläufige Regelung eines zivil-, straf-, verwaltungsrechtlichen oder gesellschaftlichen Interessenkonfliktes, die abstrakt gefasst eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regeln und für alle in dem Geltungsbereich des jeweiligen Gesetzes lebenden Personen - eventuell erst beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen - gleichermaßen gelten soll. Diese Regelung muss dann auf alle einschlägigen Fälle gleichermaßen angewandt werden. Manchmal sind Gesetze aber auch nur »abstrakt« mit Geltung für eine unbestimmte Vielzahl von Fällen formuliert, obwohl mehr oder weniger klar ist, dass die besondere Situation, die zum Erlass des speziellen Gesetzes geführt hatte, kaum oder wohl gar nicht mehr auftreten wird. Im Verwaltungsbereich ist ein solches Gesetz aber trotzdem erforderlich, um u.a. der staatlichen Verwaltung die Grundlage für ein gesetzmäßiges Handeln zu eröffnen. Man spricht in solchen Fällen von »Einzelfallgesetzen«. Damit ist aber nur der Anlass ihres Zustandekommens gemeint, nicht jedoch der Rahmen ihrer Gültigkeit. Gesetze sollten einen fairen Interessenausgleich zwischen den jeweils betroffenen gesellschaftlichen Gruppierungen und ihren unterschiedlichen Interessen anstreben und keine Gruppierung auf Kosten einer anderen bevorzugen. Wenn der Gesetzgeber nicht mit dieser Intention handelt, können Gesetze sehr ungerecht sein. Neben der im besten Falle Gemeinschaftsfrieden anstrebenden und Gemeinschaftsfrieden möglichst auch stiftenden Funktion der Gesetze werden mit ihrer Hilfe auch gesellschaftliche Entwicklungen gesteuert. Da Politik ganz allgemein als »das Noch-nicht-Entschiedene« verstanden werden kann, ist »Gesetz« dann das zur Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen »vorläufig verbindlich Entschiedene«. 2.7.1 Die Notwendigkeit exakter Abfassung von Gesetzen Die Notwendig keit exakter Gesetze können aber auch unsinnige Auswirkungen haben und somit unsinnig (abgefasst) sein: Abfassung von "Adoptiert - aber sie gelten als `blutsverwandt' Gesetzen Zwei Waisenkinder brauchen für Heirat eigenes Gesetz! Und das ganze Parlament wird zur Hochzeit eingeladen dh Ottawa - Super-Aufwand um ein Liebespaar: Damit zwei Verliebte heiraten können, muß ein eigenes Gesetz geschaffen werden - und selbst die Queen muß dem Ja-Wort noch zustimmen. Dabei ist das Liebespaar weder prominent noch adlig. Das Pech von Scott und Kim Broddy ist ganz einfach: Die beiden waren als Waisenkinder von ein und derselben Familie adoptiert worden und gelten seither als blutsverwandt - für Parlamentarier eine `gesetzliche Form höheren Blödsinns'. Schicksal gespielt hatten Vater und Sohn Broddy: Vater Broddys Familie adoptierte Scott vor 25 Jahren, sechs Jahre später kümmerte sich die kinderlose Familie des älteren `Bruders' von Scott um die kleine Kim. Beide wuchsen im gleichen Haus wie Geschwister auf. In den letzten Jahren aber wurde mehr aus der `Geschwisterliebe'. Um nichts `Verbotenes' zu tun, mieden `Onkel' und `Nichte' jeden engeren Kontakt. Bis Scott seiner Familie erklärte: `Ich kann das nicht mehr länger ertragen. Ich wandre aus.' Da eröffneten die `Eltern' Kim und Scott die Wahrheit. Doch jetzt legte sich der Standesbeamte der neuen Liebe quer: Adoptivkinder haben den gleichen Status wie natürliche Kinder - Heirat ausgeschlossen. Jetzt berät das kanadische Parlament eigens für dieses Paar eine `Lex Broddy'. Im Mai soll dieses Gesetz mit der Unterschrift der Queen als Landesherrin in Kraft treten. ..." (Morgenpost 24.02.82) 183 Im deutschen Recht ist die Rechtsfolge des Heiratsverbotes bei durch Adoption begründeter Verwandtschaft bei der Schaffung des (inzwischen ins BGB eingearbeiteten) Ehegesetzes gleich gesehen und nicht ganz so zwingend ablehnend geregelt worden, wie es in Kanada der Fall ehemals zu sein schien. Die Kanadier hätten sich an den nachfolgend wiedergegebenen damals geltenden Bestimmungen des deutschen Ehegesetzes orientieren oder entsprechende eigenständige Regelungen finden können: "§ 7 EheG Annahme als Kind / jetzt [fast wortgleich u.a. ohne Schwägerschaftsheiratsverbot] § 1308 BGB Adoption (1) Eine Ehe soll nicht geschlossen werden zwischen Personen, deren Verwandtschaft [oder Schwägerschaft] im Sinne von § 4 Abs. 1 durch Annahme als Kind begründet worden ist. Das gilt nicht, wenn das Annahmeverhältnis aufgelöst worden ist. (2) Das Vormundschaftsgericht kann von dem Eheverbot wegen Verwandtschaft in der Seitenlinie und wegen Schwägerschaft Befreiung erteilen. ... " Danach ist eine Befreiung nur für Adoptionsverwandte der geraden Linie ausgeschlossen; ein Elternteil soll sein Kind und ein Großelternteil sein Enkelkind nicht heiraten können. Das Vormundschaftsgericht kann aber die Ehe zwischen Geschwistern zulassen, deren Verwandtschaftsverhältnis auf der Annahme als Kind beruht. Die in Kanada 1982 geplante "Lex Broddy" wird zwar so formuliert werden, dass sie für eine (künftige) unbestimmte Vielzahl von Fällen Geltung haben kann, wird aber trotzdem ein »Einzelfallgesetz« sein und vermutlich auch bleiben. Aber man weiß ja nie, wie verrückt das Leben spielt. Bei der von dem kanadischen Parlament 1982 geplanten gesetzlichen Neufassung müssen aber auch gesetzliche Hemmnisse bedacht werden, um Missbrauch von vornherein ausschließen zu können. Wie sollte ein neues Gesetz lauten, damit es z.B. nicht durch einen Vater/Bruder im Zusammenwirken mit der Tochter/Schwester unterlaufen werden kann, wenn die beiden heiraten wollten? Das ginge ja ganz einfach: Die Tochter ließe sich durch einen Freund des ehewilligen Verwandten adoptieren und würde dann nach bürgerlichem Recht nicht mehr als verwandt mit dem Vater oder Bruder gelten. Soll das zulässig sein? Wie kann man das Bad ohne das Kind ausschütten? Im deutschen Recht war dieser Fall durch § 4 Ehegesetz, jetzt durch § 1307 BGB, bedacht und geregelt: "§ 4 Verwandtschaft und Schwägerschaft / jetzt ohne Schwägerschaftsheiratsverbot § 1307 BGB Verwandtschaft Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Verwandten in gerader Linie, zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern [sowie zwischen Verschwägerten in gerader Linie]. Das gilt auch, wenn das Verwandtschaftsverhältnis durch Annahme als Kind erloschen ist." Der kanadische Gesetzgeber brauchte bei der Abfassung der "Lex Broddy" also nur die einschlägigen Paragraphen aus dem deutschen Ehegesetz abzuschreiben. So etwas wird auch gemacht: Bei einer anstehenden gesetzlichen Neuregelung kuckt man schon über den Zaun, wie ein juristisches Problem vielleicht in einem anderen Land sinnvoll geregelt worden ist, und welche Erfahrungen mit dieser ins Auge gefassten Regelung dort gesammelt worden sind. Das ist die Aufgabe der rechtsvergleichenden Jurisprudenz. Man kann bei der Erarbeitung eines Gesetzes oft nicht gleich alle Eventualitäten von vornherein mitbedenken, auch wenn man sich noch so sehr darum bemüht. Das geht meistens schief. Die mangelnde Voraussicht wird in den wenigsten Fällen vorwerfbar sein. Immer sind die sich entwickelnden Lebensverhältnisse, ist das pralle Leben einfallsreicher als der um Voraussicht und Nachvollziehbarkeit sich mühende Mensch! „Fast ganz normal Was Brittany denkt, weiß Abigail nicht so genau, und Abbys Gefühle sind anders als Brittys. Trotzdem verstehen sich die achtjährigen Schwestern, die in einem Körper leben, blendend – meistens. Manchmal gibt es Streit. Dann haut eine Hand die andere. ... Abby und Britty sind zwei Menschen und teilen sich einen Körper. Sie haben einen gemeinsamen Rumpf, auf dem ihre beiden Köpfe sitzen – eine aberwitzige Laune der Natur. Die medizinische 184 Literatur kennt weltweit ganze vier Fälle dieser Art von siamesischen Zwillingen. ... Die Zwillinge haben zwei Herzen in ihrem gemeinsamen Körper. Außerdem drei Lungenflügel, drei Nieren und zwei Mägen. Aber nur eine Leber und dann von den Hüften abwärts alle Organe bloß noch in einfacher Ausfertigung. ... Dem rechten Bein gibt Abbys Gehirn, dem linken aber das von Britty die Befehle. Wenn beide [in ihrem Wollen] nicht übereinstimmen, kommt es zur Totalblockade. ... Manchmal streiten sie sich. Dann haut eine Hand die andere. ... Sie fühlen sich verschieden: Abby ist energischer, Britty musischer. ... Britty will Künstlerin werden, ihre Schwester Kindergärtnerin. ... Überleben aber werden sie nur als Einheit. Zwar fühlen sie Durst und Hunger getrennt, zwar spürt die eine nicht, wenn jemand die andere auf deren Körperseite kitzelt, doch über den Blutkreislauf sind sie untrennbar verbunden. ... Doch mit der Pubertät kommt bald die Zeit, in der die Kinder sich abgrenzen, sich zurückziehen wollen. ... Britty und Abby haben gesunde Fortpflanzungsorgane in ihrem gemeinsamen Unterleib. Abby sagt, sie will Kinder haben. Ihre Eltern meinen, daß ihre Zwillinge heiraten sollten. Die Mutter wünscht sich zwei Ehemänner, der Vater einen für beide. ...“ (STERN 42/98) Man kann durch ein Studium ja richtiggehend »verbildet« werden: Als ich den vorstehenden Artikel las, erwischte ich mich dabei, wie der Jurist in mir während des Lesens sofort die sich mit einem solchen Schicksal auftürmenden juristischen Probleme rauszupulen und anzudenken begann: Wenn ein Mann die Zwillinge heiratet: ist das dann Bigamie? Wenn er mit dem einen Unterleib »schläft«: ist das dann bezüglich der mit ihm nicht verheirateten Frau, seiner Schwägerin, nur außerehelicher Geschlechtsverkehr, der in der Hälfte der us-amerikanischen Staaten strafbar ist (zum Glück für Bill Clinton aber nicht in Washington.), oder gar eine Vergewaltigung? Wenn Kinder kommen: wer ist die Mutter? Wenn zwei Ehemänner da sind und mit dem einen gemeinsamen Unterleib ihrer Frauen »wohllüstig« zusammen sind – an den Gedanken müssten sich alle vier vermutlich erst einmal gewöhnen, denn wie ist man da diskret, und bekommt auch immer die jeweilige Frau die ihr von ihrem Mann zugedachten Gefühle, werden auch immer in dem Gehirn der zugehörigen Ehefrau die Endorphine ausgeschüttet? –: von wem sind dann die Kinder, von welchem Vater und welcher Mutter? Aber im Zeitalter der Genanalyse ist dieses das wohl inzwischen medizinisch und dadurch dann auch juristisch am leichtesten zu lösende Problem. Ohne Genanalyse wäre es wohl kaum zu lösen. Von solchen Besonderheiten der Natur einmal abgesehen und zu unseren alltäglichen Normalfällen zurückkehrend gilt die Beobachtung, dass man bei der Konzipierung eines Gesetzes oft nicht gleich alle Eventualitäten von vornherein mitbedenken kann, auch wenn sich der Gesetzgeber und die ihm zuarbeitende Ministerialbürokratie noch so sehr darum bemühen. „Tausend Fälle können eintreten, die der Gesetzgeber nicht vorausgesehen hat. Das Gefühl dafür, dass man nicht alles voraussehen kann, ist eine sehr notwendige Voraussicht“ (Rousseau). Darum muss „... der Gesetzgeber ... über seiner Zeit stehen. Er arbeitet für die Zukunft mehr als für die Gegenwart, mehr für die heranwachsende als für die alternde Generation“, forderte sein Landsmann Balzac. Das gilt deswegen verstärkt, weil die Halbwertzeiten von Gesetzen sich beschleunigt haben, da sie zunehmend mit heißer Nadel genäht werden. (Das konnte man u.a. in Deutschland nach dem Regierungswechsel 1998 sehr anschaulich beobachten. Man konnte gar nicht so schnell Zeitung lesen, um sich auf dem Laufenden zu halten, wie die Gesetze geändert wurden!) Irgendein Problem rutscht den »Gesetzesmachern« dabei oft doch durch die Finger. Da muss dann später nachgebessert werden, damit ein Gesetz von den Betroffenen angenommen wird und im Extremfall nicht als ungerecht oder gar unmenschlich empfunden wird. Darauf hatte schon Jesus hingewiesen, indem er zur Belehrung der selbstgerechten jüdisch-orthodoxen priesterlichen Gesetzesfanatiker und zu deren Ärger demonstrativ gegen das strikte Feiertagsruhe-Gebot verstieß und am Sabbat Kranke heilte, denn für Jesus stand der Mensch im Mittelpunkt des weltlichen Lebens, nicht das von den Priestern verwaltete und interpretierte Gesetz. Leider vermochten seine irdischen Statthalter das nicht so zu sehen: Für die Päpste standen nicht die Menschen mit ihren Bedürfnissen und Nöten im Mittelpunkt, so dass notfalls auch einmal ein Gesetz ohne Prinzipienreiterei zur Seite geschoben worden wäre, um einer menschlichen Notlage auf mitmenschliche Art und Weise gerecht zu werden. Für eine Kirche, die einen jahrzehntelangen Prinzipstreit aus Fragen wie der machen konnte, wie viele Engel auf einer Nadel- oder Kirchturmsspitze Platz hätten, hatten die von ihr erlassenen Gesetze zu gelten; gleichgültig, wie viel Leid und welche Gewissens- und damit Seelenqualen sie über Jahrtausende dadurch hervorrief! Und dieses starre Festhalten an auf falschem biologischen und religiösen Fundament gegründeten und schon längst überholten Kirchenrechtsnormen im Sexualbereich dauert bis in 185 unsere Zeit an. Das weist die Professorin für katholische Theologie Ranke-Heinemann in ihrem verdienstvollen Buch für den Bereich katholische Kirche und Sexualität an vielen Beispielen nach. Ein von der Tochter unseres früheren Bundespräsidenten Heinemann in ihrem Buch gegebenes Beispiel mit Geltung für unsere heutige Zeit gefällig? Bitte sehr: „Dieses von Thomas [von Aquin, Ehrentitel: lumen ecclesiae, das Kirchenlicht, 1274 gestorbener Hochscholastiker, dessen auf antiken Autoren wie frühen Kirchenvätern und -lehrern, z.B. Augustinus, und den biologisch teilweise falschen Ansichten des Aristoteles fußende Sexualethik bis in unsere Zeit maßgeblich geworden und geblieben ist; der Autor] mit Berufung auf Gott und die Natur vorgeschriebene zielgerechte und zielgerichtete Ausscheiden des Samens findet heute eine Auswirkung bei der sog. homologen Insemination. Letztere wurde 1987 von der Vatikanischen Kongregation für Glaubenslehre verboten: »Die homologe künstliche Besamung innerhalb der Ehe kann nicht zugelassen werden.« Es gibt jedoch eine Ausnahme: Bei einer Gewinnung des männlichen Spermas durch den ehelichen Akt mittels Kondom muß dieses Kondom durchlöchert sein, damit die Form eines natürlichen Zeugungsaktes aufrechterhalten bleibt und nicht eine unerlaubte Verhütungsmethode stattfindet. Der Eheverkehr muß also so ablaufen, als ob er zur Zeugung führte. Das Kondom muß so durchlöchert sein, als ob Zeugung auf diese Art möglich wäre (vgl. PublikForum, 29.5.1987, S. 8). Und nur auf diesem Umweg über den wie ein fruchtbarer Akt ablaufenden unfruchtbaren ehelichen Akt darf man dann zur Fruchtbarkeit Nachhilfe leisten. Die angeblich natürliche Form des ehelichen Aktes ist das erste Gebot geworden und auch dann geblieben, wenn sein ursprüngliches von der Kirche vorgeschriebenes Ziel, nämlich die Zeugung, gar nicht erreicht werden kann und Gewinnung des Samens durch Masturbation genausogut oder unkomplizierter wäre. Aber Masturbation fällt immer noch und auch dann noch unter die widernatürlichen, weil zeugungsverhindernden schwersten Sünden, wenn sie eine Zeugung gerade ermöglichen soll. Der genormte Ablauf ist wichtiger geworden als das Ziel, nämlich die Zeugung. Was »natürlich« ist, wird in der Moraltheologie von alten Traditionen bestimmt und diese Tradition von alten ehefernen Männern sorgfältig gehütet.“1 Nun könnte man sich als Nicht-Katholik über ein Kondom, das zum Auffangen des Samens des Ehemannes vor Gebrauch extra durchlöchert wird, schlapp lachen – oder über den katholischen Klerus nur noch resigniert mit den Schultern zucken. Aber dann hätte sich die Wiedergabe des im katholischen Kirchenrecht gründenden Standpunktes des Vatikans bezüglich der homologen künstlichen Besamung innerhalb der Ehe kaum gelohnt. Dieses in die Problematik „des Rechts“ einführende Buch soll ja nicht zu einem Witzbuch ausarten – auch wenn es manchmal bewusst Gelegenheit zum befreienden Lachen bietet, weil man sonst nicht alles ertragen könnte, was einem im Bereich des Rechts manchmal so geboten wird. Und außerdem: „Über jedem guten Buch muss das Gesicht des Lesers von Zeit zu Zeit hell werden“ (Christian Morgenstern). Weil es das Anliegen dieses Buches ist, Sie beim Verstehen dessen zu unterstützen, was »Recht« für eine staatlich oder religiös definierte - Gemeinschaft bedeutet, und Ihnen u.a. die Einsicht vermittelt werden soll, dass das Recht letztlich oft religiös auf dem hinter der jeweiligen Religion stehenden Menschenbild gegründet ist oder – wie bei der rechtlichen Benachteiligung der griechischen Frauen in der Antike dargestellt – mit dem hinter der jeweiligen Religion stehenden Menschenbild auch nur hergesucht begründet wurde und wird, soll nicht schulterzuckend über die Stellungnahme des Vatikans zur homologen künstlichen Besamung innerhalb der Ehe hinweg gegangen werden. Das Interessante ist ja die Frage, wie es zu so einer abstrusen, gleichwohl mit völligem Ernst vertretenen kirchenrechtlichen Regelung kommen kann, ein Präservativ zu durchlöchern, um dann mit dem bewusst zerstörten Verhüterli den Samen des Ehemannes aufzufangen: Wie sieht das der eigenartig anmutenden rechtlichen Regelung zu Grunde liegende religiös begründete geistige Konstrukt aus? Seit Jahrtausenden galt nach der Überzeugung von Kirchenlehrern, dass selbst nicht verhütender Geschlechtsverkehr – von verhütendem ganz zu schweigen! - sogar unter Ehepartnern, weil mit fleischlicher Lust verbunden und darum (oft/meistens?) mit Genuss vollzogen, eine Sünde sei.2 Insbesondere aber sei Geschlechtsverkehr dann äußerst sündhaft, wenn er „widernatürlich“ ausgeübt werde. Das sei nicht nur bei „Sodomie“ (eigentlich: Unzucht mit Tieren; in der katholischen Kirche aber jahrhundertelang verwendete Bezeichnung für Analverkehr und Homosexualität) – die bis 1975 auch durch §§ 175 ff StGB mit 1 2 Ranke-Heinemann, Uta: Eunuchen für das Himmelreich Katholische Kirche und Sexualität, Hamburg 1988, S. 206 f Papst Gregor I., der Große († 604): „Die Lust kann nie ohne Sünde sein.“ In „Responsum Gregorii“ / Antwortschreiben an den Bischof Augustinus von England. Dieses Zitat habe in der katholischen Kirch eine sehr große Wirkung gehabt, da es „bis in unser Jahrhundert als vom großen Papst Gregor I. stammend unentwegt zitiert“ wurde. Vgl. Ranke-Heinemann, Uta: Eunuchen für das Himmelreich Katholische Kirche und Sexualität, Hamburg 1988, S. 147 186 Gefängnisstrafe und zeitweiliger Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte unter Strafdrohung stand - der Fall, sondern auch dann, wenn zwar Mann und Frau den Geschlechtsakt ausführten, dabei aber keine Zeugung beabsichtigt sei – was staatlicherseits nicht bis ins 20. Jahrhundert strafbewehrt war -, weil dann ja (ebenfalls!) männlicher Samen vergeudet werde. In dem männlichen Samen wurde – in Anlehnung an die biologischen Vorstellungen des Aristoteles – eine „potentieller Mensch“ und damit etwas Göttliches und darum besonders Schützenswertes gesehen, weil nach dieser Vorstellung der Mann der allein Zeugende und die Frau nur das empfangende Gefäß sei – wie der Ackersmann den Samen in die Ackerfurche streut und daraus neues Leben wächst; eine Anschauung, die sich 1677 nach der Entdeckung der beweglichen Samenfäden im männlichen Ejakulat noch einmal besonders festigte. Auch nach der Entdeckung des weiblichen Eies 1827 wurde die Jahrtausende Geltung besessen habende theologische Sichtweise auf die unterschiedlichen Anteile von Mann und Frau an der Entstehung neuen Lebens nicht den neueren Erkenntnissen der Biologie angepasst. Bis zur Einführung des Kirchlichen Gesetzbuches der katholischen Kirche CIC 1917 galt als grundlegendes Werk des katholischen Kirchenrechts die 1142 entstandene, u.a. auf den Lehren des Augustinus fußende Gesetzessammlung des Mönches Gratian. In dieser Gesetzessammlung wird eine Stufenleiter der Unzucht aufgestellt, an deren Spitze der Coitus interruptus stehe. Er sei nach christlichem Kirchenrecht die Spitze der Unzucht, verwerflicher als Hurerei oder der als schlimmer angesehene Ehebruch, ja sogar schlimmer noch als Geschlechtsverkehr mit der eigenen Mutter, wenn der Verkehr mit der eigenen Mutter „natürlich“, d.h., auf Zeugung hin offen ist.3 Der Geschlechtsakt sei hingegen höchstens dann sittlich, wenn er der von der Kirche vorgegebenen Ordnung in Zweck – ausschließlich Zeugung - und Körperhaltung(!) – z.B. dürfe die Frau nicht auf dem Mann sitzen, sondern habe in bestmöglicher Empfängnisposition mit gespreizten Beinen unter ihm auf dem Rücken zu liegen, damit der Samen des Mannes nicht aus ihrer beim Sitzen „umgedrehten“ Gebärmutter herausfließen könne, um so die beste Empfängnismöglichkeit zu gewährleisten - entspreche. Diese etwas längeren Ausführungen waren notwendig, um zu verdeutlichen, warum nach katholischem Kirchenrecht u.a. Verhütung als eine Todsünde angesehen wird und wie sich diese Ansicht dann auf den Bereich der sogenannten homologen Insemination bis heute auswirkt. Sklavischer Gesetzesgehorsam kann - im günstigsten Fall - eine menschliche Gesetzesanwendung verhindern. „Nur mit allen Fingern SAD New York – Seit drei Jahren versucht der 78 Jahre alte Exilkubaner Armando Valencia, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Siebenmal hat der alte Mann, der seit 27 Jahren in Miami lebt, schon ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt, achtmal musste er seine Fingerabdrücke abliefern. Zweimal wurde er sogar schon eingeladen, den Eid als amerikanischer Staatsbürger abzulegen, doch beide Male wurde er wieder zurückgeschickt. Valencias Problem ist, dass er keinen kompletten Satz von Fingerabdrücken vorlegen kann – er verlor vor 20 Jahren bei einem Arbeitsunfall zwei Finger.“ (HH A 05.12.98) Im Extremfall kann sklavischer Gesetzesgehorsam zu abgrundtiefer Inhumanität führen, wie wir Deutschen es an den Rassegesetzen der Nazis erlebt haben. 2.7.2 Kampf um gesetzliche Neuregelungen auf Grund geänderter gesellschaftlicher Verhältnisse am Beispiel der Feiertagsruhe Auch in der Bundesrepublik besteht ein grundsätzliches, in verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen angeordnetes, letztlich auf die in Art. 4 II GG geregelte ungestörte Religionsausübung zurückführbares Feiertagsgebot. Darum ist vor Jahrzehnten ein Gartenbesitzer sogar zu einem Bußgeld verurteilt worden, weil ihn ein missgünstiger Nachbar angezeigt hatte, als der Gartenbesitzer an einem Sonntag frisch angelieferte Bäume eingepflanzt hatte, um sie nicht vertrocknen zu lassen. Dieser Hinweis half dem Angezeigten vor Gericht aber nicht, obwohl das Verbot der Feiertagsarbeit u.a. nicht bei unaufschiebbaren Arbeiten in der Landwirtschaft gilt! Die Richter hätten so sehr leicht von dieser gesetzlich vorgesehenen Ausnahme vom Verbot der Feiertagsarbeit ausgehend eine Analogie4 zu Gunsten des Angezeigten bilden können! (Solche Analogien sind 3 4 Ranke-Heinemann, Uta: Eunuchen für das Himmelreich Katholische Kirche und Sexualität, Hamburg 1988, S. 211 f Eine in einem anderen Zusammenhang geschaffene Rechtsnorm mit rechtsähnlichem Tatbestand wie in dem zu regelnden Fall wird wegen der so beurteilten gleichen oder ähnlichen Interessenslage auf einen nicht geregelten Bereich übertragen, um durch die in dieser Rechtsnorm angeordnete Rechtsfolge auch in dem bisher gesetzlich nicht geregelten Fall zu einem 187 grundsätzlich erlaubt; im Bereich des Strafrechts in einem Rechtsstaat aber nur zu Gunsten eines Angeklagten, nie zu seinen Ungunsten!) Werden die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur strikten Wahrung der Feiertagsruhe in unserer säkularisierten Welt von der Mehrheit der Bevölkerung noch angenommen? Werden sie den Anforderungen an eine moderne Industriegesellschaft noch gerecht? Wohl eher nicht. Werden diese Bestimmungen von den Verwaltungsjuristen und denen der Verwaltungsgerichtsbarkeit noch ernstgenommen oder - wie der § 218 StGB vor seiner Neuregelung 1975 - von den Gerichten mehr oder minder übergangen? Bisher: Ja, sie werden noch ernstgenommen. Gelten sie auch für Maschinen? Dazu einige Zeitungsmeldungen: "Sonntags nie in den Waschsalon ddp Kassel - Auch wenn keine Menschen, sondern Maschinen in Münzwaschsalons arbeiten, müssen sie die Sonn- und Feiertagsruhe einhalten - zumindest in Hessen. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel untersagte einem Unternehmer, sein Geschäft außer an Werktagen zu öffnen. Mit dem Urteil bestätigte das Gericht ein von der Stadt Wiesbaden verhängtes Öffnungsverbot. Der Waschsalon sei auf Gewinnerzielung gerichtet, der Betrieb damit Arbeit. Die Feiertagsgesetze der meisten anderen Bundesländer seien zwar ähnlich, die Eilentscheidung aber nicht unbedingt übertragbar (Az.: 8 TH 17/92)." (HH A 15.05.92) Ähnlich war die Rechtslage vom Hamburgischen OVG 1991 beurteilt worden, ohne dass die Politiker sich damit zufrieden gaben: Kampf um gesetzlic he Neuregel ungen auf Grund geändert er gesellsch aftlicher Verhältni sse am Beispiel der Feiertags ruhe "Bezirk Wandsbek fordert Betriebserlaubnis für Autowaschanlagen Streit um sauberen Sonntag Die Bezirksversammlung Wandsbek legt sich mit der Hamburger Justiz an. Mit großer Mehrheit sprach sich das Kommunalparlament jetzt für den Betrieb von Autowaschanlagen an Sonntagen aus. Genau das aber hatte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht im vorigen Jahr verboten. Trotzdem forderte die Bezirksversammlung Wandsbek `Bürgermeisterin' Ingrid Soehring (CDU) auf, sich beim Senat für die Öffnung der Autowaschanlagen einzusetzen. `Es ist die einhellige Auffassung aller Fraktionen, daß das hamburgische Feiertagsrecht liberalisiert werden muß, um den Anforderungen der Bürger in einer immer stärker auf Freizeit orientierten Gesellschaft gerecht zu werden', sagte der CDU-Abgeordnete Detlef Gottschalck. Die noch weitergehende Forderung der Christdemokraten, den Betrieb von Fitneßstudios, Mitfahrzentralen und privaten Flohmärkten am Sonntag zuzulassen, wurde jedoch von der SPD/FDP-Mehrheit abgelehnt. Dem Pro-Waschanlagen-Beschluß von Wandsbek lag ein Antrag der FDP zugrunde. Darin wurde auf die Umweltbelastung hingewiesen, die entsteht, wenn Autofahrer ihre Wagen wochenends am Straßenrand oder auf dem Grundstück waschen. Der liberale Fraktionsvorsitzende Dr. Dr. Hans Joachim Widmann meint: `Die Sonn- und Feiertagsruheverordnung und das aus ihr abgeleitete Waschverbot stammen aus einer Zeit, in der die Vorstellung herrschte, daß der Bürger sonntags in der Kirche und zu Hause sein sollte. Diese Vorstellung widerspricht unserer heutigen flexiblen Freizeitgesellschaft.' Dagegen stellte das Oberverwaltungsgericht in einer 1991 rechtskräftig gewordenen Entscheidung (Aktenzeichen OVG Bf VI 54/89) fest: `Der Betrieb einer automatischen Autowaschanlage sowie der Einsatz von Münzstaubsaugern an Sonn- und Feiertagen stehen im Widerspruch zu der besonderen Natur dieser Tage und sind geeignet, die äußere Ruhe dieser Tage zu stören.' Die Autopflege dient nach Ansicht der Richter `vornehmlich ästhetischen Zwecken'. ... Die Hamburger Feiertagsschutzverordnung untersagt an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen `alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten'. ... `Der Sonntag darf nicht zum Arbeitstag werden', sagt Dr. Mattner. Der Spezialist hat ein schon in als angemessen erachteten Ergebnis zu gelangen. Über die Berechtigung für die rechtsanaloge Anwendung lässt sich dann trefflich streiten. Aber so gibt es neue Doktoren der Rechte. Im Strafrecht ist eine Analogiebildung zu Ungunsten eines Täters strikt verboten. Das gilt für einen Rechtsstaat, der NaziDeutschland nicht war und wo zur Vermeidung sonst fälliger Freisprüche oder um zur für das abzuurteilende Delikt vom Gesetz nicht vorgesehenen Todesstrafe gelangen zu können, Analogien zu Ungunsten der in die Rechtsmaschinerie Geratenen gebildet worden waren. 188 zweiter Auflage erschienenes 250-Seiten-Werk über das `Sonn- und Feiertagsrecht' geschrieben." (HH A 11.05.92) "Zwei Vorstöße aus der Koalition Sonntags arbeiten ap/rtr München - Die Deutschen sollen nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann (FDP) auch sonntags arbeiten. `Wir können es uns in der hoch automatisierten deutschen Wirtschaft nicht länger leisten, daß teure Maschinen nur fünf Tage in der Woche laufen', sagte Möllemann der `Bunten'. ..." "Sonntags bräunen? dpa Berlin - Bräunungsstudios dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts. Die Stadt Karlsruhe unterlag Baden-Württemberg (Az 1 C 38.90)." "Feiertagsrecht soll renoviert werden Suche nach dem neuen Sonntag Wie heilig ist der Sonntag? Die Hamburger Feiertagsverordnung verbietet an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich `öffentlich bemerkbare Arbeiten'. Welche Tätigkeiten sind darunter zu verstehen? ... `Wir brauchen ein Gesetz, das der Verfassung ebenso Rechnung trägt wie den Bedürfnissen einer modernen Freizeitgesellschaft', ... Das Grundgesetz gebietet - ebenso wie früher schon die Weimarer Reichsverfassung: ‘Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.' Andererseits haben sich die Freizeitgewohnheiten in den vergangenen Jahrzehnten stark geändert. ... Etwa 90 Prozent der Fitneßstudios sind auch am Sonntag in Betrieb, sie sind dann sogar am stärksten ausgelastet. Bei den Sonnenstudios hat nur gut die Hälfte auch am Sonntag geöffnet. Autowaschbetriebe bleiben an diesem Tag geschlossen. Tankstellen dürfen ihre nebenbei betriebenen Autowaschanlagen nicht mehr sonntags in Gang setzen. Das Oberverwaltungsgericht hat dies im vorigen Jahr verboten. Die Studie stellte auch fest, daß ein Teil der mit Sonntagsarbeit Beschäftigten gern einen festen freien Tag in der Woche hätte. ..." (HH A 16.11.92) "Sonntagsarbeit ap Bonn - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) lehnt es ab, künftig am Sonntag mehr Arbeit zuzulassen. `Die Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Deutschland erfordert es nicht, daß der Sonntag zum Arbeitstag gemacht wird', meinte der neue CDA-Vorsitzende Werner Schreiber." (HH A 12.06.93) "Bald auch sonntags arbeiten rtr Bonn - Bundeswirtschaftsminister Günter Rexrodt (FDP) will das Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen lockern und das Nachtarbeitsverbot für Frauen aufheben. Es müsse möglich sein, an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten, wenn dies zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen notwendig sei, sagte Rexrodt." (HH A 15.06.93) "Sorge um freien Sonntag dpa Baden-Baden - Die katholische Kirche lehnt eine Ausweitung der Sonntagsarbeit weiterhin ab. Zwar sage die Kirche nicht generell nein zur Sonntagsarbeit, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann. Allerdings dürfe die gegenwärtige Wirtschaftskrise nicht dazu benutzt werden, jetzt etwas zu erreichen, was man schon immer habe durchsetzen wollen. Sollten ausschließlich wirtschaftliche Gründe den Ausschlag geben, dann sei ein `Dammbruch' gegen einen arbeitsfreien Sonntag zu befürchten. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums arbeiten rund drei Millionen Menschen regelmäßig an Sonn- und Feiertagen. Das sind knapp neun Prozent aller Beschäftigten. Der Mitte Juli vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf für ein neues Arbeitszeitgesetz sieht vor, daß Unternehmen aus Konkurrenzgründen Sonn- und Feiertagsarbeit anordnen können." (HH A 10.08.93) Als das Buch konzipiert wurde, war die Problematik schon zeitweilig aktuell. Das erste Ladenschlussgesetz war in der Bundesrepublik 1956 auf der Grundlage der kaiserlichen Gewerbeordnung von 1891 eingeführt worden. 189 1989 wurde der donnerstägliche „Dienstleistungsabend“ zugelassen. 1996 gab es eine weitere Novellierung des Ladenschlussgesetzes, der zufolge die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag auf 20 Uhr verlängert wurden. Im Zuge der Internationalisierung und Globalisierung kochte die Diskussion um eine Freigabe der Ladenöffnungszeiten 1999 wieder hoch. Im Jahre 2000 wurde von den Ländern über den Bundesrat eine weiter liberalisierte »Neunovellierung« des Ladenschlussgesetzes angestrebt.5 Die Befürworter längerer, bis zumindest in Feriengebieten - möglicherweise auch in den Sonntag ausgedehnter Wochenöffnungszeiten und Gegner der »Service-Wüste Deutschland« verweisen auf die Beispiele in anderen, teilweise kirchlich sehr geprägten katholischen Ländern wie z.B. Mexiko, in denen man in großen Städten in vielen Supermärkten jeden Tag 24 Stunden lang an allen sieben Tagen in der Woche einkaufen kann. Sie sehen ein „erhebliches öffentliches Interesse“ an längeren Öffnungszeiten, die den Sonntag mit umfassen sollten. Grundsätzliche sonn- und feiertägliche Öffnungszeiten kannten im Europa des Jahres 2004 Großbritannien und das noch sehr katholische Irland ganztägig von 00-24 Uhr, Schweden von 05-24 Uhr, Portugal von 06-24 Uhr und Finnland von 09-20 Uhr; in Belgien und Frankreich gab es ein Beschäftigungsverbot für Angestellte, in allen anderen Ländern der EU galt hinsichtlich der Ladenöffnungszeiten ein Sonn- und Feiertagsverbot. Die Gegner einer Sonntagsöffnung - und die Mehrzahl der Gerichte – setzten sprachlich einen drauf und erkannten ein „überragendes öffentliches Interesse“ daran, die im dritten der Zehn Gebote angeordnete Feiertagsruhe weiterhin zu heiligen. Sie diffamierten das von den Befürwortern behauptete „erhebliche öffentliche Interesse“ als Tanz ums Goldene Kalb. Aber worin besteht ihr „überragendes öffentliches Interesse“? Solche juristischen Formeln sind beliebig ausfüllbare Leerformeln: Keiner kann eindeutig zwingend nachweisen, was ein „überragendes/erhebliches“ öffentliches Interesse im jeweils konkreten Einzelfall genau bedeutet und worin sich beide graduell unterscheiden. Da kommen dann die oft nicht mitgeteilten, sondern nur unterstellten oder pauschal behaupteten Wertungen des Argumentierenden zum Tragen. Rund um die Uhr shoppen in 10 Ländern Werktags soll der gesetzliche Ladenschluss von Rügen bis Passau gestrichen werden HAMBURG dpa Die gesetzlichen Ladenschlusszeiten sollen nach dem Willen von zehn Bundesländern bald Geschichte sein. Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen die Ladenöffnungszeiten an allen Werktagen freigeben, berichtet die Bild am Sonntag. Die Bundesländer hatten sich im Bundesrat auf einen Gesetzentwurf der baden-württembergischen Landesregierung geeinigt, wonach künftig die Länder für den Ladenschluss zuständig sein sollen und nicht mehr der Bund. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen noch weitergehen und Geschäften in Urlaubsorten auch den Sonntagsverkauf erlauben. Dagegen will das Saarland die Ladenschlusszeiten nicht verändern. Noch nicht festgelegt hätten sich Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz und Schleswig-Holstein. (taz 20.09.04) Die Gewerkschaft Ver.di lehnte die Pläne für das Einkaufen rund um die Uhr an allen Werktagen selbstverständlich und reflexartig strikt und kategorisch ab, weil eine Freigabe der Ladenöffnungszeiten zu Lasten der Beschäftigten im Einzelhandel gehe. Auch die kleineren und mittleren Betriebe würden darunter leiden. Ein Aus für die bisherigen gesetzlichen Ladenschlusszeiten wäre "ökonomischer Schwachsinn". Die absehbare Folge wäre eine weitere Konzentration im Handel. Das Ladenschlussgesetz sei ein "Arbeitnehmerschutzgesetz". Die Auswirkungen einer Freigabe der Öffnungszeiten für die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten kümmerten Politiker, die ein Einkaufen rund um die Uhr forderten, offensichtlich einen "feuchten Kehricht". Befürworter der Freigabe der Ladenöffnungszeiten argumentieren hingegen, eine hohe Flexibilität bei den Öffnungszeiten von Montag bis Samstag sei sinnvoll, weil dadurch in Handel und Dienstleistungsgewerbe neue, dauerhafte Arbeitsplätze entstehen könnten – obwohl das Kaufvolumen bei der angespannten wirtschaftlichen 5 Nach einer im Juni 2004 ergangenen Entscheidung des BVerfGs, die den Ländern die grundsätzliche Kompetenz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten zuwies, einigten sich im September 2004 die Länder auf eine Bundesratsinitiative Baden-Württembergs hin auf ein flexibles Ladenöffnungsrecht. Angestrebt wurde im Zeitalter der Rund-um-die-UhrEinkaufsmöglichkeit im Internet, dass grundsätzlich für alle Geschäfte die Öffnungszeiten montags bis freitags von 06-22 Uhr und samstags von 06-20 Uhr möglich sein sollen. Zusätzlich solle es Verkaufsmöglichkeiten an grundsätzlich vier Sonntagen außerhalb des Weihnachtsgeschäftes geben. Sonntagssonderregelungen für Orte mit touristischem Schwerpunkt sind möglich. 190 Gesamtsituation vermutlich nicht steigen wird, wohl aber die Personalkosten, die der Einzelhandel bei der immer wieder publizierten geringen Rendite gar nicht wird aufbringen können. Von der Hoffnung auf weitere Arbeitsplätze hat sich auch der Gesetzgeber leiten lassen; ob sich die Hoffnungen bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Gesetzgebung ist halt ab und zu ein Schuss ins Blaue. Im Fall sonntäglicher Geschäftsöffnung sehen bei uns kirchlich sich gebunden Fühlende den Untergang des christlichen Abendlandes heraufdämmern - obwohl in dem wohl katholischsten Land Europas, in Polen, die Geschäfte sonntags geöffnet haben, ohne dass dieses den äußerst katholischen Grundcharakter des Landes verändert hätte. Diese sich kirchlich gebunden Fühlenden gehören mit zur politischen Meinungsträgerschaft unseres Landes; im Gegensatz zu denjenigen, die den leeren Kirchen fernbleiben. Doch, um es an einem Beispiel deutlich zu machen: Der noch sehr kirchlich geprägte katholische Charakter z.B. Mexikos wird von der katholischen Kirche des Landes durch die dort generell erlaubten fakultativen sonntäglichen Geschäftsöffnungen nicht als gefährdet angesehen. Viele großstädtische Mexikaner benutzen ihren Kühlschrank - so sie zu der Schicht derer gehören, die sich ein solches Haushaltsgerät kaufen kann - nach eigener, aber zugegeben nicht unbedingt repräsentativer Beobachtung, verstärkt zum Kühlen von Getränken, aber nicht zu einer so ausgeprägten Vorratshaltung wie sie in Deutschland gebräuchlicher ist. Wozu auch, wenn man bei Bedarf um die Ecke in den sieben Tage die Woche Tag und Nacht geöffneten Supermarkt gehen kann! Das ist wohl auch auf den den Lebensstil der Mexikaner mitprägenden Einfluss des übergroßen Nachbarn im Norden zurückzuführen, der einen mexikanischen Staatspräsidenten in den Stoßseufzer ausbrechen ließ: „Armes Mexiko: so nah an den Vereinigten Staaten von Amerika und so fern von Gott!“ Beim Namen genannt stehen in dem Streit um eine sonntägliche Geschäftsöffnung das allgemeine Feiertagsinteresse der Arbeitnehmer und das christliche Feiertagsinteresse gegen das Einkaufsverlangen derjenigen, die in der Woche kaum zum Einkaufen kommen oder nicht kommen wollen und das diesen Umstand kalkulierende Profitinteresse der Ladeninhaber, sowie das geänderte Freizeitverhalten. Eine weitere Liberalisierung erfolgte 2003, als den Geschäften erlaubt wurde, auch sonnabends bis 20 Uhr zu öffnen. Damit ist fast der Stand des Jahres 1900 erreicht: Damals wurden für Werktage Öffnungszeiten zwischen 5 und 21 Uhr festgelegt. Dann preschte Berlin vor, wo man seit einiger Zeit sein Auto sonntags in Waschanlagen reinigen lassen darf. 2003 erklärte die rot-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein, sie wolle den Schutz von Sonn- und Feiertagen in ihrem Land deutlich lockern. Videotheken sollen sonntags schon vor 13.00 Uhr, Waschsalons und Auto-Waschanlagen erstmals überhaupt öffnen dürfen. „Auto waschen bald auch am Sonntag Kiel - Autowaschanlagen können in Schleswig-Holstein künftig sonntags öffnen, und private Flohmärkte dürfen auch am Totensonntag stattfinden. Der Landtag will das neue Gesetz noch in dieser Woche beschließen. Einig sind sich alle Fraktionen, dass Autowaschanlagen, Waschsalons und Videotheken künftig ganztägig öffnen dürfen. Auch Saunen sowie Fitness- und Bräunungsstudios, die bisher eine Einzelverordnung benötigten, dürfen jetzt ganztägig öffnen. Die "stillen" Feiertage sind aber auch künftig besonders geschützt: Am Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag sind Tanzveranstaltungen und ausgelassene Sportfeste tabu. Kritik kommt von der CDU-Opposition. Ihr Fraktionsvize Jost de Jager befürchtet eine "Umkehr der Beweislast". So müsse künftig die Kirchengemeinde den Beweis führen, dass etwa ein Biker-Treff oder ein Straßenfest in der Nachbarschaft den Gottesdienst stört. Die SPD will dieser Argumentation nicht folgen. Eine Durchführungsbestimmung werde dafür sorgen, so ihr Rechtsexperte Peter Eichstädt, dass die Ordnungsämter auch von sich aus prüfen müssen. Klare Unterschiede gibt es in der Frage der Zuständigkeiten. Die SPD will die Ordnungsämter entscheiden lassen. Sie könnten die Situation vor Ort besser einschätzen, so Eichstädt. Die CDU setzt auf landesweite Regelungen. Uneinheitliche Entscheidungen, so befürchtet de Jager, höhlten auf Dauer den Sonntagsschutz aus. Er steht damit weitgehend allein da. Grüne, FDP und SSW wollen den SPD-Vorschlag unterstützen. Epd“ (HH A 16. 06.04) 191 Selbstverständlich kritisierte die Kirche in Schleswig-Holstein den Gesetzentwurf zur Änderung des Sonn- und Feiertagsrechts von 1953 prompt: Der Schutz der Sonn- und Feiertage, insbesondere der drei stillen Feiertage Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag, sei nicht ausreichend, Sportveranstaltungen an diesen stillen Feiertagen undenkbar. Eine Liberalisierung der Öffnungszeiten analog der in Schleswig-Holstein auf den Weg gebrachten Änderungen wird seit 2003 immer wieder einmal auch in Hamburg angestrebt, wo eine bürgerliche Koalition die FeiertagsSchutzverordnung wenigstens für Münz-Autowaschanlagen kippen will. 2004 wollte die CDU-Bürgerschaftsfraktion das „Sonntagswaschverbot“ (allerdings nur) für automatische Waschanlagen oder Wasch-Stationen, die kein Personal benötigen und nicht in Wohngebieten liegen, vom von ihr dominierten Landesparlament aufheben lassen. Um den absehbaren Konflikt mit den Kirchen von vornherein zu entschärfen, soll die Wascherlaubnis für die Automaten aber erst ab 13.00 Uhr gelten: Früher zogen Damen wie meine Mutter einen frischen Schlüpfer an, wenn sie zum Sonntagsgottesdienst gehen wollten; nach der von der Landes-CDU intendierten gesetzlichen Neuregelung müssen die Kirchgänger aber in einem dreckigen Auto vor der Kirche vorfahren und dürfen es erst hinterher waschen! Und das auch nicht in jeder automatischen Autowaschanlage: Autowaschen am Sonntag? Im Prinzip ja, aber ... Öffnen dürfen nur automatische Autowaschanlagen. Personaleinsatz ist verboten, sogar zum Kassieren. Sl – HARBURG. Erst im Februar hatte der Hamburger Senat das Kippen des Autowaschverbots an Sonn- und Feiertagen verkündet. Allerdings mit Einschränkung. So dürfen nur automatische Waschanlagen in Industriegebieten diese Dienstleistung anbieten, um Anwohner nicht zu stören. Freudestrahlend ließen die Waschanlagenbetreiber Plakate mit neuen Öffnungszeiten drucken, stellten neue Mitarbeiter ein und freuten sich auf zusätzliche Geschäfte. Um so mehr staunten American Carwash-Chefin Karin Veyhl und ihre Kollegen von anderen Waschanlagen in Harburg, als in den letzten Wochen ein Schreiben des Bezirksamtes kam. Darin heißt es: „Sie betreiben die Autowaschanlage auch an Sonntagen und setzen dafür Personal ein. Dies ist nicht zulässig. An Sonn- und Feiertagen dürfen Autowaschanlagen nach der geltenden Feiertagsschutzverordnung nur automatisch, d.h. ohne Personaleinsatz betrieben werden.“ Unter Androhung von Bußgeld wurden Veyhls aufgefordert, in Zukunft die Waschstraße an Sonn- und Feiertagen geschlossen zu halten. Zwei Tage später erschienen zwei Mitarbeiter des Verbraucherschutzamtes und überbrachten die Botschaft noch mal mündlich. „Aber wir betreiben doch eine automatische Waschanlage“, argumentierte Karin Veyhl. „Nein“, konterten die Herren, „Sie haben ja Personal zum Kasieren.“ „Natürlich“, staunte Karin Veyhl, „wir arbeiten doch nicht umsonst. Wie sollen wir denn an unser Geld kommen? Die Tankstellen haben doch auch Personal zum Kassieren.“ Das sei was völlig anderes, so die Bezirksamt-Mitarbeiter. Die Tankstellen hätten ohnehin Personal, und die würden für die Autowaschanlage quasi nur nebenbei kassieren. ... Karin Veyhl und ihre Kollegen erwägen jetzt eine Sammelklage gegen diese Verordnung.“ (Harburger Wochenblatt 11.05.05) Die Farce war damit noch nicht zu Ende, musste aber irgendwie ohne Gesichtsverlust zu Ende gebracht werden: „Streit um Autowaschanlagen Es lief so gut, dann kam das Aus: Vier automatische Autowaschanlagen in Hamburg mußten ihren Sonntagsbetrieb wieder einstellen. Der Grund: Sie haben für diesen Service zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Ein Verstoß gegen die Feiertagschutz-Verordnung, wie einem Lebensmittel- und Gewerbekontrolleur des Bezirks Wandsbek auffiel. Um es vorwegzunehmen: Das gute Ende ist in Sicht. "Wir werden sehen, daß dieser Fall arbeitnehmerfreundlich geregelt wird", heißt es aus der zuständigen Innenbehörde, nachdem der Fall einige Wellen geschlagen hatte. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit solle niemand wegen einer Verordnung seinen Job verlieren. Behördensprecher Marco Haase rechnet mit einer Änderung der Verordnung noch im Spätsommer. Für Bahn- und Busfahrer, Tankwarte, Ärzte, Mitarbeiter von Notdiensten und zahlreiche andere Berufe gilt sie schon längst nicht mehr. "Die Waschanlagenbetreiber können davon ausgehen, daß dieser Fall gerecht geregelt wird", versichert Haase. Alle sollen die gleiche Chance haben. Dennoch sind "automatisch" und "automatisch" nicht automatisch das Gleiche: Waschanlagen, für die der diensthabende Tankwart nebenan die Tickets verkauft, sowie Münzwaschanlagen gelten als absolut automatisch. Waschstraßen wie die von Mr. Wash oder Clean Car, bei denen Mitarbeiter auf der Anlage stehen, 192 sind nicht ganz so automatisch. Seit Februar können die Hamburger ihre Autos sonntags zwischen 13 und 18 Uhr waschen - in automatischen Anlagen, die in Gewerbegebieten stehen. "Von Mitarbeitern steht da gar nichts. Deshalb haben wir ja aufgemacht", erklärt ein Mitarbeiter von Mr. Wash. Und Mr.-Wash-Chef Richard Enning in Düsseldorf wundert sich. In Kiel und Berlin hat er keinerlei Probleme. Und die Anlagen dort laufen sonntags sogar ab 9 Uhr. Eli“ (HH A 26.05.05) Insbesondere Händler in Tourismuszentren wollten das die Öffnungszeiten reglementierende, ihrer Meinung nach sogar strangulierende Ladenschlussgesetz und die Feiertagsverordnung nicht mehr so verbraucherfeindlich akzeptieren, und es wurde geklagt, letztlich bis rauf zum BVerfG: Der Kaufhof am Berliner Alexanderplatz hatte im Sommer 1999 das Verfahren gezielt in Gang gebracht, als er sein Kaufhaus sowohl am Samstag nach 16 Uhr als auch am Sonntag öffnete. Ein Einzelhändler klagte auf Unterlassung und hatte damit den erwarteten Erfolg. Denn das bundesdeutsche Ladenschlussgesetz lässt Sonntagsöffnungen nur in Ausnahmefällen zu. Als das Warenhaus rechtskräftig zur Unterlassung verurteilt worden war, hatte es das oberste deutsche Gericht »angerufen«; natürlich nicht per Telefon, sondern per Klagschrift, was die Juristen auch als ein Anrufen des Gerichts bezeichnen. Die Metro-Tochter Kaufhof AG wollte das Ladenschlussgesetz kippen, weil es, so wurde argumentiert, den Konzern in seiner Berufsausübungsfreiheit unzulässig beschränke. Außerdem sei der Anspruch auf Gleichbehandlung verletzt, weil Tankstellen und Bahnhofshändler rund um die Uhr ihre Waren anbieten können: Apotheken dürfen Arzneien, Kioske Zeitungen und Bäcker Brötchen verkaufen, und an Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen kann sich der Kunde mit Artikeln des "Reisebedarfs" eindecken - wozu fast alles gehört, so dass mancher Bahnhof zum Shopping-Center und nicht wenige Tankstellen zu regelrechten Supermärkten geworden sind. Weitere Ausnahmen gelten für beliebte Tourismusziele, und Berlin-Mitte ist nun wirklich ein Tourismusziel ersten Ranges! Das Ladenschlussgesetz und das Verbot der Sonntagsöffnung seien "verhängnisvolle Symbole der Reformunfähigkeit" Deutschlands, so der Prozessvertreter der Kaufhof AG in der mündlichen Verhandlung. Bereits jetzt arbeiteten 12 Prozent aller Beschäftigten am Sonntag, und die Verbraucher wollten den "ErlebnisEinkauf". Das Ladenschlussgesetz sei eine nicht mehr zeitgemäße staatliche Gängelung. Der Schutz der 2,8 Millionen Beschäftigten im deutschen Einzelhandel sei im Arbeitszeitgesetz und in den Tarifverträgen ausreichend geregelt, so dass es des Ladenschlussgesetzes nicht bedürfe. Der Einzelhandel sei gegen über den durch Ausnahmeregelungen begünstigten Betrieben benachteiligt. Würde »Karlsruhe« das Ladenschlussgesetz für verfassungswidrig erklären? Der Sonntag steht als Tag der "Arbeitsruhe" zwar nicht ausdrücklich im Grundgesetz, aber er ist über Art. 140 GG, der einige die Kirchen betreffende Artikel der Weimarer Verfassung von 1919 für weiterhin gültig erklärt, »verdeckt« ins Grundgesetz hineingenommen worden, denn in dem u.a. übernommenen Art. 139 WV heißt es: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“ Dass ein Gesetz verfassungswidrig ist, das eine Verfassungsvorschrift umsetzt, wäre schon sehr überraschend. Die beiden großen Kirchen in Deutschland, die den arbeitsfreien Sonntag in der mündlichen Verhandlung engagiert verteidigten und die bestehenden Ausnahmeregelungen als viel zu weitgehend kritisierten, durften nicht nur auf göttlichen Beistand hoffen, sondern auch auf den des höchsten deutschen Gerichts. Einstimmig entschied das Gericht, dass das Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen verfassungsgemäß ist. Der Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe sei als Regel zu sichern. In der Frage der Beschränkung der Ladenöffnungszeiten auf 20.00 Uhr während der Werktage war das Richtergremium dagegen gespalten. Vier Richter des Ersten Senats, darunter Präsident Hans-Jürgen Papier, wollten den Ladenschluss zumindest an Werktagen freigeben. Das Gesetz sehe inzwischen so viele Ausnahmen vor, dass es nicht mehr konsequent sei. Darum sei diese Beschränkung nicht mehr gerechtfertigt. Da für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit aber eine Mehrheit der acht Richterstimmen notwendig ist, bei Stimmengleichheit eine Verfassungsklage also abgelehnt wird, blieb die Beschwerde von Kaufhof auch in dieser Hinsicht erfolglos: Der Eingriff in die Grundrechte der Ladeninhaber sei durch das Ziel gerechtfertigt, ungünstige Arbeitszeiten der Beschäftigten zu vermeiden. Der Schutz von Arbeitnehmerinteressen vor Nachtarbeit wurde als vorrangig gegenüber den Firmeninteressen gesehen und gewertet. Die Ausnahmen für Tankstellen, Bahnhöfe, Bäcker, Blumen- und andere Händler dürften nicht überschätzt werden, sie beträfen insgesamt weniger als fünf Prozent der 2,8 Mill. Beschäftigten im Einzelhandel. Die »Richterkönige« entschieden außerdem, dass der Bund auch weiterhin für den Ladenschluss zuständig ist. Seit 1994 gilt im Grundgesetz zwar eine länderfreundliche Kompetenzregelung, diese kam hier aber nicht zur 193 Anwendung, weil sie nur für neue Gesetze gilt. Allerdings könne der Bund seine diesbezügliche Gesetzgebungskompetenz an die Länder abgeben, die dann andere Öffnungszeiten in Landesladenschlussgesetzen regeln könnten. Dabei habe allerdings ein „Kernbereich an Sonn- und Feiertagsruhe unantastbar“ zu bleiben, gaben die Bundesverfassungsrichter den Landesgesetzgebern mit auf den angedeuteten Weg. 2.7.3 Juristisches Konfliktfeld Organ»spende« Juristisches Konfliktfeld Ogan»spende« Ein weiteres Beispiel für ein größere Bevölkerungsteile betreffendes juristisches Konfliktfeld neben der schon angesprochenen Neuregelung des § 218 StGB oder der Feiertagsruhe ist der Problemkreis der Organ»spende«. Er fällt, wie alle anderen Bereiche auch, unter der Fragestellung: "Muss eingeschritten werden? Was wollen wir? Was wollen wir äußerstenfalls zulassen?", als Problem zu treffender Wertentscheidungen in den Bereich »Recht« und nach dieser vorgelagerten Wertentscheidung für die nähere rechtliche Ausgestaltung in den Bereich »Gesetz«. Um zu wissen, was bei neueren Entwicklungen geregelt werden soll, muss der Gesetzgeber deshalb ein wachsames Auge auf juristische Grauzonen haben. Üblicherweise wird die Gesetzgebungsmaschinerie zur Regelung neu eröffneter technischer Möglichkeiten erst dann angeworfen, wenn bei an sich segensreichen Neuerungen Missbräuche oder eklatante Fehlentwicklungen überdeutlich geworden sind. Der Gesetzgeber hechelt der neuesten technischen Entwicklung zwangsläufig immer hinterher. So auch im Bereich der Organ»spende«. Gegen eine freiwillige lebensrettende Organspende kann niemand ernsthaft etwas Grundsätzliches vorbringen und tut es auch nicht. Organspenden werden – rein theoretisch – bejaht: man könnte ja selber auf ein Spenderorgan angewiesen sein. Die erforderliche Spendebereitschaft hingegen ist nicht in ausreichendem Umfang gegeben! Relativ unproblematisch sind freiwillige lebensrettende Organspenden dann, wenn sie gerade Gestorbenen entnommen werden. Nach sehr vielen Herz-, Nieren- und Lebertransplantationen stehen die Kirchen als überparteiliche moralische Instanzen dieser medizinischen Möglichkeit nicht (mehr) ablehnend gegenüber. Keine Probleme gibt es, wenn der Verstorbene durch einen Organspenderausweis deutlich gemacht hat, dass er im Falle seines (gesunden) Ablebens z.B. durch einen Verkehrsunfall seine intakten und benötigten Organe denjenigen zur Verfügung stellen möchte, die derer bedürfen und die gleiche Blutgruppe und die beste Organverträglichkeit aufweisen, um die trotz allem dann das weitere Leben erforderliche Immunsuppression so niedrig wie möglich zu halten: Trotz größtmöglicher Verträglichkeit wird das implantierte Organ von dem aufnehmenden Körper immer als fremd erkannt. Der aufnehmende Körper versucht, sich mit Immun- und Abstoßungsreaktionen gegen das fremde Gewebe zu wehren. Nun gibt es aber einen wesentlich größeren Bedarf an Organen, als durch solche wirklich freiwilligen Spenden zusammenkommen, denn in Deutschland ist die Spendebereitschaft deutlich geringer als in anderen europäischen Staaten. 2005 warteten in Deutschland 12.000 Menschen auf Organspenden: 9.200 Nieren, 1.500 Lebern, 600 Herzen und 450 Lungen wurden benötigt. Es wurden aber 2003 nur 13,6 Organe im Mittelwert pro eine Million Einwohner in Deutschland gespendet. (Es wurden 4.175 Organe übertragen, im Mittelwert drei pro Organspender.) In Spanien, dem Spitzenreiter in Europa, werden hingegen 31,5 Organe pro eine Million Einwohner gespendet. Deutsche Organempfänger leben – zum Ärger unserer Nachbarn - über Eurotransplant von der größeren Spendebereitschaft in den anderen europäischen Ländern, die sich ebenfalls Eurotransplant angeschlossen haben. Weil es zu wenige Spender gibt, standen 2005 rund 9.200 Deutsche mit fortgeschrittener Nierenerkrankung auf der Warteliste für eine Nierentransplantation in einem der 40 Zentren, in denen jährlich zwischen 2.000 und 2.400 Nieren verpflanzt werden; 2003 waren es 2081 Nieren von Toten, zu denen die Lebendspenden kamen. Bis zur Implantation eines geeigneten Organs sind sie auf eine Dialyse angewiesen. Neu auf die Warteliste kommen aber jedes Jahr 2.500 bis 3.000 Patienten. Die Schere zwischen dem Bedarf an Nieren und der Verfügbarkeit wird immer größer. Im Schnitt warten Patienten sechs Jahre auf eine Niere. Etwa 15 Prozent sterben, bevor sie ein Ersatzorgan erhalten können. Besonders bedroht sind Patienten mit fortgeschrittenen Leberfunktionsstörungen, meist auf Grund einer Zirrhose oder von Tumoren. Zwar sind davon weniger Menschen betroffen - etwa 1.500 Deutsche stehen auf der Warteliste für eine Lebertransplantation und rund 700 Organe werden jedes Jahr verpflanzt -, aber ihr Zustand verschlechtert sich oft rapide, und es gibt im Gegensatz zur Dialyse bei Nierenpatienten keine lebensrettende Maßnahme, um die Wartezeit zu überbrücken. Viele Patienten müssen zwei Jahre und länger auf eine 194 Lebertransplantation warten, bei der ihnen ein fremder Leberlappen eingesetzt wird. Bis zu einem Fünftel der Patienten, die auf der Warteliste stehen, sterben. 2003 wurden außerdem 194 Lungen(flügel) und 339 Spenderherzen übertragen, auf die aber schon rund 450 Patienten wegen einer Lungen- und 600 Patienten wegen einer Herztransplantation warteten. (Weltweit warten 70 000 Menschen auf ein Spenderherz, nur jeder Zehnte erhält es rechtzeitig. Die Mediziner hoffen, die Bedarfslücke in naher Zukunft mit Kunstherzen schließen zu können.) Wegen der Organarmut werden so für einen Teil der auf ein Spenderorgan wartenden rund 12.000 Menschen in Deutschland die Wartelisten zu Todeslisten. „Diese Menschen fühlen sich wie in einer Todeszelle“, berichten Ärzte. Wie soll der dringend benötigte Rest beschafft werden? Da treten Beschaffungsprobleme auf, die rechtlich irgendwie geregelt werden müssen: sowohl für Lebendspenden wie für die Organentnahme bei Verstorbenen. INTERNISTEN FORDERN Nur Spendewillige sollen selbst Organe bekommen Wer keine Organe spenden will, soll nach Meinung des Ärztefunktionärs Manfred Weber im Notfall auch selbst keine bekommen. Der Mangel an Spenderorganen kostet in Deutschland täglich zwei Menschenleben. Wiesbaden - Um den Mangel an Spendeorganen zu lindern, schlägt der Internist Manfred Weber radikale Lösungen vor: Die Haltung zur Organspende sollte regelmäßig verpflichtend bei der Verlängerung des Personalausweises abgefragt werden, forderte der Vorsitzende der Gesellschaft für Innere Medizin heute in Wiesbaden. "Wer dabei Nein sagt, bekommt auch nichts." In Nordrhein-Westfalen würden jährlich auf eine Million Einwohner nur von neun Menschen Organe gespendet. "Die Situation ist katastrophal", sagte Weber. Benötigt werden jedoch 60 Transplantationen je eine Million Einwohner pro Jahr. Menschen, die ihren Beitrag verweigerten, sollten auch Nachteile bei den Leistungen haben, erklärte der Internist. Organspenden sind ein wichtiges Thema beim 111. Deutschen Internistenkongress vom 2. bis zum 6. April in Wiesbaden. Derzeit stehen in Deutschland rund 12.000 Menschen auf der Warteliste für eine Transplantation, allein 9500 Patienten warten auf eine neue Niere. Im vergangenen Jahr wurden jedoch bundesweit nur 3500 Organe gespendet, darunter 2000 Nieren. Die Erfolgsaussichten des Eingriffs sind nach Angaben des Internistenverbandes gut: Nach einem Jahr funktionierten noch fast 90 Prozent der transplantierten Nieren. Innerhalb Deutschlands bestehen große Unterschiede in der Spendenbereitschaft. Spitzenreiter im Jahr 2004 war Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 36 Organenspenden je eine Million Einwohner, fast vier Mal so viel wie in Nordrhein-Westfalen. Über die Gründe des Organmangels wird immer wieder heftig gestritten. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) macht vor allem Krankenhäuser dafür verantwortlich, die eine Zusammenarbeit mit den Transplanteuren verweigerten. 40 Prozent der 1400 deutschen Klinken mit Intensivstationen, klagt DSO-Vorsitzender Günter Kirste, "machen bei der Rekrutierung von Organspendern nicht mit. Da wird teilweise richtig gemauert". Die Klinikärzte weisen den Vorwurf mangelnder Kooperation jedoch zurück. In ihren Augen sind die Transplanteure selbst nicht unschuldig an der Notlage. Eine lange "Liste von Ungereimtheiten" etwa legt Hans Fred Weiser, Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte (VLK), der DSO zur Last. Wenn die Stiftung ihre Politik nicht merklich ändere, rechne er sogar mit einem weiteren "Rückgang der realisierten Organspende um 20 bis 30 Prozent". So moniert Weiser, dass die DSO keine mobilen Teams mehr zur Verfügung stelle, die rund um die Uhr rufbereit sind, um bei einem Patienten den Hirntod zu diagnostizieren. Zudem kritisiert der VLK-Präsident, die DSO-Spitze setze sich nicht hinlänglich mit den ethischen Fragen auseinander, die mit der Transplantation einhergehen. SPIEGEL ONLINE 31.03.04 Die Probleme fangen an, wenn der Verstorbene keine vorsorgliche Entnahmeverfügung getroffen hat: Acht von zehn Angehörigen können nur vermuten, wie der Verstorbene zu einer Entnahme seiner Organe stehen würde, da das Thema des eigenen Todes mehrheitlich so angstbesetzt ist, dass viele es vermeiden, sich mit dieser Frage auseinander zu setzen. Das müssen dann die gramgebeugten Angehörigen in ihrem ersten Schmerz noch zusätzlich leisten. Sie müssen innerhalb kürzester Frist – praktisch wenn die Leiche noch warm ist und viele Angehörige darum den Tod noch nicht wahr haben wollen, sie noch die Hoffnung hegen, dass der entscheidende Schritt zum Exitus noch nicht irreversibel vollzogen wurde - entscheiden: Dürfen dem schmerzvoll Vermissten, 195 der sie nicht mehr benötigt, zur Deckung des gesellschaftlichen Bedarfs einige dringend benötigte Organe entnommen werden? Wenn die Ärzte sich nun irren und doch noch Hoffnung besteht? Schließlich sind ja schon zahlreiche Komapatienten ins Leben zurückgekehrt; einige sogar erst nach vielen Monaten, gar Jahren! „Nach 20 Jahren aus Koma erwacht New York - Eine Frau, die seit einem Unfall vor 20 Jahren im Koma lag, spricht wieder. "Hi, Mum!" sagte die heute 38jährige Sarah Scantlin plötzlich zu ihrer Mutter. Auch an ihr früheres Leben erinnert sie sich wieder. Die Ärzte sind ratlos. dpa“ (HH A 12.02.05) Könnte in der Zwischenzeit nicht vielleicht die medizinische Entdeckung gemacht werden, die den eigenen Verwandten aus dem »Zwischenreich« der »Ausleibigkeit« zurückholen könnte? Um diese Entscheidungsnotwendigkeit in dieser Extremsituation zu vermeiden, haben einige Länder per Gesetz jeden gerade Verstorbenen zu einem potentiellen Organspender erklärt, sodass ihm benötigte Organe entnommen werden dürfen. Und wenn man damit nicht einverstanden ist: Darf das mit jedem gerade Verstorbenen gemacht werden oder kann man sich gegen Organentnahme über seinen eigenen Tod hinaus schützen, so man es überhaupt will? Ist es unethisch, eine Organentnahme nach dem von zwei Ärzten festgestellten Hirntot zu verweigern, wo so viele Organe benötigt werden, dass die momentane Zahl der Organe Verstorbener bei weitem nicht ausreicht, um die andernfalls oft Sterbenskranken mit einem Ersatzorgan zu versorgen, so dass bei aller damit verbundenen Problematiken – auch für den Spender - auf „Lebendspenden“ zurückgegriffen werden muss? Jede fünfte verpflanzte Niere, jede zehnte Leber stammt von einem Lebendspender, der auch mit Komplikationen rechnen muss6 Wie sollten Lebendspenden geregelt werden, damit die Gefahr einer Kommerzialisierung möglichst verhindert wird? Lebendspenden nur innerhalb der Verwandtschaft? Nach anfänglichen Schwierigkeiten „Vater will Niere spenden: Ärzte sagen nein SAD Leicester – Ein ungewöhnliches Familiendrama erschüttert England. Cliff Pendregaust möchte seinem Sohn eine Niere spenden, findet seit vier Jahren jedoch keinen Arzt, der ihn operiert. Beide Kinder des 67jährigen sind mit einem Genfehler auf die Welt gekommen. Als Neil eines Tages ins Koma fiel, spendete der Vater eine Niere. Der 31jährige erholte sich, kann heute wieder normal leben. Doch jetzt muß der Ex-Major zusehen, wie es seinen zweiten Sohn Russell (35) immer schlechter geht. ‘Ich dachte mir, es liegt in meiner Hand, auch Russell seine Freiheit zu geben‘, sagt Pendregaust. ‘Er arbeitet als Manager für eine Hotelkette und muß jede Woche 15 Stunden an der künstlichen Niere hängen. Ich bin Rentner und hätte Zeit.‘ Mehrere Ärzte-Gremien befaßten sich mit seinem Fall, diskutierten auch die ethische Problematik. Ein Chirurg, der helfen will, fand sich nicht. Auch Appelle an den Ärzteverband British Medical Association blieben ohne Erfolg.“ (HH A 20.02.96) hat sich die Meinung der Ärzte wohl überall in die Richtung entwickelt, freiwillige(!) Lebendorganspenden auch unter Nichtverwandten zuzulassen und vorzunehmen: Weltweit sind z.B. Hunderttausende Nieren verpflanzt worden. Am unproblematischsten ist das dann, wenn der Lebendspender nicht im Verdacht steht, sich damit einen wirtschaftlichen Vorteil – und sei es »nur« aus Dankbarkeit heraus – zu »erspenden«. Potenzielle Spender müssen über alle Risiken informiert werden und die Freiwilligkeit der Spende wird durch eine psychologische Untersuchung wie auch durch eine Ethikkommission zu klären versucht. Aber da kann sich immer noch der reiche Erbonkel oder die reiche Erbtante durch eine testamentarische Verfügung ein Organ »erkaufen«, obwohl der Kommission ausschließlich altruistische Überlegungen erzählt werden. Lebendspenden nur innerhalb der Kleinfamilie und Verwandten ersten Grades? Doch da stehen nicht ausreichend Organe zur Verfügung. Sollen in dieser Zwangslage sogenannte „Überkreuzspenden“ zugelassen werden, dass ein Ehepartner ein Organ für einen fremden Ehepartner spendet, wenn dessen Partner im Austausch sein Organ für den eigenen Ehepartner spendet, dem man wegen zu großer Gewebeunverträglichkeit mit dem eigenen Organ nicht helfen kann? Leider muss inzwischen der letzte Wortteil des Begriffs Organ»spende« bei Lebend»spenden« nicht ohne Grund 6 Bei bis zu 20 Prozent der Spender von Leberlappen kommt es zu Komplikationen. Der Versicherungsschutz von Lebendspendern ist bisher aber nicht eindeutig geklärt. 196 in die Fragwürdigkeit des Ausdrucks verdeutlichende Zeichen gesetzt werden: In der Presse fanden sich in den frühen 90-er Jahren des letzen Jahrhunderts Meldungen, dass z.B. an der Grenze Griechenlands zu dem albanischen Armenhaus Europas Kinder aufgefunden worden waren, die mit einer frischen Narbe herumirrten und nicht wussten, dass sie eingefangen und nach Entnahme einer Niere wieder laufen gelassen worden waren. Bei dieser kriminellen Organbeschaffung lag eindeutig keine Spende vor. Ein weiteres Beispiel für deliktisch beschaffte Organe: „Chirurg als Organdieb? SAD London – Mitte Dezember meldeten die Weltmedien einen ‘medizinischen Durchbruch‘. Dem Inder Purna Saikia (31) sei neben seinem eigenen, von Geburt an kranken Herzen das Herz eines Schweines als Zusatzpumpe eingepflanzt worden. Die Operation fand in einer abgelegenen Bergklinik im Bundesstaat Assam statt. Sylvester war der Patient tot. Die Behörden ordneten eine Leichenöffnung an. Dabei wurde schnell klar: Der Chirurg hatte das Herz des Patienten nicht im Brustkorb gelassen. Und: Er hatte auch beide Lungenflügel, Leber, Galle und weitere Organe entfernt und teilweise durch Tierorgane ersetzt. Zwei Wochen ließ sich der Chirurg als Pionier der Medizin feiern. Jetzt sitzt Dr. Dr. Dhani Ram Baruah in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: ‘Schuldhafte Tötung‘. Den Pathologen standen die Haare zu Berge. Der Arzt hatte die Tierorgane wahllos miteinander verbunden. Sie waren so zurechtgestutzt, daß Fachleute bis heute nicht sicher sagen können, von welcher Tierart sie stammen. Der Verdacht: Saikia mußte sterben, weil Baruah und Kollegen seine Organe weiterverkaufen wollten. In der primitiven Klinik sind in den letzten zwei Jahren fünf Patienten gestorben. (HH A 14.01.97) Bei den in diesem Bereich gegebenen Missbrauchsmöglichkeiten stellt sich - und noch verstärkt in dem der sich im Zuge des rasanten Wissenszuwachses auf dem Gebiet der Gentechnologie entwickelnden Gentherapie7, die das Problem der Organspende bedeutungslos werden lassen könnte, wenn es gelingt, die zur Reparatur menschlicher Körper benötigten Organe in ausreichendem Umfang zu züchten - die Frage: "Soll der Medizin alles erlaubt sein zu tun, was sie schon kann und noch darüber hinaus hinzulernen wird?" Da bestand großer Regelungsbedarf, dem inzwischen durch einige Gesetze abzuhelfen versucht wurde. Sehen wir uns an, was den Gesetzgeber zum Handeln zwang: "In naher Zukunft wird es in der Medizin zu radikalen Verteilungskämpfen kommen, insbesondere in der Transplantationsmedizin. Denn kein Geld der Welt reicht für eine gleichmäßige Versorgung aller Menschen mit lebensverlängernden Ersatzteilen. Schon heute verkaufen Menschen in Brasilien oder Indien Nieren an reiche US-Amerikaner, Japaner, Araber und Europäer. In Brasilien werden immer häufiger Kinder ermordet aufgefunden, denen Organe fehlen. Auch bei uns wird es in Kürze zwei Klassen Menschen geben: arme Organspender und reiche Organempfänger." Leserbrief von Siegfried Pater, Autor des Buches "Organhandel - Ersatzteile aus der Dritten Welt" an den STERN, mit dem er gegen die Kannibalisierung von Armen aus der Dritten Welt durch Reiche aus den Industrieländern Stellung bezieht. "‘Reiche können Leben erkaufen' Edeltraud Swoboda, Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte Harburg: ‘Ich habe die Befürchtung, daß Menschen, die viel Geld haben, sich ihr Leben erkaufen können. So ist es heute in Südamerika, wo Kinder aus armen Familien entführt, ihnen die Netzhaut entfernt wird, damit reiche, ältere Menschen ihr Augenlicht wiederbekommen. So wird das Leben der Reichen verlängert, das der Armen verkürzt. Organspende soll möglich sein, aber nur auf freiwilliger Basis. Wichtig ist, daß die Notwendigkeit in der Bevölkerung bewußter gemacht wird.'" (Harburger Anzeigen und Nachrichten 20.01.92) Die für Operationen erforderlichen Organe sind nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. „Spenderorgane: Das Versagen der Kliniken UKE-Professor: Viele Patienten könnten noch leben wenn Krankenhäuser potentielle Spender 7 Britischer Professor aus Bath: „In der Gentechnologie droht die Gefahr des Biofaschismus. Es ist angedacht, wie schon bei Fröschen erfolgreich erprobt, irgendwann Menschen ohne Köpfe als auszuweidende Ersatzteillager zu züchten.“ 197 melden würden. Hanna Kastendieck / Miriam Opresnik Zwei von drei Menschenleben könnten jeden Tag gerettet werden, wenn die deutschen Krankenhäuser ihrer Pflicht nachkämen und potenzielle Organspender melden würden. ... Nach Schätzungen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) melden nur 50 Prozent der Krankenhäuser mit Intensivstation potenzielle Organspender – obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Das sind 700 der 1400 entsprechenden Kliniken. ... Aus Mangel an Organen sterben nach Angaben der DSO in Deutschland rund 30 Prozent der rund 11.778 Menschen, die auf ein neues Organ warten. Die CDU-Bundestagsfraktion fordert daher Sanktionen für Krankenhäuser, die ihrer Meldepflicht nicht nachkommen. ... Nach Paragraph 11 Absatz 4 des Transplantationsgesetzes sind Krankenhäuser verpflichtet, potenzielle Organspender der DSO zu melden. Da das Transplantationsgesetz ... nur apellativen Charakter hat und Verstöße nicht geahndet werden, fordert die DSO, dass die Bundesländer auf Landesebene für die Einhaltung sorgen müssen. ... ’Der finanzielle, personelle und organisatorische Aufwand ist vielen Kliniken einfach zu groß’, vermutet UKE-Professor Reichenspurner. Zwar bekommen die Spender-Krankenhäuser für eine Organentnahme von der DSO eine Aufwandserstattung zwischen 2090 und 3370 Euro. Reichenspurner: ’Für die Krankenhäuser ist es aber dennoch einfacher, das Beatmungsgerät einfach abzuschalten.’“ (HH A 11.06.04) „Missstand Als Mutter eines Fünfjährigen, der auf eine neue Niere wartet und dem ich wahrscheinlich eine spenden muss, kommt mir die Galle hoch: Wie kann es in einem Land wie Deutschland angehen, dass so ein Missstand nicht viel früher entdeckt wurde? Dass dringend gebrauchte Organe einfach auf dem Friedhof ’vergammeln’, nur weil – leider viele – einfach zu faul sind, Spenderorgane zu melden? Ich möchte lieber nicht wissen, wie viele Lebendspenden hätten vermieden werden können, wenn alle potenziellen Spenderorgane gemeldet worden wären. Abgesehen von dem Leid der Angehörigen und denen, die auf ein Spenderorgan warten, bedeutet eine erfolgreiche Transplantation auch eine Kostenersparnis: Die Dialysebehandlung unseres Sohnes kostet etwa 36 000 Euro im Jahr. Leserbrief Susanne Adrian, per E-Mail” (HHA 15.06.04) „Zu bequem für Organspenden Miriam Opresnik Stellen Sie sich vor, Ihr Kind braucht ein neues Herz, weil es mit einem schweren Herzfehler geboren wurde. Oder stellen Sie sich vor, Ihr Partner braucht eine neue Leber, weil er an Hepatitis erkrankt ist. Und dann stellen Sie sich vor, diese Menschen müssen sterben. Weil sie nicht rechtzeitig ein neues Organ bekommen. Weil viele Krankenhäuser ihrer Meldepflicht nicht nachkommen. Unvorstellbar? Nein! Alltag in Deutschland. Nach Schätzungen verschweigt jedes zweite Krankenhaus mit Intensivstation den Hirntot eines Patienten. Eines Patienten, der als Organspender geeignet wäre. Warum? Weil die Kliniken scheinbar kein Interesse daran haben, ihre Betten mit wirtschaftlich nutzlosen Fällen zu belegen. Weil es bequemer ist, die Beatmungsgeräte einfach abzuschalten. Weil sie nicht bedenken, dass mit der Meldung eines Organspenders Menschenleben gerettet werden könnten. Wenn Krankenhäuser ihrer Pflicht nicht freiwillige nachkommen, muss nachgeholfen werden. Mit besseren Schulungen und Motivation zum einen. Mit schärferen Gesetzen zum anderen. Gesetzen, die nicht nur an den gute Willen der Ärzte appellieren, sondern bei Verstößen auch Konsequenzen haben. Wer das Problem verschweigt, macht sich mitschuldig. Gesetze müssen eingehalten werden. Sich dafür einzusetzen ist Sache der Länder. Hamburg als Medizinhochburg sollte hier Vorreiter sein.“ (HH A 11.06.04) In der Bundesrepublik sterben mangels eines ausreichenden Organangebotes z.B. ein Drittel aller Menschen, die im Schnitt ca. sechs Jahre auf ein Spenderherz oder eine Leber warten müssen, vor der lebensrettenden Operation. (In den USA ist in einer solchen Notlage - wenigstens vorübergehend - einem Menschen ein Pavian- 198 Herz, einem anderen eine Schweineleber eingepflanzt worden. Da gibt es bislang keine rechtlichen Organspendeprobleme, auch nicht von Tierschutzverbänden.) In Deutschland werden inzwischen 4.000 Organtransplantationen pro Jahr vorgenommen. 2003 gab es 3.482 verstorbene Organspender. Dem standen 12.000 auf eine Spenderorgan Wartende auf einer immer länger werdenden Transplantationswarteliste gegenüber. Der Nachfrageüberhang könnte nur durch die erweiterte Zulassung von »Lebendspenden« - der Anteil liegt noch deutlich unter dem vieler anderer Länder: in Norwegen sind zum Beispiel 50 Prozent der Nierentransplantationen eine Lebendspende - oder durch eine Erhöhung der Verstorbenenspende mithilfe einer Widerspruchslösung wie in Spanien oder Österreich abgebaut werden. Danach ist jeder nach seinem Tod Organspender - es sei denn, er hat dagegen explizit zu Lebzeiten widersprochen. In der BRD stammen mehr als 20 % der »gespendeten«(?) Organe von Verwandten oder dem Empfänger Nahestehenden. Eine Kommission muss vor der Transplantation feststellen, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, um Zwang oder Organhandel (möglichst) auszuschließen, denn den will keiner; es sollen nicht solche Zustände herrschen wie in den USA, wo per Internet Nieren für 80.000 $ pro Stück angeboten wurden. Organspende Ulrike Baureithel Der Körper als Warenlager Die schleichende Materialisierung des Menschen Ende vergangenen Jahres erlangte der Ingenieur Peter Randell aus der englischen Grafschaft Kent internationale Berühmtheit: Weil das staatliche Gesundheitssystem die teure Therapie seiner sechsjährigen Tochter Alice, die seit ihrer Geburt an zerebraler Kinderlähmung leidet, nicht übernehmen wollte, bot der verzweifelte Vater im Online-Aktionshaus Ebay eine seiner Nieren an. Mit dem erhofften Erlös von 150.000 Euro wollte er den dringend benötigten Therapieplatz für Alice finanzieren. Nachfrage gab es durchaus, doch bevor der Deal abgewickelt werden konnte, wurden Randalls illegale Organangebote sowohl in Großbritannien als auch in den USA entdeckt und strafrechtlich verfolgt. Daraufhin spendeten die Leser der britischen Zeitung "Sun", die den Fall bekannt machte, einen Teil des benötigten Geldes. Eine Geschichte nach dem Geschmack der Boulevardpresse: Schwerkrankes Kind, opferbereite Eltern, die vor der staatlichen Mittellosigkeit und Ignoranz kapitulieren, und eine solidarische Lesergemeinde. Die Protagonisten sind keine skrupellosen Organhändler, die, wie vergangenes Jahr in der Ukraine, neugeborene Babys ausschlachten oder verdächtigt werden, Organe von Waisenkindern zu verhökern, wie im Fall eines südafrikanischen Ehepaars. Hier handeln verzweifelte Eltern, die keinen Ausweg mehr wissen und auf menschliches Verständnis hoffen dürfen. Der sozialpolitische Aspekt der Story - die Tatsache, dass die europäischen Wohlfahrtsstaaten sich nicht mehr jede medizinische Leistung leisten können oder leisten wollen und dabei sind, implizit oder explizit eine Zweiklassenmedizin zu etablieren - ist dabei nur die eine Seite, die das Publikumsinteresse und die Spendenbereitschaft mobilisiert. Gravierender an der Geschichte ist die Frage, ob Peter Randell seinen Körper "besitzt" und über seine Teile verfügen kann, zumal, wenn er wie in diesem Fall ein ethisch einwandfreies Ziel verfolgt. Ist der Körper sein "Eigentum", ein Produkt, für das er - man denke nur an gesundheitspräventive Maßnahmen - einerseits "Haftung" übernimmt und dessen Teile andererseits auf dem Markt angeboten werden können? Oder ist der Körper ein unveräußerliches "Ding", das verwertbaren Maßstäben zu entziehen ist? Die gesetzlichen Grundlagen der europäischen Länder sind weitgehend eindeutig: Organhandel ist so auch im britischen Fall - verboten. Weder die eigenen Organe noch die eines Dritten sind eine "marktfähige" Ware und können also auch nicht gehandelt werden. In der Bundesrepublik regelt das Ende der 90er-Jahre kontrovers diskutierte Transplantationsgesetz (TPG) den Umgang mit Organspende und ihre Grenzen. Die postmortale Organspende ist zulässig, wenn das Einverständnis des Betroffenen vorliegt oder dessen Angehörige nach seinem vermuteten Willen entscheiden ("erweiterte Zustimmungslösung"), vorausgesetzt, zwei Ärzte haben den so genannten "Hirntod" festgestellt. Die Lebendspende (also beispielsweise die Spende einer Niere oder eines Teils der Leber) ist nur dann möglich, wenn ein enges Verwandtschafts- oder Beziehungsverhältnis vorliegt, das von einer Ethikkommission zu beurteilen ist. Es darf - von so genannten "Aufwandsentschädigungen" abgesehen - in keinem Fall ein auf das Organ bezogener finanzieller Ausgleich stattfinden. Soweit die Regelungen, die hinsichtlich der Lebendspende derzeit allerdings wieder zur Disposition stehen. Denn das mit dem unveräußerlichen Körper und seinen Teilen ist eine schwierige Angelegenheit. 199 Transparent ist die über Jahrzehnte hinweg bewährte Blutspendepraxis: Man erhält ein Taschengeld dafür, dass man Zeit investiert und gegebenenfalls auch die eine oder andere Unpässlichkeit in Kauf nimmt. Aber schon bei der Samenspende liegen die Dinge anders. Ein Samenspender wird vergleichsweise gar nicht schlecht - für seine Dienste und sein Produkt bezahlt. Weibliche Eier dagegen sind in Deutschland unverkäuflich. Eine geschlechtsspefische Diskriminierung? In diesem Fall wohl eher nicht, denn die Begehrlichkeiten der Wissenschaft, beispielsweise in der Stammzellforschung, sind so groß, daß hier die Gefahr bestünde, dass sich gerade Frauen aus schwächeren Schichten zur "Eierernte" melden würden. Doch wie steht es mit den vielen menschlichen Präparaten, die überall im medizinischen Alltag gesammelt und in sogenannten Biobanken aufbewahrt und der Forschung und Industrie zur Verfügung gestellt werden? Mit welchem Recht werden sie privatisiert und beispielsweise von der Pharmaindustrie verwertet, ohne dass die einstigen Lieferanten je einen schlappen Euro von der Rendite sehen? Die derzeit auszuhandelnde Biopatent-Richtlinie ist ein heißes Eisen der Politik; Patente "auf Leben" sind höchst umstritten. Das Argument, dass sich gerade einkommensschwache, finanziell bedrängte Menschen zum Verkauf ihres Körpers gezwungen sehen könnten, wird auch gegen die Kommerzialisierung der Organspende in Anschlag gebracht. Wer sozial abgesichert lebt, wird sich unter normalen Umständen kaum veranlasst sehen, eine Niere zu verkaufen. Doch wie sieht das für arme Menschen aus unterentwickelten Ländern aus? Auf einer Anhörung der Enquete-Kommission "Recht und Ethik in der modernen Medizin" des Deutschen Bundestages kolportierte kürzlich ein Sachverständiger die Meinung eines indischen Kollegen, der Verständnis für die bezahlten Lebendspenden aufbrachte, weil "dies in Indien die Ausbildung von Töchtern" sicherstelle. Aber rechtfertigt der - im Übrigen nur vermutete - Nutzen für benachteiligte Mädchen den Handel mit Körperteilen? Zumal in diesem Fall, wo die Industrienationen eindeutig Vorteilnehmer sind, während die übrigen Teile der Welt einmal mehr in die Rolle billiger Lieferanten für unsere "Ersatzteillager" gedrängt werden? Repräsentative Untersuchungen gerade aus Indien zeigen außerdem, dass die "Spender" durch den Verkauf ihrer Nieren keineswegs der Schuldenfalle entkommen. Im Gegenteil führen die gesundheitlichen Auswirkungen einer Organentnahme häufig zu zusätzlicher Verschuldung. Den Profit schöpfen ohnehin die Vermittler ab: In Südafrika wurde kürzlich ein Israeli zu 660 Euro Strafe verurteilt, der aufgrund falscher Annahmen eine Niere für 45.000 Dollar "bestellt" hatte; für den brasilianischen Spender fielen gerade einmal 6.000 Dollar ab. In den Industrienationen ist der Bedarf an Organen offenbar, trotz aller Aufrufe an die Spendenbereitschaft der Bevölkerungen, nicht zu decken. Wenn die Deutsche Stiftung Organtransplantation alljährlich ihre Zahlen bekannt gibt, dann immer mit dem mehr oder minder dezenten Hinweis auf den vom Egoismus der Allgemeinheit zu verantwortenden "Tod auf der Warteliste", dem viele Patienten entgegensehen. Die Hightech-Medizin macht Angebote, die wahrgenommen werden wollen und sollen. Den betroffenen sterbenskranken Patienten ist daraus kein Vorwurf zu machen, auch wenn gelegentlich und nicht immer zu Unrecht über hybride Ansprüche und mangelnde "Compliance", also die Bereitschaft transplantierter Patienten, sorgsam mit dem Mangelgut umzugehen, lamentiert wird. Aber auch diejenigen, die sich gegen eine Organspende entscheiden, sind keiner Unterlassungssünde zu zeihen: Der Alltag der Organspendepraxis, seine Voraussetzungen ("Hirntod") und psychologischen Folgen sind so problematisch und unabsehbar, dass keine "Bringschuld" eingeklagt werden kann. Dies gilt mehr noch für die Lebendspende. Wo endet die Freiwilligkeit und wann der (versteckte) Zwang? Die Gutachter von Ethik-Kommissionen sollen nicht nur beurteilen, wie eng die Beziehung zwischen Spender und Empfänger tatsächlich ist und ob sie die Bedingungen des TPG erfüllt, sondern auch, ob Druck ausgeübt, Geld fließen oder lebenslange Dankesschuld produziert wird. Die Tatsache, dass die Lebendspende in den letzten Jahren in Deutschland stark zunimmt, könnte auch daran liegen, so die vorsichtige Vermutung von Hans-Ludwig Schreiber von der Bundesärztekammer, dass dies "ein Weg für bestimmte Begünstigte" ist, die Warteschlange zu umgehen. Im Falle der Familie Randell wäre die Selbstinstrumentalisierung des Körpers durch Peter tolerierbar gewesen, litte Alice unter Niereninsuffizienz und hätte der Vater mit seiner Niere das Leben der Tochter gerettet. Dass die Lebensqualität von Alice durch die beabsichtigte Therapie möglicherweise ganz ähnlich gesteigert würde, rechtfertigt jedoch nicht, dass der Vater seine Niere verkauft - selbst wenn er damit "nebenbei" auch noch das Leben eines weiteren Patienten rettet; allerdings eines Patienten, der diese "Ware" auch bezahlen kann. Wir leisten uns heutzutage eine überaus teure Hightech-Medizin, die zwar in nicht geringem Umfang 200 aus direkten Steuermitteln oder indirekten Transferleistungen (zum Beispiel überteuerten Medikamenten) finanziert und abgesichert wird, die aber, das ist bereits absehbar, bald nicht mehr für jedermann verfügbar sein wird. Wir leisten uns gesundheitliche Ansprüche, die wir selbst nicht bedienen können und für deren Befriedigung, das steht zu befürchten, die Ressourcen der ärmeren Ländern herangezogen werden. Wenn heutzutage kostengebeutelte deutsche Kliniken ihre Tore für Ölmilliardäre öffnen, die sich dort für ihre Petrodollars gesundflicken lassen, dann ist dies sozusagen nur die umgekehrte Richtung desselben Prozesses. Aber mehr noch leisten wir uns den Abschied von einem Körper- und Menschenbild, das ganzheitlich geprägt und unteilbar ist. Es beruht auf der Vorstellung eines unverwechselbaren, unveräußerlichen Individuums, das mehr ist als seine (verwertbaren) Teile. Diese schleichende Materialisierung des Körpers, seine Umwertung in ein handelbares Warenlager, verantwortet gewiss nicht nur die medizinische Zunft; aber als Produzentin von Menschenbildern hat sie daran ihren Anteil, und es ist noch nicht abzusehen, was sie Tröstliches an diese Stelle setzen wird. Ulrike Baureithel ist Redakteurin beim "Freitag". Das Parlament 14.06.04 Das bange Hoffen auf Organspende Tausende Kranke aus Deutschland stehen auf der Warteliste Gesundheit und Soziale Sicherung. Tausende schwer erkrankte Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein lebensrettendes Organ. Dieses Thema hat die CDU/CSU-Fraktion zum Anlaß für eine Große Anfrage genommen (15/2707). Nun liegt die Anwort der Bundesregierung (15/4542) vor. Darin sieht sie keine Notwendigkeit, die Betreuung und Koordinierung der Lebendorganspende in Deutschland zu verbessern und zieht auch eine positive Bilanz des Ende 1997 in Kraft getretenen Transplantationsgesetzes. Die gesetzliche Regelung der Organtransplantation habe die notwendige rechtliche Sicherheit und die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Organspende und Transplantation in Deutschland geschaffen. Die über Jahre hinweg zentralen Streitfragen, nämlich der Hirntod als sicheres Todeskriterium und die Befugnis zur Einwilligung durch die nächsten Angehörigen mit der erweiterten Zustimmungslösung, wurden dadurch aus der Sicht der Exekutive zufriedenstellend gelöst. Trotz der Erfolge der Medizin in den Anwendungsmöglichkeiten, Überlebensquoten und Lebensqualität der Betroffenen bestehe aber dennoch weiterhin das Problem der sehr begrenzten Verfügbarkeit von Organen für die Transplantation, so die Antwort weiter. Nach Angaben der Regierung standen am 1. November 2004 insgesamt 11.933 Patientinnen und Patienten aus Deutschland auf den Wartelisten. Darunter befanden sich 9.235 Personen, die auf eine Niere, 1.483 Personen, die auf eine Leber, 586 Personen, die auf ein Herz, und 453 Personen, die auf eine Lunge zur Transplantation warteten. Den gleichen Angaben zufolge wurden 2003 in Deutschland 2.516 Nieren, 855 Leber, 393 Herzen und 212 Lungen transplantiert. Die Zahl der postmortal gespendeten Organe habe 2003 mit 3.496 den bislang höchsten Stand erreicht, der für das vergangene Jahr nach bisherigen Erkenntnissen nicht erreicht werden konnte. Gleiches gilt für die Zahl der transplantierten - postmortal und lebend gespendeten - Organe: Sie habe 2003 mit 4.175 den höchsten Stand erreicht. Im europäischen Vergleich lag Deutschland 2003 mit 13,8 postmortalen Organspenden je Million Einwohner im Mittelfeld, heißt es. Die Bundesregierung geht in ihrer Antwort davon aus, dass die Spendenbereitschaft entscheidend von der Wahrnehmung der gegebenen Möglichkeiten einer Organspende abhängt. Durch kontinuierliche, umfassende und sachliche Aufklärung der Bevölkerung sowie durch eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Transplantationszentren und den anderen Krankenhäusern könnten die Möglichkeiten zur postmortalen Organspende besser wahrgenommen werden. Auch die ideelle Anerkennung einer Organspende könne dazu beitragen, die Organspendenbereitschaft zu erhöhen. Als Beispiel führt die Regierung eine Initiative des bayerischen Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen an, das jährlich gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation- Regionalorganisation Bayern den bayerischen Organspendenpreis an besonders verdiente Krankenhäuser verleiht. Nach dieser Veranstaltung sei jedes Jahr ein deutlicher Anstieg der Beteiligung der Krankenhäuser an der Organspende zu verzeichnen. Eine ähnliche Initiative sei auch in Thüringen geplant. Das Parlament 17.01.05 Niere um Niere, Herz um Herz WIESBADEN dpa Wer keine Organe spendet, soll auch keine bekommen: Der Vorsitzende der 201 Gesellschaft für Innere Medizin, Manfred Weber, schlägt vor, die Haltung zur Organspende verpflichtend bei der Verlängerung des Personalausweises abzufragen. "Wer dabei Nein sagt, bekommt auch nichts." In NRW kämen nur 9 Organspender auf 1 Million Einwohner. "Die Situation ist katastrophal." Menschen, die ihren Beitrag verweigerten, sollten auch Nachteile bei den Leistungen haben, so Weber. Organspende ist ein Thema beim 111. Internistenkongress vom 2. bis 6. April. Derzeit stehen in Deutschland rund 12.000 Menschen auf der Warteliste für eine Transplantation. 2004 wurden in Deutschland etwa 2.000 Nieren verpflanzt. Die Erfolgsaussichten seien gut: Nach einem Jahr funktionierten noch fast 90 Prozent der Transplantate. taz 31.03.05 Organe nur noch für Spender? Transplantation: Mediziner fordert, Organe nur noch an spendebereite Patienten zu vergeben - und löst heftige Reaktionen aus. Von Cornelia Werner Mit drastischen Maßnahmen wollen Internisten die Organspendebereitschaft in Deutschland erhöhen. "Wer sich nicht für eine Spende entscheidet, sollte einen Nachteil als Empfänger haben", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), Prof. Manfred Weber. Er forderte, die Bürger alle fünf Jahre mit der Frage zu konfrontieren, ob sie für eine Organspende bereitstünden. Ein Vermerk könne bei der Verlängerung des Personalausweises aufgenommen werden. Wer Nein sagt, scheide als Organempfänger aus. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) warten bundesweit 12 000 Menschen auf ein Spenderorgan. Im Jahr 2004 gab es nur 1081 Organspender. Nach einer Umfrage der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung haben nur zwölf Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis, aber 68 Prozent sind bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden. Zum Vorschlag von Prof. Weber sagte Heiner Smit, Bevollmächtigter des Vorstands der DSO: "Bei allem Verständnis für die Sorge von Prof. Weber um seine Patienten ist er mit seiner Forderung über das Ziel hinausgeschossen. Einen Zwang zur Organspende sieht das Transplantationsgesetz nicht vor und motiviert die Menschen nicht zur Spende." Andererseits würden jeden Tag drei Patienten sterben, die auf ein Organ warten. "Wir könnten mehr Patienten retten, wenn sich mehr Menschen für eine Organspende entscheiden würden", sagte Smit. Prof. Xavier Rogiers, ärztlicher Leiter des Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), meinte, man sollte über den Vorschlag von Prof. Weber ernsthaft nachdenken und damit eine gesellschaftliche Diskussion anregen. Zudem müßte man auch die Frage stellen: "Ist es akzeptabel, in gesunden Zeiten eine Organspende zu verweigern und dann, wenn man krank ist, eine Transplantation in Anspruch zu nehmen?" Dr. Michael Reusch, Präsident der Hamburger Ärztekammer, lehnt den Vorschlag ab: "Das wäre nur eine andere Form des Tauschhandels und ethisch nicht vertretbar. Eine solche Regelung ist auch praktisch nicht durchsetzbar: man denke an Kinder, die Organe empfangen, und deren Eltern, die sich auf die spätere Verfügbarkeit der Organe des Kindes verpflichten müßten. Ich werte diesen Vorstoß als nicht ernst gemeinten, bewußt provokativen und verzweifelten Versuch, die Spendebereitschaft zu erhöhen. Mein Appell an die Hamburger: Entscheiden Sie sich freiwillig für die Spende und füllen einen Organspendeausweis aus!" Dr. Fabian Peterson, Pressesprecher der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft, sagte: "Ich begrüße, daß mit dem Vorschlag auf den dramatischen Mangel an Spendeorganen aufmerksam gemacht wird. Doch ein solches ,Klubmodell' schließt Menschen generell als Organempfänger aus und ist wohl verfassungswidrig. Allenfalls könnte über das sogenannte ,Solidarmodell' in Form einer Besserstellung von erwachsenen Patienten auf der Warteliste nachgedacht werden, wenn sie bereits einen Spendeausweis besaßen, bevor sie auf ein Organ angewiesen waren. Die beste Lösung bleibt aber, wenn die in Umfragen ermittelten vielen Befürworter der Organspende alle auch einen Spendeausweis ausfüllen." Auf mehr Aufklärung setzt auch Prof. Hermann Reichenspurner, ärztlicher Leiter des Herzzentrums am UKE. Er findet den Vorschlag fragwürdig, "weil er einer Bestrafung gleichkommen würde". Denkbar wäre seiner Meinung nach auch die Widerspruchslösung, wie sie in Belgien und Österreich praktiziert wird. Das heißt, daß grundsätzlich eine Organspende bei Verstorbenen in Frage kommt, es sei denn, die Person hat zu Lebzeiten widersprochen oder die Angehörigen widersprechen. Sicherlich seien die Zahlen katastrophal. Es gebe Länder, in denen die Zahl der Organspenden mehr als dreimal so hoch sei wie in Deutschland - etwa Spanien. Dort werde eine gezielte Aufklärungsarbeit geleistet. 202 Eine Mitverantwortung der Kliniken für den Mangel an Spenderorganen sieht auch die DGIM. Nur wenn sich Mediziner in den Krankenhäusern um potentielle Organspender kümmerten, sei Deutschland in der Lage, genügend Spenderorgane bereitzustellen, sagte Prof. Hans-Peter Schuster, Generalsekretär der DGIM. Wenn jedes Krankenhaus pro Jahr nur zwei Organe zur Verfügung stelle, "wäre die Warteliste sofort weg". erschienen (HH A 01.04.05) Transplantate nur für Organspender? Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin stößt auf großen Widerstand von Ranty Islam Berlin - Kein Bürger sollte zu einer Entscheidung über seine Bereitschaft für eine Organspende gezwungen werden. Dies sagt Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Sie reagiert damit auf einen entsprechenden Vorschlag des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), Manfred Weber. Dieser hatte sich am Mittwoch dafür ausgesprochen, die Bürger alle fünf Jahre mit der Frage zu konfrontieren, ob sie für eine Organspende bereitstünden oder nicht. Ein entsprechender Vermerk könne im Personalausweis aufgenommen werden. "Wer sich nicht für eine Spende entscheidet, sollte einen Nachteil als Empfänger haben", so Weber. Auch die Ministerin ist der Ansicht, daß Menschen für die Chance, ein Spenderorgan zu erhalten, bereit sein sollten, sich registrieren zu lassen. "Aber jeder sollte für sich selber entscheiden, ob dies für ihn ein gangbarer Weg ist", sagte Schmidt. Rund 12 000 Menschen warten derzeit bundesweit auf ein Spenderorgan. Im vergangenen Jahr konnten jedoch nur 3508 Organe für eine Spende entnommen werden. Die Situation hat sich seit Verabschiedung des Transplantationsgesetzes vor acht Jahren nur unwesentlich verbessert. Die erhoffte massive Steigerung der Zahl von Spenderorganen ist ausgeblieben. Ein Grund sei der "katastrophale" Trend bei der Bereitschaft zur Organspende, so Weber. Mit seinem Vorschlag könnten potentielle Organspender auf breiter Front direkt angesprochen werden. Außerdem sei jedoch die mangelnde Kooperation von Ärzten und Krankenhäusern ein großes Problem. Dafür macht Weber das Gesetz mitverantwortlich. Nach der Regelung wurden die Bereiche Organentnahme, -vermittlung und -transplantation organisatorisch getrennt. "Damit sind bestehende Kooperationen zwischen Transplantationszentren und umgebenden Krankenhäusern zerstört worden", so Weber. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) ist statt dessen seit 2000 die zentrale Koordinierungsstelle für Organspenden. Sie ist in Kontakt mit bundesweit 1400 Krankenhäusern und 50 Transplantationszentren. Viele Kliniken kooperieren jedoch nicht. Oft fehlten konkrete Richtlinien, wer und wie vor Ort Entscheidungen über eine Organentnahme trifft und wie diese dann umgesetzt würden, sagt Heiner Smit, Bevollmächtigter des DSO-Vorstandes. Grund sei auch, daß viele Bundesländer nur unzureichend konkrete Regelungen auf Basis des Transplantationsgesetzes des Bundes geschaffen hätten. Wo solche Regelungen bestünden, schlage sich dies in der Zahl der Spenderorgane nieder. Etwa in Mecklenburg-Vorpommern - dort ist die Zahl der Spenden pro Million Einwohner fast dreimal so hoch wie in Nordrhein-Westfalen. "Insgesamt ist das Gesetz jedoch bisher nicht im Sinne des Gesetzgebers umgesetzt worden", so Smit. DIE WELT 01.04.05 Die Bundesärztekammer (BÄK) fordert, anonyme Spenden zu ermöglichen, ebenso wie Überkreuz-Spenden, das heißt, der Partner eines Organkranken spendet für den erkrankten Partner eines anderen und umgekehrt. Eigentlich sind derartige Spenden hier zu Lande nicht erlaubt. Doch de facto werden sie gelegentlich praktiziert, eine Grauzone für die Ärzte. In den USA oder Schweden liegt der Anteil der Lebendspender bei bis zu 50 Prozent aller Organspenden. Missbrauch der gesetzlichen Beschränkungen ist möglich: EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE Der Spenderskandal Von Ansbert Kneip Wie ein Amerikaner über das Internet eine neue Niere erhielt. Für eine neue Niere sind 295 Dollar kein zu hoher Preis, selbst dreimal 295 Dollar nicht. Bob Hickey brauchte eine, er hätte wohl auch mehr bezahlt. Hickey, 58 Jahre alt, Frührentner aus Edwards in Colorado, eine Niere vom Krebs zerfressen und entfernt, die zweite ebenfalls krank. Er spürt, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Dreimal die Woche geht Hickey zur Dialyse, seit 1999 wartet er auf ein Spenderorgan. Vielleicht 203 findet sich 2005 eine passende Niere, wer weiß. 60.000 Amerikaner stehen auf der Warteliste, jeden Tag sterben 16, die zu lange warten mussten. Es gibt zu wenig Organspender. Und dann, Anfang dieses Jahres, hört Hickey im Radio von diesem neuen Internet-Service, matchingdonors.com, zu Deutsch etwa: passende Spender. Er tippt die Adresse ein. Bei matchingdonors geht es darum, Menschen zu finden, die bereit sind, ein Organ herzugeben - und zwar jetzt, nicht erst, wenn sie tot sind. Sie dürfen dafür kein Geld verlangen, denn das wäre Organhandel, und der ist verboten. Lebendspender können zum Beispiel Knochenmark geben. Das ist vergleichsweise gefahrlos, es macht nur kaum jemand. Ein gesunder Mensch kann sogar auf eine seiner Nieren verzichten, ohne dass es ihn beeinträchtigt. 295 Dollar kostet die Mitgliedschaft pro Monat. Hickey bucht für drei Monate, dann darf er sich in eine Datenbank eintragen: Name, Alter, Krankheit. Dazu E-Mail-Adresse, Wohnanschrift, Telefonnummer, Lebenslauf, Beruf, medizinische Daten. Nichts bleibt privat, das ist das Prinzip von matchingdonors. Ein potenzieller Spender soll die Empfänger kennen lernen, er soll sich rühren lassen von ihrem Schicksal. Und er soll wählen dürfen, wer am Ende das Organ erhält. Bob Hickey lädt noch ein Foto von sich hoch. Es funktioniert besser als erwartet. Drei Monate später haben fast 500 Menschen Kontakt zu ihm aufgenommen, über die Hälfte davon Frauen. Manche wollen ihm nur Glück wünschen, manche verlangen Geld, obwohl das verboten ist. Hickey ist ein stattlicher Mann, sein Spender müsste deshalb mindestens 1,75 Meter groß sein damit fallen praktisch alle Frauen weg. Auf der Dialysestation hat Hickey jetzt eine Beschäftigung. Er telefoniert, fragt nach, gibt Auskunft, er arbeitet die Liste ab: noch hundert Kandidaten, noch zwei Dutzend, noch zehn. Endlich wieder hat er das Gefühl, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Am Ende bleibt genau ein Spender übrig: Robert Smitty, 32 Jahre alt, ein Lkw-Fahrer aus Chattanooga, Tennessee, 2000 Kilometer entfernt. Smitty ist groß genug, er hat die richtige Blutgruppe. Und er will, sagt er, einmal im Leben etwas richtig Großes tun. Etwas, worauf er stolz sein kann und seine zehnjährige Tochter auch. Die beiden Männer telefonieren jetzt fast täglich miteinander. Smitty erzählt, dass er zufällig auf matchingdonors gestoßen sei, eigentlich habe er sich nur über Organspenden nach dem Tod informieren wollen. Erst Hickeys Steckbrief habe ihn überzeugt, Lebendspender zu werden. Es wäre die erste per Internet vermittelte Nierenverpflanzung. Über Geld, so beteuern beide, reden sie nicht. Hickey wird seinem Spender Flug, Unterkunft und Verdienstausfall erstatten, alles in allem rund 5000 Dollar. Das ist erlaubt. Am Morgen des 18. Oktober liegen die Männer nebeneinander im Narkoseraum des St.-Luke'sHospitals in Denver. Die Infusionsnadeln stecken in den Armen, es ist halb sieben, in einer Stunde soll es losgehen, der Anästhesist wartet noch auf das Okay des Ärzteteams. Um Viertel nach acht geht er nachsehen, wo die Kollegen denn bleiben. Ein paar Minuten später tritt der Chefarzt in den Raum, er hat eine schlechte Nachricht: "Ich werde Sie nicht operieren", sagt er. Er habe gerade erst erfahren, auf welche Weise Spender und Empfänger zusammengefunden hätten. Dass jemand an der Warteliste vorbei einen fremden Spender finde, sei unfair, dass jemand übers Internet eine Niere spende, höchst verdächtig. Der Arzt glaubt nicht, dass Smitty seine Niere aus reiner Menschenliebe hergeben will, und er glaubt nicht, dass Hickey wirklich nur 5000 Dollar Spesen zahlt. Er vermutet, dass die beiden einen heimlichen Deal haben. Eine Schwester entfernt die Infusionsnadeln, die Patienten müssen sich wieder anziehen. In seinem Hotel hängt Hickey sich ans Telefon, er redet mit Anwälten, Journalisten und Ärzten, er gibt Radio-Interviews. Am nächsten Tag erscheinen die ersten Artikel, die Klinik gerät unter Druck. Schließlich gibt es keinen Beweis für einen heimlichen Organhandel, die ethischen Bedenken wirken auf einmal bürokratisch und kalt. Der Fall macht nationale Schlagzeilen, am Ende gibt die Klinik nach. Einen Tag später bekommt Hickey nun doch die Niere von Smitty eingepflanzt. Aus humanitären Gründen, sagt der Arzt. Alles geht glatt. Ob wirklich kein Geld geflossen ist, lässt sich nicht sagen. In der vergangenen Woche stellte sich heraus, dass Hickey, der Empfänger, im Sommer einen Oldtimer angeboten hat, für 40.000 Dollar. Wofür braucht er das Geld? Und Smitty, der Nierenspender, hat eine kriminelle Drogen-Vergangenheit, Schwierigkeiten im Job und Schulden bei seiner Frau. Ein Beweis ist das natürlich alles nicht. "Ihr werdet keinen Beweis finden", sagt Smitty. "Und niemand kann Bob meine Niere wieder wegnehmen." SPIEGEL ONLINE 02.11.04 204 In der Schweiz ist ein Gesetz in Arbeit, das alle Begrenzungen aufheben soll. 25.000 Bundesbürger sind auf Dialysemöglichkeiten angewiesen. Eine Nierentransplantation kostet in der Bundesrepublik ca. 50.000,- €, da keine Kosten für einen »Organkauf« anfallen, plus ca. 10.000 € pro Jahr an Nachsorgekosten. Die Krankenkassen sparen an einer solchen Operation trotz dieser Operationskostenhöhe viel Geld, weil ein einziges Jahr Dialyse Kosten in Höhe von mindestens 25.000,- € bis 45.000,- € verursacht; das sind bei der augenblicklichen Wartezeit für eine Ersatzniere von mindestens drei Jahren bis zu 135.000 €. Um auf diesen Misstand des herrschenden verheerenden Organmangels hinzuweisen und so ein Fanal zu setzen, hat der Transplantations-Chirurg und damalige Leiter des Transplantationszentrums Lübeck, Prof. Dr. Hoyer, 1996 einem ihm völlig unbekannten 29-jährigen Bayern eine seiner eigenen Nieren gespendet! „’Wenn ich, der ich genau weiß, wie so eine Transplantation abläuft, mich selbst dazu entschließe, dann muß es doch unbedenklich sein. ... Organspende ist die moralische Pflicht eines jeden, der die uneingeschränkten Möglichkeiten einer modernen Medizin auch für sich in Anspruch nehmen möchte,’ so Hoyer, für den Organspende ’Nächstenliebe’ bedeutet“ (Harburger Rundschau 01.07.97). Ein Kollege von Hoyer, der Chirurg Brölsch, machte den Vorschlag, da der Verkauf von Organen in Deutschland verboten ist, Nierenspendern einen Steuerfreibetrag von 10.000 € jährlich zuzuerkennen, weil sie mit ihrer Organspende sehr erheblich zur finanziellen Entlastung des Gesundheitssystems beitrügen. (Bei einem Steuersatz von 33,33 % wäre das ein Gegenwert von 3.333 €: ein relativ unerheblicher Betrag für jemanden mit diesem Steuersatz; wer aus Geldnot seine Niere verkaufen will, hat bei seinen Schulden meist einen Steuersatz von nur 0-10 %. Da lohnt sich eine solche steuerliche Anerkennungsprämie gar nicht.) Spenderausweise gibt es beim Roten Kreuz, beim ADAC, den Ortskrankenkassen, einer Gesundheitsbehörde oder dem Arbeitskreis Organspende.8 In Bayern versucht man seit 2004 durch die Schulung von Lehrern zu erreichen, dass sie bei ihren Schülern den Gedanken für die Notwendigkeit von Organspenden verstärkt wecken. "Die Dritte Welt ist die Organbank der Reichen. Menschen verkaufen aus Armut ihren Körper Das Geschäft mit der Verzweiflung Kala und Shekar Kumar waren verzweifelt. Das Ehepaar hatte kein Geld und keine Arbeit. Eines Morgens reihten die beiden sich in die Schlange vor der Pendalia-Klinik in der südindischen Stadt Madras ein. Dort warten jeden Tag Menschen, die nichts mehr zu verkaufen haben außer einen Teil von sich selbst - eine Niere. Das Paar wurde angenommen und operiert. Kala Kumar: `Mit dem Geld will ich meinem Sohn eine Ausbildung ermöglichen. Die haben wir nie gehabt.' Die Kumars sind zwei von etwa 2000 Menschen, die in Indien jährlich eine Niere verkaufen. Der Marktpreis liegt bei 1500 US-Dollar (rund 2500 Mark); das entspricht dem sechsfachen durchschnittlichen Jahreseinkommen. Indien gilt als der größte Markt für menschliche Organe. Eine Hornhaut ist für 5000 Dollar zu haben, ein Stück Haut für 20 Dollar. Der Handel ist legal und nimmt wegen der extremen Armut im Land ständig zu. Die Käufer sind oft wohlhabende Araber oder Inder. In Indien gibt es pro Jahr 80 000 neue Fälle von Nierenversagen, aber nur 600 Dialysegeräte zur Blutwäsche, mit denen die Kranken am Leben erhalten werden. Da sind viele auf den Kauf des lebenswichtigen Organs angewiesen. Solche Organe werden mit verbesserten Konservierungslösungen immer länger haltbar gemacht. Auch in anderen Ländern blüht das Geschäft mit der Verzweiflung. Der größte südamerikanische `Lieferant' ist Brasilien. Der brasilianische Erzbischof Luis Bambaren: `Es gibt in Südamerika nachweislich Organisationen, die Kinder kaufen oder entführen, um sie zu ermorden und ihre Organe zu verkaufen.' Rosalie Bertell von der Internationalen Kommission für Mediziner in Genf zitierte Berichte aus Mexiko, nach denen dort in `Masthäusern' Straßenkinder wieder aufgepäppelt werden, bevor sie getötet und `ausgeschlachtet' werden. Auf den Philippinen wurde den zum Tode verurteilten Sträflingen für eine Nierenspende eine Strafmilderung gewährt. In Japan akzeptieren Kredit-Haie Nieren als Schuldentilgung. In Ägypten ist eine Niere für 10.000 bis 15.000 Dollar zu haben. Auch hier ist der Verkauf legal. Von chinesischen Ärzten wurde bestätigt, daß die Volksrepublik Nieren von hingerichteten 8 Arbeitskreis Organspende / Postfach 1562 / 63235 Neu-Isenburg / Tel.: 06102/3590 205 Sträflingen ohne deren Wissen gegen Devisen an Patienten aus Hongkong verkauft. Dort gibt es so wenig Spender, daß die Wartezeit für eine Operation statistisch 60 Jahre beträgt. Grund dafür ist der traditionelle chinesische Glaube, daß die Seele nach dem Tode keinen Frieden finden kann, wenn der Körper zerstückelt wird. Die Transplantationen kosten zwischen 17.000 und 33.000 Dollar. Nach offiziellen Angaben werden in China pro Jahr etwa 700 Menschen wegen Verbrechen wie Mord, Raub, Schmuggel oder Bestechung zum Tode verurteilt und mit einem Schuß in den Kopf getötet. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schätzt die Zahl jedoch wesentlich höher ein. Ärzte aus Hongkong vermuten, daß auch politische Häftlinge, darunter Verurteilte der gewaltsam niedergeschlagenen Demokratiebewegung von 1989, unter den Erschossenen waren, deren Nieren verkauft wurden. China bestreitet die Vorwürfe. Organhandel gibt es auch vor unserer Haustür. 1989 gab es in England einen Skandal, als Ahmet Koc (38), ein Landarbeiter aus der Osttürkei, nach einer vermeintlichen Gesundheitsüberprüfung aus der Narkose erwachte und eine Niere weniger hatte. Koc wurde zurück in die Türkei geschickt, für seine Niere bekam er 4000 Dollar. ... Sechs private Londoner Kliniken versorgten damals wohlhabende türkische, iranische oder indische Patienten mit von Türken gekauften Nieren. Inzwischen wurde Organhandel in England unter Strafe gestellt. In Deutschland machte 1988 Baron Rainer Rene Adelmann von Adelmannsfelden Schlagzeilen. Er schickte Briefe an bankrotte Unternehmer, in denen er etwa 75 000 Mark für eine Niere bot. In Deutschland gibt es bisher kein Gesetz, das Transplantationen und den Organhandel regelt. Schlimmer als westeuropäische Staaten trifft das Problem jedoch die Dritte Welt. Entwicklungsländer als Organreservoir für Reiche. Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in Genf sagten, in der Dritten Welt nehme der Verkauf von Organen alarmierende Ausmaße an. Offizielle Zahlen gibt es nicht, weil die meisten Beteiligten schweigen. ... Vom internationalen Geschäft mit menschlichen `Ersatzteilen' profitieren auch skrupellose Händler, die für die Vermittlung von Organen saftige Provisionen kassieren. Körperteil-Makler George Abouna, Leiter der Transplantationsabteilung der Universität Kuweit, befürchtet, daß der in vielen Staaten illegale Organhandel vom organisierten Verbrechen übernommen wird. Denn das Geschäft lohnt sich. Die Nachfrage steigt ständig. Während viele den Verkauf von Organen als Ausbeutung der Ärmsten der Armen in den Entwicklungsländern verurteilen, debattiert man in den USA über das Recht für jeden, seine eigenen Organe zu verkaufen oder zumindest eine Entschädigung für entnommene Organe zu bekommen. Wie in den meisten Ländern gibt es dort nicht genug Organspender. In den Vereinigten Staaten sterben jährlich mehr als 2.000 Menschen, während sie auf eine Transplantation warten. Knapp 15.000 Operationen werden pro Jahr durchgeführt, 23.000 Patienten stehen auf der Warteliste. Um die Bereitschaft der Menschen zu steigern, im Falle ihres Todes Organe zu spenden und damit einen schwarzen Markt für lebenswichtige Körperteile zu verhindern, ist eine staatliche Entschädigung für die Hinterbliebenen im Gespräch, zum Beispiel zur Deckung der Beerdigungskosten. Der Handel mit Organen ist verboten. Dr. James Light vom Washington Hospital Center, einer der größten Transplantationseinrichtungen der USA, schätzt jedoch, daß 15 bis 20 Prozent der Menschen, die für Verwandte oder Freunde eine Niere gespendet haben, vom Empfänger Geld geboten bekommen haben. Nach Ansicht des indischen Arztes Dr. Reddy ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Amerikaner und Europäer sich mit dem Thema Organverkauf auseinandersetzen müssen. `Der Bedarf an Nieren steigt weiter', sagt er. `Immer mehr Menschen hängen an Dialysegeräten.' Eine Erhöhung der Spenderbereitschaft im Todesfall soll Erleichterung bringen. In Ländern wie Indien und Ägypten ist dies aus religiösen Gründen nicht möglich, so daß der Handel mit Nieren dort weiter boomen dürfte. `Es ist einfacher, Organe von lebenden Spendern zu entnehmen', sagt Dr. Malaka Fouad aus Kairo. `Denn die Toten respektieren wir seit der Zeit der Pharaonen - vielleicht mehr als die Lebenden.'" SAD (HH A 22.10.91) "`Kontrollierte Verzweiflung': Arbeitsloser will Organe verkaufen dpa New York. Ein verzweifelter Arbeitsloser in New York will für 25.000 Dollar (40.000 Mark) eine Niere oder einen Lungenflügel verkaufen, um seine drückenden Schulden loszuwerden, und hat nach eigenen Angaben bereits Kontakt mit einer kaufwilligen Deutschen. 206 Thomas Frey annoncierte in einem New Yorker Anzeigenblatt, nachdem andere Blätter die Anzeige abgelehnt hatten. `Ich werde obdachlos und könnte ein Verbrechen begehen, etwa Drogen verkaufen', sagt er. `Aber das will ich nicht. Ich will ein guter Bürger sein und meine Schulden bezahlen.' Seine Anzeige bezeichnete er als einen `Akt kontrollierter Verzweiflung', der ihm helfen könnte, 20.000 Dollar Schulden zurückzuzahlen. Dem 28jährigen, der vor einem Jahr seinen Job bei einem Kurierdienst verlor und keine Arbeitslosenunterstützung mehr erhält, schwant, daß er mit dem Gesetz in Konflikt geraten könnte. Die Anwältin Judy Doesschate von der New Yorker Gesundheitsbehörde bestätigte, daß es ein Vergehen sei, wissentlich ein Organ zu verkaufen, bedroht mit bis zu einem Jahr Haft. Frey meint, um das Gesetz zu umgehen, könnte er seine Niere spenden, und die Empfängerin könnte ihm im Gegenzug 25 000 Dollar schenken, oder er könnte seine Niere für vielleicht 99 Jahre verpachten. Die Kaufinteressentin habe ihm erklärt, sie brauche nach Auskunft der Ärzte binnen eines Jahres eine Nierentransplantation." (Harburger Anzeigen und Nachrichten 24.01.92) Das Ganze erinnert an das mittelalterliche deutsche Sprichwort: „Wer nichts im Beutel hat, muss mit der Haut zahlen.“ Nur dass es jetzt in durch die Fortschritte der Medizin verschärfter Form gilt, denn damals war »nur« damit gemeint, dass ein Schuldner, der nicht in der Lage war, seine Schulden zu bezahlen, diese durch Arbeit beim Gläubiger abtragen musste. Und ein jahrelanges Schuldsklavendasein war nicht lebenswert, weiß Gott nicht! Das ging dem Schuldner ganz unschön an die Nieren, aber eben »nur« im übertragenen Sinne; jetzt aber, in unserer modernen Zeit mit ihrer teilweise praktizierten „VampirMedizin“, wo einer glaubt, sich auf Grund seines Reichtums und der Armut des anderen diessem seine Lebenskraft teilweise abkaufen zu können, hat das Sprichwort für einige Unglückliche seine im realen Wortsinn einschneidende Aktualität wiedererlangt. "Reportage über die skandalösen Geschäfte mit Organen Ersatzteillager Mensch Ghowindbhai ist ein 26jähriger Inder, Analphabet aus einem Dorf, von einer chronischen Krankheit geplagt. In Bombay geriet er an Leute, die ihm zu helfen versprachen. Aber diese Leute zogen ihn buchstäblich über den Tisch - über den Operationstisch. Als der junge Mann aus der Narkose erwachte, fehlte ihm eine Niere. Er bekam eine Handvoll Geld, umgerechnet 2500 Mark, und wurde nach Hause geschickt. Seine Niere hat jetzt ein wohlhabender Araber. Ghowindbhai war nämlich an professionelle Organhändler geraten. ... Die Reporter haben herausgefunden, daß auch deutsche Patienten sich in Krankenhäusern der Dritten Welt Organe einpflanzen lassen. Die Spender werden dabei manchmal, wie der arme Ghowindbhai, auch übers Ohr gehauen. Organverpflanzungen sind aus der Sicht der Patienten zweifellos ein großer medizinischer Fortschritt. Aber seit einigen Jahren haben sich im In- und Ausland obskure Figuren des Geschäfts mit menschlichen Organen angenommen. In der Bundesrepublik bewegen sie sich damit in einem rechtsfreien Raum. Kein Gesetz regelt bisher diesen ethisch außerordentlich sensiblen Bereich. Nicht anders ist es mit abgetriebenen oder zu früh geborenen Embryos oder Föten, die als `Material' für Forschungszwecke, aber auch für Transplantationen sehr gesucht sind. Öffentlich wird immer wieder bestritten, daß man auch in Deutschland auf dem `freien Markt' jederzeit einen Fötus kaufen könne. Aber man kann. Das will Silvia Matthies in ihrer Reportage beweisen. ..." (HH A 19.04.89) "Fötus weinte SAD Rom - Schock in einer Klinik in Modena (Italien): Als einem angeblich totgeborenen Fötus die Hirnanhangdrüse entnommen werden sollte, fing die Frühgeburt (sechster Monat) an zu weinen. Der kleine Junge lebte noch 24 Stunden. Jetzt ermittelt das Gesundheitsamt gegen die behandelnden Ärzte wegen Fahrlässigkeit." (HH A 30.09.91) "Sohn verunglückt - Organe entnommen HA/ann Berlin - Lucie John (66) aus Berlin wußte, daß ihr Sohn Bernd Dieter (33) während seines Spanienurlaubs mit dem Auto verunglückt war und in Barcelona im Krankenhaus lag. Ein Arzt hatte es der Mutter am Telefon mitgeteilt. Was sie aber nicht ahnte: Ihr Sohn starb kurz nach dem Anruf an den Folgen des Unfalls. Herz, Nieren, Lungen, Leber und Augen wurden dem Toten ohne Rücksprache mit den Angehörigen entnommen. Erst fünf Tage nach dem Unglück, als Bernds Schwester nach Barcelona flog und vor dem leeren 207 Bett des Bruders stand, erfuhr sie: Bernd Dieter John ist tot, seine Organe wurden für Transplantationszwecke freigegeben. Die Urne wurde nach Berlin geschickt. In Spanien dürfen Ärzte ohne Einverständnis der Angehörigen Organe von Toten entnehmen. Dieses Gesetz gilt auch für Ausländer. Die sogenannte Widerspruchsregelung gibt es auch in Österreich, Italien, Frankreich, Griechenland, Portugal und der Schweiz. `Wer ins Ausland fährt und im Todesfall seine Organe nicht spenden möchte, sollte dies notieren und den Zettel stets bei sich tragen. Dann ist man vor unfreiwilliger Organentnahme sicher', sagt Gabriele Wollflast, Juristin an der Universität Göttingen." (HH A 19.09.91) "Mord-Uni: Chef gab den Auftrag Obdachlose in Kolumbien für Versuche getötet Eine grauenhafte Meldung überschattete den Karneval in der kolumbianischen Hafenstadt Barranquilla. Im Universitätsgebäude waren die Leichen von elf Obdachlosen gefunden worden. Gerüchte, wonach sie für die Medizin sterben mußten, wollten nicht verstummen. Jetzt kam die Wahrheit ans Licht. Sie ist schlimmer als befürchtet. Von Walter Unger SAD Bogotá - Als die Fahnder den 34jährigen Chef der Sicherungstruppe der Universität von Barranquilla festnehmen wollten, kamen sie fast zu spät. Bevor bei Petro Vilora die Handschellen klickten, schluckte er den Inhalt einer Flasche Insektengift. Dem Tode nahe kam er in die Intensivstation der Universitätsklinik. Die Ärzte konnten ihn retten. Nun hat er im Krankenbett gestanden. Was er der Polizei ins Protokoll diktierte, erschütterte selbst die an Greuel gewöhnten Beamten. Vilora: `Ich allein habe mehr als 50 Menschen totgeschlagen.' Wieviele Opfer auf das Konto seiner 14 Kollegen gehen, die ebenfalls festgenommen wurden, konnte er nicht beziffern. `Wir suchten uns nur Opfer aus, von denen wir annahmen, daß sie keine Angehörigen hatten und nicht vermißt würden.' Vilora weiter: `Weil Schußwunden aufgefallen wären, erschlugen wir alle.' Entschuldigend fügte er hinzu: `Ich wußte, daß alle Schuld auf mich fallen würde. Aber ich bin nicht allein verantwortlich - ich erhielt die Mordaufträge vom Direktor, von Professor Navarro.' Navarro blieb vorerst auf freiem Fuß, obwohl in der Leichenhalle seines Instituts noch zwölf weitere Leichen gefunden wurden, deren Herkunft unklar ist. Einige waren bereits zerlegt, in Sezierschüsseln fand die Polizei Gliedmaßen. Allen Leichen waren die Fingerkuppen, die eine Identifizierung möglich gemacht hätten, abgeschnitten worden. Navarro bestritt jedoch, mit den Morden irgend etwas zu tun zu haben: `Alle Leichen, die zum Sezieren gebraucht werden, wurden legal gekauft.' ..." (HH A 07.03.92) "Außer in den Niederlanden, Island, Malta, Liechtenstein und Irland gibt es überall im europäischen Ausland Transplantationsgesetze. Die regeln die Organ-Entnahme nach zwei Modellen: o Bei der Einwilligungslösung müssen die Angehörigen9 ihre Zustimmung ausdrücklich erteilt haben, bevor die Organe eines Hirntoten entnommen werden dürfen. Oder es liegt eine verbindliche Erklärung des Verstorbenen vor, etwa in Form eines Organspenderausweises. Obwohl es hierzu keine gesetzliche Grundlage gibt, praktizieren die deutschen Transplantationszentren diese Regelung seit über zwanzig Jahren. o Bei der Widerspruchsregelung muss der Verstorbene zu Lebzeiten erklärt haben, daß er einer Organentnahme nicht zustimmt. Oder die Angehörigen verweigern diese Operation. Liegt kein Einspruch vor, müssen die Ärzte nicht rückfragen, bevor sie verpflanzbare Organe entnehmen. Diese Regelung gilt zum Beispiel in Österreich und, zumindest formell, noch in den neuen Bundesländern. Eine entsprechende DDR-Verordnung aus dem Jahre 1975 hat der Einigungsvertrag nicht ausdrücklich annulliert. Dennoch halten sich auch die ostdeutschen Transplantationszentren an die Einwilligungslösung. ... Nicht einmal die Transplanteure sind sich über den richtigen Kurs bei einem Organspendegesetz einig. ... Als Kompromiß schlägt die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Transplantationszentren eine Informationslösung vor. Hier müssen die Angehörigen von der beabsichtigten Organentnahme 9 „Nächste Angehörige“ im Sinne von § 4 II TPG sind in der Rangfolge ihrer Aufzählung: 1. Ehegatte, 2. volljährige Kinder, 3. Eltern(teil), 4. volljährige Geschwister und 5. Großeltern. Diesen wird eine volljährige Person gleichgestellt, „die dem möglichen Organspender bis zu seinem Tode in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahegestanden hat; sie tritt neben den nächsten Angehörigen“, so dass ein Lebensabschnittspartner nicht ausgeschlossen ist. 208 unterrichtet werden. Eine förmliche Zustimmung der Verwandten ist dann nicht notwendig. Schweigen wird als Einwilligung interpretiert. Jeder Einspruch, sei es durch ein Dokument des Verstorbenen oder durch die Angehörigen, verbietet die Explantation. ... Die ethische Grundlage der Organspende ist in Deutschland kaum noch strittig. Die katholische Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche haben 1990 eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der es heißt: »Aus christlicher Sicht ist die Bereitschaft zur Organspende nach dem Tod ein Zeichen von Nächstenliebe und Solidarisierung mit Kranken und Behinderten.« ... Die beiden großen christlichen Kirchen haben keine Schwierigkeiten, den Hirntod als eine Form des »exitus letalis« anzusehen - jenes Moments, in dem die Seele den sterbenden Menschen verlassen hat (exitus), was für seinen Körper den Tod bringt (letalis). »Daß das irdische Leben des Menschen unumkehrbar zu Ende ist, wird mit der Feststellung des Hirntodes zweifelsfrei erwiesen«, heißt es in der gemeinsamen Kirchenerklärung von 1990. ... 1989 räumte die Bundesregierung ein, eine Firma »Asiatransplant« biete in der Bundesrepublik Nieren von lebenden Spendern für 100.000 Mark an; ein Experiment von »Stern TV« in den neuen Bundesländern zeigte vor wenigen Wochen, daß dort manche Bürger nicht zögerten, eine gesunde Niere für 7500 Mark zu verkaufen.“ (STERN 7/91) "Deutsche Hospizhilfe mit Sitz in Buchholz fordert: `Keine Organspende ohne Zustimmung' wer Harburg/Buchholz. Viele Schwerkranke warten jahrelang auf eine Organspende, für manche bedeutet diese Zeit sogar den sicheren Tod. Denn Organspenden sind in den alten Bundesländern Mangelware. Ein Gesetzentwurf zur Organspende soll Abhilfe schaffen. Er sieht die Organentnahme bei `hirntoten' Unfallopfern auch ohne Zustimmung der Betroffenen selbst oder deren nächsten Angehörigen vor. Wer das nicht will, kann Widerspruch einlegen (Widerspruchslösung) und muß dann aber stets für den Fall des Falles ein entsprechendes Formular bei sich tragen. Professor Johann-Christoph Student von der Deutschen Hospizhilfe mit Sitz in Buchholz ... ist entschiedener Kritiker des Entwurfes. Den Tod des Gehirns als Ende des Menschlichen zu betrachten, hält er für `ethisch problematisch'. Damit werde der Wert des Gehirns als Sitz typischer menschlicher Wesensart überbetont. Student stellt dem Hirntod den Tod des Gesamtorganismus gegenüber. Prinzipiell begrüßt Student Organspenden als `sinnvollen Akt der Unterstützung Schwerstkranker.' Er meint aber, daß Transplantationen kein Allheilmittel seien. Viele Kranke seien auch danach weiterhin chronisch krank. `In der geplanten Gesetzgebungs-Initiative spiegelt sich einmal mehr die Mißachtung des sterbenden Menschen in unserer Gesellschaft wider', sagte Student. Anstatt mehr für die Humanisierung des Sterbens zu tun, werde statt dessen das Recht auf ein riskantes Lebenserhaltungsmanöver betont." (Harburger Anzeigen und Nachrichten 20.01.92) "Toter steckte sechs Menschen mit Aids an az München - Sie hofften auf Leben, aber was ihre Rettung schien, brachte den Tod. In den USA wurden sechs Menschen mit Aids angesteckt, weil sie Organe und Gewebe eines HIVpositiven Mordopfers erhielten. Drei von ihnen sind bereits gestorben. Jetzt geht bei deutschen Patienten die Angst um: Kann das auch bei uns passieren? Claudio Denzlinger, Arzt im Münchner Klinikum Großhadern: `Blut- und Organspenden werden zwar auf Aids getestet. Doch ein Restrisiko bleibt. Unter unglücklichen Umständen ist eine HIVInfektion bei Organverpflanzungen auch bei uns möglich.' In den USA erregt der Fall seit Tagen die amerikanische Öffentlichkeit. Der 22jährige William Norwood aus Virginia war von Gangstern überfallen und grausam mißhandelt worden. 23 Stunden kämpften die Ärzte um sein Leben - vergebens. Der Mann starb, aber seine Organe sollten `weiterleben'. Insgesamt 56 Menschen erhielten Gewebe-Transplantate von Norwood. Drei US-Bürger, die sein Herz und seine Nieren bekamen, sind bereits tot. Bei drei weiteren Empfängern wurde der Virus nachgewiesen. Die anderen 50 Patienten zittern noch. Wie viele von ihnen angesteckt wurden, ist unklar. Sicher scheint nur: Mordopfer William Norwood, der keiner Risiko-Gruppe angehörte, wurde 209 vermutlich, kurz bevor er starb, im Krankenhaus durch eine verseuchte Blut-Transfusion infiziert. Martin Cader vom Gesundheitsministerium in Virginia: `Blutspenden werden auf Aids getestet, die Tests sind verläßlich.' Der Münchner Arzt Claudio Denzlinger sagt dagegen: `Es gibt eine diagnostische Lücke von drei bis zwölf Wochen, in der der Virus nicht erkennbar ist.'" (HH A 25.05.91) Manche potentiell vorhandenen Krankheiten kann man innerhalb des kleinen Zeitfensters, das für eine Transplantation überhaupt nur offen steht, nicht diagnostizieren, so dass immer ein Restrisiko bleibt: „Tollwut durch Organspende Medizin-Panne: Empfänger erhielten infizierte Transplantate - drei Patienten in Lebensgefahr. Neu-Isenburg - Erstmals haben sich in Deutschland bei Organtransplantationen drei Empfänger mit dem tödlichen Tollwut-Erreger angesteckt. Sie sind in einem "äußerst kritischen Zustand". Drei weiteren Empfängern geht es gut. Alle sechs hatten Ende 2004 Organe einer offensichtlich mit Tollwut infizierten Frau (26) erhalten, deren Erkrankung damals nicht bekannt war. Lebensbedrohlich erkrankt sind eine junge Frau in Hannover, die eine Lunge erhalten hatte, ein Patient in Hannoversch Münden, dem eine Niere verpflanzt worden war, sowie ein Mann in Marburg, der die zweite Niere der Spenderin sowie die Bauchspeicheldrüse erhalten hatte. Die Patientin in Hannover zeigte nach der Transplantation "Zeichen einer Entzündung des Gehirns", so der Transplantationsmediziner Axel Haverich. Der Marburger Patient hatte die Uniklinik bereits verlassen und kam am Montag mit schweren Krankheitssymptomen zurück. Ohne Tollwutsymptome sind ein Patient, der in Heidelberg die Leber und zwei Patienten, die in Mainz die Augenhornhäute bekommen hatten. Inzwischen wurden vorsorglich alle Personen geimpft, die mit der Spenderin und den Infizierten in Kontakt gekommen waren. Die Spenderin war erst im Oktober von einer Indien-Reise zurückgekehrt. Ob sie dort von einem Tier gebissen wurde, sei ungewiß. Die Frau habe keine Tollwutsymptome gehabt. Sie starb Ende des Jahres nach Drogenkonsum an Herzstillstand. Die Organe wurden ihr an der Uniklinik Mainz entnommen. Dabei seien alle vorgeschriebenen Untersuchungen durchgeführt worden, versichert der Ärztliche Klinik-Chef Manfred Thelen: "Die Diagnostik auf eine Tollwuterkrankung vor einer Transplantation ist unmöglich." Dies sei "ein schreckliches Unglück". In Deutschland war bislang kein Fall bekannt, in dem Organempfänger mit Tollwut infiziert wurden. In den USA starben 2004 vier Patienten an der Krankheit, denen infizierte Organe vom selben Spender übertragen worden waren. Es war der erste bekannte Fall. Ein Restrisiko bestehe bei Transplantationen immer, sagt Prof. Xavier Rogiers (47), Chef des Transplantationszentrums im Hamburger UKE. In den vergangenen zehn Jahren gab es zwei Fälle von Tollwut in Deutschland. Die Patienten hatten sich in Indien und Sri Lanka angesteckt. Beide starben. ap/HA“ (HH A 17.02.05) "Drüsen verkauft? `Report': DDR exportierte Hirn-Teile dpa München - In der ehemaligen DDR ist nach Informationen des Bayerischen Fernsehens über Jahre hinweg ein schwunghafter Handel mit den Organen toter DDR-Bürger betrieben worden. `Report aus München' berichtete gestern abend, 30.000 Hirnanhangdrüsen (Hypophysen) seien pro Jahr nach Schweden, Dänemark und der Schweiz verkauft worden. Ohne Wissen der Angehörigen sollen von nahezu jedem Leichnam in der DDR die Hypophysen entnommen und auf ihre `Verwertbarkeit' überprüft worden sein. Dieser Organhandel soll der DDR-Außenhandelsbank jährlich Devisen in Höhe von 1,5 Millionen Mark eingebracht haben." "Organe vom Henker afp Washington - Die Volksrepublik China benutzt nach Angaben der US-Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch/Asia hingerichtete Häftlinge als Organspender. Manchen Menschen würden bereits Organe entnommen, noch bevor sie tot seien. `Einige Erschießungen werden absichtlich verpfuscht, damit die Gefangenen noch leben, wenn ihnen die Organe entnommen werden.'" „Menschenrechte 210 Hingerichtet und ausgeschlachtet In China hat sich aus den Massenexekutionen ein lukrativer Handel mit Organen und eine regelrechte Transplantationsindustrie entwickelt. Getötet wird dabei genau nach Bedarf ... Noch auf dem Hinrichtungsplatz entnehmen die Ärzte die bestellten Organe. Meistens auf der Ladefläche eines LKW. ... An einem Tag im März 1986 wurde Dr. Miao Chen vom Parteisekretär seiner Klinik zu einer speziellen Mission befohlen. Mit einem Kollegen und zwei Studenten wurde er in ein entlegenes Gefängnis gefahren. Sie wurden in einen Nebenraum des Gefängnisses geführt. Dort lag ein Mann auf einer Pritsche. Er lebte noch, war aber bereits unter Vollnarkose. Dr. Chen wurde befohlen, dem Häftling den Leib zu öffnen und ihm beide Nieren zu entnehmen. Die Organe wurden sofort mit einem Militär-Hubschrauber in eine Transplantationsklinik geflogen. Der junge Arzt traute sich nicht, Fragen zu stellen, doch er hörte, wie sich zwei Offiziere über den Häftling unterhielten: »Morgen wird er sowieso erschossen.« ...“ (STERN 05.03.98) "Hinrichtung nach Maß - Todeszellen als Organbank SAD London - Chinas Todeszellen sind die schaurigste Organbank der Welt. Die meisten Hinrichtungen finden auf ärztliche Vorbestellung `nach Maß' statt, damit das Opfer hinterher ausgeschlachtet werden kann. Wenn es mit einem Transplantat besonders eilt, werden Todeskandidaten bei lebendigem Leibe seziert. Das deckte jetzt die BBC-Reporterin Sue Lloyd-Roberts auf. Sie hatte sich in China als `reiche Amerikanerin' ausgegeben, um für ihren `kranken Vater' eine Spenderniere zu finden. Sie bekam ein Angebot über 30.000 Dollar - in bar! Im Reich der Mitte, wo fast 70 Vergehen mit dem Tod bestraft werden, sterben pro Jahr schätzungsweise 10.000 Menschen von Henkershand. Ein Arzt braucht sich bloß den passenden Todeskandidaten auszusuchen, der dann maßgerecht exekutiert wird - das heißt: Benötigt der Doktor ein inneres Organ, wird das Opfer mit einem Kopfschuß umgelegt. Ist dagegen zum Beispiel eine Netzhaut gefragt, stirbt der Delinquent per aufgesetztem Herzschuß. In eiligen Fällen wie für einen hohen Parteifunktionär oder einen reichen Ausländer entnimmt der Chirurg das Organ auch dem noch lebenden Häftling. Die Reporterin zitiert einen Arzt mit den Worten: `Im Gefängnis bekomme ich die frischesten Organe.'" „China: Organe von Hingerichteten rtr Washington – Ein chinesischer Arzt hat dem US-Kongress bestätigt, dass in China hingerichteten Häftlingen Organe für Transplantationen entnommen werden – auch dann schon, wenn sie noch nicht klinisch tot gewesen seien. Die chinesische Regierung sprach von Verleumdung.“ (HH A 29.06.01) „Organhandel ap Hongkong – Ein Krankenhaus im Süden Chinas handelt nach einem Zeitungsbericht mit Organen hingerichteter Häftlinge. Eine auf diesem Wege ermöglichte Lebertransplantation werde mit umgerechnet 73 000 Mark berechnet. Bisher seien rund 40 Eingriffe durchgeführt worden, berichtete die Zeitung ‘South China Morning Post‘“. (HH A 10.01.00) 10 "Geschäft mit Transplantaten soll strafbar werden Organhandel ist Mord Straßburg - Das Europäische Parlament will in der EG ein Verbot des kommerziellen Handels mit menschlichen Organen durchsetzen. Ein grundsätzliches Verbot ist ferner für die Entnahme von Organen bei Minderjährigen oder entmündigten Personen, von wenigen streng geregelten Ausnahmen abgesehen, geplant. Organe, deren Ursprung nicht eindeutig bestimmt werden kann, dürfen danach weder eingeführt noch verwendet werden. ... In Form eines europäischen Verhaltenskodexes, so die Parlamentsentschließung, solle der Grundsatz sowohl der Unverkäuflichkeit menschlicher Organe als auch der Anonymität des Spenders gegenüber dem Empfänger geregelt werden. ... Hintergrund der Straßburger Initiative ist der wegen des chronischen Mangels an Transplantaten in In dem STERN-Artikel: „Pause in der Fabrik des Todes“ vom 15.06.00 findet sich der Satz: „Die USA aber, allen voran Texas, gehören zu den sechs Staaten, die diese ‘Barbarei‘[der Verhängung der Todesstrafe; d. Verf.] zulassen – neben dem Iran, Nigeria, Saudi-Arabien und dem Jemen. Selbst der Weltmeister im Hinrichten, China, hat sie vor kurzem abgeschafft.“ Im Deutschlandfunk wurde aber noch nach diesem Datum über Todesurteile aus China berichtet! 10 211 den letzten Jahren weltweit stark angestiegene gewerbliche Handel mit Organen. Wegen der damit verbundenen hohen Gewinnspannen ist es in mehreren Entwicklungsländern aber auch in Industriestaaten immer wieder zur Verstümmelung und Ermordung von Föten, Kindern und Erwachsenen gekommen, um menschliche Körperteile zu verkaufen, heißt es im Parlamentsbericht. Die vom sozialdemokratischen französischen Berichterstatter, dem bekannten Krebsforscher Leon Schwarzenberg genannten Beispiele muten wie schlimmste Visionen schlechter Horrorfilme an. Amerikaner adoptieren Kinder aus Peru, nur um sie im brutalsten Sinne des Wortes ausschlachten zu können. In Argentinien wurden Kranken in einer psychiatrischen Klinik Blut, Hornhaut und andere Organe entnommen und 1.395 Patienten verschwanden ganz. 3.000 in den letzten fünf Jahren von italienischen Familien adoptierte brasilianische Kinder sind verschwunden. In Einzelfällen konnten Gerichte ihre Spuren bis in Privatkliniken verfolgen, wo ihnen Organe entnommen wurden. Diesen Praktiken will das Europäische Parlament dadurch weitgehend den Boden entziehen, daß der Organhandel in Zukunft grundsätzlich wie Mord bewertet und bestraft werden soll. ..." (Das Parlament 17.10.93) "Organhandel Die Mafia tötet Kinder Italiens Sozialminister schlägt Alarm Der Verdacht besteht schon lange. Jetzt hat Italiens Sozialminister Antonio Guidi erstmals öffentlich bestätigt: Die Mafia adoptiert Kinder in der Dritten Welt, schmuggelt sie nach Europa. Hier werden sie getötet und in Geheimkliniken ihre Organe entnommen. Von ANDREAS ENGLISCH SAD Rom - Bisher galten die Gerüchte als reinstes Gruselszenario überdrehter Kinder in Brasilien. In einer sensationellen Erklärung vor der Sozialkommission des Abgeordnetenhauses sagte Italiens Minister für Soziales und Familie, Antonio Guidi: `Der Verdacht ist leider kein Lügenmärchen, sondern die Wahrheit.' ... Eine Zeugin sei die italienische Konsulin in Recife (Brasilien) ... . Sie habe ihm bestätigt, daß die Mafia einen Organhändlerring organisiert hat und systematisch Kinder tötet. Guidi wies außerdem darauf hin, daß Interpol nach 3.000 Kindern aus Brasilien fahndet, die zur Adoption freigegeben wurden und seitdem verschwunden sind. Laut Interpol `kostet' ein Kind in Südamerika nicht mehr als 4.000 US-Dollar auf dem Schwarzmarkt, wobei die Mütter knapp 100 Dollar erhielten. Interpol, so Guidi, habe ferner mehrere Fälle von Kindern nachgewiesen, die vermißt waren, nach einigen Tagen plötzlich wieder auftauchten mit noch frischen Operationswunden. Ihnen fehlte meistens eine Niere. ... Verdächtig erscheint den Vermittlern folgendes: In der Regel verlangen Eltern aus der ersten Welt Kleinkinder oder Neugeborene. Seit knapp sechs Monaten häufen sich aber die Anträge zur Adoption von Kindern, die stark bis sehr stark behindert und im Alter von 8 bis 12 Jahren sind. Minister Guidi: `Wir glauben, daß die Kinder von der Mafia nach Italien geschmuggelt werden, um von hier aus ihre eigentliche Bestimmung zu erreichen.' ... Nach Ansicht der Berater des Ministers sollen Gebote von bis zu 100.000 Mark für lebenswichtige Organe keine Seltenheit sein. Besonders grauenhaft an diesem Handel, so glauben die Experten im Guidi-Team, ist die Tatsache, dass die Kinder sozusagen bei lebendigem Leib ausgeschlachtet werden. Da nahezu alle menschlichen Organe nur mit erheblichen Schwierigkeiten auch nur für kurze Zeit konserviert werden können, wäre eine Transplantation aus einem noch lebenden Menschen nahezu ideal. Der Patient, der die Organe empfängt, könnte im gleichen Saal behandelt werden, in dem das Kind stirbt. ..." (HH A 23.09.94) „Handel mit Organen dpa/ap München – Organisierte Verbrecherbanden in Russland töten obdachlose Kinder, um ihre Organe an zahlungskräftige Kunden im In- und Ausland zu verkaufen. Das gehe aus einem Geheimpapier des Bundesnachrichtendienstes (BND) an die Bundesregierung hervor, berichtete das Nachrichtenmagazin ‘Focus‘.“ (HH A 30.10.99) "Organhandel: Eltern verkaufen Augen ihrer Kinder an reiche Europäer SAD Paris - In Südamerika werden Kindern die Augen entnommen, um sie für teures Geld an Patienten aus reichen Ländern zu verkaufen. Das behauptet die Autorin Marie-Monique Robin. Ihre Reportage `Die gestohlenen Augen' wurde gestern im TV-Sender M 6 gezeigt. `Mütter aus Südamerika kassieren 30 Mark pro Auge', sagt die Journalistin. `Ihre Kinder sind dann zwar blind, aber sie können ihre Familie für einige Wochen ernähren.' Die Autorin hatte bei ihren Recherchen 212 vorgegeben, daß bei ihrer kleinen Tochter eine Augenoperation notwendig sei. Einschlägige Ärzte in Argentinien und Kolumbien erklärten sich sofort bereit zum Eingriff. Kostenpunkt: pro Auge 3000 Mark. Und: keine Wartezeiten. Patienten in Europa und den USA warten oft bis zu drei Jahre auf die kostbare Spender-Hornhaut. Der Organhandel blüht. Marie-Monique Robin fand heraus: `Immer mehr europäische Ärzte schicken ihre Patienten nach Südamerika.'" (HH A 09.01.95) "Niere Kasse zahlt nicht für indisches Spenderorgan dpa Lüneburg - 35.000 US-Dollar zahlte der Autohändler Siegfried G. (56) für die Transplantation einer Niere. Das Organ eines lebenden indischen Spenders (28) wurde ihm in einem Krankenhaus in Bombay eingepflanzt. Die Hoffnung des Kaufmanns, daß die Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) die Kosten erstatten würde, erfüllte sich nicht. Ethisch-moralische Bedenken, mit denen die DAK die Zahlung ablehnte, bestünden zu Recht, meinte das Sozialgericht Lüneburg (Az.: S 9 Kr 19/93). Der Deutsche hatte seine medizinischen Daten an die Klinik geschickt und schon nach sechs Wochen einen Operationstermin erhalten. Vorher mußte er dreimal wöchentlich zur Dialyse. Der junge Organspender hat sich von dem Geld ein Taxi gekauft." (HH A 28.10.93) „Grundsatzurteil ap Kassel – Für einen schwer nierenkranken Lüneburger (60) war es der letzte Ausweg. Weil es in Deutschland für ihn kein Spenderorgan gab, fuhr er nach Bombay, kaufte sich von einem Inder (26) eine Spenderniere und ließ sie sich in einer Klinik einpflanzen. Kosten: 35 000 Dollar. Seine Krankenkasse (DAK) weigerte sich, ihm das Geld zu erstatten. Das Bundessozialgericht gab der Kasse recht. Begründung: Den Körper des Menschen zum Handelsobjekt zu machen, verstoße gegen das Grundgesetz (Az.: 1 RK 25/95)“ (HH A 16.04.97) „Organhandel ’Nieren, Herzklappen, praktisch alles’ Der illegale Handel mit Organen boomt. Die Türkei gilt als Hauptumschlagplatz - doch die Ermittler tappen weitgehend im Dunkeln Genf - Die Untersuchung beim Hausarzt endete mit einer bösen Überraschung. Der Mediziner eröffnete der Pförtnerin Laudiceia Cristina da Silva: ’Ich habe eine sehr schlechte Nachricht. Eine Niere ist aus Ihrem Körper verschwunden.’ Die junge Brasilianerin rang nach Luft. Der Verdacht der Frau aus São Paulo fiel auf das staatliche Krankenhaus: Dort hatten Chirurgen ihr eine Zyste im Bereich des Eierstocks herausgeschnitten. Auf die polizeiliche Untersuchung des möglichen Organdiebstahls reagierten die Ärzte des Spitals mit einer erstaunlichen Erklärung: Die Zyste habe die Niere umschlossen. Das Organ sei zusammen mit der Geschwulst wegoperiert worden - ein dummer Fehler eben. Seit sieben Jahren lebt Laudiceia nur noch mit einer Niere. Die andere wurde höchstwahrscheinlich auf dem Schwarzmarkt für Organe feilgeboten. ’Die Klientel weitet sich aus’, sagt Nikola Biller-Andorno von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Nach einem WHO-Bericht warten derzeit 40 000 Menschen allein in Europa auf eine neue Niere. Um nicht wertvolle Zeit zu verlieren, schauen sich viele der Todgeweihten auf dem Schwarzmarkt um. ’Dort gibt es nicht nur Nieren und Leber, Sie können die Netzhaut oder ganze Augen kaufen, Herzklappen, Hirnteile, praktisch alles’, erklärt Nancy Scheper-Hughes, Professorin mit Forschungsschwerpunkt Organhandel in Berkeley. Die Preise für gebrauchte Körperteile schwanken erheblich. Wer sich in den USA eine Niere implantieren läßt, muß bis zu 200 000 Dollar hinlegen. In ärmeren Ländern reichen schon einige tausend Dollar aus. ’Exakte Zahlen über den weltweiten Organhandel sind nicht vorhanden’, sagt Biller-Andorno. Fest steht aber: Eine Organmafia hält Teile der Szene fest im Griff. Zu den besonders umsatzstarken Regionen, die in der Branche ’Nierengürtel’ heißen, zählt auch Moldawien. In dem europäischen Armenhaus tragen inzwischen immer mehr Menschen ihre Körper zu Markte. Händler kaufen Nieren oft für weniger als 3000 Euro. In der Türkei läßt sich dann der zehnfache Preis für das Organ erzielen. Die Türkei ist mittlerweile zur ’Drehscheibe’ des Organhandels geworden. Die Fahnder tappen oft im Dunkeln. Illegale Aktivitäten würden ’observiert’, teilt ein Beamter von Interpol in Lyon mit. Organhandel sei aber ein ’sehr schwieriges Gebiet, weil die Gesetze in vielen Staaten verschieden sind’. Tatsächlich fehlt immer noch ein rechtlich verbindliches internationales Abkommen gegen den Organhandel. EPD“ (DIE WELT, 17.11.04) 213 "Organ-Handel wird unter Strafe gestellt HA Bonn - Jeder kommerzielle Handel mit Organen von lebenden Spendern soll bereits in Kürze in Deutschland unter Strafe gestellt werden. Ein von Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger (FDP) gestern in Bonn vorgestellter Gesetzentwurf sieht vor, `jeglichen gewinnorientierten Umgang mit menschlichen Körpersubstanzen, sofern sie einem Menschen entnommen und zum therapeutischen Einsatz bestimmt sind', zu verbieten. Im Vordergrund steht dabei der Handel mit nicht regenerierungsfähigen Organen, Organteilen und Geweben, bei deren Entnahme die gesundheitlichen Risiken besonders groß sind. Aber auch der Handel mit Haut, Knochenmark und Lebersegmenten, die von lebenden Spendern transplantiert werden, soll bestraft werden. Es müsse verhindert werden, daß Menschen vor allem in der Dritten Welt sowie in Osteuropa `von skrupellosen Geschäftemachern ausgebeutet und als lebende Ersatzteillager für Reiche in den westlichen Industrienationen mißbraucht werden', begründete die Ministerin ihren Gesetzentwurf. Deshalb werde die geplante Regelung auch für im Ausland begangene Taten gelten. Frau Leutheusser-Schnarrenberger verwies darauf, daß es bei der Transplantationsmedizin zumindest in Teilbereichen einen deutlichen Mangel an geeigneten Spenderorganen gebe. Angesichts dessen sei die Versuchung für Geschäftemacher groß, `existentielle Notlagen bei Empfängern wie Spendern in besonders verwerflicher Weise auszunutzen'. Deshalb wolle man vor allem zwei Dinge verhindern: Zum einen dürfe der menschliche Körper nicht kommerzialisiert werden. Zum anderen dürfe die Verfügung und Verteilung lebenswichtiger Organe nicht von der finanziellen Leistungsfähigkeit potentieller Empfänger abhängen. `Maßgeblich für eine verantwortbare Entscheidung kann nur die therapeutische Dringlichkeit im Einzelfall sein', betonte die Ministerin. ... Nicht erfaßt werden von dem überarbeiteten Entwurf der Handel mit Organen Verstorbener sowie die Fragen der Transplantationsmedizin. Für beide Bereiche seien die Länder zuständig." (HH A 18.06.94) Mangel an Spenderorganen Zweifel Von MAX CONRADT Noch nie ist es irgendwo einmal gelungen, einen Menschen, dessen Hirnaktivität erloschen war, wieder ins Leben zurückzuholen. Dennoch gibt es jetzt erneut, überwiegend emotional bestimmt, Zweifel an der Eindeutigkeit des Hirntodes. Und diese Zweifel an der Sicherheit der Todesbestimmung haben die Bereitschaft zur Organspende wieder zurückgehen lassen. Tatsächlich ist schwer verständlich zu machen, daß sich bei einem totgesagten Menschen, der da im Krankenzimmer liegt, dennoch der Brustkorb unter der mechanischen Atemhilfe hebt und senkt, daß der Körper noch warm, die Haut noch rosig ist - alles Zeichen von Leben. Schaltet der Arzt aber die Mechanik aus, erlöschen augenblicklich diese vermeintlichen Lebenszeichen. Man muß indessen Verständnis haben für Angehörige, die in einer solchen Situation am Bett eines Verstorbenen stehen. Indem sie jedoch eine Organentnahme verweigern, helfen sie ihrem Toten nicht mehr, verweigern aber einem anderen Todkranken, weiter leben zu können. In der Welt gibt es Tausende, die mit fremden Organen leben, die sich wieder gesund fühlen. Sie belegen, daß die Organtransplantation zu den segensreichsten Errungenschaften der modernen Medizin gehört." (HH A 18.06.94) "Bitte, spendet Organe! Seehofers Appell an die Deutschen: `Solidarität über den Tod hinaus' co/ap/dpa Bonn/Hamburg - Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesärztekammer-Präsident Karsten Vilmar haben die Bundesbürger eindringlich dazu aufgerufen, Organe zu spenden. Seehofer sagte, dies sei `Solidarität über den Tod hinaus'. Der Bedarf an Nieren, Herzen und Lebern sei nahezu doppelt so hoch wie die Zahl der erfolgten Transplantationen. Nach den Diskussionen der vergangenen Wochen um ein Transplantationsgesetz sei die grundsätzliche Bereitschaft zur Organspende in der Bevölkerung von 90 auf 70 Prozent gesunken. Seehofer betonte, die Bundesregierung werde in einem Transplantationsgesetz nur eine Lösung mittragen, die das Selbstbestimmungsrecht der Bürger und ihr über den Tod hinaus fortwirkendes 214 Persönlichkeitsrecht achte. Ausschlaggebend sei der Wille des einzelnen oder, wenn keine Äußerung zu Lebzeiten vorliege, der seiner Angehörigen. Die von ihm angestrebte `Informationslösung' sehe vor, daß bei fehlender Willenserklärung des Verstorbenen den Angehörigen eine Frist von einigen Stunden eingeräumt werde, in denen sie ihre Zustimmung zur Organentnahme geben oder verweigern könnten. Bislang aber hat der Bund keine Gesetzgebungskompetenz für eine umfassende Regelung des Transplantationsrechts. Noch stehe die Zustimmung des Bundesrates zu einem Bündel von Grundgesetzänderungen aus, von denen eine auch die Regelung der Organentnahme möglich machen solle, sagte Seehofer. Bei Zustimmung des Bundesrates könne das Transplantationsgesetz als eines der ersten Gesetze in der neuen Legislaturperiode verabschiedet werden. ... Eingehend auf die Auseinandersetzung um die Frage, ob Organe auch wirklich nur bei Toten entnommen werden, sagte Vilmar, erst wenn der Tod unwiderruflich eingetreten sei, würden Organe entnommen. Das bedeute den unumkehrbaren Stillstand von Herz und Kreislauf (Herztod) oder den vollständigen und irreversiblen Ausfall des gesamten Gehirns trotz künstlich aufrechterhaltener Herz- und Kreislauffunktion (Hirntod). Dies müßten zwei Ärzte feststellen, die nichts mit der Transplantation zu tun hätten. Seehofer erklärte, die Bundesrepublik sei im Eurotransplant-Verbund mittlerweile das Land mit der niedrigsten Quote an Organspenden. Im ersten Halbjahr 1994 seien es 14,3 Organspender je eine Million Einwohner gewesen. In Luxemburg waren es im gleichen Zeitraum 30, in Österreich 29,3 und in Belgien 22,6. `Wir sind schon seit vielen Jahren Organ-Importland, insbesondere für Nieren, Herzen und Lebern', sagte der Minister. In Brasilien nimmt der Organhandel immer brutalere Züge an. Ausländer adoptieren zum Schein behinderte Kinder, um deren Augen, Lungen und Nieren meistbietend auf dem schwarzen MedizinMarkt zu verkaufen. Auf eine entsprechende Studie der Universität Brasilia machte gestern Radio Vatikan aufmerksam. Oft verliere sich die Spur der Kinder. Wie viele von ihnen ermordet wurden, ist nicht bekannt." (HH A 13.08.94) „Transplantationen Lange Warteliste dpa Köln – Etwa jeder vierte Patient, der in Deutschland auf ein lebensrettendes Herz oder eine Leber wartet, stirbt angesichts eines dramatischen Mangels an Organspenden innerhalb der Wartezeit. Die Zahl der Sterbefälle auf der Warteliste wachse seit Jahren ... . Das im Dezember 1997 in Kraft getretene Transplantationsgesetz habe bisher nicht zu der erwarteten Zunahme von Organspenden geführt. ...“ (HH A 17.03.99) Nach bisher gültiger Rechtsauffassung verstieße es gegen die in Art. 1 GG als höchstem Verfassungswert angegebene Würde des Menschen, wenn menschliche Organe durch bezahlte Lebend»spenden« kommerzialisiert würden, der Mensch sich zur Ware machen, der Körper zu einer handelbaren Ressource eines Verarmten würde. Menschen würden aus verzweifelter Geldnot Organe »spenden«, Organe insbesondere aus der dritten Welt gekauft werden. Beides bedeutete Ausbeutung in extremster physischer Form. Der Zugang zu den weiterhin dringend benötigten Organen darf nicht zum Exklusivrecht Wohlhabender werden. In z.B. Belgien und Österreich gilt im Todesfall durch eine widerlegliche gesetzliche Vermutung jeder als Organspender, der sich zu Lebzeiten nicht ausdrücklich gegen die Organspende entschieden hat. Deutschland als bevölkerungsreichstes Land Europas lebt mit seiner nicht effektiven Einwilligungslösung von Organen aus Ländern mit Widerspruchslösung. Aus dem ZEIT-Dossier „Operation Niere“ (05.12.02) „... 160 000 Dollar hat er einem israelischen Geschäftsmann gezahlt, der das Organgeschäft arrangierte. Er hätte den Handel auch in Südafrika, den USA oder Deutschland abwickeln können, ... In den USA allerdings hätte er bis zu 250 000 Dollar für eine Niere zahlen müssen. Die Türkei ist billiger. ... Wohlhabende Dialysepatienten reisen um die Welt, um eine Niere zu kaufen, was ihnen zu Hause bei Strafe verwehrt ist. Engländer und Deutsche fliegen nach Indien, Japaner in die USA, Nordamerikaner nach Peru oder Brasilien. Der Handel ist professionell organisiert und wird häufig als medizinischer Tourismus deklariert. ... ‚Arabische Transplantationspatienten zahlen zwischen 215 100 000 und 500 000 Dollar für die Operation’ heißt es in einem im Internet veröffentlichten Werbebrief. Pro Niere ein Gewinn bis zu 70 000 Dollar In anderen Ländern werden die illegalen Geschäfte kaum verhüllt praktiziert, z.B. in Israel. Dort ist der Kauf einer Niere so normal, dass mancher Kranker erst gar nicht die eigene Familie mit der Bitte um eine Organspende belastet. ... Auch die israelischen Krankenkassen sponsern Auslandstransplantationen – mit Billigung des Gesundheitsministeriums. Auf Dauer ist die Dialyse teurer als eine Organverpflanzung mit ihren Folgekosten. So erstatten die Kassen den Patienten den in Israel üblichen Kostensatz einer Transplantation. ... die Krankenkassen betreiben keine Recherche, ob die Transplantation im Ausland womöglich illegal war. ... Dabei ist dieses Geschäft in Israel wie in allen Ländern der westlichen Welt verboten. ... Am Ende gab ihm [dem zur Organentnahme in die Türkei geflogenen Moldawier Nikolae; der Autor] Jakob das Geld, 2800 Dollar. Versprochen hatte man ihm 3000, aber 200 Dollar wurden davon für das Flugticket abgezogen. Zu Hause kaufte er sich ein Häuschen: drei kleine Zimmer plus Garten, ein Fahrrad für den sechsjährigen Sohn, ein bisschen Essen und Kleidung – dies alle für eine Niere. ... Gelegentlich hat Nikolae Schmerzen an der Operationsnarbe. Doch für einen Arztbesuch fehlt das Geld. ... Nach der Operation sieht ein moldawischer Nierenspender noch einmal einen Arzt, ... ‚Je ärmer ein potenzieller Verkäufer, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Verkauf seiner Niere jedes Risiko lohnt’, schrieb etwa die britische Philosophin Janet Radcliffe-Richards mit anderen Autoren im Fachblatt The Lancet.“ „Todesstrafe für Organhändler Kabul – Afghanistans Präsident Hamid Karsai will Handel mit Kinderorganen künftig mit der Todesstrafe ahnden. Damit reagiert Karsai auf die steigende Zahl von Entführungen von Kindern, denen dann Organe entnommen würden, um diese ins Ausland zu verkaufen. (rtr)“ (HH A 05.07.04) Manchmal fällt es richtig schwer, aus grundsätzlichen Erwägungen heraus weiterhin gegen die Todesstrafe zu sein! 2.7.4 Das GG als lebender (Rechts-)Organismus Wenn sich der Magen nach der Lektüre des letzten Kapitels wieder etwas beruhigt hat, soll kurz auf die angesprochene Grundgesetzänderung zur Umverteilung der Gesetzgebungskompetenz von den Ländern auf den Bund eingegangen werden. Das GG als Grundgesetzänderungen sind nichts Ungewöhnliches. Im Rahmen von 42 Änderungen und Ergänzungen wurden seit Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23. Mai ("Verfassungstag") 1949 über 185 Artikel aufgehoben, neu lebender eingefügt oder - teilweise mehrfach - geändert. Das Grundgesetz kann als ein lebender (Rechts-) Organismus (Rechts-) Organismu begriffen werden. Und wie in einem Körper die zu erledigenden Aufgaben an die einzelnen Organe verteilt sind, s so sind auch im Grundgesetz die Zuständigkeiten zur Regelung der einzelnen Aufgaben an bestimmte Staatsorgane verteilt. 2.7.5 Regelungen der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern im GG 216 Regelungen der Gesetzgebu ngskompete nz zwischen Bund und Ländern im GG Technisc he Neuerung en bewirken oft einen juristischen Regelungsbed arf Was nun den (Teil-)Bereich der Gesetzgebungskompetenz anbelangt, sind – als Antwort auf den zentralistischen Führerstaat der NS-Zeit - laut Artikel 70 I GG grundsätzlich zunächst einmal die Länder für die Gesetzgebung innerhalb der Bundesrepublik zuständig. Doch von diesem Grundsatz ist bei Lichte besehen - abgesehen von der Polizei-, Justiz- und Kulturverwaltungshoheit - nicht allzu viel übrig geblieben. Um u.a. gemäß Art. 72 II Nr. 3 GG die (grundsätzliche) Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik zu wahren, sind immer mehr Kompetenzen von den Ländern auf den Bund übergegangen. Schließlich hat der Bund ja auch das meiste Geld, und wer das Geld hat, der hat meist auch das Sagen. Das ist immer ein wichtiges Argument! So ist das Gesetzgebungsverhältnis zwischen Bund und Ländern zu Ungunsten der Länder in eine beträchtliche Schieflage geraten. Der eben angesprochene Grundsatz der Ländergesetzgebungskompetenz besteht aber nicht für den Bereich der in den Artikeln 71 und 73 GG geregelten ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes und nur eingeschränkt für den Bereich der in den Artikeln 72, 74 und 74 a geregelten konkurrierenden Gesetzgebung. Dort haben die Länder nur dann die Befugnis zur Gesetzgebungskompetenz gemäß Art. 72 I GG, "... solange und soweit der Bund von seinem Gesetzgebungsrechte keinen Gebrauch macht". Besteht in diesem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung, geht das Gesetzgebungsrecht auf den Bund über. Ähnlich verhält es sich mit der Rahmengesetzgebung des Bundes. Um Streit möglichst zu vermeiden auch eine ungemein wichtige Aufgabe des Rechts(!), das die Regelung von Fragen und Problemen mit rechtlichem Gehalt von vornherein berechenbar machen soll -, ist in Katalogen geregelt, welcher Bereich in welche Schublade fällt. Dabei hat sich die von der Idee her größte Schublade "Länderkompetenz" ständig weiter geleert. Aber neue Anforderungen, an die früher niemand gedacht hat, weil sie nach damaligem Wissensstand einfach nicht vorstellbar oder bis dato politisch nicht gewollt waren – nehmen wir als eines der letzten die Bevölkerung der Bundesrepublik bewegenden Beispiele die im Schnellverfahren erlassenen unterschiedlichen Kampfhundeverordnungen der Länder, nach denen ein und derselbe Hund, wenn er von der Familie in den Urlaub mitgenommen und im Auto vom Norden Deutschlands in den Süden transportiert wird in manchen Bundesländern sofort getötet werden müsste, in anderen weiterleben darf -, füllen die Länderschublade unversehens immer einmal wieder mit einigen Krumen auf. Nachdem Organtransplantationen zum dringlichen Alltagsgeschäft gehören und einige Länder mit eigenen Gesetzesvorlagen unterschiedlichen Inhalts tätig geworden waren, besteht das Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen Regelung dieses Bereiches. Aber dem Bund sind zunächst die Hände gebunden, denn dieser Bereich gehört, wie ein Blick in die grundgesetzlichen Gesetzgebungskompetenz-Kataloge zeigt, zunächst nicht zu dem Bereich des Bundes. Und schon nimmt der Bund diese Kompetenzkrume - mit erforderlicher Zustimmung der Länder - aus der Länderschublade bald wieder heraus. 2.7.6 Technische Neuerungen bewirken oft einen juristischen Regelungsbedarf Jeglicher technische Fortschritt bringt stets Gefahren mit sich, nicht nur im Bereich der Biomedizin. Das ist eine Binsenweisheit. In allen Lebensbereichen wurden immer wieder neue bedeutende Entdeckungen gemacht, die geregelt werden mussten. Daraus ergibt sich für die Gesellschaft: Je größer der Fortschritt in einem Wissensbereich, desto größer ist meistens auch der juristische Regelungsbedarf, um bei gefahrgeneigter Technik die Grenzen dessen abzustecken, was „die Moral“, die jeweilige gesellschaftliche Wertordnung der Wissenschaft an Freiraum gestatten will. Nicht ohne Grund wurde in Art. 5 III GG geregelt: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“, womit deren Wertordnung gemeint ist; nur durch sie kann die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre eingeschränkt werden. Vor der Spaltung des Atoms bestand keine Notwendigkeit zur Schaffung eines Atomgesetzes. Seit der Nutzung der Kernenergie im großen Stil musste versucht werden, diese ungeheure Gefahrenquelle für eine unabsehbare Vielzahl von Menschen - erinnert sei an Tschernobyl und andere Kernkraftwerkshavarien wie in Harrisburg und anderswo sowie an den aufgekommenen Plutoniumschmuggel durch strengste Sicherheitsauflagen wenigstens juristisch ein wenig zu entschärfen. Das übernehmen dann die Juristen der Exekutive, indem sie Entwürfe erstellen, bei deren Erarbeitung sie sich von (meist interessegebundenen) Lobbyisten beraten lassen. Durch im Sinne seiner Arbeit- oder Auftraggeber günstige Einflussnahme auf den zu schaffenden Gesetzeswortlaut der Entwürfe (mittels z.B. der Festsetzung hoher Grenzwerte) kann sich ein Lobbyist, der nach der Maxime handelt: „Klage, ohne (vorher) zu leiden!“, sehr "verdient" machen! 217 Aktuellstes Beispiel für die Einschränkung der Forschung durch die Wertordnung der Verfassung war die Forschung an embryonalen Stammzellen. Sie war zwar in anderen Ländern erlaubt, in der Bundesrepublik bis Ende 2002 aber nicht, weil darin – unter dem Einfluss der Kirchen? - von der Mehrheit der deutschen Parlamentarier und vielleicht auch von dem BVerfG, das sich aber noch nicht zu diesem Problempunkt geäußert hat, ein Verstoß gegen die nicht in allen Einzelheiten genau festgelegte und daher interpretier- und wandelbare Wertordnung des Grundgesetzes gesehen worden war. 2.7.7 BVerfG als "juristische Notbremse" unterlegener Politiker Diese oftmals im Zusammenwirken zwischen Lobbyisten und Ministerialbürokratie erstellten Entwürfe gehen anschließend in den Rechtsausschuss, und zuletzt schlägt die Stunde der in der Legislative (gesetzgebenden Gewalt) versammelten Politiker - wenn nicht danach einige mit der neuen gesetzlichen Regelung unzufriedene, BVerfG als im parlamentarischen Ringen unterlegene Politiker die Judikative (rechtsprechende Gewalt) in Form des "juristische Bundesverfassungsgerichts anrufen, das dann (wenigstens für einige Zeit) verbindlich feststellt, was Sache sein Notbremse" soll. Diese Bestrebungen des Ziehens der juristischen Notbremse durch bei der Abstimmung nach der dritten unterlegene Lesung unterlegene Politiker und die daraufhin gefällten Entscheidungen können sich - wie z.B. im Falle der r Politiker vielen versuchten Neuregelungen des § 218 StGB - ohne weiteres gegen das Rechtsempfinden der Mehrheit des Volkes richten. Das demokratische Mehrheitsprinzip wird in einem solchen Falle durch das BVerfG institutionell konterkariert. Die hierauf vom BVerfG getroffenen Entscheidungen müssen aber auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein! Sonst hätte nicht ein ehemaliger Präsident unseres obersten Gerichts, Prof. Zeidler, unumwunden zugegeben: "Auch das Verfassungsgericht irrt." Mancher unterlegene Politiker hat der parlamentarischen Mehrheit schon zugerufen: „In Karlsruhe sehen wir uns wieder!“ Und wenn die Ansicht der parlamentarischen Regierungsmehrheit dann in Karlsruhe unterlag, dann erfüllte das die Regierungspolitiker manchmal mit maßlosem Zorn, den einige nicht bändigen konnten, so dass z.B. der Bundesminister Wehner (SPD) 1973 kundtat: „Wir lassen uns die Ostpolitik nicht von den acht Arschlöchern in Karlsruhe kaputt machen!“ So sehr hatte ihn die von den Verfassungsrichtern erzwungene Gesetzesmakulaturproduktion in den Harnisch gebracht. Ähnlich abfällig hatte sich schon 1952 der Bundesjustizminister Dehler (FDP) geäußert, der dem BVerfG vorgeworfen hatte, es führe sich als „Vorgesetzter des Parlaments“ auf, und er war zu dem Schluss gelangt, dass man „wegen eines solchen Gremiums Deutschland nicht vor die Hunde gehen lassen“ könne. Die Anrüpeleien von Seiten der Exekutivorgane unterblieben erst (für einige Zeit: bis der Bayerische Ministerpräsident Stoiber mit Schaum vor dem Mund offen zum Widerstand gegen das „Kruzifix-Urteil“ aufrief), als der Präsident des BVerfGs sich entschieden zur Wehr setzte und auf die ihm zugetragene WehnerÄußerung hin den Politikern – ohne Nennung des Anlasses - ins Stammbuch schrieb: „Kein (anderes) Verfassungsorgan ist berechtigt und autorisiert, ein vom BVerfG ergangenes Urteil als nicht rechtens abzuqualifizieren!“ 2.7.8 Beispiele für juristischen Regelungsbedarf aus dem Bereich der Biomedizin Doch noch einmal zurück zum Bereich der Medizin, wo sich für die Öffentlichkeit mit am offensichtlichsten regelungsbedürftige Neuerungen ergeben, insbesondere wenn Schlüsselfragen der Spezies Mensch juristisch geregelt werden müssen. Dann müssen viele Teilaspekte aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen zusammen gebracht werden, um eine gesellschaftlich akzeptierte Lösung zu erarbeiten. Wenn Biologen oder Mediziner durch ihre Forschungen eine Tür nach der anderen zu einer neuen Erkenntnis aufgestoßen haben und die Folgen ihres Tuns absehbar sind, dann muss gefragt werden, ob der sich andeutende Weg beschritten werden soll. Mit den Biologen und Medizinern arbeiten dann Theologen, Philosophen, Juristen und insbesondere die Ethiker zusammen, die sich auf die ethische Überprüfung medizinischer Sachverhalte spezialisiert haben, die Bioethiker. Bioethik beschäftigt sich mit den sittlichen Fragen von Geburt, Heilung, Leben und Tod im Lichte des biomedizinischen technologischen Fortschritts. Umstritten sind dabei insbesondere Themen wie künstliche Zeugung im Bereich der frühen Humanembryologie, die Diagnose von Erbkrankheiten noch vor Schwangerschaft durch Präimplantationsdiagnostik (PID) oder vor der Geburt, die diagnostische und therapeutische Verwertung der Erkenntnisse über das menschliche Genom für die Zeugung gesunder Kinder oder die Züchtung von Ersatzorganen, die Rechtfertigung des Schwangerschaftsabbruchs, im Sinne einer Ethik 218 des Helfens und Heilens die Entnahme von Organen Hirntoter oder, besonders sensibel, das Gebiet der aktiven Sterbehilfe. Tief greifende Konflikte zwischen eher pragmatisch denkenden und handelnden Ärzten und Biologen einerseits und teilweise fundamentalistisch denkenden und argumentierenden insbesondere Theologen und Ethikern sind dabei in der Sache angelegt. Aufgabe der Politik ist es, unter Assistenz der Juristen die in der Gesellschaft vertretenen unterschiedlichen Positionen in einer sozialverträglichen Weise auszugleichen, denn radikale weltanschauliche Entscheidungen würden einer offenen, moralisch pluralen, demokratischen Gesellschaft nicht gerecht. Dabei ist absehbar, dass eine gesellschaftliche Gruppe, die in diesen Entscheidungsprozessen unterliegt, sich zum BVerfG flüchten wird, um die von ihr als verhängnisvoll eingestufte Entwicklung trotz ihrer gesellschaftlichen Minderheitenposition doch noch stoppen zu können. Die Diskussion war bislang gekennzeichnet durch weltanschauliche Kontroversen zwischen einer mehr pragmatischen Richtung, die Chancen und Risiken der Biomedizin rational abzuwägen trachtet, im Gegensatz zu einer grundsätzlich argumentierenden Richtung, die ein Menschenbild – behauptet wird: des Grundgesetzes; das aber nicht so eindeutig festgelegt ist, so dass sich hinter dem Schutzwall Grundgesetz das eigene, meist religiös beeinflusste Menschenbild des mit dem Grundgesetz Winkenden verbirgt - gegen vermeintlich viel zu technikgläubigen und zudem kommerziell motivierten Fortschrittsoptimismus zu verteidigen trachtet. Die Ausgangsfragestellung aller dieser Überlegungen lautet: Darf die Medizin alles das tun, was sie schon jetzt oder – noch gefährlicher – in baldiger Zukunft kann? Sicher darf die Medizin kinderlosen Ehepaaren grundsätzlich bei der Verwirklichung ihres Kinderwunsches helfen – inzwischen angesichts der ständig weiter sinkenden Fruchtbarkeit auf Grund der durch Umweltbelastungen beängstigend abgenommenen Spermiendichte und der zunehmenden Intersexualität11 eine pure Notwendigkeit: Allein in Deutschland versuchen 50.000-60.000 Frauen jährlich durch In-vitro-Fertilisation ihren Kinderwunsch erfüllt zu bekommen, teilweise in fünf, sechs, sieben und mehr Anläufen - die zur Sucht werden können -, weil im Mittelwert bisher nur jede dritte künstliche Befruchtung gelingt. Seit der 2004 in Kraft getretenen Gesundheitsreform müssen Frauen/Paare, die eine künstliche Befruchtung vornehmen lassen wollen, mindestens die Hälfte der Kosten eines solchen Eingriffs selber tragen. Die Kassen beteiligen sich nunmehr maximal an den Kosten dreier Versuche. Wurden bis 2004 meistens zwei Embryonen eingesetzt – der zweite ist oft der »Starter« für den gesamten Vorgang, denn wenn zwei Embryonen eingesetzt werden, verdoppelt sich die Erfolgsquote -, lassen sich viele Frauen jetzt gleich die in Deutschland gesetzlich maximal mögliche Anzahl von drei Embryonen einsetzen, um – wie sie hoffen – größere Erfolgsaussichten zu haben und so die Kosten einiger Fehlversuche zu sparen. Doch nur bei Frauen ab 35 wirkt sich der dritte Embryo erfolgssteigernd aus. Jede vierte Labor-Zeugung führt zu einer Mehrlingsschwangerschaft Und das, obwohl Mehrlingsschwangerschaften riskanter sind als eine übliche Ein-Kind-Schwangerschaft, denn die Gefahr, eines der Kinder vor der Geburt zu verlieren, liegt bei Zwillingen bei fast sechs Prozent und damit rund viermal höher als bei Ein-Kind-Schwangerschaften. Bei Drillingen gibt es sogar in beinahe jedem zehnten Fall eine Totgeburt, was bei den betroffenen Frauen eine erhöhte Gefahr der Erkrankung an Depressionen, Bluthochdruck oder Diabetes führt. Drillinge kommen darüber hinaus in 90 % der Fälle als Frühchen zur Welt. Durch die hohe Selbstbeteiligung halbierte sich die Anzahl der in Deutschland künstlich gezeugten Babys von 20.000 auf 10.000 pro Jahr. Um die mit den Mehrlingsschwangerschaften verbundenen Probleme besser handhaben zu können, fordern Fortpflanzungsmediziner eine Dringlichkeitsänderung des Embryonenschutzgesetzes dahingehend, dass eine größere Anzahl von Embryonen künstlich befruchtet werden dürfe: wie in Schweden und Österreich praktiziert, wählen die Reproduktionsmediziner aus einer Reihe von 11 Durch die Verwendung von billig(er)en Kunststoffweichmachern und deren Eintrag in Seen, Flüsse und Meere, durch vom Regen in die Felder gewaschene Pflanzenschutzmittel und durch die zunehmende Hormonbelastung des Grundwassers durch Urin aus der zu lange mit verbotenen Mitteln gearbeitet habenden oder noch damit arbeitenden Tiermast und der die Pille nehmenden Frauen verändert sich die Geschlechtsausbildung weltweit: Tiere wie z.B. Krokodile beginnen zu verweiblichen, es entstehen zur Fortpflanzung nicht mehr fähige Eisbär-Zwitterwesen, … Solch eine Entwicklung geht natürlich am Tier Mensch, das das alles verursacht hat, auch nicht spurlos vorbei. Bei jeder 2.000sten Geburt, ca. 400 im Jahr, können Ärzte nicht mehr entscheiden, ob es sich um ein männliches oder weibliches Kind handelt. Dieses intersexuelle „3. Geschlecht“ in den verschiedensten Formen des Hermaphroditismus hat z.B. einen männlichen Chromosomensatz plus(!) einer kleinen Gebärmutter. Wenn sogar die Geschlechtsausbildung durch die Umweltbelastung in so starkem Maße beeinflusst wird, dann ist klar, dass auch die männliche Fruchtbarkeit zunehmend durch eine Reduzierung der Spermienbildung in Mitleidenschaft gezogen wird. Als Samenspender kommen – im Gegensatz zu früheren Vorstellungen – nunmehr vermehrt ältere(!) Männer in Betracht, weil deren Spermienbildung noch nicht so stark durch Umweltbelastungen gestört ist: Frauen mit dem Wunsch nach gesunden Kindern müssten sich also vermehrt in Richtung älterer Männer orientieren! (Und so kommen Männer wie ich wieder »ins Gespräch«.) 219 künstlich gezeugten Embryonen nach rund fünf Tagen denjenigen Zellklumpen aus, der sich am besten entwickelt hat und dessen Einnistung daher am wahrscheinlichsten erscheint. Die Chance auf eine Schwangerschaft ist bei diesem Vorgehen in etwa so hoch, wie bei beim Transfer von zwei nicht selektierten Embryonen. Die Gefahren von Mehrlingsschwangerschaften werden so aber vermieden. Da einige Länder, wie u.a. das katholisch geprägte Spanien, sogar eine Untersuchung der Gene auf Erbkrankheiten erlauben, wird dadurch die Chance auf ein gesundes Kind wesentlich erhöht. In Deutschland aber, dem Land der ethischen Bedenkenträger, wird unter ethischen und religiösen Gesichtspunkten gewichtig diskutiert, nach welchen Kriterien eine Auswahl eines Embryos getroffen werden dürfte und was mit den anderen Zellklumpen geschehen soll, die in Schweden zur Forschung freigegeben werden und in anderen Ländern vermutlich in den Müll kommen. „Diese Techniken sind möglich . Insemination: Zum Zeitpunkt des Eisprungs wird aufbereitetes Sperma in die Gebärmutter gespritzt. . Künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, IVF): Für eine künstliche Befruchtung (Reagenzglasbefruchtung) bekommt die Ehefrau Hormone, so daß mehrere Eibläschen in einem Zyklus heranreifen. Diese werden durch die Scheide (mit oder ohne Narkose) abpunktiert. Im Reagenzglas werden die Eizellen dann mit den Spermien des Ehemannes vermischt. Etwa drei Tage später werden bis zu drei Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt. . ICSI-Therapie (Intracytoplasmatische Spermieninjektion): Die Vorbehandlung ist dieselbe wie bei IVF. Im Labor werden die Spermien aber gezielt in jede Eizelle eingebracht. . TESE-Therapie (testikuläre Sperma-Extraktion): Diese Behandlung wird eingesetzt, wenn keine Spermien im Ejakulat vorhanden sind. Die Spermien werden mit dieser Methode direkt aus dem Hodengewebe gewonnen und dann für ICSI genutzt. (ang)“ (HH A 24.11.04) Beispiele für juristische n Regelungs bedarf aus dem Bereich der Medizin „Fakten aus dem IVF-Register 2003 Wie viele künstliche Befruchtungen mit welchem Erfolg in Deutschland durchgeführt worden sind, wurde auf dem 18. Jahrestreffen der deutschen IVF-Zentren vergangene Woche in Hannover berichtet. Dort wurde der Jahresbericht 2003 des Deutschen IVF-Registers vorgestellt, der die Arbeit der insgesamt 116 Zentren in Deutschland erfaßt. Demnach wurden 2003 insgesamt 63 111 Frauen behandelt, das waren rund 10 000 Frauen mehr als im Jahr 2002. Insgesamt wurden im IVF-Register 107 675 Behandlungen erfaßt. 89 016 Behandlungen wurden auch eingeleitet, 81 042mal wurden Eizellen entnommen. Diese Zahl dokumentiert, daß einige Frauen mehrfach behandelt wurden. Mittels Reagenzglasbefruchtung wurden 9197 Kinder geboren, rund 1500 mehr als 2002. Insgesamt gab es mehr als 2200 Mehrlingsgeburten, darunter sechsmal Vierlinge. 3924 Schwangerschaften endeten mit einer Fehlgeburt. Außerdem waren noch 7170 Frauen schwanger, als das IVF-Register erstellt wurde. (ang)“ (HH A 24.11.04) Nach der Gesundheitsreform 2004 werden von den gesetzlichen Krankenkassen nur noch drei Versuche gezahlt. Trotzdem wird bereits jedes 80. Kind in der Petrischale gezeugt. Und dabei können gravierende Fehler entstehen, die dann in schweren juristischen Entscheidungen aufgearbeitet werden müssen: Wechselfälle des Schicksals Ärzte setzten einer Mutter falschen Embryo ein: Eine Million Dollar Schadenersatz von Ulli Kulke Berlin - Nur wenige Minuten nach ihrem Eingriff an Susan Buchweitz war den beiden Ärzten klar: Sie haben soeben einen folgenschweren Fehler begangen. Doch die zwei Doktoren in San Francisco hielten dicht. Und es ist nicht mal einfach, sie dafür moralisch zu verurteilen. Jetzt wurde ihre Klinik zu einer Million Dollar Schadenersatz verurteilt. Es war im Sommer 2000, als die Dekorateurin sich in einer gynäkologischen Klinik einen Embryo einsetzen lassen wollte. Der Vater: ein unbekannter Samenspender. Schon lange hatte die 47-Jährige sich vergeblich um eine Schwangerschaft bemüht, vielleicht sollte es ihr letzter Versuch sein. Gleichzeitig war noch ein Ehepaar anwesend, zwecks künstlicher Befruchtung mit fremder Eizelle. Neun Monate später bekam Buchweitz einen gesunden Sohn, die Ehefrau gebar glücklich eine Tochter. Doch als beide Kinder zehn Monate alt waren, kam der einschneidende Anruf: Eine 220 ehemalige Klinikangestellte hatte ausgepackt, verraten, dass die Embryonen vertauscht worden waren. Sofort gestanden die Ärzte, meinten aber, sie hätten bei aller Abwägung verhindern wollen, dass Buchweitz abtreibt, und geschwiegen - eine Haltung, die vor Gericht sogar akzeptiert wurde. Auch die allein stehende Mutter hätte sich in ihre - genetisch - falsche Mutterschaft gefügt. Doch das Ehepaar, nun ebenfalls erschüttert, klagte vor Gericht auf das Sorgerecht für seinen Sohn; Buchweitz' Anwaltsrechnungen türmten sich, sie musste die Klinik verklagen, bekam am Dienstag die Million zugesprochen. Und nun? Ähnliche Fehler wurden nur drei Mal bekannt. Zwei Mal in London, darunter eine weiße Frau mit zwei schwarzen Zwillingen sowie ein "Ringtausch" mit drei betroffenen Frauen, und ein Mal in New York, wo eine weiße Frau Zwillinge gebar: ein leibliches Baby und einen nicht verwandten schwarzen Sohn. Nicht verwandt? Das ist die Frage, und so gibt sich das Gericht in San Francisco in Sachen Sorgerecht erst mal ratlos, gestattete vorläufig einen Besuch alle zwei Wochen. "Eine merkwürdige Situation", findet die Gebär-Mutter, "es steht in keinem Psychologiebuch, wie man damit umgehen soll." Nach deutschem Recht ist die leibliche Mutter diejenige, die das Kind geboren hat. Weder Leihmütter noch Eizellenspenden sind bei uns erlaubt, so ist die Regelung unproblematisch - bis der Arzt danebengreift. (DIE Welt, 05. 08.04) Darf zur Erfüllung des Kinderwunsches jedes Mittel angewandt werden? (Bisher) Sicher nicht, auch wenn das manche Evolutionsbiologen auf Grund der rasanten Fortschritte auf diesem Gebiet zukünftig möglicherweise anders sehen mögen. Der Evolutionsbiologe Robin Baker, der sich nach Aufgabe seines Lehrstuhls in Manchester ganz der Schriftstellerei über sein Fachgebiet gewidmet hat, schreibt in „Sex im 21. Jahrhundert / Der Urtrieb und die moderne Technik“ im Kapitel „Menschenwürde, der Wille der Götter und andere Belanglosigkeiten“ (S. 402 ff) mit Blick auf die Fortpflanzung im 21. Jahrhundert und die damit verbundenen rechtlichen Probleme: „Die Widersprüchlichkeit der Meinungen, die von der Öffentlichkeit, von Juristen und von Theologen in der Frage vertreten werden, was natürlich sei und was nicht, ist zum Schreien. Der Begriff des Natürlichen bietet keine Grundlage, um uns eine Meinung zur Zukunft zu bilden. Nur wer unbekleidet geht, sich nie rasiert, keine Deodorantien benutzt, nie Kontrazeptiva verwendet und als Frau alle Kinder stillt, bis sie sich von selbst entwöhnen, kann ohne Heuchelei die Fortpflanzungstechnik der Zukunft mit der Begründung ablehnen, sie sei unnatürlich. Der Kniefall vor der Natur ist eindeutig keine Position, von der aus man die Zukunft der Fortpflanzung ablehnen kann. ... Wenn ... mit Menschenwürde und dem Willen von Göttern argumentiert wird, sagt mir das nichts. Hinzu kommt noch, daß verschiedene Götter Verschiedenes wollen, verschiedene Propheten Verschiedenes lehren und verschiedene Theologen verschiedene Interpretationen haben. Und es weckt nicht gerade Vertrauen, daß die alten Propheten, deren Worte für uns interpretiert werden, nie von Spermien oder Genen gehört haben und daß die Interpreten oft Junggesellen sind. ... Ich will nur eine Einschätzung von dem kaum faßbaren Wortgeklingel vermitteln, das Philosophen und Theologen lediglich dazu dient, emotionale Vorurteile zu rechtfertigen. Im Streit um die Fortschritte der Fortpflanzungstechnik geht es vielfach um Rechte der Menschen. Die zentrale Frage ist, ob die Menschen ungeachtet ihrer Lebensumstände das Recht auf Fortpflanzung haben. Unsere ganze Evolutionsgeschichte war von der Natur diktiert, und folglich hatten die Menschen kein Recht auf Fortpflanzung. Die Situation war eindeutig, weil es keine Alternative gab. Wer konnte, pflanzte sich fort, wer nicht konnte, nicht. Von Rechten war keine Rede. Die moderne Technik hat jedoch eine Alternative geschaffen, und die Gesellschaft hat ein Recht in den Raum gestellt. Jetzt könnte sich jeder fortpflanzen, wenn er nur Zugang zur Technik erhielte – so wird sich die Situation jedenfalls im Jahr 2010 darstellen. Natürlich hat der Staat die Macht, den Menschen ein solches Recht streitig zu machen. Je nachdem, welche Technik unter das Verbot fällt, wird ein bestimmter Teil der unfruchtbaren Bevölkerungsgruppe von der Fortpflanzung ausgeschlossen. Wenn man zum Beispiel die Leihmutterschaft verbietet, sind Frauen, die kein Kind austragen können, für immer zur Kinderlosigkeit verdammt. Genauso ergeht es denen, die keine Gameten [weibliche oder männliche Sexualzellen (Eizellen oder Spermatozoiden); der Verf.] ausbilden können, wenn das Klonen und der Kerntransfer verboten werden. Aber hat die Gesellschaft als solche überhaupt das Recht, einem bestimmten Teil der unfruchtbaren Bevölkerungsgruppe die Freuden der Elternschaft zu versagen und sie einem anderen zu gewähren? Das kann man bezweifeln, besonders wenn nicht mehr dahinter steckt als diffuse Vorstellungen von Würde, von göttlicher Lenkung und von Natürlichkeit oder, was auch vorkommt, eine bloße Phobie gegen Individuen, die wegen der neuartigen Technik ihrer Zeugung nicht recht einzuordnen sind.“ Doch insbesondere das Klonen birgt – bis jetzt? - zu viele Gefahren! Da hat der Gesetzgeber nach meiner evolutionsbiologischen Laienmeinung Grenzen zu setzen, damit die Medizin nicht alles das tut, was sie heute 221 schon kann. Das sieht der Evolutionsbiologe Baker anders: „Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß Klonen einmal zur menschlichen Fortpflanzung als eine der zahlreichen Optionen, die künftigen Generationen offen stehen werden, gehören wird. Vielleicht muß man ihm aber erst einmal einen Namen geben, der weniger Emotionen schürt. Wie wäre es zum Beispiel mit »künstlicher Zwillingszeugung«?“12 Baker sieht zwei herausragende Fallkonstellationen, die seiner Meinung nach dem Klonen letztlich zum Durchbruch verhelfen werden: Wenn Eltern ihr geliebtes Kind in jungen Jahren durch einen tragischen Unfall verlieren und herzbewegend darum bitten, „dem Körper ihres Kindes noch lebende Zellen zu entnehmen, damit sie geklont und als ihr nächstes Kind, als Zwilling des toten Kindes, weiterleben können, wird man sich dieser verständlichen Bitte kaum verschließe