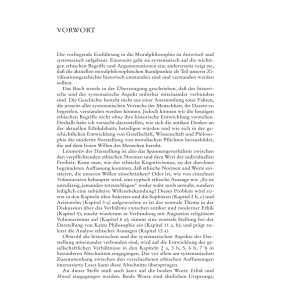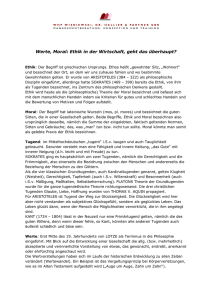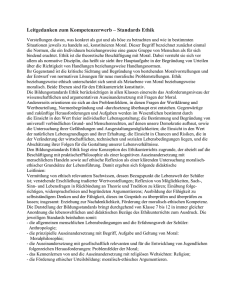Leist_Zentrum der Moral [3] 22.8.2012 - Ethik
Werbung
![Leist_Zentrum der Moral [3] 22.8.2012 - Ethik](http://s1.studylibde.com/store/data/020227557_1-7fa86b216998cd3499d13743a2524fdf-768x994.png)
Von den Grenzen in das Zentrum der Moral. Eine kleine Geschichte der angewandten Ethik Anton Leist Für Andreas Kuhlmann 1. Ein kurzer Blick zurück Auch wenn heute kaum mehr vorstellbar: angewandte Ethik war einmal ein aufsehenerregendes Unternehmen! Bei ihrem ersten Auftritt war sie von einer gesellschaftlichen Relevanz, wie es für eine geisteswissenschaftliche Disziplin, gar eine philosophische, ungewöhnlich ist. Im Verlauf der 1980er Jahre des letzten Jahrhunderts, und verstärkt gegen deren Ende, meldete sich in Deutschland eine religionsfreie und häufig dezidiert anti-metaphysische, philosophische Ethik zu den sog. „Grenzfragen“ des menschlichen und tierischen Lebens zu Wort und brach damit in eine Domäne der öffentlichen Meinungsbildung ein, die davor fast völlig von den Männern der Kirchen beherrscht worden war. Noch zur selben Zeit galten in der öffentliche Wahrnehmung in Deutschland katholische und evangelische Theologen als die einzigen „Fachleute“ für Ethik, die, ebenfalls ein Novum, neben „Interessenvertretern“ wie Medizinern, Feministinnen oder Tierschützern zur Teilnahme an relevanten Debatten autorisiert schienen. Dass sich auch Philosophen beruflich mit der Moral befassen, wurde gegen Ende der 1980er Jahre über die Fachdisziplin hinaus durch das Wirken vor allem zweier Repräsentanten des Fachs bekannt. Auf der einen Seite gewann die technologiekritische Umweltethik von Hans Jonas, vor allem sein bereits 1979 auf Deutsch publiziertes Buch Das Prinzip Verantwortung, einen zunehmenden Kreis von Lesern. 2 Anton Leist Zustimmend reagierte allerdings – aufgrund des sehr allgemeinen tugendethischen, in den normativen Folgen vagen Profils des Buchs – vorrangig der wertkonservative Teil der akademischen Öffentlichkeit, der aber zu dieser Zeit in Deutschland eine starke Allianz mit der grünen Bewegung eingegangen war. 1 Auf der anderen Seite hinterließ die angelsächsische Ethik zunehmend Spuren auch in der deutschsprachigen Philosophie. Rezeption und Widerstand gegenüber dieser Ethik kristallisierten sich vorrangig an einer einzigen Figur, an Peter Singer und dessen ebenfalls 1979 zuerst im englischen Original und 1984 auf Deutsch erschienenem Buch Praktische Ethik.2 Der Kontrast zwischen Jonas’ und Singers ethischen Positionen konnte größer kaum sein und die von beiden verursachte starke Aufmerksamkeit belegte ein im Umbruch befindliches Moralverständnis. Hier die globale humanistische Verantwortungsforderung für zukünftiges „menschliches Leben“, die schwer in präzisen Rechten und Pflichten zu kodifizieren ist. Dort der scharf geschnittene Interessenkonsequentialismus, den Singer zum ersten Mal auf so anscheinend heterogene Themen wie den Umgang mit Tieren, mit Schwangerschaft, Früheuthanasie, Sterbehilfe und 3.-Welt-Armut anwandte. Hier der ausgreifende historische Diagnoseversuch des „Planeten“, dort das alltagsnahe Abwägen mit Vergleichen zwischen konkreten Handlungssituationen. Hier die mahnende Beschwörung, dort das systematisierende Argumentieren mit dem Interessenprinzip. Auffallend der Kontrast zwischen klarem angelsächsischem Argumentationsstil und vager deutscher Hermeneutik. Inhaltlich am wichtigsten unterschieden sich beide Philosophen darin, dass Jonas als moralischer Mahner im umfassenden Stil auftrat und sich dabei auf grundsätzlich bekannte Weise auf das geläufige ethische Achten, Verehren und Verantworten stützte, während Singer weniger mahnte als zentrale moralische Intuitionen ungerührt in Frage stellte. Im Prinzip war ein derart elementarer Angriff auf die „herrschende Moral“ seit der Entwicklung des Utilitarismus durch Mill und Sidgwick 1 Jonas 1979. Eine englische Übersetzung erschien 1984 und blieb im Kontrast zur deutschsprachigen Debatte in der angelsächsischen Szene weitgehend unbeachtet. Einige „kasuistische“ Studien auch zur Medizin hat Jonas begleitend betrieben, gleichzeitig vor verfrühter Kasuistik aber gewarnt (Jonas 1985, S. 11). 2 Singer 1979 (dt. Singer 1984/1994). Thematisch verwandte Publikationen Singers aus diesem Zeitraum waren vor allem Singer/Kuhse 1985 und Singer 1995. 3 Anton Leist im 19. Jahrhundert durchaus bekannt.3 Aber niemand davor hat dieses Kritikpotential aus seiner akademischen Hülle zu befreien und so plastisch, einfach und konkret in alltägliche Anwendungen zu übersetzen vermocht, wie es in den einzelnen Kapiteln der Praktischen Ethik geschieht. Die aus dem einfachen Interessenprinzip folgenden moralischen Gründe führen zu einer starken moralischen Aufwertung des Lebens der Tiere (bis hin zur strikten moralischen Gleichheit von Säugetieren mit Selbstbewusstsein und Menschen); zur moralischen Neutralität des beginnenden menschlichen Lebens vor dem Erlangen von Selbstbewusstsein; und zur dringlichen Forderung des Kampfs gegen Armut im weltweiten Maßstab. Während Jonas’ Traktat nur das diffuse Gefühl der ethischen Bedenklichkeit erzeugt, verschiebt Singers Interessenprinzip die moralischen Gewichte auf punktuell klare Weise: die tierischen Interessen sind nicht generell den menschlichen nachgeordnet, menschliches Leben ist nicht in jeder Form schützenswert, die Hilfe gegenüber anderen ist moralisch nicht mehr (als subjektiv auslegbare „positive Pflicht“) dem Gutdünken überlassen. Während sich jemand wie Nietzsche nicht als „Ethiker“ bezeichnet hätte, weil traditionell gesehen Ethiker solche Personen waren, die bekannte Forderungen der Moral pädagogisch verstärken, kam nun mit Singer eine Figur in die Öffentlichkeit, die als Ethiker die Moral in zentralen Bereichen in Frage stellt, dem Lebensschutz am Beginn und (teilweise) Ende des menschlichen Lebens. „Besserer Tierschutz“ und „höhere Entwicklungshilfe“ – das sind gewohnte und entsprechend aufmerksamkeitsresistente Forderungen. „Akzeptiertes Töten von Neugeborenen“ – das wurde zwar von berüchtigten Eugenikern, aber davor kaum von einem akademischen Ethiker gehört und führte deshalb zu vehementen sozialen Reaktionen. Im Unterschied zu den angelsächsischen Ländern betraf der „Skandal“, der sich an Singer mehr entzündete als von ihm entfacht wurde, weniger die inhaltliche-normative These des Erlaubtseins des Tötens von Neugeborenen – diese These wurde von so gut wie keinem deutsch 3 Die Einschränkung „im Prinzip“ ist zu beachten, weil sich weder Mill noch Sidgwick das tatsächliche Konfliktpotential zwischen Utilitarismus und christlich tradierter Moral klar vor Augen führten. So war Mill der Meinung, sein Utilitarismus sei mit der Goldenen Regel und dem Liebesgebot Jesu nicht nur verträglich, sondern drücke diese in „höchster Vollkommenheit“ aus. S. Mill 1879, S. 30. 4 Anton Leist sprachigen Ethiker geteilt. Der Skandal erhielt sein Feuer vielmehr anhand der Frage, ob über dieser These im öffentlichen Raum überhaupt diskutiert werden dürfe, ob also der uneingeschränkte Schutz „menschlichen Lebens in jeder Form“ überhaupt rechtfertigungsbedürftig sei. Die Kritiker und Gegner Singers unterstrichen ihre Opposition durch das gewaltsame Stören und Verhindern entsprechender Veranstaltungen und Publikationen, die „liberalen Verteidiger“ Singers traten zwar nicht für die Tötungs-, aber für die Diskussionsfreiheit des Tötens von Neugeborenen ein. Anhand allein der inhaltlich verwandten Publikationen Norbert Hoersters im immer um politische Korrektheit bemühten SuhrkampVerlag ließ sich bereits einige Jahre später sagen, dass die „liberale“ Gruppe am Ende einflussreicher war: über den „Wert“ des menschlichen Lebens durfte und darf inzwischen öffentlich diskutiert werden, auch wenn die Vorstellung der moralischen Neutralität bewusstlosen menschlichen Lebens nach wie vor kaum Anhänger findet.4 2. Ethische Theorie trifft auf reale Moral Wie wir seit dem Schicksal Sokrates’ wissen, ist das Aufeinandertreffen von Philosophen in Aktion und Alltagsmenschen immer prekär, und das umso mehr, je stärker die fraglichen Meinungen praktisch relevant sind. Für die Ethik entsteht daraus das tiefe Problem, in welchem Ausmaß sie sich von den Alltagsmeinungen lösen und sie kritisch rekonstruieren oder gar verwerfen und reformieren soll. Im philosophischen Sprachgebrauch nennt man elementarste Prinzipien, Normen und Werte eine „ethische Theorie“, woraus sich das für alle Ethiker unumgängliche Problem eröffnet, in welchem Ausmaß diese „Grundnormen“ mit gewohnten „Intuitionen“ (Meinungen und Gefühlen) abgestützt werden oder diese ihrerseits begründen sollen. Vereinfacht lassen sich die Ethiker nach 4 Dokumentarisch zur Singer-Affäre s. vor allem: Anstötz (Hg.) 1992; Anstötz/ Hegselmann/Kliemt (Hg.) 1995; Euthanasie heute – Thema oder Tabu? Analyse & Kritik 12, Heft 2, 1990; Hegselmann/Merkel (Hg.) 1991; Singer 1991; Singer 1994, Anhang: „Wie man in Deutschland am Reden gehindert wird“; Singer 2009; Wuchterl 1996, Kap. 5: „Die Singer Affäre und die Euthanasie-Kontroverse“; Düwell 2009. Zur Ähnlichkeit der Position Hoersters: Im Unterschied zu Singer hält Hoerster die Geburt für eine nicht zu übertretende „ethische Grenze“, allerdings nur aus pragmatischen Gründen, die sich Singer im Prinzip ebenfalls zueigen machen könnte: Hoerster 1995. 5 Anton Leist „Fundamentalisten“ und „Kohärentisten“ sortieren, je nach dem Ausmaß, in dem sie einzig aus Grundnormen heraus argumentieren oder umgekehrt nur versuchen, die verbreiteten Intuitionen in eine inhaltlich stimmige Einheit zu bringen. Tatsächlich gibt es kaum Fundamentalisten und Kohärentisten in Reinform, auch wenn Singers Interessenethik einem „reinen“ fundamentalistischen Argumentieren schon sehr nahe kommt. Ein nicht nur akademisch-diskursiver, sondern vor allem sozialer Beratungsbedarf durch „ethische Theorien“ besteht seit einigen Jahrzehnten in den westlichen Gesellschaften schon deshalb, weil sich der Eindruck erhärtet hat, weniger dass die traditionelle, säkular-christliche Moral in sich widersprüchlich ist, als dass sie den aktuellen Anforderungen nicht mehr gewachsen scheint. Nur Kohärentist zu sein ist deshalb angesichts der veränderten Lebensumstände keine mögliche Option mehr, die herkömmliche Moral muss in vieler Hinsicht neu formuliert werden, und das wird kaum ohne eine „ethische Theorie“ gelingen. Rein abstrakt betrachtet, eröffnet sich damit eine unbegrenzte Vielfalt von Möglichkeiten des Kombinierens von zu „rettenden“ moralischen Intuitionen und ethischen Prinzipien, und die Polyvalenz des akademischen und außerakademischen „ethischen Diskurses“ scheint die Ratlosigkeit angesichts einer solchen Vielfalt zu bestätigen. Wie auch die kaum weiter reduzierbare Zahl von etwa fünf sogenannten „Standardtheorien“ der philosophischen und theologischen Literatur zu belegen scheint, herrscht Uneinigkeit darüber, welche normativen Prinzipien „fundamental“ bzw. welche der in ihnen kristallisierten Intuitionen vorrangig zu berücksichtigen sind. In dieser Situation bleibt den einzelnen Ethikern nur die Hoffnung, mithilfe eines möglichst umfassenden Argumentariums die konkurrierenden Kollegen einfach kraft Umfang und Vollständigkeit zu widerlegen – eine Strategie, die gleichermaßen anspruchs- wie voraussetzungsvoll ist. Die meisten, notgedrungen themenbegrenzt argumentierenden Ethiker finden sich deshalb mit dem Problem normativer Parteilichkeit konfrontiert, das sie mit dem gängigen Verständnis der philosophischen Ethik kaum lösen können. Im akademischen Diskurs ist ein „theoretischer Pluralismus“ willkommener Anlass für immer weitere heftige Dispute, in der Alltagspraxis entkräftet er hingegen die Autorität der Ethik. Meines Erachtens wird der Pluralismus durch die Annahme erzeugt, dass allein Prinzipien und Intuitionen den Kern des ethischen Diskurses bilden 6 Anton Leist (verbunden mit, in der Regel weniger riskantem, empirischem Wissen). Weicht man von dieser ungewöhnlich engen, wenn auch typisch philosophisch-kognitivistischen Ausgangsbasis ab, dann liegt viel näher, dass eine „ethische Theorie“ mindestens auch eine Sozialtheorie zu sein hat – einfach deshalb, weil ihr Gegenstand Moral nur stark-idealisierend in Form von Prinzipien und Intuitionen zu identifizieren ist und realistischer als eine Form des sozialen Handelns, der sozialen Beziehungen und Interaktionen, ja gar der sozialen Institutionen in Form einer „Basisstruktur“ (Rawls) gesehen werden sollte. In der wirklichen Welt ist die Moral Bestandteil einer speziellen Form des sozialen Tuns und Unterlassens, weshalb diese realsoziale Dimension der Moral einzufangen keine sachfremde Erwartung an eine „ethische Theorie“ sein kann. Für einen Ethiker, der nur ein wenig auch Soziologe ist, reduziert sich die Komplexität des ethischen Diskurses – vielleicht überraschend – auf nahezu eine einzige moralphilosophische Tradition, nämlich diejenige des Kontraktualismus, der die Moral als ein vertragsähnliches, interaktives Sozialgeschehen begreift. Aus verschiedenen, später noch zu schildernden Gründen gilt der Kontraktualismus allerdings als eine Art „Ersatzethik“, der gegenüber die „echte“ Ethik und Moral zu retten sind.5 Ein solches Urteil erklärt einzig den kognitiven Gehalt zur Quelle von Normativität und überspitzt die im Prinzip wichtige Differenz zwischen dem kognitivem Gehalt der Moral und den psychologischen Motiven für das reale soziale Handeln. Meines Erachtens bringen sich die kognitiven Ethiker damit in eine methodische Lage, aus deren Parteilichkeit sie sich nicht mehr zu befreien vermögen. Aufgrund ihres einseitig kognitiven Moralmodells sind insbesondere die meisten angewandten Ethiker nur Repräsentanten einer Teilmoral, die sie Andersdenkenden gegenüber nicht verteidigen können. Im folgenden will ich diese Diagnose des „realsozialen Defizits“ der theoretischen und angewandten Ethik anhand eines skizzenhaften Durchgangs durch die sich in Anschluss an die Singer-Affäre entwickelnde angewandte Ethik sowohl illustrieren wie belegen. Die Interessentheorie bzw. der Handlungsutilitarismus sind ihrer Einfachheit wegen die besten Ausgangspunkte für jeden ethischen Diskurs, der angesichts veränderter 5 Diese Vorstellung beginnt in der neueren Literatur vor allem mit Mackie 1974, aus Mackies Sicht durchaus, weil antiideologisch, positiv. Als ein Verlustgeschehen stellt es sich dann bei Tugendhat 1993 dar. 7 Anton Leist Lebensumstände die traditionelle Moral zu reformieren versucht. 6 An den Schwierigkeiten und Grenzen einer sich von hier aus entwickelnden ethischen Theorie lassen sich deshalb die Grenzen jeder kognitiven ethischen Theorie entdecken. 3. Wie sich ethische Theorie durch Bioethik auflöst Die Interessentheorie ist deshalb ein höchst plausibler Ausgangspunkt für eine kritische Haltung gegenüber der Moral, weil schwer daran zu zweifeln ist, dass der Schutz von Interessen zu den vorrangigen Funktionen der Moral gehört. Allerdings überwiegt in diesem Gedanken der Funktion des Schutzes eben der Schutz, und es ist nicht unerheblich, wie man das Objekt des Schutzes begrifflich fasst: ob als Interesse, Präferenz, Lust, Wohl oder allgemein Leben. Was häufig als „Scharfsinn“ der angewandten Ethik empfunden wird, wie sie Peter Singer und andere aus der sprachanalytischen Tradition stammende Ethiker (im Kontrast zu einem geisteswissenschaftlichen Philosophen wie Jonas) entwickelt haben, entspringt meist Kohärenzüberlegungen mittels geeigneter Beispiele, mit denen auch die begrifflichen Entscheidungen begründet werden sollen. Wenn Töten moralisch unerheblich ist, weil das Lebewesen kein Überlebensinteresse hat, dann spielt eine zentrale Rolle, ob „Überlebensinteresse“ der einzig treffende Begriff ist und was er bedeutet. Singers Ethik ist zunächst fundamentalistisch in dem Sinn, dass sie im Konflikt zwischen dem Interessenprinzip und der verbreiteten moralischen Intuition (wonach Neugeborene keinesfalls getötet werden sollten) unbeirrt auf das Prinzip setzt. Sie ist aber außerdem „begriffsfundamentalistisch“ darin, dass sie kein Problem damit sieht, der begrifflichen Entscheidung die vollständige Beweislast aufzuerlegen. Ohne den Hintergrund der sprachanalytischen Diskussionskultur wäre ein solches Vertrauen auf einzigartig treffende Beschreibungen des Wohls von Lebewesen vermutlich überhaupt nicht denkbar – ein Ver- 6 Ob Interessentheorie und Utilitarismus völlig deckungsgleich sind, ist umstritten. Meines Erachtens folgt das Maximierungsprinzip (also der Handlungsutilitarismus) aus ersterer, aber dieser Punkt kann hier auf sich beruhen bleiben. 8 Anton Leist trauen, das eine ganze Gruppe von „analytischen“ Ethikern ausgezeichnet hat und teilweise immer noch auszeichnet.7 Entsprechend diesen zwei Stufen des Fundamentalismus eröffnen sich zwei Ebenen eines alternativen Bewertens: erstens diejenige, nicht allein auf ein Prinzip zu setzen, sondern es durch beachtenswerte Intuitionen zu ergänzen und zu korrigieren; und zweitens diejenige alternativer oder sogar pluralistischer Beschreibungen des Gegenstands der Moral. Worin liegt der Unterschied? Im ersten Fall wird das Begriffsgerüst der Theorie, hier der Interessentheorie oder des Utilitarismus, beibehalten, aber durch konträre Intuitionen ergänzt oder korrigiert. Im zweiten Fall wird das Begriffsgerüst der Theorie verlassen und es werden eine oder mehrere andere begriffliche Perspektiven ins Spiel gebracht. Ersteres könnte man den „schwachen Fundamentalismus“, letzteres einen „ethischen Pluralismus“ – hier einen Pluralismus im Grenzbereich der Moral – nennen. Ein ausgesprochen umsichtiger und erfindungsreicher schwacher Fundamentalist ist Dieter Birnbacher. Birnbacher teilt mit Singer eine subjektive (allerdings nicht in Präferenzen gefasste) Werttheorie und er hält den Utilitarismus für die angemessenste Theorie der angewandten Ethik. Andererseits weicht er in vielen ethischen Fragen von Singers Urteilen ab. So sieht er bei der Früheuthanasie eine erhebliche Dammbruchgefahr sowie indirekte Auswirkungen der Diskriminierung von Behinderten. 8 Töten und Sterbenlassen konsequentialistisch gleichzusetzen, wird ihm zufolge verbreiteten Reaktionen nicht gerecht (2006, S. 187f). Passive Sterbehilfe sei häufig der aktiven vorzuziehen, und grundsätzlich komme „pragmatischen Gründen“ die vorrangige Rolle zu (1995, S. 371f). „Menschenwürde“ ist für Birnbacher nicht schlicht ein „metaphysischer“ und damit zu verwerfender, sondern ein in seinem Alltagsgebrauch differenziert zu rekonstruierender und teilweise „sentimentalistisch“ zu begründender Begriff. In seiner Anwendung auf ungeborenes menschliches Leben drückt „Würde“ die Achtensgefühle Dritter aus sowie eine „Gattungssolidarität“ (2004, S. 267f). Handlungs 7 Zu dieser Gruppe gehörten neben Singer vor allem Joel Feinberg, John Harris, Michael Tooley, Richard Hare, Jonathan Glover, Jeff McMahan, im deutschen Sprachraum neben Hoerster auch Tugendhat und Birnbacher. Ich selbst habe begriffsfundamentalistisch argumentiert in Leist 1990. Meines Wissens ist die stillschweigend anti-quineanische, apriorisch-sprachanalytische Prämisse dieser Philosophen nie explizit begründet oder in Frage gestellt worden. 8 Birnbacher 2006, S. 178-192. 9 Anton Leist und Unterlassenspflichten gleichzusetzen ist für „reale Menschen“ nicht „lebbar“ (1995, 130), unterlassene Hungerhilfe wie Singer mit aktivem Töten gleichzusetzen, ist deshalb Unsinn. Wie diese Beispiele verdeutlichen, ergänzt Birnbacher das Interessenprinzip mit der Rücksichtnahme auf die durchschnittlichen Gefühle und Motive relevanter Personen, gestützt auf teils nachprüfbare, teils vermutete Reaktionen und Folgen. Dadurch ergibt sich ein sozial kontextualisierter, die konkreten bioethischen Praktiken wesentlich sozialnäher nachzeichnender Utilitarismus, den Birnbacher „indirekten“ und „sentimentalen“ Utilitarismus nennt (2006, S. 49). Sowohl die Sekundärfolgen regelmäßigen Befolgens moralischen Urteilens sollen berücksichtigt werden – etwa die unüberschaubaren Folgen der erlaubten Kindstötung – wie unausweichlich menschliche Gefühle beachtet, sind sie verbreitet und typisch genug.9 Über diesem beachtlichen Bemühen um soziale Ausgewogenheit sollte nicht übersehen werden, dass Birnbacher dennoch ein ethischer Fundamentalist ist. Er plädiert für eine subjektive Werttheorie, nach der die normative Grundlage einer rationalen Moral einzig in dem zu maximierenden angenehmen Erleben liegt. Zwar schwächt er auch in diesem Punkt den Begründungsanspruch ab, indem er den indirektsentimentalen Utilitarismus als nur für „plausibel“, nicht „zwingend“ erklärt, hält diese Plausibilität aber für eingebettet in einen zwingenden, weil unparteilich-universalen „Begriff“ der Moral (2006, S. 45-51). Birnbacher ist also ein klarer Begriffs- und ein schwächerer Wertfundamentalist. Entsprechend teilt er mit Singer eine grundsätzlich verwandte Werttheorie, die ihn bei der Frage des Tötens von Tieren und im Bereich der Ökologie zu weitgehend analogen Ergebnissen führt und die sein sekundäres, auf Risiken und Gefühle abstützendes Argumentieren mit erheblichen Beweislasten versieht. Mein Vorbehalt gegen die kognitiv verkürzte „ethische Theorie“ war, dass sie voraussichtlich zur normativen Parteilichkeit führt. Anders ausgedrückt, dass sie ihre Urteile Andersdenkenden gegenüber nicht zwingend machen kann. Wie eben gesehen, scheint Birnbacher tendenziell bereit, dieses Defizit einzuräumen. Bleibt dann aber noch ein normativer 9 Der Bioethiker Andreas Kuhlmann hat Birnbachers Schriften aus Gründen dieser sozialen Nähe und Umsicht heraus besonders hochgeschätzt. S. sein Vorwort in Birnbacher 2006 sowie Kuhlmann 2001 und 2011. 10 Anton Leist Anspruch in der Behauptung, ein moralisches Urteil sei „plausibel“? Die Nebenfolgen und Gefühle zu beachten, statt sie wie Singer bewusst zu ignorieren und reformieren zu wollen, ist nur in dem Sinn „plausibler“, dass die Urteile „alltäglicher“ und damit sozial akzeptabler werden. Hält man (wie ich) die Idee eines „Begriffs“ der Moral für sprachanalytische Metaphysik, dann spricht nichts dagegen, die induktive oder (in Birnbachers Terminologie) „rekonstruktive“ Methode (etwa des 4Prinzipien-Ansatzes) (2006, S. 35-44) für noch plausibler zu halten als die utilitaristische, so dass mindestens drei alternative Methoden zur Wahl stünden. Ob man wie Singer als radikaler moralischer Reformer auftreten will oder wie Birnbacher als moralischer Moderator, wäre dann nicht theoretisch zu entscheiden – sondern ergäbe sich aus der sozialen Rolle, die man als Ethiker in der Gesellschaft einnehmen will. Abgesehen von diesem generellen, möglicherweise von anderen „Theorien“ zu teilenden Los, steckt ein gehöriges Maß an Beliebigkeit und Subjektivität, ja teilweise Widersprüchlichkeit, in den „indirekten Gründen“, auf die Birnbacher seine gemäßigteren Folgerungen stützt. Gilt wirklich, dass gegenüber menschlichen Embryonen Gattungssolidarität empfunden wird (2004, S. 268)? Warum ist eigentlich die Abneigung angesichts eines Cyborgs oder eines klonierten Menschen vernachlässigbar (2006, S. 77-82), die Abneigung gegen den instrumentellen Umgang mit Embryonen oder Leichnamen nicht (2004, S. 267)? Wenn die emotionale Reaktion auf den Cyborg kritisierbar ist, welchen Sinn kann dann noch „Gattungswürde“ der speziesistischen „Reinheit“ (2004, S. 268) haben? Wann sind solche Gefühle „tief liegende Gefühle“ (S. 267) und wann nicht? Und wie rational und stabil ist die unterschiedliche emotionale Wahrnehmung von Tun und Unterlassen? Wenn die „rationale Abklärung“ der Gefühle als nötig eingeräumt wird, warum führt sie am Ende nicht doch zur direkten Interessenanalyse, wie Singer sie vertritt? Alle diese Fragen deuten darauf hin, dass hinter der Differenz zwischen dem direkten und dem indirekten Utilitarismus nur die nicht selbst begründbare Entscheidung für den reformatorischen, gemäßigten Berufsauftrag als Ethiker steht. Dann aber bleibt die angewandte Ethik bereits im Ansatz moralisch parteiisch. 11 Anton Leist 4. Gutes Leben statt Lebensinteresse Der von Singer und Birnbacher geteilte Begriffsfundamentalismus unterstellt, die Welt sei begrifflich soweit klar geordnet, dass sich Gründe mit erheblicher moralischer Tragweite auf diese Ordnung stützen können. Im Bereich des Tötungsverbots gilt das für die Annahme, dass „Interessen“ und „Bewusstsein“ die einzigen oder mindestens vorrangigen Begriffe sind, anhand derer sich die Schädigungsfähigkeit von Lebewesen manifestiert. Das einschlägige Argument lautet ja, dass ein Lebewesen durch das Ende seines Lebens keinen Schaden erleide, wenn es kein Bewusstsein seiner Zukunft bzw. kein Überlebensinteresse hat. Den meisten Tieren und allen menschlichen Neugeborenen fehlen diese Eigenschaften, woraus die moralische Neutralität ihres Tötens folgt – beurteilt direkt in Bezug auf sie. Neben der Annahme, dass einzig die Handlungsfolgen über die moralische Qualität entscheiden, ist die Exklusivität der subjektiven Interessenbewertung verantwortlich für dieses Ergebnis. Doch wie ist diese Exklusivitätsannahme selbst begründet? Wenn wir an ein Neugeborenes und an die Frage denken, ob das Faktum seiner Existenz „gut“ ist, dann denken wir keineswegs an sein subjektives Lebensinteresse. Vielmehr beurteilen wir spontan den „objektiven Wert“ des Lebens dieses Neugeborenen. Die Welt ist „reicher“, wenn es dieses Neugeborene gibt als wenn nicht. Birnbacher stimmt dieser Intuition explizit zu, findet in ihr aber die Individualität des jeweiligen Lebens unberücksichtigt, weshalb nicht die hinreichende Schädigungsqualität erreicht würde, die für das Tötungsverbot nötig wäre (2006, S. 240f). Freilich: mit einiger Phantasie lässt sich das Neugeborene (und bereits sein Embryo und Fötus) auch als frühes Subjekt des Lebens eines sich entwickelnden individuellen Menschen ansehen, und das Gute seiner aktuellen Existenz als Teil des Guten seines gesamten Lebens. Meines Erachtens liegt diese Perspektive des gesamten Lebensguts eines Menschen der spontanen Reaktion der Freude über ein Neugeborenes (um seiner selbst willen) zugrunde. Diese Sicht ist durchaus eine „vorausgesetzte-Existenz-Sicht“ des bereits lebenden Wesens, so dass sie mit der Folgerung der überzubevölkernden Erde nicht konterkariert werden kann. Wenn diese Lebensgut-Sicht ebenso plausibel ist, dann konkurriert mit dem Interessen- und Bewusstseinsbegriff derjenige des Lebensguts, und mit welchen Gründen dieser Begriff 12 Anton Leist vernachlässigbar oder durch den des Überlebensinteresses übertrumpfbar wäre, bleibt unklar.10 Die Interessenargumentation verschafft sich ihren analytischen Respekt durch ihre präzise ethische Diagnose zu den verschiedenen Handlungsoptionen. Doch dieser Respekt ist nur so berechtigt, wie eine alternative Bewertung des menschlichen Lebens unberechtigt ist – und als solche erwiesen werden kann. Letzteres ist aber offensichtlich nicht der Fall, die Lebensgut-Sicht wird einfach ignoriert. Mit ihr will ich übrigens nicht behaupten, dass sein Leben für das Neugeborene denselben Wert hat wie für das zehnjährige Kind oder für den jungen oder alten Erwachsenen, der dieses Leben lebt. Vielleicht hat das Leben des Neugeborenen aufgrund seines noch fehlenden subjektiven Bewusstseins weniger Wert. Ausreichend für eine vorsichtigere ethische Diagnose ist bereits, dass sich über den Grad an „Wert“ beim Neugeborenen im Vergleich zum sich entwickelnden Kind und Erwachsenen nichts Präzises sagen lässt – eine quantifizierende oder auch nur vergleichende Wertdiagnose scheint unmöglich. Deshalb führen Interessenethiker sich und andere in die Irre, wenn sie die exklusive Zuständigkeit der Interessenkategorie unterstellen. Die moralische Qualität des Tötens von frühem menschlichem Leben ist nicht so präzise zu verorten, wie sie nahelegen. Eine ähnliche Kritik gilt für die ethische Analyse des Tötens von Tieren. Für die unzähligen, täglich geschlachteten Tiere wird von Singer und Birnbacher angenommen, dass ihr Töten, wenn schmerzlos, aufgrund fehlenden Überlebensinteresses moralisch akzeptabel sei (Birnbacher 2006, S. 243). Nun lässt sich bereits pauschal vermuten, dass die Tierproduktion unter kapitalistischen Konkurrenzzwängen nicht in der Lage ist, den Nutztieren zu einem auch nur einigermaßen leidfreiem Leben zu verhelfen, so dass auch der Interessen-Tierethiker dennoch gegen den Konsum von Tierprodukten votieren muss. Allerdings behindert er eine klare Stellungnahme dadurch, dass er den psychologischen Zirkel zwischen dem in seinem Ende und dem in seinem „Lebensalltag“ missachtetem tierischem Leben nicht aufzubrechen vermag. Die meisten Tierproduzenten sind nicht in der Lage, ein Tier 10 So habe ich auch bereits argumentiert in Leist 2005, Kap. 4. Vgl. nicht unähnlich, nur umständlicher und mit Assoziationen an das „Potentialitätsargument“: Marquis 2009. 13 Anton Leist artgemäß zu behandeln, das zu töten sie sich im Recht sehen. Weil die Interessenethiker das Töten als moralisch akzeptabel einräumen (und einräumen müssen), bleibt meines Erachtens ihr Einfluss auf den Tierschutz entsprechend begrenzt. Singer hat durch sein frühes Buch Animal Liberation (1975) fraglos zur Sensibilisierung unseres Umgangs mit Tieren beigetragen. Die Freiheit zu töten aber unterläuft diese Wirkung. Tiere, die moralisch gesehen getötet werden dürfen, dürfen auch zu menschlichen Zwecken instrumentalisiert werden; und Tiere, die von Menschen genutzt werden dürfen, werden unter durchschnittlichen Menschen – wie Menschen nun einmal sind – leiden müssen. Es gibt kein gutes Tierleben unter falschen Bedingungen, eben der Bedingung des Getötetwerdens. Rationalistische Philosophen wie die Vertreter des Interessenarguments können sich zwar im Rahmen ihrer Begriffe vehement gegen das Leid von Tieren wenden, und sie tun das auch. Aber sie müssen die Klarheit ihrer Argumentation für relevanter halten als die psychologische Abwertungstendenz der Tiere, zu der sie mit ihrer Klarheit beitragen. Im Konflikt zwischen ihrer begrifflichen Klarheit und dem Tierschutz sind sie vorrangig Philosophen und erst sekundär Tierschützer. Diese Philosophen tragen, zugespitzt ausgedrückt, dazu bei, dass den Tieren mehr Leid geschieht, als nötig wäre.11 Im Fazit scheint mir deshalb naheliegend, dass die angewandte Ethik zum Tierschutz kaum mehr etwas beitragen kann, wenn sie dem landläufigen Töten von Nutztieren nichts entgegenzusetzen hat. Die Sensibilität vieler Fleischkonsumenten und -produzenten im Umgang mit den Tieren hat sich in den westlichen Ländern während der letzten Jahre zweifellos gesteigert. Gegenwärtig aber scheinen die Möglichkeiten des ethischen Tierschutzes an eine Grenze gelangt zu sein. Die professionelle 11 Der vorangehend unterstellte psychologische Zusammenhang kann auch bezweifelt werden und muss deshalb mit empirischen Belegen untermauert werden. Anregend finde ich den Kontrast zwischen dem instrumentellen und dem ehrvollen Umgang mit Tieren, wie ihn etwa der Film „Facing Animals“ des Holländers Jan van IJken belegt (s. http://freefromharm.org/). „Lieblingstiere“ werden nicht getötet, der sorgende Umgang mit ihnen und die Tötungshemmung gehen Hand in Hand. Von daher liegt nahe, dass für die Mehrzahl von Menschen auch das Umgekehrte gilt: Akzeptierte Tötung zieht akzeptiertes Leiden nach sich. Aber zugegeben: der eben geäußerte Vorwurf gegenüber den Interessenethikern bedarf einer umfangreicheren Empirie. 14 Anton Leist Abschirmung des Leids, das Tieren in der Fleischproduktion zugefügt wird, der allgemeine Freibrief, Tiere zu nutzen, die weitgehende Freiheit im Abwägen zwischen menschlichen und tierischen Interessen bei Höherrangigkeit der menschlichen – das alles sind Rahmenbedingungen, unter denen eine wesentliche Verbesserung des gegenwärtigen Loses der Tiere kaum mehr möglich scheint. Meines Erachtens würde nur der Appell an das ganze „artgerechte“ Leben eines Tiers nicht nur das frühzeitige Töten von Schweinen, Kälbern und Hühnern in zweifelhaftem Licht erscheinen lassen, sondern auch die Interessenabwägung zugunsten der menschlichen Interessen erheblich erschweren. Ohne einen Sinn dafür zu entwickeln, wie das Ganze eines Lebens beschaffen ist, bleibt das Tier ein verwertbarer Gegenstand, und zu dieser Rechenmentalität sollte die angewandte Ethik nicht – wie über den Interessenbegriff – beitragen, sondern sie sollte sie verhindern! 5. Von der Naturethik zur Umweltgerechtigkeit Zeitgleich mit den diversen technischen Revolutionen in der Medizin stellte sich in den 1970er und 1980er Jahren ein erstes, sich eruptiv verbreitendes Bewusstsein von den ökologischen Grenzen des Naturverbrauchs ein. In Deutschland wurde 1980 die Bundespartei der Grünen gegründet und ihre Vertreter schafften es 1983 in den Bundestag. Wie manche in dieser ersten Generation ökologiebewusster Politiker waren etwa um dieselbe Zeit auch die ökologischen Ethiker der ersten Generation häufig Wertfundamentalisten. Arne Naess (1989) und Holmes Rolston (1988) waren beispielsweise „Tiefenökologen“ der Art, dass sie in der Natur, in einzelnen Lebewesen, Arten und Biotopen einen ethischen Wert zu erkennen versuchten. Eine solche „Öko-“ oder „Physiozentrik“ würde im Unterschied zur „anthropozentrischen“ Ethik die Wertgewichte so weit verschieben, dass nicht nur kurz- oder längerfristige Nutzeneinbußen gegen das industrielle Zerstören der Umwelt stünden, sondern auch moralische Gründe. Aus menschlicher Sicht „unnütze“ Natur, wie viele Spezies oder unbevölkerte Landschaften, könnten dann gegen den Bau von Staudämmen oder Abräumanlagen mit Gründen geschützt werden.12 An solchen Beispielen kristallisierte sich 12 Für ein Beispiel der ersteren Art kann man an den „Snail Darter“, eine vom Aussterben bedrohte Fischart, denken, die den Bau des Tellico Staudamms in 15 Anton Leist für einflussreiche Ökoethiker der ersten Generation die Überzeugung, dass eine zeitgemäß reformierte Moral eine Moral auch der Natur, die umgeschriebene Ethik eine „Naturethik“ sein müsste.13 Wie schwer es aufgeklärten Moralphilosophen jedoch fällt, einer solchen Erwartung zu entsprechen, lässt sich wiederum beispielhaft an der Interessenethik bzw. am Utilitarismus zeigen. Die moderne Ethik ist mit der philosophischen Aufklärung an der Einsicht orientiert, dass menschliche Interessen (Hume, Bentham, Mill) oder menschliche Vernunft (Kant) die Grundpfeiler der Moral sind, wobei die empfindungsfähige Natur teils einbezogen (Utilitarismus), teils aber auch als vernunftund damit wertlos gezähmt und kontrolliert werden soll (Kant). Unter diesen Modernen offeriert die Perspektive der Interessen also noch die günstigste Basis für eine Naturethik, die aber auch dort ihre Grenze hat, wo die „natürliche Natur“, also Spezies, Biotope, Landschaften, Wasser, Kristalle, nicht selbst empfindungsfähig ist. Wird die Grenze der Moral anhand von Empfindungsfähigkeit gezogen, kann das Aussterben einer Art kein moralisch relevantes Phänomen sein, die Forderung nach „ökozentrischen Werten“ scheint auf einem Missverständnis zu beruhen, weil „Wert“ (als Objekt von moralischer Relevanz) an Empfindungsfähigkeit und damit an eine genuin menschliche Eigenschaft geknüpft ist – selbst in ihrem Vorkommen bei den Tieren. Über die empfindungsfähigen, auch wildlebenden Tiere hinaus kann es deshalb eine moderne „Naturethik“ nicht geben. Singer hat diese Grenze in seinen Publikationen stillschweigend anerkannt, indem er sich neben den bereits erwähnten mensch- und tierzentrierten Themen außer dem Problem des Klimawandels keines ökologischen Themas angenommen hat, das zu einem Wandel der Wertbasis herausforderte.14 Man darf Singer sicher unterstellen, dass er das Interessenargument nicht aufzugeben bereit ist und also die menschlichen Interessen als einzigen Maßstab auch für den Schutz der Natur anerkennt. Bei – aus heutiger Sicht noch harmlosen – Umweltproblemen wie Wald Tennessee verhinderte (s. Plater 2008). Für letzteres Beispiel an den geplanten „Harris Supersteinbruch“ in Schottland, der auch durch ökologische Argumente verhindert wurde (s. Barton 1996). 13 S. die Überblicke und Sammlungen von Angelika Krebs, in Krebs 1999 und Krebs (Hg.) 1997. 14 Zum Klimawandel schlägt er ein Menschenrecht auf gleiche Emissionen vor: s. Singer 2002, Kap. 2. Für Gründe gegen diesen Vorschlag s. Leist 2011a. 16 Anton Leist sterben/Katalysator oder Ozonloch/FCKW-freie Kühlschränke mag der Naturschutz auf dieser Basis noch unstrittig aus menschlichen Interessen ermittelt werden können. Aber in welchem Interesse das Erhalten des Snail-Darters gewesen sein soll, ist unerfindlich, während die Vorteile eines Staudamms für die Energiegewinnung auf der Hand liegen. Manche „pragmatistischen“ Umweltethiker wie Bryan Norton (2005) sind der Meinung, dass es der Verteidigung einer „intrinsischen“ Werthaftigkeit der Natur gar nicht bedarf, weil die gegenwärtigen zivilisatorischen Eingriffe in die Natur allein aufgrund ihrer langfristigen Rückwirkung auf die menschlichen Interessen ebenso kritisiert werden können wie unter ökozentrischen Prämissen. Doch eine solche Vermutung irrt in Hinblick auf das reale Ausmaß der Konflikte. Anhand des häufig zitierten Arguments, bestimmte aussterbende Spezies „könnten“ sich in der Zukunft als für Menschen nützlich erweisen, zeigt sich schnell, wie spekulativ eine vermutete Konvergenz der Positionen tatsächlich ist. Die biologischen Unterschiede zwischen vielen Spezies sind minimal, dem möglichen Nutzen steht auch ein möglicher Schaden gegenüber, der mögliche Nutzen ist heute völlig unvorhersehbar, usw. Überdies belegen nicht nur die menschliche Ressourcengewinnung, sondern auch der verbrauchende „Genuss“ der natürlichen Umwelt durch Freizeitsport, Zersiedelung, Verbrauch von Tiefenwasser, internationaler Fischvorräte, Folgen von Straßen- und Flugverkehr, Nebeneffekte von Windkrafträdern, nicht zu sprechen vom Großproblem Klimawandel, dass die menschlichen Interessen mit dem Konservieren der „natürlichen Natur“ keineswegs konvergieren. Die den Menschen umgebende Natur wird seit Jahrtausenden den menschlichen Zwecken unterworfen und seinen Bedürfnissen angepasst, und das geschieht bisher im Bewusstsein völliger Berechtigung. Bestenfalls begrenzt und unter speziellen menschlichen Wertprämissen, wie etwa dem Bewahren einer Kulturlandschaft als „Heimat“, könnten deshalb starke Konservierungsgründe dem weiteren Umarbeiten der Natur zu einer künstlichen Natur im Weg stehen.15 Auch dann aber handelt es sich um keinen generellen und kategorischen Schutz, denn der Interessen 15 S. dazu das „Heimatargument“ in Krebs 1999, S. 55f sowie Krebs im vorliegenden Band. Krebs schließt sich auch dem Plädoyer des wertkonservativen Philosophen Roger Scruton an: Scruton 2012. 17 Anton Leist konflikt zwischen materiellem Wohlstand und zu bewahrender Heimat, und Heimat generell, kann je nach den Umständen verschieden ausfallen. Wiederum hat Dieter Birnbacher die begrifflichen Möglichkeiten des Interessenarguments für die ökologische Ethik vielleicht am weitestgehend ermittelt. Zwar steht er auch dann einer Naturideologie kritisch gegenüber, wenn sie insgesamt vorteilhafte Folgen hätte („funktionale Argumente“: 2006, Kap. 5), aber er tendiert zu der Ansicht, dass der Eigenwert der Natur durch „inhärente Werte“ imitiert werden könne, in denen die instrumentelle Werthaltung jeweils an ein Ende gelangt (2006, S. 112-6). Anstatt dem Wald einen „intrinsischen“ Wert zuzubilligen, sollte der subjektive Werttheoretiker dem Wald einen Selbstwert im Rahmen einer geeigneten Nutzung des Walds, etwa des ästhetischen Wohlgefallens beim Spaziergang, zuschreiben.16 Meines Erachtens bewirkt diese Terminologie eher Verwirrung, denn die Rede von inhärenten Werten ändert nichts am zugrundeliegenden, wenn auch weit gefassten, instrumentellen menschlichen Verhältnis zur Natur, in diesem Fall eben dem Zweck der Natur zur ästhetischen Erfahrung. Während die Natur, hätte sie einen intrinsischen Wert, ihre Nutzer irgendwann dazu zwingen könnte, sie angemessen zu beachten, bleibt der inhärente Wert von den subjektiven Interessen abhängig – Nutzer, denen die Ästhetik der Natur fremd ist, verhalten sich wie Nutzer, denen die Ästhetik der Musik fremd ist. In einer liberalen Gesellschaft, die sich zugute hält, zwischen individuellen Lebensstilen und strengen moralischen Normen zu unterscheiden, lässt sich deshalb mit ästhetisch-ökologischen Gründen gegen materiellen Wohlstand nur schwach opponieren, wenn im letzteren auch Armut im Spiel ist. Unklar ist aber bereits, was der Ethiker einer Mehrheit von Bürgern entgegenzusetzen hat, die beliebig höheren Wohlstand dem Naturgenuss vorziehen.17 Das Problem des Gewichtens der ästhetischen, oder wie Ott umfassender sagt (Ott 2009, S. 83), der „kulturellen“ Naturinteressen (Schönheit, Heimat, Erholung, Faszination, Spiritualität), lässt beispielhaft die vollständige Überforderung und damit normative Untauglichkeit der Interessenethik, und stellvertretend auch der kognitiven Ethik, für öko 16 Ähnlich Krebs (Hg.) 1997, S. 371. Worauf ein Ethiker wie Konrad Ott die These „starker“ (substitutionsresistenter) im Unterschied zu „schwacher“ (substitutionsfähiger) Nachhaltigkeit stützen will, bleibt deshalb unklar: s. einschlägig Ott 2009. 17 18 Anton Leist logische Probleme erkennen. Die Interessenethik konnte bei den im Rahmen der säkular-christlichen Ethik anstehenden bioethischen Grundsatzkonflikten der 1970er und 1980er Jahre eine große Relevanz entfalten, weil sie mit dem Interessenbegriff ein methodisch attraktives Instrument für Entscheidungen über die Grenzfragen der Moral anzubieten vermochte. Obwohl einseitig und nicht zwingend vertreten, entfaltete dieser einfache Gedanke eine ungewöhnliche soziale Wirkung – eben angesichts von Zuständigkeitsproblemen an der Grenze des moralisch Relevanten. Wie von Mills Utilitarismus bereits hinlänglich bekannt, sind jedoch gerechte Verteilungen durch das Nutzenprinzip kaum oder nur vage zu begründen. 18 Geht es beim Argumentieren mit Interessen um das Summieren, Vergleichen und Gewichten von Interessen, wie das bei Gerechtigkeit nötig ist, ist die utilitaristische Grundidee untauglich und verführt bekanntlich zum Missachten von Rechten. Die Diagnose ist vielleicht nicht allzu gewagt, dass es nach 40 Jahren umfangreichen Ethikdisputs nicht mehr vordringlich darum geht, eine religiöse oder metaphysische Moral absoluter Ver- und Gebote zu korrigieren, sondern eher darum, Konflikte zwischen als solchen moralisch legitimen menschlichen Interessen zu entscheiden. Die ethisch brisanten Themen sind inzwischen von den Grenzen der Moral in ihre Mitte, nämlich in die Mitte verschärfter Gerechtigkeitskonflikte eingewandert, wo sie mit dem einfachen Interessenprinzip nicht beantwortet werden können. Illustrieren lässt sich das am Konflikt zwischen der Schönheit einer Landschaft und den Kosten ihres ökonomischen Nichtnutzens. Dazu müssten die beteiligten Interessen in einen Wertvergleich gebracht werden. Wie sollen diese Interessen ideal, also mit „ethischen Gründen“, verglichen werden? Angenommen sogar, das ginge, so stellen sich konkrete ökologisch-ökonomische Konflikte immer innerhalb selbst bereits normativ geregelter gesellschaftlicher Kontexte. Die höheren Transportkosten beispielsweise, die durch das Vermeiden von Küstenstreifen durch Frachtschiffe entstehen, schlagen sich in höheren Güterkosten nieder. Je nachdem, um welche Güter es sich handelt, werden bereits bestehende ungleiche Wohlfahrtsverteilungen verschärft. Sollen 18 S. Mill 1871, Kap. 5. Vielleicht ist es nicht unnötig zu erinnern, dass Rawls (1971) seine bis heute maßgebliche Gerechtigkeitstheorie in scharfer Abgrenzung zum Utilitarismus entwickelt hat. 19 Anton Leist diese betroffenen Interessen alle mit einbezogen werden? Wie soll geprüft werden, ob sie berechtigt oder unberechtigt sind? Wann handelt es sich bei den betroffenen Interessen um elementare oder um luxuriöse? Sollte nicht überhaupt der Gewinn durch niedrigere Transportkosten in die elementaren Interessen der Bewohner fremder Länder fließen? Ist die Zahl der beteiligten Interessen irgendwie abzugrenzen? Das Interessenprinzip versagt angesichts dieser Fülle von Fragen. Die Interessenethik war die naheliegendste Antwort auf die säkularchristliche Moral in der Phase nach dem II. Weltkrieg, ja wurde von dieser geradezu herausgefordert. Weder Jonas’ Schöpfungsverantwortung, noch die parallel entwickelte Diskursethik waren in der Lage, der Bioethik ein zeitgemäßes inhaltliches Profil zu geben – ebenso wenig wie andere Erben von Kants Ethik das vermochten.19 Aufgrund ihres ebenfalls kognitiven Charakters ist eben auch die Interessenethik für die Probleme in der „Mitte der Moral“ untauglich. „Kognitiv“ ist eine Ethik, zur Erinnerung, wenn sie sich nur aus abstrakten normativen Elementen wie Werten und Normen speist, ohne deren sozialen Hintergrund einzubeziehen. „Zeitgemäß“ wäre eine gegenwärtige Ethik hingegen dann, wenn sie die Eigenschaften des normativen Minimalismus und der sozial angemessenen Skepsis miteinander verbindet. Auf den ersten Blick scheint die Interessenethik diese Anforderungen optimal zu erfüllen, denn normativ-minimalistisch ist sie allemal. Zum Verhängnis wird ihr allerdings, dass sie ein falsches, rationalistisches Verständnis von Skepsis hat bzw. dass sie mit einzelnen, voneinander getrennten Interessen einen Schritt zu minimalistisch ansetzt. Bei der Skepsis gegenüber Moral sollte man bedenken, dass sie mit der Moral ein soziales Verhältnis beurteilt und voraussetzt – die Moral also nicht vom einsamen, irrealen Standpunkt aus beurteilt werden kann. „Bloß“ kognitiv wird die Ethik dann, wenn sie diese Voraussetzung ignoriert, in der Folge entwickelt sie sozial rigorose bis autistische Rezepte, denen in der realen Gesellschaft deshalb keine sozialen Strukturen entsprechen, weil deren Voraussetzungen in den Grundlagen der Moral ignoriert wurden. Wie die rhetorischen Tendenzen in Birnbachers indirektem Utilitarismus zeigen, lässt sich 19 Abgesehen von der anhaltenden, schwer zu beendenden und deshalb kaum aussagekräftigen Diskussion über den normativen Gehalt des Würdebegriffs hat die kantianische Ethik zur Bioethik so gut wie nichts beigetragen. Zur Anwendung auf die Tiere s. jetzt den riskanten Versuch von Korsgaard 2012. 20 Anton Leist dieses grundsätzliche Defizit zwar im nachhinein etwas reparieren, aber nur auf Kosten moralischer Parteilichkeit. In der politischen und gesetzgeberischen Praxis ist die Gesellschaft der entsprechenden Bioethik vorhersehbar nicht gefolgt. Soweit die medizinischen Praktiken in den letzten Jahrzehnten liberalisiert wurden, geschah das eher in Kenntnis der rationalen Uneindeutigkeit der Grenzen der Moral als ihrer interessentheoretischen Präzisierbarkeit. Nur ideologisch, starr-glaubend, lässt sich die Grenze der Moral fixieren, und die Interessenethik ist damit eine mit den säkular-christlichen Prinzipien durchaus vergleichbare Ideologie. Unsere Ansichten und Gefühle zu den Grenzen des menschlichen Lebens sind wesentlich prägnanter als die zum Verhältnis gegenüber Tieren oder der Natur im weiteren Sinn. Soziale Tumulte wie in der Singer-Affäre sind nicht zufällig beim Tierschutz oder unter ökologischen Ethikern kaum bekannt – mit Ausnahme vielleicht des parteiinternen Streits der ersten Generation grüner Politiker. Wenn die angewandte Ethik heute eher in das Stadium eines pluralistischen, konsensorientierten und grundsatzfernen Arbeitens übergegangen ist, dann nicht nur aufgrund der weniger ideologisch geprägten Auseinandersetzung, sondern auch aufgrund aktueller Themen, die eher im Zentrum der Moral als an ihren Grenzen liegen. 6. Eine sozialnormative angewandte Ethik Moral, das ist nicht nur eine Menge von Rechten, Pflichten und Werten, sondern eine spezielle Art sozialer Beziehungen. Zwar ist es nicht unüblich, von der Moral so zu reden, dass sie in den sozialen Beziehungen als selbst unabhängige Größe angerufen wird, aber das entspringt einer einseitigen, kognitiven Haltung zur Moral. Die Moral wird dann von den sozialen Beziehungen abgespalten – und ebenso alle möglichen Gründe, warum man der Moral folgen sollte und warum sie sozial fordernd ist. Die Moral kann meines Erachtens nicht aus dem Geflecht der Rechte, Pflichten und Werte allein begründet werden, sondern sie benötigt ein Verständnis der sozialen Beziehung, im Rahmen derer sie ihre Funktion hat. Ein von Aristoteles ausgehendes Modell für dieses Verständnis ist die Freundschaft unter miteinander eng vertrauen Personen. Ein anderes, von Hume ausgehendes Modell ist das des bloßen Einhaltens von Rech- 21 Anton Leist ten unter einander fremden Personen, die aus der Sicherheit durch geltende Rechte Vorteile genießen. Viele angewandte Ethiker bedienen sich heute der Kohärenzmethode, die von den sozialen Voraussetzungen möglicher moralischer Verbindlichkeiten abstrahiert, und sie tragen deshalb zur Lösung realer sozialer Konflikte nur begrenzt bei. Nur wenn sich zwischen den Geltens- und den Befolgensgründen nicht nur unterscheiden ließe, sondern letztere als normativ irrelevant ausgeklammert werden könnten, wären die rein kognitiv ermittelten Normen „wahr“ oder „gültig“, ungeachtet dessen, wie sich die realen Menschen verhalten. Wiederum bietet die Interessenethik ein anschauliches Beispiel für die Willkür einer solchen Unterstellung: warum sollte die bloße Existenz von Interessen per se dazu taugen, normative Forderungen an andere zu stellen? Derselbe Einwand gilt aber gegen alle abstrakten, vermeintlich normativen Begriffe wie Würde, Solidarität, Menschsein, Natalität usw., und natürlich auch gegen alle aus unseren abstrakten Ansichten heraus ermittelten Forderungen: warum sollten sie anderen gegenüber verbindlich sein? Die allgemeine Antwort hierauf kann nur lauten: verbindlich werden solche Forderungen dann, wenn alle Beteiligten und Betroffenen darin einstimmen sollten, dass sie verbindlich sind. Die eben formulierte Bedingung kann im Sinn eines kategorischen und im Sinn eines bedingten Sollens verstanden werden. Die kategorische Form wird von der kantianischen Tradition unterstellt, die bedingte von der kontraktualistischen. Die kategorische Form benötigt ein „moralisches Erkennen“, weshalb die bedingte viel naheliegender ist – auf das je konkrete Maß dessen, was moralischen Forderungen in sozialen Beziehungen psychologisch abverlangt werden kann, kommt es deshalb an.20 Es kann dann nicht „eine“ Moral, sondern nur viele moralische Verbindlichkeiten geben, und keine außerhalb effektiv gelebter sozialer Beziehungen. Die Aufgabe des Ethikers, und gesteigert die des mit konkreten Problemen beschäftigten angewandten Ethikers, muss deshalb die des Ermittelns tatsächlicher und potentieller, anzubahnender 20 Tugendhats (2003) Kritik am humeanischen Kontraktualismus unterstellt den ausschließlichen (kantianischen) Kontrast von selbstinteressierten und moralischen Motiven. Eine solche Trennung wäre nur sinnvoll, wenn das Sollen eine nichtpsychologische Quelle haben könnte. Zu entsprechender Kritik an Tugendhat s. Leist 2006. 22 Anton Leist sozialen Beziehungen sein. Der allgemeine für die verschiedensten Angebote geltende sozialnormative Rahmen könnte sein, dass moralische Normen im Geist kooperativer Beziehungen gesucht und gefunden werden. Moralische Normen sind deshalb immer nur rekonstruktiv zu postulierende, nie als solche normativ-kognitiv „erkannte“. Nur die längerfristige (implizite oder explizite) Akzeptanz in dem entsprechenden Kollektiv kann die Garantie bieten, dass die Normen berechtigt sind. Aufgrund teils ihrer frühen Konzentration auf die Grenzfragen der Moral, sowie teils des verbreiteten kohärentistischen Methodenmodells spielt ein solches sozialnormatives Verständnis in der angewandten Ethik soweit eher eine geringe Rolle. Die kontraktualistische Medizinethik Robert Veatchs (1991), der Versuch von Mark Bernstein (1997), Jennifer Swanson (2011) und anderen, die moralische Bedeutung der Tiere in der Gerechtigkeitstheorie von Rawls zu ermitteln, David Schlosbergs Gerechtigkeitsansatz zur Umwelt (Schlosberg 2007), sind ungewöhnlich in der angewandten Ethik. Hier ist auch nicht der Platz, um die verschiedenen sozialen Sphären in ihren Unterschieden, Zielen und Voraussetzungen zu charakterisieren und allererst zu prüfen, ob sich aus ihnen überhaupt ein gemeinsames Verständnis kooperativen Handelns extrahieren lässt. Die Beziehungen zwischen Arzt und Patient sind offensichtlich, bei unklar gewordenem Ideal, einer Freundschaft näher (wenn auch nicht identisch), und die über den Weltmarkt verflochtener Bürger nördlicher und südlicher Ländern sind offensichtlich, wieder bei unklarem Ideal, eher der reinen Nutzenkooperation näher. Die moralischen Normen können deshalb für beide Beziehungen nicht dieselben sein. Die sozialnormative Ethik muss sich entsprechend vor allem dagegen verwahren, mit einer speziellen Form des Kontraktualismus identifiziert zu werden. Selbst für die internationalen Beziehungen zwischen den Verursachern und den Betroffenen des Klimawandels herrschen Spielräume der Fairness, die mit dem potentiellen Nutzen durch ein für alle vorteilhaftes Klimaabkommen gekoppelt werden könnten (s. Leist 2011a; 2011b). Damit Fairness wirksam und gültig werden kann, ist aber ein Nutzen durch Fairness vorausgesetzt. Demgegenüber bleiben abstrakt an Menschenrechte appellierende Varianten der Klimaethik nicht nur politisch ergebnislos, sondern sind eben auch nur weitere Varianten der geläufigen Moralideologie. Die eine für alle Menschen unter allen Umständen gültige Moral ist eine Fiktion der westlich-christlichen Kultur, 23 Anton Leist und sie wird überwiegend nicht einmal im Westen anders als rhetorisch wahrgenommen. 7. Das zukünftige Thema: Internationale Umweltgerechtigkeit Sofern sich in der angewandten Ethik in den etwa 40 Jahren ihrer neueren Geschichte überhaupt eine interessante Entwicklung zugetragen hat, so ist es die ihrer Aufgabenerweiterung durch die Globalisierung. Der Gründung der Zeitschrift Bioethics 1987 (durch Peter Singer) ist 2001 die des Ablegers Developing World Bioethics gefolgt, und ähnlich sind alle Themen der angewandten Ethik heute teils durch die internationale Dimension der realen Probleme, teils durch die erweiterten kulturellen Differenzen geprägt. Die ethischen Traditionen Europas sind dadurch nicht überflüssig geworden, aber unter ihnen bietet sich diejenige am vielversprechendsten an, die sowohl soziale und kulturelle Kontexte berücksichtigen wie elementarste menschliche Eigenschaften beachten kann, ohne ihren Blick durch spezielle metaphysische Voraussetzungen wie der Summe von Einzelinteressen oder der inhaltlich gebietenden Vernunft einschränken zu lassen. National wie international haben sich im Laufe der 40 Jahre zudem materielle Knappheit und deren soziale Folgen in den Vordergrund geschoben. Die größte ethische Aufmerksamkeit gehört heute unter allen Themen der angewandten Ethik solchen wie Ressourcengerechtigkeit, Migrationsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Zertifikatmarktgerechtigkeit, transgenerationeller Gerechtigkeit – also Varianten der internationalen Gerechtigkeit als einer erweiterten Umweltgerechtigkeit. In dieser Entwicklung drückt sich eine Einsicht aus, die im Grund auch in der Frühphase der angewandten Ethik bereits gemacht werden konnte, über der Konzentration auf die Grenzprobleme aber leicht zu übersehen war: dass nämlich Gerechtigkeit die bei weitem wichtigste, weil für die Stabilität der Gesellschaft verantwortliche moralische Norm ist. Noch immer denken viele Ethiker bei „Moral“ nicht vorrangig an Gerechtigkeit, sondern an eine ungeordnete Vielfalt von Werten. Damit demonstrieren sie wiederum, dass in ihrem Verständnis von Moral keine Verbindung zu den sozialen Strukturen vorgesehen ist, die für den Bestand der Gesellschaft am wichtigsten sind. 24 Anton Leist Wenn wir stattdessen alle moralischen Fragen, seien es die Grenzoder die Verteilungsfragen, aus dem Geflecht sozialer kooperativer Beziehungen angehen wollen, dann ergibt sich aus der Art der kooperativen Beziehungen indirekt auch eine mögliche Antwort auf den moralischen Status der an diesen Beziehungen Beteiligten.21 Die Gründe für diesen Status folgen dann nicht aus einem abstrakten Begriff der Moral, sondern aus den vollziehbaren und mindestens ansatzweise bereits vollzogenen Handlungen und Interaktionen. Der sozialnormative Ansatz ist offen dafür, welche moralischen Perspektiven gegenseitig eingeräumt werden. Die Moral ist nach ihm ein soziales Regelwerk, das fortwährend neu erfunden und justiert werden muss, nicht Ergebnis eines zu erkennenden menschlichen „Wesens“. Allein schon aufgrund ihrer prinzipiellen Offenheit darin, die moralischen Bedürfnisse in einer sich verändernden Welt je neu zu beantworten, sollte die konstruktive Grundidee der angewandten Ethik die der kooperativen Beziehungen sein.22 Literatur Anstötz, Ch. (Hg.) (1992): Peter Singer in Dortmund, Uni Dortmund. Anstötz Ch./Hegselmann R./Kliemt H. (Hg.) (1995): Peter Singer in Deutschland, Frankfurt a.M. (auch: http://www.uni-due.de/ philosophie/personen.php?ID=104&MATERIAL=111). Barton, H. (1996): The Isle of Harris Superquarry: Concepts of the Environment and Sustainability. In: Environmental Values 5.2, S. 97122. Bernstein, M. (1997): Contractualism and Animals. In: Philosophical Studies 86.1, S. 49-72. Birnbacher, D. (1995): Tun und Unterlassen, Stuttgart. Birnbacher, D. (2004): Menschenwürde – abwägbar oder unabwägbar? In: Kettner, M. (Hg.): Biomedizin und Menschenwürde, Frankfurt a.M., S. 249-271. 21 S. beispielsweise meinen Versuch, die Tiere als gemeinschaftliche Partner einzuordnen: Leist 2005, Kap. 8. Auch Wolf (2008, 179) spricht von „quasi vertragsähnlichen Beziehungen zwischen ungleichen Partnern“, versucht aber verschiedene Quellen für die Mensch-Tier-Moral zu identifizieren. 22 Mit Dank für Hinweise an Christian Thies und Ursula Wolf. 25 Anton Leist Birnbacher, D. (2006): Bioethik zwischen Natur und Interesse, Frankfurt a.M. Düwell, M. (2009): Equality, Speciecism and the Sanctity of Human Life. In: Schaler, J.A. (Hg.): Peter Singer under Fire, Chicago, S. 395418. Hegselmann, R./ Merkel R. (Hg.) (1991): Die Debatte über Euthanasie: Beiträge und Stellungnahmen, Frankfurt a.M. Hoerster, N. (1995): Neugeborene und das Recht auf Leben, Frankfurt a.M. Jonas, H. (1979): Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt a.M. Jonas, H. (1984): The Imperative of Responsibility, Chicago. Jonas, H. (1985): Technik, Medizin und Ethik, Frankfurt a.M. Korsgaard, Ch. (2012): A Kantian Case for Animal Rights, in: J. Hänni/ M. Michel/D. Kühne, Animal Law: Tier und Recht, Zürich. Krebs, A. (Hg.) (1997): Naturethik: Grundtexte der gegenwärtigen tierund ökoethischen Diskussion, Frankfurt a.M. Krebs, A. (1999): Ethics of Nature, Berlin. Kuhlmann, A. (2001): Politik des Lebens – Politik des Sterbens. Bioethik in der liberalen Demokratie, Berlin. Kuhlmann, A. (2011): An den Grenzen unserer Lebensform, Frankfurt. Leist, A. (1990): Eine Frage des Lebens, Frankfurt a.M. Leist, A. (2005): Ethik der Beziehungen, Berlin. Leist, A. (2006): Zwischen Gründen und Gefühlen. Zu Ernst Tugendhats Rationalismusproblem. In: Scarano, N./Suarez, M. (Hg.): Ernst Tugendhats Ethik, München. S.195-217. Leist, A. (2011a): Klimagerechtigkeit. In: Information Philosophie, Heft 5, S. 1-9. Leist, A. (2011b): Klima auf Gegenseitigkeit. In: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Bd.16, S. 159-178. Mackie, J.L. (1974): Ethics. Inventing Right or Wrong, Harmondsworth. Marquis, D. (2009): Singer on Abortion and Infanticide. In: Schaler, J.A. (Hg.): Peter Singer under Fire, Chicago, S. 133-152. Mill, J.St. (1871): Utilitarianism, London; dt. Der Utilitarismus, hg. von D. Birnbacher, Stuttgart 1976. Naess, A. (1989): Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy, Cambridge. Norton, B. (2005): Sustainability. A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management, Chicago. 26 Anton Leist Ott, K. (2009): Zur Begründung der Konzeption starker Nachhaltigkeit. In: Koch H.-J./Hey Ch. (Hg.): Zwischen Wissenschaft und Politik. 35 Jahre Gutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen, Berlin. Plater, Z. (2008): Tiny Fish/Big Battle: 30 Years after TVA and the Snail Darter Clashed, the Case still Echoes in Caselaw, Politics and Popular Culture. In: American Currents 34.3, S. 1-8. Rawls, J. (1971): A Theory of Justice, Cambrige/MA. Rolston, H. (1988): Environmental Ethics: Duties in a Natural World, Philadelphia. Schaler, J.A. (Hg.) (2009): Peter Singer under Fire, Chicago. Schlosberg, D. (2007): Defining Environmental Justice. Theories, Movements, and Nature, Oxford. Scruton, R. (2012): How to think Seriously about the Planet. The Case for an Environmental Conservativism, Oxford. Singer, P. (1975): Animal Liberation. A New Ethics for our Treatment of Animals, New York; dt. Befreiung der Tiere, München 1982. Singer, P. (1979): Practical Ethics, Oxford; dt. 1984, Praktische Ethik, Stuttgart, 2. Aufl. 1994. Singer, P. (1991): Bioethik und akademische Freiheit. In: Hegselmann, R./Merkel R. (Hg.) (1991): Die Debatte über Euthanasie: Beiträge und Stellungnahmen, Frankfurt a.M., S. 312-326. Singer, P. (1995): Rethinking Live and Death. The Collapse of our Traditional Ethics, Oxford; dt. Leben und Tod. Der Zusammenbruch der traditionellen Ethik, Erlangen 1998. Singer. P. (2002): One World. The Ethics of Globalization, New HavenLondon. Singer, P. (2009): An Intellectual Autobiography. In: Schaler, J.A. (Hg.): Peter Singer under Fire, Chicago, S. 1-73. Singer, P./Kuhse, H. (1985): Should the Baby Live? The Problem of Handicapped Newborns, Oxford; dt. Muss dieses Kind am Leben bleiben? Das Problem schwerstgeschädigter Neugeborener, Erlangen 1993. Swanson, J. (2011): Contractualism and the Moral Status of Animals. In: Between the Species 14.1, S. 1-17. Tugendhat, E. (1993): Eine Vorlesung über Ethik, Frankfurt. Veatch, R. (1991): The Patient-Physician Relation. The Patient as Partner, Bloomington. 27 Anton Leist Wolf, U. (2008): Die Mensch-Tier-Beziehung und ihre Ethik. In: Wolf, U. (Hg.): Texte zur Tierethik, Stuttgart, S. 170-192. Wuchterl, K. (1996): Streitgespräche und Kontroversen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, Bern, Stuttgart, Wien.