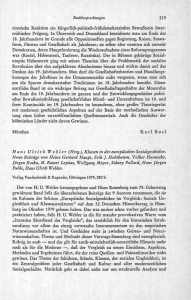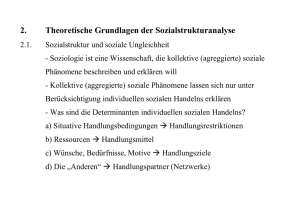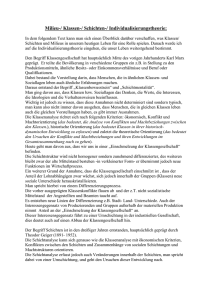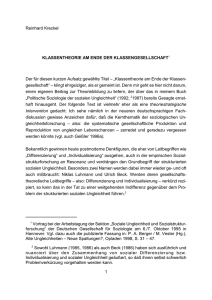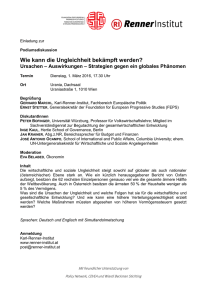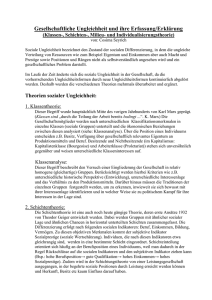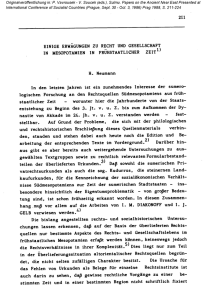Unsere Klassengesellschaft
Werbung

Unsere Klassengesellschaft Wie könnten die Deutschen angemessen über ihr Gemeinwesen sprechen? Ein unzeitgemäßer Vorschlag Von Paul Nolte 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Vor einiger Zeit präsentierte das Magazin Spiegel-reporter eine Titelgeschichte über die "Internet-Deutschen". Während Boris-"Ich bin drin"-Becker als Musterexemplar dieser neuen Spezies den Leser anlächelte, versuchten die Zahlenkolonnen einer Emnid-Erhebung, der Behauptung des Magazins wissenschaftlichen Anstrich zu verleihen: Deutschland teilt sich - in diejenigen mit Internet-Anschluss auf der einen Seite und die minder Privilegierten ohne Internet auf der anderen. Nicht näher bezeichnete "Gesellschaftskritiker" warnen angeblich bereits "seit Jahren" davor, doch nun ist das Unglück eingetreten: Die internetlosen Deutschen sind das neue "Proletariat", ganz Deutschland "ist auf dem Weg in die ZweiKlassen-Gesellschaft". Man staunt und stutzt. Erst einmal verwundert es, dass zehn Jahre nach dem Ende des europäischen Kommunismus noch einmal Begriffe aus dem Arsenal der politischen Sprache geholt werden, mit denen Marx einst den Durchbruch der Industriegesellschaft begleitete und die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, in der DDR noch länger, die Selbstdeutung von Politik und Gesellschaft prägten. Haben wir nicht die unglückseligen Zeiten der sozialen Zerklüftung der Gesellschaft in ein ärmliches Proletariat und eine vermögende Bürgerschicht, wenigstens im Westen Deutschlands seit den Zeiten des Wirtschaftswunders, glücklich überwunden? Leben wir nicht längst einträchtig beieinander, in der Harmonie des Massenkonsums? Sehen wir uns nicht viel lieber als moderne, dynamische "Wissens-" oder "Zivilgesellschaft"? Die Rede von einer neuen Zweiklassengesellschaft zeigt immerhin, dass sich ältere Muster der sozialen Struktur in unserem kollektiven Gedächtnis erhalten haben, die manchmal wie schlechtes Gewissen über uns kommen. Schaut man aber genauer hin, wird klar: Was hier als neue Spaltung der deutschen Gesellschaft entlang der "Internet-Linie" verkauft wird, ist alles andere als neu. Es ist vielmehr ein getreues Abbild der alten Klassengesellschaft, die wir verdrängt haben, ohne ihre Realität beseitigen zu können. Die Internet-Linie trennt in altbekannter Manier diejenigen, die in ungesicherten, schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen leben, die viel fernsehen und wenig Bücher lesen, von den anderen, die von der ökonomischen Entwicklung profitieren, vielleicht selbstständig sind, in jedem Fall gut verdienen und an der Bildungs- und Informationsflut partizipieren. Sagen wir es deutlich: Bildung und Besitz sind immer noch die Grundlage dieser neu-alten Klassengesellschaft. Aus Bildung und Besitz ergeben sich bestimmte Vorlieben und Lebensentwürfe, zu denen jetzt eben auch das Internet gehört. Sogar in den politischen Präferenzen spiegelt sich das Muster der bürgerlichen Klassengesellschaft wider: Die FDP und die Grünen genießen bei Internet-Nutzern viel mehr Ansehen als bei den Nichtnutzern - nicht etwa, weil Guido Westerwelle so viel vom Surfen versteht, sondern weil diese beiden Parteien gegenwärtig am stärksten den Charakter von Klassenparteien haben: die FDP als Partei des "Mittelstandes" - in Wirklichkeit der bestverdienenden Geschäftsführer und Zahnärzte -, die Grünen als Partei der bildungsbürgerlichen Erbmasse aus Lehrern, Sozialpädagogen und Universitätsdozenten. Gewiss ist manches an den Spannungslinien unserer Gesellschaft durchaus neu. Drei wichtige Beispiele liegen auf der Hand: Der private Konsum hat, zum Beispiel mit dem auffällig gesteigerten Markenbewusstsein, eine größere Bedeutung für die Selbststilisierung des Einzelnen und seinen Platz in der Gesellschaft gewonnen. Internet-Nutzer sind vergleichsweise jung - ein Beleg dafür, dass Alter und Generation in den sozialen Verteilungskämpfen eine größere Rolle spielen. Und jeder weiß, dass zwischen "alter Bundesrepublik" und "Ex-DDR" eine soziale und kulturelle Kluft liegt, die sich in den vergangenen Jahren eher vergrößert als geschlossen hat. Diese Stichworte sind jedem Zeitungsleser vertraut. Trotzdem sind wir erstaunlich blind dafür, wie eng solche Phänomene mit dem Grundproblem der sozialen Schichtung, mit den Funktionsmechanismen der Klassengesellschaft, zusammenhängen. Aufmerksame Beobachter wissen spätestens seit Mitte der achtziger Jahre von der wachsenden Schere zwischen den Einkommen aus selbstständiger und aus unselbstständiger Arbeit. Sie wissen auch, dass Konsum und Lifestyle soziale Unterschiede nicht eingeebnet, sondern vergrößert haben. Aber in Politik und Öffentlichkeit hat all das kaum Resonanz gefunden: Es wäre zu peinlich zuzugeben, dass Klassenunterschiede auch im Übergang in das 21. Jahrhundert unsere Gesellschaft noch fundamental prägen - vom 1 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 Schulbesuch bis zur Gesundheitsversorgung, vom Einkommen bis zur politischen Macht. Auch das liberale Feuilleton spricht lieber über die vermeintlich egalisierende "Individualisierung", über die Gesellschaft der "Optionen" und der "Risiken". Selten fällt dabei auf, dass die einen mehr Optionen haben, die anderen größere Risiken tragen. Man muss diese Diagnose nicht einmal teilen, um sich über die Unfähigkeit der Politik zu wundern, soziale Unterschiede noch angemessen zur Sprache zu bringen. Meist wird mit allgemeinsten Kategorien wie dem "Volk" oder den "Bürgerinnen und Bürgern" zugekleistert, dass Menschen unterschiedliche Möglichkeiten, Mentalitäten und Lebensentwürfe haben - und dass diese Merkmale sich nicht zufällig in der Gesellschaft verteilen. Wenn den Politikern aber das Bewusstsein dafür fehlt, in welcher Gesellschaft wir leben, und die Begriffe nicht mehr zur Verfügung stehen, um das auszudrücken, führt dies zu einem Realitätsverlust und zu einem Mangel an Problemlösungsfähigkeit, den sich keine Demokratie auf Dauer leisten kann. In der Debatte über die Ursachen rechtsradikaler Gewalt ist diese Unsicherheit spürbar. Wenn etwa der hessische Ministerpräsident Roland Koch über dieses Thema räsoniert, spricht er verschämt von der Angst der "kleinen Leute" vor dem Verlust des Nationalstaates und von der Erfahrung des "einfachen Mannes". Worüber soll man sich mehr wundern: über die hausbackenen Begriffe, die an Schwarzweißfilme der Wirtschaftswunderzeit erinnern - oder darüber, dass Koch überhaupt gesellschaftsanalytische Kategorien zur Beschreibung eines politischen Problems heranzieht? Roland Koch erwähnt sogar das "untere Drittel der Bevölkerung". Also gibt es doch noch eine Unterschicht in Deutschland - auch wenn dieses Wort im politischen Diskurs der Bundesrepublik fast obszön geworden ist. Wirft man einen Blick in programmatische Texte der Parteien, so bestätigt sich der Eindruck, diese seien unfähig, ein Bild der gegenwärtigen Gesellschaft zu entwerfen, soziale Unterschiede und Konfliktlinien auf den Begriff zu bringen. In ihrem Grundsatzprogramm von 1994 spricht die CDU unter der Überschrift "Soziale Ordnung" von Prinzipien wie Gerechtigkeit und Solidarität - aber auf welche gesellschaftliche Lage diese Prinzipien eigentlich angewendet werden sollen, bleibt ganz offen. Später ist von der "Sozialpolitik seit dem 19. Jahrhundert" die Rede, sogar vom Konflikt zwischen "Kapital und Arbeit" - aber das ist eine historische Reminiszenz. Auch die "Neue Soziale Frage" ist schon vor einem Vierteljahrhundert von Heiner Geißler entdeckt worden - und es ist bezeichnend, dass trotz des enormen ökonomischen und sozialen Wandels seitdem praktisch keine neuen Begriffe mehr erarbeitet worden sind, die den veränderten Interessenlagen und sozialen Differenzierungen gerecht werden. Von der FDP kann man das ohnehin kaum erwarten. Nachdem sie eine Weile das bemerkenswerte Experiment betrieben hatte, sich ausdrücklich als Klassenpartei der "Besserverdienenden" und "Leistungsbereiten" zu präsentieren, hat sie inzwischen den Rückzug in das allein selig machende Konzept der "Bürgergesellschaft" angetreten. Das ist schön und gut, wenn es um Innen- und Rechtspolitik geht - aber kann man damit die Gesellschaft verstehen? Überhaupt verdeckt die Rede von der "Zivilgesellschaft" die sozialen Unterschiede, ohne die man über die Möglichkeit, politische und sittliche "Zivilität" zu erreichen, doch gar nicht reden kann. Und wie sieht es auf der Linken aus, wo man schon aus historischen Gründen eine größere Sensibilität für das Thema erwarten könnte? Im noch gültigen Grundsatzprogramm der SPD von 1989 werden ausführlich die Grundsätze einer "freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft" skizziert. Ganz am Schluss erst findet sich ein Abschnitt über die "Überwindung der Klassengesellschaft". Es ist der kürzeste des ganzen Kapitels, und man sucht in ihm vergeblich Auskunft darüber, wer oder was eigentlich die sozialen Klassen seien, die sich in dieser Klassengesellschaft gegenüberstehen. Für das Wahlprogramm Gerhard Schröders 1998 war selbst das zu drastisch: Jetzt will die SPD nur noch "die sozialen Gräben in unserer Gesellschaft zuschütten" - nur welche? - und setzt dabei auf die "Leistungsträger unserer Gesellschaft", die den Kern der Neuen Mitte ausmachen sollen. Einzig bei den Grünen wird das Grundproblem der sozialen Ungleichheit einigermaßen unverbrämt ausgesprochen. Dabei steht das Problem von Armut und Unterstützungsbedürftigkeit im Vordergrund. Das ist löblich, reicht aber nicht aus; und ein Gesamtentwurf der "gesellschaftlichen Situation der Zeit", wie man in Anlehnung an Karl Jaspers' einstige Diagnose der "geistigen Situation der Zeit" sagen könnte, kommt so nicht zustande. Spätestens hier liegt der Einwand nahe, dass dies doch alles ganz normal und nicht weiter verwunderlich sei. Warum sollte in Politik und Öffentlichkeit ein so unappetitliches Thema wie die Aufteilung der Gesellschaft in unterschiedlich ausgestattete Schichten und Klassen gerne angesprochen werden? Es erscheint selbstverständlich, dass die Rede darüber verpönt ist. Doch ist dies keineswegs normal; es ist auch nicht immer so gewesen. In vorindustriellen Gesellschaften waren es die Menschen ohnehin gewohnt, als einem bestimmten "Stand" 2 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 zugehörig angesprochen und im Alltag entsprechend behandelt zu werden. Die politische Sprache war getränkt von sozialen Rangfragen. Auch in der industriellen Klassengesellschaft, die sich in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts herausbildete, war es nicht anders. Gerade weil die neuen, durch den Markt geschaffenen Klassenzugehörigkeiten für die Zeitgenossen so unerhört waren, wurde darüber diskutiert. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse gehörte zur Identität des Individuums; sie bot eine Gemeinschaft, die soziale Sicherheit verlieh. Auch die Politik ging ganz selbstverständlich davon aus, dass Menschen unterschiedlicher Klassenlage unterschiedliche Interessen hatten; bis in die Weimarer Republik hinein wurde das Wahlvolk gezielt als "Bauern" oder "Bürger", "Mittelstand" oder "Arbeiter" angesprochen. Erst in der Bundesrepublik der fünfziger Jahre hörte das auf. Darin wirkte teils das Bemühen des Nationalsozialismus nach, soziale Unterschiede in einer "Volksgemeinschaft" einzuschmelzen; teils lösten sich extreme Härten der "sozialen Frage" tatsächlich auf; teils machte man die Erfahrung, dass das Schweigen über soziale Ungleichheit gesellschaftlich integrierend und befriedend wirken konnte. Die positive Funktion des Schweigens und Verdrängens war gerade in Deutschland wichtig, inzwischen aber überwiegen die Kosten. Denn eine demokratische Gesellschaft sollte sich Rechenschaft über ihre Bauprinzipien ablegen. Eigentlich müsste soziale Ungleichheit ein großes Thema unserer Zeit sein. In allen westlichen Industrieländern hat sich der Trend zu einer immer egalitäreren Einkommensverteilung seit den achtziger Jahren markant umgekehrt. Zeitweise schien sich ein Sensorium für die damit neu entstehenden, oder wieder verschärfenden, sozialen Probleme herauszubilden - aber wer spricht heute noch über die "Zweidrittelgesellschaft"? Für diese öffentliche Verdrängung gibt es viele Gründe. In Deutschland tat sich seit 1990 eine neue gesellschaftliche Kluft zwischen "West" und "Ost" auf, die mit Klassenunterschieden scheinbar nichts zu tun hatte. Unter linken und liberalen Intellektuellen ist Gesellschaftskritik, überhaupt das Denken in Kategorien der "Gesellschaft", passé und gilt als altmodisch; man wendet sich der "Kultur" zu, der Welt der Symbole und Imaginationen, nicht mehr der harschen materiellen Realität. Im Westen suggeriert die neue Unterschichtung durch Einwanderer aus Südeuropa und der Türkei den "Deutschen", für sich hätten sie das Problem einer Klassengesellschaft gelöst. Es gibt eine "neue Armut", aber im Allgemeinen ist das Wohlstandsniveau in der Ära Kohl auch für diejenigen gestiegen, die weniger als der Durchschnitt besaßen oder verdienten: Der soziale "Fahrstuhleffekt", das Anheben des allgemeinen Lebensstandards, machte vergessen, dass die Abstände wuchsen und sich neue, subtile Mechanismen der sozialen Differenzierung herausbildeten. Diese neuen Mechanismen der Klassengesellschaft findet man nicht so sehr, wie früher, in der Sphäre der Arbeit, sondern in Konsum und Alltag. Auch hier war Amerika Vorreiter; gegen Ende der achtziger Jahre stellte die Publizistin Barbara Ehrenreich eine neue Polarisierung des Gütermarktes in ein "Oben" und "Unten" fest, während das ehemals dominierende, solide mittlere Segment immer mehr Schwierigkeiten hatte, Käufer zu finden. Das galt für Alltagsgüter wie Bier oder Haushaltsgeräte ebenso wie für die Orte des Einkaufens, die Warenhäuser und Lebensmittelgeschäfte. Seit etwa zehn Jahren lässt sich dasselbe in Deutschland beobachten. Für Waren aller Art etabliert sich ein hochtrabend "Premium-Segment" genannter Markt, während am anderen Ende der Preiskampf der "Discounter" immer härter wird. Man kann Mineralwasser für 30 Pfennig verkaufen und ab einer Mark aufwärts - dazwischen ist es schwierig; und es sind klassische Einzelhandelsunternehmen wie Karstadt, die darunter am meisten leiden. Auffallend wenig wird darüber gesprochen, wie eng dem jeweiligen Angebot bestimmte soziale Käufer- oder Nutzertypen entsprechen. Die Vervielfachung der Offerten hat den Blick darauf verstellt, dass der Zuwachs an Optionen sehr klassenspezifisch genutzt wird, mehr noch: der Demonstration und Verfestigung von Klassenunterschieden dient. Das Fernsehen ist das beste Beispiel: Der Aufstieg der Privatsender hat ja nicht einfach zu einer "Bilderflut" geführt, er hat vor allem eine Klassendifferenzierung des Fernsehens bewirkt, die es zur Zeit des Duopols von ARD und ZDF nicht gab. Mit RTL und Sat.1 ist ein spezielles Unterschichtfernsehen entstanden, und deshalb war es nur konsequent, dass sich am anderen Ende der sozialen Skala Sender wie 3sat oder Arte etablierten. Wenn es in den fünfziger und sechziger Jahren jene Tendenz zur "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" gegeben hat, von der der Soziologe Helmut Schelsky sprach, hat sich der Trend inzwischen umgekehrt. Von solchen Unterschieden will die Gesellschaft zwar nichts wissen - und doch passt sich fast jeder den Spielregeln der neuen Differenzierung an und kennt die geheimen Codes. Trotz vieler kluger Konzepte der Sozialwissenschaften ist die 3 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 klassenprägende Kraft von Konsum und Lebensstil in unserer Gesellschaft im Grunde noch immer unverstanden. Es würde sich lohnen, den neuen Klassendifferenzen auch in anderen Dimensionen nachzuspüren. Natürlich ist es wahr, dass der Faktor "Generation" heute größere Bedeutung als früher hat. Wie der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist Alter ein soziales Merkmal, das eine durchaus eigene Prägekraft besitzt. Aber in Politik und Öffentlichkeit wird meist der Eindruck erweckt, als wären "die" Senioren geradezu die Avantgarde einer klassenlosen Gesellschaft, als wären Menschen über 60 nur noch alt und nicht mehr Bürger oder Arbeiter, (Ex-)Unternehmer oder (Ex-)Verkäuferinnen. Das führt zu seltsamen Schieflagen der Diskussion: Während die Parteien Alter immer noch als Armutsrisiko klassifizieren, liest man andererseits ständig über die reichen Alten auf den Kreuzfahrtschiffen. Ein wenig mehr "Klassen-Bewusstsein" würde hier zu größerer Klarheit führen - aber auch zu unpopulären Maßnahmen wie der Aufhebung pauschaler "Seniorenermäßigungen" in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln. Schließlich ist auch der Unterschied zwischen dem "Westen" und dem "Osten" der Bundesrepublik in vieler Hinsicht als Klassengegensatz zu deuten. Mit Recht vergleicht man ja häufig die Durchschnittsverdienste, Haushaltseinkommen oder privaten Vermögen in den neuen und alten Bundesländern und stellt einen großen Abstand fest. Aber höchstens verschämt gibt man zu, dass sich daran so schnell gar nichts ändern wird, weil es ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen ist: nämlich zwischen zwei ganz unterschiedlichen Schichtungsstrukturen. Und dieser Unterschied hat historische Wurzeln, die weit hinter die Vereinigung zurückreichen: mindestens bis zur Massenabwanderung des Bürgertums und der Mittelschichten, der Selbstständigen und der Gebildeten aus der entstehenden DDR. Zurück blieb die Arbeiterschicht. Auf der Grundlage der bestehenden Sozialstruktur wird sich die "Angleichung der Lebensverhältnisse" also nie vollziehen lassen. Man müsste dann auch fordern, die Lebensverhältnisse in Duisburg-Nord oder Köln-Chorweiler dem Durchschnitt der alten Bundesrepublik anzupassen. Mehr "Klassen-Bewusstsein" heißt auch: Abschied nehmen von manchen bequemen Illusionen. Ein Plädoyer für mehr Klassenbewusstsein - das mag sich antiquiert anhören, wie die Aufforderung zur Rückkehr in die Denkwelten der Arbeiterbewegung vor hundert Jahren. Es heißt aber nur, dass wir ein geschärftes Bewusstsein dafür brauchen, in einer Welt zu leben, die immer noch durch soziale Ungleichheit, durch Schichtung und Klassendifferenzen geprägt wird. Das weiter zu verdrängen kann angesichts der rasanten Veränderungen, wie wir sie zum Beispiel in der Informations- und Wissensökonomie erleben, und angesichts der demografischen Veränderungen, denen wir nicht ausweichen können, politisch gefährlich sein. Mit Klassenkampf hat das gar nichts zu tun, wohl aber mit gesellschaftlicher Selbstaufklärung. Gewiss, der alte Anklagegestus, wie er noch vor einiger Zeit aus den Büchern Bernt Engelmanns über die "Reichen" der Bundesrepublik sprach, hat sich verbraucht und wird von niemandem vermisst. Sagen darf man freilich auch: Der "Sozialneid" ist in Deutschland zum Totschlagargument geworden; wer überhaupt noch soziale Unterschiede anzusprechen wagt, bekommt reflexartig die "Du schürst den Sozialneid"Bratpfanne auf den Kopf gehauen. Umgekehrt muss man sich von der Illusion verabschieden, die Armut abschaffen, die Unterschicht zur bürgerlichen Mittelklasse machen oder soziale Ungleichheit überhaupt aufheben zu können - und sei es auch nur in der rührenden, typisch deutschen Schrumpfvision von der "Angleichung der Lebensverhältnisse". Auch hier kann "Klassen-Bewusstsein" zu jener Annäherung an die Wirklichkeit verhelfen, die effektive Sozial-, Struktur- oder Wirtschaftspolitik erst ermöglichen. "Klassen-Bewusstsein" als Einsicht in die Realitäten der gesellschaftlichen Struktur und der sozialen Ungleichheit ist deshalb ein Projekt bürgerlicher Aufklärung. Der britische Historiker David Cannadine argumentiert in seiner Studie über Class in Britain ähnlich: "Klasse" ist kein kommunistisches Konzept, wie Margaret Thatcher glaubte; es war vor Marx da und wird das Ende des Marxismus überleben. Seine Wurzeln reichen dorthin zurück, wo jetzt viele nach den Fundamenten der Zivilgesellschaft graben: in die schottische Aufklärung mit ihren großen Autoren wie Adam Smith, Adam Ferguson oder John Millar. Politische Zivilgesellschaft und kapitalistische Klassengesellschaft sind eng verwandt. Von Bonn aus, dem rheinischen Treibhaus bürgerlichen Wohlergehens, konnte man einfache Einsichten über die Strukturen einer deutschen Klassengesellschaft leicht verdrängen. Über den Sozialschock der politischen Klasse bei ihrer Ankunft in Berlin im vergangenen Jahr, als sie Straßen und U-Bahnen plötzlich mit fremden Wesen aus einer anderen sozialen Welt teilen musste, ist in den Medien amüsiert berichtet worden. Vielleicht setzt die Ankunft im 4 Alltag ja wirklich Bewusstseinsveränderungen in Gang. Die Politik der Berliner Republik könnte davon nur profitieren. 5