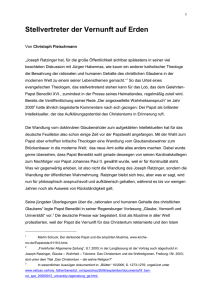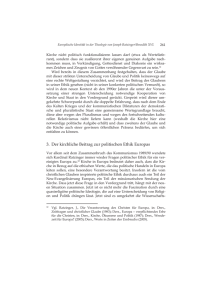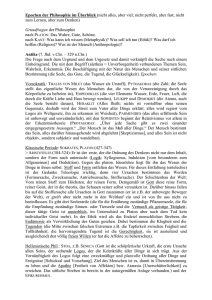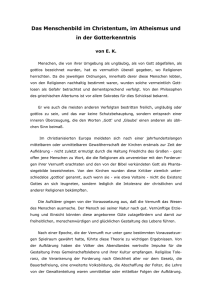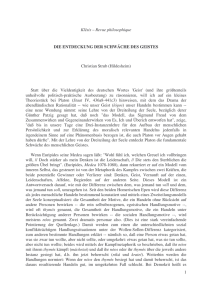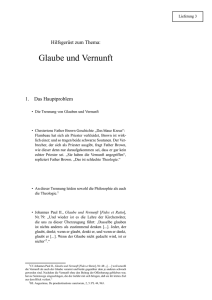Friedrich Wilhelm Graf
Werbung

Studia Theologica VI, 1/2008, 84 - 113 Friedrich Wilhelm Graf Prägnante Distinktion. Das theologische Programm Joseph Ratzingers [Benedikt XVI.] 1. Religious market oder: My God sells Zu den vielversprechenderen Deutungsmodellen der Religionswissenschaften zählt schon seit einigen Jahrzehnten die sogenannte Religionsökonomie. 1963 hat der heute in Boston lehrende Religionssoziologe Peter L. Berger einen inzwischen berühmten Essay „A Market Model for the Analysis of Ecumenicity“ publiziert.1 Berger hat dort zwei widersprüchliche Entwicklungen auf den Religionsmärkten der USA analysiert. Einerseits ließen sich vielfältige Gesprächskontakte zwischen christlichen Kirchen und kleineren religiösen Gemeinschaften beobachten, Verhandlungen über konkrete Zusammenarbeit, etwa im sozialen Bereich, Vereinbarungen über Zweckbündnisse, auch Gespräche über Fusionen. Zur modernen Religionskultur gehört eben der permanente ökumenische Dialog, ohne daß sich immer genau sagen ließe, worüber da geredet wird. Worum geht es eigentlich – wenn man von funktionärstypischen Selbstbeschäftigungsritualen einmal absieht? Nicht nur um Annäherung jedenfalls. Denn viele dieser Akteure sind andererseits zugleich auch um neue konfessionelle Profilbildung bemüht, um klare Abgrenzung von anderen Kirchen und religiösen Gruppen durch Neubestimmung konfessionsspezifischer Identität. Zwischen den ökumenischen 1 Berger, Peter L.: A Market Model for the Analysis of Ecumenicity, in: Social Research 30 (1963), 77-93. Aufbrüchen des 20. Jahrhunderts und der energischen Betonung des Konfessionellen bestehe jedoch, so Berger, kein Widerspruch. Gerade der intensivierte ökumenische Dialog zwinge die Beteiligten vielmehr dazu, auf diese Prozesse durch neue konfessionelle Identitätserfindung zu reagieren, da alle religiösen Organisationen und Institutionen auf einem pluralistischen Religionsmarkt agieren. In dieser Marktsituation ist jeder Anbieter dazu gezwungen, die besondere Leistungsfähigkeit seiner Heilsprodukte, Seelendienstleistungen und Lebenssinngüter deutlich herauszustellen. Je vielfältiger, bunter, unübersichtlicher moderne Religionsmärkte zu werden drohen, je mehr alte christliche Anbieter durch neue religiöse Bewegungen und Sinnstifter unter Konkurrenzdruck geraten, desto entschiedener muß jeder einzelne Wettbewerber die überlegene Qualität seiner Angebote zur Schau stellen. Anders formuliert: Wie jedes andere Unternehmen müssen auch Religionskonzerne ihre „corporate identity“ pflegen, den eigenen Markennamen profilieren, die Qualität ihrer Güter und Dienstleistungen sichtbar machen. Genau dazu dient unter den Bedingungen des Pluralismus das neue Konfessionsbranding. Seit dem Erscheinen von Bergers Aufsatz vor gut vierzig Jahren hat sich in den USA eine eigene akademische Disziplin, eben die „Religious Economics“, entwickelt. Die von ihren profiliertesten Vertretern wie Roger Finke, Rodney Stark und Laurence Iannaccone entworfenen religionsökonomischen Deutungsmuster ermöglichen es, religiöse Wandlungsprozesse relativ präzise zu modellieren und das konkrete Reaktionsverhalten einzelner Akteure schlüssig nachzuzeichnen.2 Der prekäre diagnostische Nachteil klassischer 2 Finke, Roger/Stark, Rodney: The Churching of America, 1776-1990. Winners and Losers in 2 Interpretationskonstrukte im Stil der Säkularisierungsthese lag darin, daß sie die religiösen Organisationen und Institutionen lediglich als passive Opfer diffuser gesellschaftlicher Megatrends wie „Entkirchlichung“, „Verwissenschaftlichung“, „Konsumismus“ oder „Hedonismus“ in den Blick nahmen. Gerade diese Vorstellung aber ist in den analytisch kühlen Begriffen und erschließungsstarken Sprachspielen der Religionsökonomie als modernisierungstheoretisches Dogma destruiert worden. Denn religiöse Akteure reagieren auf sich ändernde Rahmenbedingungen und steigende Konsumentenautonomie höchst unterschiedlich. Das Spektrum ihrer Verhaltensmuster reicht von theologisch induzierter Wahrnehmungsresistenz und notorischer Selbstveränderungsverweigerung bis hin zu professionalisierter Welt- und Selbstbeobachtung, die sich häufig mit der Bereitschaft verbindet, Anpassungsflexibilität zu entwickeln und kundenorientiert zu handeln, beispielsweise semantische Umschaltprozesse gezielt zu forcieren und Rezeptionsblockaden abzubauen. So war etwa der Umgang der römischkatholischen Kirche mit dem Begriff der „Menschenrechte“ noch um die Mitte des 20. Jahrhunderts von polemischen Ausfällen gegen liberalistische Zeitgeistverirrungen und ein falsches anthropozentrisches Autonomieverständnis geprägt. Nur wenige Jahrzehnte später aber setzt sich eben diese Institution in bioethischen Diskursgremien ganz selbstverständlich als berufene Hüterin der wahren Rechte des Menschen in Szene. Manche Kirchen haben also auf die Traumata der – zumal im „langen“ 19. Jahrhundert – krisenhaft erlittenen Modernisierung bemerkenswert intelligent reagiert. Fern verschwommener Konsensrhetorik haben sie Strategiekonzepte entwickelt und Our Religious Economy, New Brunswick 1992; Iannaccone, Laurence R.: Introduction to the Economics of Religion, in: Journal of Economic Literature 36 (1998), 1465-1495. 3 umzusetzen vermocht, die inmitten eskalierender Unübersichtlichkeit das Angebot verläßlicher Orientierung und starker Identitätssicherung mit werbend suggestiver Kraft präsentieren. Diese ganz unterschiedlichen Verhaltensmuster im Umgang mit externen wie internen Status-quo-Bedrohungen und Pluralisierungsschüben differenzierter erfassen und nachzeichnen zu können, zählt zu den großen Stärken der Religionsökonomie. Mit ihrer Ausrichtung auf die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage aber gelingt es ihr auch, die immer wieder frappierenden religionskulturellen Unterschiede im Vergleich der nordamerikanischen und europäischen Religionslandschaften zumindest in wichtigen Aspekten plausibel zu deuten. In wie weit diese religionsökonomischen Prozesse zugleich im Zuge ihrer Beschreibung sozialkonstruktivistisch generiert oder etabliert werden, soll hier undiskutiert bleiben. 2. Herausforderungen der Persönlichkeit: pontifex maximus e sede litterarum Benedikt XVI. wird nur gerecht, wer das theologische Programm des Dogmatikprofessors Joseph Ratzinger ernst nimmt. Nie zuvor in der neueren Christentumsgeschichte ist ein vergleichbar brillanter Theologenintellektueller auf die cathedra Petri gelangt. Sein thematisch weit gespanntes theologisches Œuvre ist von hoher innerer Kontinuität und faszinierender gedanklicher Stringenz geprägt. Außergewöhnliche ideenhistorische Bildung verband sich schon in der Dissertation über „Augustins Lehre von der Kirche“ mit dem Interesse am prägnanten, distinktionsstarken dogmatischen Begriff. Früh entwickelte Ratzinger eine kritische Sicht der modernen pluralistischen 4 Beliebigkeitskultur und der vielfältigen Pathologien einer offenen Gesellschaft, die eines integrativen Ethos entbehrt. In engem Zusammenhang mit seinen Zeitdiagnosen entfaltete er eine Theorie der starken Kirche als Hüterin wahrer Humanität. Obgleich viele seiner deutschsprachigen Fachkollegen ihn bald als starrsinnigen Hardliner und unbelehrbaren Glaubenswächter kritisierten, war er genau gelesen ein hörbereiter, dialogischer Denker. Bemerkenswerte Rezeptionsbereitschaft und sensible Nachdenklichkeit hat Ratzinger gerade mit Blick auf die deutschsprachige protestantische Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts bewiesen. Seine Aufsätze und Bücher lassen Spuren intensiver Auseinandersetzung mit Ernst Troeltsch, Karl Barth, Rudolf Bultmann und Wolfhart Pannenberg erkennen. Gerade wegen seiner Hochschätzung protestantischer Universitätstheologie leidet auch Ratzinger unter dem Verfall der evangelischen Kirchentümer in Deutschland. Im Münchner Gespräch mit Jürgen Habermas hat der Präfekt der Glaubenskongregation im Januar 2004 noch einmal das Grundproblem der europäischen Geistesgeschichte entfaltet, das Verhältnis von fides et ratio. Glaube und Vernunft ordnet Ratzinger einander in einem Modell wechselseitiger Begrenzung zu. Mit den Frankfurter Meisterdenkern einer „Dialektik der Aufklärung“ führt er die antiliberalen, totalitären Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts auf den Monomythos einer sich selbst verabsolutierenden Zweckrationalität zurück. Wo die Vernunft sich keiner konstitutiven Grenzen bewußt bleibe, schlage sie in zerstörerische Allmachtsphantasien um. Ob der sich autonomisierenden Erkenntnisdynamik der modernen Wissenschaften und ihrer zerstörerischen Potenzen, von der Atomwaffe bis hin zu Menschenpark5 Projekten einer biotechnischen Selbsterschaffung des endlich neuen Menschen, hält Ratzinger die Kantianische Konzeption einer kritizistischen Selbstbegrenzung der modernen Vernunft für gescheitert. Nur religiöser Glaube könne dank seines konstitutiven Bezugs auf Gott ethisch relevante Grenzen des „Moderne-Projekts“ rein rationaler Selbst- und Weltentwürfe des Menschen markieren. Aufklärungsbelesen betont Ratzinger zugleich die hohe Ambivalenz des religiösen Bewußtseins, das in mehr oder minder subtiler symbolischer Selbstgleichschaltung mit Gott seinerseits sündhafte Omnipotenzlust zu kultivieren und in Fanatismus, Intoleranz oder gar in gewalttätigen Terror umzuschlagen drohe. Ratzinger will zugleich die Vernunft durch die Religion begrenzen und den christlichen Glauben durch die Vernunft vor religionsideologischer Selbstverabsolutierung bewahren. Nur dank innerer Klarheit, Vernünftigkeit könne der recht verstandene, zur Einsicht in seine Grenzen fähige christliche Glaube dramatisch bedrohte Humanität stützen. Einst von der römischen Kirche vehement abgelehnte „Menschenrechte“ deutet er als Konkretionen der Ebenbildlichkeit Gottes. In diesem Interpretationsprogramm steckt auch der steile Anspruch, daß letztlich nur der Kirche eine zureichende Deutungskompetenz über die Rechte des Menschen eigne. Mit seiner „Korrelationsmethode“ (P. Tillich) kann Ratzinger der kulturellen Partikularität des okzidentalen Rationalismus ebenso gerecht werden wie der religionskulturellen de-facto-Relativität der christlichen Kirchen. Präziser als andere deutschsprachige katholische Dogmatiker seiner Generation hat er sich an den harten kognitiven Problemen des überkommenen christlichen 6 Wahrheitsanspruchs abgearbeitet. Wo manche katholische Gelehrte die Vielfalt je eigener religiös grundierter Moralkulturen ignorieren und die Menschheit überhaupt mit ihrem artifiziell abstrakten Welteinheitsethos beglücken wollen (was Andersdenkende nur als wohlmeinende Unterdrückung erleiden können), setzt Ratzinger auf die Anerkennung faktischer Differenzen, so daß er interkulturelle Dialoge zu intensivieren verlangt. Essentialistische Stereotypen antagonistischer Religionskulturräume, etwa im Sinne Huntingtons, dekonstruiert er mit dem Hinweis darauf, „daß alle kulturellen Räume durch tiefgreifende Spannungen innerhalb ihrer eigenen kulturellen Tradition geprägt sind“. Die römisch-katholische Weltkirche sieht er in ihren pluralen religiöskulturellen Umwelten deshalb mit je eigenen Wertkonflikten konfrontiert. Gerade deshalb gibt er der klaren, verbindlichen Lehre der Kirche auch in moralischen Fragen ein so hohes Gewicht. Nur durch prägnant definierte Identität, durch einen klaren ekklesiologischen Begriff ihrer selbst, könne die römisch-katholische Kirche verhindern, in den vielfältigen Interaktionen innerhalb divergenter Kulturen in ein Ensemble mehr oder minder katholischer „Ortskirchen“ auseinanderzufallen. Im klaren Gegensatz zu Walter Kardinal Kasper hat Ratzinger der römischen „Gesamtkirche“ konsequent eine ontologische wie temporale Priorität vor jeder einzelnen „Teilkirche“ zuerkannt. In seinen zahlreichen Texten zur Amtstheologie des Papsttums, die nun den Charakter antizipierter Selbstreflexionen gewonnen haben, hat Ratzinger gern die unaufhebbare Widersprüchlichkeit der Primatsidee betont. Gerade der ideale Repräsentant der Einheit wirkt faktisch kirchenspaltend. Insoweit kann ein protestantischer Theologe Benedikt XVI. nur an die Einsicht des Regensburger Dogmatikprofessors Joseph Ratzinger erinnern: „Für das 7 Papsttum und die katholische Kirche bleibt die Papsttumskritik der nichtkatholischen Christenheit ein Stachel, eine immer christusgemäßere Verwirklichung des Petrusdienstes zu suchen“. Im Land der Reformation hat der Präfekt der Glaubenskongregation vor allem mit der Erklärung „Dominus Jesus“ vom 6. August 2000 Ärgernis erregt. Die vehement geführte Debatte hat begrüßenswerte theologische Klarheit befördert. Zwar können einzelne Getaufte anderer Konfessionen als „Brüder“ und „Schwestern“ angeredet werden. In einer höchst modernen Institutionentheorie hat das Lehramt jedoch zugleich darauf insistiert, daß die eine Kirche Jesu Christi allein in der römisch-katholischen Kirche „subsistiert“. Bedeutet dies eine Zweiklassen-Ekklesiologie, derzufolge die Christen in den nicht-römischen „kirchlichen Gemeinschaften“ erst dann wieder Glieder der wahren Kirche sind, wenn sie den Primat des Papstes anerkennen, das römisch-katholische Amtsverständnis teilen und die Eucharistie nur so empfangen, wie das Lehramt dies vorschreibt? Viele reformerische römischkatholische Theologen haben diese Frage damals bejaht und Ratzinger eine klerikalarrogante Herabsetzung der leider getrennten protestantischen „Geschwister“ vorgeworfen. Nicht wenige protestantische Universitätstheologen haben genau umgekehrt argumentiert und Ratzinger für wohltuende Präzision im ökumenischen Diskurs gedankt. Ratzinger ist kein Antiökumeniker, sondern genau umgekehrt ein offensiver Theoretiker ökumenischer Differenzhermeneutik. Er will die theologischen Unterschiede zwischen der römischen (in seiner Sprache: allein katholischen) Kirche und den aus der Reformation hervorgegangenen „kirchlichen Gemeinschaften“ möglichst scharf 8 und präzise benennen, weil nur im harten Ringen um die Wahrheit sich Chancen möglicher konstruktiver Verständigung eröffnen. In einem Glückwunschbrief an den Tübinger protestantischen Dogmatiker Eberhard Jüngel schrieb Joseph Kardinal Ratzinger: „Mitten in den Versuchungen des Relativismus haben Sie nachdrücklich das Bekenntnis zum Dominus Iesus in seiner ganzen Größe lebendig gehalten. Mit allem haben Sie auch einen entscheidenden ökumenischen Dienst geleistet, denn am Ende kann uns nur das Stehen zum 1. Gebot und das unverrückbare Bekenntnis zum Herrsein Jesu Christi miteinander verbinden. Daß Sie dabei auch kontrovers das protestantische Erbe im Gegenüber zur katholischen Kirche verteidigt und eilfertige Harmonisierungen abgewiesen haben, sehe ich im letzten auch als einen Beitrag zur wirklichen Einheit an. Denn darin drückt sich nicht nur Ihre Treue zu dem Erbe aus, von dem her Sie in den Glauben hineingeführt worden sind, sondern auch der Ernst des Ringens um die Wahrheit.“ So schreibt kein Gegner ökumenischer Gespräche, sondern ein seriositätsbesessener Denker, der andere ernst nimmt, indem er argumentativen Streit um den theologischen Begriff verlogenen Konsensritualen vorzieht. Mit hoher Prägnanz hat er die ekklesiologische Alternative bezeichnet, um die es im Kern geht: Entweder existiert die eine Kirche Jesu Christi in einer legitimen Vielfalt sichtbarer Konfessionskirchen, so daß Einheit allein spirituell, als Prädikat der ecclesia invisibilis zu denken ist. Oder die Einheit muß empirisch gedacht, also strikt auf Rom bezogen werden. In der Entfaltung des römischen Exklusivitätspostulats hat sich Ratzinger allerdings in tiefe Widersprüche verwickelt. Der Wahrheitsanspruch des 9 kirchlichen Dogmas läßt sich dogmatisch nur im Rahmen der Offenbarungslehre und ethisch nur über eine Theorie des Naturrechts als lex divina begründen. Wieso dem römischen Lehramt hier eine qualitativ eigene Wissensnähe zu Gott zukommen soll, derer die Christen in den nicht-römischen Kirchen entbehren, begründet Ratzinger häufig durch amtstheologische Argumente, mit zirkulärer Selbstreferenzialität. Intellektuelle Fairneß gebietet den Hinweis, daß der Theologenintellektuelle Ratzinger hier selbst Probleme sieht, die ein Präfekt der Glaubenskongregation und nun ein Papst nur um den Preis einer - in römischer Perspektive – fatal protestantisch wirkenden Spiritualisierung des Kirchenverständnisses eingestehen könnte. Ob hier Beschwörungsformeln wie „gesetzt als nicht-gesetzt, unverfügbar“ weiterhelfen? Oder hat der Präfekt der Glaubenskongregation, der kraft Amtes die Grenzen des kirchlich legitimen Diskurses definieren soll, hier implizit eine Politik der Diskursöffnung vorgeschlagen und sich als Reformer in mancherlei Moralfragen positioniert? Man wird bei der Beantwortung dieser Frage seine erste Enzyklika nicht außer Acht lassen können. 3. cum caritate coniuncta: Liebe vs. Li(e)beralismus Deus caritas est ist neben "Einführung" und "Schluß" wesentlich in zwei Hauptteile gegliedert: Einen ersten Teil über "Die Einheit der Liebe in Schöpfung und Heilsgeschichte" sowie den zweiten Teil über "Caritas – Das Liebestun der Kirche als einer 'Gemeinschaft der Liebe'". Beide Hauptteile gewinnen jeweils durch Zwischenüberschriften Struktur, in denen die einzelnen, numerierten Absätze zu thematischen Blöcken zusammengefaßt werden. Über das Verhältnis der "beiden großen, eng miteinander verbundenen 1 0 Teile" der Enzyklika gibt eine ihnen vorangestellte "Einführung" (1) Auskunft: "Der erste (scil. Teil) wird einen mehr spekulativen Charakter haben, da ich beabsichtige, darin (...) einige wesentliche Punkte über die Liebe, die Gott dem Menschen in geheimnisvoller Weise und völlig vorleistungsfrei anbietet, zu klären und zugleich die innere Verbindung zwischen dieser Liebe Gottes und der Realität des menschlichen Lebens aufzuzeigen. Der zweite Teil wird konkreterer Natur sein, denn er soll die kirchliche praktische Umsetzung des Gebotes der Nächstenliebe behandeln" (1). Der Heilige Vater möchte zur Intensivierung kirchlicher Caritas beitragen: "Mein Wunsch ist es, auf einige grundlegende Elemente nachdrücklich einzugehen, um so in der Welt eine neue Lebendigkeit wachzurufen in der praktischen Antwort der Menschen auf die göttliche Liebe" (1). Der zweite Teil ist in sechs Themengruppen gegliedert: "Das Liebestun der Kirche als Ausdruck der trinitarischen Liebe" (19), "Das Liebestun als Auftrag der Kirche" (20-25), "Gerechtigkeit und Liebe" (26-29), "Die vielfältigen Strukturen des Liebesdienstes im heutigen sozialen Umfeld" (30), "Das spezifische Profil der kirchlichen Liebestätigkeit" (31) sowie "Die Träger des karitativen Handelns der Kirche" (32-39). Schon dieser Aufbau läßt erkennen, daß hier entschieden von der Kirche her gedacht wird. Für den Heiligen Vater ist Nächstenliebe zunächst innerhalb der Kirche "als Gottes Familie in der Welt" geboten (25a). "In dieser Familie darf es keine Notleidenden geben." (25a) "Innerhalb der Gemeinschaft der Kirche darf es keine Armut derart geben, daß jemandem die für ein menschenwürdiges Leben nötigen Güter versagt bleiben." (20) Zwar betont Benedikt in einem zweiten Schritt auch die 1 1 Allgemeinheit des Liebesgebots, das "die Grenzen der Kirche" überschreite (25b). Aber dem nach innen gerichteten, kirchenfamiliären Liebesdienst erkennt er einen Vorrang zu: "Unbeschadet dieser Universalität des Liebesgebots gibt es aber doch einen spezifisch kirchlichen Auftrag - eben den, daß in der Kirche selbst als einer Familie kein Kind Not leiden darf" (25b). Kirchliche oder kirchennahe Sozialdienstleister agieren europaweit faktisch auf einem hochdifferenzierten Sozialmarkt, in dem zahlreiche gewinnorientierte, entschieden weltliche Anbieter genau dieselben Assistenzdienstleistungen wie "Caritas" und "Diakonie" anbieten. Der Heilige Vater kommt auf diese Konkurrenzsituation indirekt zu sprechen, indem er "das spezifische Profil der kirchlichen Liebestätigkeit" zu schärfen versucht (31). Daß sozialkaritative Angebote und Assistenzdienstleistungen auch von nicht-kirchlichen, "weltlichen" Unternehmen erbracht werden, sucht er mit einer höchst traditionellen naturrechtlichen Reflexionsfigur zu deuten: "Das Zunehmen vielfältiger Organisationen, die sich um den Menschen in seinen verschiedenen Nöten mühen, erklärt sich letztlich daraus, daß der Imperativ der Nächstenliebe vom Schöpfer in die Natur des Menschen selbst eingeschrieben ist. Es ist aber auch ein Ergebnis der Gegenwart des Christentums in der Welt, die diesen in der Geschichte oft tief verdunkelten Imperativ immer wieder weckt und zur Wirkung bringt. (...) In diesem Sinn reicht die Kraft des Christentums weit über die Grenzen des christlichen Glaubens hinaus. Um so wichtiger ist es, daß das kirchliche Liebeshandeln seine volle Leuchtkraft behält und nicht einfach als eine Variante im allgemeinen Wohlfahrtswesen aufgeht." (31) Auf einem konkurrenzbestimmten Sozialmarkt will Benedikt die – im 1 2 Management-Deutsch formuliert – 'Sichtbarkeit' und Identität katholischer Anbieter durch entschieden geistliche Profilierung stärken. Er setzt auf neue Rückbindung von Caritas-Organisationen an die Kirche, die Reklerikalisierung relativ autonomer Caritas-Dienstleister, um ihre (römisch-)katholische Bindung sichtbar zu machen. Zugleich werden die hier Mitarbeitenden an ihre Treuepflicht gegenüber den Bischöfen erinnert und ihnen in neuer Gebotsintensität die Pflichten eines dezidiert geistlichen Lebenswandels im Zeichen von ora et labora eingeschärft. "Es ist Zeit, angesichts des Aktivismus und des drohenden Säkularismus vieler in der karitativen Arbeit beschäftigter Christen die Bedeutung des Gebetes erneut zu bekräftigen." (37) Benedikt bemüht hier den alten Kampfbegriff "Säkularismus" nicht etwa zur Bezeichnung einer gottvergessenen Mentalität außerhalb der Kirche. Vielmehr sieht er "viele" in Caritas-Unternehmen tätige Menschen von "Säkularismus", also von Glaubensverlust oder Abfall vom Glauben bedroht. Mit seiner Enzyklika will er den in Caritas-Organisationen Mitarbeitenden ihre Glaubenspflicht verdeutlichen; konkret sollen sie vor allem wieder mehr beten. Auch fordert er mehr aktiv gelebte Kirchlichkeit und Gehorsam gegenüber dem jeweiligen Bischof: "Wer Christus liebt, liebt die Kirche und will, daß sie immer mehr Ausdruck und Organ seiner Liebe sei. Der Mitarbeiter jeder katholischen karitativen Organisation will mit der Kirche und daher mit dem Bischof dafür arbeiten, daß sich die Liebe Gottes in der Welt ausbreitet (...)" (33). Es ist nur konsequent, daß der Heilige Vater die professionsspezifischen Fähigkeiten von Caritas-Mitarbeitern nicht allein als "berufliche", sondern zugleich als spirituelle, geistliche Kompetenz beschreibt. "Die Helfer müssen so ausgebildet sein, daß sie das Rechte auf rechte Weise tun und dann für die weitere 1 3 Betreuung Sorge tragen können. Berufliche Kompetenz ist eine erste, grundlegende Notwendigkeit, aber sie allein genügt nicht. Es geht ja um Menschen, und Menschen brauchen immer mehr als eine bloß technisch richtige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie brauchen die Zuwendung des Herzens. Für alle, die in den karitativen Organisationen der Kirche tätig sind, muß es kennzeichnend sein, daß sie nicht bloß auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, sondern sich dem anderen mit dem Herzen zuwenden, so daß dieser ihre menschliche Güte zu spüren bekommt. Deswegen brauchen diese Helfer neben und mit der beruflichen Bildung vor allem Herzensbildung: Sie müssen zu jener Begegnung mit Gott in Christus geführt werden, die in ihnen die Liebe weckt und ihnen das Herz für den Nächsten öffnet, so daß Nächstenliebe für sie nicht mehr ein sozusagen von außen auferlegtes Gebot ist, sondern Folge ihres Glaubens, der in der Liebe wirksam wird (vgl. Gal 5,6)." (31) Dieser Begriff der "Herzensbildung" wird theologisch im "Programm Jesu" verankert, der im Unterschied zu allen weltlichen Sozialutopien und Ideologien allein das "sehende Herz" gewollt habe (31). Wie auch immer man solche "Herzensbildung" näher verstehen mag – Benedikt will die karitativen Berufe als kirchliche Professionen verstanden wissen; "Sozialdienst" ist für ihn ein "zugleich durchaus geistlicher Dienst", "wirklich geistliches Amt" (21). Mehr Spiritualität und Gebetspraxis werden eingeklagt. In dieser Kirchenperspektive können die harten ökonomischen Realitäten, mit denen sich kirchliche oder kirchennahe Sozialdienstleister auf konkurrenzbestimmten Sozialmärkten konfrontiert sehen, gar nicht erst in den Blick kommen. In einer Art papaler Verdachtshermeneutik führt Benedikt die 1 4 vielfach zu beobachtenden Krisenphänomene katholischer Sozialdiakonie auf die mangelnde Frömmigkeit der hier Beschäftigten zurück. Mit seinen Glaubensappellen und Gebetsrufen schreibt er faktisch nur die religiös induzierte Realitätsferne und Ökonomievergessenheit vieler kirchlicher Diakonie-Diskurse fort. Die derzeit entscheidenden Fragen werden gar nicht erst gestellt: Wie lassen sich unter den Bedingungen harter Anbieterkonkurrenz etablierte Standards von Assistenz sichern? Wie läßt sich sozialpaternalistische Bevormundung der Hilfeempfänger durch die Helfenden vermeiden? Wie können im Rahmen gemeinnütziger Organisationsstrukturen hinreichende Mittel für gebotene Investitionen erwirtschaftet, also Gewinne gemacht werden? Wie läßt sich die Leistungskraft christlich geprägter Sozialunternehmen stärken? In den Leitbildprozessen katholischer Sozialdienstleister vermag Deus caritas est schon deshalb keine konstruktive Orientierungskraft zu entfalten, weil die soziale Umwelt dieser Organisationen und Unternehmen nur äußerst reduziert in den Blick kommt. So steht zu befürchten, daß Deus caritas est in den Selbstverständigungsprozessen der diversen Sozialkatholizismen eher eine desorientierende, zerstörerische Wirkung entfalten wird: als hilfloser Versuch, der harten Logik eines konkurrenzbestimmten Sozialmarktes mit dem autoritativen Appell an die Gesinnung der in katholischen Sozialunternehmen Arbeitenden zu begegnen; als ein Versuch, der immer nur in kontraproduktiver Überforderung von Menschen3 enden kann, die "die Kirche" doch braucht, will sie "das Licht Gottes in die Welt einlassen" (39). 3 Karl Kardinal Lehmann geht hingegen davon aus, daß die "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vielfältigen Caritas" durch die Enzyklika "ermutigt" werden (Lehmann, K., a.a.O., 137). 1 5 Karl Kardinal Lehmann hat in seiner Würdigung von Deus caritas est den wohl umfangreichsten Absatz 28 über die "gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates" als besonders gelungen bezeichnet. "Der Unterschied und die Bezogenheit von Politik und Glaube aufeinander werden aufgezeigt. (...) Hier kommt es zu guten Formulierungen über die Aufgabe der Kirche in Politik und sozialer Gestaltung der Gesellschaft".4 Auch in Fragen politischer Ethik argumentiert Benedikt XVI. entschieden traditionsorientiert. Die spezifisch katholische Vision einer idealen Ordnung menschlichen Zusammenlebens entfaltet er in scharfer Abgrenzung vom Marxismus. Von "der christlichen Staats- und Soziallehre" sei immer betont worden, "daß das Grundprinzip des Staates die Verfolgung der Gerechtigkeit sein muß und daß es das Ziel einer gerechten Gesellschaftsordnung bildet, unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips jedem seinen Anteil an den Gütern der Gemeinschaft zu gewährleisten" (26). Gerechtigkeitssemantik durchzieht den gesamten Hauptteil des Textes. Gerechtigkeit dient insbesondere als Leitbegriff zur Ordnung der komplexen Beziehungen zwischen Glaube und Politik, Kirche und Staat. Desto mehr fällt auf, daß der so zentrale Begriff nirgends prägnant bestimmt wird. "Die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates ist zentraler Auftrag der Politik." (28a) Denn für das Christentum sei die Unterscheidung von Staat und Kirche oder, wie die Enzyklika im Zitat der Pastoralkonstitution Gaudium et spes betont, die Anerkenntnis einer "Autonomie des weltlichen Bereichs" 4 Lehmann, K., a.a.O., 132f. 1 6 grundlegend. Doch so entschieden die Definitionsmacht über "das Gerechte" zunächst der "praktischen Vernunft" zugewiesen wird, so sehr wird auch eine Mitauslegungskompetenz der Kirche geltend gemacht. "Was ist Gerechtigkeit? Das ist eine Frage der praktischen Vernunft; aber damit die Vernunft recht funktionieren kann, muß sie immer wieder gereinigt werden, denn ihre ethische Erblindung durch das Obsiegen des Interesses und der Macht, die die Vernunft blenden, ist eine nie ganz zu bannende Gefahr." (28a) Eigene Beachtung verdient die Metaphorik der "ethischen Erblindung": Interesse und Macht können die Vernunft so stark blenden, daß sie ethisch wahrnehmungsgestört, unterscheidungsunfähig wird. Deshalb bedarf die Vernunft der "Reinigung". Wann genau diese Reinigungsmetaphorik in offizielle Texte des Vatikans Eingang gefunden hat, wäre noch näher zu untersuchen; in seinen eigenen theologischen wie kirchenpolitischen Publikationen machte der Präfekt der Glaubenskongregation von ihr in den letzten Jahren einen so intensiven Gebrauch, daß seine Textteppiche bisweilen als von Reinigungsphantasmen durchwebt erschienen. Als Instanz der Reinigung der Vernunft galt in Joseph Kardinal Ratzingers theologischen Publikationen naturgemäß der Glaube. Auch in seiner ErstEnzyklika erkennt Benedikt XVI. dem Glauben und speziell der "Katholischen Soziallehre" Mandat und Kraft zu, die Vernunft zu reinigen. "Der Glaube (...) ist zugleich auch eine reinigende Kraft für die Vernunft selbst. Er befreit sie von der Perspektive Gottes her von ihren Verblendungen und hilft ihr deshalb, besser sie selbst zu sein. Er ermöglicht der Vernunft, ihr eigenes Werk besser zu tun und das ihr Eigene besser zu sehen. Genau hier ist der Ort der 1 7 Katholischen Soziallehre anzusetzen: Sie will nicht der Kirche Macht über den Staat verschaffen; sie will auch nicht Einsichten und Verhaltensweisen, die dem Glauben zugehören, denen aufdrängen, die diesen Glauben nicht teilen. Sie will schlicht zur Reinigung der Vernunft beitragen und dazu helfen, daß das, was recht ist, jetzt und hier erkannt und dann auch durchgeführt werden kann." (28a) Für diese Orientierungskraft oder Reinigungskompetenz der "Soziallehre der Kirche" – ausdrücklich verweist der Papst auf das neue Kompendium5 – wird schon im folgenden Satz auf "Vernunft und Naturrecht" rekurriert: "Die Soziallehre der Kirche argumentiert von der Vernunft und vom Naturrecht her, das heißt von dem aus, was allen Menschen wesensgemäß ist." Im nächsten Absatz wird erneut das Bild gebotener "Reinigung" bemüht: "Es hat sich gezeigt, daß der Aufbau gerechter Strukturen nicht unmittelbar Auftrag der Kirche ist, sondern der Ordnung der Politik – dem Bereich der selbstverantwortlichen Vernunft – zugehört. Die Kirche hat dabei eine mittelbare Aufgabe insofern, als ihr zukommt, zur Reinigung der Vernunft und zur Weckung der sittlichen Kräfte beizutragen, ohne die rechte Strukturen weder gebaut werden noch auf Dauer wirksam sein können." (29) Trotz der Rede von "der Autonomie des weltlichen Bereichs" oder der Qualifizierung der praktischen Vernunft als "selbstverantwortlich" soll die Vernunft nur durch den Glauben (bzw. die "Soziallehre der Kirche") davor geschützt werden können, angesichts der Übermacht von Interessen zu erblinden. Insoweit bleibt die Vernunft um ihrer Reinheit willen abhängig von der Orientierungskraft des Glaubens und "der Kirche". Das von Joseph Kardinal Ratzinger in den letzten Jahren immer wieder empfohlene komplexe Korrelationsmodell von Glaube und 5 Päpstlicher Rat "Justitia et Pax" (Hg.), Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg, 2006. 1 8 Vernunft6 ist in der ersten Enzyklika des Papstes nun sozialethisch konkretisiert worden. Die dem Glauben der Kirche zugeschriebene vernunftfördernde Reinigungskraft setzt allerdings voraus, daß "die Kirche" als Institution jenen "Verblendungen" durch Machtfixierung oder Selbstinteresse nicht zu unterliegen vermag, von denen sie die "praktische Vernunft" zu reinigen intendiert. Doch üben Päpste keine mehr oder minder symbolische Macht aus? Verfolgt die Kirche als Institution keinerlei Interessen? Sind ihr alle weltlichen Versuchungen immer schon wesensfremd? Ist nur ihr eine fortwährend reine, verblendungsresistente praktische Vernunft erschlossen? Weiß sie über das behauptete "Naturrecht" prinzipiell mehr zu sagen als andere Akteure? Das Korrelationsmodell von Deus caritas est spiegelt ein Selbstverständnis des römisch-katholischen Lehramtes, in dem "der Kirche" immer schon eine implizite moralische Prärogative im Kampf gegen die "Verunreinigungen" der politischen Vernunft eignet. Insofern bleibt Benedikt XVI. sehr viel stärker als seine Autonomie-der-Welt-Rhetorik suggeriert den römisch-katholischen Überlieferungen einer potestas indirecta der Kirche in den politischen Arenen verpflichtet. Wolfgang Huber hat dies mit Blick auf das monomythische Vernunftkonzept gezeigt, an dem Benedikt XVI. trotz aller neueren Debatten um eine Vielfalt von Rationalitäten, aber in Fortschreibung idealistischer Einheitsvernunftsbegriffe ungebrochen festhält. Benedikt könne keine Selbstbegrenzung der in der "Katholischen Soziallehre" inkarnierten Vernunft denken. "Wenn demgegenüber jedoch Rationalität selbst einen pluralen Charakter hat, dann kann auch die in der katholischen Soziallehre enthaltene Rationalität nur eine unter vielen sein; und es kann gerade nicht im vornherein 6 Siehe beispielsweise Ratzinger, J.: Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen, Freiburg, 2005, bes. 38. 1 9 und für jeden Fall als sicher vorausgesetzt werden, daß sie mit anderen Perspektiven auf die Autonomie weltlicher Bereiche zur Deckung kommen oder für deren angemessene Deutung einen Alleinvertretungsanspruch geltend machen kann. Diesem unausweichlichen Deutungsstreit (...) scheint die Enzyklika so entgehen zu wollen, daß sie eine Reinigung der weltlichen Vernunft für notwendig erklärt, für die eine besondere Verantwortung der Kirche zu konstatieren ist. Gegenüber der Tradition einer Lehre von der potestas indirecta der Kirche in weltlichen Angelegenheiten aber ist dies (...) nur ein gradueller, nicht ein prinzipieller Unterschied – obwohl der Begriff der Autonomie zunächst etwas anderes nahe zu legen scheint."7 In der päpstlichen Reinigungsmetaphorik steckt trotz aller Demutsgesten viel moralische Arroganz. Weder vermag der Heilige Vater zu sagen, wo und wie, mit welchen Verfahren und Instrumenten "die Kirche" die intendierte Purifizierung der praktischen Vernunft empirisch vollzieht, noch kann er sich der pluralismuskompatiblen Einsicht öffnen, daß "die Kirche" im öffentlichen Diskurs über die ethischen Grenzen der politischen Vernunft bestenfalls ein Mandat neben anderen hat. Seine ideale Kirche "reinigt" andere, etwa Institutionen der politischen Vernunft, sagt aber nichts darüber aus, daß auch sie zur Vermeidung von Fehlentwicklungen institutionalisierter Religion immer neu der "Reinigung" bedarf. Insoweit bleibt Benedikts Argumentation einer spezifisch römisch-katholischen Asymmetrie, einer Überdetermination der Kirche verpflichtet. Dies dürfte auf Dauer sehr viel problematischer sein als die eklatante analytische Schwäche in den vagen Aussagen zur "Globalisierung" 7 Huber, W.: Reinigung der Liebe – Reinigung der Vernunft. Zur päpstlichen Enzyklika "Deus caritas est', in: Benedikt XVI, a.a.O., 97-111, hier 108. 2 0 oder die widersprüchlichen Beschreibungen der Rolle der "Laien" im politischen Prozeß der Durchsetzung besserer Gerechtigkeit. Denn unbeschadet seines polemischen Gebrauchs des Interessenbegriffs leitet Benedikt aus seinem Bild der starken Kirche als des idealen Subjekts personzentrierter Carität auch klare Forderungen nach staatlicher Unterstützung des kirchlichen Liebesdienstes ab: "Nicht den alles regelnden und beherrschenden Staat brauchen wir, sondern den Staat, der entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip großzügig die Initiativen anerkennt und unterstützt, die aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften aufsteigen und Spontaneität mit Nähe zu den hilfsbedürftigen Menschen verbinden." (28)8 Darf man dies auch als einen Reflex kirchlichen Selbstinteresses an staatlicher Alimentation kirchlich organisierter Caritas lesen? Dies ist, zugegebenermaßen, eine "typisch protestantische" Frage. Aber man muß sie stellen, im Interesse der Beförderung einer zunehmend europäisierten Zivilgesellschaft, die allen Assistenzbedürftigen effiziente soziale Dienstleistungen anzubieten vermag. Die legitimen Interessen der Bürger sind jedenfalls zu wichtig, um deren Deutung allein einer kirchlichen Institution zu überlassen, die sich traditionstreu eine exklusive Definitionsmacht über "das ganzheitliche Wohl des Menschen" (19) zuschreibt. "Das gemeine Wohl aller" gebietet es, daß auch alle mit gleicher Autorität an den Deutungskämpfen um beste Lösungen teilnehmen dürfen. Welch grundlegende Bedeutung nicht nur die Debatte als solche, sondern deren Aneignung über die konfrontationsorientierte Auslegung 8 Ein Vertreter der "Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände" erklärt dazu: "Diese Aussagen könnten gut als ordnungspolitisches Leitbild beim Angebot sozialer Dienstleistungen und der Schaffung der entsprechenden staatlichen Rahmenbedingungen dienen" (Enste, D. H., a.a.O., 8). 2 1 von Symbolbegriffen erlangen kann - auch weit über eine Vision Europas hinaus – zeigte ja nicht zuletzt der Streit um manche Äußerung zur Identitätsbestimmung in Abgrenzung vom Islam. 4. Graecia amissa! – Akademische Offenheit und Konkurrenzbewußtsein In der Regensburger Universität, der für ihn wichtigsten Station seines Professorenlebens, hatte Benedikt XVI. auf eigenen Wunsch noch einmal über sein wissenschaftliches Zentralthema, das Verhältnis von Glaube und Vernunft, reden und zugleich den Ort akademischer Theologie in der modernen Forschungsuniversität markieren wollen. Gerade die nun hinzugefügten Anmerkungen machen deutlich, daß der Redner weniger als Papst auftreten denn als Systematischer Theologe sein individuelles theologisches Programm bündeln wollte. Der Autor schlägt selbst den Bogen zur Bonner Antrittsvorlesung von 1959 über „Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis“. Auch zitiert er sein als Präfekt der Glaubenskongregation geschriebenes Buch „Der Geist der Liturgie“ und betont die Kontinuität zur erstmals 1968 erschienenen „Einführung in das Christentum“. Nicht ohne Anflüge von Intellektuelleneitelkeit teilt Benedikt zum wohl populärsten Ratzinger-Buch mit: „Ich denke, daß das dort Gesagte trotz der weitergegangenen Diskussion nach wie vor sachgemäß ist“. Muß selbst ein Papst noch für seine Bücher werben? Der Heilige Vater will sichtlich akademische Kompetenz demonstrieren. Den fiktionalen Dialog des byzantinischen Kaisers Manuel II. Palaeologos mit einem 2 2 „gebildeten Perser“ hatte der Regensburger Redner nach einer philologisch nicht unumstrittenen Teiledition des mit ihm seit Münsteraner Tagen verbundenen Islamforschers Adel Theodor Khoury zitiert. Nun werden auch zwei neuere Editionen genannt. Zur berühmten Sure 2,256 „Kein Zwang in Glaubenssachen“ hatte der Redner erklärt, daß „die Kenner sagen“, sie sei „eine der frühen Suren aus der Zeit, in der Mohammed selbst noch machtlos und bedroht war“. Nun ist es „wohl eine der frühen Suren“, und dies sagt nur noch „ein Teil der Kenner“. Die Fähigkeit zu subtiler Abschwächung des ursprünglich Gesagten bekunden noch diverse andere kleinere Texteingriffe. Für den Redner hatte Palaeologos seine Kritik, der Islam biete „nur Schlechtes und Inhumanes“ und wolle den Prophetenglauben „durch das Schwert“ verbreiten, „in erstaunlich schroffer, uns überraschend schroffer Form“ geäußert. In der definitiven Druckfassung spricht der Papst nun von „uns unannehmbar schroffer Form“. Auch betont er in einer eigenen Anmerkung, daß er sich Palaeologos’ Fundamentalkritik des Islam nicht zu eigen mache, sondern seine Regensburger Hörer „einzig ... auf den wesentlichen Zusammenhang zwischen Glauben und Vernunft hinzuführen“ gedachte. Noch immer liest man freilich, daß der Kaiser in seiner Mohammed-Kritik „zugeschlagen hat“. Man mag darüber streiten, ob Gelehrte so reden sollten. Denn Kampfmetaphern dürften wenig hilfreich sein, zum theologisch äußerst anspruchsvollen Thema von Glaube und Vernunft „hinzuführen“. Gewalttätige Proteste muslimischer Akteure und der besonnene „Offene Brief“ prominenter Imame, Muftis und Religionsgelehrter haben in der deutschen Öffentlichkeit den Eindruck verstärkt, es sei in Regensburg vor allem um eine 2 3 Positionsbestimmung der Papstkirche gegenüber einem in Teilen auch gewalttätigen Islam gegangen. Benedikt selbst aber konzentriert sich primär auf die Verhältnisbestimmung von „Glaube und Vernunft“. Vier aktuellen theologischen Diskursen gilt die besondere Aufmerksamkeit des Systematikers auf dem Petrusstuhl: wahres Wesen Gottes, wahres Konzept der Theologie, wahrer Begriff der Vernunft, wahre Sozialgestalt des Christentums. Es geht, prononciert gesagt, in der Regensburger Rede sehr viel mehr um Gottesbild und falsche Religion, Wissenschaft und deutsche Universität, Europa und das Christentum sowie Inkulturation und neue, außereuropäische Formen des Christentums als um den Islam. Der Regensburger Redner formuliert hier jeweils prägnante, harte Abgrenzungen, geleitet von klar erkennbaren kulturund religionspolitischen Intentionen. Mit faszinierender gedanklicher Konsequenz steuert er auf seinen Zielpunkt zu: Das Christentum sei essentiell an griechisches Vernunftdenken, hellenistische Metaphysik gebunden, und deshalb seien viele neue außereuropäische Entwicklungsformen des Christentums kirchlich unausweichlich illegitim. Dem Islam unterstellt der Papst, wenig überzeugend, Gott rein als abstrakt transzendenten Willen aufzufassen. Gegenüber diesem „Willkürgott“ müsse der wahre Gott, der dreieinige Gott der Christen, als liebendes Vernunftwesen gedacht werden, ganz im Sinne des Prologs zum Johannesevangelium, der „das abschließende Wort des biblischen Gottesbegriffs“ biete: Am Anfang war die Vernunft. Die notwendige, wesensmäßige Bindung des christlichen Glaubens an den Logos-Gott erläutert Benedikt näher mit Begriffen der klassischen Analogielehre, daß es zwischen Gottes ewigem Schöpfergeist und 2 4 unserer geschaffenen Vernunft Ähnlichkeiten gebe, die uns Gott zu erkennen erlaubten. Schon bei einzelnen Theologen im alteuropäischen Spätmittelalter sah Ratzinger und sieht der Papst allerdings genau jenes voluntaristische Gottesbild vertreten, das er dem Islam zuschreibt. Vor allem bei Duns Scotus lokalisiert er den theologischen Ursprung einer „Enthellenisierung“ des Christentums, die er dann in der Reformation, der Philosophie Kants und den liberalprotestantischen Theologien seit der Aufklärung vertreten sieht. Es ist kein Zufall, daß er gerade hier, in der kritischen Absage an den kulturprotestantischen Kirchenhistoriker Adolf von Harnack, auf seine Bonner Antrittsvorlesung zurückkommt. Der Regensburger Redner führt nur den Kampf fort, den er schon 1959 gegen die Harnacks Deutungslinien folgenden Fachkollegen in der deutschsprachigen römisch-katholischen Universitätstheologie eröffnet hatte. Im Klartext: Wer das Christentum von den griechischen Denkformen der altkirchlichen Lehrbildung zu lösen versucht, gibt für Ratzinger Essentielles, Wesensnotwendiges preis und hat nach Benedikts Papalsicht schlicht keinen Anspruch darauf, sich Christ nennen zu dürfen. Nur konsequent ist es dann, alle Konzepte der Theologie als historischer Kulturwissenschaft des Christentums abzulehnen. Ausdrücklich verwirft der Papstautor einen theologischen Historismus, der die Wissenschaftlichkeit der Theologie an streng geschichtliches Denken rückbinden, ihre Existenzberechtigung innerhalb der Universität kulturwissenschaftlich begründen will. Ratzinger setzt auf eine metaphysische Theologie, die angesichts des grassierenden Spezialistentums in den einzelnen Disziplinen ein „inklusives“, „umfassendes“, „weites“ Verständnis der „Vernunft“ einklagt, eine 2 5 theologia perennis, die sich für „das Ganze“ zuständig weiß und gegen jeglichen methodologischen Atheismus eine konstitutive Gottbezogenheit aller wissenschaftlichen Wahrheitssuche betont. Akademische Theologie müsse gegen spezifisch moderne Selbstbegrenzungen der Vernunft darauf insistieren, daß Gott, Religion und Ethos nicht aus dem wissenschaftlichen Diskurs ausgeschlossen werden dürften. Sie soll gemeinsam mit der Philosophie in den Institutionen der Wissenschaft „das Hören auf die großen Erfahrungen und Einsichten der religiösen Traditionen der Menschheit, besonders aber des christlichen Glaubens“ sichern. Benedikt erhebt den steilen Anspruch, daß „eine dem biblischen Glauben verpflichtete Theologie“ über Vernunft und Wahrheit einfach mehr zu sagen wisse als andere Wissenschaften. Der metaphysische Theologiebegriff des Papstes ist eng verknüpft mit einer Fundamentalkritik sowohl aller kritizistischen Vernunftkonzepte als auch einer rein positivistischen, aufs isolierte Einzelne und technische Verfügungsmacht konzentrierten Wissenschaftspraxis. Zwar verzichtet der Regensburger Redner auf seine Lieblingsformel „Diktatur des Relativismus“. Aber er lastet sehr pauschal „dem Westen“ – gehört der Bischof von Rom nicht dazu? – eine pathologische Verengung des Vernunftverständnisses an, die ungewollt nur krankhafte Perversionen des Religiösen fördere. Auch hier argumentiert Benedikt XVI. faszinierend konsequent. Wo Europa seine normative religiöse Grundlage, die „Synthese“ von Jerusalem, Athen und Rom, preisgebe, „säkularistisch“ werde, provoziere es nur jene harten, bei einzelnen gewaltförmigen Glaubensreaktionen, unter denen es leide. Implizit steckt in seiner Kritik „des Westens“ ein massiver Machtanspruch. Nur „die Kirche“ weiß 2 6 um die „bleibende Grundlage dessen, was man mit Recht Europa nennen kann“. Biographische Erinnerung und philosophisch-theologische Reflexion dienen in der Regensburger Rede einem prägnanten religionspolitischen Interesse. Dies zeigen gerade die kritischen Passagen zur „Enthellenisierung des Christentums“. „Enthellenisierung“ wirkt wie ein Stichwort aus theologischen Spezialistendebatten, in denen es nur um tote Vergangenheit, lebensfern Abgehobenes geht. Für den Regensburger Redner ist „Enthellenisierung“ jedoch ein zentraler Begriff zur Analyse der gegenwärtigen religionskulturellen Lage des globalen Christentums. Er spricht von einer „dritten Enthellenisierungswelle, die derzeit umgeht“: „Angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kulturen sagt man heute gern, die Synthese mit dem Griechentum, die sich in der alten Kirche vollzogen habe, sei eine erste Inkulturation des Christlichen gewesen, auf die man die anderen nicht festlegen dürfe. Ihr Recht müsse es sein, hinter diese Inkulturation zurückzugehen auf die einfache Botschaft des Neuen Testaments, um sie in ihren Räumen jeweils neu zu inkulturieren. Diese These ist nicht einfach falsch, aber doch vergröbert und ungenau.“ Diese Passage markiert die religionspolitische Zielsetzung der Rede ungleich prägnanter als das umstrittene Palaeologos-Zitat. Für den Bischof von Rom sind die lehrhaften „Grundentscheidungen“ der Alten Kirche unaufgebbar, dem Glauben wesentlich. Nur wer der europäischen Kultursynthese von biblischer Überlieferung und griechischem Geist folge, sei wahrhaft Christ. Den boomenden neuen Christentümern der südlichen Hemisphäre bestreitet der 2 7 Papst damit jede christliche Legitimität. Indem er „die Reformation“ als erste Enthellenisierungswelle deutet, formuliert er eine radikal antiprotestantische religionspolitische Agenda. Seine Kritik gilt insbesondere den protestantischen Pfingstkirchen, zu denen in den letzten Jahren allein in Lateinamerika mehrere Millionen Katholiken konvertiert sind. Kein vernünftiger Europäer kann ein Interesse an neuen innerchristlichen Konfessionskonflikten und Kulturkämpfen haben. Aber gebotener intellektueller Respekt gegenüber dem Regensburger Redner zwingt dazu, seine implizite Botschaft ernst zu nehmen: Der Bischof von Rom spricht ca. 400 Millionen Menschen, die sich als Christen bekennen, wahre, weil dem griechischen Geist verpflichtete Christlichkeit ab. 5. Evidenz gelungener Papstwahl: Benedikt im Spiegel katholischer „Marktpolitik“ Ratzingers Wahl fügt sich bei Beachtung des bisher Gezeigten hervorragend ein in religionskulturelle Entwicklungstrends, die sich weltweit seit den 1970er Jahren beobachten lassen. Auf allen Kontinenten sind die religiösen Märkte seit den 1970er Jahren durch verschärfte Konkurrenz zwischen alten und neuen Anbietern geprägt. Viele westeuropäische Intellektuelle haben lange Jahre nur auf einen neuen aggressiven Islam geblickt, den sie dann schnell als "Fundamentalismus" verwarfen. Aber neue "harte Religion" hat keineswegs nur in traditionell muslimischen Gesellschaft an Gewicht gewonnen. Auch im Christentum lassen sich derzeit einige aggressiv expandierende Gruppen und Strömungen beobachten, die mit sehr hoher Durchsetzungskraft gerade viele 2 8 junge Menschen an sich zu binden vermögen. In zahlreichen Gesellschaften des Südens, in Lateinamerika und in Afrika, wird der traditionelle Volkskatholizismus durch die erfolgreiche Missionstätigkeit der sog. Pfingstkirchen bedroht, durch charismatische Gruppen und auch Sekten, die harte moralische Normen predigen, aber auch effizient Netzwerke der Nächstenliebe knüpfen. Auch in den USA haben in den letzten dreißig Jahren auf den pluralistisch umkämpften Religionsmärkten primär die Anbieter mit starker Marke, die Meinungsführer der Christian Right gewonnen. Mit Ratzingers Wahl bestätigt die römisch-katholische Kirche, daß sie diesen Trend verstanden hat, sich ihn zu eigen machen will. Vielleicht sollte so betrachtet die Namenswahl gar nicht an den XV. Benedikt, den Friedenspapst des Ersten Weltkriegs, erinnern. Benedikt XIV., Papst von 1740 bis 1758, gilt als einer der gelehrtesten Päpste der Neuzeit. Er war trotz vielfältiger innerkirchlicher Reformen in der Sache, der Verteidigung des römisch-katholischen Wahrheitsanspruchs gegen den Geist der Aufklärung, von harter Entschiedenheit. Je vielfältiger, unübersichtlicher moderne Gesellschaften werden, desto mehr müssen religiöse Institutionen ihre Unterscheidbarkeit betonen. Die Wahl Benedikts XVI. zeigt nur, daß die Kardinäle dies verstanden haben. Joseph Kardinal Ratzinger als Papst Benedikt XVI.: Die römische Kirche setzt auf die starke Marke prägnanter Unterscheidbarkeit mit dezidiert eurozentrischem Profil. 2 9