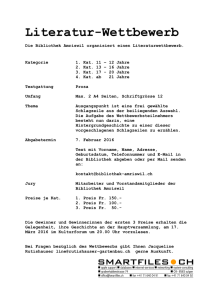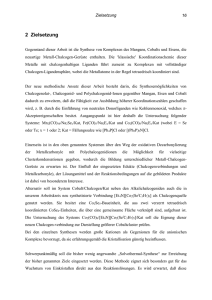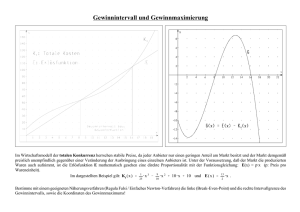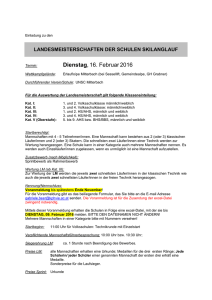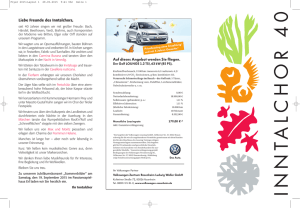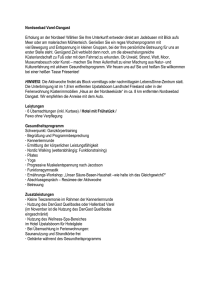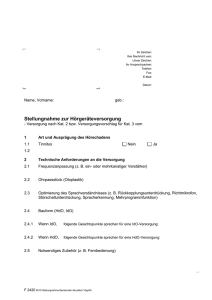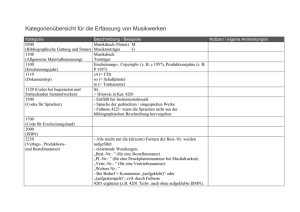Kuenstlertexte
Werbung
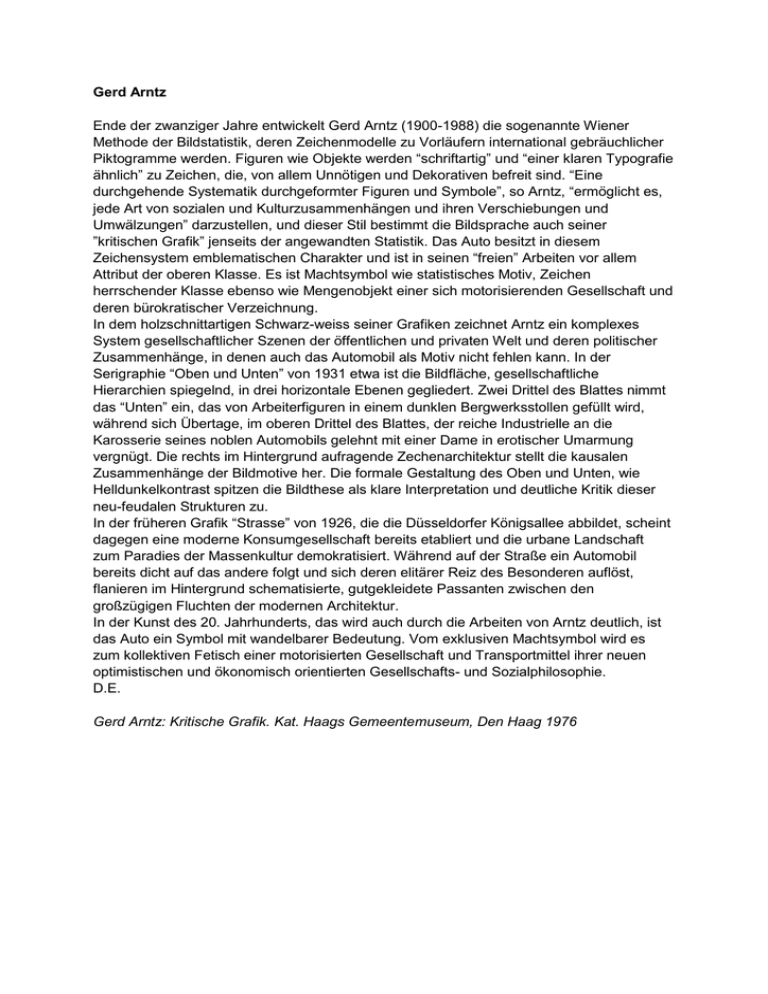
Gerd Arntz Ende der zwanziger Jahre entwickelt Gerd Arntz (1900-1988) die sogenannte Wiener Methode der Bildstatistik, deren Zeichenmodelle zu Vorläufern international gebräuchlicher Piktogramme werden. Figuren wie Objekte werden “schriftartig” und “einer klaren Typografie ähnlich” zu Zeichen, die, von allem Unnötigen und Dekorativen befreit sind. “Eine durchgehende Systematik durchgeformter Figuren und Symbole”, so Arntz, “ermöglicht es, jede Art von sozialen und Kulturzusammenhängen und ihren Verschiebungen und Umwälzungen” darzustellen, und dieser Stil bestimmt die Bildsprache auch seiner ”kritischen Grafik” jenseits der angewandten Statistik. Das Auto besitzt in diesem Zeichensystem emblematischen Charakter und ist in seinen “freien” Arbeiten vor allem Attribut der oberen Klasse. Es ist Machtsymbol wie statistisches Motiv, Zeichen herrschender Klasse ebenso wie Mengenobjekt einer sich motorisierenden Gesellschaft und deren bürokratischer Verzeichnung. In dem holzschnittartigen Schwarz-weiss seiner Grafiken zeichnet Arntz ein komplexes System gesellschaftlicher Szenen der öffentlichen und privaten Welt und deren politischer Zusammenhänge, in denen auch das Automobil als Motiv nicht fehlen kann. In der Serigraphie “Oben und Unten” von 1931 etwa ist die Bildfläche, gesellschaftliche Hierarchien spiegelnd, in drei horizontale Ebenen gegliedert. Zwei Drittel des Blattes nimmt das “Unten” ein, das von Arbeiterfiguren in einem dunklen Bergwerksstollen gefüllt wird, während sich Übertage, im oberen Drittel des Blattes, der reiche Industrielle an die Karosserie seines noblen Automobils gelehnt mit einer Dame in erotischer Umarmung vergnügt. Die rechts im Hintergrund aufragende Zechenarchitektur stellt die kausalen Zusammenhänge der Bildmotive her. Die formale Gestaltung des Oben und Unten, wie Helldunkelkontrast spitzen die Bildthese als klare Interpretation und deutliche Kritik dieser neu-feudalen Strukturen zu. In der früheren Grafik “Strasse” von 1926, die die Düsseldorfer Königsallee abbildet, scheint dagegen eine moderne Konsumgesellschaft bereits etabliert und die urbane Landschaft zum Paradies der Massenkultur demokratisiert. Während auf der Straße ein Automobil bereits dicht auf das andere folgt und sich deren elitärer Reiz des Besonderen auflöst, flanieren im Hintergrund schematisierte, gutgekleidete Passanten zwischen den großzügigen Fluchten der modernen Architektur. In der Kunst des 20. Jahrhunderts, das wird auch durch die Arbeiten von Arntz deutlich, ist das Auto ein Symbol mit wandelbarer Bedeutung. Vom exklusiven Machtsymbol wird es zum kollektiven Fetisch einer motorisierten Gesellschaft und Transportmittel ihrer neuen optimistischen und ökonomisch orientierten Gesellschafts- und Sozialphilosophie. D.E. Gerd Arntz: Kritische Grafik. Kat. Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1976 Giacomo Balla Der Maler Giacomo Balla, geboren 1871 in Turin und dort 1958 gestorben, gehört zusammen mit Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo und Gino Severini zu den „Ersten Fünf", den Unterzeichnern des „Futuristischen Manifests der Maler" von Filippo T. Marinetti vom Februar 1910 und damit zu den Begründern der futuristischen Malerei, wobei er erst ab 1912 aktiv am futuristischen Leben teilnahm. Die futuristische Revolte erteilte den in Italien allgegenwärtigen klassischen Kulturtraditionen seit der Antike eine radikale Absage, durch die die Mauern der Museen niedergerissen, Gemälde und Skulpturen der Vernichtung preisgegeben werden sollten. „Wir erklären, daß sich die Herrlichkeit der Welt um eine Schönheit bereichert hat: die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosivem Atem gleichen... ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake. ...Wir leben im Absoluten, denn wir haben schon die ewige allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen,“ heißt es 1909 in Marinettis „1. Futuristischen Manifest“. In Gemälden, in der Skulptur, in Wandgestaltungen, in Lesungen und theatralischen Inszenierungen ebenso wie in Modeentwürfen wird das neue Lebensgefühl des 20. Jahrhunderts gesucht, dabei inspiriert vom umfassenden Dynamismus eines universalen Lebensprinzips, das von raumerobernder Technik ebenso getragen ist wie von der Philosophie der Intuition im Sinne von Henri Bergsons „élan vital", dem Vitalismus Friedrich Nietzsches und dessen Verherrlichung des „Übermenschen". Die neuen Bildthemen der Eisenbahnen, Dampfer, Flugzeuge, Automobile und des Lebens in den Großstädten verlangten nach einer eigenen Bildsprache. Nach einer analytischen Phase bis 1915 entwickelt Balla einen Kanon von Kraftlinien, die sich in „synthetisch, subjektiv, abstrakt-dynamischen Formen" zu artikulieren hatten. Balla widmet sich den formalen Analogien zu menschlichen, tierischen, vor allem auch mechanisch-technisch automobilen Bewegungen. Es galt, die Gesetze der Linie der Geschwindigkeit sichtbar zu machen, in synästhetischen Dimensionen kombiniert mit Licht und Geräusch, mit Raum und Volumen, auch dem Erlebnis von Landschaft. Balla ist in diesen Jahren die dominierende Figur der futuristischen Malerei. In dem zusammen mit Fortunato Depero publizierten Manifest „Futuristische Rekonstruktion des Universums" (1915) heißt es: „Wir sind in den innersten Wesenskern des Universums vorgedrungen und beherrschen die Elemente. Auf diese Weise gelangen wir zur Konstruktion." DT David Elliot: BALLA – The Futurist. Kat. Edinburgh 1987 Andrew Bush Der Fotokünstler Andrew Bush (geb. 1957 in St. Louis, Missouri) lebt und arbeitet seit den frühen achtziger Jahren in der Stadt, deren Einwohner wohl mehr als irgendwo sonst durch das Auto geprägt sind. In Los Angeles gilt: Du bist was du fährst. So stellen auch die zwischen 1989 und 1991 entstandenen „Vector Portraits“ im Auto sitzende Menschen vor, gerahmt durch das Seitenfenster, reduziert auf Kopf, Schulter und die Hand am Steuer. Bush hat sie auf der Straße, im Vorbeifahren oder bei kurzen Stops mit einer Großbildkamera aufgenommen. Am Beifahrer-Fenster seines eigenen Wagens befestigt, löst er sie per Fernbedienung aus. Dabei erinnert sein pseudo-wissenschaftliches Vorgehen an Ed Rushas visuelle Kataloge von Parkplätzen und Tankstellen. Die Bildtitel dokumentieren Datum, Zeit, Geschwindigkeit, Wetterbedingungen und Ort der Aufnahmen. Menschen, die wir sonst nur kurz passieren, können wir hier eingehend betrachten und überlegen, wer sie – ihrer Kleidung, ihrem Gebahren und ihrem Auto nach zu schließen – wohl sein mögen. Mehr oder weniger unbemerkt dringt der fotografische Blick in den halb-privaten, „bewegbaren Raum“ (portable room) des Autos ein. Wie dieser alltägliche Vouyeurismus ist uns auch das Verhalten der Insassen bekannt. Sie benehmen sich, als wären sie für die Welt außerhalb des Autos unsichtbar. Abgeschirmt hinter Metall und Glas wiegen sie sich in vermeintlicher Sicherheit und Intimität. Auto fahren, das heißt lange Phasen der Selbstversunkenheit, die sich bis zu einem hypnoseähnlichen Trancezustand (freeway state of mind) steigern können, um sich dann wieder mit ungezügelten Ausbrüchen (screaming yawn) und kosmetischen Verrichtungen bei gedrosselter Geschwindigkeit abzuwechseln. So sehr die Schnappschüsse einerseits das Typische erkennen lassen, so scharf sind andererseits individuelle Charaktere gezeichnet. In ihrer Ausschnitthaftigkeit und unterstützt durch die Bildtitel entfalten die Fotografien – Filmstills vergleichbar – ihr erzählerisches Potential. Die Autos erzählen Geschichten, ähnlich wie die Häuser der Leute oder ihre Visitenkarten, die Andrew Bush ebenfalls zum Thema von Serien indirekter Porträts machte. Wir erfahren zwar nichts über die angesteuerten Ziele, umso mehr aber über bestimmte verbreitete Fahrgewohnheiten und Verhaltensweisen. Nicht zufällig wurde der Künstler als Marktforschungs-Berater von renommierten Autofirmen konsultiert, die seine Fotos in diesem Sinne gelesen haben: als Psychographien des automobilisierten Menschen. FE Thomas Demand Eine Kamera fährt in einen Tunnel, der sich im Verlauf der Straßenführung leicht absenkt. Eine klassische Autounterführung, wie jeder sie vielfach in Großstädten durchfahren hat. Auf einem leicht erhöhten Betonabsatz reihen sich wuchtige Stahlbetonpfeiler zum trennenden Mittelstreifen. In einer langgezogenen Linkskurve führt der Weg wieder hinaus. Dünne Lichtbänder auf beiden Seiten, die den Weg begleiten. Ein rollendes Geräusch, das sich allmählich verstärkt. Plötzlich ein Nichts, alles wird dunkel, das Geräusch klingt ab und verstummt. Dann setzt sich die Fahrt fort. Erst nach wiederholtem Hinsehen wird klar, daß man immer wieder in den Tunnel hineinfährt, aber nicht wieder herauskommt. „Tunnel“ ist eine großformatig projizierte DVD-Endlosschleife, in die sich der zum Autofahrer gewordene Betrachter verfängt, der er regelrecht zwangsneurotisch verfällt. Wie in allen seinen Arbeiten läßt Thomas Demand (geboren 1964 in München) den Betrachter mit minimalen Informationen zurück. Und doch, vielleicht erkennt der eine oder andere, daß es sich bei „Tunnel“ um den Nachbau jenes Tunnels in Paris handelt, in dem Diana, Prinzessin von Wales, im August des Jahres 1997 bei einem nächtlichen Autounfall tödlich verunglückte. Kaum jemand ist am tatsächlichen Ort gewesen, das Wissen um diesen Ort ist vielmehr ein massenmedial transportiertes, mit dem tage- und wochenlang Sendungen und Seiten gefüllt wurden. Aber die Erinnerung ist noch da, diffus und reaktivierbar. Der zunächst nicht benannte, dann doch bekannte Kontext lädt den Ort auf, veranlaßt zu Spekulationen und Vermutungen, macht aus dem nächtlichen Tunnel einen Schauplatz, an dem sich Alltagsmythos und Tod treffen. Die künstlerische Strategie Demands ist bei diesem Video derjenigen seiner fotografischen Arbeiten vergleichbar. Ein Raum, ein Interieur oder eine architektonische Situation werden detailgenau in Pappe und Papier nachgebaut, dann fotografisch dokumentiert und verarbeitet, oder wie in der vorliegenden Arbeit, gefilmt. Durch die nüchterne künstliche Rekonstruktion geschieht Erstaunliches, der Ort wird zur reinen Konstruktion und, da völlig unbesetzt, zu einem seltsamen Nicht-Ort. Auf seine ursprüngliche bloße Form und Leere zurückgeführt, werden alle an ihn gestellten Erwartungen enttäuscht. Mit seinen sterilen Nachbauten führt Demand vor, daß ein Ort mehr ist als sein Erscheinungsbild. Denn die nächtliche Autofahrt und ihr dramatischer Höhepunkt, der Aufprall, das Entsetzen und der Schmerz, sind unsichtbar. Alles spielt sich ausschließlich im Kopf des Betrachters ab. Erst hier verknüpfen sich die verschiedenen Sinnebenen und Bedeutungspotentiale. Demands Arbeiten sind materialisiertes Nachdenken über Wahrnehmungsmuster, Wirklichkeit und Mythenbildung. Durch die suggestive Kraft des Tunnels sowie durch das kurze Ausblenden alles Sichtbaren gelingt dem Künstler die Inszenierung eines sich in Sekundenbruchteilen ereignenden tödlichen Autounfalls. UT Thomas Demand. Kat. Fondation Cartier, Paris 2000 Tamara Grcic „Gestern Mittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 495 in Höhe Erftstadt. Bei einem Frontalzusammenstoß stießen zwei Pkw zusammen. Beide Fahrer erlagen ihren Verletzungen noch am Unfallort, vier weitere Personen, darunter drei Kinder, wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in das nahegelegene Krankenhaus eingeliefert.“ So ähnlich könnte ein Kommentar zu der raumgreifenden Bodeninstallation „Autoteile und Decken“ von Tamara Grcic (geboren 1964 in München) lauten. Die Künstlerin verteilt beschädigte Autoteile auf dem Boden: zersplitterte Scheinwerfer und Scheiben, zerbeulte Karosserieteile, abgebrochene Chrom- und Zierleisten. Die Autoteile werden gestützt, bedeckt und umwickelt von zahlreichen Decken und Kissen. Das Arbeiten mit verschrotteten Autoteilen ist seit César und Chamberlain bekannt, doch bei „Autoteile und Decken“ geht die bildhauerische Erfindung wesentlich weiter. Es ist nicht nur die Anordnung der objets trouvés, die sich die Künstlerin auf Schrottplätzen zusammensucht, es sind nicht nur die haptischen Qualitäten der unterschiedlichen Materialitäten, die gegenläufiger kaum sein könnten (Blech, Glas – Wolle, Textilien), sondern es ist die Subtilität des künstlerischen Eingriffs, die aus dem alltäglichen Material veränderte Ordnungen schafft. Auf den ersten Blick scheint alle Lebendigkeit gewichen, man läuft über eine Art Trümmerfeld. Nach längerem Hinsehen entwickeln die verstreuten Fragmente eine Eigendynamik und beleben sich. In ironischer Umkehrung werden die Autoteile zu Verletzten, die schützend bedeckt werden. Mit minimalen Eingriffen formt die Künstlerin viele einzelne Kleinskulpturen und wiederholt in ihrer Vorgehensweise ihr künstlerisches Prinzip der Fragmentierung: Die Autoteile werden überlagert, entzerrt oder isoliert, die Decken werden gefaltet und drapiert, mal als Einzelstück, mal in Verbindung mit Karosserieteilen. Die Sensibilität der Künstlerin für kleinste Veränderungen und deren Auswirkungen auf Wahrnehmungsprozesse und Bedeutungszuweisungen zeigte sich schon in früheren Arbeiten wie z.B. den „Blumenbildern“ von 1992 oder der Fotoserie „Falten, N.Y.C.“ von 1997. Auch die Zusammenstellung der Farbwerte in „Autoteile und Decken“ folgt keinem Zufallsprinzip, sondern fügt sich in die Gesamtkomposition ein. Auffällig ist das häufige kräftige Rot, das nicht nur an Blut, sondern auch an Leben denken läßt. Überhaupt gilt das Interesse der Künstlerin vielfach der Körperlichkeit hinter den Dingen, einer noch nicht bekannten oder wahrgenommenen Präsenz, die sich durch Verletzlichkeit und Veränderlichkeit artikuliert und bestehende Denkmuster und Bedeutungszuweisungen kippt. UT Tamara Grcic. Kat. Fridericianum. Kassel 2000 Cordula Güdemann Wurstartig verformt von kräftigen Pinselhieben (und von traumartig intensiver Phantasie) schweben die „Killerautos" (1989) der Stuttgarter Malerin Cordula Güdemann (geboren 1955) durch vage bestimmten Stadtraum. Die Szene ist menschenleer, die Fahrzeuge haben sich wahrhaft automobil gemacht. Sie bewegen sich, ohne daß jemand sie steuerte. Was menschlich wäre, scheint vielmehr in die Autos selber übergegangen zu sein, so leibhaftig wirken ihre hautfarbenen Karosseriekörper. Im Fahrzeuginneren sind an den Übergangszonen wie bei den menschlichen Körperöffnungen rote Ränder zu sehen. Vor der Kulisse abweisender Hochhausbauten erinnern die drei Autogestalten fast an Jugendliche, die, zwischen Langeweile und sexueller Potenz hin- und hergerissen, zu marodieren beginnen. Mit ihren phallisch verlängerten Nasen erinnern die „Killerautos" an die terroristischen Narren in Stanley Kubricks „Uhrwerk Orange". Wie der britische Regisseur richtet die Malerin einen phantastisch hellsichtigen, d.h. ebenso zutreffenden wie von allen theoretischen Begründungslasten und Rechtfertigungen befreiten Blick auf die Lust als Element menschlicher Gewaltbereitschaft. Güdemanns Malerei ist der immer neue Versuch, möglichst unmittelbar zu zeigen, wie es wirklich ist. Sie ist eine politische Künstlerin, ohne sich in Diskursmoden zu verheddern. Die latente Obszönität der wurstigen, überlangen Limousinen macht die aggressive, destruktive Lust offenbar, die sich im Autofahren zu befriedigen sucht, dabei von der Allgemeinen Straßenverkehrsordnung leidlich unter Kontrolle gehalten wird und zugleich den Tankstellennetzen, die dieser Lust den Stoff liefern, unglaubliche Umsätze beschert. Der Bildraum, in dem all dies zu erkennen ist, ist eine Art Splitterraum, eine polyvalente Bühne, entzifferbar über verschiedene Lesarten. Die Schwerelosigkeit, die eines der Automobile wie einen Fisch schweben läßt, gibt dem Anblick die drückende Dichte eines Aquariums. Der kulissenartige Hintergrund fügt etwas theaterhaft Präsentatives hinzu. Das Licht in diesem Raum wirkt ebenso golden wie tranig. Die braunen Schlieren und Farbbeimengungen lassen an „Phäkalia" denken (Titel einer Bildserie Güdemanns, die ebenfalls Ende der achziger Jahre entstand). Güdemanns innerbildliche Raumkonzeption ist die der Collage, rückübersetzt in Malerei. Der disparate Alltagsraum ist für sie nicht über getreue Abbildung eines natürlichen Vorbildes darstellbar, sondern nur als eigensinniges Bild, nur Bildgesetzen gehorchend, also dem, was man sieht, wenn man wach die Augen schließt. MW Cordula Güdemann: Bilder aus der bewohnten Welt. Kat. Düsseldorf 1994 Richard Hamilton Das Portfolio „Five Tires remoulded“ (1971) steht am Ende einer fast 20-jährigen Beschäftigung mit einer Werbeanzeige, die in fünf Reifenprofilen die Geschichte des Automobils nachzeichnet und für Richard Hamilton (geboren 1922 in London) zu einer Reflexion über das Verhältnis von Kunst und Technik wurde. Alltägliche Präsenz der Waren und des Konsum als Wirklichkeit der Wahrnehmung beschäftigt Richard Hamilton, den führenden Kopf der Independant Group am ICA in London, die mit der Ausstellung „This is tomorrow“ 1956 die englische Pop Art als Wegbereiter für eine weltweit wirksame Kunstbewegung ins Leben rief. 1963 stellt er sich selbst auf einem Auto sitzend zwischen Mercury Raumkapsel, Kühlschrank, Superstaubsauger und schöner Frau dar. Dabei geht es Hamilton sowohl um die gesellschaftskritische Analyse der Warenwelt als auch um die durch die Gegenwart gestellten Herausforderungen an die tradierten Künste. Das um seiner visuellen Präsenz zu Beginn der fünfziger Jahre diskutierte Inserat nimmt Richard Hamilton zum Anlaß, die Grenzen tradierter Kunstübung zu erproben. Um 1964 entwickelt er das Konzept, jene fünf Autoreifen idealtypisch in der seit der Renaissance geübten Zentralperspektive zu zeichnen. Dabei zielt er, ganz im Sinne des anspruchsvollen handwerklichen Ethos Marcel Duchamps, von einer hochprofessionellen, zeit- und arbeitsintensiven Wiedergabe der verschieden gestalteten und in die Gummimasse eingetieften Profile in der Fläche. Das Vorhaben, ebenso anspruchslos im Thema wie anspruchsvoll in der Realisierung, scheitert an den zeitlichen – und damit finanziellen Voraussetzungen – und dies trotz einer vergleichsweise einfachen geometrischen Struktur, die in den Illusionismus einer zentralperspektivischen Räumlichkeit überführt werden sollte. So erscheint 1964 der Siebdruck „Five Tyres abandonded". Erst um 1971 kann Hamilton mit Hilfe eines Computerprogramms die Reifen als Ringkonstruktionen berechnen lassen und entdeckt dabei neue Verfahrensweisen zur Entwicklung von Volumen auf der Fläche. Zudem gelingt es, die perspektivisch zerdehnten Profile dreidimensional ins Relief zu übersetzen. Damit skizziert Hamilton das Problem: Die Transformation einer künstlerischen Idee bezogen auf die technischen Mittel, die die jeweilige Gegenwart parat hält, wobei zeitlicher und handwerklicher Aufwand zur Realisierung erst durch Einsatz modernster Technologien in ein wirtschaftlich vertretbares Verhältnis gesetzt werden. 1971 wäre dies einmal mehr berechtigt gewesen, „This is tomorrow" genannt zu werden. DT Thomas W. Gaethgens: Richard Hamilton. Studien 1937–1977. Kat. Bielefeld 1978 Stefan Hoderlein Zwei Raver werden bei einer nächtlichen Autofahrt gefilmt. Ihre Ausgelassenheit und Lebenslust äußern sich in rhythmischen Bewegungen auf dem Vordersitz eines Opels aus den achtziger Jahren. Es wird viel gelacht und geredet. Irgendwann wirft der Fahrer, Hoderlein selbst, voller Übermut ein Plüschtier aus dem Dachfenster des Wagens. Begleitet wird die nächtliche Ravetour durch die Großstadt von der für Hoderlein obligatorischen Technomusik. Das Spontanvideo „Mental Mayhem“, das der Künstler mit Hilfe einer auf die Kühlerhaube des Opels montierten Kamera gefilmt hat, verbindet kongenial den Mythos Auto mit dem mittlerweile mythischen Charakter der Raverszene der achtziger und neunziger Jahre. Die Autofahrt ist nicht nur die filmische Umsetzung der Musik, sondern Autofahrt und Musik gehen mit den Ravern als verbindendem Element ineinander auf. Es sind ihre Bewegungen, die den Rhythmusflow von Musik und Auto harmonisieren und zueinander in Beziehung setzen. In „Mental Mayhem“ wird das Auto zum erweiterten Innenraum, zum verlängerten Dancefloor, so daß sich die Kategorien des Ortes verschieben. Als Teil eines selbstverständlich gewordenen und nicht mehr hinterfragten Lebensraumes fügt sich das Auto in die natürliche Umwelt des Menschen ein und wird zum Mikrokosmos. Die Grenze zwischen Privatraum und öffentlichem Raum ist aufgehoben. Alltagsraum und inszenierter Raum treffen sich und fügen sich zusammen. Auf dieser Grundlage wird für den Künstler alles zum Material und die Entgrenzung zum künstlerischen Prinzip. Leitmotivisch durchziehen Musik (Techno) und Tanz (Rave) das Oeuvre des Video- und Installationskünstlers Hoderlein (geboren 1960 in Düsseldorf), für den die Musik lebensbestimmendes Element und selbstverständliches Material für sein künstlerisches Schaffen ist. So weist auch seine künstlerische Strategie vielfach Parallelen zum Vorgehen der Techno-Musiker auf: Mehrere Spuren werden übereinander gelegt, um verschiedene Bedeutungsebenen erlebbar zu machen. Das Sampling, die Struktur von Schichtung und Anhäufung, inspirierte Arbeiten wie „Feuerzeuge“ von 1995 und „Bilder aus der Jetztzeit“ von 1997, einer Ansammlung von Hunderten von Dias aus seiner persönlichen Biographie, die der Künstler zu einer Rauminstallation zusammenfügt, in der sich Erfahrung und Dasein verdichten. UT Hannah Höch Die Zersplitterung des Blickes war keine dadaistische Erfindung. Nicht künstlerische Willkür, sondern jede Autofahrt erzeugte eine wilde Collage von Anblicken und rasenden Mustern, zumal für die Wahrnehmung eines Erwachsenen um 1920, der nicht von Kindesbeinen an häufiges Autofahren gewohnt sein konnte. Wie Kurt Schwitters in Hannover begnügte sich von den Berliner Dadaisten insbesondere Hannah Höch (1889-1978) nicht mit tagespolitischer Provokation. Ihre formal und assoziativ vielschichtigen Kompositionen, von ihren männlichen Dada-Freunden seinerzeit nicht recht ernst genommen, erwiesen sich (zusammen mit George Grosz´ Werken) als diejenigen Zeitdiagnosen, die den Berliner DADA-Aktionismus überdauerten. Ihre Fotomontagen porträtieren den hysterisierten Alltagsraum kurz nach dem katastrophal verlorenen Ersten Weltkrieg in Berlin. Sowohl das rasende Automobil wie die zuschnappende Fotokamera zerstörten die Überschaubarkeit eines Hier und Jetzt, einer von einem Menschen zu einem Zeitpunkt faßbaren Gegenwart. Die Geschwindigkeit des Kraftwagens ebenso wie die explosionsartige Vervielfältigung von Fotografien und Nachrichten in der Presse stehen symptomatisch für Überforderung und Desorientierung menschlicher Wahrnehmung, wie Höchs zersplitterte Bildordnung sie festhält. In der Collage hinterlassen zwei den Raum hysterisierende Maschinen ihre Spuren: das Automobil als sinnlos vielfaches, drängend herbeischwebendes Emblem, als Reifen und Gestänge, und die immer perspektivische Fotografie als Ausgangsmaterial des fragmentierten Klebebildes. Unter den Bedingungen harter Schnitte bleiben von dem „schönen Mädchen“, das der Titel nennt, nur Versatzstücke, deren proportionale Beziehungslosigkeit das Zerfallen personaler Integrität anzeigen mag. Unter der riesigen Haartracht gähnt Leere, der Körperraum des „Mädchens“ wird durchkreuzt von Autoteilen. Dabei scheint Höch das „schöne Mädchen“ nicht spöttisch preisgeben zu wollen. Vielmehr hält die Fotomontage unerbittlich fest, was eine hochmotorisierte Medienmaschinerie, wie sie seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts zuerst die Metropolen, dann die gesamte westliche Gesellschaft beeinflußt, der oder dem Einzelnen antut. Bei Höch ist zu sehen, daß das Eindringen industrieller Visualität und der Werbewelt ins Menschenbild ein äußerst aggressiver Vorgang ist (von dem sich die bürgerliche Gesellschaft bis heute nicht erholt hat, im Gegenteil). Hannah Höch, deren bedeutender künstlerischer Beitrag zu DADA sowie zur Entwicklung der Fotocollage und deren auffällige Sonderposition als einzige Künstlerin der Berliner Dadaisten erst Ende der sechziger Jahre kunsthistorisch bemerkt wurden, kommentierte ihre revolutionären Bilderfindungen 1975 im Rückblick ohne Auftrumpfen: „Ich sah meine Aufgabe darin, diese turbulente Zeit bildlich einzufangen.“ MW Götz Adriani: Hannah Höch. Köln 1980 Zuzanna Janin „Es gibt da eine Theorie, die mir gefällt: Jeder Organismus schafft sich sein Äußeres, das ein erkennbares Zeichen ist, und sein Inneres, das eine funktionale Maschine ist. Das Äußere hat visuelle Charakteristika, ist individualisiert und stellt das Ego heraus, während das Innere, die Apparatur, die das Weiterleben ermöglicht, nicht individualisiert ist, das heißt, es hat nur einen funktionellen, motorischen Charakter, keinen visuellen“ (Zuzanna Janin). Die Frage wäre dann, ob wir als zeichentragende individuelle Hülle mehr umkleiden als ein maschinales, dabei selbstbewegtes Inneres – nicht: „Ich bin mein Auto“, sondern: „Ich bin ein Auto“. In „Do You Really Know How To Do it“ transponiert Zuzanna Janin eine Rummelplatzszenerie in den musealen Raum – durchaus eine Ironisierung der Institution. Die als jugendliches Freizeitvergnügen wohlvertraute Situation ist auf das Wesentliche reduziert: zwei Autoscooter, die in einem abgesicherten Feld gegeneinander antreten. Das Spielzeuggefährt wird als Panzer aus Metall und Gummi zur zweiten Haut seiner Fahrer, die es vor härteren Konsequenzen schützt. Auch wenn die Übertragung aus dem Alltagszusammenhang ohne weitere Gestaltungseingriffe erfolgt, wirkt die Installation symbolisch, als Zusammenspiel aus Physischem und Metaphorischem. Im Autoscooter geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Geschicklichkeit. Es gilt, dem anderen möglichst kräftig an den Karren zu fahren, ohne selbst zu viel abzubekommen. Die existentielle Thematik des Unfalls wird auf der Ebene des Rummelplatzspieles verhandelt. Die 1964 in Warschau geborene Zuzanna Janin entwickelt ihre Themen aus ihrer eigenen Geschichte, aus ihrer Erinnerung, ihrem Umfeld. In ihren Installationen entstehen Bilder, in denen sich Vergangenes und Zukünftiges mischt und in deren experimentellen Räumen der Besucher die eigene Geschichte mit einspielt. Erik van der Heeg verweist auf Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, um das Phänomen einer außerzeitlichen Erzählung im Werk von Janin zu beschreiben, denn im ständigen Gleiten durch die Zeit gelingt es, auch hier Erinnerung zumindest für einen Moment außerhalb des Zeitflusses zu rekonstruieren. DE Allan Kaprow In einem seiner bekanntesten Environments, dem mehrmals realsierten „Yard“ (1961 New York, 1970 Köln, 1986 Dortmund) häuft der 1927 geborene Amerikaner Allan Kaprow eine Unmenge alter Autoreifen an und läßt das experimentierfreudige Kunstpublikum in diesem Ambiente mit unsicheren Schritten balancieren. Zweckentfremdet werden die Reifen zum Grund einer anderen Körper-, Form- und Materialerfahrung, wobei Kaprow eine reine Ästhetisierung ablehnt: „Abgesehen von den Verdiensten in jedem einzelnen Fall, schien sich diese Binsenweisheit jedes Mal, wenn wir einen Haufen Industrieprodukte in einer Galerie sahen oder Alltagsleben auf einer Bühne aufgeführt wurde, zu bestätigen: vor allem die Behauptung, daß sich alles ästhetisieren ließe, brächte man es nur in das richtige künstlerische Ambiente. Doch warum sollten wir alles ästhetisieren wollen? Alle Ironie wäre verloren, die provokanten Fragestellungen vergessen“ (Kaprow 1983). Damit setzt sich Kaprow vom Duchampschen Readymade ab, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem radikalen Kunstgriff die Frage nach der Begrifflichkeit und den Bedingungen von Kunst neu stellt. Auch die aus der Idee des Readymades entwickelten, späteren künstlerischen Einsätze von industriellen Materialien und Objekten, inklusive den Ansätzen der Pop Art versteht Kaprow als trivial. Wenn Kaprow in „Household“ (1964) das Autowaschen zum kollektiven Happening macht oder in „Gas“ (1966) stillgelegte Schrottautos zum dreidimensionalen Bildgrund einer Malaktion werden, so hat dies vor allem politische Motive. Der „Non-Artist“, als der er sich versteht, hat, im Einklang mit der allgemeinen Politisierung der Kunst in den sechziger Jahren, erzieherische (Gegen-)Funktion in einer modernen Gesellschaft, in der Massenmedien und Freizeitindustrie den stärksten Einfluß auf öffentliche Bildung haben. Kaprow versteht Kunst als soziales Instrument und definiert sie um zum „Spiel“, dessen formal-ästhetische Wahrnehmung er auch in seinen Schriften zur Differenz von „Gaming and Playing“ um wesentliche soziale und politische Aspekte erweitert. Die Ritualisierung alltäglicher Handlungen wird in der spielerischen Wiederholung zugleich aggressiv und kritisch. 1979 konzipiert und baut Kaprow für die „6. Kunstwoche des Ruhrpark Shopping Centers“ in Bochum seinen „Tire Tower“: einen ursprünglich 15 Meter hoch geplanten Turm in Form eines monumentalen Schaltknüppels aus alten Autoreifen. Daß Kaprow mit diesem in ironischer Weise phallischen, autophilen Denkmal aus verbrauchter Bereifung sowohl das banale Pathos des nahen Konsumtempels kommentiert als auch auf die Nachbarschaft des Bochumer Opel-Werkes anspielt, haben sicher nicht nur die bemerkt, die den Turm kurz nach seiner Errichtung in Brand setzten und zerstörten. DE Allan Kaprow: Kat. Museum am Ostwall, Dortmund 1986 Rachel Khedoori In den Jahren 1994-97 filmte Rachel Khedoori (geboren 1964 in Sydney) ihren ehemaligen Schulweg entlang der 102nd Street in Inglewood, Kalifornien. Der zwei Stunden dauernde Film besteht aus einer Serie von langsamen und gedehnten Aufnahmen aus einem Auto heraus, das sich immer in gleicher Distanz parallel zum Bürgersteig bewegt. Das gemächlich filmische Gleiten tastet genauso unspektakulär wie präzise die Straßenseiten mit ihren Häuserfassaden ab. Es ereignet sich nichts, das den Blick irritieren oder gar stören würde. Durch die Positionierung der Kamera im Innenraum des Autos wird der Betrachter physisch involviert, es scheint, als sei der abgefilmte Weg der seine. Doch diesen Eindruck relativiert Khedoori durch die Präsentationsform, denn wie in anderen ihrer Arbeiten arrangiert sie diesen Film in einem Raum, den sie eigens für die Filmprojektion konzipiert hat, so daß die künstlerische Arbeit aus drei Teilen besteht: dem Film, der Projektionsapparatur und dem Raum. Während der Vorführung sieht der Betrachter nicht nur die eigentliche Projektion, sondern auch die Filmspulen mit der gesamten technische Konstruktion des filmischen Apparates. Allein gelassen sieht sich der Betrachter einem komplexen System von Perspektiven, Wahrnehmungen und Wirklichkeitsebenen ausgesetzt, mit dem die Künstlerin die scheinbare Eindeutigkeit von Wahrnehmung hinterfragt und deren Bedingungen thematisiert. Wie auch Khedooris „Blue Room“ von 1999 wird „102nd Street“ zu einer raumfüllenden Installation, bei der das komplexe technische System mit der Vielschichtigkeit des Phänomens Erinnerung korrespondiert. Das entspannte Fahren entlang der Straße erinnert an die Zeit des Kinderwagens, an ein Wohlgefühl des Aufgehobenseins, an die Zeit, in der das Kind das sanfte Vorübergleiten der sichtbaren Welt als Wahrnehmungsform kennengelernt und eingeübt hat. Die regressiven Aspekte der Autofahrt, die durch den dunklen Raum als Metapher noch verstärkt werden, sind offensichtlich und gewollt. Doch durch den installativen Charakter verhindert Khedoori, daß sich der Betrachter selbstvergessen in der eigenen Regression verliert. Die Künstlerin zwingt ihn, sich mit Illusion und Wirklichkeit auseinanderzusetzen und sich unsentimental der Erinnerung zu nähern. UT Martin Kippenberger In einer nächtlichen Szenerie fällt das Licht einer Laterne auf ein schneebedecktes Auto. Ähnlich wie in Weegees Fotografien von verschneiten Autos, die wie schlafende Tierkolosse wirken, scheint die Schneedecke den Wagen auf seltsame Weise zu renaturieren. Mit der Karosserie verdeckt der Schnee zugleich die Markenidentität des Autos. Unserem Versuch, die Marke zu erraten, kommt ein in diese tabula rasa eingetragener Schriftzug zuvor. Ihm zufolge ist es „No Capri“. Was ist es aber dann? Entscheidender als die Beantwortung dieser Frage ist wohl, warum wir es überhaupt wissen wollen. Die status- und identitätsstiftende Funktion des Autos ist ein Gemeinplatz, den Kippenberger (geboren 1953 in Dortmund, gestorben 1997 in Wien) am Einzelfall überprüft. Nicht Technik und Ausstattung interessieren ihn: „Autoquartett hab ich nie gespielt.“ Wenn er auch selbst keinen Wagen fuhr, kannte Kippenberger den Reiz des großen Auftritts, einen Bentley zu mieten und sich „durch die Gegend“ chauffieren zu lassen. Und: „Ich guck mir gerne ’n Jaguar E an. Hätte ich Platz in meinem Haus, in einer Garage, würd’ ich mir den auch da rein stellen, ’nen Jaguar E“ (1991). Was heißt es also, ein Modell vor dem Haus stehen zu haben, das nach dem Sehnsuchtsziel aller Italienreisenden benannt ist? Angesichts der kalten Witterung wirkt die südländische Aura des Typennamens deplaziert. Was wir sehen, ist „Kein Capri bei Nacht“. Das bezieht sich doppeldeutig auf das Auto, aber auch auf seine schnöde, trostlos wirkende Umgebung. Von den romantischen Küsten Capris sind wir hier wohl ähnlich weit entfernt wie der „Nudel-Laden“ namens „Capri“ bei Kippenbergers späterer Wohnung in Los Angeles. Die meisten Besitzer eines Ford Capri, von manchen abschätzig „Vorstadt-Ferrari“ genannt, werden nie bis nach Italien gekommen sein. Und dennoch machen die Bilder und assoziativen Versprechungen, die von den Autonamen transportiert werden, das Auto zu einem Traumgegenstand. Die Beziehung, die Fahrer zu ihrem Auto pflegen, und das Bild, das sie von ihm haben, sind sensibel. Gegen Desillusionierungen, wie sie Kippenberger mit nur zwei Worten betreibt, sind sie ebensowenig gefeit wie der Lack gegen häßliche Kratzer. FE Martin Kippenberger: The happy end of Franz Kafka's „Amerika". Kat. Deichtorhallen Hamburg. Köln 1999 Kane Kwei Für die Passage am Ende des Lebens bedarf der Körper eines Vehikels. Der Sarg ist die Hülle, die es den Lebenden ermöglicht, den Toten zu ehren und auf seinem letzten Weg zu begleiten. Der Schreiner, Zimmermann und Bildhauer Kane Kwei (1924 in Teshie geboren, dort 1992 gestorben) vom Volk der Ga in Ghana hat in seinem plastischen Schaffen seit 1951 die Kultur des repräsentativen Begräbnisses durch figurative Särge fortentwickelt. Etwa zwei Dutzend Sargmodelle hat Kane Kwei bis 1992 entworfen. So wurde etwa ein Sarg in Gestalt einer riesigen Zwiebel gefertigt, da der Verstorbene durch den Anbau und Vertrieb von Zwiebeln zu Ansehen und Wohlstand gekommen war. Daneben gibt es den Getreidesack, den Schuh, die Flasche, das Flugzeug, das Huhn. Die Werkstatt wird heute von Sohn und Neffe weitergeführt. Den Sarg in Gestalt einer weißen Mercedes-Limousine könnte man nach abendländischer Lesart als moderne Version vom Kahn des Charon für das Seelengeleit über den Styx verstehen, doch würde diese eurozentristische Deutung der ghanaischen Auffassung widersprechen. Für das Verständnis dieser Form der seit mehr als zwei Jahrzehnten üblichen Begräbnisrituale in Teshie müssen traditionelle animistische Vorstellungen mit einbezogen werden, wie sie sich in der Ehrung des Toten und seiner Familie durch ein mehrtätiges Trauerfest äußern. Die Auswahl des Sargmotivs gilt den Lebensgewohnheiten und der gesellschaftlichen Position des Verstorbenen. „Dieser Sarg stellt keineswegs eine Kritik am materiellen Erfolg dar, sondern dient ganz im Gegenteil dessen Verherrlichung. Der Mercedes ist zu verstehen als das höchste afrikanische Symbol für Reichtum, gesellschaftliche Stellung und Wertschätzung" (Susan Voge). Kane Kweis Skulpturen sind nicht als Objekte bloß ästhetischer Anschauung zu lesen im Sinne eines autonomen Kunstwerks. Sie stehen im Dienste eines Rituals, das, in afrikanischen Traditionen verwurzelt, zugleich Anteil hat an der interkulturell verbreiteten Statussymbolik großer Automarken. So gehört denn auch der Videokünstler Nam June Paik, ebenfalls Wanderer zwischen den kulturellen Hemisphären, zu den Förderern Kane Kweis. Als Beitrag zur zeitgenössischen afrikanischen Kunst ist Kane Kweis Schaffen erstmals in der Ausstellung „Les Magiciens de la Terre" (Paris 1989) gewürdigt worden. Kane Kweis Werk stellt Parameter westlicher Kunst in Frage. Seine Werke sind darauf angelegt, auf immer der Betrachtung entzogen zu sein, wenn in ihnen die Verstorbenen begraben werden. DT Michaela Melián „Am 12.8.1888 hatte sich Berta Benz... aus Wut über ihren Ehemann Carl Benz in einen von ihm entwickelten Prototypen gesetzt, der bis zu diesem Zeitpunkt als nicht fahrtauglich galt. Immerhin 130 Kilometer bis nach Pforzheim hat sie mit diesem Fahrzeug zurückgelegt. Das war weltweit die erste Überlandfahrt mit einem Automobil und ihr Mann konnte es anschließend als ‚Bockige Berta’ auf der Münchner Weltausstellung präsentieren“ (Nina Oswald). Die Installation „Berta Benz, Konstruktion“ (1998), der 1956 in München geborenen Künstlerin Michaela Melián konfrontiert mit Irritation und Verweigerung, denn die Motive, die sie zeigt, entsprechen nur in Annäherung den in der Erzählung genannten Figuren und Objekten. Meliáns Installation besteht aus Holzlatten, welche die innere Konstruktion des zentralen Motivs bilden und einer Husse aus hautfarbenem Satin, die dieses Gerüst überspannt. Immerhin läßt sich in diesem raumgreifenden, fleischfarbenen Objekt die Form eines Autos erahnen. Nicht nur formal, auch inhaltlich wird die Installation „Berta Benz“ zur Konstruktion, zum Konstrukt aus disparaten Objekten und Motiven. Über der Szene schwebt eine in die Horizontale gekippte Bildtafel, die mit demselben fleischfarbenen Stoff bespannt ist wie das Holzgerüst des dysfunktionalen Automodells. Langsam rotiert der scheinbar organische Spiegel über der Szene. Auf die Wandfläche im Hintergrund ist ein nur grob differenziertes Porträt eines weiblichen Gesichtes gestempelt: vermutlich Berta Benz. Diese Phantombilder, die immer wieder in Arbeiten Meliáns auftauchen, sind nach ihren Personenbeschreibungen am polizeilichen Fahndungscomputer angefertigt. Meliáns künstlerische Produktion von Fremdkörpern und Störbildern fragt nach der eigentlichen Identität von Objekten, die sich letztlich immer als Konglomerat subjektiver Mythologien erweist. Und so spielt „Berta Benz, Konstruktion“ als eine künstlerische Nacherzählung von Personen und Objekten auch mit der Ungreifbarkeit weiblicher Modelle, deren extremste kulturelle Verzerrung sich im Bild der Hysterikerin findet. Bereits 1999 hatte die Künstlerin in der Münchner Galerie Barbara Gross eine Ausstellung unter dem Titel “HysterikerIn/Automobil” gezeigt. In deren Zusammenordnung aus weiblicher Exstase und maschinalem Körper offenbart sich das Auto nicht nur als Beschleunigungs-, sondern mehr noch als Mythos-Maschine. Entsprechendes referierte auch die jüngste, reale und durch die Presse hysterisierte Koppelung zwischen Frauenkörper und Maschine, die durch den Tod der englischen Kronprinzessin Diana 1998 in einem Mercedes entstand. In den Showrooms von Autohändlern auf der ganzen Welt wurden daraufhin eine Woche lang die Automodelle dieser S-Klasse verhüllt. DE Michaela Melian: Tomboy. Kat. Kunsthalle Baden-Baden, 1995 Olaf Metzel Die Arbeitsweise von Olaf Metzel (geboren 1952 in Berlin) gleicht ein wenig einer Autofahrt – keiner Sonntagsfahrt ins Naherholungsgebiet, auch nicht der dösigen Pendlerfahrt ins Büro, sondern der erlebnisoffenen Fahrt ins Blaue, mal lässig, mal mit Vollgas. Immer sind Kamera, Notizbuch und Zeichenstift zur Hand, übergangslos können der Alltag am Straßenrand oder Fundstücke aus den Medien für Metzel Ideengeber einer Installation werden. 1982 verwandelte der Künstler die Münchner „Tankstelle Landsbergerstr. 193 (B2)“ in eine „Drive-In-Ausstellung“ (Metzel), 1997 stattete er die Ebene 4 des Parkhauses Bremer Platz in Münster mit einer „akustischen Installation“ aus: ein Crashtest, im Dolby-SurroundSystem gut hörbar gemacht. So, wie es in Metzels Arbeitsweise den (geradezu autobahnartigen) Wechsel von Gesamtentwurf in Hochgeschwindigkeit und bildhauerischer Feinabstimmung im Schrittempo gibt, sind seine Arbeiten strukturiert von einem paradoxen Ineinander großer Geste und hintersinniger Anspielung, von zerschlagenen, angebrannten oder aufgesplitterten Einzelteilen und schlüssigem Gesamtzusammenhang, von anarchistischer Kompromißlosigkeit und gesellschaftspolitischer Bezugnahme. Viele seiner raumgreifenden Arbeiten sehen so aus, als seien sie gerade an ihre Stelle gestürzt. Dabei resultiert die Anmutung des zufällig Selbstverständlichen aus einem genauen Arrangement von Destruktion und Konstruktion. So ist Metzels krachend zersplittertes Basketballfeld „112:104“ (1990/91) als spätes Echo von C.D. Friedrichs Gemälde einer Schiffszerstörung („Die gescheiterte Hoffnung“, 1823/24) gedeutet worden, wobei die Arbeit ebenso starke Anklänge an den optimistischen Konstruktivismus des russischen Avantgarde hat. Olaf Metzel, dessen provokante und (zumal im öffentlichen Raum) viel diskutierten Arbeiten ihn zu einem der heute international bedeutendsten Bildhauer Deutschlands gemacht haben, ist ein engagierter Hochschullehrer und ein treu sorgender Familienvater. Wenn die Schulferien nahen, wird das Familienauto bepackt, um auf der „Strada del Sole“ der italienischen Adria entgegen zu fahren. Metzels gleichnamige Installation verwandelt den immobilen Ausstellungsraum in die automobile Fahrgastzelle. Der Cassettenrecorder läuft, die Autobahn saust unten durch, das Zeitgefühl verschwimmt, das Raumgefühl auch – wie viele Gepäckträger sind eigentlich auf dem Autodach? So, wie sich solche Fragen nach neun Stunden Autobahn langsam ins übermüdete Bewußtsein senken (und eine dringende Kaffeepause signalisieren), scheint sich das Gewirr von umflochtenen Dachgepäckständern von oben in den Ausstellungsraum gesenkt zu haben. Auch mit dieser Arbeit erzeugt Metzel intensive Stimmungen aus paradoxen Konstellationen, wirken doch die Gepäckständer kopfüber gegen die Decke gestürzt. MW Olaf Metzel. Kat. Darmstadt 2001 Christiane Möbus Drei hochglanzpolierte Aluminiumobjekte mit hermetisch abweisender Lackoberfläche bewegen sich leise surrend durch den Raum, elektrisch angetrieben und lichtelektronisch gesteuert. Wie bei einer blanken Autokarosserie verhindert die spiegelnde Oberfläche den Blick in die Tiefe. Der Betrachter sieht sich selbst, im Autolack und in den seitlich angebrachten Rückspiegeln. Auto-mobil, aus sich selbst beweglich und bewegt sind diese, der menschlichen Erfindungskraft entwachsenen und ihr doch nahen Bodenskulpturen, die, augenscheinlich um ihrer selbst willen, nach nicht faßbaren Plänen die Räume durchmessen. Handwerklichkeit ist vorausgesetzt, Handschrift nicht gesucht. Dadurch knüpfen diese von Christiane Möbus (geboren 1947 in Celle) entworfenen Skulpturen an barocke Automaten an und isolieren den Zauber der Selbstbewegung genauso analytisch wie geheimnisvoll. In der blechernen Hülle sind die notwendigen Aggregate verborgen, die die Kurvenfahrten der gelb, schwarz und grau gefaßten Elemente ermöglichen und in ihrer Dauerbewegung doch nur etwas zu umkreisen scheinen, das selber unsichtbar und rätselhaft bleibt. Das Kreisen um eine unwägbare Mitte erscheint als eines der wesentlichen Paradigmen im Werk der in Berlin lehrenden Bildhauerin. Die „solipsistische Selbstbezüglichkeit" führt auf jenes Unfaßbare, das ironisch in den seitlichen Rückspiegeln in fiktiver Authentizität gebrochen erscheint. Der Spiegel dient der Selbst- wie der Rückversicherung für eine Bewegung, die in ein Nirgendwo führt. „Die Omnibusrückspiegel in MANPOWER, silent, zeigen nichts von der Welt, sondern allein den Reigen der selbstvergessenen Bewegungen der Objekte, die sich in ihren Spiegeln spiegeln" (Stephan Berg). Möbus führt Automobilität an sich vor, also Maschinen, die einerseits auf das menschlich Machbare verweisen und andererseits eine Entwicklung andeuten, an deren Ende sich die Maschinen über das menschlich Benutzbare und Angemessene hinaus entwickelt, sich verselbständigt haben. Insofern geht es um die Möglichkeiten und Grenzen der nicht nur automobilen Freiheit, um die ganz große Fahrt in ein diesseitiges, innerweltliches Nirgendwo. Diese automobilen Einheiten brauchen keine menschlichen Benutzer mehr. DT Eckhard Schneider: Christiane Möbus – laute und leise Stücke. Kat. Hannover 1997 Oskar Nerlinger Mit dem Album „8 Autobilder" (1927) entwirft der Maler, Zeichner und Graphiker Oskar Nerlinger (geboren 1893 in Schwann/Württemberg, gestorben 1969 in Ost-Berlin) die Vision der Raumeroberung durch die Maschine und durch das Auto. Im fortschrittlich und links orientierten Kreis um Herwarth Walden und seine Berliner Galerie „Der Sturm" fühlt sich Nerlinger der Fraktion der Konstruktivisten seit Beginn der zwanziger Jahre verbunden. 1926 ist der Mitinitiator der Gruppe „Die Abstrakten". Der antiindividualistischen Kunstauffassung des Konstruktivismus, dem künstlerischen Klima von El Lissitzkys Proun-Bildern, den Maßgaben der „Neuen Typographie" von Laszlo Moholy Nagy und Herbert Bayer, aber auch den dadaistischen Zersplitterungen der Wahrnehmungswelt antwortet bei Nerlinger eine teils abstrakt, teils gegenständlich deutbare Klarheit. Einfachheit des Bildaufbaus und stringente Sachlichkeit machen sich zum – gleichwohl suggestiven – Ausdruck der im Aufbruch begriffenen neuen Zeit und erscheinen ihrem auf Objektivität gründenden wissenschaftlich-technischen Lebensentwurf angemessen. Die Collagen bauen – darin charakteristisch für die zwanziger Jahre – auf die enge Verbindung von künstlerischer Wahrheit und Objektivität auf. Grundformen wie Kreis, Rechteck, Dreieck und Trapez in den Farben Rot und Blau werden mit Fotografien und Zeitungsausschnitten, die farblich durch ihre reine Materialität wirken, in einen dynamischen Kontext gestellt. „Die Erfahrung lehrt, daß die sachliche Darstellung die am meisten überzeugendste ist. Auch der Laie weiß, wie sehr eine zeichnerische Wiedergabe gefärbt sein kann und wie gering die Möglichkeiten der Unwahrheit der Fotografie ist" (Oskar Nerlinger). In diesem Album wird das Auto, respektive der Rennwagen, im Kontext der Welteroberung gesehen. Wie ein Komet aus der Unendlichkeit fliegt er über Hochhäuser in New York, Sanddünen in Afrika, schneebedeckte Berge, Großbaustellen, Sportwettbewerbe, Menschenmassen dahin. Er suggeriert Geschwindigkeit, Dynamik, erotische Momente, aber auch Unnahbarkeit vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der optimistisch gestimmten Vision einer technologischen Weltbeherrschung und steht im Gegensatz zum rituellen Leben tradierter Gesellschaftsformen. Getragen von der Utopie der Machbarkeit entstehen Bilder einer aus den zentralperspektivischen, dreidimensionalen Fugen geratenen Welt und des einsamen Menschen in seinem rasenden bzw. fliegenden Körperpanzer, der sich über alles Irdische, Massenhafte, Althergebrachte erhebt, und letztlich erdenfern von allem Momentanen seiner eigenen Vision lebt, die durch die kontrollier- und beherrschbare Maschine ermöglicht wird. DT Heidrun Schröder-Kehler: Oskar Nerlinger 1893–1969. Kat. Pforzheim 1993 Dennis Oppenheim Dennis Oppenheim (geboren 1938 in Electric City, Washington) hat in seinem umfangreichen und in seiner Erscheinungsweise höchst diskrepanten Werk immer wieder die Frage nach der Weltwahrnehmung des Menschen gestellt. In seinen frühen Land-Artund Body-Art-Projekten experimentierte er mit Überschneidungen innerer und äußerer Systeme. Seine Marionetten und Puppen, die als Substitute der Person des Künstlers agieren, wurden durch die gigantischen, stets die Gefahr als produktiven Aspekt miteinbeziehenden „Machine Works“ und temporären „Factories and Fireworks“ abgelöst. Hier wie auch in den großen architekturbezogenen Installationen der vergangenen Jahre wird deutlich, daß die zahlreichen, häufig absurden Maschinen und mechanischen Konstruktionen nie für eine technokratische Haltung stehen, sondern gedankliche Weltentwürfe und das Verhältnis zwischen dem Menschen und der von ihm geschaffenen Welt hinterfragen. Das Ende der achziger Jahre erlebt Oppenheim als Krise. Auf die raumgreifenden Außenarbeiten wie die eklektizistische „Impersonation Station“(1988) folgen überraschend klein dimensionierte plastische Objekte. Oppenheim erzählt, er habe in dieser Zeit nach „physiologischen Bildern“ gesucht, die sich als Metaphern für die als Zeitphänomen erfahrene Verunsicherung eigneten. Er findet sie in Tierkörpern, die in den „New Sculptures“ mal bedroht, mal bedrohlich, häufig aber auch zitathaft, ironisch gebrochen, etwa auf Wortspiele und sprichwörtliche Redensarten bezug nehmend auftreten und in Kombination mit Verweisen auf die zur zweiten Natur gewordene Technik stellvertretend für die Erdenbewohner schlechthin erscheinen. „Second Generation Image Zebra“ verbindet alle diese Aspekte und Ambivalenzen: Als augenfällige Hohlform ist es ein in mehrfacher Hinsicht „falsches“ Trojanisches Pferd, aus dessen Innerem ein Spielzeugauto wie aus einem Tunnel herausfährt. Trotz der Umkehrung der Größenverhältnisse wirkt die sich hier vollziehende feindliche Übernahme virulent, da sich die Grenzen zwischen lebendigem Leib und toter Maschine aufzulösen scheinen. Erinnert das Auto durch den dicken roten LatexÜberzug an eine Zunge, die als Irrtum einer genetischen Manipulation nun an der falschen Stelle aus dem Körper ragt, so ist das Zebra eine tote Hülle. Die Augen und Nüstern sind geschlossen und die ornamentalen Streifen, die den Körper überziehen, erweisen sich als Reifenspuren. Vom doppeldeutigen Wort Zebrastreifen ist es nicht weit zu Bremsspuren. Ein zynisches Zitat der Tyre-prints von Robert Rauschenberg? Interpretationsmöglichkeiten bieten sich viele, allen gemeinsam ist die Verbindung zum Auto, diesem hier so harmlos erscheinenden Spielzeug, das doch bereits überall seine Spuren hinterlassen hat. MB Dennis Oppenheim: And the Mind Grew Fingers. Selected Works 1976–90. The Institute for Contemporary Art, P.S.1 Museum, New York 1992 Blinky Palermo Es gibt nur sehr wenige Arbeiten im Werk von Blinky Palermo, die einen eindeutigen Gegenstandsbezug aufweisen. Spätestens seit seinem Eintritt in die Klasse von Joseph Beuys an der Düsseldorfer Akademie 1964 arbeitet er an gegenstandslosen Konzeptionen, konzentriert sich auf einfache Formen und Farbanordnungen. Die formale Neuorientierung wird begleitet durch die Wahl eines neuen Namens: Peter Heisterkamp (geboren 1943 in Leipzig, gestorben 1977 auf den Malediven) nennt sich von nun an Blinky Palermo. So streng seine in den folgenden 13 Jahren entstehenden Objektbilder und Bildobjekte, seine Stoffbilder und Wandmalereien zunächst erscheinen, so sind sie doch nie Illustrationen einer Theorie, sondern verdanken ihre kraftvolle Intensität dem Zusammentreffen des Wirklichen (sei es ein Fundstück oder der Verweis auf erlebtes Leben) mit dem konzeptuell Gesetzten. Eindrücklichstes Beispiel für diese Ambivalenz, die der formalen Klarheit jegliche Dogmatik nimmt, ist das Gemälde „Flipper“, dessen Farbgeometrie der Seitenbemalung eines Spielautomaten folgt und so die triviale Bilderwelt des Alltags mit der Erhabenheit der Gegenstandslosigkeit verbindet. Der Siebdruck „Auto“ gibt als Farbform scheinbar die groben Umrisse eines Autos in Seitenansicht – allerdings ohne Räder – erkennbar wieder. Die in zwei Brauntönen serigraphierte, nahezu opake Form steht leicht schräg im Bild und unterscheidet sich im Malduktus deutlich von der sich auf der rechten Bildseite expressivmalerisch ausbreitenden türkis-blauen Pinselschrift. Etwas geschieht zwischen den zwei konträr aufgefaßten Bildbereichen, ein Zusammenstoß? Schwarze Kleksformen scheinen hinter dem Auto aufzusteigen. Verschließt sich der Siebdruck einer eindeutigen Lesart ebenso wie einer Vergleichbarkeit mit anderen Bildtypen im Werk Palermos, so handelt es sich bei dem aufcollagierten Oval, das die Kontur des Autos fast zu sprengen scheint und zugleich als Fläche definiert bleibt, um eines der immer wiederkehrenden Bildzeichen Palermos. Bereits 1966 entsteht die „Graue Scheibe“ als Wandobjekt, deren ovale Form 1970 in einem der frühesten druckgraphischen Werke Palermos aufgegriffen und mit dem schwarzen Quadrat, dem grünen und dem blauen Dreieck zu den „4 Prototypen“ in einer Mappe zusammengefaßt wird. Als freie, sich in ihrer leichten Unregelmäßigkeit gegen eine Geometrisierung behauptende und dadurch lebendige Form steht das Oval auch im „Auto“. Als Form an sich behauptet es sich gegen das scheinbar als konkreter Verweis erscheinende Auto und stellt es damit zugleich in Frage. Wie sicher wären wir, daß es sich bei der braunen Form um ein Auto handelt, wenn nicht der Titel uns diese Denkrichtung vorgäbe? MB Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst: Blinky Palermo. Kat. Leipzig 1993 Francis Picabia „Die Vernunft läßt uns die Dinge sehen in einem Licht, wie sie nicht wirklich sind. Und schließlich: Wie sind sie wirklich?" So kennzeichnet Francis Picabia (geboren 1879 in Paris, 1953 dort gestorben) die produktive Skepsis, mit er die internationale Avantgarde der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rezipierte und irritierte. Picabia, Maler und Schriftsteller, war theoretischer Geist und erfindungsreicher Bildproduzent, aktiver und abtrünniger Dadaist, Provokateur und reicher Bonvivant mit männlicher Lust an schnellen Autos. Dank finanzieller Unabhängigkeit besaß er eine Sammlung verschiedener Sportwagen und Limousinen, die er – in seinen eigenen Worten – um die Sammlung schöner Frauen ergänzte. Sein Werk ist geprägt von stilistischer Willkür, Gemälden in den unterschiedlichsten Stilhaltungen vom Pointilismus über Prä-Pop bis zu Prä-Minimalismus und Kinokitsch. Reproduktionen nach eigenen Werken lassen sich als Retroästhetik oder als selbstbezügliche Appropriation qualifizieren, als dies noch nicht Mode war. In den Jahren von Dada in Zürich, Köln, Berlin, Paris und New York entstehen „Mechanomorphien" im Zwischenreich der erotisch-mechanischen Maschinenphantasien. In einem Raumkasten erscheint eine fiktive Konstruktion, die aus Teilen eines Autos entwickelt sein könnte. Die Maschine wird zur Metapher erotischer Assoziationen, das Umeinanderkreisen, das Einund Durchdringen großer und kleiner Röhren, das Energie freisetzende Stampfen von Zylinder und Pleuelstange inszenieren die „Parade der Liebe" (1917). Picabia antwortet so auch auf die Technikeuphorie der italienischen Futuristen. Die Bilderwelt der Nicht-Kunst wird für den anarchischen Surrealisten früh zur Quelle für bildnerische Reflexion. So wandelt sich die technische Zeichnung einer Zündkerze zum „Portrait of an American Girl in the State of Nudity" (1915), ein ironischer Kommentar zur zündenden Wirkung der Technik auf die Männerwelt. Das erotische Moment, das Menschen innerlich bewegt und motiviert, verlagert sich in ein Maschinenteil. Die Zündkerze, die das Benzin-Luftgemisch zur Explosion bringt, das Motor und Wagen antreibt, ist (gegenläufig zum Titel) auch ein phallisches Symbol der neuen Zeit, in der die Wirtschaft belebt, die Welt gestaltet und soziales Prestige begründet wird. Die Männerphantasie maschinenanaloger Weltaneignung verleugnet Picabia mit seiner Faszination für schnelle Autos keineswegs, unterfüttert sie allerdings mit einem ambivalenten Wortspiel. Der auf Wertarbeit verweisende Schriftzug „For Ever" auf der Zündkerze spielt auf den Wunsch nach erotischer Dauer an, ohne sich über die desillusionierende Mechanisierung menschlicher Sexualität zu täuschen. DT William A. Camfield: Francis Picabia. His art, life and times. Princeton 1979 Richard Prince Ende der siebziger Jahre ist der in New York lebende Richard Prince (geboren 1949 in der Panama-Kanal-Zone) dazu übergegangen, bestehende Fotografien nochmals fotografisch zu reproduzieren. Er fotografiert Anzeigen von Motorrädern und aus Fachzeitschriften, Fotos aus der Szene der Rocker und ihrer freizügig posierenden „Girlfriends“. Aus den Massenmedien entnimmt er Bilder von heroischen Marlboro-Männern einerseits, von den Hippie-Erben der Cowboys andererseits, den ungezügelten Easy Ridern, die mit ihren schweren Maschinen die Straßen beherrschen. Auf den Highways kehren amerikanische Mythen wieder. Das Pferd wurde gegen das Automobil ausgetauscht, die Maschine behielt jedoch animalische Züge. Die von Prince veranschaulichte Analogie zum Hai hat Tradition: Bereits in Marinettis „Manifest des Futurismus“ von 1909 ist von Autos als „Bestien“ die Rede. In den „Abflußgraben einer Fabrik“ geschleudert, bergen „Fischer und (...) Naturforscher“ den Wagen „wie einen großen gestrandeten Haifisch“. Der automobilen Raserei entspricht dabei der futuristische Bildersturm gegen die statischen Kunsttraditionen. Die Mobilie Auto wurde gegen die Immobilie des Museums als Friedhof der Kunst in Stellung gebracht. Stand die dynamische, zerstörerische Maschine dort als Zeichen des ästhetischen Aus- und Aufbruchs, so signalisiert sie bei Prince die Freiheit an den sozialen Rändern und verweist zugleich auf das Aggressionspotential, das sich unter der Herrschaft repressiver Wohlanständigkeit der Mittelklasse anstaut. Teil 1 von „Creative Evolution“ (1985) zeigt, wie riesige Monster-Trucks kleinere (Schrott–)Autos überrollen. Teil 2 suggeriert den monströsen Aspekt des Autos im Allgemeinen. Offensichtlich sind dem Auto nicht nur heimtierähnliche Eigenschaften zugewachsen, es trägt auch die Symbolik von Jagd und Kampf, die sich in der Benennung von Automobilen – etwa als Jaguar oder Thunderbird – wie auch im Design niederschlägt. Wie rohe Muskelprotzerei und Dominanzgebärde wirken die übergroßen ‚Monster-Reifen‘. Aber auch bei PKW-Karosserien sind die zähnefletschenden Physiognomien der Kühlergrills in verdeckter Form als Drohgebärden zu verstehen. Vermeintliche, durch diese Symbolik noch verschärfte Aggressionen durch zu nahes Auffahren oder (Licht-)Hupen lösen selbst beim sanftmütigsten Autofahrer eine Art defensiver Urreaktionen aus. Wir entdecken uns dabei, im Auto aggressiver zu sein als in anderen Alltagssituationen. Bei Verstößen gegen die territoriale Integrität, die wir von unserem Körper auf unser Auto und dessen Umfeld ausdehnen, regt sich das Tier in uns, das sein Revier verteidigt. Prince hält uns den Spiegel vor. FE Richard Prince: Photographien/Photographs 1977–1983. Hannover 1994 Jason Rhoades Im Fußraum vor dem Beifahrersitz des Chevrolet Impala sind nicht Pappbecher und andere Verpackungen von Fastfood zu sehen, sondern eine Installation von Paul McCarthy. So erklärt der Fahrer, Jason Rhoades (geboren 1965), den Einbau seines Künstlerkollegen und früheren Lehrers an der UCLA in Los Angeles. Die Limousine wird zum Ausstellungsraum. Als alltagspraktische und als Ideen-Vehikel sind Automobile für Rhoades kraftvolle Beschleuniger, etwa wenn sich sein Atelier um einen regelmäßig (natürlich mit dem Auto) aufgesuchten Autofriedhof erweitert oder wenn der „Impala“ zwei Ausstellungshäuser in Zürich und Nürnberg im realen Pendelverkehr oder als bedachtsam positionierte Parkplatzskulptur aufeinander bezieht. Die Anregung, überhaupt Außenskulpturen aufzustellen, geht auf Rhoades´ Beobachtung des Markterfolges des Pontiac Fiero in den USA zurück. Vor allem durch sein Design bediente der zweisitzige Sportwagen Ende der achziger Jahre amerikanische Klischeevorstellungen von europäischer Hochwertigkeit, ohne tatsächlich pannensicher zu sein. Das machte den Fiero zu einer häufigen, oft sehr langfristig installierten „Außenskulptur" (Rhoades) vor amerikanischen Eigenheimen und regte den Künstler zu seinem „Monaco Fiero“ (1994) an. Aus der Welt vorstädtischer Autofreunde stammt auch der Ausdruck „cherry" (etwa: aufgemotzt) im Titel von „Cherry Makita" (1993). Als Mischung von Atelier und Autowerkstatt verknüpft die Installation die Rollen von Hobbymechaniker, Künstler und (fiktivem) ExRennfahrer und zeigt in ihrem Zentrum einen Chevroletmotor, der mit seiner vollen Kraft an einen Heimwerkerbohrer („Makita") angeschlossen ist. Der groteske Kraftüberschuß steht zum einen für phallische Energie, die Rhoades immer wieder als ebenso kruden wie grundsätzlichen Antrieb künstlerischer Arbeit vorführt. Zugleich steht die Übermotorisierung für den explosionsartigen Entwicklungsprozeß der Moderne, dem laut Rhoades alle Bremsen abhanden gekommen sind. Häufig verbindet der Künstler in seinen Arbeiten Elemente von Willkür und Aggressivität mit fein abgestimmten Verweisstrukturen und einem geradezu ethnologischen Sensorium für Alltagsmythen der automobilen Konsumgesellschaft. Wie viele andere Arbeiten Rhoades´ ist „Fucking Picabia Cars / Picabia Car with Ejection Seat" (1997/2000) eine Weiterentwicklung aus vorherigen Installationszusammenhängen, in diesem Fall „The Intersection of the Autopursuits" (1997, Biennale Venedig). Die Autosilhouette ist nun kopfüber eingespannt in ein Gestänge, das seinen Gegenstand einerseits analytisch-investigativ zu präsentieren scheint und ihn andererseits mit groteskem Pathos himmelwärts dynamisiert. Der rote „Ejection seat“, eigentlich Ausstattung eines Düsenjets, gleicht den automobilen Geschwindigkeitsrausch männlicher Sexualität an. Wie ein Same kann der Fahrer auf dem Höhepunkt einer wilden Tour aus dem Autokörper herausgeschleudert werden. MW Eva Meyer-Hermann: Volume A Rhoades Referenz. Kat. Kunsthalle Nürnberg, Köln 1998 Gerhard Richter Als Gerhard Richter (geboren 1932 in Waltersdorf, Oberlausitz) Anfang der sechziger Jahre begann, nach meist schwarzweißen Vorlagen aus Prospekten, Zeitungen oder dem Fotoalbum zu malen, waren seine Bildsujets von herausfordernder Trivialität: unspektakuläre Tier-Darstellungen und Familienporträts, Einrichtungsgegenstände, touristische Sehenswürdigkeiten, Flugzeuge und Autos. Es war „eine Art Flucht“ ins Banale (Richter, 1970), eine Variante der Pop Art, die weniger auf die kommerziellen Massenbilder der Werbung und Unterhaltung als auf die Welt des Kleinbürgerlichen abzielte. Angesichts der Seltenheit italienischer Marken, auf die sich Richter in seinen Auto-Bildern offensichtlich konzentrierte, waren ein „Ferrari“ (1962), ein „Alfa Romeo“ (1965, nach einem Zeitschriftenausschnitt) oder eben „Zwei Fiat“ (1965) sicher einen Schnappschuss wert, wenn man ihnen auf der Straße begegnete. Vom konkreten Gegenstand der mutmaßlichen Vorlage (eines Urlaubs- oder Pressefotos) löst Richter seine Darstellung aber gezielt ab. Die bildnerische Organisation wird flächiger und diffuser. Richter verunklärt die Konturen und verstärkt vorhandene Unschärfen durch Verwischungen. Dem Abbild wird so auf Kosten seiner Deutlichkeit eine anderes „Bild“ abgewonnen, das zwar mit seiner Fotoähnlichkeit die Objektivität der Fotografie anstrebt, zugleich aber die Eigengesetzlichkeit der Malerei betont. Er habe das Foto „nicht als Mittel für eine Malerei [benutzen], sondern die Malerei als Mittel für das ‚Foto‘ verwenden“ wollen, sagt Richter 1972 im Rückblick. Richters Foto-Gemälde desillusionieren, sie betonen den Scheincharakter der Gegenwart des Bildes in der Malerei und hinterfragen zugleich die Zurechnungsfähigkeit der realen Fotografie. Nur sehr bedingt gelingt es dem Fotografen – zumal dem Amateur – Bewegung wiederzugeben. Indirekt verweist dies auf die relative Langsamkeit der menschlichen Wahrnehmung. „Zwei Fiat“ huschen vorbei und lösen sich vor unseren Augen wie vor der Kameralinse förmlich auf. Man ist erinnert an die frühen sachfotografischen Experimente Anton Stankowskis zur Visualisierung von Geschwindigkeit. Die irritierende Verfremdung des Gegenstands in Richters „Foto-Malerei“ (Klaus Honnef) reflektiert, wie sehr Auto und Fotoapparat als die beiden zentralen raumüberwindenden Maschinen des 20. Jahrhunderts unsere Sichtweise der Welt geformt haben. FE Gerhard Richter. Kat. 36. Biennale in Venedig, Essen 1972 Gerhard Richter. Bilder 1962–1985. Köln 1986 James Rosenquist Ein Stückchen Wiese im späten Frühjahr vielleicht, Gras in lichtem Grün, vereinzelt mit Gelb durchsetzt, eine lockere Struktur von Kreidestrichen, ohne festen Grund, darüber in Grautönen ein spiralförmig verdrehter, geplatzter Autoreifen. Nicht abgefahrenes Profil ist der Grund für die Zerstörung. Der ausfransende Rand suggeriert eine über die physischen Grenzen hinausgehende Belastung, eine unkontrollierte Explosion, vielleicht das Scheitern eines Lebensplans durch einen Unfall. James Rosenquist (geboren 1933 in Grand Forks, North Dakota) ist gelernter Werbegraphiker und Reklamemaler und einer der führenden Protagonisten der amerikanischen Pop Art. Werbung, die kollektiven Mythen der Warenwelt, die Suggestion eines Paradieses auf Erden ohne Verfall und Tod sind sein Bildmaterial, mit dem er durch bloßes Zitat und präzise Kombinatorik gesellschaftlich relevante und unbewußt wirksame Realien des menschlichen Bewußtseins und Abgründe einer industrialisierten Lebenswelt aufdeckt. Seit Beginn der sechziger Jahre hat er der gegenständlichen Malerei in seinen zumeist großformatigen Gemälden eine neue Dimension eröffnet. „In meinen Bildern müssen die Dinge lebens- und überlebensgroß sein. Ich glaube, dass es möglich ist, einem etwas so nahe zu bringen, daß man hindurchsehen kann. Ich liebe, die Dinge in unerwartete Nähe zu bringen... und zu sagen: Na, wie gefällt es Dir?" (James Rosenquist 1972). Dies gilt auch für das großformatige Pastell „Blow Out“ (1970), das ein alltägliches Motiv monumentalisiert zeigt. Hier scheint das Unvorhersehbare auf, jenseits von hochglanzpolierten Karosserien mit aufsehenerregenden Chromleisten, prestigeträchtigen Ledersitzen und PS-Zahlen, Geschwindigkeitsrausch und Traum der Selbstverwirklichung. Hat sich hier menschliches Schicksal, Planen, Lebenskampf, Lebenslust und Lebensglück, entschieden an einem von vier nur wenig mehr als postkartengroßen Gummistücken, die den Kontakt zur Erde bilden? Der nicht nur „American Dream" grenzenloser Raumeroberung scheint an sein unerwartetes Ende gekommen zu sein: „Blow out" heißt Reifenpanne, aber auch „Licht ausblasen, auslöschen, sich eine Kugel durch den Kopf jagen, zertrümmern." Der Reifen liegt auf einer Wiese, körperhaft und zugleich eine Spirale, wie eine in sich verdrehte Straße, entfernt auch an die Doppelhelix einer menschlichen DNS erinnernd, ein Lebensweg von irgendwoher, der immer ein Ende hat. Rosenquists Zeichnung gibt sich so banal und abgründig wie ein dummerweise geplatzter Reifen. DT Evelyn Weiss: James Rosenquist. Kat. Museum Ludwig Köln 1972 Edward Rusha Als Edward Rusha (geboren in Omaha, Nebraska) 1963 sein später legendäres Fotobuch „Twentysix Gasoline Stations“ veröffentlichte, teilte er mit der amerikanischen Pop Art jener Jahre die scheinbar naive Hinwendung zu Alltag und Konsum, wodurch die hochmögenden Abstrakten Expressionisten und Ideographen der fünfziger Jahre mit ihren erlesenen LateinKenntnissen plötzlich ins kunsthistorische Abseits gesetzt wurden. Wie andere damals junge Künstler, etwa Rauschenberg und Johns, sah Rusha in malerischer Vergeistigung und Überhöhung eine Sackgasse, nicht zu vergleichen mit der visuellen Reizdichte am Straßenrand bei heruntergekurbeltem Wagenfenster. Die „Twentysix Gasoline Stations“ liegen an der berühmten Route 66, die Rusha als Student zwischen Los Angeles und dem Heimatort seiner Jugend in Oklahoma häufig entlang fuhr. Eine ebenso berühmte Straße stellte Rusha 1966 ebenso lapidar in seinem acht Meter langen, zickzack gefalteten Buch „The Sunset Strip“ dar. Zu sehen sind die Gebäude am bekanntesten Straßenzug Hollywoods, und zwar fortlaufend am oberen und kopfüber am unteren Rand einschließlich eingedruckter Hausnummern. Mit Hilfe der seriell und wertungslos aneinandergereihten Einzelfotos übersetzt die Arbeit eine langsame Autofahrt in ein Buch. Rushas insgesamt 16 Fotobücher und seine großformatigen Leinwände mit isolierten Wörtern wie „Flash, „ACE“ oder „Smash“ bestechen durch ihre Lakonie. Die Wörter funktionieren nicht als philosophischer Resonanzraum (wie etwa die Bildtitel Barnett Newmans), sondern sie scheinen Rusha buchstäblich während des Autofahrens zugefallen zu sein. „Fisk“ oder „Electric“ prägen sich als Schlagworte großer Werbetafeln am Highway sekundenkurz dem Blick des Vorbeifahrenden ein und dringen als kontextloser Splitter in die automobil zerstreute Wahrnehmung ein, um dort beziehungslos, aber werbesprachlich grell präsent zu bleiben: „Words without thoughts“ (Titel einer Installation in Miami 1985). Wie Hannah Höch und Giacomo Balla zu ihrer Zeit zieht Rusha die Summe aus der unausweichlichen Veränderung der menschlichen Wahrnehmung durch das allgegenwärtige Automobil. In den sechziger Jahren ist der Kraftwagen, sind Ausfallstraßen und riesige Parkplätze längst zur natürlichen Umwelt des weißen amerikanischen Wohlstandsbürgers geworden, hat die urbane Automobilisierung die vormals übermächtige Natur Nordamerikas bezwungen und zum eingezäunten Reservat gemacht, das mit dem Auto besichtigt werden kann. Das Fotobuch „Thirtyfour Parking Lots in Los Angeles“ (1967) widmet sich der Realität riesiger, ganze Landschaftszüge einnehmender Parkplätze und übertrifft – ein fast boshaft ironischer Nebeneffekt – durch geschickte Wahl der Blickwinkel und Tageszeit mit seinen Schwarzweißmustern manche malerische Bemühung des Abstrakten Expressionismus. MW Neal Benezra, Carry Brougher: Ed Rusha. Kat. Zürich Berlin New York 2000 Harry Sachs Der in Berlin lebende Harry Sachs (geboren 1974 in Stuttgart) thematisiert in seinen Performances und Videoarbeiten die durch das Auto veränderte Wahrnehmung der mit dem Auto er-fahrenen Welt. Der Film „Opel – Zuverlässig in die Zukunft“ (2000) gleicht zunächst in Teilen einem Werbespot. Er wird durch Slogans eingeleitet, bald aber bemerkt man, daß die Wahl auch auf ein beliebiges anderes Modell hätte fallen können. Die vorangestellten Botschaften – „Vielseitig im Straßenverkehr“ und „Sicher im Gelände“ – werden nicht mit technischen Details belegt. Sie geben eher abstrakte Stichworte von idealer Funktionalität, mit denen die Werbung auf kollektive Visionen antwortet. Solchen „Visionen vom perfekten Auto“ nähert sich Sachs mit einer ungewöhnlichen Umrüstung seines Opels an. Zunächst steigt der Künstler von oben in den mit Plastik ausgekleideten und gänzlich mit Wasser angefüllten Wagen. Sobald die Luftversorgung über eine herkömmliche Sauerstofflasche gewährleistet ist und der Wagen mit röhrendem Motor anfährt, kann sich ein ganz neues Fahrgefühl einstellen. Wie in einer Blase, einem „rollenden Uterus“, als den Peter Sloterdijk das Auto im allgemeinen charakterisiert hat, ist der Fahrer geborgen. In den Innenraum dringen kaum Geräusche. Sachs gleitet wie in einem Aquarium durch den Stadtraum. Im Wasser ist er beinahe schwerelos – man scheint durch die Landschaft zu fliegen. Mit ihrer Taucherausrüstung erinnern Sachs und seine Beifahrer, die im zweiten Teil des Videos für eine „Gelände“-Fahrt auf einem Sportplatz zusteigen, entfernt an die frühen Weltraumfahrer, die Heroen des in den fünfziger Jahren eingeläuteten Jet-Zeitalters. Seither ist das Auto, so Sachs, die „Rakete des kleinen Mannes“, der eigentlich auch gern Astronaut sein möchte. Die dynamischen Heckflossen amerikanischer Straßenkreuzer gaben diesem Traum Form. Im Video ist allerdings die Innenperspektive dominant. Der surreale Charakter, den die Außenwelt des automobilen Wasserbehälters annimmt, zeigt mittels Übertreibung, wie sehr die raumdurchdringende Maschine unsere Wahrnehmung bereits verändert hat. Daß wir im Laufe unseres automobilen Daseins oder auf Reisen „wachsen“ (auch über unser Auto hinaus), suggeriert auf ironische Weise eine zweite Arbeit, die in Zusammenarbeit mit Franz Höfner und Michael Böhler entstand. Während einer Performance im rumänischen Cluj füllten Kompressoren allmählich aufblasbare Westen, welche die vier Insassen eines „Skoda Elan“ (1998) tragen und sie förmlich aufquellen lassen. FE Georg Scholz Auf dem 30,5 x 49,3 cm großen Aquarell der frühen zwanziger Jahre zeigt sich eine urbane Straßenszene. Während auf der rechten Bildseite ein feister, rosiger, in Anzug und Fliege gepreßter Herr mit Monokel und Zigarre aus dem Fond eines offenen roten Automobils glotzt, gehen links im Bild ein knochig magerer und gebückter Mann mit einem zerschlissenen Jacket und ein ebenso armseliger Junge auf der Straße. Beide tragen die „Badische Morgenpost“ unter dem Arm. Den Hintergrund bildet industrielle Architektur mit Gastürmen und Schornsteinen. Auffallend ist die Bilddialektik, die Georg Scholz (1880– 1945) einsetzt: Dem dicken Reichen, dessen dralle Leibesfülle sich in den runden Formen des luxuriösen Automobils wiederholt, steht die ausgemergelte Gestalt des Arbeiters gegenüber. Das satte Rot der motorisierten Kutsche steht im Kontrast zum Grau der Straße, das sich in Gesicht und Kleidung der beiden Figuren aus der Arbeiterschicht spiegelt. Scholz zeichnet weniger eine realistische Momentaufnahme eines städtischen Straßenbildes als ein mit Symbolen besetztes Gesellschaftsmodell. Während das Auto in den Schriften der Futuristen als ästhetisches Beschleunigungsmotiv gefeiert wird und zur Revolutionsmaschine mutiert, oder in den urbanen Zukunftsvisionen etwa eines Oskar Nerlinger die Erscheinung der neuen Stadt prägt, deren konzentrierte Masse es logistisch zu organisieren gilt, fungiert das Motiv des Autos bei den Malern der Neuen Sachlichkeit, zu denen auch Georg Scholz zählt, als Herrschaftssymbol in statischer Form. Obwohl sich nach dem Ersten Weltkrieg der Werterelativismus längst zur kulturellen Grundfolie entwickelt hatte, vor der sich die bisherige Gesellschaftsordnung aufzulösen begann, und internationale Kunstbewegungen wie die Futuristen und Dada den neuen Menschen und damit auch die neue Gesellschaft ausriefen, behaupteten Künstler wie Scholz und Grosz in ihren Bildern weiter eine statische Klassengesellschaft – wenn auch in zugespitzter und pervertierter Form: Unternehmer, Arbeiter, Intellektueller, Soldat, Prostituierte. Wie bei Grosz haben auch die Typisierungen von Scholz den karikaturhaften Charakter der politischen Zeichnung. Das Auto interessiert nicht an sich in seiner eigenen Ästhetik, sondern hat lediglich Zeichenqualität. Mit „Zeitungsträger“ (1920/21) positioniert sich Scholz zwischen der politischen Persiflage des Dada und dem sozialen Realismus der Malerei der Neuen Sachlichkeit. Arbeiter und Industrieller bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, das Automobil als Machtsymbol aber scheint für den Transfer auf die offensichtlich erfolgreichere Seite zu garantieren. D.E. Georg Scholz: Malerei, Zeichnung, Druckgrafik. Kat. Stadt Waldkirch, 1990 Dirk Skreber Lang, sehr lang dehnt sich die Haube des amerikanischen Straßenkreuzers aus der Tiefe des Bildraums dem Betrachterblick entgegen und läßt den Vordergrund der Bildbühne unbetretbar erscheinen. Nur der Blick darf in diesen Showroom hinein. Betreten nicht erwünscht, außer, du bist wirklich cool, mindestens so cool wie der Schlitten hier! Autokarosserien können vorsprachlich und doch sehr wirksam Imponiersignale aussenden, wie sie Dirk Skreber (geboren 1961 in Lübeck) in seinem Ölbild von 1987 festhält. Ein wenig allerdings sabotieren das Altmeisterliche von Maltechnik und Farbgebung sowie die liebevoll ausgepinselten Ornamente auf Boden, Gardine und Säule den unterkühlten Auftritt. Auch daß sich das Automobil in der Bildkomposition noch unter die Trennlinie von Boden und Vorhang duckt, läßt es fast wie eine platte Flunder auf dem Boden eines trüben Aquariums erscheinen. Nichts ruiniert Effekt heischende Auftritte nachhaltiger als verrutsche Details und kleine Lächerlichkeiten. Die allerdings nimmt Skreber bewußt in Kauf, wenn der Malprozeß sie mit sich bringt, oder baut sie, wo nötig, ein – denn: Nichts ist, wie es scheint. Sanft und ein bißchen schräg geht bei Skreber diese Desillusion aus dem Illusionismus von Bildtiefe und Gegenständlichkeit hervor. Auch in dem extravaganten Aufblick (1990) auf sechs amerikanische Gasoline Guzzlers, übermotorisierte Schaukelschiffe der Landstraße, verschließt sich Skrebers Manierismus nicht zum Selbstzweck, sondern ist innerbildliche Infragestellung eingewöhnter Seherwartungen. In welchen Raum blicken wir eigentlich? Auf den Parkplatz vor einem Hochhaus in Houston oder Alabama? Dafür wirkt das Bildlicht zu künstlich. Sehen wir von einem Studiogerüst auf ein Filmset hinunter? Oder zeigt der Bildausschnitt ein aufwendig hingebasteltes Detail aus einer Spielzeugeisenbahnlandschaft? In einem fast quadratischen Bild von 1988 fahren ein gelbes und ein blaues Auto im Kreis, geführt von zeigerartigen Armen wie auf einer überdimensionalen Uhr. Auf der Kreisbahn mit weißer Straßenmittemarkierung fährt das eine Auto auf der Innen-, das andere auf der Außenbahn. Besteht das Gestänge, das beide Autos mit dem Mittelpunkt verbindet, aus zwei gegeneinander beweglichen Armen oder ist es eine durchgehende Stange? Was soll die Anordnung? Ein Abnutzungstest für Autoreifen von 1961? Eine Souveniruhr für Autofreaks vom Hockenheimring? Ein sekundenkurzer Bildgedanke, wie er einem im Halbschlaf durch den Kopf schießt? Skrebers desillusionierter Manierismus, das Ineinander von schnoddrig stehen gelassenen Verzerrungen und melancholisch entrücktem Bildlicht, ermöglicht ihm eine suggestive Sentimentalität ohne Kitsch. Als Erwachsene bestaunen wir Automobile durch Kinderaugen, also auf eine für immer verlorene Weise. MW Skreber. Kat. Kunstraum München e.V., Kunsthalle Rostock. München 1992 Anton Stankowski Während seines Studiums an der Folkwangschule in Essen 1926–1929 hat sich der in Stuttgart tätige Grafiker, Fotograf und Maler Anton Stankowski (geboren 1906 in Gelsenkirchen, gestorben 1998) mit den Regeln einer „Neuen Fotografie“ vertraut gemacht, wie sie der Bauhaus-Lehrer Laszlo MoholyNagy theoretisch propagierte. Nach den Prinzipien dieses „Neuen Sehens“ rückte er die gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie, ihre Mittel und Wirkungen in den Vordergrund. Überzeugt von der Eigengesetzlichkeit des fotografischen Mediums legte er den Schwerpunkt seiner Arbeiten auf die Erfassung optischer Phänomene. Zentral für Stankowskis Sachfotografie ist die Suche nach dem richtigen Belichtungsmoment, um das Flüchtige festzuhalten. Gleicht die Bezeichnung eines früheren Fotos als „Zeitprotokoll mit Auto“ (1929) den abstrakten Titeln Giacomo Ballas, so ist bei einer Fotografie von 1930 unter Betonung der Kameramechanik auch die Belichtungszeit mathematisch präzise angegeben und ins Verhältnis zur Geschwindigkeit des fahrenden Autos gebracht: „1/100 sec. bei 70 km/h“. Der Titel weist das Foto als Experiment aus. Unter den genannten Wahrnehmungsbedingungen verwandeln sich die Bäume am Rand einer Straßenflucht zu amorphen Mauern und vermitteln ein Gefühl von Geschwindigkeitsrausch. Aus der spektakulären Perspektive wird die Landschaft für den Autofahrer respektive den beifahrenden Fotografen zum Film. Die Unschärfe, die zu eliminieren eine der großen Herausforderungen der frühen Fotografie war, ist nun als bewußtes Gestaltungselement eingesetzt. Die Verwischungen visualisieren Bewegung. Beeinflußt vom „Futuristischen Fotodynamismus“ (Giulio Bragaglia) verbildlicht Stankowski jene Dynamik der technisierten Lebenswelt, deren erstes Symbol den italienischen Futuristen das Auto war. Ihrem Programm zufolge sollte die durch die Maschine ermöglichte, beschleunigte Bewegung und die damit einhergehenden Veränderungen des menschlichen Wahrnehmungsapparates die bestehende ästhetische Ordnung kippen. In F.T. Marinettis Hymne „An das Rennautomobil“ ( 1912) ist der Traum vom rasenden, durch die Maschine geläuterten Körper mit dem Appell verknüpft, die Fesseln der (Kunst-)Tradition zu sprengen: „Die Bremsen los! Ihr könnt nicht? Brecht sie denn, daß sich des Motors Schwung verhundertfacht! Hurrah! Die niedre Erde fesselt mich nicht mehr. Endlich befrei ich mich und fliege schon (...).“ FE Stephan von Wiese (Hg.): Anton Stankowski. Das Gesamtwerk (...). Stuttgart 1983 Anton Stankowski: Fotografie. Kat. Staatsgalerie Stuttgart 1991 Heinrich Weid Das Ornament verziert die Oberfläche, ist dekoratives Beiwerk, zählt zum Kunstgewerbe und hat in anspruchvoller, sich selbst reflektierender, autonomer Kunst keinen legitimen Platz. In der älteren Kunstgeschichtsschreibung wurde das Ornament vor allem solchen Epochen zugeordnet, deren Zeitvorstellungen nicht ergebnisoffen und evolutionär, sondern zirkulär geschlossen, eigentlich statisch sind: das Ornament als Form gewordene Wiederholbarkeit, Ereignislosigkeit. Heinrich Weid kommen solche Qualifizierungen gerade recht, um sich beherzt über sie hinweg zu setzen. Zwar liegen ihm die historischen Ornamentformen – ob nun Knorpelwerk oder Ohrmuschelstil – nicht als solche am Herzen. Aber daß Tapeten, Gußkeramik mit fein strukturierter Oberfläche oder verzierte Pavillons im Park heute keine ernstzunehmenden Themen der Kunst sein sollen, hindert den Künstler nicht daran, sich genau diesen zuzuwenden und fast barocke Raumzusammenhänge zwischen Wandgestaltung und Kleinskulptur herzustellen. Im maschinenkonformen Rapport des Tapetenmusters erscheinen zwischen Autoreifen verkehrsschilderartige Männchen, funktionale Piktogramme für „Mensch“, wie sie eigenartigerweise für das späte 20. Jahrhundert mit seinen normativen Menschenrechten, ausdifferenzierten Lebensstilen und kundenbezogenen Konsumangeboten typisch sind. In dreidimensionaler Form und zugleich aus der starren Wiederholung des Tapetenmusters gelöst, variiert Weid das schematische Modul „Mensch“ in den Keramiken, die wandleuchterartig aus dem Tapetenmuster hervortreten. Die Keramikgüsse, die der Künstler in einem aufwendigen, halbindustriellen Verfahren selbst herstellt, wirken im ersten Augenblick als ironische Travestie eines Kerzenhalters. Auf den zweiten Blick jedoch ergibt sich aus Weids Verwendung kunstgewerblicher Verfahren und Stilelemente neuer Sinn. Das Ornamentale umspielt hier keinen anderen, „eigentlichen“ Inhalt mehr. Es zeigt sich selbst als genuin leere Form. Die Groteske der Renaissance machte den menschlichen Körper zum ornamentalen Stückwerk, setzte Köpfe und Oberkörper mit pflanzlichem oder abstraktem Rankwerk gleich. Diese beunruhigende, heute unterschwellig brutal wirkende Verfügung über den Menschenkörper erfährt in Weids keramischen Mischwesen eine absichtsvolle Variation. In manchen seiner Wandskulpturen geraten menschlicher und maschinaler Körper ineinander, wird die Autokarosserie zur Leibeshülle und umgekehrt. Aus der lakonischen Harmlosigkeit von Spielzeug (die Grußformen der Reifenmuster sind von Spielzeugautos abgenommen) gehen wenig harmlose Fragen hervor: Was bedeutet es in letzter Konsequenz, wenn Menschenleib und Maschinenkorper immer enger miteinander identifiziert sind? Was bedeutet: „Ich bin mein Auto“? Weids Autozimmer, eine Mischung aus Environment und abgründig guter Stube, paßt in seiner anachronistischen Statik eigenartig gut zum Dynamikthema „Autofahren“. Auch bei Tempo 190 km/h sitzt der Fahrer still. MW Tom Wesselmann Tom Wesselmann (geboren 1931 in Cincinatti) malt Standards des Konsums, die Erlösung von und Freiheit in den alltäglichen Zwängen des kleinfamiliären Daseins versprechen. Wesselmann stellt globale Selbstverständlichkeiten einer Welt dar, in der sich der Traum vom angenehmen Leben für alle im Dasein verwirklicht, um mit Andy Warhol zu sprechen: „Everybody wants to be alike.“ Das repräsentative Paar im repräsentativen Wagen vor repräsentativer Bergkulisse mit repräsentativem See: Die Welt bietet sich als das dar, was kollektive Hoffnungen der späten Industriegesellschaft in ihr sehen wollen. Der Herr von Stand zog seit dem 18. Jahrhundert von England aus den Rhein hinunter, um auf dem Weg nach Rom zum Studium der Antike die Alpen zu passieren. Der Ursprung des internationalen Tourismus ist in diese Zeit der Aufklärung zu setzen, da das Reisen zum Bildungsgut des Gentleman gehörte, auf der Suche nach dem Erhabenen in Natur und Kunst. Europäische Traditionen sind für Wesselmann wesentlich: Der weibliche Akt, Stilleben, Landschaftsmalerei, dies alles erscheint in bester Tafelbildtradition. „Landschaft Nr. 4“ ist eine vollendete akademischen Komposition, nahezu wenigstens. Das Auto als Repoussoir und Maßstab gesellschaftlichen Erfolgs der Protagonisten wird so zum Identifikationsparameter für den Betrachter. Der blaugraue See suggeriert Tiefe und Weite, die der Monumentalisierung des dahinterliegenden Berggipfels dient und damit zur Überhöhung des Eindrucks einer die Seele weitenden Erhabenheit beiträgt. Doch ist alles nur Fiktion, das Zusammenspiel der touristischen Versatzstücke ist als Collage entwickelt. Es ist die Ästhetik einer Industrie, die unter den Auspizien der freien Marktwirtschaft auf die Kollektivierung des Bewußtseins aus ist. Denn schon in den sechziger Jahren ist die Welt mediatisiert, durch Fotografie und Printmedien, durch Fernsehen und allgegenwärtige Reklame. Dadurch erst scheint sie wahr und nur so wahrnehmbar. Träume sind so machbar, bezahlbar und mühelos alljährlich im Urlaub wiederholbar zu durchleben. Das Paar reist, wohlanständig gekleidet, durch die Kulisse von Derivaten einer zum Industrieprodukt herabgesunkenen Ästhetik, auf der (verzweifelten) Suche nach dem individuellen Erlebnis in unberührter Natur, geschützt in der verglasten Beobachtungskabine für nahezu jedermann. Das industrielle gefertigte Ziel ist erreicht, der Kreis hat sich geschlossen, und (fast) alle sind dabei. Für die amerikanische Pop Art, zu der Tom Wesselmann seit Beginn der sechziger Jahre gehört, war Vance Packards Buch „Die geheimen Verführer“ (1958) eine Offenbarung, suggerierte doch die Konsumindustrie grenzenlose Befriedigung aller Wünsche des Daseins, sofern sie industriellen Standards in Produkten und Dienstleistungen entsprachen. Der „Point of Sale” wurde zum „Point of no return”. DT Thomas Buchsteiner, Otto Letze: Tom Wesselmann 1959-1993. Kat. Tübingen 1994