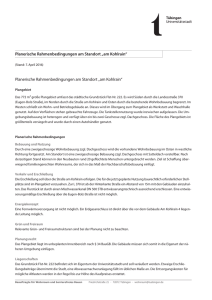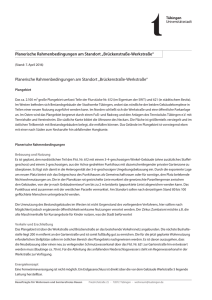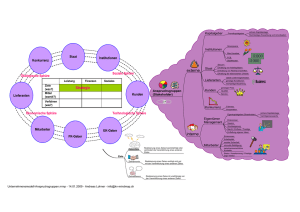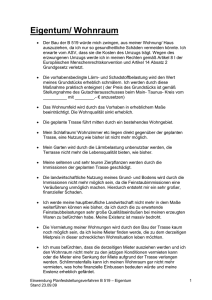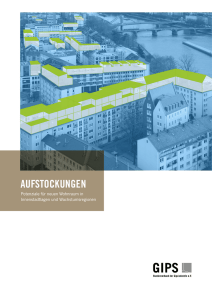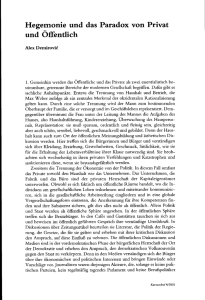Die Stadt als Wohnraum
Werbung
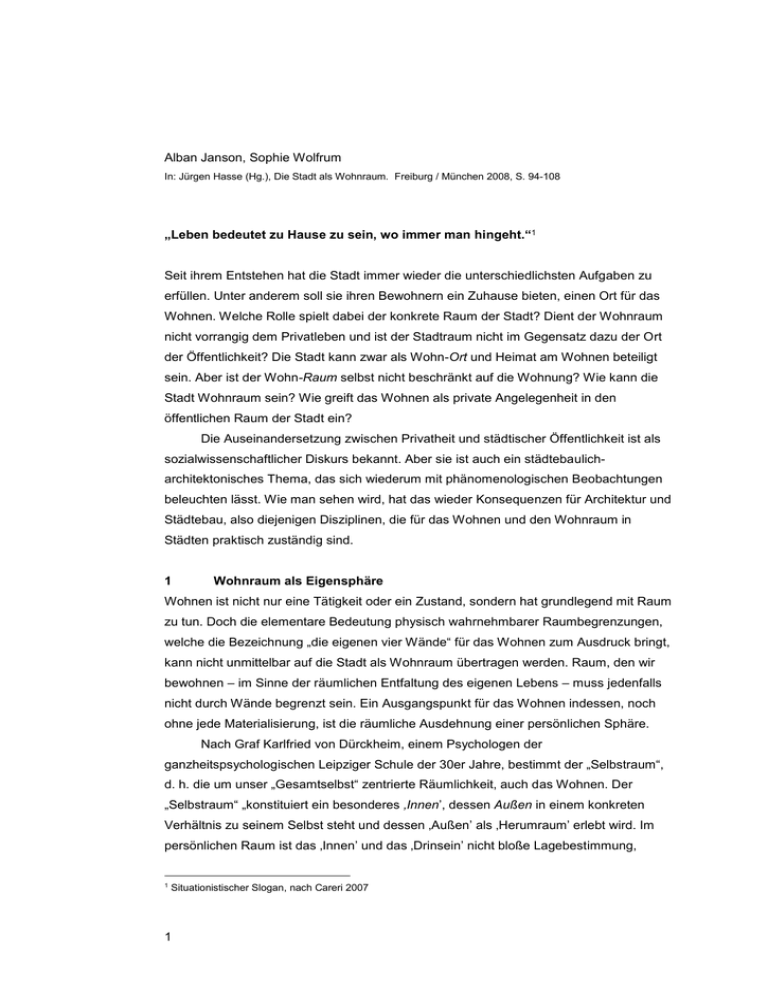
Alban Janson, Sophie Wolfrum In: Jürgen Hasse (Hg.), Die Stadt als Wohnraum. Freiburg / München 2008, S. 94-108 „Leben bedeutet zu Hause zu sein, wo immer man hingeht.“1 Seit ihrem Entstehen hat die Stadt immer wieder die unterschiedlichsten Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem soll sie ihren Bewohnern ein Zuhause bieten, einen Ort für das Wohnen. Welche Rolle spielt dabei der konkrete Raum der Stadt? Dient der Wohnraum nicht vorrangig dem Privatleben und ist der Stadtraum nicht im Gegensatz dazu der Ort der Öffentlichkeit? Die Stadt kann zwar als Wohn-Ort und Heimat am Wohnen beteiligt sein. Aber ist der Wohn-Raum selbst nicht beschränkt auf die Wohnung? Wie kann die Stadt Wohnraum sein? Wie greift das Wohnen als private Angelegenheit in den öffentlichen Raum der Stadt ein? Die Auseinandersetzung zwischen Privatheit und städtischer Öffentlichkeit ist als sozialwissenschaftlicher Diskurs bekannt. Aber sie ist auch ein städtebaulicharchitektonisches Thema, das sich wiederum mit phänomenologischen Beobachtungen beleuchten lässt. Wie man sehen wird, hat das wieder Konsequenzen für Architektur und Städtebau, also diejenigen Disziplinen, die für das Wohnen und den Wohnraum in Städten praktisch zuständig sind. 1 Wohnraum als Eigensphäre Wohnen ist nicht nur eine Tätigkeit oder ein Zustand, sondern hat grundlegend mit Raum zu tun. Doch die elementare Bedeutung physisch wahrnehmbarer Raumbegrenzungen, welche die Bezeichnung „die eigenen vier Wände“ für das Wohnen zum Ausdruck bringt, kann nicht unmittelbar auf die Stadt als Wohnraum übertragen werden. Raum, den wir bewohnen – im Sinne der räumlichen Entfaltung des eigenen Lebens – muss jedenfalls nicht durch Wände begrenzt sein. Ein Ausgangspunkt für das Wohnen indessen, noch ohne jede Materialisierung, ist die räumliche Ausdehnung einer persönlichen Sphäre. Nach Graf Karlfried von Dürckheim, einem Psychologen der ganzheitspsychologischen Leipziger Schule der 30er Jahre, bestimmt der „Selbstraum“, d. h. die um unser „Gesamtselbst“ zentrierte Räumlichkeit, auch das Wohnen. Der „Selbstraum“ „konstituiert ein besonderes ‚Innen’, dessen Außen in einem konkreten Verhältnis zu seinem Selbst steht und dessen ‚Außen’ als ‚Herumraum’ erlebt wird. Im persönlichen Raum ist das ‚Innen’ und das ‚Drinsein’ nicht bloße Lagebestimmung, 1 Situationistischer Slogan, nach Careri 2007 1 sondern ein qualitativ besonderes Erlebnis, in dem uns die Zugehörigkeit des Raumes zu unserem Selbst fühlbar zum Bewußtsein kommt. Wenn wir unsere Wohnung betreten (...) fühlen wir uns in anderer Weise ‚drinnen’, als wenn wir in irgendeinen anderen Raum eintreten, der nicht zu uns gehört (...) und dieses Gefühl enthält deutlich jenes Moment innerer Nähe, das (...) strukturelle Einsheit bedeutet.“2 „’Kommen Sie zu mir’, sagt man, und meint damit ‚in meine Wohnung’, und in gleichem Sinne sagt man statt ‚außen-sein’ ‚nicht bei sich sein’. So ist dieser Selbstraum ein Innen, das zugleich ein Mein-Innen ist.“3 Die Sphäre des Eigenen darf man sich aber nicht als eine Konstellation vorstellen, die von einem Menschen ein für allemal konstituiert wird. Alexander Gosztonyi hat darauf hingewiesen, dass es sich dabei um einen Vorgang handelt, der auf offensive Ausdehnung der persönlichen Sphäre angelegt ist (evtl. mit Phasen der Schrumpfung). „Der Mensch erweitert seine eigene, persönliche Raumsphäre von seinem Leib her sukzessiv und bezieht somit alles Räumliche in sein ‚räumliches Leben’; er konstituiert also den Raum von seinem ‚Leibraum’ her.“ In diesem „Fall wächst also der ‚Eigenraum’ des Menschen durch Erweiterung der räumlichen Lebenssphäre und der Raum wird ‚erobert’ in dem Sinne, dass immer weitere – leibliche bzw. materielle, ferner psychische und geistige – Bezüge zu Räumlichkeiten – gewissermaßen ‚organisch’ entstehen. Der Mensch ‚weitet sich’ also räumlich aus (...).“(Kursiv v. Verf.) 4 Das Innere unseres „Eigenraums“ „ist nicht etwa mit der Haut zu Ende, auch nicht nur das Kleid gehört dazu, sondern stets auch eine bestimmte Zone der freien Bewegung und über dies all das, womit man leiblich geeint ist und dessen Verstellt- oder Gefährdetsein als leibliche Selbstgefährdetheit empfunden wird.“ 5 Was aber aktuell zum „Selbstraum“ und was dagegen als zum „Herumraum“ gehörig erlebt wird, hat entweder einen gewissen andauernden Bestand oder aber verändert sich häufig mit wechselnden Situationen. Wenn mich jemand anrempelt, mir zu nahe kommt, muss er nicht meine Haut anfassen, es reicht, die äußere Hülle der Kleidung zu berühren, um mich selbst zu treffen. Auch die gepanzerte Kapsel des Autos wird beim Fahren Teil von mir: ich überhole, ich hupe, ich werde geschnitten, parke, bin zu schnell, habe einen Laternenmast gestreift. Dem Fahrer wird auf einer Kurvenstrecke nicht schlecht, das Auto wird Medium seiner Aktionsfähigkeit. Die Kinder auf dem Rücksitz müssen kotzen, für sie ist die Kabine des Autos etwas Äußeres, die sich ständig bewegende Umwelt ist eine Zumutung, welche die Adaptionsfähigkeit des Körpers überfordert. Neben der Wohnung und dem Auto kann sich der Selbstraum auf beliebige Teile des Hauses erstrecken – ich 2 Dürckheim 2005, S. 92 Ebd., S. 93 4 Gosztonyi 1976, S. 1005 5 Dürckheim 2005, S. 94 3 2 breite mich im Dachgeschoss aus – und kann sich bis in die Umgebung des Hauses ausdehnen - der Nachbar engt mich mit seinem Neubau ein. Zu den maßgeblichen Faktoren für die Ausdehnung des Selbstraums gehört unter anderem die Bedeutung der sozialen Beziehungen und des kulturellen Umfelds. So wurde die Erkenntnis, dass sich die Menschen mit einer persönlichen Raumsphäre umgeben, auch in den Sozialwissenschaften formuliert. Die in den 60er Jahren unter der Bezeichnung „proxemics“ (von engl. proximity, Nähe) von Edward T. Hall und Robert Sommer durchgeführten Untersuchungen des „personal (space) bubble“ unterscheiden vier verschiedene Raumzonen, die sich konzentrisch vom Individuum ausgehend mit zunehmender Ausdehnung im Raum staffeln (intim, persönlich, sozial, öffentlich). Den Untersuchungen zufolge variiert Ihre Größe kulturabhängig aber auch abhängig von Situationen und Beteiligten innerhalb derselben Kultur.6 Die konkrete Bedeutung dieser „persönlichen Raumblase“ betrifft danach vor allem die als angemessen empfundene räumliche Distanz zwischen Personen und die Empfindlichkeit gegenüber Verletzungen der persönlichen Raumblase. „Selbstraum“, „Bei-sich-sein“, „persönliche Sphäre“, „Eigenraum“, „Raumblase“, das sind Begriffe, in denen die sensible Erfahrung eines persönlichen Lebensbereichs zum Ausdruck kommt, eines durchaus räumlichen Sachverhalts, der jedoch nicht durch Wände oder andere physische Grenzen artikuliert werden muss. Einige dieser Begriffe stehen unmittelbar mit dem Wohnen in Zusammenhang, und es wird deutlich, dass auch die räumliche Voraussetzung für das Wohnen nicht von dem durch Wände begrenzten Wohnraum abhängt. Ermöglicht also diese verallgemeinerte Vorstellung vom Wohnen als räumlicher Entfaltung eines persönlichen Lebensbereichs ein Verständnis von emotionaler Ortsbezogenheit im Raum der Stadt, so dass man die Stadt als Wohnraum bezeichnen könnte? Die Frage ist, in welchem Maße sich die persönliche Sphäre in die Stadt ausweiten kann. 2 Expansion des Privaten „Wohnraum“ muss jedenfalls weiter gefasst werden als bis zu Fenster oder Wand des Hauses. „Der Mensch identifiziert sich mit seinem Haus. Er verschmilzt mit ihm. (...) Aber der Bereich geht weiter und bezieht sich, wenngleich in abgestufter Form auch auf alles, was an Raum der Besitzsphäre des Menschen angehört.“ 7 In unterschiedlichem Grad physisch wahrnehmbar, reicht der Wohnraum bis zur Grundstücksgrenze, zur Hecke, 6 7 Sommer 1969, S. 26ff, Hall 1966, S. 113-129 Bollnow 1963, S. 293 3 zum Zaun oder bis zum Ende der Straße. Oder aber die persönliche Sphäre dehnt sich bis zu einer virtuellen Grenze der Uneinsehbarkeit aus, die nur durch die Topographie des Geländes gebildet wird. Gerahmte Blicke – von den Schlafzimmerfenstern einer pompeijanischen Villa8 bis zu den Panoramafenstern der 60er Jahre – können die gezielte Einbeziehung von Landschaftsräumen, zumindest als Bild, in den Bereich des eigenen Wohnhauses unterstützen, was die Unterdrückung störender Elemente und die Behinderung unerwünschter Eingriffe in dieses Bild notwendig machen kann. Damit beginnen die Konflikte. Ausgehend von der „Leibfestung“ 9 als innerstem Kern, vom Bett, „als Wohnung im engen und strengen Sinne des Wortes (...) eine Weltenmitte“ 10 oder vom Karton des Obdachlosen weitet sich je nach Status und Einfluss der Wohnraum zunehmend aus. Die Stadt bewohnen hieße dann, sich mit seiner eigenen Raumsphäre in den Raum der Stadt ausdehnen, der zugleich öffentlicher Raum ist – und Raum der anderen. Der Konflikt besteht darin, dass dieser Eigenraum vom Individuum kontrolliert werden möchte aber als Raum der anderen nicht kontrolliert werden kann. Wenn die Wohnumgebung des Quartiers als Teil der persönlichen Raumsphäre (bzw. derjenigen der eigenen Familie) betrachtet wird, dann werden Gemeinschaftseinrichtungen, die das Privatleben – zum Teil schon durch ihren Anblick – stören könnten (Behindertenheim, Kindergarten, Bolzplatz) als Beeinträchtigung für die Entfaltung des privaten Lebensraums empfunden. Oft wird jegliche Veränderung im Wohnumfeld als vermeintlicher Eingriff in die Privatsphäre bekämpft. Das Konfliktpotenzial erhöht sich mit der in letzter Zeit zunehmenden Wertschätzung des Individuallebens und einer verstärkten Selbstverwirklichung in der Privatheit. „Wohnen ist in einer Zeit der Arbeitsknappheit bei steigendem Überfluß an freier Zeit zur Hauptbeschäftigung geworden.“11 Die erhöhte Wertschätzung des Individuums, verbunden mit der Betonung persönlicher Selbstentfaltung, der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Körpers und der geistigen Entwicklung bis ins Alter ist eine positiv konnotierte Entwicklung, wenn man zu der europäischen Mittelklasse gehört, die dies als Bereicherung des individuellen Lebens erfahren kann. Dieser Prozess geht mit einer Ausdifferenzierung der privaten Sphäre einher. Der private Bereich wird Spiegel der Individualität, persönlicher Ausdruck und zugleich Plateau der Entfaltung. Doch als Kehrseite der Medaille kommen Stressfaktoren zum Tragen: Das ständige Sich-Selbst- 8 Zur Bedeutung des Panoramablicks aus den Fenstern der Villa des Arrius Diomedes vgl. Hasse 2008 Selle 1993, S. 22 10 Flusser 1993, S. 91 11 Selle 1993, S. 9 9 4 Erfinden, die permanenten Anpassungsleistungen und die immer wieder neuen Lebensentwürfe, die man schon Jugendlichen abverlangt, gehen an die Substanz. Vor diesem Hintergrund gewinnt der private Raumbezirk eine besondere Wertschätzung als Sphäre unbehelligter Entspannung gegenüber den Zumutungen einer ständigen forcierten ökonomisch-gesellschaftlichen Bewährung des Individuums. Nur hier hat man seine ‚saubere Ruhe’, kann sich ein bisschen gehen lassen, muss keine Performance leisten. Unter den Prämissen einer Informationsethik wird das Private zu einem Bereich, den es vor Indiskretion und Kontrolle durch Staat und Gemeinwesen, deren Zumutungen und Zudringlichkeiten abzuschirmen gilt. „In liberalen Gesellschaften hat das Private die Funktion, ein autonomes Leben zu ermöglichen und zu schützen.“ 12 Während in der Moderne die öffentliche Sphäre diejenige war, in der sich der Mensch entfalten, über die Alltagszwänge hinaus transzendieren konnte, an der Welt teilhaben und zum ganzen Menschen werden konnte (Hannah Arendt), wird er im gegenwärtigen Kontext erst er selbst, wenn er ganz bei sich sein kann. Die hohe Wertschätzung von persönlicher Autonomie führt zu einer Einhausung des Individuums und seiner engeren sozialen Gemeinschaft in einem erweiterten sozialen Privatraum, eine Tendenz mit Folgen, die von Richard Sennett schon vor 30 Jahren als „Tyrannei der Intimität“13 beschrieben wurden und die inzwischen noch weit deutlicher geworden sind. Das Private soll immer mehr Bereiche des Lebens umfassen. In die verbleibende Öffentlichkeit geht man gezielt, um wohl dosiert soziale Kontakte zu pflegen. Der soziale Privatraum aber wird zu einem zu verteidigenden Territorium, das vor Kriminalität oder einfach nur vor Fremden oder auch vor jeglichen Veränderungen abgeschirmt werden muss. Diese Stabilität wird mit aller Macht erzwungen, Zutritte kontrolliert, Homogenität erzeugt. Die „gated communities“, von den USA bis China, bzw. die südamerikanischen „condominios“, in denen ganze Stadtviertel mit allen Wohnfolgeeinrichtungen zum kontrollierten Privatraum werden, sind nur die letzte Konsequenz; sie verbreiten sich inzwischen auf mehr oder weniger subtile Art auch bei uns. 3 Grenzverletzung und Abwehr Was als Selbstraum erfahren wird, zeigt sich nach Dürckheim vor allem im Erlebnis der Grenze, auch wenn sie nicht durch Wände gebildet wird. „In unserer Wohnung erleben wir uns abgeschlossen gegen das Außen, und wie, wenn wir in ihr sind, wir bei uns 12 13 5 Rössler 2001, Sofsky 2007 Sennett 1974 selber sind, so tritt, wer sie betritt, gleichsam in uns selber ein. Wir erleben das Tor als eine persönliche Grenze. Wir öffnen es im vollen Sinne nur dem, der zu uns gehört; nimmt sich ein anderer die Freiheit des Eintretens, so erleben wir das als unbefugtes Überschreiten einer persönlichen Grenze und ebenso erleben wir jede Grenzverletzung des Raumes als Verletzung unserer selbst.“14 „Das Innen ist hier das Ganze dessen, womit man sich leiblich eins fühlt, derart daß jeder Eingriff oder Angriff auf dieses Innen als Eingriff oder Angriff gegen einen selbst erlebt wird.“ 15 Die Begrifflichkeit von Grenzverletzung und Angriff auf einen „eroberten“ Raum (Gosztonyi) lässt mit ihren Konnotationen von Kampf und Aggression den offensiven Charakter der räumlichen Entfaltung von Lebensraum erkennen. Selbst die Gardinen dienen nach Gert Selle als „unüberschreitbare symbolische Grenze des eigenen Drinnen zum feindlichen Draußen“ vor allem dem „Schutz gegen den bösen Blick der Welt“16, während die Schrecken der Welt durch das Hereinholen in die Wohnung mit dem Fernsehen, das sich jederzeit abschalten lässt, unschädlich gemacht werden. Was Selle die „Zitadellen-Mentalität“ der Bewohner nennt, wird in England durch die auch bei uns gebräuchliche Formulierung „My home is my castle“ ausgedrückt. Es ist offensichtlich, dass es dabei nicht unbedingt um Mauern oder Wände geht, sondern um die „Verteidigungsbereitschaft“ im Hinblick auf den “beanspruchten Bewegungsraum“, so heißt es bei Bollnow. „Zum Problem wird er erst, wenn der Mensch mit seinem Raumbedarf auf den der anderen Menschen stößt“, weshalb sich der Mensch seine Bewegungsfreiheit sichern müsse, „d. h. er muß seinen Raum verteidigen und gegen das Eindringen störender Einflüsse schützen“.17 Begrifflich zugespitzt wurden solche Beobachtungen neuerdings durch Peter Sloterdijk, der u. a. vom „Wohnen als Sicheinrichten in einem gemeinsamen und persönlichen Immunsystem“18 spricht, wobei Präventivmaßnahmen die persönliche Raumsphäre gegen Verletzungen immunisieren sollen. Der Wohnbereich als Form des „Selbstraums“ wird demgemäß „als immunräumliche Selbstextension des Menschen“ verstanden.19 „Wohnen ist aus immunologischer Sicht eine Verteidigungsmaßnahme, durch die ein Bereich des Wohlseins gegen Invasoren und andere Bringer von Unwohlsein abgegrenzt wird. Alle Immunsysteme nehmen ein Recht auf Abwehr von Störungen in Anspruch, das der Begründung nicht bedarf. Wenn sie strittig werden, so 14 Dürckheim 2005, S. 93 Ebd., S. 94 16 Selle 1993, S. 10 17 Bollnow 1963, S. 284 18 Peter Sloterdijk, Sphären III. Schäume, Frankfurt /M. 2004, S. 534 19 Ebd., S. 539 15 6 nur, weil die Formate von Zonen gemeinsamer Immunität bei Kulturwesen nicht a priori feststehen.“20 Frappierend fällt auf, dass die Beschreibungen quer durch die Fachdisziplinen sich ausgesprochen häufig21 – und zudem in einem aktuellen Diskurs – einer Kampfterminologie bedienen, sobald es um das Wohnen als Bereich der persönlichen Sphäre geht – als Gegensatz etwa zu der naiven Sehnsucht nach einer pazifistischen Sprache der „Umfriedung“. Gerade die „Umfriedung“ – ein beschönigender Ausdruck angesichts der Tatsache, dass die Streitfälle im Nachbarrecht zu den häufigsten gehören – also die Grenze, selbst wenn sie nicht baulich materialisiert wird, in ihrer Funktion als Scheidung des Eigenen vom Fremden, ihrer starren Fixierung eines heimischen und eines feindlichen Bezirks macht die Identifikation des Stadtraums mit dem Wohnraum fragwürdig. Sie steht damit im Widerspruch zu dem, wofür Stadt wenigstens im gleichen Maße stehen müsste wie für das Wohnen: Urbanität. 4 Gegenstück: Urbanität als Sozialisierung des Fremden Auch als die Städte noch Mauern hatten und damit einer „Kultur der Gefühle im umfriedeten Raum“ (Hermann Schmitz) Ort und Schutz boten, war die Aufgabe eines urbanen Gemeinwesens bereits die Sozialisierung des Fremden. Urbanität bedeutet, aus dem privaten Rückzugsbereich in die Welt heraustreten zu können – in eine Sphäre von Fremdheit, die durch Toleranz gebändigt ist. Urbanität bedingt auch, diejenigen Rückzugsbereiche des Privaten zu erhalten, die dem Individuum erst die Stärke zur Begegnung mit dem Anderen im urbanen Raum verschaffen. Urbane Stadt ist Maschine (Zivilisationsmaschine, die zu Toleranz erzieht) und Heimat (die das Individuum stabilisiert) zugleich.22 Eine klassische Charakterisierung von Urbanität durch einen Soziologen: „Die Großstadt ist eigentlich eine Zumutung für das Individuum. Das physische enge Zusammenleben ist nur durch soziale Distanz erträglich. Gerade diese Distanz ermöglicht die persönliche Freiheit. Die Großstadt fördert Exzentrik und Innovation; durch den Wettbewerb auf engem Raum entsteht ökonomische und kulturelle Vielfalt.“23 Stadt oszillierte schon immer zwischen den beiden Polen Freiheit und Heimat. Stadt ist Toleranzmaschine und die große Ernährerin zugleich. Auf der einen Seite muss 20 Ebd., S. 535 Die Beispiele dafür ließen sich vermehren: Zur tiefenpsychologischen Erörterung einer “Verteidigung des Wohnraums“ vgl. Fischer 1965. Die vergebliche Errichtung eines unangreifbaren Sicherungssystems beschreibt Franz Kafka in Der Bau. Zu „Grenze“ und „Grenzverletzungen“ vgl. Waldenfels 1990. 22 Kleger 1995 23 Häussermann 2003 21 7 man sich zu Hause geborgen fühlen, sich seiner Nachbarschaft als Erweiterung der eigenen Lebenssphäre sicher sein. Auf der anderen Seite ist eine Bedingung von Freiheit, dass man sich in der Öffentlichkeit begegnen kann und begegnen muss. Damit Stadt nicht ein großes Dorf sondern tatsächlich Stadt ist, braucht sie offene Räume, öffentliche Räume, die es möglich machen, dem Fremden zu begegnen. Beschränkt sich die Stadt darauf, nur Heimat zu bieten, kommt lediglich eine Siedlungslandschaft dabei heraus, keine Stadt im vollen Sinne. Auf der ganzen Welt kann man beobachten, welche neuen Städte aus diesem Defizit entstehen. Es sind Städte, die keine öffentlichen Räume brauchen. Sie sind eine Ansammlung von Siedlungen, die nur zeitweise bewohnt sind, die bewacht werden müssen, die man nur mit dem Auto erreicht. Man kann eine Ausdifferenzierung der Räume nach thematischen Schwerpunkten erkennen, welche die Stadt der Moderne und deren Projekt der Trennung von „Funktionen“ in ihrer Ausdifferenzierung weit hinter sich lässt. Wie lässt sich aber der Widerspruch bewältigen, der entsteht, wenn eine offensive bzw. aggressive Ausweitung privater Sphären und deren zunehmende Kontrolle über den Raum der Stadt mit der ausreichenden Bereitstellung öffentlicher Räume für die Begegnung, zivilisierte Tolerierung und Assimilierung des Fremden kollidiert? 5 Performativer Urbanismus - Architektonische Konsequenzen Die Entfaltung der räumlichen Eigensphäre in einem geschützten (umfriedeten) Bereich hat selbstverständlich für den Einzelnen, die Familie, die Gruppe ihre Berechtigung. Doch während sie die vorherrschende Artikulationsform des Wohnens für die private Welt bildet, stellt so verstandenes Wohnen nicht das Modell für die „Stadt als Wohnraum“ dar. In der urbanen Welt der Stadt kann sich Wohnen als Identifikation mit einer vertrauten Räumlichkeit nicht auf eine wie auch immer gedeutete Abgrenzung stützen. Der Raum der Stadt bietet dafür andere, adäquate Möglichkeiten. Die Vertrautheit mit der Stadt24 entsteht nicht in erster Linie durch Besetzung eines Raums, sondern vielmehr durch das tätige Erkunden ihrer Räume. Stadt wird gerade nicht durch Umfriedung und die Artikulation von Grenzen des Eigenraums zum Wohnraum gemacht, sondern durch Bewegung entsteht eine je individuelle Topographie, bieten sich Spielräume vertrauter Aneignungen. Da die Aufgabe von Architektur und Städtebau nicht nur die Umschließung oder Einfriedung von Räumen ist, sondern die Zuständigkeit für alle räumlichen Verhältnisse, wird sie immer auch für die räumliche Artikulation von Bewegung eine Rolle zu spielen Eine „Theorie der unheimlichen Vertrautheit mit der Stadt“ zu formulieren beansprucht Michel de Certeau (1988, S. 187) 24 8 haben. In der Architekturtheorie hat August Schmarsow als einer der ersten den Akzent auf den Raum und die Bewegung im Raum gesetzt, nicht auf das Gebäude als Objekt. Nicht die Wände, deren Flächen uns in Höhe und Breite vor Augen treten, machen demnach in erster Linie die Wohnung aus. Entscheidend ist vielmehr die Bewegung in die Tiefe des Raumes: „Erst mit der freien Ausdehnung der Tiefenaxe wird das Gehäuse, das Schlupfloch zum Wohnraum, in dem man sich nicht gefangen fühlt, sondern aus eigener Wahl sich aufhält und lebt. Es ist auch ein geistiges Bedürfnis, das befriedigt wird, indem wir genügenden „Spielraum“ gewinnen.“ 25 „Das Raumvolumen, also, das den Menschen als Spielraum umgibt, ist das zunächst Gewollte, nicht die Aufrichtung körperlicher Dinge, die wir zu dessen Versinnlichung brauchen.“ (Kursiv v. Verf.)26 Zumindest sprachlich besteht eine Beziehung zwischen der Notwendigkeit von Spielraum, die Schmarsow für die Wohnung fordert, und dem Spiel mit dem Raum, das Michel de Certeau als Voraussetzung für die „Aneignung des topographischen Systems (der Stadt, Verf.) durch den Fußgänger“ geltend gemacht hat.27 Die „Vertrautheit mit der Stadt“ stützt sich nicht auf eine feste Bereichsabgrenzung, sondern „das Gehverhalten spielt mit der Raumaufteilung (...): es ist ihr weder fremd (es bewegt sich nicht woanders hin) noch konform (es bezieht seine Identität nicht aus ihr).“28 In der individuellen Bewegung durch die Stadt macht sich der Bewohner durch die eigenwillige Auslegung ihrer räumlichen Struktur als persönliche Lesart die Stadt vertraut. Er bewohnt die Stadt nicht, indem er einen persönlichen Bereich abgrenzt, sondern indem er eine persönliche Spur in den Raum der Stadt legt. De Certeau betrachtet die „Rhetorik des Gehens“ in Analogie zu einer „Rhetorik des Wohnens“, von der er erwartet, dass sie „Modelle und Hypothesen für die Analyse der Aneignungsweise von Orten“ liefert. 29 Die Bewegungsspur als eine Form des hodologischen Raums30, den der Stadtbewohner als kreative Eigentätigkeit zum persönlichen Raum macht und der zugleich Eigenschaften des Handlungsraums31 bzw. Aktionsraums32 im phänomenologischen Sinne besitzt, verankert das Wohnen im Raum der Stadt durch performativen Ortsbezug. Die Situationisten um Guy E. Debord und Constant Nieuwenhuys, die sich von der eigenwillig schweifenden Bewegung (dérive) in der Stadt unter anderem eine Intensivierung des Erlebens versprachen, hatten für solche experimentellen Wegräume 25 Schmarsow 1894, S. 16f Schmarsow 1897, S. 6f 27 de Certeau 1988, S. 189 28 Ebd., S. 194 29 Ebd., S. 193 30 Zu dem durch subjektiv erfahrene Wegstrukturen geprägten (= hodologischen) Raum vgl. Bollnow 1963, S. 191ff 31 vgl. ebd., S. 202ff, sowie Dürckheim 1932, S. 88 32 Ströker 1965, S. 54ff 26 9 sogenannte „psychogeographische Landkarten“ hergestellt – wir sprechen heute von „mental maps“ – individuelle Stadtpläne, „aus denen sich die Wege herauslesen lassen, die zu einer Stadt führen, die für den Menschen gebaut ist, der sie bewohnt.“ 33 Der Bewohner betätigt sich in der Produktion von Raum (Henri Lefebvre): Dann ist als Ergebnis durch die eigene Bewegung, die als eine Folge von Einzelsituationen erlebt wird, die Stadt oder ein Stück Stadt zum „gelebten Raum“ (espace vecu) geworden. „Die Stadt ist gefiltert durch subjektive Erfahrungen und ruft jene Affekte und Leidenschaften hervor, die sich herausbilden, wenn man bestimmte Orte besucht und dabei auf seine inneren Impulse achtet.“34 Angesichts einer zunehmenden Vereinnahmung des öffentlichen Raums der Stadt durch private Ansprüche, die Ausweitung der persönlichen Sphäre von Bewohnern, die sich gegen alles Fremde wehren, bis hin zur Kontrolle oder gar Absperrung ganzer Quartiere, erscheint es problematisch, auf neue Weise umfriedete Räume zu schaffen, um die erstrebte Wohnlichkeit der Städte zu erreichen. Die Alternative besteht darin, das Wohnen in der Stadt nicht in der Eingrenzung auf einen räumlichen Bezirk, sondern als Vertrautheit im performativen Umgang mit dem städtischen Bewegungsraum zu betrachten. Einer urbanen Lebensweise angemessen wäre also eine Aneignung des Stadtraums durch den individuellen Gebrauch, wobei insbesondere durch die individuelle Bewegung der städtische Raum auf eigene Art gelesen, gedeutet und damit angeeignet wird, ohne ihn zu vereinnahmen. In dieser Form des Bewohnens bildet der Raum der Stadt eine Basis der eigenen affektiven Ortsbindung aber bleibt zugleich als öffentlicher Raum und Ort der Begegnung offen für die Sozialisierung des Anderen. Welche Rolle spielen dabei Architektur und Städtebau? Sie bilden den Hintergrund, vor dem der Bewohner seine eigene räumliche Entfaltung realisiert, liefern die materielle Struktur, die er durch Bewegung und Gebrauch für sich bewohnbar macht. Soll das gelingen, dann muss die Architektur der Stadt der individuellen Aneignung einerseits ausreichend Spielraum lassen. Eine Festlegung auf vorgezeichnete Bewegungsformen und kontrollierte Verhaltensweisen, wie z. B. auf den „ErlebnisParcours“ der kommerzialisierten Malls verhindern die Einschreibung persönlicher Lebenssituationen in den Raum der Stadt. Was auf der anderen Seite aber im aktuellen urbanistischen Diskurs35 häufig verkannt wird, ist die Notwendigkeit von architektonischer Prägnanz. Verstünde man das Zustandkommen einer emotionalen Ortsbezogenheit nur als kontingentes Produkt 33 Steiner 2007, S. 50 Careri 2007 35 Vgl. etwa Das Themenheft „Situativer Urbanismus. Zu einer beiläufigen Form des Sozialen“ Archplus 183, Mai 2007 34 10 sozialer Praxis vor dem Hintergrund einer diffusen Umwelt, die eine Gesellschaft immer auch in aller Zufälligkeit produziert, dann wäre das Ergebnis nicht Offenheit sondern Beliebigkeit. Eine Architektur, die der Aneignung im Gebrauch der Nutzer entgegenkommen soll, verlangt im Gegenteil die Entschiedenheit räumlicher Gestalt. Architektur verfügt als hochspezialisierte Kulturtechnik über ein differenziertes Repertoire von innerarchitektonischen Mitteln, um unverwechselbare räumliche Strukturen mit gleichwohl offenem Bedeutungshorizont zu schaffen. Architektonische Prägnanz ist geradezu notwendig, um in einem performativen Akt mit neuen oder alten Bedeutungen versehen werden zu können. Das Zusammenspiel von Spielraum und Prägnanz macht die Anlagerungsfähigkeit von Architektur aus, ihr Fassungsvermögen für unterschiedliche Deutungen und Fiktionen, für Gebrauch und Missbrauch, Gemeinschaft und Eigensinn: Architektonische Kapazität.36 36 Vgl. Janson / Wolfrum 2006 11 Literatur Bollnow, Otto Friedrich, Mensch und Raum. Stuttgart 1963 Careri, Francesco, Walkscapes. Gehen als ästhetische Praxis. In: Archplus, 2007, H.183 Certeau, Michel de, Kunst des Handelns. Berlin 1988 (Originalausgabe 1980) Dürckheim, Graf Karlfried von, Untersuchungen zum gelebten Raum. Frankfurt a. M. 2005 (Originalausgabe in: Felix Krueger (Hg.), Neue psychologische Studien. München 1932) Fischer, Fred, Der Wohnraum. Zürich/Stuttgart 1965, S. 54ff Flusser, Vilém, Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen. München 1993 Gosztonyi, Alexander, Der Raum. Geschichte seiner Probleme in Philosophie und Wissenschaften. Freiburg/München 1976 Hall, Edward T., The Hidden Dimension. New York 1966 Hasse, Jürgen, Schöner Wohnen. Zur Bedeutung von Ästhetisierungen im Stadtraum. In: Hasse (Hg.), Die Stadt als Wohnraum. Hamburg 2008, S. 109ff Häussermann, Hartmut, Phänomenologie und Struktur städtischer Dichte. Referat anlässlich des Symposiums „Städtische Dichte in der Schweiz“ 2003. http://www.avenir-suisse.ch Janson, Alban/ Wolfrum, Sophie, Kapazität: Spielraum und Prägnanz. In: Der Architekt, 2006, Heft 5-6, S. 50-54 Kafka, Franz, Der Bau. In: Ders., Sämtliche Erzählungen. Frankfurt a. M./Hamburg 1970, S. 359-388 Kleger, Heinz, Politische Urbanität. In: PlanerIn 1995, H.4 Rössler, Beate, Der Wert des Privaten. Frankfurt a. M. 2001 Schmarsow, August, Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Leipzig 1894 Schmarsow, August, Barock und Rokoko. Eine kritische Auseinandersetzung über das Malerische in der Architektur. Leipzig 1897 Selle, Gert, Die eigenen vier Wände. Frankfurt a. M. 1993 Sennett, Richard, Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt a. M. 1986 (Originalausgabe 1974) Sloterdijk, Peter, Sphären III. Schäume. Frankfurt a. M. 2004 Sofsky, Wolfgang, Verteidigung des Privaten. Eine Streitschrift. München 2007 Sommer, Robert, Personal Space. Englewood Cliffs 1969 Steiner, Juri, Psychogeographie. In: Archplus, 2007, H.183, S. 50 Ströker, Elisabeth, Philosophische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt a. M. 1965 Waldenfels, Bernhard, Der Stachel des Fremden. Frankfurt/M. 1990, S. 28-40 12