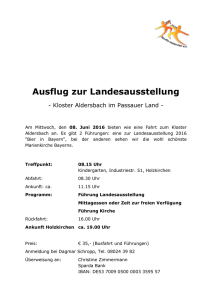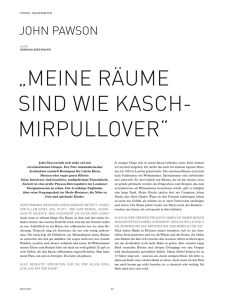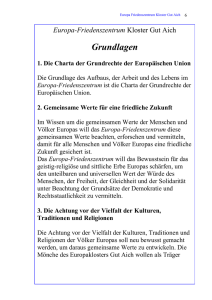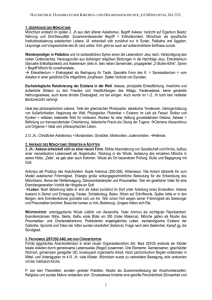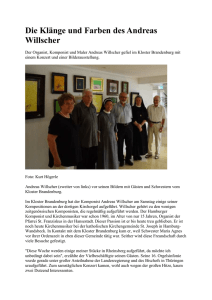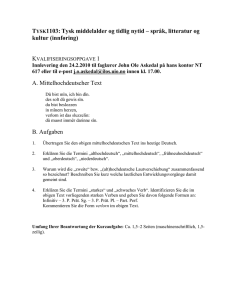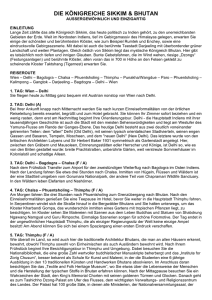bitte hier klicken - Gemeinschaft Evangelischer Zisterzienser
Werbung
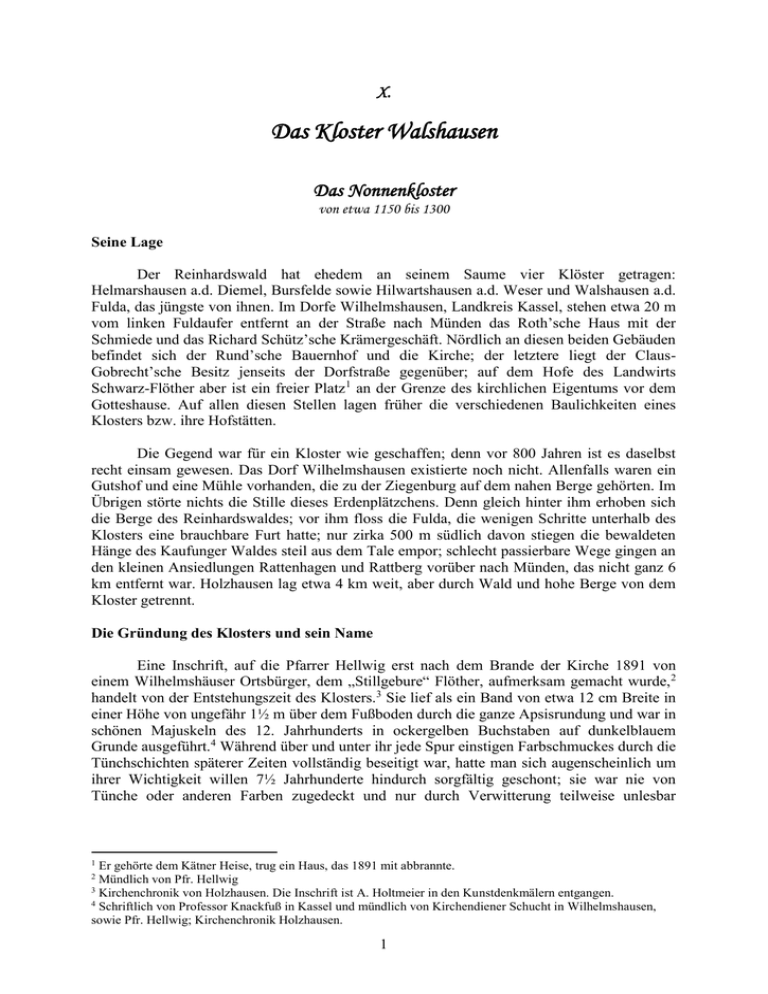
X. Das Kloster Walshausen Das Nonnenkloster von etwa 1150 bis 1300 Seine Lage Der Reinhardswald hat ehedem an seinem Saume vier Klöster getragen: Helmarshausen a.d. Diemel, Bursfelde sowie Hilwartshausen a.d. Weser und Walshausen a.d. Fulda, das jüngste von ihnen. Im Dorfe Wilhelmshausen, Landkreis Kassel, stehen etwa 20 m vom linken Fuldaufer entfernt an der Straße nach Münden das Roth’sche Haus mit der Schmiede und das Richard Schütz’sche Krämergeschäft. Nördlich an diesen beiden Gebäuden befindet sich der Rund’sche Bauernhof und die Kirche; der letztere liegt der ClausGobrecht’sche Besitz jenseits der Dorfstraße gegenüber; auf dem Hofe des Landwirts Schwarz-Flöther aber ist ein freier Platz1 an der Grenze des kirchlichen Eigentums vor dem Gotteshause. Auf allen diesen Stellen lagen früher die verschiedenen Baulichkeiten eines Klosters bzw. ihre Hofstätten. Die Gegend war für ein Kloster wie geschaffen; denn vor 800 Jahren ist es daselbst recht einsam gewesen. Das Dorf Wilhelmshausen existierte noch nicht. Allenfalls waren ein Gutshof und eine Mühle vorhanden, die zu der Ziegenburg auf dem nahen Berge gehörten. Im Übrigen störte nichts die Stille dieses Erdenplätzchens. Denn gleich hinter ihm erhoben sich die Berge des Reinhardswaldes; vor ihm floss die Fulda, die wenigen Schritte unterhalb des Klosters eine brauchbare Furt hatte; nur zirka 500 m südlich davon stiegen die bewaldeten Hänge des Kaufunger Waldes steil aus dem Tale empor; schlecht passierbare Wege gingen an den kleinen Ansiedlungen Rattenhagen und Rattberg vorüber nach Münden, das nicht ganz 6 km entfernt war. Holzhausen lag etwa 4 km weit, aber durch Wald und hohe Berge von dem Kloster getrennt. Die Gründung des Klosters und sein Name Eine Inschrift, auf die Pfarrer Hellwig erst nach dem Brande der Kirche 1891 von einem Wilhelmshäuser Ortsbürger, dem „Stillgebure“ Flöther, aufmerksam gemacht wurde,2 handelt von der Entstehungszeit des Klosters.3 Sie lief als ein Band von etwa 12 cm Breite in einer Höhe von ungefähr 1½ m über dem Fußboden durch die ganze Apsisrundung und war in schönen Majuskeln des 12. Jahrhunderts in ockergelben Buchstaben auf dunkelblauem Grunde ausgeführt.4 Während über und unter ihr jede Spur einstigen Farbschmuckes durch die Tünchschichten späterer Zeiten vollständig beseitigt war, hatte man sich augenscheinlich um ihrer Wichtigkeit willen 7½ Jahrhunderte hindurch sorgfältig geschont; sie war nie von Tünche oder anderen Farben zugedeckt und nur durch Verwitterung teilweise unlesbar 1 Er gehörte dem Kätner Heise, trug ein Haus, das 1891 mit abbrannte. Mündlich von Pfr. Hellwig 3 Kirchenchronik von Holzhausen. Die Inschrift ist A. Holtmeier in den Kunstdenkmälern entgangen. 4 Schriftlich von Professor Knackfuß in Kassel und mündlich von Kirchendiener Schucht in Wilhelmshausen, sowie Pfr. Hellwig; Kirchenchronik Holzhausen. 2 1 geworden.5 Wie es möglich gewesen ist, dass der sonst ausgezeichnete Architekt Dr. Schönmark bei der Wiederherstellung der Kirche eine so überaus wichtige urkundliche Nachricht zustreichen ließ, wird dauerlich unbegreiflich bleiben. War auch einiges undeutlich an der Inschrift, so wurden doch Kaiser Konrad und Erzbischof Heinrich von Mainz zweifellos darin zusammen genannt. Daraus folgt aber, dass Kaiser Konrad III. und Erzbischof Heinrich I., der Glückliche; denn diese beiden waren Zeitgenossen; ersterer starb 1152, letzterer regierte in Mainz von 1142 bis 1153, wo man ihn wegen seiner Sittenstrenge absetzte; er war der nämliche, der während des Kreuzzuges Konrads die Reichregierung geleitet hatte. Demnach kommen als Erbauungszeit der Klostergebäude einschließlich der Kirche die Jahre nach 1142 in Betracht. Selbstverständlich sind die Gebäude nicht in einem einzigen Jahr fertig gestellt worden. Die Bauzeit mag immerhin an 10 Jahre gedauert haben. Um 1150, etwa wurde das Kloster vielleicht am Tag der heiligen Petronilla eingeweiht. Die Richtigkeit der Inschrift wird uns durch die noch erhaltenen alten Bauformen der Kirche bestätigt, aus denen die Sachverständigen 6 auf eine Gründung des Klosters in der Mitte des 12. Jahrhunderts schließen. Die Inschrift gab uns aber nicht nur eine bloße Zeitbestimmung, sondern auch zugleich Nachricht über die Namen der Gründer des Klosters. Kaiser Konrad III. und vor allem den frommen Erzbischof Heinrich I. von Mainz müssen wir als solche 7 in Anspruch nehmen. Sie weihten ihre Gründung der Mutter Gottes, Maria. Das Siegel des Klosters zeigt daher die thronende Maria mit dem Jesuskinde. Dementsprechend heißt es nach 1525 „das Gotteshaus Sankt Marien an der Fulda nahe bei Münden“.8 Die Stätte selbst aber, auf der das Kloster Sankt Marien gebaut wurde, trug bereits den Namen Walshausen. Die Endung „Hausen“ in diesem Wort deutet darauf hin, dass schon eine kleine, vielleicht befestigte Ansiedlung in allernächster Nähe, wahrscheinlich zwischen Mühlbach und Fulda, auf dem Claus-Gobrecht’schen Grund und Boden gelegen haben muss.9 Die erste Hälfte des Namens Walshausen hängt vielleicht zusammen mit Wal = Walstatt.10 Das Ganze bedeutet demnach eine Ansiedlung auf der Walstatt. Der Lage des Platzes im Fuldatal entsprechend und darum am natürlichsten ist aber die Erklärung von Walshausen mit Talhausen.11 Der Name12 ist im Laufe der Jahre verschieden geschrieben worden. Die älteste Schreibweise 1291 lässt „h“ und „s“ in Wahlshausen weg und hat einfach Walehusen.13 Das deutlich Lesbare lautete: ANNO DOM[inicae Incarnationis……. (Jahreszahl unlesbar) reg]NANTE KUNRADO INPERATORE HENRICO ARCHIEPISCOPO SEDE[m] MOGUNTIA[e tenente] HAE AEDES [dicatae sunt?]…..(nicht zu entziffern, nur Raum für wenige Worte); nach Professor Knackfuß, der die Inschrift 1891 entzifferte, ist die Ergänzung sedem Moguntiae t e n e n t e wohl als unzweifelhaft anzusehen. Hinter dem Worte aedes aber war nichts mehr zu entziffern. Pfarrer Hellwig gibt in der Kirchenchronik an, es habe dagestanden P TONILL. Man könnte, wenn das richtig ist, an eine Tagesangabe denken, nämlich an den Tag Sanctae Petronillae, an dem vielleicht die Einweihung stattgefunden hat. 6 A. Holtmeyer, „Bau- und Kunstdenkmäler im Reg.-Bez. Kassel“ IV. Bd., Kreis Kassel-Land. 7 Pfr. Raßmann hält die Grafen von Dassel dafür; dass sie als Grafen dieses Bezirks dabei beteiligt waren, ist wohl ziemlich sicher, aber sie treten hinter dem Kaiser und Erzbischof zurück. 8 Staatsarch. Marb.; siehe Anhang. 9 Pfr. Raßmann erklärt in der hiesigen Kirchenchronik den Namen als Haus eines gewissen Mannes namens Wahl, der an der Stelle des Claus’schen Hofes sich niedergelassen habe. 10 Das Stammwort Wal hängt zusammen mit dem griechischen Verbum όλλυμι verderben, vernichten. Wahrscheinlich hat einmal zu einer unbekannten Zeit an dieser Stätte ein großer Vernichtungskampf stattgefunden. 11 Englisch valley = Tal. 12 J. Chr. Martin, Top.-stat. Nachr. 1791, II. Bd., 1. Heft, S. 92 meint, Wahl- oder Wahlshausen sei das in Vita Meinwerki verkommende Walierissen (siehe Wenk, Hess. Landesgesch. II, S. 361) und in P. Hessi-Saxon. Apud Saroch (Nr. 467) angeführte Waliereshus. Aber Walierissen in der Vita Meinwerki (apud Leibnit. I) p. 538 und 5 2 Später liest man Waleshausen 1293, 151914, Walshusium 131015, Walshußen 1519 und noch 172016, Walleshusen 1519, Walßhusen 1519, Wolshusen 150117, Wolßhußen 1511, Stift Wahlshusen 1515, Walßhaußen 1521, Wahlhausen 1554.18 Die Dorfbücher haben meist Wahlhausen 1580, 1742.19 Im Folgenden kehre ich zu der in den ältesten Zeiten am meisten beglaubigten Schreibweise Walshausen ohne „h“ zurück. Vor Verwechselungen mit anderen Wahlshausen muss man sich hüten. Selbst gelehrte Leute20 haben unser Walshausen mit dem an der Weser liegenden Verna-Wahlshausen verwechselt. Schenkung Zu seiner Existenz bedurfte das Kloster vor allen Dingen Eigentum. Fundiert und datiert wurde es hauptsächlich von den Adelsgeschlechtern in der Nachbarschaft. Spender waren 1. Die Grafen von Dassel. Die ganze Gegend diesseits der Fulda und Weser von Knickhagen bis zum Kloster Hilwartshausen mit den angrenzenden Teilen des Reinhardswaldes gehörte den Grafen von Dassel, in deren Lehen auch Altmünden und eine Reihe ausgegangener Ortschaften wie Ratten, Ratienhagen, Radberg, Givehardeshagen bis 1273 standen. Schon von seinen Vorfahren her, so sagt 1273 Ludolf von Dassel, habe er diese Grafschaft innegehabt. Wahrscheinlich sind es daher die Dasseler gewesen, die das Kloster bei seiner Gründung mit Grund und Boden fundierten und die Gerichtsbarkeit über dasselbe schon um 1150 an ihre Oberlehnsherren, die Erzbischöfe von Mainz, übergaben. Deshalb wird auch 1273 Walshausen nicht unter den von Graf Ludolf an den Erzbischof abgetretenen benachbarten Ortschaften genannt; die Erzbischöfe besaßen ja bereits die wichtigsten Rechte21 über das Kloster. 2. Die Herren von Ziegenburg. Die Tatsache, dass eine Ziegenburg oberhalb und östlich von dem Kloster nur etwa 500 m entfernt lag, begründet die Annahme, dass auch ihre Besitzer dem Kloster Stiftungen und Schenkungen übermittelten. Andererseits hatten sie als mutmaßliche Vögte das Kloster zu beschützen und von diesem Amt mannigfache Vorteile. 3. Die Herren von Sichelnstein. „Ein Graf von Sichelnstein“ hat nach der mündlichen Überlieferung im Dorf die jenseits der Fulda liegende Feldflur „die Wämme“, dem Kloster geschenkt. Welches die Veranlassung hierzu gewesen, ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Vielleicht hat er damit die Dienste22, welche ihm die Nonnen geleistet hatten, belohnen wollen. Eine Sage erzählt auch von einem unterirdischen Gange23, der von dem Kloster nach das in den Traditiones Corbeienses erscheinende Waliereshus hat mit unserem Walshausen nichts zu tun, sondern ist Welrissen, eine Wüstung bei Deisel, schriftlich von Oberlehrer Pfaff in Hofgeismar. 13 Urkunde des Kasseler Archivs 1291; vgl. Janauschek, Origines Cisterc. I, LX und Regest. D. Erzbisch. I. Bd., 1. Lief, S. 58. 14 Siehe in folgenden Seiten XXX – X+n Urkunde in der Anmerkung. 15 Meibomius, Script. III, S. 369. 16 Kirch.-B. I, Traureg. 17 Staatsarch. Marb., Urkunde. 18 Immenhaus. Sal-B. Staatsarch. 19 Landesbibl. Kassel und Staatsarch. Marb. 20 Vgl. Joach. Meiern, Origines et antiq. Plessenses, S. 73. Das 1538 im Vergleiche Landgraf Philipps mit Herzog Erich erwähnte Wahlshausen liegt „Uslar werts“, ist also Vernewahlshausen, gegen Lotze und Holtmeier. Auch was Wenk, Hess. Landesgesch. Schreibt, kann nicht alles mit Sicherheit auf unser Walshausen bezogen werden. 21 Regesten b. Erzb. I, 58 Nr. 333. 22 An der Stelle, wo jetzt Claus-Gobrecht wohnt, habe er ein Haus gehabt, wo er oft abgestiegen sei. 23 Nach der einen begann er im Keller Runds, nach der anderen beim südlichen Querschiff der Kirche. 3 dem etwa 1½ Stunden entfernten Sichelnstein geführt habe. Seine Existenz ist jedoch mehr als zweifelhaft, da aus technischen Gründen ein solcher Gang unmöglich erscheint. Überdies verliefen auch gelegentliche Nachforschungen danach im Jahre 1891 ganz resultatlos. Dennoch steckt in der mündlichen Überlieferung ein Körnchen Wahrheit. Zur Zeit Heinrichs des Löwen um1180 lebte nämlich Ritter Bardo von Sichelnstein. Er war mit der Tochter eines adligen Herrn von Ziegenberg, namens Kunigunde, vermählt. In furchtbarer Wut stach er sie tot. Man legte sie auf die Bahre. Da begann sie so stark zu bluten, dass man die Blutmengen gar nicht vom Boden aufschöpfen konnte. Jung und alt war darüber entsetzt. Der Bruder der Ermordeten, Ritter Heimbert von Ziegenberg, ritt sofort nach Fulda, wo gerade eine Fürstenversammlung tagte. Wehklagend erzählte er vor ihr die Bluttat seines Schwagers. Sogleich wurde Bardo vom Kaiser zum Tod mit dem Strick verurteilt und vom Erzbischof von Mainz in den Kirchenbann getan. Auf Fürbitte einiger Fürsten milderte aber der Kaiser des anderen Tages das harte Urteil dahin, dass Bardo in das kaiserlich freie Stift Corvey zehn Pfund feines Silber zahlen und in einem Gefängnis dieses Klosters auf eigene Kosten lebenslänglich sitzen solle; außerdem ward ihm sein goldenes Wappenschild abgesprochen und ein völlig blutrotes verliehen. Als Wedekind von Desenberg Abt von Corvey war, wurde Bardo von Sichelnstein 1189 in ein Mauergewölbe gefänglich eingezogen. Schon 1192 entließ man ihn aus seiner Haft, worauf er lange Jahre in stiller Zurückgezogenheit auf seiner Burg lebte. Aufs bitterste hatte er seine Verbrechen bereut. 24 Er verschied 1239. In der Klosterkirche Walshausen wurde er beigesetzt. Pastor Letzner25aus Münden sah noch 1558 den roten Schild Bardos an der Wand der Kirche hängen, welcher nun schon lange verschwunden ist. Als nach dem Brande 1891 unter dem Altar nach gegraben ward, fand man einen Frauenschädel mit blond gebleichtem Haar.26 Die hervorragende Stelle, wo die Leiche lag, beweist die einstige Bedeutung ihrer Person zu ihren Lebzeiten. Vielleicht war sie eine Vorsteherin des Klosters oder jene Gräfin von Sichelnstein, die in der Blüte der Jahre ihr Leben ließ, oder aber auch nur eine der Standespersonengewesen, welche nach der Gründung des Dorfes, um 1650, im Chore beerdigt wurden. Noch 1558 wurde in der Kirche am Sonntag Exaudi ein Gedächtnisgottesdienst alljährlich gehalten27. Dabei kam der Betrag von 18 Mark an arme Leute zur Verteilung. Auch dieser Gedächtnisgottesdienst mit der milden Stiftung mag wohl mit dem Gattenmord Bardos zusammenhängen. Der innerlich gebrochene und kinderlose Ritter übergab seinen Besitz dem Kloster, in dessen Kirche seine Gattin und er selbst die letzte Ruhestätte fanden. 4. Die Ordensschwestern. Anderer Besitz floss dem Kloster zu durch das Vermögen der Nonnen, das sie als Mitgift hineinbrachten. Im Laufe der Zeit erwarb Walshausen immer reichere Besitzungen. So besaß es 1293 vorübergehend 24 Hufen allein bei Volperthausen, Hellpoldessen und Udenhausen.28 Außer diesen fast 1000 Acker großen Flächen hatte es sicherlich auch in anderen Ortschaften der Nachbarschaft ausgedehnten Grundbesitz.29 „Bardo de Segelsten, apud nos imprisonatus, crimina sua deflevit amarissime“ im Brief des Abtes Wedekind. Lotze; Münden S.312. 26 Mündlich von Hegemeister Kleyensteuber. 27 Eine memoria, Lotze, Münden S. 312. 28 Reg. d. Erzb. I, 58 Nr: 333. 29 Leider fehlen urkundliche Nachrichten. 24 25 4 5. Die Erzbischöfe von Mainz. Da ihnen das Kloster unterstand,30 so lag ihnen daran, dessen Einfluss zu erhöhen. Wenn Walshausen später die Patronatsrechte über die Kirchen zu Holzhausen,31 Hohenkirchen,32 Udenhausen,32 Sankt Nikolai in Witzenhausen ausübte, so kann es diese Rechte nur den Erzbischöfen von Mainz verdanken. Wie Erzbischof Gerhard 1291 dem Sankt Georgsberger Nonnenkloster das Patronat übe die Pfarrkirche zu Frankenberg verlieh33, so hat er es in demselben Jahre 1291 auch dem Kloster Walshausen über die Nikolaikirche in Witzenhausen abgegeben34. Die Zeit, wann dem Kloster das Patronat über die anderen genannten und noch manche unbekannten Kirchen überliefert ward, bleibt jedoch verborgen; wahrscheinlich aber war das schon der Fall, als Walshausen noch von den Nonnen besetzt war. Die Nonnen Die Urkunde von 1293 schließt allen Zweifel darüber aus, dass Walshausen ursprünglich ein Nonnenkloster war. Folgende Nonnen sind darin genannt: 1. Margaretha von Ermschwerd, 2. Elisabeth von Ziegenhagen35, 3. Gertrud von Zwergen, 4. Christine von Münden, 5. Bertradis von Zwergen, 6. Gertrud von Wolfsanger, 7. Adelheit von Gunthersen, 8. Christine von Warburg, 9. Mechthild von Münden, 10. Isentrudis von Kaufungen, 11. Gertrud von Sielen, 12. Kunigunde von Hofgeismar, 13. Elisabeth von Wolfanger, 14. Bertradis von Kassel 15. Gertrud von Osterode. Auffallend ist, dass die Urkunde von 1293 nicht einmal eine Oberin, Äbtissin oder Priorin, namhaft macht. Denn die zuerst genannte Margaretha von Ermschwerd wird nicht ausdrücklich als solche bezeichnet36. 30 Iurisdictio et dominium, Reg. D. Erzb. I, 58. Greb. Sal-B. 1571. 32 Staatsarch. Marb. 33 Reg. d. Erzb. I, 35 Nr. 219. 34 Rommel, Hess. Gesch. I, Anm. S. 282, Nr. 211, nach einer Urkunde des Kasselschen Archivs vom Jahre 1291, die für mich unerreichbar war; vgl. Justi, Hess. Denkwürdigkeiten III, Nr. 2 von Ledderhose. 35 Die Reg. D. Erzb. I, 58, Nr. 333 deuten Cigenhagen fälschlich als Ziegenhain; es ist damit Ziegenhagen bei Witzenhausen gemeint. 36 Die Urkunde von 1293 (vgl. Reg. d. Erzb. I, 58), deren Original sich im Reichsarchiv München findet, hat Gudenus, Cod. Dipl. II, S. 280 f. abgedruckt. An. 1293 Nos Margaretha dicta de Ermensuerde, Elizabeth de Cigenhagen, Gertrudis de Vnergen, Christina de Munden, Bertradis de Vnergen, Gertrudis de Wulvesanger, Alheidis de Gunthersen, Cristina de Wartberg, Methildis de Munden, Isendrudis de Coyfungen, Gerdrudis de Syloz, Cunegandes de Geismar, Elizabeth de Wulvesanger, Bertradis de Casle, et Gerdrudis de Ostirode Sanctimoniales Monasterii ?? Walehusen: Tenore presentium recognoscimus quod donationem bonorum Monasterii nostri predicti, a Religioso viro dno Abbate, et Conventu, in Hersindehusenfactam, ratam et gratam habemus iuxta formam Litterarum subscriptarum desuper confectarum, quarum tenor talis est: 31 5 Welchem Orden die Nonnen angehörten, ist in Dunkel gehüllt37. Wilhelmiterinnen können es nicht gewesen sein38. Auch Zisterzienserinnen sind ausgeschlossen39. Vielleicht waren sie eine Genossenschaft adliger und vornehmer Jungfrauen der benachbarten Geschlechter, welche in ihrem Orden die Regeln des heiligen Augustinus befolgten. Die frommen Mädchen stammten ja zumeist aus der Nachbarschaft. Andere Namen von Walshäuser Nonnen sind leider der Nachwelt nicht überliefert. Das Ende des Nonnenklosters 1293 ff. Wir würden sogar die Namen der 15 angeführten Nonnen nicht kennen, wenn sie nicht in der erwähnten Urkunde von 1293 eigenhändig das Todesurteil über ihr Nonnenkloster unterschrieben hätten. Erzbischof Gerhard von Mainz trat am 12. Dezember 1293 mit Zustimmung seines Domkapitels das Herrscherrecht und die Gerichtsbarkeit über Walshausen an das Kloster Hardehausen40 bei Warburg ab. Als Entschädigung erhielt Mainz 24 Hufen Grundbesitz in Volpertshausen, Udenhausen und Helpoldessen bei Grebenstein. Auf diese Weise vermehrte der Erzbischof seinen Einfluß in der Nähe seiner Stadt Hofgeismar, während das Kloster Hardehausen seine Macht in der Nähe der ihm gehörenden Güter Holzhausen und Hadubrachtshausen (Mönchehof) weiter ausdehnte. Zugleich mag aber auch der Erzbischof deshalb seine Rechte aufgegeben haben, weil er die Aufsicht41 über das Kloster nicht so wirksam ausüben konnte, als es dem Hardehäuser Abt möglich war. Der neue Herr von Walshausen hat wohl die Nonnen in dem Kloster gelassen, bis sie eine andere Stätte aufgesucht oder in den schweren Zeiten der Hungersnot und der Pest um 1309 das Zeitliche gesegnet hatten. Vielleicht wurden auch einige seiner Bewohnerinnen auf irgendeine Art sofort abgefunden; möglich wäre auch, dass in Hardehausen zunächst gar nicht die Absicht bestanden hat, das Nonnenkloster aufzuheben; es sollte vermutlich nur unter die Ordenregeln der Zisterzienserinnen gestellt werden. Jedenfalls ist Walshausen von dem Zisterziensermännerkloster Hardehausen nicht schon 1294 mit Mönchen besetzt worden; denn sie hätten mit den Nonnen zusammen leben müssen, solche Doppelklöster aber wurden von den Zisterziensern nicht geduldet42. Bei ihnen sind männliche und weibliche Glieder des Nos Rudolfus Abbas totusque Conventus Monasterii Hersindehusen tenore presentium recognoscimus, protestantes; quod, quia Reverendus Dominus noster Gerhardus Archiepiscopus Moguntinus, cum consensu Capitali sui, Monasterium Walehusen a iurusdictione et dominio Sancte Moguntine Ecclesie eximens et dimittens, in ius monasterii nostri Hersindehusen transtulit, a nobis et posteris nostris perpetuo cum omnibus pertinenciis et iuribus suis iuxta libertatem privilegii nostri Ordinis possidendum; Nos in restaurum exemtionis et translationis prefate, damus predicto Domino nostro Archiepiscopo de bonis ipsius Monasterii Walehusen XXIIII mansos … suos apud Folprechtsen, Hilpildesen, et Udenhosen, quando requisiti fuerimus metiendos et a profata Ecclesia Moguntina, eo iure quo monasterium Walehusen ipsos habuit possidendos. Datum apud Walehusen, Anno Domini MCCXCIII, Tridie Idus Decembris. 37 Die Urkunde von 1293 läßt das nicht erkennen. 38 Rommel I, S. 337 und Anm. Nr. 211 irrt mit seinen Worten: „Von dem Orden h. Wilhelms von Guienne waren Witzenhausen und hierauf Walshausen … die ältesten Sitze in Hessen“. Denn 1.: der Orden der Wilhelmiter(= Benediktiner-Eremiten von Montevirgine in Italien) ward erst um 1120 von Wilh. V. Bercelli ins Leben gerufen und 2.: der Orden der Wilhelmiter (=Augustiner-Eremiten) entstand erst kurz vor dem Tode 1157 des Stifters Wilhelm v. Maleval. Frauenklöster sind aber stets später als Männerklöster von den Orden gegründet worden. Daß Rommel seinen Irrtum selbst I, 303 und 339 berichtigte, wie Holtmeyer IV. Bd., Anm. 18 verzeichnet, habe ich nicht feststellen können. 39 Pfr. Raßmann behauptet, es wären seit etwa 1120 Zisterzienserinnen gewesen, die er irrtümlich bis zur Reformation dort sein lässt. Aber 1120 gab es in Deutschland überhaupt noch keine Zisterzienser-Klöster, weder Männer- noch Frauenklöster. Das erste Männerkloster ist Camp (Altenkampen) bei Rheinberg im Rheinland, gegründet 1123, später Hardehausen 1140. 40 Jetzt ein Gutshof. 41 Wohl durch sein Offiziat in Heiligenstadt (?). 42 Schriftlich von Pater Gilbertus Wellstein, Abtei Marienstatt bei Hachenburg im Westerwald. 6 Ordens stets streng von einander geschieden und an ganz getrennten Stätten untergebracht worden. Das Zisterzienser-Männerkloster von 1310 bis 1525 Die Anfänge des Männerklosters Im Jahre 131043 ging eine Mönchskolonie aus den Zisterzienserkloster Riddagshausen in Hannover ab, um sich in Walshausen niederzulassen. Wahrscheinlich kam aber ein Teil des Konvents auch aus Hardehausen. Das ganze Kloster mit seinen Mönchen voll zu besetzen, dazu fehlte es wohl dem Abt von Hardehausen an den nötigen Kräften.44 Reinerus II., Abt von Riddagshausen 1303-11, mag ihn aus diesem Grund Mönche seines Klosters überlassen haben; jedenfalls aber war der Vorsteher von Hardehausen der Vaterabt45 und Visitator46 über Walshausen. Erst zehn Jahre später war er in de Lage, das Kloster mit Hardehausener Mönchen ganz zu besetzen. Als Einzugsjahr eines vollen Konvents gab der Katalog der Äbte von Altencampen 1320 an. Die Zisterzienser Im Jahre 1098 wurden von dem Benediktinerabt Robert nach vergeblichen Bemühungen, unter seinen Mönchen Zucht und Ordnung wiederherzustellen, die Abtei Citeaux bei Dijon in Frankreich gegründet, um die Regel des heiligen Benedikt in ihrer Strenge wieder aufleben zu lassen. Nach der Abtei und der alten Stadt Cistercium=Citeaux nannte man die Glieder des neuen Ordens die Zisterzienser. Die Regel, nach der die Mönche leben mussten, war außerordentlich hart. In volkreichen Städten und Gegenden durften sie sich nicht niederlassen, sondern nur an möglichst abgelegenen Plätzen. Chordienst und Handarbeit füllten ihre Tage aus; schon morgens um 2 Uhr rief sie die Klosterglocke zur Frühmette, zu einem Gottesdienst mit Gebet und Chorgesang; nach kurzer Ruhe gingen sie in die Arbeitssäle, wo sie alles selbst anfertigten, was sie brauchten; die Arbeitszeit dauerte bis abends 5 Uhr, wurde aber alle 3 Stunden durch Gebet und Gesang unterbrochen; am Morgen 43 Winter, Die Zisterzienser des nördlichen Deutschlands III, S. 43; Hans Pfeifer, D. Kl. Riddagsh. Wolfenbüttel 1896, S. 4 und 9 gibt 1301 an. 44 Vermutung von Pater Gilbert Wellstein Ord. Cist., brieflich; zudem muss bedacht werden, dass von 1309-15 eine Zeit der Hungersnot und Pest war, in der auch die Zahl der Mönche sich verringerte. 45 Vgl. in der später abgedruckten Urkunde von 1519 den Ausdruck: auctoritate paterna und vorher in nostro monasterio. 46 Meibomius, Script. III, S.369: (Chronicon Riddagshusense, Helmstadii 1605 p. 47) “Non dissimulabo hic quod annotatum reperi in Fastis Mariaerodensibus: nempe huius Reineri abbatis tempore et quidem anno 1310 ex coenobio Riddagshusano novam coloniam deductam esse Walshusium. Id monasterium ubi sit ignoro: Hoc novi, recenseri inter ea, quae subsint abbati Veteris-campi et quidem Visitationi abbatis Hardehusani in agro Paderbornensi, ut habet catalogues abbatum Campensium Johannis Dethmari, Coloniae excusus. Forte quod longe abbesset hoc coenobium Riddagshusanus alteri id commisit, sua contentus familia. Dethmarus, quem laudavi testem, Walshusensis primordial refert in annum 1320.” Vgl. hiermit Janauschek, origines Cisterc. I, LX: Walshusium, Meibomius annotatum reperit in fastis Mariaerodensibus Reineri Riddagshusani abbatis, tempore et quidem a. 1310 ex coenobio Riddagshusano novam coloniam deductam esse Walshusium idque monasterium recenseri inter ea, quae subsint abbati Veteriscampi et quidem visitationi abbatis Herdehusani in agro Paderbornensis. – Idem ille scriptor ad confusam hanc relationem adjicit Johannem Detmarum in catalogo abbatum Campensium illius coenobii primordia referre ad a. 1320, se autem ignorare ubi sit, quae exscribens Jongelinus Walshusium illud in Austria superiore (!!) et dioecesi Pataviensi floruisse putavit, Bucelinum aliosque pedisquos nactus. Aber Januschek irrt selbst, wenn er W. bis zur Säkularisation als Frauenkloster betrachtet, und Meibomius ist unzuverlässig, wenn er meint, dass Reinerus Walshausen wegen der weiten Entfernung von Riddagshausen aufgegeben habe; Hardehausen ist ja fast ebenso weit; deshalb gab auch kein Unterabt seine Rechte auf. 7 fand um 9 Uhr der Hauptgottesdienst, das Konventamt, statt; dabei wurde jedoch keine Predigt gehalten; nur hohe Festtage zeichnete man durch einen Sermon aus; um 10 Uhr nahm man ein kärgliches Mittagsmahl ein, wobei fast alles Fleisch verbannt war und nur hölzerne und irdene Geschirre zum Gebrauch dienten; zu Abend aß man um 5 Uhr, worauf Vorlesungen aus Erbauungsbüchern folgten; um 8 Uhr ging es in Einzelzellen zu Bett; das Lager bestand aus einem Strohsack, Pfühl und wollener Decke; in voller Kleidung legten sich die Mönche nieder; nur mit Erlaubnis durften sie Schuhe und Strümpfe vorher ausziehen. Die Kleidung bestand vor allem in einer groben, grauweißen Kutte, weshalb sie „Graue Mönche“47 oder „Mönche vom grauen Orden“ 1434 hießen. Neben den eigentlichen Mönchen schuf der Zisterzienserorden die so genannten Konversen = Laienbrüder, denen die Bewirtschaftung der Klosterhöfe, also die eigentliche Feldwirtschaft, oblag. Auch Walshausen barg solche Laienbrüder, die den Ackerbau daselbst betreiben; es war ein Feldkloster, in welchem der alte Mönchsgrundsatz „Bete und arbeite“ zur Ausführung gebracht wurde. Die Zisterzienser haben sich so als Kulturpioniere in Deutschland erwiesen. Altenberg und Camp im Rheinland, Chorin und Lehnin in der Mark Brandenburg, Pforta in Thüringen, Walkenried am Harz und viele andere Kulturmittelpunkte verdanken wir ihrer Tätigkeit, die allenthalben eine Hebung der sozialen Lage des Volkes herbeiführte. Auch unsere Gegend, der Südhang des Reinhardswaldes, würde nach menschlichem Ermessen nicht das geworden sein, was er heute ist, wenn sich nicht um 1310 die Zisterzienser aus Riddagshausen und Hardehausen in Walshausen niedergelassen hätten. Die Äbte von Hardehausen. Die Walshausen Mönche standen unter der Aufsicht des Abtes von Hardehausen; er war ihr Vaterabt,48 welcher alljährlich mindestens einmal das Tochterkloster visitierte; er hatte den Vorsitz bei den Wahlen inne und vollzog die Bestätigung der Gewählten. Aber wenn das Kloster auch in dieser Weise von dem Abt in Hardehausen abhängig war, so ist es doch keineswegs bloß, der Meierhof eines größeren sächsischen Zisterzienserklosters49 gewesen. Vielmehr liegt in Walshausen eins der wenigen selbstständigen Priorate vor,50 die zu dem Verband dieses Ordens zählten. Die Prioren. An der Spitze der Chormönche, deren Zahl nicht bekannt ist und kaum mehr als 10 betragen haben kann, und der Laienbrüder oder Konversen, zu denen ebenfalls etwa 10-15 gehört haben mögen, stand der Prior, der in Urkunden „andechtig“ tituliert wird.51 Er war der Pastor, Beichtvater und Seelsorger der Mönche, der sie in Zeiten der Anfechtung stärkte und tröstete; auch auf gewissenhafte Beobachtung der Ordensregel hatte er zu achten, sowie Gehorsam und Ehrerbietung zu beanspruchen. Die Pflichten des Priors lagen aber nicht nur auf religiös-sittlichem, sondern auch auf dem rein Weltlichen Gebiet; er leitete als der Vorsitzende die Zusammenkünfte der Mönche, wenn sie im Konvent über wirtschaftliche Angelegenheiten des Klosters berieten und Beschluss fassten. Arbeit gab es in jeder Beziehung für ihn genug. Monachi grisei; der Bursarius der Mönche vom „grauen Orden“ wird 434 erwähnt Staatsarch. Marb. Vgl. die gleich nachher abgedruckte Urkunde aus der Abtei Marienstatt: auctoritate paterna. 49 Wie Holtmeyer a. a. O. glaubt; dann wären Konversen daselbst ausreichend gewesen oder ein Pächter. 50 Cisterc.-Chronik, 23. Jahrg., Nr. 265, März 1911, S. 65. 51 Walsh. Urkunden im Staatsarch. Marb. und Schmincke, Manusc. von den hessischen Klöstern, Landesbibl. Kassel. 47 48 8 Von den etwa 20-30 Prioren des Klosters sind uns nur die Namen einiger überliefert51: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hermann um 1434. Walterus um 1455. Ludevicus um 1461. Henrick Symon um 1491. Johannes Beiger (Beigerl) um 1500; auf seinem spitzovalen Siegel erscheint er stehend mit dem Kelch in der Linken; außer ihm werden 1499 als Mönche genannt Conradus Gotschalki, Henricus Gottingen, Henrick Wyseminne. Henricus um 1510; nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, blieb er als „der alte Prior“ auch weiterhin im Kloster. Christian um 1515; er ward 1519 zum Abt des Klosters Bredelar in Westfalen gewählt und hieß daher Christian von Bredelar; er starb 1526.52 Heinrich vom 23. Mai 1519 bis 1525, der letzte Prior; nach seiner Herkunft ward er Heinrich von Paderborn genannt; eine Urkunde von ihm vom 2. April 1521 beginnt: „Ick Henricus von Paderborn jizt thor tydt Confirmierder prior tho Walßhußenn bekenne opanlik;” er sprach und schrieb also plattdeutsch. Seine Wahl zum Prior am 23. Mai 1519 wird uns genau beschrieben. 53 Unter dem Vorsitz der Vaterabts Johannes VI. von Hardehausen, der zum Zwecke der „Cistercienser-Chronik“ vom 1. März 1911, Nr. 265 Anm. Original-Urkunde im Archiv Abtei Marienstatt auf Pergament, das stellenweise durch Nässe beschädigt und ein wenig durchlöchert ist; die Abschrift wurde mir brieflich von Pater Gilbertus Wellstein zugesandt und ist mittlerweile in der „Cisterzienser-Chronik“ vom 1. März 1911, Nr. 265, S66/67 abgedruckt worden: Ad universorum, quorum interest, noticiam. Nos frater Joannes, abbas monasterii de Herdehusen, ordinis Cisterciensis, Paderbornensis diocesis, deducimus per presentes quod anno domini millesimo quingentesimo decimo nono die vero vicesima secunda mensis maii assidente nobis venerabili in christo patre et domino, domino Chrisstiano monasterii Breidelaris abbate personaliter in nostro monasterio Walleshusen constitui, quod quidem monasterium per cessionem videlicet dicti venerabilis patris domini Christiani de prioratu eiusdem monasterii Walshußen ad regimen abbacialis dignitatis monasterii Breidelaris novam per electionem proprio pastore destitutum ac viduatum reperientes. Ne igitur dictum monasterium sic pastoris solacio destitutum ruinam in spiritualibus pateretur, ad provisionem ipsius solerter intendere cupientes, congregatis omnibus dicti monasterii professis, ipsis diem electionis assignavimus et prefiximus secundum nostri ordinis statua. Qua die adveniente, que erat ipsa dies Desiderii martiris, convocatis omnibus more nostri ordinis in capitulo, ad nostram requisitionem surrexerunt duo seniors, et nominates electoribus, quos reliqui de conventu per nos primo, secundo et tercio requisiti, utrum electors istos idoneos reputarent, an si aliquid contra ipsos vel alterum ipsorum obicere vellent, quod hoc facerent in presenti. Qui ipsos ideneos reputantes in nostra presencia vota sua in dictos electors concorditer transtulerunt, datum et gratum se habituros, quicquid per eosdem electors in dicto negotio electionis factum et conclusum fuerit, Quo facto dicti electi adiurati per nos et admoniti, quatenus deum pre oculis habentes ad electionem huiusmodi processuri omni fraude et inordinate affectione reiecta eum eligerent, quem ad huiusmodi dignitatem idoneum reputarent. Unde dicti electors, missa de spiritu sancto solempniter celebrate, confessi et communicate, invocate spiritus sancti gratia, ad locum electionis ingredientes prestitoque iuramento secundum decreta sacri consilii Basiliensis per modum scrutinii secundum formam ordinis vota sua nobis revelantes religiosum virum, fratrem Henricum de Paderborn dicti nostril monasterii Herdehusen conventualem nostrum professum, de legittimoprocreatum, etate, prudential et moribus decoratum, in disciplina regulari nostri ordinis approbatum et in utroque statu regiminis vigilem et satis expertem, quem sic, ut permittitur, in priorem claustratem dicti monasterii Walleshusen concorditer elegerunt. Qua electione sic facta et publicata ab eodem priore sic electo, Te deum laudamus a capitulo usque ad ecclesiam omnes solemniter decantantes, deinde ad capitulum redeuntes, requisivimus rogantes, quatenus electioni de se sic facte preberet assensum pariter et consensum. Qui tandem divine nolens resistere voluntati, electioni huiusmodi sic facte consensum prebuit humiliter et devote. Unde nos auctoritate appostolica et paterna huiusmodi electionem ratam et gratam habentes, dictum dominum Henricum, prestito prius per ipsum iuramento secundum statute domini Benedicti pape duodecimi de possessionibus et rebus monasterii non alienandis, in priorem sepedicti monasterii Waleshusen electrum confirmavimus et presentibus confirmamus; inducentes eundem per sigilli traditionem in possessionem corporalem regiminis eiusdem monasterii pacificam et quietam sibique curam spiritualem et temporalem dicti monasterii committentes. Deinde omnes et singuli persone regulares dicti monasterii tunc presentes iuxta modum 52 53 9 Neuwahl eines Priors nach Walshausen gekommen war, und unter dem Besitz des Abtes Christian von Bredelar fand die Wahlhandlung in feierlicher Weise statt. Nachdem alle Mitglieder des Klosters sich versammelt hatten, bestimmte Johannes am 22. Mai den folgenden 23. zum Tag der Wahl. An ihm kamen alle Mönche im Konventssaal zusammen. Der Abt stellte ihre Anwesenheit fest. Die zwei ältesten unter den Mönchen erhoben sich danach und bezeichneten die unter ihnen mit Namen, denen die Wahl anvertraut werden sollte. Die übrigen Mönche, welche auf diese Weise nicht zum Wählen bestimmt worden waren, fragte jetzt der Vaterabt Johannes dreimal nacheinander, ob sie die ernannten Wahlmänner für geeignet hielten, oder ob sie irgend etwas gegen den einen oder anderen vorbringen wollten; sie hatten aber an denselben nichts auszusetzen und übertrugen ihnen einmütig die Wahl des Priors; was die nominierten Mönche beschlössen, wollten die anderen als gut und recht betrachten. Nunmehr wurden die Wahlmänner von dem Abt eindringlich ermahnt und beschworen, Gott vor Augen zu haben und zur Wahl unter Beiseitesetzung aller Unaufrichtigkeit und unangebrachter Verstimmung zu schreiten und nur den Mann zu wählen, welchen sie für diese Würde als den geeignetsten ansähen.54 Alsdann begab man sich in das Gotteshaus. Die Wähler empfingen dort nach vorhergehender Beichte während der HeiligenGeist-Messe, die feierlich zelebriert wurde, das Abendmahl und beteten um die Gnade des Heiligen Geistes. Jetzt gingen sie zum Wahllokal (dem Kapitelsaal), leisteten den vorgeschriebenen Eid, übermittelten auf die im Orden übliche Weise der geheimen Befragung unter vier Augen dem Abt ihr Votum und wählten Henricus von Paderborn, einen Professen und ein Konventsmitglied des Klosters Hardehausen, einen in legitimer Ehe geborenen, durch sein Alter, seine Klugheit und Sitten ausgezeichnet passenden, in der Übung der Ordensregel bewährten und in der Verwaltung weltlicher und geistlicher Angelegenheiten eifrigen und hinreichend kundigen Mönch. Einstimmig hatten sie ihn mit Zustimmung des Abtes Johannes zum Klosterprior erkoren. Nach Verkündigung des Wahlresultates stimmte der so erwählte neue55 Prior das Ta Deum Laudamus an, das alle während der nunmehrigen Prozession auf dem Wege vom Kapitelsaal zur Kirche sangen. Zum Kapitel wieder zurückgekehrt, ersuchte der Vaterabt der Erwählten um Annahme. Dieser wollte schließlich dem göttlichen Willen nicht widerstehen und erklärte sich ich demütiger und bescheidener Weise dazu bereit, das schwere Amt anzunehmen, worauf der Abt auf Grund seiner apostolischen und väterlichen Autorität die vollzogene Wahl als rechtsgültig feststellte. Der neue Prior aber schwur entsprechend den Bestimmungen des Papstes Benedikt XII., an den Besitzungen und Verhältnissen des Klosters nichts zu ändern. Sodann ward er als Prior von Walshausen vom Abt Johannes bestätigt und ihm das Siegel übergeben, wodurch er in den tatsächlichen Besitz ordinis hactenus approbatum prefato priore suo professionem fecerunt, sibi veram obedientiam premittendo. Quapropter omnibus et singulis personis regularibus sepedicti monasterii in virtute sancte obedientie auctoritate predicta precipimus et mandamus quatenus religioso eorum priore confirmato tamquam vero pastori ac rectori animarum suarum ubique et semper reverentiam et obedientiam omnimodam impendere studeant debite et devote. Ceterum, quia status mundi et revera infortunii eventus inopinate succedunt, ea propter dictum priorem dilectum nostrum suo fontali monasterio minime frustrare volentes, idcirco nos de plena voluntate et auctoritate paterna pro nobis et nostris successoribus volumes et vigour presentium decernimus, ut sepefatus prior post dicti prioratus resignationem habeat et retineat sui originalis monasterii Herdehusen liberum reingressum sine nostra aut successorum nostrorum contradictione quacumque non obstante, quod nobis aut successoribus nostris pro tunc non fuerit professus, quia originaliter lovo professus est. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum unacum sigillis venerabilis domini Christiani, abbatis in Bredelaria predicti, et religiosorum fratrum conventus monasterii Walßhusen presentibus sunt appensa. Datum et actum anno, mense et diebus quibus supra. 54 Eine Wahl konnte auf dreifache Art vor sich gehen: a) per acclamationem, d.h. der Vaterabt oder einer der Mönche schlug einem zum Amte geeigneten vor und die anderen Wahlberechtigten stimmten zu; b) per scrutinium, d.h. alle geben ihre Stimme schriftlich oder mündlich vor dem Vorsitzenden und den Zeugen ab; einige Wähler fungieren als scrutatores = Prüfer der Stimmzettel; c) per conspirationem, d.h. die Wähler bestimmten einige aus ihrer Mitte, die dann mit vollem Rechte sie Wahl betätigten. 55 Er war anwesend; anscheinend hatte ihn Vaterabt Johannes als seinen Wahlkandidaten von Hardehausen her mitgebracht. 10 der Verwaltung eingesetzt und ihm die Sorge für die geistlichen und weltlichen Angelegenheiten des Klosters anvertraut war. Prior Heinrich aber erneuerte im Namen aller anwesenden Mönche und eines jeden einzelnen von ihnen das Gelübde wahren echten Gehorsams gegen den Vaterabt, welcher seinerseits den Ordenspersonen insgesamt und jedem einzelnen von ihnen aufgab, in ihrem Prior ihren Seelenhirten zu sehen und ihm stets mit schuldiger Ehrerbietung und Gehorsam zu begegnen. Zuletzt sprach Johannes von Hardehausen noch ein Trostwort zu dem neuen Prior in Betreff seiner Zukunft bei den bedenklichen Verhältnissen der Zeit. Mönche. Unter der Aufsicht des Priors Heinrich von Paderborn lebten in Walshausen als Mönche, die uns bekannt sind: Henricus Hormes 1515, Conradus Marscalcus um 1515, Cunradus Satte 1515-25, Konrad Zancken, Clemens Hantho, Heinrich Minimen (?). Die Klostergebäude. Von der zum Kloster gehörenden Klausur56 mit dem Konventsaal und den Mönchszellen ist nur so viel bekannt, dass sie einen rechteckigen Hof einschlossen, der sich in üblicher Weise der Kirche an der Südseite vorlegte. Der Westflügel der Klausur ragte aber etwa 12 m über die Westseite der Kirche hinaus. Der Ostflügel 57 schloss sich an das Querschiff des Gotteshauses an; eine Tür verband beide; der Ansatz eines halbkreisförmigen Tonnengewölbes im Unterteil der Transeptwand lässt uns noch diesen ehemaligen Zustand deutlich erkennen. Wahrscheinlich darf man an die letzten Spuren eines Kreuzgangs denken, in den auch das Südschiff der Kirche einbegriffen war. Die Wirtschaftsgebäude, welche bei einem Zisterzienserkloster besonders groß waren, haben nördlich (Heise) und westlich (?) des Wohnblocks gelegen. Wenigstens gibt der Plan vom Ende des 16. Jahrhunderts, der auch die Konventbaulichkeiten in einer freilich durch die praktischen Bedürfnisse der neuen Ansiedler bereits entstellten Form bringt, an dieser Stelle scheunenartige Fachwerkbauten wieder. Das Torhaus auf derselben Zeichnung war ein massiver Unterstock mit rundbogigem Durchgang und Fachwerkaufbau. Man darf es als den damals erhaltenen Rest der Umwehrung ansehen, von der vielleicht auch noch der „Mönchebaumgarten“ und bestimmt die Stätten umschlossen waren, auf denen heute Roth und Schütz ihre Wohnungen haben. Die Grundmauer eines Teils der Umfassungsmauer ist in der Breite von etwa 1½ m noch vor der Schmiede Roth’s sichtbar. Derselbe Plan zeigt vor der Westseite der Kirche Baulichkeiten. 56 Nach Holtmeyer a.a.O. berichtet, sowie nach eigenen Feststellungen. Von ihm aus führte ein romanisch gewölbtes Tor (Tür) in den Garten der Mönche (mündlich von Witwe Roth, geb. Volkwein, welche diese Einrichtung noch selbst als Kind gesehen hat). 57 11 Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Klosters. Der eigne Besitz des Klosters an Grund und Boden war ziemlich bedeutend. Es gehörte ihm alles in seiner nächsten Nähe diesseits und jenseits der Fulda. Seine Laienbrüder hatten einen großen Teil hiervon selbst gerodet und trockengelegt. Um 1020 war nämlich das linke Fuldaufer von Wilhelmshausen bis zur Spiegelmühle noch Wald oder Sumpf gewesen; die Zisterzienser machten daraus fruchtbare Feldfluren. Auch nach der anderen Seite, nach Münden hin, suchten sie Neu- und Rottland zu gewinnen; am 3. Juli 1486 gab Landgraf Wilhelm dem Prior und Konvent die Freiheit, unter dem „Tsekenberg“ =Ziegenberg unter dem alten Wege daselbst, und bei „der Elsterbach“ sowie innerhalb der Grenzsteine ihrer Feldmark, die von alters her Klostereigentum gewesen ist, selbst roden und dem Acker nach bestem Nutzen uns Bequemlichkeit bauen lassen zu dürfen. Im Ganzen waren es um 1500 mehr als 700 Acker Land und Wiesen, die das Kloster in seiner nahen Umgebung besaß. Aber auch außerhalb von Walshausen in den benachbarten Ortschaften und ihren Gemarkungen hatte das Kloster Liegenschaften. In Immenhausen gehörte ihm 1434 ein Hof, wahrscheinlich der so genannte Junkernhof, der an der Stelle des heutigen Pfarrhauses sich befand; den Herren von Stockhausen war er in Lehen gegeben. Mit diesen Adligen ist das Kloster überhaupt durch mannigfaltige Fäden verknüpft gewesen. Am 14. Februar 1511 teilten zwei Herren von Stockhausen aus Münden, die beide den Vornamen Hans tragen, dem Bürgermeister und Rat von Immenhausen mit, die Stadt möchte doch die ihnen zustehenden 7 Gulden, die sie jährlich aus dem Rathaus erhalten hätten, in Zukunft dem Konvent des Klosters entrichten. Auch die Familie Kohlborn in Immenhausen hatte Lehngüter aus der Hand des Klosters in Bewirtschaftung. In Udenhausen besaß es ebenfalls Ländereien. Obwohl die letzten Nonnen von Walshausen ausgedehnten Grund und Boden 1293 dem Erzbischof von Mainz in dem genannten Dorfe überlassen hatten, so war dem Kloster doch noch solcher verblieben oder später von neuem zugefallen. Am 15. Juni 1429 gab es nämlich dem Diderich von Twergen (Zwergen) 2 Husen Land in der Udenhäuser Gemarkung für jährlich 2 Malter Korn in Meierrecht; der Vertrag ward jedoch bald wieder von dem Pächter gekündigt. Mit den Bewohnern seiner Nachbardörfer und –Städte unterhielt Walshausen auch noch in anderer Beziehung ausgedehnten wirtschaftlichen Verkehr. In Hohenkirchen, Holzhausen, Immenhausen, Udenhausen und anderen Dörfern empfing es von umfangreichen Grundflächen den Zehnten. In Holzhausen hatte das Kloster eine Scheune zur Aufnahme der zehntpflichtigen Erntemengen; für diese Scheune zahlte es 1465 eine Abgabe von 3 Mark an den Landgrafen,58 welcher den Zehnten dem Kloster durch Holzhäuser Anspänner zu Dienste einfahren ließ; auch dafür hatte Walshausen eine kleine Summe an ihn zu entrichten,1 da ja nur er damals Ansprüche auf Dienstleistungen seitens der Holzhäuser Bauern besaß. Die Ländereien in der Gegend von Waitzrodt-Langemaaße in der Größe von etwa 200 Acker waren aber in der Holzhäuser Gemarkung nicht die einzigen gewesen, die an Walshausen ehedem den so genannten „Mönchszehnten“ gaben; vielmehr zehntete das gesamte alte Holzhäuser Feld, angesehen von dem Junkernfelde, eben dahin. Die eingegangenen Ernteerträge verkaufte oder verpfändete das Kloster, soweit es dieselben für den Unterhalt seiner Mitglieder nicht selbst brauchte. So überließ es am 15. April 1515 an die Äbtissin Ilse von Paderborn jährlich 7½ 59 Malter Korn und Hafer, wiederlöslich für 150 Gulden. Schon vorher 150160 verkaufte der Konvent des Klosters dem „ehrsamen Stotter Johann“ in Kassel, 58 Greb. Amts-Rech. Staatsarch. Marb. „acht halb malter“ der „moder Ilsen“ 60 Urkunde des Klosters im Staatsarch. Marb. Vom 3. Juni 1501, die daselbst in doppelter, fast wörtlicher 59 12 seiner Frau und seinem Bruder für 64 Gulden jährlich 3 Malter Frucht halb Korn, halb Hafer aus seinem Hofe zu Immenhausen, aus seinem Zehnten zu Hohenkirchen und, wenn nötig, aus allen seinen Gütern; nach dem Tode dieser drei Personen sollte jedoch die Verpflichtung des Klosters erlöschen, das Getreide zu liefern. Andere Mittel flossen dem Kloster durch Stiftungen zu. Die Landgräfin Anna von Hessen, geborene Herzogin von Mecklenburg, spendete ihm 1515 den Betrag von 20 Gulden. Dafür nahm „der Gantz Convent des gotteshauses Sanck marien gelegen an der fulde faste by munden“ am 26. März 1515 die Verpflichtung auch sich, uff eyn jeden Montag nach dem Sonntag Jubilate eine Seelenmesse christlich und andechtiglich zu halten.61 Sicherlich war dies nicht die einzige fromme Stiftung, die den Zisterziensern in Walshausen übergeben worden war, wenn uns auch keine weitere bekannt ist.62 Im Reinhardswald übte das Kloster Gerechtsame aus; vielleicht hatte es sogar darin Eigentumsrechte. Der Landgraf von Hessen suchte sie um 1420 zu beschränken. Aber der Erzbischof von Mainz, der auch nach der Abtretung des Herrscherrechts und der Gerichtsbarkeit über das einstige Nonnenkloster Walshausen an Hardehausen das geistliche Oberhaupt der ganzen Gegend war, nahm sich des bedrängten Klosters an. Unter den Klagepunkten, die das Erzstift 1425 gegen Hessen vorbrachte, wird auch die Beeinträchtigung der Waldgerechtsame63 von Walshausen angeführt. An Bargeld scheint es jedoch dem Kloster gelegentlich gemangelt zu haben. Am 2. April 1521 bekennt nämlich Prior Heinrich zu Walshausen, dem Hans Kohlborn in Immenhausen 40 Gulden schuldig zu sein. Hierfür behielten Kohlborn und seine Frau Ilse von dem für Lehngüter an das Kloster zu entrichtenden Zins jährlich 18 Scheffel Partim ein; ohne Ausfertigung vorhanden ist: Wolßhußen, 3. Juni 1501. Wir Johannes Beyger, Prior zu Wolshusen und die gemeyne Conventshern darselbest bekennen offentlich vor unß und alle unser nachkommen in crafft disses briffes, das wyr umb unseres stifftes not und notßen willen verkaufft habenund myt dissem briefe verkauffen drye malder fruchte kassels maaß halb korn und halb haber gute frucht uß unserem hohe zu Imenhusen uß unßerm Zenden zu Hoenkyrchen vnd furter vß alle vnsern güdern dem Ersam manne Stotterjohan burger zu Cassel die wyle er lyebet und lebet und nach synem tode, ßo fullen und wollen wyr der dryer malder geben seß fertel Gertruden syner elichen hußfrauwen und die anderen seß fertel Johanse, Stotterjohans synem lyblichen bruder alles halb korn und halb habern – Und wilcher eynß von den zweyen Gertrude und Johanße uzt genant abgehet und styrbet. So fal syn teyl nemlich seß fertel ouch loß vnd vnserm closter widderheym gefallen syn Und die genanten korngulde fal vff eynem iglichem sant Michelß tage erschynen Und uff Martini darnach dye drye malder in ere gewalßam zu Cassel gutlich zu libbern und zu bezalen an eren schaden Sunder alle behynderunge kommer gebot ader vorbot geystlich oder werntlich wy dass gesiu mocht in keyne wyse. Darvor haben unß die kauffer gegeben vnd zu dank ubergelibert und gezalt seßtyg vier funsche gulden die wyr in unßern notz gewant. Und nemlich dyevier gulden geldes vor seßtzig gulden von den Carmeliten zu Cassel der myt myddergekaufft vnd gelost haben Wyr ader vnser nachkommen ensollen aber emvollen vnß auch nicht gebruchen keynerley Priuilegien genade aber freyheit Punte ader Artikel wy die synt aber erdacht mochten werden die unß genutzen Vnd den kauffers an dissen vnser ufrichtigen verschrybunge geschaden mochten in keyne wisse Sunder ine dass alle zeyt genugsam warschaff thun und dissen brieff vnd verkauff erbarlich uffrichtig stede und faste halten sunder alle geuerde Vnd wan dye drye Personen Stotterjohann, Gertrudt vnd Johans vorgenanten alle todteßhalber abgescheyden sin dass got almechtig nach syne willen schicke und verhalte ßo sol disser brieff Krafftlos vnd unß dye drye malder widderumbheym geuallen syn Alleß sunder argelist vnd geurde deß zu orkunde So han Ich Johans beyger Prior dissen brieff myt myne Jngesigel vestiglich beßigelt Vnd wyr andern hern und brüder deß Convents wolßhusen vnse gemeyne Jngesigel zur furte bekenntlich der wahrheit dissen brieff middebesigelt, der gegeben ist in dem jahr alse man schreeb nach crist geburt funfftzenhundert vnd eyn, uff Donerstag nach pinsten. 2 Siegel. Das Priorsiegel spitzoval, oben beschädigt. 61 Staatsarch. Marb. 62 Vgl. aber unter „Nonnenkloster“ 63 Holtmeyer a. a. O. 13 diesen Abzug hätten sie für ihren Grundbesitz jährlich 5 Viertel 10 Metzen Partim zu liefern gehabt. Nach Aufhebung des Klosters entrichteten sie den Zins an den „Vogtherrn“. Die Angelegenheit bereitete noch 1569 Schwierigkeiten.64 Von schweren Schicksalsschlägen, die das Kloster wirtschaftlich zurückgebracht hätten, ist der Nachwelt keine Kunde überliefert worden. Vielleicht hat es damals, als die nahe Ziegenburg zerstört wurde, auch Leiden zu erdulden gehabt. Seine Mauern konnten freilich nicht so leicht dem Erdboden gleichgemacht werden. Sie standen fest durch die Jahrhunderte hindurch. Da aber traten Ereignisse ein, welche diese starken Mauern zunächst erschütterten und sie zuletzt nach mehr als 350 Jahren gänzlich von der Erde verschwinden ließen. Das waren Vorgänge im religiösen, geistigen und wirtschaftlichen Leben des Volkes. Das Kloster in seinen letzten Zügen 1525 ff. Luther drang mit seinen Gedanken auch durch die Klostermauern von Walshausen; am Reformator schieden sich die Geister der Mönche; die einen blieben dem Papst treu, die anderen waren für Luther. Die religiösen Meinungsverschiedenheiten machten das gemeinsame Leben unter den Mönchen unerträglich und unmöglich. Der Mönch Konrad Satte, genannt Warburgk, und andere, wie vielleicht auch Joachim Leimbach traten offen auf Luthers Seite. Satte wurde aus einem Zisterzienser der erste evangelische Pfarrer in Holzhausen 1525; Leimbach folgte ihm in dieser Würde 1531 nach. Die Mehrzahl der jüngeren Mönche scheint lutherisch geworden zu sein, wenn auch nicht auf einmal, so doch allmählich. Die Männer des Klosters wurden auf diese Weise selbst seine Totengräber. Nichtsdestoweniger würde die alte Ordnung in Walshausen nicht schon acht Jahre nach dem Anschlag der 95 Sätze Luthers an die Schlosskirche zu Wittenberg sich aufgelöst haben, wenn nicht auch der regierende Landgraf von Hessen dem Klosterleben grundsätzlich ablehnend gegenübergestanden hätte. Durch das Auftreten Luthers, der selbst ganz und gar nicht ein Gegner des Mönchtums, wie es sein sollte, und insbesondere nicht der „Feldklöster“ der Zisterzienser65 gewesen ist, sondern nur ein Feind der Möncherei, wie sie vielfach in der Wirklichkeit sich zeigte, glaubte man sich damals allgemein in der Gotteserkenntnis bereichert, so dass man das mönchische Leben nicht mehr mit Gottes Geboten vereinbar fand. Auch Landgraf Philipp neigte zu dieser Meinung. Schon 1525 hob er „die Obrigkeit im Kloster auf durch Gotteserkenntniß“.66 Mit anderen Worten, der letzte Prior, Heinrich von Paderborn, ward abgesetzt. Der Vaterabt, Johannes von Hardehausen, hatte nach dessen Wahl 64 Staatsarch. Marb.: „Es seindt nuhn viel Jahr hinaußer alle Jar Fünff Viertel zehn metzen Partim auß dem Cloister Walßhaußen einen Burger zu Immenhausen genannt Hannß Kolbornn und volgennts seinem Sohne Hinrichen Jetzigen Schultheißen zu Immenhausenals ein Leibgeding vonn dem Vogthern zu Walßhausen in Ihrenn Registernn hinaus geschriebenn. Itzo aber als gedachter Schultheis seinen titulum und ankauff deßhalben ediren sollen, Prinngt er vor einen außgeschnittenen Zettel dessen Inhalts das Anno 1521 tertia in paschalibus Henrich prior zu Walßhaußen bekennt Schuldig zu sein vierzig gulden golts oder gelts wehrung, dafür muß Hans Kohlbornn oder seine erbar (Frau) Jerlichs einbehalten achtzehn Scheffel Partim an der Zinnts so das Cloister uf Kohlbornns guter geheftet furbehaltlich der Widderlosung die uf Michaelis zu thun doch zu eigenem nutzen bemelts Kloister. Wanndt aber dißer außgeschnittene Zettell mit Niemandts Handtzeichen oder Sigelen bekrefftigt ist von einem widderverkauff Sagt da doch die Register melden, es sey ein Leibgedinng, auch sich befindet, das Hanns Kohlbronn und sein Sohne lange Jahr solch achtzehn Schiffel Innbehalten, So weiß ich mich nicht genugsam Inn diese Handlung zu finden Sondernn erwartte darüber meines gn. F. und Herrn gnädigen Resolution. Signatum Cassel am 6. Januarri Anno domini 1569. 65 Seine Frau, Kath. V. Bora, war eine Zisterzienserin gewesen. 66 Vgl. im ersten Teil unter „Reformation“ die abgedruckte Urkunde S. 53 Anm. 14 1519 richtig prophezeit, dass „ in Wahrheit des Unheils Ausgang sich unvermutet naht“. An das Versprechen der Hilfe in der Not, welches ihm damals von Johannes gegeben worden war, mag wohl Heinrich 1525 gedacht und seine Zuflucht in seinem Mutterkloster Hardehausen gesucht und gefunden haben. Ob auch die etwaige Sittenlosigkeit der Mönche Veranlassung gab, die Obrigkeit des Klosters kurzerhand schon1525 aufzuheben, darüber fehlen Nachrichten. Rechtsgültigkeit erlangte die Aufhebung der Walshäuser Obrigkeit erst zwei Jahre später. Am 21. und 22. Oktober 1526 wurde die Reformation für Hessen auf der Synode zu Homberg beschlossen und am 15. Oktober 1527 auf einem Landtag zu Kassel die Aufhebung sämtlicher Klöster im Fürstentum Hessen erklärt. Damit war das Siegel auf Landgraf Phillips Vorgehen gegen Walshausen beigedrückt. Drei Mönche fügten sich sofort den Beschlüssen des Landtags. Konrad Zancken, Clemens Hantho und Heinrich Minimen wurden schon 1527 für ihre Ansprüche abgefunden. Ein Teil der Mönche aber und zwar nicht nur in Walshausen, sondern auch in anderen Klöstern widersetzten sich der Aufhebung, einmal, weil sie nicht protestantisch werden und bei ihrem Klosterleben verbleiben wollten und sodann, weil sie ihr Vermögen in das Kloster gebracht hatten und von Rechts wegen Unterhaltung bis an ihr Lebensende verlangen konnten. Infolgedessen bestanden in Hessen zunächst noch sieben Klöster weiter. Darunter befand sich Walshausen, das auch aus anderen aufgehobenen Klöstern Mönche und – Nonnen hatte aufnehmen müssen67, damit sie darin ihr Leben beschlössen (?). Aus diesem Umstand mag es wohl zu erklären sein, dass sehr angesehene Gelehrte68 Walshausen irrtümlich als Zisterzienserinnenkloster angesehen haben. Die Zustände des „Klosters Walshausen“ im Jahre 1554 Obwohl 1554 anscheinend keine Mönche und Nonnen mehr vorhanden waren, hieß die Stätte doch immer noch das Kloster Walshausen und gehörte zum Amt Immenhausen.69 Alle Ländereien, Wiesen und Gärten, welche um und vor dem Kloster lagen, waren damals an drei „Hooffleute“ für das Dritteil aller Frucht, bis auf Weiteres“ vertan. Dieser dritte Teil der Ernte wurde „hinter den Hooffleuten“ im Felde gesammelt, für den Landesfürsten in seine Zehntscheune, die zwischen der Kirche und dem Hause des Kaufmanns Richard Schütz eingerichtet ward, eingefahren und darin gedroschen; es kamen davon c. 120 Viertel, halb Korn und halb Hafer, ein, wovon 65 Viertel, „an etliche Pfarrherren und Schuldiener“ fielen. Außerdem zahlten die drei Bewohner jährlich 2 Gulden Kuhgeld. Der Förster Johann Cuntze gab von seiner Länderei und seinen Wiesen im Jahre 1 Gulden 15 Alb. Den „Baumgarten“ oder „den Münchegaarden“ hinter dem Kloster, welcher auf der Stelle des alten Totenhofs und noch weit darüber hinaus auf jetzt Schwarz- und Böttger’schem Boden lag, hatte sich Landgraf Phillip zur Hälfte vorbehalten, offenbar des Obstes wegen. Der Landesfürst hatte auch das Recht, die Fulda bis gegen „Bollenfurdt“ zu fischen und den so genannten Landzug70 bis gegen Münden im Jahre einmal zu tun. Wer das Wehr bei Walshausen innehatte und brauchte, gab jährlich bis auf weiteres an seine „Fürstl. Gnaden“ 3 Gulden 26 Alb. 67 Raßmann in der hiesigen Kirchenchronik. Urkundliche Beweise dafür habe ich selbst nicht finden können. Janauschek, Origin. Cist. I, introduction LX.; nach ihm Raßmann. 69 Sal-B. Immenhausen Staatsarch. Marb, 70 Vgl. unter „Amt Grebenstein“. 68 15 Alle diese Einrichtungen, welche unter der Aufsicht eines landgräflichen Vogts71 standen, galten nur als vorläufig. Ausdrücklich wird von ihnen immer wieder gesagt, dass sie „bis auf weiteren Bescheid“ getroffen seien. Erst 1572 fand eine endgültige Regelung statt, worüber im folgenden erzählt wird. XI. Wilhelmshausen Dorf und Feld Die Gründung des Dorfes von Landgraf Wilhelm IV., „den Weisen“, 1572. Während Landgraf Philipp bei der Reformation für sich selbst nicht einen Pfennig der Klostereinkünfte begehrte, sondern sie für Kirchen- und Schulzwecke sowie für wohltätige Anstalten verwandt hatte, zog sein Sohn und Nachfolger, Wilhelm IV., sämtliche Güter und Einnahmen der noch bestehenden sieben Klöster für den Staat ein, um damit sein Heer kriegstüchtig zu machen, sein Land in einen guten Befestigungszustand zu setzen und vor allem die Stadt Kassel zu einer Festung ersten Ranges zu erheben. Am 8. August 157272 verordnete der Landgraf durch seinen Kanzler, S. Bing, dass an Stelle der drei73 „Hofleute“ in Walshausen acht Ackermänner und zwölf Kätner angesiedelt würden. Sein „Küchenmeister“, Eckhard Ungefug, der Rentmeister zu Schöneberg und der Förster von Walshausen erhielten den Auftrag, die Verhältnisse in folgender Weise neu zu regeln: 1. Die Klostergebäude und Behausungen. Sie sollten den Leuten „ausgeschrieben und eingeteilt werden umb ziembliche gepurliche Belohnung“. Anscheinend sind sie an zwei, später drei Bauern und an zwei Kätner für einen unbekannten Preis verkauft worden. Die übrigen Häuser und Scheunen mussten in der Richtung nach dem Walde hin gebaut werden. Da sich Wilhelm IV. für Bauwesen sehr interessierte, gab er dazu in eigener Person nähere Anweisungen; er ließ die Häuser mit Mauerwerk untersetzen, damit die Schwellen „nicht gar im Dreck“ lägen.74 Bis zum Jahre 1580 waren nicht weniger als 45 Feuerstätten vorhanden.75 Man erkennt daraus, dass sich außer den 8 Bauern und 12 Kätnern etwa 20 bis 25 andere Familien schon niedergelassen hatten. Die Bauern bauten den Dorfteil „im Dorfe“, die Kätner die so genannte „Köterei“.76 Beide Teile heißen so bis auf den heutigen Tag. Jedes Haus sollte 1 fl. Grundzins, 1 Rauchhuhn, 2 Michaelishähne geben. „Vogtherr“ 1569 genannt; er wohnte in Walshausen. Staatsarch. Marb. auf zwei fast gleichlautenden Blättern. 73 Original-Lager-Stück- und Steuerbuch von 1768 in der Spezial-Beschreibung lässt das Dorf irrtümlich aus einem Meierhof, der Wahlshausen geheißen, entstanden sein und zwar schon 1560. 74 Staatsarch. Marb. Jetzt ist das etwas ganz Selbstverständliches, damals aber nicht. 75 Dorfbuch 1580 Landesbibl. Kassel; kontribuable. 76 Ein alter Situationsplan vom Dorfe befindet sich im Staatsarch. Marb. 71 72 16 2. Ländereien. Im ganzen hatte das Kloster zu „Walshussenn“ 20 oder 21 „Huben“ = 600 Acker „arthaftigen“ Landes gehabt. Davon fielen jedem der 8 Ackermänner 69 Acker zu, zusammen 552 Acker. Ein Kätner bekam nur 4 Acker, zusammen 48 Acker. Die Ansiedler erhielten auch das Recht, an der Fulda abwärts zu roden, so dass die Kätner bald 6 Acker besaßen. Auf das so entstandene Rottland sollte eine Abgabe von 4 Pf. „Rottgeld“ pro Acker gelegt werden. Jede Hufe, die hier nur 30 Acker umfasste, hatte an Zins zu entrichten jährlich 2 Malter Partim, so dass die Ackerleute von ihren mehr als 18 Hufen Land zusammen 72 Viertel Korn und 72 Viertel Hafer liefern sollten, die Kätner aber von ihren nicht vollen 2 Husen 8 Viertel Korn und 8 Viertel Hafer, und zwar zu Michaelis. Die Einkünfte des Landesherrn vom Zehnten veranschlagte man auf 30 Viertel Korn und 30 Viertel Hafer, so dass die herrschaftliche Rentnerei auf eine Fruchtlieferung von 220 Viertel rechnen konnte. Auch sollte jeder Meier 2 Gänse, zusammen 16, liefern; an barem Geld erwartete man von der neuen Bewohnerschaft 6 fl. Einnahmen. Mergelstellen in der Gemarkung durften die Bewohner auf Anweisung ohne Entgelt zum Düngen gebrauchen. 3. Gärten. Zusammen gab’s 34 Acker Gartenland. Davon empfing jeder der 8 Erbmeier 2½ bis 3 Acker. Für die 12 Kätner blieben je 1 Acker übrig. Auf den 24 Acker ruhten 34 fl. Lasten. 4. Wiesen. In Betracht kamen 110 Acker. Die 8 Bauern sollten davon 96 Acker, jeder also 12 Acker erhalten. Die noch übrigen 14 Acker hätten sich die 12 Kätner zu teilen, jenseits der Fulda sollte man sich neue Wiesen roden. Von den gesamten Wiesen rechnete man auf eine Einnahme von 32 fl. 20½ Alb. 5. Weide und Hute. Das Recht der Schäferei ward für 1 bis 2 Pferche erteilt. Es mussten von 2 Pferchen 2 Trifthämmel, 2 Triftlämmer und von jedem Schaf 4 Pf. von etwa 600 Stück demnach 12 fl. Gegeben werden. Hute und Weide sollten die neuen Bewohner nach Notdurft angewiesen erhalten.77 6. Holz. Bauholz sollte den Leuten aus dem Forste überlassen werden unter der Bedingung, dass sie es selbst schneiden und rechtlich damit umgehen würden. Über das Brennholz müssten sie kommende Bestimmungen abwarten; es fielen ihnen später dieselben Hausforstrechte zu wie den Holzhäusern, nur dass ihr Gebiet ein noch umfangreicheres war.78 Man rechnete für den Landgrafen auf 15 fl. Forstgeld. 7. Dienste. 77 Ursprünglich befand sich die Hute im Mühlengrund und am Gahrenberg; auch die Kellermark war es früher schon einmal vorübergehend; die Leute wollten aber keinen ordentlichen Zins dafür bezahlen. 78 Siehe vorn unter „Wald-Hausforst“. 17 Dem Landesherrn hatten sie nicht nur Fahrdienste, sondern auch besondere Jagddienste zu leisten; sie sollten als ‚Grenzschützen’ dem jeweiligen Förster auf sein Verlangen bei Tag und Nacht folgen, um den Wald vor Wilddieben79 zu schützen, und ihm helfen, diese zur Haft zu bringen. Für solche besonderen Leistungen wurde ihnen die Freiheit von den Ackerdiensten versprochen; später wollten die Beamten die Bewohner doch dazu zwingen, Dienste mit dem Geschirr zu verrichten; die ‚Grenzschützen’ aber sträubten sich dagegen; sie erhielten auch 1684 einmal Recht. Der Name des neuen Dorfes. Landgraf Wilhelm IV. der Weise, war also der eigentliche Begründer des Dorfes, wenn auch dessen Entstehung im letzten Grunde mit der Reformation Luthers und der Säkularisation der Klöster zusammenhing. Nach diesem Landgrafen nannte man es daher, zunächst nur im amtlichen Sprachgebrauch ‚die Dorfschaft Wilhelmshausen’. Der neue Name findet sich schon im Dorfbuch 1580;80 in den Mund des Volkes aber ging er nur ganz allmählich über, und zwar in abgekürzter Form Wilmshausen 1702 81, Wilmershausen 1762.82 Heute bedient man sich nur des neuen Namens; das alte ‚Wals-Wahlhausen’, welches noch 1742 83 ganz allgemein von den Leuten gesprochen wurde, ist bei vielen sogar der gänzlichen Vergessenheit anheim gefallen.84 79 Sie kamen hauptsächlich aus Bonafort, Münden, Gimte und anderen hannöverschen Dörfern. Landesbibl. Kassel. 81 Kirch.-B. I, Tot.-Reg. 82 V. Westphalen, Kriege des Herzogs Ferdinand von Braunschweig VI, S. 129. 83 Dorfbuch, Landesbibl. Kassel: vulgo Wahlhausen. 84 Das ist nicht nur beim Volke, sondern auch bei Gelehrten längst der Fall; so schreibt Teuthorn, Ausführliche Geschichten der Hessen III, S. 196/197: ‚In Betracht des Klosters Wilhelmshausen…ist es erlaubt von der Gleichheit des Namens eines Ortes auf dessen Ursprung zu schließen, so wagen wir die Vermutung, dass gedachtes Kloster dem Wilhemiterorden zuständig sei, dass es dem Stifter desselben seine Benennung zu verdanken habe’; er weiß nichts von dem alten Namen Walshausen und von der Begründung des Dorfes durch Landgraf Wilhelm IV. von Hessen. 80 18