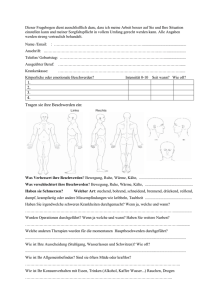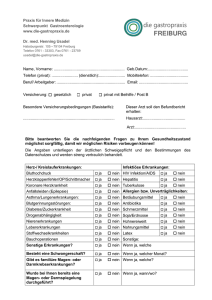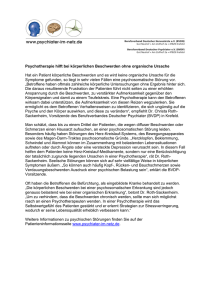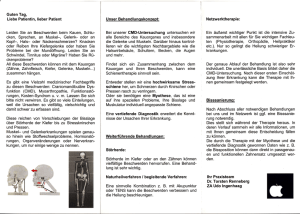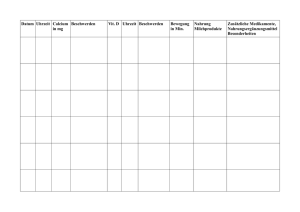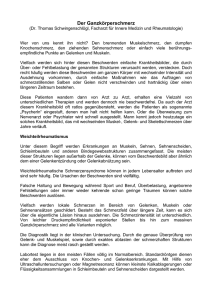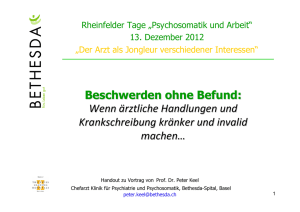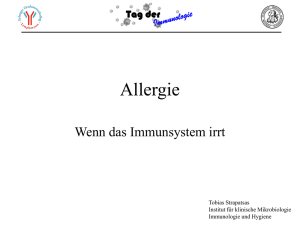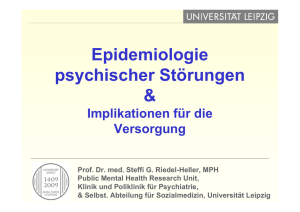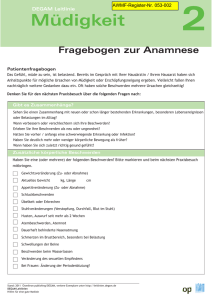Dokumentieren 2034506
Werbung

Prävalenz und beeinflussende Kofaktoren von Beschwerden des Bewegungsapparates in einem allgemeinmedizinischen Patientengut unter besonderer Berücksichtigung des Kniegelenkes Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor medicinae (Dr. med.) vorgelegt dem Rat der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena von Diplom-Mediziner Stefan Katzmann geboren am 8. September 1961 in Eisenach Erster Gutachter: Prof. Dr. R. Schiele, Jena Zweiter Gutachter: Prof. Dr. R. A. Venbrocks, Eisenberg Dritter Gutachter: Prof. Dr. Dr. R Kessel, Lübeck Tag der öffentlichen Verteidigung: 4. September 2007 Abkürzungsverzeichnis Abb. Abbildung ANOVA analysis of variances BMI Body-Mass-Index BWS Brustwirbelsäule bzw. beziehungsweise ca. zirka d. h. das heißt ggf. gegebenenfalls HER-AS Herner Arthrosestudie HWS Halswirbelsäule ISG Ileosakralgelenk k. A. keine Angaben Lkw Lastkraftwagen LWS Lendenwirbelsäule MRT Magnetresonanztomografie Pkw Personenkraftwagen vs. versus z. B. zum Beispiel Z. n. Zustand nach Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung................................................................................................................1 2 Einleitung..............................................................................................................................3 2.1 Prävalenz von Beschwerden des Bewegungsapparates.............................................3 2.2 Rückenschmerzen......................................................................................................5 2.3 Osteoarthrose.............................................................................................................6 2.4 Risikofaktoren und Korrelate von Erkrankungen des Bewegungsapparates............................................................................................6 3 Ziele Arbeit.....................................................................................................................8 der 4 Material und Methode.........................................................................................................9 4.1 Studienpopulation......................................................................................................9 4.2 Fragebogen.................................................................................................................9 4.3 Zeitlicher Ablauf und Durchführung der Studie......................................................10 4.4 Anamnesedaten........................................................................................................11 4.5 Fremdbefunde..........................................................................................................11 4.6 Statistische Methoden..............................................................................................11 5 Ergebnisse...........................................................................................................................12 5.1 Beschreibung der untersuchten Population..............................................................12 5.1.1 Geschlechtsund Altersverteilung.................................................................12 5.1.2 Anthropometrische Befunde..........................................................................12 5.1.3 Familienstand.................................................................................................14 5.1.4 Beruf und Bildung..........................................................................................14 5.1.5 Lebensgewohnheiten......................................................................................16 5.1.6 Sportliche Aktivität........................................................................................19 5.2 Ergebnisse zu Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems...............................20 5.2.1 Beschwerden der Wirbelsäule........................................................................22 5.2.2 Beschwerden der Gelenke..............................................................................27 5.3 Begleiterkrankungen................................................................................................31 5.4 Ausgewählte Komorbiditätsdaten bei Beschwerden des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes..........................................................................33 5.5 Beschwerden des Kniegelenkes...............................................................................36 5.5.1 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Lokalisation, Alter und Geschlecht...............................................................36 5.5.2 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von anthropometrischen Befunden.......................................................................39 5.5.3 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Familienstand........................................................................................40 5.5.4 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Bildung und Beruf.........................................................................................41 5.5.5 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Lebensgewohnheiten.....................................................................................42 5.5.6 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von sportlicher Aktivität......................................................................................43 5.5.7 Kniebeschwerden und muskulo-skelettale Begleiterkrankungen......................................................................................44 5.5.8 Kniebeschwerden und nicht muskulo-skelettale Begleiterkrankungen......................................................................................48 6 Diskussion............................................................................................................................50 6.1 Diskussion der Ergebnisse zu Beschwerden der Wirbelsäule..................................51 6.2 Diskussion der Ergebnissen zu Beschwerden der Gelenke......................................53 6.3 Diskussion der Ergebnissen zu Beschwerden des Kniegelenkes.............................56 7 Schlussfolgerungen.............................................................................................................60 8 Literaturverzeichnis...........................................................................................................61 9 Anhang.................................................................................................................................71 1 Zusammenfassung Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems zählen zu den häufigsten Gesundheitsstö-rungen in den entwickelten Industrieländern. Während bei den Erkrankungen der Wirbelsäule die Datenlage relativ gut dokumentiert ist, fehlen für die degenerativen Gelenkerkrankungen, speziell für die Osteoarthrosen, in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend allgemein verlässliche epidemiologische Prävalenzdaten. Anliegen der vorliegenden Untersuchung war es, die Patienten-Kohorte einer allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis hinsichtlich der Prävalenz von Beschwerden der Wirbelsäule und der Gelenke zu untersuchen und gleichzeitig mögliche Faktoren zu ermitteln, die Prädiktoren für das Entstehen von Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems sein könnten. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse sollen präventive Ansätze, welche in den allgemeinmedizinischen Praxisalltag integriert werden können, aufgezeigt werden. Vorbereitete Fragebögen wurden im Rahmen der hausärztlichen Sprechstunde bzw. der Hausbesuche ausgegeben. Die Teilnahme an der Studie war für die Patienten freiwillig. Zur Auswertung lagen die Fragebögen von 951 Patienten vor. Es wurden neben Angaben zu Alter und Geschlecht, anthropometrischen Daten, Daten zu Lebensumständen und -ge-wohnheiten auch Erkenntnisse über Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates gewonnen. Nach Rücklauf der Bögen wurden den Patienten anhand der Patientenkartei relevante Begleiterkrankungen zugeordnet. Die weitere Auswertung der Daten erfolgte in anonymisierter Form. Die Daten der manuell erstellten Fragebögen wurden zunächst in eine Excel-Datenbank übertragen und anschließend mittels eines Statistikprogramms ausgewertet. Die Prävalenzdaten von Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden wurden in der vorliegen-den Arbeit sowohl in Bezug auf die Gesamtzahl als auch in Abhängigkeit von verschiede-nen Faktoren (Alter, Geschlecht, anthropometrische Daten, Lebensumstände, Lebens-gewohnheiten, Angabe von Schmerzen) dargestellt. Die Prävalenz von Wirbelsäulen-beschwerden betrug 56 %, die der Gelenkbeschwerden 50,1 %. Frauen leiden häufiger an Beschwerden des Bewegungsapparates als Männer. Zunehmender Body-Mass-Index konnte als ein signifikanter Risikoindikator für die Entstehung von LWS-Beschwerden und Beschwerden des Schulter-, Knie- und Sprunggelenkes identifiziert werden. Ein weiterer Risikofaktor für die Entstehung von Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems war zunehmendes Alter. Die Lendenwirbelsäule war im Bereich des Achsskeletts die am häu-figsten von Schmerzen betroffene Region. Bei den Gelenken wies das Kniegelenk die höchste Prävalenz hinsichtlich der Angabe von Beschwerden auf. Patienten mit Gelenk-beschwerden unterschiedlicher Lokalisation unterscheiden sich nicht im Hinblick auf ihre Begleiterkrankungen, wobei Kniepatienten tendenziell häufiger an Erkrankungen leiden, welche mit Adipositas assoziiert sind. Raucher hatten tendenziell häufiger Kniegelenks-beschwerden als Nichtraucher. Andere Lebensgewohnheiten zeigten keine Assoziation mit dem Auftreten von Schmerzen des Kniegelenkes. Aufgrund ihrer hohen Prävalenz verursachen Beschwerden des Bewegungsapparates erhebliche Kosten. Weibliches Geschlecht, zunehmendes Alter, Übergewicht und Rauchen sind Risikoindikatoren für das Auftreten von Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden. Gewichtsreduktion und Rauchverzicht als beeinflussbare Faktoren könnten die Prävalenz derartiger Beschwerden senken. 2 Einleitung 2.1 Prävalenz von Beschwerden des Bewegungsapparates Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems zählen zu den häufigsten Gesundheitsstö-rungen in den entwickelten Industrieländern. Es existieren zahlreiche epidemiologische Studien, bei denen in Abhängigkeit von der Genauigkeit der Erhebung Prävalenzraten zwi-schen 10 und 50 % angegeben werden. Man kann davon ausgehen, dass ca. 70 bis 80 % aller Menschen irgendwann im Leben unter Beschwerden der Wirbelsäule oder der Gelenke leiden (CUNINGHAM and KELSEY, 1984; BADLEY and TENNANT, 1992; ANDERSSON et al., 1993; MILES et al., 1993; BUCKWALTER and MARTIN, 1995; BRAGE and BJERKEDAL, 1996; HAGEN et al., 1997; LINTON et al., 1998; URWIN et al., 1998; BASSOLS et al., 1999; ELLIOTT et al., 1999; BERGMANN et al., 2001). In der Literatur werden unterschiedliche Angaben zur Prävalenz von Rücken- und Gelenk-schmerzen gemacht. Diese differierenden Angaben resultieren aus alters-, geschlechts- und demografischen Unterschieden der untersuchten Patientenkollektive. Während im Kindesalter die Beschwerden – abgesehen von Verletzungsfolgen und Miss-bildungen – relativ selten sind, steigt die Prävalenz bereits im Jugendalter auf Werte an, die bis ins hohe Lebensalter hinein relativ konstant bleiben (SPAHN et al., 2004). Abgesehen vom individuellen Leidensdruck und der eingeschränkten Lebensqualität füh-ren die Schmerzen des Bewegungsapparates auch zu erheblichen Behinderungen, die sich in vielen Lebensbereichen auswirken. Bei allen Industriestaaten stehen Schmerzen an erster Stelle in der Statistik der Fehlzeiten, Krankschreibungen und Frühberentungen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes standen in der Bundesrepublik im Jahr 2002 die Gesundheitsausgaben für Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems mit 25,2 Milliarden Euro an dritter Stelle nach den Ausgaben für Krankheiten des Kreislauf- und des Verdauungssystems. Es entstanden Kosten von 310 Euro pro Einwohner und Jahr. In den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen Deutschlands waren im Jahr 2003 die drei am häufigsten genannten Hauptdiagnosen Arth-rose des Hüftgelenkes (7 %), Rückenschmerzen (6,9 %) und die Arthrose des Kniegelen-kes (6,0 %); (Angaben lt. Statistischem Bundesamt 2004). Unabhängig vom kausalgenetischen Zusammenhang führt das Symptom „Schmerz“ den Patienten mit Erkrankungen des Bewegungsapparates zum Arzt, meist Hausarzt, wobei derartige Beschwerden zu einem Teil durch organische Veränderungen im Bereich der Knochen, der Bänder und des Knorpels sowie der Muskulatur (so genannte „organisch bedingte Beschwerden“) hervorgerufen werden. Zu einem großen Teil sind diese Beschwerden jedoch auch durch außerhalb des muskulo-skelettalen Systems bedingte Stö-rungen verursacht bzw. werden durch diese Störungen verstärkt (so genannte „funktionelle Beschwerden“). Entsprechende differenzialdiagnostische Überlegungen müssen den therapeutischen Ansatz bestimmen, wobei die adäquate Schmerzbeeinflussung oberste Priorität haben muss, um die Lebensqualität des Patienten mit Schmerzen im Bewegungsapparat zu verbessern, funktionelle Einbußen auszugleichen und einer Chronifizierung vorzubeugen. Etwa 80 % aller Rückenschmerzpatienten sind nach zwei Monaten wieder beschwerdefrei, d. h. Rückenschmerzen haben meist eine sehr gute spontane Rückbildungstendenz. Allerdings kommt es bei einem Teil der Patienten zu einem episodischen Wiederauftreten und bei einem kleineren Teil zu einer Chronifizierung. Die neuropathologischen Mechanismen der Chronifizierung können nicht allein dadurch erklärt werden, dass chronische Schmerzen auf chronischen Krankheiten beruhen, sondern man weiß, dass zwischen der Pathologie einer Krankheit und dem Schmerz keine eindeu-tige und verlässliche Beziehung besteht: Der diagnostizierte Bandscheibenvorfall, die Arthrose können schmerzfrei bis extrem schmerzhaft sein; andererseits fehlt bei Patienten mit schweren Rückenschmerzen nicht selten eine greifbare Pathologie (ZIMMERMANN, 2004). Ursache für die Chronifizierung sind im peripheren Nervensystem Veränderungen an den Nozizeptoren, wie Sensibilisierung durch Entzündungsmediatoren oder Vermehrung der Anzahl der Nozizeptoren, bzw. zentrale Mechanismen, wie Sensibilisierung der Schmerz übertragenden Neurone und Abschwächung der hemmenden Neurone, welche die zentrale Weiterleitung der Schmerzinformation kontrollieren (SCHMIDT et al., 1994; BORSOOK, 1997; HANDWERKER, 1999; STANTON-HICKS, 2000; ZIMMERMANN and HERDEGEN, 1996; FLOR, 1991, MENSE, 1993). Die Beurteilung der individuellen Schmerzsituation beim Patienten, d. h. die differenzial-diagnostische Einordnung der Schmerzgenese und die retrospektive und prognostische Einschätzung des Schmerzverlaufes, ist eine der schwierigsten Aufgaben bei der Betreu-ung eines Schmerzpatienten. 2.2 Rückenschmerzen Schon die Definition von Rückenschmerzen bereitet im deutschen Sprach- und Schrift-gebrauch Schwierigkeiten, da der Begriff „Rückenschmerzen“ häufig als Synonym für Kreuzschmerzen, manchmal aber auch als Sammelbegriff für Kreuzschmerzen (low back pain), Nackenschmerzen oder Schmerzen im Brustwirbelsäulenbereich verwendet wird. Zur Unterscheidung hinsichtlich ihrer Genese hat sich die Trennung zwischen spezifischen und nichtspezifischen Rückenschmerzen bewährt. Im Gegensatz zu nicht spezifischen Rückenschmerzen haben spezifische Rückenschmerzen ein eindeutig diagnostizierbares pathologisches Korrelat, z. B. den Bandscheibenvorfall, insbesondere mit begleitender Nervenwurzelirritation (Pseudoradikulitis) mit oder ohne Spinalkanalstenosierungen, Ver-letzungsfolgen nach Wirbelfrakturen oder persistierende Instabilität, Tumoren oder Infek-tionen (Spondylodiscitis). Bei ca. 85 % der Patienten liegt dagegen ein unspezifischer Rückenschmerz vor, bei dem auch mit aufwendigen diagnostischen Mitteln kein objekti-vierbarer medizinischer Befund zugeordnet werden kann (RASPE, 2001). Für den Rückenschmerz werden in internationalen Erhebungen Prävalenzzahlen zwischen 10 und 45 % angegeben (CUNINGHAM and KELSEY, 1984; BADLEY and TENNANT, 1992; ANDERSSON et al., 1993; MILES et al., 1993; BRAGE and BJERKEDAL, 1996; HAGEN et al., 1997; LINTON et al., 1998; URWIN et al., 1998; BASSOLS et al., 1999; ELLIOTT et al., 1999; BERGMANN et al., 2001; CIMMINO et al., 2001). Die genauesten Angaben zu schmerzepidemiologischen Daten für den bundesdeutschen Raum liefert zurzeit das bevölkerungsrepräsentative Bundes-Gesundheitssurvey aus dem Jahr 1998. Diese Daten belegen eine charakteristische Alters- und Geschlechtsabhängigkeit der Prävalenz von Rückenschmerzen. Während die 12-Monats-Prävalenz bereits im jungen Erwachsenenalter hoch ist und in den oberen Altersgruppen nur noch geringfügig zunimmt, ist für die 7-Tages-Prävalenz ein deutlicher Anstieg bis zum 6. Lebensjahrzehnt zu verzeichnen. Frauen sind in allen Altersgruppen häufiger als Männer betroffen (BELLACH et al., 2000). Eine Erklärung für die bestehenden Alters- und Geschlechter-effekte steht derzeit noch aus. Wahrscheinlich sind diese Unterschiede durch ein komple-xes Zusammenspiel von biologischen, physischen und sozialen Faktoren bedingt (LERESCHE, 1999). 2.3 Osteoarthrose Die primären Arthrosen gehören zu den am weitesten verbreiteten Gelenkerkrankungen. Sie sind durch Knorpeldegeneration und sekundäre Reaktionen von Synovia, Kapselband-apparat und subchondralem Knochen gekennzeichnet. Vor allem bei älteren Individuen treten häufig intermittierende entzündliche Episoden auf (BRANDT et al., 1986). Wenn auch zwischenzeitlich einzelne pathogenetische Schritte der Arthrose geklärt werden konnten, so ist diese Definition noch heute gültig. Die primäre Arthrose mit letztlich ungeklärter Genese wird von sekundären Arthrosefor-men unterschieden, bei denen die auslösenden Faktoren bekannt sind. Darüber hinaus kön-nen unterschiedliche Stadien der Arthrose differenziert werden, wie die klinisch stumme, die aktivierte (entzündete) und die klinisch manifeste, dekompensierte Arthrose mit Dauer-schmerz. Bislang gab es in der Bundesrepublik Deutschland keine repräsentativen Prävalenzdaten zur Osteoarthrose (SENN et al., 1998; STATISTISCHES BUNDESAMT, 1998; GÜNTHER et al., 1999). Zur Schätzung der Arthroseprävalenz musste auf Daten aus den Niederlanden zurückgegriffen werden. Aktuelle Prävalenzdaten für die Bundesrepublik publizierten erstmals SCHNEIDER et al. im Jahr 2005, nachdem die Daten des Bundes-Gesundheitssurveys ausgewertet worden waren. Demnach wurde eine Gesamtprävalenz der Arthrose an mindestens einem Gelenk von 27,7 % der über 18-jährigen Erwachsenen ermittelt. Während bei den unter 30-Jährigen nur jeder Zwanzigste an mindestens einem Gelenk eine Arthrose aufweist, trifft dies bei den über 60-Jährigen für jeden zweiten zu. Weitere Daten wird die im Frühjahr 2005 gestartete Herner Arthrosestudie (HER-AS) liefern, bei der 8.000 Einwohner der Stadt Herne, die älter als 40 Jahre sind, hinsichtlich ihrer Gelenkbeschwerden befragt und ggf. untersucht werden. 2.4 Risikofaktoren und Korrelate von Erkrankungen des Bewegungsapparates Ein epidemiologisches Screening nach Risikofaktoren und Korrelaten der Erkrankungen des Bewegungsapparates erscheint sinnvoll, da aufgrund der multifaktoriellen Genese hiermit der Verlauf der Erkrankung durch entsprechende Präventivmaßnahmen unter Umständen in Zukunft steuerbar wird. Zunehmendes Alter und weibliches Geschlecht sind nicht beeinflussbare Faktoren, welche besonders die Entstehung der Osteoarthrose begünstigen. Im Hinblick auf andere, lebensstilbezogene Faktoren wie Rauchen, Übergewicht, physi-sche Belastung bei Beruf und Sport, Vorhandensein von Diabetes mellitus oder Arterio-sklerose wurden zahlreiche epidemiologische Studien durchgeführt, insbesondere im Zusammenhang mit degenerativen Wirbelsäulenbeschwerden, welche jedoch keine ein-heitlichen oder sogar widersprüchliche Ergebnisse erbrachten (BATTIÉ et al.,1991; BÖSTMANN et al.,1993; HAN et al., 1997; HELIOVAARA et al., 1991; JONES et al.,1998; KELSEY et al., 1984; KURUNLAHTI et al., 1999; LUOMA et al., 2000; MANNINEN et al., 1995; MIRANDA et al., 2001; O’NEILL et al.,1999; SEIDLER et al., 2004). Wahrscheinlich spielen für die Höhe des Erkrankungsrisikos bei Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems auch additive oder multiplikative Interaktionsmechanismen eine wesentliche Rolle (SEIDLER, 2004). 3 Ziele der Arbeit Anliegen der vorliegenden Untersuchung war es, eine regional begrenzte Patienten-Kohorte einer allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis hinsichtlich der Prävalenz von Beschwerden der Wirbelsäule und der Gelenke zu untersuchen. Zudem sollen Erkenntnisse über anthropometrische Daten und psychosoziale Begleitfaktoren, über die Lebens-gewohnheiten sowie Begleiterkrankungen der betroffenen Patienten aufgezeigt werden, um mögliche Prädiktoren für das Entstehen von Beschwerden des muskulo-skelettalen Sys-tems zu identifizieren. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sollen ggf. präventive Ansätze, welche im allgemeinmedizinischen Praxisalltag angewandt werden können, aufgezeigt werden. 4 Material und Methode 4.1 Studienpopulation Die Studie erfolgte in einer allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis in einer länd-lichen Region des Freistaates Thüringen. Die Patientenklientel der Praxis rekrutiert sich im Wesentlichen neben dem Praxissitz Wolfsburg-Unkeroda aus zwei weiteren Ortschaften. Die Einwohnerzahl des Einzuggebietes von 33,38 km² beträgt 2.337 Personen (Thüringer Landesamt für Statistik, 2005). Weitere allgemeinmedizinische bzw. fachärztliche Praxen befinden sich nicht im Einzugsgebiet. Das Versorgungsspektrum der Praxis deckt die all-gemeinmedizinische Grundversorgung ab. Im Zeitraum vom 08.11.2004 bis zum 28.02.2005 wurden alle Patienten, welche das 18. Lebensjahr erreicht hatten und die Praxis kontaktierten, nach vorheriger Zustimmung zur Teilnahme an der Studie erfasst. Es wurden sowohl Patienten rekrutiert, welche die Praxis selbst aufsuchten, als auch Patienten, bei denen ein Hausbesuch absolviert wurde. Patienten, die aufgrund der Anamnese nicht in der Lage gewesen wären, den Fragebogen sinngemäß zu erfassen, wurden nicht angesprochen (z. B. Patienten mit Demenzerkran-kung, Debilität oder anderen psychopathologischen Krankheitsbildern, welche die Kogni-tion wesentlich beeinflussen). 4.2 Fragebogen Zur Durchführung der Untersuchung wurde ein Fragebogen mit 24 Fragen erstellt. Die geschätzte Bearbeitungsdauer betrug acht Minuten. In diesen Gesamtfragebogen wurde der Fragerström-Test zur Einschätzung des Schweregrades der Nikotinabhängigkeit bei Rau-chern (FAGERSTRÖM et al., 1996) integriert (Anlage im Anhang). Außerdem wurden anthropometrische Daten, Angaben zu Person, Familienstand, Bil-dungsniveau, beruflicher Tätigkeit, Charakterisierung der Tätigkeit hinsichtlich der Art der körperlichen Belastung, sportlicher Betätigung sowie Aussagen über den zeitlich bezoge-nen Alkoholkonsum und die Ernährungsgewohnheiten erhoben. 4.3 Zeitlicher Ablauf und Durchführung der Studie Zur Überprüfung der Verständlichkeit des Fragebogens wurde der eigentlichen Studien-phase eine Pilotphase vorgeschaltet. Die Auswahl der Probanden erfolgte ebenso wie in der Hauptstudie. 20 zufällig ausgewählte Patienten wurden gebeten, den Fragebogen aus-zufüllen. Durch die folgende Auswertung wurde deutlich, welche Fragen missverständlich formuliert waren oder Probleme bei der Auswertung bereiteten. Diese Fragen wurden dann in modifizierter Form in den endgültigen Fragebogen übernommen. Dieser endgültige Fragebogen wurde nach einer kurzen Erläuterung seines Zwecks und der Versicherung der Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht im Hinblick auf personenbezo-gene Daten während der Sprechstunde dem Patienten ausgehändigt. Patienten, welche in zumutbarer Gehdistanz zur Praxis wohnten, bzw. Patienten, welche in absehbarem Zeit-raum wiederbestellt waren, wurde der Fragebogen in einem verschließbaren, an die Praxis adressierten Umschlag mitgegeben. Patienten aus Nachbarorten erhielten den Fragebogen in einem frankierten Rückkuvert. An alle Patienten, denen ein Fragebogen ausgehändigt wurde, erging die Aufforderung, den Bogen innerhalb einer Woche zur Praxis zurück-zubefördern. Die Fragebögen wurden entsprechend der Patientenkartei nummeriert, um eine spätere Zuordnung zu gewährleisten. Die Ausgabe und Rückgabe bzw. postalische Rücksendung der Fragebögen wurde mithilfe der Vergabe von unterschiedlichen Desktop-Objekten im Praxis-EDV-Programm kontrol-liert. So konnten Patienten, welche die Praxis aufsuchten und den Fragebogen noch nicht zurückgegeben hatten, identifiziert werden und entsprechend an die Rückgabe erinnert werden. Schriftliche bzw. telefonische Mahnungen wurden nicht vorgenommen. Von den 1.012 ausgegebenen Fragebögen konnte ein Rücklauf von 951 Bögen (94 %) erreicht werden. Fehlende Angaben wurden, wenn möglich, gemeinsam mit dem Patienten ergänzt. Sechs Patienten verweigerten die Annahme der Fragebögen. 4.4 Anamnesedaten Anschließend wurden anhand der Patientenkartei relevante Begleiterkrankungen erfasst. Im Einzelnen wurden folgende Krankheitsgruppen differenziert: - Herz-Kreislauf-Erkrankungen - Diabetes mellitus - Fettstoffwechselerkrankungen - Gicht/Hyperurikämie - Magen-Darm-Erkrankungen - Endokrinologische Erkrankungen - Hauterkrankungen - Psychische Erkrankungen - Rheumatoidarthritis - Osteoporose - Krebserkrankungen 4.5 Fremdbefunde Lag ein kürzlich erhobener Facharztbefund vor (orthopädisch, chirurgisch oder radiolo-gisch), wurden die entsprechenden Diagnosen erfasst. Befunde, welche länger als ein Jahr zurücklagen, wurden nicht berücksichtigt. 4.6 Statistische Methoden Die manuell erstellten Fragebögen wurden nach Abschluss der Untersuchung zunächst in eine Excel-Datenbank übertragen. Anschließend erfolgte die statistische Auswertung mit-tels des Statistikprogramms SPSS (Version 11 01 S.). Durchschnittswerte wurden mit ± Standardabweichung angegeben. Die statistische Analyse erfolgte nach Prüfung auf Normalverteilung mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test durch Vergleich der Varianzen 2 (ANOVA). Zum Vergleich prozentualer Häufigkeiten wurde der χ -Test verwandt. Für alle statistischen Tests wurde das Signifikanzniveau auf p < 0,05 festgelegt. 5 Ergebnisse 5.1 Beschreibung der untersuchten Population 5.1.1 Geschlechts- und Altersverteilung Insgesamt wurden die Daten von 951 Patienten ausgewertet. Dabei handelte es sich um 468 Männer (49,2 %) und 483 Frauen (50,8 %). Das mittlere Alter aller Patienten betrug 53,83 ± 16,7 Jahre bei einem Minimum von 18 Jahren und einem Maximum von 92 Jahren. In der Gesamtpopulation ergab sich ein signifikanter Unterschied (p = 0,002) hinsichtlich des Alters zwischen Männern (52,1 ± 17,0 Jahre) und Frauen (55,5 ± 16,4 Jahre). 5.1.2 Anthropometrische Befunde Die durchschnittliche Größe der Patienten betrug 169,7 ± 9,2 cm bei einem Minimum von 147 cm und Maximum von 197 cm. Das Durchschnittsgewicht betrug 78,24 ± 14,1 kg bei einem Minimum von 43 kg und Maximum von 134 kg. Ausgehend von Größe und Gewicht ergab sich ein durchschnittlicher Body-Mass-Index von 26,81 ± 4,2 kg/m² bei einem Minimum von 15 kg/m² und einem Maximum von 43 kg/m². Unter- und normgewichtige Personen fanden wir in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen mit einer Prävalenz von 72,2 % (n = 65). Prä-Adipöse mit einem Body-Mass-Index von 25 bis 29,9 kg/m² waren in der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen am häufigsten vertreten (56,3 %; n = 116). Patienten mit Adipositas Grad I (Body-Mass-Index von 30 bis 34,9 kg/m²) hatten mit 26,8 % (n = 40) in der Altersgruppe 70- bis 79-Jährige die höchste Prävalenz. Patienten mit Adipositas Grad II (Body-Mass-Index von 35 bis 39,9 kg/m²) verteilten sich relativ gleichmäßig auf alle Altersgruppen mit einem Prävalenzgipfel bei den 60- bis 69-Jährigen und 7,8 % (n = 16) dieser Altersgruppe. Acht Patienten wiesen einen Body-Mass-Index über 40 kg/m² auf. Sie verteilten sich in die Altersgruppen 50- bis 59-Jährige, 60- bis 69-Jährige und 70- bis 79-Jährige (Abbildung 5.1). Abb. 5.1: Body-Mass-Index in Abhängigkeit von den Altersgruppen Fast drei Viertel der Männer sind prä-adipös bzw. adipös. Die höchste Prävalenz mit 49,4 % (n = 231) sind bei den Prä-Adipösen mit einem Body-Mass-Index von 25 bis 29,9 kg/m² zu beobachten. Das sind signifikant (p = 0,02) mehr als in den übrigen Gewichtsgruppen. Bei den Frauen sind ein Drittel (32,3 %; n = 285) mit einem Body-Mass-Index bis 24,9 kg/m² norm- bzw. untergewichtig. Die Gewichtsverteilung ähnelt ansonsten der Männergruppe, wobei in den höheren Gewichtsklassen (Adipositas Grad I, II und III) prozentual mehr Frauen vertreten sind als Männer. Die meisten Frauen (40,6 %; n = 196) sind, wie die Männer, prä-adipös (Abbil-dung 5.2). Abb. 5.2: Body-Mass-Index in Beziehung zum Geschlecht 5.1.3 Familienstand Von den Patienten gaben 158 (16,6 %) an, ledig zu sein, 658 (69,2 %) waren verheiratet, 94 (9,9 %) verwitwet und 41 (4,3 %) geschieden. 5.1.4 Beruf und Bildung Bildungsniveau Auf die Frage nach dem höchsten erreichten Bildungsgrad gaben 141 Patienten (14,8 %) den Abschluss der 10. Klasse an, 21 Patienten (2,2 %) hatten bis zum Zeitpunkt der Unter-suchung Hochschulreife erreicht, 561 Patienten (59 %) eine abgeschlossene Lehre, 131 Patienten (13,8 %) Fachschulabschluss und 59 Patienten (6,2 %) Hochschulabschluss. 38 Patienten (4,0 %) machten dazu keine Angaben (Abbildung 5.3). Abb. 5.3: Höchster erreichter Bildungsgrad Beruflicher Status Unter den Patienten waren 473 (50 %) Arbeiter/Angestellte, 33 (3 %) Selbstständige, 68 (7 %) Arbeitslose und 377 (40 %) Rentner (Abbildung 5.4). Abb. 5.4: Beruflicher Status Physische Belastung im Beruf Befragt nach der körperlichen Belastung im Beruf bzw. früheren Beruf gaben 223 (23 %) der Patienten an, vorwiegend sitzend tätig zu sein, 651 (69 %) Patienten beschrieben wech-selnde körperliche Belastung, 77 (8 %) Patienten machten keine Angaben. 184 (19,3 %) der Probanden fahren beruflich Pkw, Lkw oder landwirtschaftliche Geräte. 5.1.5 Lebensgewohnheiten Nikotinkonsum Unter den Befragten fanden sich 789 (83 %) Nichtraucher, eingeschlossen 145 ehemalige Raucher. Von den 162 (17 %) Rauchern gaben zwölf Patienten an, ausschließlich Zigarre bzw. Pfeife zu rauchen. Innerhalb der Rauchergruppe fanden sich signifikant (p < 0,05) mehr Männer (67 %; n = 109) als Frauen (33 %; n = 53). Abbildung 5.5 zeigt die Prävalenz der Raucher der eigenen Untersuchungsgruppe im Ver-gleich zur gesamten Bundesrepublik (Lampert, 2004). Abb. 5.5: Vergleich der Raucherprävalenz der eigenen Patienten im Vergleich zur gesamten Bundesrepublik Die Auswertung des Fagerström-Tests zur Einschätzung des Grades der Nikotinabhängig-keit ergab eine starke bis sehr starke Abhängigkeit bei 18 Rauchern (11,1 %). Etwas mehr als die Hälfte der Raucher kann als sehr gering bzw. nicht nikotinabhängig eingeschätzt werden (65,8 %; n = 92). 23,5 % (n = 38) der Raucher sind geringgradig und 8,6 % (n = 14) mittelgradig abhängig (Abbildung 5.6). Abb. 5.6: Grad der Abhängigkeit bei Rauchern nach Fagerström-Test Alkoholkonsum Der Alkoholkonsum wurde anhand der Trinkfrequenz eingeschätzt. So gaben 165 (17,4 %) Patienten an, niemals Alkohol zu trinken. 786 (82,6 %) Patienten trinken Alkohol. Davon nach eigenen Angaben 647 (70,9 %) Patienten gelegentlich (Wochenende, besondere Anlässe), 76 (8 %) mehrmals wöchentlich und 36 Patienten (3,8 %) täglich (Abbildung 5.7). Abb. 5.7: Alkoholkonsum Betrachtet man den angegebenen Alkoholverbrauch in Abhängigkeit vom erreichten Bil-dungsstand, so zeigt sich, dass in der Gruppe, welche täglichen Alkoholkonsum angab, Patienten mit Hochschulabschluss prozentual am häufigsten vertreten waren (8,5 %; n = 5; p = 0,005). Patienten, welche einen Abschluss der 10. Klasse als bisher höchsten erreichten Bildungsgrad angaben, trinken eigenen Angaben zufolge in 26,2 % (n = 37) der Fälle nie Alkohol. Nur gelegentlichen Alkoholkonsum geben am häufigsten Patienten mit Abitur als höchsten erreichten Bildungsgrad an (90,5 %; n = 19). 38 Patienten (4 %) machten keine Angaben (Abbildung 5.8). Abb. 5.8: Alkoholkonsum in Abhängigkeit vom Bildungsniveau Ernährungsgewohnheiten Befragt nach ihrem Ernährungsverhalten gaben 861 (90,5 %) der Patienten an, täglich Obst und/oder Gemüse zu essen. Insgesamt 743 (78,1 %) Patienten trinken täglich Kaffee. 5.1.6. Sportliche Aktivität Von den befragten Patienten gaben 447 (47 %) an, regelmäßig Sport zu treiben, drei Pati-enten machten dazu keine Angaben. Männer (47,2 %; n = 221) und Frauen (46,8 %; n = 226) treiben gleichermaßen häufig Sport. Von den Sport treibenden Patienten tun dies nach eigenen Angaben 319 (71,4 %) regelmä-ßig, 117 (26,2 %) gelegentlich, 11 Patienten machten dazu keine Angaben. In einer Sportgruppe engagieren sich 112 (25, %) der aktiven Patienten, die übrigen treiben allein Sport oder machten keine Angaben. Die Prävalenz von Sporttreibenden ist in der jüngsten Altersgruppe (18- bis 29-Jährige) mit 71,1 % (n = 64) am höchsten und sinkt mit zunehmendem Alter. Eine Ausnahme bilden die Patienten der Altergruppe der über 80-Jährigen, in der mehr Patienten (30,6 %; n = 11) Sport treiben als bei den 70- bis 79-Jährigen (Abbildung 5.9). Abb. 5.9: Prävalenz von Sporttreibenden in Abhängigkeit vom Alter 5.2 Ergebnisse zu Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems Auf die Frage „Hatten Sie in den letzten drei Monaten Schmerzen im Bereich der Wirbel-säule oder der Gelenke?“ antworteten 730 (76,8 %) der Patienten mit „ja“. Die höchste Prävalenz mit 93 % (n = 80) wiesen die 70- bis 79-jährigen Frauen auf, gefolgt von der Gruppe der 50- bis 59-jährigen Frauen mit 90,2 % (n = 92). Bis auf die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen wiesen die Frauen regelmäßig eine höhere Prävalenz an Beschwerden auf (p < 0,05). Bei den 30- bis 39-jährigen Männern klagten 75,9 % (n = 41) über Beschwerden der Wir-belsäule oder der Gelenke in den letzten drei Monaten. In der gleichen Altersgruppe gaben 67,3 % (n = 35) Frauen muskulo-skelettale Beschwerden an (Abbildung 5.10). Abb. 5.10: Alters- und geschlechtsabhängige Prävalenz von Schmerzen des muskuloskelettalen Systems in den letzten drei Monaten Die Gesamtprävalenz von Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems beträgt bei Frauen 83,2 % (n = 402), bei Männern 70,1 % (n = 328); sie ist bei Frauen signifikant höher (p < 0,05). Vergleicht man die einzelnen Körperregionen, so geben Frauen im Bereich der Wirbel-säule, Kniegelenke und Hüftgelenke signifikant häufiger Schmerzen an als Männer. Bei der Angabe von Beschwerden in den Schultergelenken, Ellenbogen, Handgelenken, Sprunggelenken und Füßen war der Geschlechtsunterschied nicht signifikant (Tabelle 5.1). Tab. 5.1: Prävalenz der Beschwerden in den einzelnen Körperregionen in Abhängigkeit vom Geschlecht Männer Wirbelsäule einschl. ISG % 56,0 Frauen Gesamt 69,6 62,9 p < 0,05 Schultergelenk n 262 336 598 % 16,2 19,5 17,9 0,113 Ellenbogen n % 8,1 76 94 7,7 170 7,9 0,443 Handgelenk Hüftgelenk n % 6,6 38 n % 8,8 n 31 37 8,9 75 7,8 43 13,0 0,117 74 10,9 0,022 41 63 104 Gesamt Kniegelenk Männer % 26,1 Frauen 34,0 30,1 122 Sprunggelenk n % 5,1 24 Fuß n % 2,4 Gesamt n 11 % 70,1 p 164 5,4 0,005 286 5,3 26 2,5 0,488 50 2,4 12 83,2 0,531 12 76,8 < 0,05 n 328 402 730 5.2.1 Beschwerden der Wirbelsäule Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden In der Untersuchungsgruppe gaben 533 (56 %) Patienten an, in den letzten drei Monaten Wirbelsäulenbeschwerden gehabt zu haben. Nur 418 (44 %) Patienten hatten keine Beschwerden (Abbildung 5.11). Abb. 5.11: Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden innerhalb der letzten drei Monate Lokalisation und Anzahl der betroffenen Regionen 428 (45 %) Patienten hatten in einer definierten Region (Halswirbelsäule, Brustwirbel-säule, Lendenwirbelsäule oder in einem bzw. beiden Ileosakralgelenken) Beschwerden. 97 (10,2 %) Patienten hatten Schmerzen in zwei der oben genannten Regionen, 8 (0,8 %) Patienten verspürten in drei Regionen Schmerzen. Männer lokalisieren ihre Schmerzen tendenziell öfter in nur einer Region der Wirbelsäule, während bei Patienten, welche in mehreren Regionen Schmerzen empfinden, die Frauen überwiegen (Abbildung 5.12). Abb. 5.12: Anzahl schmerzhafter Wirbelsäulenregionen, geschlechtsabhängig Von den befragten Patienten klagten 44,9 % (n = 427) über Beschwerden im Lendenwir-belsäulenbereich. In der Häufigkeit folgen Klagen über Schmerzen der Halswirbelsäule (26,6 %; n = 253), wohingegen die Brustwirbelsäule (14,2 %; n = 135) und die Ileosakralgelenke (8,8 %; n = 84) eine geringere Rolle spielen (Abbildung 5.13). Abb. 5.13: Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden nach Lokalisation Im Gesamtkollektiv gaben signifikant mehr Frauen als Männer Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule (p < 0,05), Brustwirbelsäule (p = 0,008) und Lendenwirbelsäule (p = 0,011) an. Bei den Ileosakralgelenken fanden sich keine nennenswerten Unterschiede. Fast die Hälfte der Frauen (48,7 %) hatte in den letzten drei Monaten Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule (Abbildung 5.14). Abb. 5.14: Wirbelsäulenbeschwerden in Abhängigkeit von Region und Geschlecht im Gesamtkollektiv Betrachtet man die Relationen zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die betroffene Wirbelsäulenregion, sieht man, dass Patienten mit Beschwerden im Bereich der Halswir-belsäule in 69,6 % (n = 176) der Fälle weiblich und 30,4 % (n = 77) männlich sind (p < 0,05). Patienten mit Beschwerden der Brustwirbelsäule sind zu 60,7 % (n = 82) weiblich und zu 39,3 % (n = 53) männlich (p = 0,008). Im Lendenwirbelsäulenbereich stellt sich das Verhältnis 55 % (n = 235) weiblich zu 45 % (n = 192) männlich dar (p = 0,011). Nicht signifikant war das Verhältnis bei Beschwerden der Ileosakralfugen mit 54,8 % (n = 46) weiblich und 45,2 % (n = 38) männlich. In absteigender Wirbelsäulenlokalisation gleicht sich also das Verhältnis zwischen Män-nern und Frauen in Bezug auf die Häufigkeit der Angabe von Beschwerden in den einzel-nen Regionen an (Abbildung 5.15). Abb. 5.15: Prozentuales Verhältnis der Geschlechter bei Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden, aufgegliedert nach Regionen Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden in Abhängigkeit vom Body-Mass-Index Mit zunehmendem Body-Mass-Index sinkt die Prävalenz von HWS-Beschwerden. Die Unterund Normgewichtigen mit einem Body-Mass-Index von 18 bis 24,9 kg/m² haben mit einer Prävalenz von 27,4 % (n = 78) am häufigsten HWS-Beschwerden. Im Bereich der LWS verhält sich das Auftreten der Beschwerden entgegengesetzt zu dem der HWS: Die Prävalenz von Schmerzen nimmt mit steigendem Body-Mass-Index zu und ist bei den Patienten mit Adipositas Grad III (Body-Mass-Index über 40 kg/m²) am höchs-ten (Tabelle 5.2). Tab. 5.2: Prävalenz der Wirbelsäulenbeschwerden in Abhängigkeit vom Body-Mass-Index (kg/m²) Gruppen nach Body-Mass-Index 18–24,9 25–29,9 30–34,9 35–39,9 über p 40 0,975 HWS % 27,4 26,9 25,5 23,1 25,0 n 78 115 49 9 2 0,840 BWS % 14,4 13,8 13,5 20,5 12,5 n 41 59 26 8 1 0,214 LWS % 40,4 46,1 45,8 56,4 62,5 ISG n 115 197 88 22 % 8,1 9,1 8,9 12,8 n 23 39 17 5 5 0,773 5.2.2 Beschwerden der Gelenke Prävalenz der Gelenkbeschwerden Von den untersuchten Patienten gab die Hälfte (49,9 %; n = 475) an, in den letzten drei Monaten keine Beschwerden in den Gelenken gehabt zu haben. Die andere Hälfte (51,1 %; n = 476) hatte Beschwerden in einem oder mehreren Gelenken (Hand-, Ellenbogen-, Schulter-, Hüft-, Knie-, Sprung- und/oder Fußgelenke). Wie bei den Wirbelsäulenbeschwerden bestand auch bei den Gelenkbeschwerden ein signi-fikanter Zusammenhang dahingehend, dass Frauen (54,5 %; n = 263) häufiger Schmerzen in den Gelenken verspüren als Männer (45,5 %; n = 213). Lokalisation und Anzahl der betroffenen Regionen In der Gruppe der Patienten mit Gelenkbeschwerden lokalisieren Männer den Schmerz häufiger in nur einer Region, während Frauen öfter als Männer den Schmerz in mehreren Regionen angeben (Abbildung 5.16). Abb. 5.16: Anzahl schmerzhafter Gelenkregionen, geschlechtsabhängig Von den befragten Patienten klagten 30,1 % (n = 286) über Beschwerden in einem oder beiden Kniegelenken. 17,9 % (n = 170) der Patienten gaben Beschwerden der Schultergelenke an. Jeder zehnte Patient hatte in den letzten drei Monaten Schmerzen in den Hüftgelenken (n = 104). Ellenbogen-, Hand-, Sprunggelenke und Füße liegen mit der Prävalenz von Schmerzen unter 8 % (Abbildung 5.17). Abb. 5.17: Prävalenz von Gelenkbeschwerden nach Lokalisation Im Gesamtkollektiv gaben, mit Ausnahme der Beschwerden im Ellenbogen, Frauen häufi-ger Gelenkbeschwerden an als Männer. Dieser Zusammenhang war im Bereich der Hüft-gelenke (p = 0,002) und Kniegelenke (p = 0,008) signifikant (Abbildung 5.18). Abb. 5.18: Gelenkbeschwerden in Abhängigkeit von Region und Geschlecht im Gesamtkollektiv Betrachtet man die Relation zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die betroffene Gelenkregion, so zeigt sich, dass Patienten mit Beschwerden im Hüftgelenk zu 60,6 % (n = 63) weiblich und zu 39,4 % (n = 41) männlich sind (p = 0,034). Ein weiterer signifikanter Geschlechtsunterschied (p = 0,008) ergibt sich nur noch beim Kniegelenk: Über Beschwerden in diesem Gelenk in den letzten drei Monaten klagen 57,3 % (n = 164) weibliche und 42,7 % (n = 122) männliche Patienten. Bei den übrigen aufgeführten Gelenkregionen ergab sich kein signifikanter Unterschied im Hinblick auf die geschlechtsbezogene Häufigkeit (Abbildung 5.19). Abb. 5.19: Prozentuales Verhältnis der Geschlechter bei Patienten mit Gelenkbeschwer-den, aufgegliedert nach Regionen Prävalenz von Gelenkbeschwerden in Abhängigkeit vom Body-Mass-Index Tabelle 5.3 zeigt den Zusammenhang von Beschwerden der einzelnen Gelenkregionen vom Body-Mass-Index (kg/m²). Signifikante Zusammenhänge ergeben sich bei den Schulter-, Knie- und Sprunggelenken: In diesen Regionen steigt die Prävalenz von Beschwerden mit zunehmendem Body-Mass-Index. So haben 87,5 % (n = 7) der Patienten mit einem Body-Mass-Index über 40 kg/m² Beschwerden in einem oder beiden Kniegelenken. Vier Patienten (50 %) mit Adipositas Grad III klagen über Schmerzen der Sprunggelenke. Tab. 5.3: Prävalenz von Gelenkbeschwerden in Abhängigkeit vom Body-Mass-Index ( kg/m²) Gruppen nach Body-Mass-Index 18-24,9 25-29,9 30-34,9 35-39,9 Schultergelenk % 12,6 19,2 20,8 23,1 37,5 0,044 3 Ellenbogen n 36 82 40 9 % 7,4 8,0 8,9 5,1 12,5 1 Hand n 21 34 17 2 % 7,0 8,2 7,8 5,1 25,0 2 Hüftgelenk n 20 35 15 2 % 9,5 10,3 15,1 7,7 12,5 1 Kniegelenk n 27 44 29 3 % 19,3 31,1 37,0 51,3 87,5 7 Sprunggelenk n 55 133 71 20 % 1,8 5,2 7,8 10,3 50,0 4 Fuß n 5 22 15 4 % 2,1 2,3 2,1 5,1 12,5 6 10 4 2 0,910 0,403 0,323 <0,05 <0,05 0,300 1 5.3 Begleiterkrankungen Prävalenz der Begleiterkrankungen Die Tabelle 5.4 zeigt die Prävalenz nicht muskulo-skelettaler Erkrankungen. Mehr als die Hälfte der Patienten (53,1 %; n = 505) leidet an einer arteriellen Hypertonie. 26,4 % (n = 251) weisen eine behandlungsbedürftige Fettstoffwechselstörung auf. Im Gesamtkollektiv findet man 184 (19,3 %) Herzkranke und 175 (18,4 %) Diabetiker. Die Prävalenz an Begleiterkrankungen beträgt 77,4 % (n = 736). Tab. 5.4: Prävalenz von Begleiterkrankungen n Prävalenz [%] Herzerkrankungen 184 19,3 Pulmonale Erkrankungen 93 Hypertonie 505 53,1 Diabetes mellitus 175 18,4 Hyperlipidämie 251 26,4 Hyperurikämie 75 7,9 Osteoporose 46 4,8 Baucherkrankungen 121 12,7 Endokrine Erkrankungen 147 15,5 Hauterkrankungen 81 9,8 8,5 Psychiatrische Erkrankungen 110 11,6 Rheumatoidarthritis 13 1,4 Tumorerkrankungen 18 1,9 Gesamt 736 77,4 Prävalenz der Begleiterkrankungen in Beziehung zu Alter und Geschlecht Die Prävalenz von Begleiterkrankungen steigt signifikant (p < 0,05) mit zunehmendem Alter und ist bei Frauen signifikant (p = 0,001) höher als bei Männern. Dabei zeigen 70- bis 79jährige und über 80-jährige Frauen eine Prävalenz von 100 % im Hinblick auf Begleiterkrankungen (n = 86 bzw. n = 21). Bei den gleichaltrigen Männern sind in jeder Altersgruppe jeweils zwei Patienten (3,2 % bzw. 13,3 %) nicht komorbide (Abbildung 5.20). Abb. 5.20: Prävalenz nicht muskulo-skelettaler Erkrankungen in Beziehung zu Alter und Geschlecht 5.4 Ausgewählte Komorbiditätsdaten bei Beschwerden des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Prävalenz von Monarthralgien des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes In der untersuchten Population war die Prävalenz von Beschwerden der Knie-, Schulter- und Hüftgelenke am höchsten. 56 % (n = 533) der Patienten hatten keine oder nur in anderen als oben aufgeführten Gelenkregionen Beschwerden. Die Kniegelenke waren mit einer Prävalenz von 18,6 % (n = 177) am häufigsten als isoliert betroffenes Gelenk genannt worden. Mit 8,5 % bezeichneten 81 Patienten das Schultergelenk als einzige schmerzhafte Gelenk-region. 5,6 % (n = 56) hatten in Knie- und Schultergelenk Beschwerden. Abbildung 5.21 zeigt die prozentuale Verteilung der Beschwerden der großen Gelenke. Abb. 5.21: Prävalenz von Beschwerden der Schulter-, Hüft- und Kniegelenke Body-Mass-Index bei Monarthralgien des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Betrachtet man die Patienten mit einer Monarthralgie des Schulter-, Hüft- oder Kniegelen-kes in Abhängigkeit vom Body-Mass-Index, so ergibt sich kein signifikanter Unterschied. Der mittlere Body-Mass-Index bei Patienten mit Schulterbeschwerden betrug 26,6 (± 3,9) kg/m², bei Patienten mit Hüftbeschwerden 26,6 (± 3,9) kg/m² und für Kniepatienten 28,1 (± 4,7) kg/m². Bei allen drei Gelenken sind die Patienten mit einem Body-Mass-Index von 25 bis 29,9 kg/m² (Übergewicht) am häufigsten vertreten. Die Patienten mit Adipositas Grad II (BMI 35 bis 39,9 kg/m²) und Adipositas Grad III (BMI über 40 kg/m²) trifft man am häufigsten in der Gruppe mit Beschwerden der Knie-gelenke an (Abbildung 5.22). Abb. 5.22: Prävalenz der Gruppen nach Body-Mass-Index bei Patienten mit einer Monarthralgie des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Altersabhängigkeit bei Monarthralgien des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Das mittlere Alter der Patienten mit Schulterbeschwerden betrug 55 (± 15,2) Jahre, bei Patienten mit Hüftbeschwerden 58,8 (± 13,5) Jahre und bei Patienten mit Kniebeschwer-den 59 (± 17,7) Jahre. Patienten mit lokalisierten Beschwerden im Hüftgelenk findet man mit einer Prävalenz von 29,6 % (n = 24) in der Gruppe der 50- bis 59-jährigen Patienten am häufigsten. Patienten in der 7. Lebensdekade klagen, wenn ihnen nur ein Gelenk Beschwerden berei-tet, signifikant (p = 0,01) am häufigsten über das Hüftgelenk (41,5 %; n = 17). In der Gruppe der 70- bis 79-Jährigen trifft man auf das Kniegelenk als das am häufigsten von einer isolierten Arthralgie betroffene (27,1 %; n = 48). Abbildung 5.23 zeigt die altersabhängigen Prävalenzgipfel bei Monarthralgie des Schul-ter-, Hüft- oder Kniegelenkes. Abb. 5.23: Altersabhängige Prävalenz bei Monarthralgie des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Komorbidität bei Monarthralgien des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Hinsichtlich des Auftretens von relevanten Begleiterkrankungen ergeben sich zwischen der Monarthralgie des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes keine signifikanten Unterschiede. Tendenziell leiden aber Patienten mit einer Gonalgie häufiger an einer arteriellen Hyperto-nie, Hyperlipidämie, an Diabetes mellitus und an Hyperurikämie (Tabelle 5.5). Tab. 5.5: Prävalenz von Begleiterkrankungen bei Patienten mit isolierten Beschwerden des Schulter-, Hüft- oder Kniegelenkes Schulter-gelenk Hüft-gelenk Knie-gelenk Total Hypertonie % 55,6 63,4 45 Hyperlipidämie n % 25,9 n Herzerkrankungen % 18,5 21 15 Diabetes mellitus n % 23,5 19 Hyperurikämie n % 3,7 65,0 26 19,5 36,6 186 30,8 0,072 63 92 26,8 0,081 50 80 23,7 0,948 28,2 15 22,0 24,3 9 43 12,4 0,346 115 35,6 8 7,3 62,2 p 71 9,4 0,074 3 Osteoporose n % 4,9 4 Rheuma n % 3,7 n 3 3 22 7,3 28 5,7 13 2,3 17 2,3 4 5.5 Beschwerden des Kniegelenkes Da das Kniegelenk das mit Abstand am häufigsten von Beschwerden betroffene Gelenk ist, soll im Folgenden auf Zusammenhänge zwischen Beschwerden des Kniegelenkes und beeinflussende Faktoren eingegangen werden. Die Prävalenz von Kniebeschwerden betrug 30,1 % (n = 286). 5.5.1 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Lokalisation, Alter und Geschlecht Ein Fünftel der Frauen (20,9 %; n = 99), das ist signifikant mehr als bei den Männern (p = 0,012), klagte über Schmerzen in beiden Kniegelenken in den letzten drei Monaten. Männer klagen häufiger über Schmerzen im linken (21,4 % vs. 18,4 %), Frauen über Schmerzen im rechten (28,2 % vs. 26,3 %) Kniegelenk (Abbildung 5.24). Abb. 5.24: Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von betroffener Seite und Geschlecht 0,177 0,439 7 Die höchste Prävalenz von Kniebeschwerden hat die Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen mit 49,7 % (n = 74). In dieser Gruppe klagt jeder Zweite über entsprechende Beschwerden. Auf die geringste Rate trifft man bei den 40- bis 49-Jährigen, bei denen nur 16,6 % (n = 28) über Schmerzen geklagt haben. Generell steigt die Prävalenz von Knieschmerzen mit zunehmendem Alter, wobei sich die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen und die Gruppe der über 80-Jährigen entgegen diesem Trend verhält (Abbildung 5.25). Abb. 5.25: Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Alter 57 % (n = 49) der Frauen zwischen 70 und 79 Jahren klagten in den letzten drei Monaten über Schmerzen in einem oder beiden Kniegelenken. Die geringste Prävalenz zeigen die 40- bis 49-jährigen Männer (14,1 %; n = 12). Der Prävalenzanstieg in der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen wird, wie in Abbildung 5.26 ersichtlich, von den Männern verursacht (25,9 %; n = 14). In der Gruppe der 30- bis 39-jährigen Männer, welche über Kniebeschwerden klagte, wie-sen vier Patienten Normgewicht, sechs Patienten Übergewicht und vier Patienten Adiposi-tas Grad I auf. Es fanden sich fünf Raucher und neun Nichtraucher bzw. ehemalige Raucher. Außer vier Patienten gaben alle an, Sport zu treiben, davon acht Patienten regelmäßig und drei in einer Sportgruppe, wobei ein Patient bis vor kurzem aktiv Vereinsfußball spielte. Vier Patienten wurden bereits arthroskopiert, bei zwei Patienten lag ein Z. n. Trauma vor. Fachärztliche Befunde (Unfallchirurgie, Orthopädie) lagen von sieben Patienten vor; hier-bei wurden bei fünf Patienten Meniskuspathologien beschrieben, bei einem Patienten eine Chondropathie und bei einem weiteren ein Bandscheibenvorfall. Eine bildgebende Diagnostik mittels Magnetresonanztomografie wurde bei drei Patienten dieser Gruppe betrieben, wobei sich pathologische Meniskusbefunde erheben ließen. Abb. 5.26: Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht 5.5.2 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von anthropometrischen Befunden Die Körpergröße und das Körpergewicht allein zeigten keine Assoziation mit dem Auftre-ten von Kniebeschwerden. Ein Fünftel (19,3 %; n = 55) der unter- und normgewichtigen Patienten mit einem Body-Mass-Index bis 24,9 kg/m² gab Beschwerden in einem oder beiden Kniegelenken an. Mit zunehmendem Body-Mass-Index steigt die Prävalenz von Knieschmerzen signifikant (p < 0,05) an, sodass sieben von acht Patienten (87,5 %) mit einem Body-Mass-Index von über 40 kg/m² über Kniebeschwerden klagen (Abbildung 5.27). Abb. 5.27: Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Body-MassIndex (kg/m²) 5.5.3 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Familienstand Die Hälfte (51,1 %; n = 48) der verwitweten Patienten klagte über Kniebeschwerden in den letzten drei Monaten. Unter den verheirateten Patienten gaben 31 % (n = 204) Schmerzen in einem oder beiden Kniegelenken an; jeweils 17,1 % der Ledigen (n = 27) und Geschiedenen (n = 7) hatten entsprechende Beschwerden (p < 0,05; Abbildung 5.28). Betrachtet man obigen Zusammenhang detaillierter unter Berücksichtigung der einzelnen Altersgruppen, so findet man nur bei den 18- bis 29-Jährigen (p = 0,038) und 40- bis 49-jährigen Patienten (p = 0,026) eine Abhängigkeit des Auftretens von Kniebeschwerden vom Familienstand, welche das festgelegte Signifikanzniveau von p < 0,05 erreicht. Bei den 40- bis 49-Jährigen geben mit 21,8 % (n = 27) die Verheirateten am häufigsten Knieschmerzen an. Von den verwitweten und geschiedenen Patienten klagte keiner und unter den 24 ledigen Patienten einer über entsprechende Beschwerden. Abb. 5.28: Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Familienstand 5.5.4 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Bildung und Beruf Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Bildungsstand Hinsichtlich der Angabe von Kniebeschwerden, aufgetreten in den letzten drei Monaten, und dem höchsten erreichten Bildungsstand ergab sich kein signifikanter Zusammenhang. Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom beruflichen Status Von den untersuchten Patienten gab die Gruppe der Rentner am häufigsten an, unter Knie-beschwerden zu leiden (44,7 %; n = 163). Bezieht man das Alter in die Betrachtung mit ein, ergibt sich mit p = 0,025 nur bei den 50bis 59-jährigen Patienten ein signifikanter Zusammenhang. Danach haben acht (61,5 %) der 13 Patienten dieser Altersgruppe, welche ihren beruflichen Status als „Rentner“ beschrieben, Kniebeschwerden. 5.5.5 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Lebensgewohnheiten Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Nikotinkonsum Tabelle 5.6 zeigt das Auftreten von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Nikotinkonsum. In der Gruppe der 30- bis 39-jährigen Raucherinnen klagen vier (57,1 %) von sieben Pati-entinnen über Kniegelenksschmerzen (p = 0,006). Bei den gleichaltrigen Nichtraucherin-nen treten bei sechs (13,3 %) von 57 Patientinnen Beschwerden auf. Bei den 40-bis 49-jährigen Männern haben 27,6 % (n = 8) der Raucher Schmerzen gegen-über 7,1 % (n = 4) der Nichtraucher (p = 0,01). Außer in der Gruppe der 40- bis 49-jährigen Frauen und der 60- bis 69-jährigen Männer und Frauen treten Kniebeschwerden bei Rauchern tendenziell bzw. signifikant häufiger auf (Tabelle 5.6). Eine Assoziation zwischen dem Auftreten von Kniebeschwerden und der Dauer des Niko-tinkonsums (Raucherjahre), der Art des Nikotinkonsums (Zigarette/Zigarre/Pfeife) oder dem Grad der Abhängigkeit vom Nikotin (Fagerström-Test) konnte nicht hergestellt wer-den. Tab. 5.6: Prävalenz von Beschwerden im Kniegelenk in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Nikotinkonsum Alters-gruppe [Jahre] 18 - 29 keine KnieKnie-beschwerden beschwerden ♂ NR 23 (85,2 %) 4 (14,8 %) ge-samt p 27 22 (78,6 6 28 0,525 (21,4 %) %) 19 (86,4 %) 3 (13,6 22 NR %) 9 4 (30,8 13 0,221 R (69,2 %) %) 28 (75,7 %) 9 (24,3 %) 37 R ♀ 30 - 39 ♂ NR 12 (70,6 5 17 0,692 (29,4 %) %) 39 (86,7 %) 6 (13,3 45 NR %) 3 4 (57,1 7 R 0,006 (42,9 %) %) 52 (92,9 %) 4 (7,1 %) 56 R ♀ 40 - 49 ♂ NR 21 (72,4 8 29 0,01 (27,6 %) %) 53 (80,3 %) 13 66 NR (19,7 %) 15 3 (16,7 18 0,772 R (83,3 %) %) 59 (77,6 %) 17 (22,4 %) 76 R ♀ 50 - 59 ♂ NR R 12 (70,6 5 (29,4 %) 17 0,537 %) ♀ 68 (70,8 %) NR 28 96 (29,2 %) 2 4 (66,7 6 (33,3 %) %) 30 (33,3 %) 90 R 60 - 69 ♂ NR 60 (66,7 %) 0,055 10 (76,9 3 13 0,459 (23,1 %) %) 58 (60,4 %) 38 96 NR (39,6 %) 5 2 (28,6 7 0,564 R (71,4 %) %) 36 (61,0 %) 23 (39,0 %) 59 R ♀ 70 - 79 ♂ NR 2 4 (50,0 %) 35 (41,7 %) 49 84 NR (58,3 %) 2 2 R (100,0 %) 9 (64,3 %) 5 (35,7 %) 14 R ♀ über 80 ♂ NR 2 (50,0 %) 1 1 (100,0 %) 11 (52,4 %) 10 21 (47,6 %) R ♀ NR R NR - Nichtraucher, R - Raucher Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit vom Alkoholkonsum Es ergibt sich kein Zusammenhang bezüglich des Auftretens von Beschwerden im Bereich der Kniegelenke in Abhängigkeit vom Alkoholkonsum. Auch die angegebene Trinkfrequenz hatte unter Berücksichtigung der einzelnen Alters-gruppen keinen Einfluss auf die oben genannte Fragestellung. 0,663 0,1 0,205 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Ernährungsgewohnheiten Zwischen dem täglichen Verzehr von Obst und/oder Gemüse und dem Auftreten von Kniebeschwerden fanden sich in den einzelnen Altersgruppen keine Assoziationen, ebenso wenig wie beim Kaffeekonsum. 5.5.6 Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von sportlicher Aktivität Die Tatsache, ob die Patienten angaben, Sport zu treiben oder nicht, hatte keinen Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens von Kniebeschwerden (Abbildung 5.29), auch nicht unter Berücksichtigung von Alter und Geschlecht. Abb. 5.29: Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von sportlicher Aktivität 5.5.7 Kniebeschwerden und muskulo-skelettale Begleiterkrankungen Prävalenz von Kniebeschwerden in Abhängigkeit von Wirbelsäulenbeschwerden Patienten aller Altersgruppen, welche in mindestens einer Wirbelsäulenregion (Halswirbel-säule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule oder Ileosakralgelenke) Beschwerden angaben, klagten auch gleichzeitig häufiger über Kniebeschwerden. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht signifikant (Abbildung 5.30). Abb. 5.30: Prävalenz von Kniebeschwerden bei Wirbelsäulen-Gesunden (WSg) und Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden (WS) in Abhängigkeit vom Alter Von den Patienten, welche keine Wirbelsäulenbeschwerden angaben, klagten 107 (25,6 %) über Kniebeschwerden. Innerhalb der Patientengruppe, welche über Beschwerden in einer Wirbelsäulenregion klagte, gaben 138 (32,2 %) gleichzeitige Knieschmerzen an. Bei zwei angegebenen Regionen der Wirbelsäule betrug die Prävalenz von Kniebeschwer-den 38,1 % (n = 37); bei den acht Patienten, welche drei schmerzhafte Wirbelsäulenregio-nen angaben, klagte die Hälfte auch über Kniebeschwerden. Betrachtet man die Anzahl der genannten Wirbelsäulenregionen, welche von den Patienten als schmerzhaft beschrieben wurden, so ergibt sich signifikant (p = 0,024), dass mit zunehmender Anzahl von Regionen die Prävalenz von gleichzeitig bestehenden Knie-beschwerden steigt (Abbildung 5.31). Abb. 5.31: Prävalenz von Kniebeschwerden bei Patienten mit Wirbelsäulenschmerzen in Abhängigkeit von der Anzahl der betroffenen Regionen Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden bei Patienten mit Kniebeschwerden Tabelle 5.7 listet die Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden bei Patienten mit Knie-beschwerden, in Abhängigkeit vom Geschlecht, auf. Bei den Männern mit Kniebeschwerden klagen 27,0 % (n = 33) über bestehende HWS-Schmerzen (p = 0,05), bei den Männern ohne Knieprobleme tun dies nur 12,7 % (n = 44). Ebenfalls signifikant haben Männer mit Kniebeschwerden mehr Probleme im Bereich der Lendenwirbelsäule (53,3 %; n = 65) als Männer ohne Knieschmerzen (36,7 %; n = 127). Bei den Frauen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Auftreten von Wirbel-säulenbeschwerden zwischen Patientinnen mit und ohne Kniebeschwerden. Tab. 5.7: Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden bei Patienten mit und ohne Knie-beschwerden Prävalenz [%] bei Patienten mit Kniebeschwerden HWS ♂ 27,0 ♀ BWS Prävalenz [%] bei Kniegesunden 33 12,7 36,0 ♂ 13,9 ♀ n 59 28 p 44 <0,05 36,7 17 10,4 17,1 n 117 36 16,9 0,879 0,290 54 0,968 LWS ♂ 53,3 65 36,7 ♀ ISG 52,4 127 86 ♂ 9,8 46,7 149 12 7,5 ♀ 9,8 0,001 26 16 9,4 0,233 0,420 30 0,901 Prävalenz von Beschwerden anderer Gelenkregionen bei Patienten mit Kniebeschwerden Patienten mit Kniebeschwerden leiden auch signifikant häufiger an Beschwerden in ande-ren Gelenkregionen. Eine Ausnahme bildet bei Frauen der Bereich der Hand- und Sprunggelenke und bei den Männern der Bereich der Füße. Am auffälligsten ist die Koinzidenz mit Beschwerden der Schultergelenke: Hier leiden 29,5 % (n = 36) der Männer mit Kniebeschwerden auch unter Schulterschmerzen bzw. 26,2 % (n = 43) der Frauen (Tabelle 5.8). Tab. 5.8: Prävalenz von Gelenkbeschwerden bei Patienten mit und ohne Kniebeschwerden Prävalenz [%] n Prävalenz [%]bei bei Patienten mit Kniegesunden Kniebeschwerden Schultergelenk ♂ 29,5 ♀ Ellenbogen Sprunggelenk 19 8,5 14 21,3 35 5,6 13 4 4,9 18 9,1 0,020 29 0,839 23 0,006 8,8 28 <0,05 11 0,001 4,1 2,0 8 0,007 11 <0,05 13 3,2 7,9 51 18 <0,05 18 6,6 ♂ 3,3 ♀ 16,0 20 3,2 ♂ 10,7 ♀ Fuß 11,6 ♂ 14,8 ♀ 43 p 40 <0,05 20 5,2 ♂ 16,4 ♀ Hüftgelenk 26,2 ♂ 16,4 ♀ Hand 36 11,6 n 13 7 1,3 0,076 0,431 4 0,015 5.5.8 Kniebeschwerden und nicht muskulo-skelettale Begleiterkrankungen 69,6 % (n = 199) der Patienten mit Kniebeschwerden leiden unter Bluthochdruck. Somit ist die arterielle Hypertonie die häufigste allgemeinmedizinische Begleiterkrankung bei Knie-kranken. In abnehmender Häufigkeit folgen die Fettstoffwechselstörungen bei 35,7 % (n = 102) der Patienten mit Kniebeschwerden, die Herzerkrankungen mit 29,7 % (n = 85) und Diabetes mellitus mit 24,8 % (n = 71). Abbildung 5.32 zeigt die Prävalenz der allgemeinmedizinischen Begleiterkrankungen bei Patienten mit Knieschmerzen. Abb. 5.32: Prävalenz der Begleiterkrankungen bei Patienten mit Kniebeschwerden Betrachtet man die Prävalenz von Begleiterkrankungen in Abhängigkeit vom Alter der Patienten, ergeben sich die in Tabelle 5.9 gelisteten signifikanten Zusammenhänge. Tab. 5.9: Signifikant höhere Prävalenz von Begleiterkrankungen bei Patienten mit Knie-beschwerden Begleiterkrankung Altersgruppe[Jahre] Prävalenz bei Knie-beschwerden[%] n Herzerkrankung 42,5 31 27,1 53,6 74,1 15 31,2 53,2 40 14,3 4 5,9 16,7 1 9 11,8 2 Hypertonie Diabetes mellitus Hyperurikämie Rheuma 60 - 69 40 - 49 50 - 59 40 - 49 18 - 29 50 - 59 18 - 29 Prävalenz bei Kniegesunden [%] 3,5 5,0 In der Gruppe der Patienten mit Kniebeschwerden ergab sich in Abhängigkeit vom Alter keine höhere Prävalenz bei Lungenerkrankungen, Lipidstoffwechselstörungen, Osteopo-rose, Abdominalerkrankungen, endokrinen Erkrankungen, dermatologischen Erkrankun-gen, psychischen Erkrankungen und Krebserkrankungen. 6 Diskussion Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates nehmen in den entwickelten Industrie-ländern epidemische Ausmaße an. Abgesehen von den erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten (direkte Kosten für medizinische Behandlung, Rehabilitation, Prävention und indi-rekte Kosten durch z. B. Arbeitsausfall, Invalidität) bedeuten die Schmerzen für die Betrof-fenen auch eine Minderung der Lebensqualität. Für die vorliegende Untersuchung wurden alle Patienten, welche die Praxis kontaktierten und älter als 18 Jahre waren, in einem festgelegten Zeitraum zur Teilnahme aufgefordert. Eine Selektierung wurde nur hinsichtlich des intellektuellen Vermögens zum Verständnis des Fragebogens vorgenommen. Wie in jeder Fragebogenuntersuchung lässt sich nicht klären, ob die Responder wahrheitsgemäß antworteten. Diese grundsätzliche Frage nach der Aufrichtigkeit der Antworten stellt sich in jeder Untersuchung mit Selbstbeurteilungs-charakter. Das Geschlechterverhältnis der Patienten war ausgeglichen, die Frauen waren jedoch im Durchschnitt signifikant älter, entsprechend der höheren Lebenserwartung der Frauen gegenüber Männern. Das durchschnittliche Körpergewicht der Bevölkerung steigt bei Männern und Frauen mit zunehmendem Alter an, im hohen Alter ist es dann wieder geringer (FILIPIAK et al., 1993). Entsprechend repräsentativ war auch der altersabhängige Gewichtsverlauf der vorliegen-den Untersuchungsgruppe zum bundesdeutschen Vergleich. Für die Männer der unter-suchten Population ergibt sich hinsichtlich des Body-Mass-Index ein vergleichbarer Wert zur bundesdeutschen Bevölkerung, wonach etwa die Hälfte übergewichtig und 19 % adi-pös sind. Bei den Frauen wird bundesweit ein Drittel als übergewichtig eingestuft – in der untersuchten Kohorte sind es 40,6 %; adipös sind hier 27,1 % bei bundesweit 22 % der Frauen (BERGMAN and MENSINK, 1999). Die weiblichen Probanden weisen also ein höhe-res Gewicht als die bundesdeutsche Vergleichsgruppe auf. Daten zum Rauchverhalten der Bevölkerung wurden 1998 im Bundes-Gesundheitssurvey und 2003 im telefonischen Bundes-Gesundheitssurvey veröffentlicht (JUNGE et al., 1999, LAMPERT et al., 2004). Demnach ist die Raucherprävalenz in der eigenen Untersuchungsgruppe deutlich niedriger als im Bundesvergleich. Ursächlich hierfür könnte ein höherer Altersdurchschnitt der Untersuchungsgruppe im Vergleich zu den Daten der Bundes-Gesundheitssurveys sein, welche den realen Altersgang der Bevölkerung widerspiegeln. Bei beiden Geschlechtern nimmt die Prävalenz des Rauchens mit zunehmendem Alter ab. So rauchen nur noch 12,9 % der über 64-jährigen Männer und 4,9 % der über 64-jährigen Frauen (HELMERT, 1999). Da Menschen, welche eine Arztpraxis aufsuchen, häufiger multimorbide und somit älter sind, erklärt sich die niedrigere Raucherprävalenz in der vorliegenden Kohorte. Die Einschätzung des Alkoholkonsums anhand der Trinkfrequenz, wie in der vorliegenden Untersuchung vorgenommen, kann sicherlich nur ein Anhaltspunkt sein. Eine genauere Befragung, welche auf die tägliche Trinkmenge in Gramm Rückschlüsse und somit eine Vergleichbarkeit mit anderen Erhebungen zugelassen hätte, wäre über den geplanten Rah-men der Studie hinausgegangen. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Auswertung des Bundes-Gesundheitssurveys geben jedoch Frauen wie auch Männer, welche einen höheren sozioökonomischen Status erreicht haben, häufiger einen höheren und die gesund-heitlich verträgliche Menge überschreitenden Alkoholkonsum an (WINKLER et al., 1999). In der Untersuchungsgruppe gaben die Patienten mit Hochschulabschluss am häufigsten einen täglichen Alkoholkonsum an. Die Bedeutung der körperlichen Aktivität für die verschiedenen Dimensionen der Gesund-heit ist in der internationalen Literatur gut belegt (PAFFENBARGER et al., 1993; BOUCHARD, 1994; US-DEPARTMENT OF HEALTH AN HUMAN SERVICES, 1996; MENSINK, 1999; SAMITZ, 2002). Ein körperlich aktiver Lebensstil hilft mit, das Risiko für Übergewicht, Osteo-arthrose und Rückenschmerzen zu senken. Der prozentuale Anteil der Sport treibenden Personen in der untersuchten Gruppe ist repräsentativ für die bundesdeutsche Bevölkerung, wonach mit zunehmendem Alter die Bereitschaft, sich sportlich zu betätigen, bei Frauen und Männern gleichermaßen sinkt (MENSINK, 2003). Der bei den über 80-jährigen Patien-ten der eigenen Kohorte zu verzeichnende Anstieg der aktiven Patienten gegenüber den zehn Jahre jüngeren muss konstatiert werden, ohne dass sich eine schlüssige Erklärung dafür ergibt. 6.1 Diskussion der Ergebnisse zu Beschwerden der Wirbelsäule Die 3-Monats-Prävalenz von Wirbelsäulenbeschwerden dieser Studie liegt bei 56 %. Die Angaben in der deutschen und internationalen Literatur schwanken von einer Punktpräva-lenz (Rückenschmerzen heute) von 35 % bis zu einer Lebenszeitprävalenz von über 80 % (REISBORD et al., 1985; RASPE, 1993; BERGMAN et al., 2001; WEINER et al., 2006; SALAFFI et al., 2005; SCHNEIDER et al., 2006). Die im Überblick etwas höhere Prävalenz in der vor-liegenden Studie im Vergleich zu den Literaturangaben liegt möglicherweise darin begrün-det, dass es sich um ein vorselektiertes Patientengut handelt. Der Anlass des Aufsuchens der Praxis war gegebenenfalls schon der vorhandene Schmerz im Bereich des Bewegungsapparates, sodass kein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung zustande kam. Differenziert man die prozentuale Häufigkeit der betroffenen Wirbelsäulenregionen, so klagen mit Abstand die meisten Patienten über Beschwerden der Lendenwirbelsäule (44,9 %), sog. „low back pain“. Dabei ist die Lendenwirbelsäule die einzige Region der Wirbelsäule, in welcher mit zunehmendem Body-Mass-Index auch die Beschwerdepräva-lenz zunimmt. Hier ist ein Zusammenhang zwischen zunehmendem Körpergewicht und vermehrter sta-tisch-mechanischer Beanspruchung der unteren Wirbelsäulenabschnitte anzunehmen. LIUKE et al. (2005) verifizierte diese Tatsache mittels Magnetresonanzuntersuchungen der lumbalen Bandscheiben bei Patienten mit einem Body-Mass-Index über 25 kg/m², indem er mit zunehmendem Body-Mass-Index ein erhöhtes Risiko für Bandscheibendegeneratio-nen feststellte. Im Halswirbelsäulenbereich sieht man, dass mit 69,6 % vs. 30,4 % die Frauen signifikant mehr Schmerzen angeben. FEJER et al. (2005) kommen in einer Metaanalyse, speziell die Lebenszeitprävalenz betreffend, auch zu dem Ergebnis, dass Frauen häufiger über HWS-Beschwerden klagen als Männer. In absteigender anatomischer Wirbelsäulenlokalisation gleicht sich das Geschlechterverhältnis bei der Angabe von Schmerzen an, sodass bei den Patienten mit LWS-Beschwerden 55 % weiblich und 45 % männlich sind. Vergleicht man die Angabe der Anzahl der betroffenen Regionen im Bereich der Wirbelsäule, geben Frauen signifikant häufiger als Männer an, in mehr als einer Region Schmerzen zu haben. Der Zusammenhang zwischen schweren mechanischen Belastungen der Wirbelsäule und der Entstehung von Rückenschmerzen, speziell im Bereich der Lendenwirbelsäule, lässt sich gut nachvollziehen. Hier spielt vor allem das Heben und Tragen von schweren Lasten eine Rolle, aber auch Arbeiten in Zwangshaltungen (gebückt, über Kopf, auf den Knien, in verdrehter Körperhaltung, andauernd sitzend), Arbeiten mit ruckartigen Bewegungen oder unter Einfluss von Vibrationen (Berufskraftfahrer, Fahren von landwirtschaftlichen Gerä-ten). In diesem Zusammenhang lassen sich die Beschwerden der Männer, welche im Bereich der Lendenwirbelsäule die höchste Prävalenz aufweisen, insofern erklären, als Männer öfter körperlich schwerere Arbeit verrichten als Frauen. Dass Rückenschmerzen aber nicht nur mechanische, sondern auch psychosomatische Aspekte haben, ist gut bekannt. Ein nicht zu unterschätzender Anteil von Rückenschmer-zen wird von psychosozialen Konflikten aus der Arbeitswelt und aus dem Privatleben unterhalten und kann demzufolge nicht allein medizinisch-somatisch gelöst werden. MAYR et al. (2003) fanden in einer Untersuchung von Rückenschmerzpatienten ohne plausible organische Ursache eine Inzidenz psychiatrischer Auffälligkeiten von 62 %, wobei Depressionen und Angstzustände im Vordergrund standen. Auf der anderen Seite ist bekannt, dass Frauen häufiger an psychischen Störungen leiden als Männer (MERBACH et al., 2002). Die 4-Wochen-Prävalenz einer diagnostisch abgesicherten psychischen Störung beträgt bei 36- bis 45-jährigen Männern 10 % und bei gleichaltrigen Frauen 23 %, womit bei Frauen mehr als doppelt so häufig wie bei Männern eine psychische Erkrankung diag-nostiziert wird (WITTICHEN et al., 1999). In diesem Zusammenhang lassen sich die höhere Prävalenz von Rückenschmerzen und die häufigere Angabe von Wirbelsäulenbeschwerden bei Frauen im Kontext mit einer höheren Prävalenz für psychische Erkrankungen erklären. Es ist hier also möglich, dass der Rückenschmerz eine somatische Manifestation einer psy-chischen Störung ist, speziell im Bereich der Halswirbelsäule. Inwieweit der Einfluss der Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen oder Unterschiede in der zentralen Schmerzverarbeitung von Bedeutung für die geschlechtsdifferente Schmerzperzeption ist, ist Gegenstand der neueren Forschung und bleibt abzuwarten. Die Kenntnis der unter-schiedlichen Prävalenz und Wahrnehmung von Schmerzen bei Männern und Frauen sollte aber jetzt schon die therapeutischen Optionen bestimmen. 6.2 Diskussion zu Ergebnissen der Beschwerden der Gelenke Die Hälfte aller Patienten hatte in den vergangenen drei Monaten Schmerzen in einem oder mehreren Gelenken. Vergleicht man die vorliegenden Daten mit denen von SCHNEIDER et al. (2005), so ergibt sich in der eigenen Gruppe eine Prävalenz von 50,1 % aller Patienten mit Gelenkbeschwerden gegenüber 27,7 % Osteoarthritis-Patienten in der Nettostichprobe von 6.205 Personen des Bundes-Gesundheitssurveys. Die Gründe hierfür könnten wie-derum erstens die vorselektierte und nicht randomisierte eigene Untersuchungsgruppe sein und zweitens, dass nicht jeder Patient mit Gelenkbeschwerden an einer Osteoarthritis litt, sondern der Gelenkschmerz ätiopathogenetisch vielfältiger ist, sodass andere Krankheits-bilder wie Meniskopathien oder Gichtarthropathien auch unter der Entität Gelenkschmerz subsummiert wurden. Als Ursache für den Gelenkschmerz findet man häufig, im Gegensatz zum meist unspezifi-schen Rückenschmerz, ein pathologisch-anatomisches Substrat. Anders als beim Rücken-schmerz, bei welchem doch eher unabhängig von der Genese eine symptomatische Thera-pie zur Anwendung kommt, macht sich hier ein Defizit der vorliegenden Untersuchung dahingehend bemerkbar, dass die Pathogenese des Gelenkschmerzes nicht differenziert wird. Andererseits ist es ja primär das Symptom Schmerz, welches den Patienten veran-lasst, den Arzt aufzusuchen, unabhängig davon, ob ursächlich eine Gichtarthropathie, eine Meniskuspathologie oder eine degenerative Chondromalazie verantwortlich ist. Bekannt ist allerdings auch, dass bei radiologischer Erfassung und Klassifikation der Arthrosen ein großer Teil nie symptomatisch wird, es sich um eine „stumme Arthrose“ handelt (FELSON et al., 1988; SUN et al., 1997). Trotz allem ist die pathogenetische Differenzierung, insbe-sondere differenzialtherapeutisch, von großer Bedeutung. Bei der Angabe von Beschwerden in den verschiedenen Gelenken zeigt sich bei den Frauen eine höhere Prävalenz von Gelenkbeschwerden (54,5 % vs. 45,5 %). Außerdem geben Frauen häufiger als Männer an, in mehr als einem Gelenk Beschwerden zu haben. Die Ursache könnte auch hier wiederum in der geschlechtsdifferenten Schmerzperzeption und -verarbeitung liegen, jedoch weniger als bei der Wirbelsäule im psychosomatischen Bereich. Die höchsten Prävalenzzahlen zeigten mit 30,1 % das Kniegelenk, mit 17,9 % das Schul-tergelenk und mit 10,9 % das Hüftgelenk. Außer im Ellenbogengelenk hatten Frauen in allen Gelenkregionen häufiger Schmerzen, signifikant war der Unterschied im Hüft- und Kniegelenk. Der etwas höhere Anteil von Männern bei Patienten mit Beschwerden im Ellenbogenbereich könnte auf höheren mechanischen Stress zurückzuführen sein, welchem Männer infolge schwererer Arbeit ausgesetzt sein könnten. Eine beweisende Kausalität lässt sich allerdings nicht ableiten. Bei der Auswertung der Ergebnisse des Bundes-Gesundheitssurveys zeigt sich der lineare Zusammenhang zwischen steigendem Body-Mass-Index und Arthroseprävalenz (SCHNEIDER et al., 2005). Auch andere Autoren konnten nachweisen, dass das Risiko, eine Osteoarthrose zu entwickeln, mit zunehmendem Körpergewicht eindeutig steigt (ANDERSON et FELSON, 1988; HOCHBERG et al., 1995; DAVIS et al., 1990; TEPPER et HOCHBERG, 1993; MARKS et ALLEGRANTE, 2002; STURMER et al., 1998). In der eigenen Untersuchungsgruppe war dieser Zusammenhang bei den Beschwerden des Schulter-, Knie- und Sprunggelenkes signifikant. Die Ursache für die höhere Prävalenz von Knie- und Sprunggelenkbeschwerden bei Patienten mit Übergewicht lässt sich durch die höhere mechanische Belastung des Gelenkknorpels erklären. Ein Grund für die steigende Präva-lenz von Schulterbeschwerden mit zunehmendem Body-Mass-Index ist nicht offensicht-lich. WENDELBOE et al. (2004) können zumindest die Tatsache bestätigen, dass eine Asso-ziation zwischen steigendem Body-Mass-Index und der Notwendigkeit von Schulter-Chi-rurgie besteht, wobei die höchste Odds-Ratio (3,13 bei Männern, 3,51 bei Frauen) bei Pati-enten mit einem Body-Mass-Index über 35 kg/m² lag. Patienten dieser Gewichtsgruppen (Adipositas Grad II und III) klagten auch in der vorliegenden Kohorte über die meisten Schulterbeschwerden. Bei der bisherigen Analyse der Beschwerden der am häufigsten betroffenen Gelenke wurde unberücksichtigt gelassen, dass eine bestimmte Anzahl von Patienten nicht nur in einem, sondern in mehreren Gelenken gleichzeitig Schmerzen aufwies. Somit konnte nicht zugeordnet werden, welcher Kofaktor mit dem Auftreten der Beschwerden assoziiert ist. Deshalb wurden im Weiteren diejenigen Patienten identifiziert, welche ausschließlich im Schultergelenk bzw. Hüft- oder Kniegelenk Schmerzen hatten. Dabei zeigte sich, dass die Kniepatienten ein höheres Alter und einen größeren Body-Mass-Index hatten als die Schulter- und Hüftpatienten. Hier könnte erneut die vorwiegend mechanischen Einflüssen zugrunde liegende Genese der Kniegelenksarthrose eine Rolle spielen. Bei allen drei Gelenken waren Patienten mit Prä-Adipositas (Body-Mass-Index von 25 bis 29,9 kg/m²) am häufigsten vertreten. Der altersbezogene Prävalenzgipfel lag bei Patienten mit Schulter-beschwerden zwischen dem 50. und 59. Lebensjahr, bei Patienten mit Hüftbeschwerden zwischen dem 60. und 69. Lebensjahr und bei Kniepatienten zwischen dem 70. und 79. Lebensjahr. Die Entstehung von Schulter- und Hüftgelenkbeschwerden müsste demzufolge ursächlich noch anderen, z. B. genetischen Faktoren, anzulasten sein, welche aber mit der vorliegenden Methodik nicht dargestellt werden konnten. Der Rückgang der Arthroseprä-valenz in den höchsten Altersgruppen, wie in der vorliegenden Kohorte nachzuvollziehen, ist ein Phänomen, welches auch schon FELSON und ZHANG (1998), SWOBODA (2001) und HELIOVAARA et al. (1993) in ihren Studien beschrieben. SCHNEIDER et al. (2005) erklärt dies durch einen Selektionseffekt, durch welchen es infolge des chronischen Verlaufes der Osteoarthrose und der damit häufig verbundenen Komorbidität zu einer erhöhten Mortali-tät der Arthrosegruppe kommt. Die Kenntnis der Begleiterkrankungen erlaubte es, den Patienten mit Gelenkerkrankungen deren Komorbiditätsdaten zuzuordnen. So ergab sich, dass sich Schulter-, Hüft- und Knie-patienten hinsichtlich ihrer erfassten Begleiterkrankungen nicht wesentlich unterschieden. Tendenziell hatten die Patienten mit Kniebeschwerden häufiger hohen Blutdruck, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Hyperurikämie. Das sind diejenigen Erkrankungen, welche mit Adipositas assoziiert sind und daher auch mit einer höheren Prävalenz von Knieschmerzen. 6.3 Diskussion zu Ergebnissen zu Beschwerden des Kniegelenkes „Es scheint so, als habe sich die Natur mit dem Kniegelenk zu viel vorgenommen. Es ist kein reines Scharniergelenk, sondern lässt auch Drehbewegungen zu. Da es jedoch nicht so stabil wie ein Kugelgelenk ist, muss es durch verschiedene Bänder und Menisken gehalten werden. Gehen, Laufen, In-die-Hocke-Gehen, Sitzen, Knien, Aufstehen: Schon die Bewe-gungen des Alltags stellen hohe Anforderungen an das Kniegelenk, vor allem dann, wenn Übergewicht hinzukommt.“ Diese treffende Beschreibung der Problematik des Kniegelen-kes von FÜEßL (2005) mag die hohen Prävalenzzahlen von Kniebeschwerden in der allge-meinmedizinischen und orthopädisch-chirurgischen Sprechstunde erklären. Fast jeder dritte Patient gab an, in den vergangenen drei Monaten Schmerzen im Knie-gelenk gehabt zu haben. SUN et al. (1997) fanden in den relevanten internationalen Studien Prävalenzzahlen der radiologischen Manifestation der Gonarthrose zwischen 4,3 % und 36 % bei Männern sowie 3,6 % und 35 % bei Frauen. Die klinische Prävalenz ist erwar-tungsgemäß geringer, da nicht alle Betroffenen über Gelenkschmerzen klagten. Die Aus-wertung der ersten Ergebnisse der Herner Arthrose-Studie, der ersten bevölkerungsreprä-sentativen Befragung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zum Thema Arth-rose ergab, dass 36 % der Befragten über Beschwerden in den Kniegelenken klagten (THIEM, 2005). Seitendifferentes Auftreten von Arthrosen wird von NEAME et al. (2004) beschrieben. Bei den Händen und Tibiofemoralgelenken traten Arthroseveränderungen mehr auf der rechten als auf der linken Körperhälfte auf. Ursächlich schuldigt der Autor der Studie biomechani-sche Faktoren für die Entstehung an. In der vorliegenden Untersuchung klagen Frauen sig-nifikant häufiger als Männer über Schmerzen in beiden Kniegelenken. Pathogenetisch diskutiert werden müssen dabei das höhere Gewicht der Frauen als in Vergleichsgruppen, aber auch der geschlechtsabhängige Unterschied in der Schmerzperzeption sowie letztlich auch psychosomatische Faktoren. Bezüglich des seitendifferenten Auftretens der Beschwerden klagten die Männer mehr über Schmerzen im linken als im rechten Kniegelenk, bei den Frauen stellte sich dies entgegen-gesetzt dar. Ein kausaler Hintergrund ließ sich mit den vorliegenden Daten nicht feststel-len. Repetiert man die umfangreiche Literatur zur Frage der Risikofaktoren bzw. Prädiktoren für die Entstehung von Kniebeschwerden infolge einer Gonarthrose, so werden überein-stimmend zunehmendes Alter, Übergewicht und weibliches Geschlecht genannt (HOCHBERG et al., 1995; DAVIS et al., 1990; STURMER et al., 2000; SCHNEIDER et al., 2005; COOPER et al., 2000; PARADOWSKI et al., 2005; HOLMBERG et al., 2005; SANDMARK et al., 1999; HART et al., 1999; DING et al., 2005; TEICHTAHL et al., 2005). CHRISTENSEN et al. (2005) und MESSIER et al. (2005) konnten bei ihren übergewichtigen Patienten mit Gonarthrose durch eine Gewichtsreduktion eine deutliche Verbesserung der Gelenkfunk-tion erreichen, besonders durch Kombination mit körperlichem Training. Die Geschlechtsabhängigkeit der Kniebeschwerden lässt sich in der vorliegenden Unter-suchungsgruppe bestätigen. Mit 57,3 % vs. 42,7 % klagten die Frauen signifikant häufiger über Schmerzen in den Kniegelenken. Die Prävalenz von Knieschmerzen stieg in der eigenen Patientengruppe mit zunehmendem Alter nahezu linear an. Eine Ausnahme bildete die Altersgruppe der 30- bis 39-jährigen Männer, bei denen ein deutlicher Prävalenzgipfel hinsichtlich der Angabe von Beschwer-den zu verzeichnen war. Die empirische Vermutung, dass es sich bei Männern in dieser Gruppe um „alternde Vereinsfußballer“ handeln könnte, konnte nicht bestätigt werden. Bei genauer Analyse der betroffenen 14 Patienten gab nur einer an, bis vor kurzem aktiv Fuß-ball gespielt zu haben. Bei fünf Patienten konnte eine Meniskuspathologie als Ursache der Beschwerden eruiert werden, bei jeweils einem Patienten eine Chondropathie bzw. ein Bandscheibenvorfall. Die altersbedingte Zunahme von Kniebeschwerden lässt sich einerseits durch den Zeitraum des Einwirkens des mechanischen Stresses auf die Menisken und den Gelenkknorpel erklä-ren. ENGLUND et al. (2004) und DAHAGHIN et al. (2005) fanden andererseits in ihren Stu-dien eine Assoziation zwischen dem Auftreten von Handarthrosen und Kniegelenksarthro-sen. Es scheint also auch eine genetische Veranlagung zu geben, die bestimmte Patienten zu degenerativen Veränderungen der Gelenke disponiert: Man hat sich einen Meniskus bzw. Gelenkknorpel vorzustellen, der anlagebedingt, von vornherein den Belastungen und bewegungsbedingten Scherkräften gegenüber weniger widerstandsfähig ist. Übereinstimmend mit der Literatur konnte auch in der vorliegenden Untersuchung ein sig-nifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Kniebeschwerden und zunehmen-dem Body-Mass-Index hergestellt werden. So gaben sieben von acht Patienten mit einem Body-Mass-Index über 40 kg/m² Kniebeschwerden an. Der pathogenetische Zusammen-hang der mechanischen Überlastung des Gelenkknorpels mit zunehmendem Gewicht wurde von DING et al. (2005) durch den Nachweis von strukturellen Schäden des Knorpels bei Patienten mit höherem Body-Mass-Index aufgezeigt. Der Einfluss des Rauchens auf die Osteoarthrose des Kniegelenkes wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Ältere Studien von FELSON et al. (1989) und SANDMARK et al. (1999) kommen zu dem Schluss, dass Rauchen ein signifikanter Schutz vor der Entstehung einer Kniegelenksarthrose ist bzw. das relative Risiko der Entwicklung einer solchen senkt. Andere Autoren kommen zu gegensätzlichen Meinungen, wie HART und SPECTOR (1993) und WILDER et al. (2003), welche keine Risikoreduktion durch Nikotinkonsum hinsichtlich der Entwicklung einer Kniegelenksarthrose feststellen können. Das geringere Auftreten von Kniebeschwerden bei Rauchern könnte, so SCHNEIDER et al. (2005), durch die Kausal-kette „Tabakkonsum – BMI – Osteoarthrose“ zustande kommen, da regelmäßiger Tabak-konsum Stoffwechsel aktivierend und Appetit reduzierend wirkt. Dafür sprechen Analysen der Daten des Bundes-Gesundheitssurveys, wonach Raucher einen niedrigeren Body-Mass-Index als Nichtraucher aufweisen. In der vorliegenden Studie konnte bis auf die Gruppen der 40- bis 49-jährigen Frauen und 60- bis 69-jährigen Männer eine tendenzielle, bei den 30- bis 39-jährigen Frauen und den 40- bis 49-jährigen Männern eine signifikante Assoziation zwischen dem Tabakkonsum und einer höheren Prävalenz von Kniebeschwer-den aufgezeigt werden. Die Dauer des Nikotinkonsums (Raucherjahre) oder der Grad der Nikotinabhängigkeit spielten dabei keine Rolle. Andere Lebensgewohnheiten, wie Alkoholkonsum oder Kaffeegenuss, zeigten ebenso keine Assoziation mit dem Auftreten von Kniebeschwerden wie Merkmale einer gesunden Lebensweise, z. B. täglicher Verzehr von Obst und Gemüse oder regelmäßige sportliche Aktivität. Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden und Beschwerden in anderen Gelenkregionen klagten auch häufiger über Kniebeschwerden. Ein Grund hierfür könnte, wie schon erwähnt, in einer genetischen Disposition zur Entwicklung derartiger Erkrankungen zu suchen sein. Betrachtet man die Koinzidenz von nicht muskulo-skelettalen Begleiterkrankungen bei Kniepatienten, fällt die hohe Prävalenz von Erkrankungen auf, welche im weiteren Sinne dem metabolischen Syndrom zuzuordnen sind, wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstö-rungen und Diabetes mellitus. Diese Krankheiten sind wiederum mit erhöhtem Body-Mass-Index assoziiert, welcher signifikant die Rate an Osteoarthrosen des Kniegelenkes ansteigen lässt. Die Therapie dieser Krankheiten, besonders aber eine relevante Gewichts-reduktion, wirken sich auch positiv auf den Schweregrad der Kniegelenksarthrose aus (C HRISTENSEN et al., 2005; MESSIER et al., 2005). Bei kritischer Betrachtung der vorliegenden Studie fallen einige Defizite auf. So waren die Gruppen aufgrund der Multimorbidität zum Teil sehr heterogen, es fehlte eine gesunde Vergleichsgruppe aus dem gleichen Patientengut und es mussten überregionale Daten zum Vergleich herangezogen werden. Des Weiteren wurde das Symptom Schmerz nicht einge-hender differenzialdiagnostisch eingegrenzt bzw. keine Quantifizierung des Schmerzes vorgenommen, z. B. mittels geeigneter Messinstrumente. Auf der anderen Seite muss berücksichtigt werden, dass die Studie aus dem allgemeinmedizinischen Praxisalltag kommt und die Priorität demzufolge mehr auf praxisrelevante als auf rein akademische Erkenntnisse gelegt wurde. Für künftige Untersuchungen wären weitere Aspekte interessant: Spiegelt sich die Kennt-nis der geschlechtsdifferenten Schmerzperzeption und -verarbeitung in der Therapie von Beschwerden des muskulo-skelettalen Systems in der Allgemeinmedizin wider? Welche Rolle spielen koinzidente metabolische Einflüsse in der Pathogenese der Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden? Aufschlussreich wäre auch die Frage, wie stark die Beschwerden des Bewegungsapparates die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen und welche Kofaktoren hierbei eine Rolle spielen, z. B. anthropometrische Einflüsse, sozioökonomi-scher Status, Lebensgewohnheiten oder Begleiterkrankungen. 7 Schlussfolgerungen Erkrankungen des Bewegungsapparates zählen zu den Krankheiten mit der höchsten Punktund Lebenszeitprävalenz. Dadurch entstehen erhebliche volkswirtschaftliche Kos-ten. Am häufigsten betroffen sind beim Achsskelett die Lendenwirbelsäule und im Bereich der großen Gelenke das Kniegelenk. Durch die vorliegende Studie konnten als Prädiktoren und Risikofaktoren für das Auftreten solcher Beschwerden weibliches Geschlecht, zuneh-mendes Alter, Übergewicht und Rauchen identifiziert werden. Besonders bei den Wirbel-säulenbeschwerden spielen auch psychosomatische Aspekte eine Rolle. Durch Einflussnahme auf erhöhtes Körpergewicht und den Nikotinkonsum könnte die Prä-valenz von muskulo-skelettalen Beschwerden gesenkt werden. Zudem sollte die geschlechtsspezifische Schmerzperzeption und -verarbeitung in der Dif-ferenzialtherapie berücksichtigt werden. 8 Literaturverzeichnis (1) Anderson JJ, Felson DT. Factors associated with osteoarthrosis of the knee in the first national Health and Nutrition Examination Survey (HANES I). Evidence for an asso-ciation with overweight, race, and physical demands of work. Am J Epidemiol 1988: 128; 179-189 (2) Andersson HI, Ejlertsson G, Leden I and Rosenberg C. Chronic pain in a geographically defined general population: studies of differences in age, gender, social class, and pain localization. Clin J Pain 1993: 9; 174-182 (3) Badley EM, Tennant A. Changing profile of joint disorders with age: findings from a postal survey of the population of Calderdale, West Yorkshire, United Kingdom. Ann Rheum Dis 1992: 51; 366-371 (4) Bassols A, Bosch F, Campillo M, Canellas M and Banos JE. An epidemiological comparison of pain complaints in the general population of Catalonia (Spain). Pain 1999: 83; 9-16 (5) Battié MC, Videman T, Gill K, Moneta GB, Nyman R, Kaprio J, Koskenvuo M. Smoking and lumbar intervertebral disc degeneration: an MRI study of identical twins. Spine 1991: 16; 1015-1021 (6) Bellach BM, Ellert U, Radoschewski M. Epidemiologie des Schmerzes – Ergebnisse des Bundes-Gesundheitssurveys 1998. Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitschutz 2000: 43; 424-431 (7) Bergman S, Herrstrom P, Hogstrom K, Petersson IF, Svensson B, Jacobsson LT. Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographic associations in a Swedish population study. J Rheumatol 2001: 28; 1369-1377 (8) Bergmann KE, Mensink GBM. Körpermaße und Übergewicht. Gesundheitswesen 1999: 61 (Sonderheft 2); 115-120 (9) Bergmann S, Herrstrom P, Hogstrom K, Petersson IF, Svensson B and Jacobsson LT. Chronic musculoskeletal pain, prevalence rates, and sociodemographical associations in a Swedish population study. J Rheumatol 2001: 28; 1369-1377 (10) Borsook D (ed) (1997) Molecular neurobiology of pain. IASP, Seattle, 369 (11) Böstman OM. Body Mass Index and height in patients requiring surgery for lumbal intervertebraldisc herniation. Spine 1993: 18; 851-854 (12) Bouchard C, Shephard RJ, Stephens T (eds). Physical activity, fitness and health: International proceedings and consensus statement. Human Kinetics Publishers, Champaign, IL 1994 (13) Brage S and Bjerkedal T. Musculoskeletal pain and smoking in Norway. J Epidemiol Community Health 1996: 50; 166-169 (14) Brandt KD, Mankin HJ, Shulman LE: Workshop on etiopathogenesis of osteoarthritis. J Rheumatol 1986: 13; 1130-1160 (15) Buckwalter JA and Martin J. Degenerative joint disease. Clin Symp 1995: 47; 1-32 (16) Christensen R, Astrup A, Bliddal H. Weight loss: the treatment of choice for knee osteoarthritis? A randomized trial. Osteoarthritis Cartilage 2005: 13; 20-27 (17) Cimmino MA, Parisi M, Moggiana GL, Maio T and Mela GS. Prevalence of self-reported peripheral joint pain and swelling in an Italian population: the Chiavari study. Clin Exp Rheumatol 2001: 19; 35-40 (18) Cooper C, Snow S, McAlindon TE, Kellingray S, Stuart B, Coggon D, Dieppe PA. Risk factors for the incidence and progression of radiographic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2000: 43; 995-1000 (19) Cuningham LS and Kelsey JL. Epidemiology of musculoskeletal impartiments and associated disability. Am J Public Health 1984: 74; 574-579 (20) Dahaghin S, Bierma-Zeinstra SM, Reijman M, Pols HA, Hazes JM, Koes BW. Does hand osteoarthritis predict future hip or knee osteoarthritis? Arthritis Rheum 2005: 52; 3520-3527 (21) Davis MA, Ettinger WH, Neuhaus JM. Obesity and osteoarthritis of the knee: evidence from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I). Semin Arthritis Rheum 1990: 20; 34-41 (22) Ding C, Cicuttini F, Scott F, Cooley H, Jones G. Knee structural alteration and BMI: a cross-sectional study. Obes Res 2005: 13; 350-361 (23) Elliott AM, Smith BH, Penny KI, Smith WC and Chambers WA. The epidemiology of chronic pain in the community. Lancet 1999: 354; 1248-1252 (24) Englund, M, Paradowski PT, Lohmander LS. Association of radiographic hand osteoarthritis with radiographic knee osteoarthritis after meniscectomy. Arthritis Rheum 2004: 50; 469-475 (25) Fagerström KO, Kunze M, Schoberberger R, Breslau N, Hughes JR, Hurt RD, Puska P, Ramström L, Zatonski W. Nicotine dependence versus smoking prevalence among countries categories of smokers. Tobacco control 1996: 5; 52-56 (26) Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: a systematic critical review of the literatur. Eur Spin J 2005: 6 [Epub ahead of print] (27) Felson DT. Epidemiology of hip and knee osteoarthrosis. Epidemiol Rev 1988: 10; 1-28 (28) Felson DT, Anderson JJ, Naimark A, Hannan MT, Kannel WB, Meenan RF. Does smoking protect against osteoarthritis? Arthritis Rheum 1989: 32; 166-172 (29) Felson DT, Zhang Y. An update on the epidemiology of knee and hip osteoarthritis with a view to prevention. Arthritis Rheum 1998: 41; 1343-1355 (30) Filipiak H, Schneller H, Döring A et al., Monica-Projekt Augsburg, GSF-Bericht. GSF-Forschungszentrum 1993 (31) Flor H (1991) Psychobiologie des Schmerzes. Huber, Bern (32) Füeßl HS. Schwachstelle Kniegelenk. MMW-Fortschr Med 2005: 25; 614 (33) Günther KP, Stürmer T, Trepte CT, Naumann T, Kinzl L, Puhl W. Häufigkeit gelenkspezifischer Risikofaktoren bei Patienten mit fortgeschrittenen Cox- und Gonarthrosen in der Ulmer Osteoarthrose-Studie. Z Orthop Ihre Grenzgeb 1999: 137; 468-473 (34) Hagen KB, Kvien TK and Bjorndal A. Musculoskeletal pain and quality of life in patients with noninflammatory joint pain compared to rheumatoid arthritis: a population survey. J Rheumatol 1997: 24; 1703-1709 (35) Han TS, Schouten JS, Lean ME and Seidell JC. The prevalence of low back pain: an association with body fatness, fat distribution and height. Int J Obes Relat Metab Disord 1997: 21; 600-607 (36) Handwerker HO (1999) Einführung in die Pathophysiologie des Schmerzes. Springer, Berlin Heidelberg (37) Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis in middle-aged women: the Chingford Study. Arthritis Rheum 1999: 42; 17-24 (38) Hart DJ, Spector TD. Cigarette smoking and risk of osteoarthritis in women in the general population: the Chingford study. Ann Rheum Dis 1993: 52; 93-96 (39) Heliovaara M, Macular M, Knekt P, Impivaara O and Aromaa, A. Determinants of sciatica and low-back pain. Spine 1991: 16; 608-614 (40) Heliovaara M, Makela M, Impivaara O, Knekt P, Aromaa A, Sievers K. Association of overweight, trauma and workload with coxarthrosis. A health survey of 7.217 persons. Acta Orthop Scand 1993: 64; 513-518 (41) Helmert U. Einkommen und Rauchverhalten in der Bundesrepublik Deutschland – eine Sekundäranalyse der Daten des Mikrozensus 1995. Gesundheitswesen 1999: 61; 31-37 (42) Hochberg MC, Lethbridge-Cejku M, Scott WW Jr, Reichle R, Plato CC, Tobin JD. The association of body weight, body fatness and body fat distribution with osteoarthritis of the knee: data from the Baltimore Longitudinal Study of Aging. J Rheumatol 1995: 22; 488-493 (43) Holmberg S, Thelin A, Thelin N. Knee osteoarthritis and body mass index: a popula-tion-based case-control study. Scand J Rheumatol 2005: 34; 59-64 (44) Jones G, White C, Sambrook P, Eisman J. Allelic variation in the vitamin D receptor, lifestyle factors and lumbar spinal degenerative disease. Ann Rheum Dis 1998: 57; 94-99 (45) Junge B, Nagel M. Das Rauchverhalten in Deutschland. Gesundheitswesen 1999: 61 (Sonderheft 2); 122ff. (46) Kelsey JL, Githens PB, O’Conner T, Weil U, Calogero JA, Holford TR, White AA, Walter SD, Ostfeld AM, Southwick WO. Acute prolapsed lumbar intervertebral disc. An epidemiologic study with special reference to driving automobiles and cigarette smoking. Spine 1984: 9; 608-613 (47) Kurunlahti M, Tervonen O, Vanharanta H, Ilkko E, Suramo I. Association of atherosclerosis with low back pain and the degree of disc degeneration. Spine 1999: 24; 2080-2084 (48) Lampert T, Burger M. Rauchgewohnheiten in Deutschland – Ergebnisse des telefoni-schen Bundes-Gesundheitssurveys 2003. Gesundheitswesen 2004: 66; 511-517 (49) LeResche L. Gender considerations in the epidemiology of chronic pain. In: Crombie IK, Croft PR, Linton SJ, LeResche L, von Korff M (eds). Epidemiology of pain. IASP Press, Seattle 1999; 43-52 (50) Linton ST, Hellsing AL and Hallden BA. A population-based study of spinal pain among 35-45-year-old individuals. Spine 1998: 23; 1457-1463 (51) Liuke M, Solovieva S, Lamminen A, Luoma K, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimaki H. Disc degeneration of the lumbar spine in relation to overweight. Int J Obes (Lond) 2005: 29; 903-908 (52) Luoma K, Riihimäki H, Raininko R, Luukkonen R, Lamminen A, Viikari-Juntura E. Lumbar disc degeneration in relation to occupation. Scand J Work Environ Health 1998: 24; 358-366 (53) Manninen P, Riihimäki H, Heliövaara M. Incidence and risk factors of low-back pain in middle-aged farmers. Occup Med (Lond) 1995: 45; 141-146 (54) Marks R, Allegrante JP. Body mass indicies in patients with disabling hip osteoarthritis. Arthritis Res 2002: 4; 112-116 (55) Mayr M, Högler S, Ghedina W, Berek K. Low back pain and psychiatric disorders. Lancet 2003: 361; 531 (56) Mense S. Nociception from skeletal muscle in relation to clinical muscle pain. Pain 1993: 54; 241-289 (57) Mensink GBM. Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Bundes-Gesundheitssurvey: Körperliche Aktivität 2003: 5-7 (58) Mensink GBM. Körperliche Aktivität. Gesundheitswesen 1999: 61 (Sonderheft 2); 126-131 (59) Merbach M, Singer S, Brähler E. Psychische Störungen bei Männern und Frauen. In: Hurrelmann K, Kolip P (eds) Geschlecht, Gesundheit und Krankheit. Frauen und Männer im Vergleich. Huber, Bern (2002): 258-272 (60) Messier SP, Loeser RF, Miller GD, Morgan TM, Rejeski WJ, Sevick MA, Ettinger WH Jr, Pahor M, Williamson JD. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum 2004: 50; 1501-1510 (61) Miles TP, Flegal K and Harris T. Musculoskeletal disorders: time trends, comorbid conditions, self-assessed health status and associated activity limitations. Vital Health Stat 1993; 275-288 (62) Miranda H, Viikari-Juntura E, Martikainen R, Takala EP, Riihimäki H. Individual factors, occupational loading, and physical exercise as predictors of sciatic pain. Spine 2002: 27; 1102-1109 (63) Neame R, Zhang W, Deighton C, Doherty M, Doherty S, Lanyon P, Wright G. Distribution of radiographic osteoarthritis between the right and left hands, hips, and knees. Arthritis Rheum 2004: 50; 1487-1494 (64) O’Neill TW, McCloskey EV, Kanis JA, Bhalla AK, Reeve J, Reid DM, Todd C, Woolf AD, Silman AJ. The distribution determinants, and clinical correlates of vertebral osteophytosis: a population based survey. J Rheumatol 1999: 26; 842-848 (65) Paradowski PT, Englund M, Lohmander LS, Roos EM. The effect of patient characteristics on variability in pain and function over two years in early knee osteoarthritis. Health Qual Life Outcomes 2005: 3; 59 (66) Paffenbarger RS, Hyde RT, Wing AL, Lee IM, Jung DL, Kampert JB. The association of changes in physical activity level and other lifestyle characteristics with mortality among men. N Engl J Med 1993: 328; 538-545 (67) Raspe H. Back pain. In: Silman A, Hochberg A (eds). Epidemiology of the rheumatic diseases. Oxford University Press, Oxford 2001; 309-338 (68) Raspe H, Kohlmann T. Rückenschmerzen – eine Epidemie unserer Tage? Dtsch Ärztebl 1993: 90; 2165-2172 (69) Reisbord LS, Greenland S. Factors associated with self-reported back-pain prevalence: a population-based study. J Chronic Dis 1985: 38; 691-702 (70) Salaffi F, De Angelis R, Grassi W. Prevalence of musculoskeletal conditions in an Italian population sample: results of a regional community-based study. I. The MAP-PING study. Clin Exp Rheumatol 2005: 23; 819-828 (71) Samitz G, Mensink GBM (Hrsg.). Körperliche Aktivität in Prävention und Therapie. Hans Marseille Verlag GmbH (2002), München (72) Sandmark H, Hogstedt C, Lewold S, Vingard E. Osteoarthritis of the knee in men and women in association with overweight smoking, and hormone therapy. Ann Rheum Dis 1999: 58; 151-155 (73) Schmidt RF, Schaible HG, Meßlinger K, Heppelmann B, Hansch U, Pawlak M. Silent and active nociceptors: structure, functions and clinical implications. In: Gebhart GF, Hammond DL, Jensen DS (eds). Proceedings of the 7th World Congress on Pain. Progress in pain research and management, vol 2. IASP (1994) Seattle, 213-250 (74) Schneider S, Lipinski S, Schiltenwolf M. Occupations associated with a high risk of self-reported back pain: representative outcome of a back pain prevalence study in the Federal Republic of Germany. Eur Spine J 2006: Jan 24; [Epub ahead of print] (75) Schneider S, Schmitt G, Mau H, Schmitt H, Sabo D, Richter W. Prävalenz und Korrelate der Osteoarthrose in der BRD. Orthopäde 2005; 34: 782-790 (76) Seidler A: Epidemiologische Evidenz zum Zusammenhang zwischen Rauchen, Über-gewicht sowie Arteriosklerose und strukturellen Bandscheibenschäden. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2004: 39; 67-78 (77) Seidler A, Bolm-Audorff U, Schmitt E, Elsner G. Zum Zusammenhang von Rauchen und Übergewicht mit bandscheibenbedingten Erkrankungen der Lendenwirbelsäule – Ergebnisse einer Fall-Kontroll-Studie. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2004: 39; 12-14 (78) Senn E, Offenbächer M, Plenk A. Häufigkeit und Krankheitslast degenerativer Gelenkerkrankungen und Schmerzzustände des Hüft- und Kniegelenkes in Deutschland – Ergebnisse der Definitionsphase einer multizentrischen, epidemiologischen Studie. Z Rheumatol 1998: 57; 258-261 (79) Spahn G, Schiele R, Hell AK, Klinger HM, Jung R, Langlotz A. The prevalence of pain and deformities in the feet of adolescents. results of a cross-sectional study. Z Orthop Ihre Grenzgeb 2004: 142; 389-396 (80) Spahn G, Schiele R, Langlotz A, Jung R. Prevalence of functional pain of the back, the hip and the knee in adolescents. Results of a cross-sectional study. Dtsch Med Wochenschr 2004: 129; 2285-2290 (81) Stanton-Hicks M (2000). Complex regional pain syndrome (type I, RSD; type II, causagia): controversies. Clin J Pain 16 (Suppl): S33-S40 (82) Statistisches Bundesamt 1998. Gesundheitsbericht für Deutschland: Gesundheits-berichterstattung des Bundes. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (83) Sturmer T, Gunther KP, Brenner H. Obesity, overweight and patterns of osteoarthritis: the Ulm Osteoarthritis Study. J Clin Epidemiol 2000: 53; 307-313 (84) Sturmer T, Sun Y, Sauerland S, Zeissig I, Gunther KP, Puhl W, Brenner H. Serum cholesterol and osteoarthritis. The baseline examination of the Ulm Osteoarthritis Study. J Rheumatol 1998: 25; 1827-1823 (85) Sun Y, Sturmer T, Gunther KP, Brenner H. Incidence and Prevalence of cox- and gonarthrosis in the general population. Z Orthop Ihre Grenzgeb 1997: 135; 184-192 (86) Swoboda B. Aspekte der epidemiologischen Arthroseforschung. Orthopäde 2001: 30; 834-840 (87) Teichtahl AJ, Wluka AE, Proietto J, Cicuttini FM. Obesity and the female sex, risk factors for knee osteoarthritis that may be attributable to systemic or local leptin bio-synthesis and its cellular effects. Med Hypotheses 2005: 65; 312-315 (88) Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip osteoarthrosis: data from the First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES-I). Am J Epidemiol 1993: 137; 1081-1088 (89) Thiem U, Friedrich C, Pientka L. Repräsentative Studie zu Gelenkbeschwerden und Osteoarthrose: die Herner Arthrose-Studie HER-AS (www.versorgungsforschung.nrw.de), 2005 (90) Thüringer Landesamt für Statistik. www.tls.thueringen.de, 2005 (91) Urwin M, Symmons D, Allison T, Brammah T, Busby H, Roxby M, Simmons A and Williams G. Estimating the burden of musculoskeletal disorders in the community comparative prevalence of symptoms at different anatomical sites and relation to social deprivation. Ann Rheum Dis 1998: 57; 649-655 (92) U.S. Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of Surgeon General. Atlanta, 1996. GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (93) Weiner DK, Sakamoto S, Perera S, Breuer P. Chronic low back pain in older adults: prevalence, reliability, and validity of physical examination findings. J Am Geriat Soc 2006: 54 (1); 11-20 (94) Wendelboe AM, Hegmann KT, Gren LH, Alder SC, White GL Jr, Lyon JL. Association between body-mass index and surgery for rotator cuff tendinitis. J Bone Joint Surg Am 2004: 86-A (4); 743-747 (95) Wilder FV, Hall BJ, Barrett JP. Smoking and osteoarthritis: is there an association? The Clearwater Osteoarthritis Study. Osteoarthritis Cartilage 2003: 11; 29-35 (96) Winkler J, Stolzenberg H. Der Sozialschichtindex im Bundes-Gesundheitssurvey (Social status scaling in the German National Health Interview and Examination Survey). Gesundheitswesen 1999: 61 (Sonderheft 2); 178-183 (97) Wittichen HU, Müller N, Pfister H. Affektive, somatoforme und Angststörungen in Deutschland – Erste Ergebnisse des bundesweiten Zusatzsurveys „Psychische Stö-rungen“. Gesundheitswesen 1999: 61 (Sonderheft 2); 216-222 (98) Zimmermann M. Neuronale Mechanismen der Schmerzchronifizierung. Orthopäde 2004: 33; 515-524 (99) Zimmermann M, Herdegen T (1996) Plasticity of the nervous system at the systemic, cellular and molecular levels: a mechanism of chronic pain and hyperalgesia. In: Carli G, Zimmermann M (eds). Towards the neurobiology of chronic pain. Progress in brain research, vol 110. Elsevier, Amsterdam, 233-259 9 Anhang Anlage 1 Pat.-Nr.: Datum: .................. ....................... Liebe Patientin, lieber Patient! Das Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Schiele) und die Praxisklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Eisenach (Dr. med. G. Spahn, Dr. med. S. Kirschbaum) führen in Zusam-menarbeit mit unserer Praxis eine Untersuchung zum Gesundheitszustand der Bevölkerung, insbesondere in Bezug auf Erkrankungen der Wirbelsäule und Gelenke, durch. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Wir bitten Sie, den folgenden Fragebogen auszufüllen. Sie benötigen dazu etwa 8 Minuten. Den ausgefüllten Fragebogen schicken Sie bitte in beigefügtem Rückkuvert innerhalb der nächsten 7 Tage zurück oder geben ihn in der Praxis ab. Wir versichern Ihnen, dass alle Daten vertraulich behandelt werden und die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes streng beachtet werden. Die Fragebögen werden nach anonymer Auswertung für wissenschaftliche Zwecke vernichtet. Falls Sie Fragen zum Ausfüllen des Bogens haben, wenden Sie sich bitte an uns. Zur Beantwortung der Fragen markieren Sie Ihre Antwort durch ein Kreuz in dem Kästchen. z. B. ja nein Falls Zahlenangaben erforderlich sind, schreiben Sie bitte die Zahlen in die vorgegebenen Felder. ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ z. B. ⎣1⎦ ⎣7⎦ ⎣3⎦ X Einige Fragen zu Ihrer Person ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Jahre 1. Bitte geben Sie Ihr Alter an. 2. Sind Sie männlich oder weiblich? 1 männlich 2 weiblich 3. Bitte geben Sie Größe ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ cm und Gewicht ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ kg an. 4. Familienstand : ledig 1 verheiratet 2 verwitwet 3 geschieden 4 5. Schulbildung: bis 10. Klasse 1 Abitur 2 abgeschlossene Lehre 3 Fachschulabschluss 4 Hochschulabschluss 5 6. derzeitig ausgeübte Tätigkeit: _______________________________ Arbeiter/Angestellter 1 selbstständig 2 mit vorwiegend sitzender Tätigkeit 11 wechselnde körperliche Belastung 12 Fahren von Kraftfahrzeugen (Pkw, Lkw, landwirtsch.Geräte) 13 arbeitslos 3 Rentner 4 (beschreiben Sie Ihre frühere Tätigkeit) vorwiegend sitzende Tätigkeit 14 wechselnde körperliche Belastung 15 Fahren von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW, landwirtsch. Geräte) 16 Ihre Gesundheit 7. Rauchen Sie? Nichtraucher 1 ehemaliger Raucher 2 Falls Sie rauchen, Zigaretten 4 Raucher 3 oder Zigarre/Pfeife 5 Seit wie vielen Jahren rauchen Sie? ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Wie schnell nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? innerhalb von 5 Minuten 31 6–30 Minuten 32 31–60 Minuten 33 nach 60 Minuten 34 Finden Sie es schwierig, auf das Rauchen zu verzichten, wenn es verboten ist? (z. B. im Kino, in Versammlungen usw.) ja 35 nein 36 Auf welche Zigarette fällt es Ihnen besonders schwer zu verzichten? die erste Zigarette morgens 37 jede andere 38 Wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag? 0–10 39 11–20 40 21–30 41 31 und mehr 42 Rauchen Sie stärker in den ersten Stunden nach dem Aufstehen oder während des übrigen Tages? ja 43 nein 44 Rauchen Sie auch, wenn Sie so krank sind, dass Sie im Bett liegen müssen? ja 45 nein 46 8. Trinken Sie Alkohol? nein 1 selten 2 mehrmals wöchentlich 3 täglich 4 9. Treiben Sie Sport? ja 1 nein 2 Falls ja, gelegentlich 3 regelmäßig 4 Falls ja, in der Sportgruppe/Verein 5 allein/selbstständig 6 10. Ernährung Essen Sie täglich Obst/Gemüse? Trinken Sie täglich Kaffee? ja 1 nein 2 ja 3 nein 4 11. Hatten Sie in den letzten 3 Monaten Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule oder der Gelenke? ja 1 nein 2 Wenn ja, markieren Sie in folgendem Schema diejenigen Stellen, welche Ihnen Schmerzen bereiteten: Lebenslauf Name, Vorname Katzmann, Stefan Geburtsdatum 08. September 1961 Geburtsort Eisenach 1968 - 1976 Besuch der Polytechnischen Oberschule Förtha 1976 - 1980 Besuch der Erweiterten Oberschule Gerstungen 1980 Abitur 1980 - 1982 18-monatiger Grundwehrdienst bei der NVA 1982 - 1988 Studium der Humanmedizin an der Karl-Marx-Universität Leipzig, davon einjährige Pflichtassistenz am Kreiskrankenhaus Eisenach 31.08.1988 Hochschulabschluss, Verleihung des akademischen Grades Diplom-Mediziner 01.09.1988 Approbation als Arzt 1988 - 1992 Facharztausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin an der Kreispoliklinik Eisenach seit 01.10.1992 Niederlassung in eigener Praxis in Wolfsburg-Unkeroda, seit 1998 Gemeinschaftspraxis mit Ehefrau Wolfsburg-Unkeroda, den ………………… …............................................ Stefan Katzmann Ehrenwörtliche Erklärung Hiermit erkläre ich, dass mir die Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät der Fried-rich-Schiller-Universität bekannt ist, ich die Dissertation selbst angefertigt habe und alle von mir benutzten Hilfsmittel, persön-lichen Mitteilungen und Quellen in meiner Arbeit angegeben sind, mich folgende Person bei der Auswahl und Auswertung des Materials sowie bei der Herstellung des Manuskripts unterstützt hat: Herr Dr. med. G. Spahn, Eisenach, die Hilfe eines Promotionsberaters nicht in Anspruch genommen wurde und das Dritte weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen von mir für Arbeiten erhalten haben, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen, dass ich die Dissertation noch nicht als Prüfungsarbeit für eine staatliche oder andere wissenschaftliche Prüfung eingereicht habe und dass ich die gleiche, eine in wesentlichen Teilen ähnliche oder eine andere Abhandlung nicht bei einer anderen Hochschule als Dissertation eingereicht habe. Jena, den ……………………… …………………………………………… Dipl.-Med. Stefan Katzmann Danksagung Mein Dank gilt Herrn Professor Dr. R. Schiele für seine Bereitschaft und das mir entge-gengebrachte Vertrauen, die vorliegende Arbeit am Institut für Arbeits-, Sozial-, Umweltmedizin und -hygiene der Friedrich-Schiller-Universität Jena durchführen zu dürfen, obwohl ich schon seit 15 Jahren dem Universitätsbetrieb fern bin. Ohne die Motivation und fachliche Hilfe von Herrn Dr.med. G. Spahn, Praxisklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie Eisenach, hätte mein Mut wahrscheinlich nicht gereicht, mich an diese akademische Hürde zu wagen. Vielen Dank für die geopferte Zeit und die vielen nützlichen Tipps. Ein herzlicher Dank gebührt meiner Schwester Andrea Katzmann, welche sich als frei-berufliche Lektorin meiner Arbeit gewidmet hat und Frau R. Trommler vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin für die hilfreichen Hinweise zur äußeren Textform. Besonderer Dank gilt meiner Ehefrau Ute und meinen Kindern Julius und Johanna, die mir durch Rücksichtnahme, Verständnis und vorübergehende Befreiung von häuslichen Tätig-keiten eine wichtige Stütze waren. Dank natürlich auch an meine Patienten, welche durch ihre Mithilfe diese Arbeit erst ermöglichten.