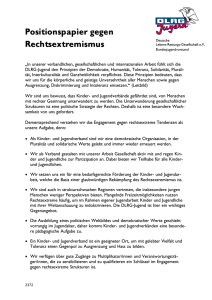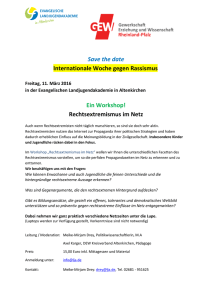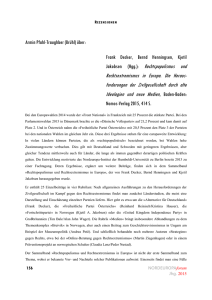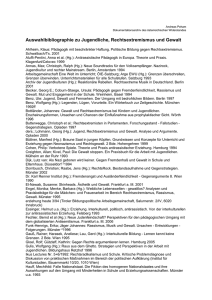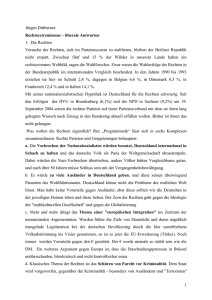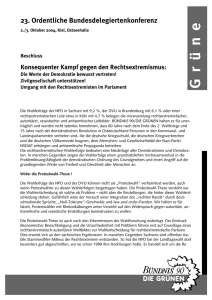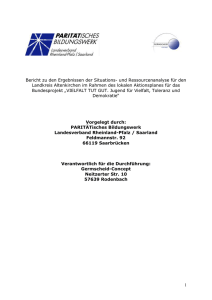Kurt Möller - Hochschule Esslingen
Werbung
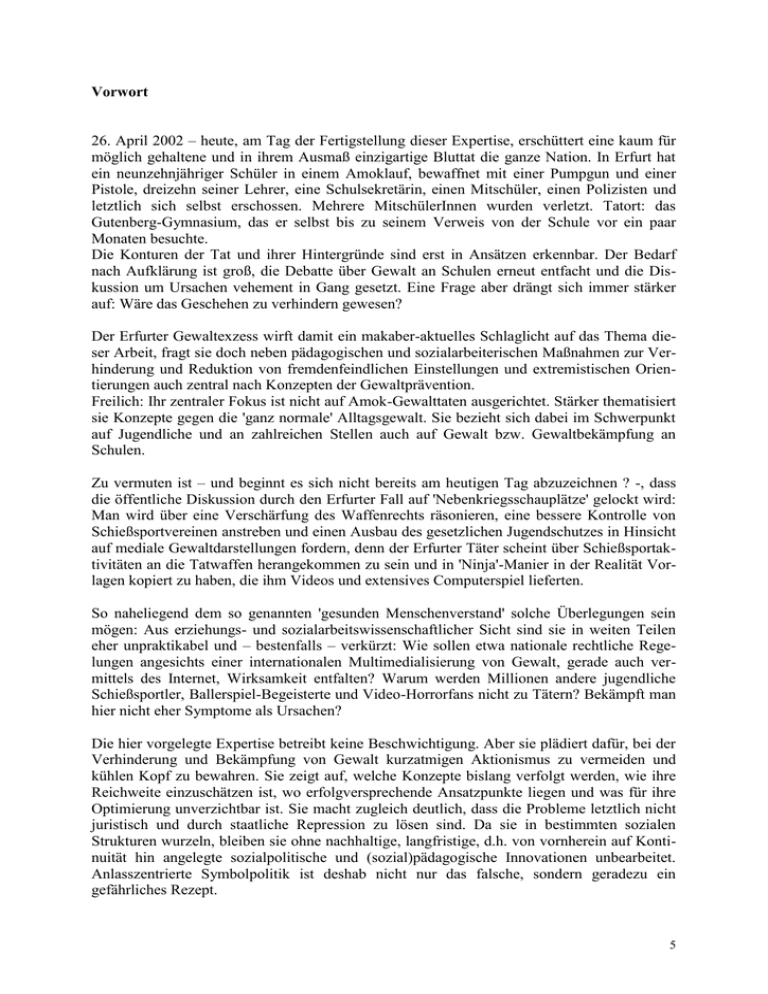
Vorwort 26. April 2002 – heute, am Tag der Fertigstellung dieser Expertise, erschüttert eine kaum für möglich gehaltene und in ihrem Ausmaß einzigartige Bluttat die ganze Nation. In Erfurt hat ein neunzehnjähriger Schüler in einem Amoklauf, bewaffnet mit einer Pumpgun und einer Pistole, dreizehn seiner Lehrer, eine Schulsekretärin, einen Mitschüler, einen Polizisten und letztlich sich selbst erschossen. Mehrere MitschülerInnen wurden verletzt. Tatort: das Gutenberg-Gymnasium, das er selbst bis zu seinem Verweis von der Schule vor ein paar Monaten besuchte. Die Konturen der Tat und ihrer Hintergründe sind erst in Ansätzen erkennbar. Der Bedarf nach Aufklärung ist groß, die Debatte über Gewalt an Schulen erneut entfacht und die Diskussion um Ursachen vehement in Gang gesetzt. Eine Frage aber drängt sich immer stärker auf: Wäre das Geschehen zu verhindern gewesen? Der Erfurter Gewaltexzess wirft damit ein makaber-aktuelles Schlaglicht auf das Thema dieser Arbeit, fragt sie doch neben pädagogischen und sozialarbeiterischen Maßnahmen zur Verhinderung und Reduktion von fremdenfeindlichen Einstellungen und extremistischen Orientierungen auch zentral nach Konzepten der Gewaltprävention. Freilich: Ihr zentraler Fokus ist nicht auf Amok-Gewalttaten ausgerichtet. Stärker thematisiert sie Konzepte gegen die 'ganz normale' Alltagsgewalt. Sie bezieht sich dabei im Schwerpunkt auf Jugendliche und an zahlreichen Stellen auch auf Gewalt bzw. Gewaltbekämpfung an Schulen. Zu vermuten ist – und beginnt es sich nicht bereits am heutigen Tag abzuzeichnen ? -, dass die öffentliche Diskussion durch den Erfurter Fall auf 'Nebenkriegsschauplätze' gelockt wird: Man wird über eine Verschärfung des Waffenrechts räsonieren, eine bessere Kontrolle von Schießsportvereinen anstreben und einen Ausbau des gesetzlichen Jugendschutzes in Hinsicht auf mediale Gewaltdarstellungen fordern, denn der Erfurter Täter scheint über Schießsportaktivitäten an die Tatwaffen herangekommen zu sein und in 'Ninja'-Manier in der Realität Vorlagen kopiert zu haben, die ihm Videos und extensives Computerspiel lieferten. So naheliegend dem so genannten 'gesunden Menschenverstand' solche Überlegungen sein mögen: Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Sicht sind sie in weiten Teilen eher unpraktikabel und – bestenfalls – verkürzt: Wie sollen etwa nationale rechtliche Regelungen angesichts einer internationalen Multimedialisierung von Gewalt, gerade auch vermittels des Internet, Wirksamkeit entfalten? Warum werden Millionen andere jugendliche Schießsportler, Ballerspiel-Begeisterte und Video-Horrorfans nicht zu Tätern? Bekämpft man hier nicht eher Symptome als Ursachen? Die hier vorgelegte Expertise betreibt keine Beschwichtigung. Aber sie plädiert dafür, bei der Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt kurzatmigen Aktionismus zu vermeiden und kühlen Kopf zu bewahren. Sie zeigt auf, welche Konzepte bislang verfolgt werden, wie ihre Reichweite einzuschätzen ist, wo erfolgversprechende Ansatzpunkte liegen und was für ihre Optimierung unverzichtbar ist. Sie macht zugleich deutlich, dass die Probleme letztlich nicht juristisch und durch staatliche Repression zu lösen sind. Da sie in bestimmten sozialen Strukturen wurzeln, bleiben sie ohne nachhaltige, langfristige, d.h. von vornherein auf Kontinuität hin angelegte sozialpolitische und (sozial)pädagogische Innovationen unbearbeitet. Anlasszentrierte Symbolpolitik ist deshab nicht nur das falsche, sondern geradezu ein gefährliches Rezept. 5 Einleitung Was tun gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt? Wer immer auf diese Gretchenfrage der Verteidigung und Sicherung einer rechtsstaatlichliberalen Gesellschaftsordnung nach tragfähigen Antworten sucht, tut gut daran, die Problematik zum einen zunächst genau zu analysieren, bevor u.U. folgenreiche Weichenstellungen in Hinsicht auf zu beschreitende Bearbeitungswege erfolgen, zum anderen diese Analyse darüber hinaus auch kontinuierlich vorzunehmen, um Problementwicklungen und –verläufe zeitnah studieren und aus diesem Untersuchungsprozess Konsequenzen ziehen zu können. Im Mittelpunkt solcher Analysen steht im allgemeinen neben der möglichst detaillierten Beschreibung der Phänomene die Fahndung nach den Problemursachen. Auf diesem Feld werden vor allem die Politikwissenschaft, die Soziologie, die Psychologie und die Erziehungswissenschaft herausgefordert. Die erziehungswissenschaftliche Forschung sieht sich allerdings (noch) stärker als die anderen genannten Disziplinen unter Anwendungsdruck, zumal sie bislang kaum durch eine im Rahmen einer eigenständigen Disziplin verortete, praxisorientierte sozialarbeitswissenschaftliche Forschung entlastet wird. Sie wird von Seiten der Öffentlichkeit unausweichlich mit der Erwartung konfrontiert, nicht bei Phänomenographie und Hintergrundanalyse stehen zu bleiben, sondern darüber hinaus praxisorientierte Schlussfolgerungen für die Arbeitsbereiche der Pädagogik und der Sozialen Arbeit zu ziehen. Mehr noch: Dem Kern ihres Aufgabenfelds wird auch die Analyse der pädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis selbst zugewiesen. Allerdings lässt schon ein oberflächlicher Blick auf die empirischen Forschungsaktivitäten der Erziehungswissenschaft zum Themenbereich von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt deutlich werden, dass dieser zuletzt genannte Funktionsaspekt innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre augenscheinlich deutlich vernachlässigt wurde. Themenbezogene erziehungswissenschaftliche Studien wurden meist als Sozialisationsforschung bzw. als eine Art von Erziehungs- und Bildungssoziologie angelegt. Dies hat zur Folge, dass disziplinäre Abgrenzungen verschwinden und weitgesteckte Kongruenzflächen mit Forschungsfragen, -inhalten und -anlagen anderer Disziplinen zu Stande kommen. Man muss in dem zuletzt genannten Umstand keinen prinzipiellen Mangel erblicken. Zusammen mit der o.g. kritischen Sicht auf eine vereinseitigende, nämlich ursachenanalytische Schwerpunktsetzung der erziehungswissenschaftlichen Forschung, die im übrigen zudem noch weitgehend Antworten auf die pädagogisch vermutlich viel weiter führende Fragestellung nach den Bedingungen von Gewaltfreiheit, nicht fremdenfeindlichem bzw. nicht rechtsextremem, demokratischem Denken und Handeln oder auch nach Distanz(ierungsfaktoren) von antidemokratischer Positionierung und positiven Integrationsfaktoren schuldig bleibt, führt er aber doch in Bezug auf die Anlage dieser Expertise im Kontext der interdisziplinären Kooperation mit den anderen Expertisen zum Forschungsverbund dazu, eine Fokussierung auf die pädagogische und sozialarbeiterische Praxis vorzunehmen. Konkret: Bezogen auf die Einleitungsfrage untersucht die vorliegende Studie das, was in den entsprechenden professionellen Arbeitsfeldern getan wird, um Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt entgegenzutreten bzw. abzubauen, Anerkennungszerfall zu verhindern und Integrationspotenziale zu stärken. Neben dem damit kurz angerissenen wissenschaftlichen Ausgangspunkt liegt ein praxisbezogener Ausgangspunkt darin, dass die öffentlichen und wissenschaftlichen Debatten über die Phänomene von Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit sowie die in 6 ihrem Kontext entwickelten Bearbeitungsperspektiven der praktischen Pädagogik bzw. der Sozialen Arbeit von je her herausragende Rollen bei der Beeinflussung dieser Problemlagen zuweisen. Dies gilt nicht nur für den Diskurs über pädagogisch zu verantwortende Ursachen z.B. in Elternhaus und Schule, sondern auch und vor allem für angestrebte Problemlösungen, für die Entwicklung von geeigneten Antworten auf Prozesse des Anerkennungszerfalls und der sozialen Desintegration im Hintergrund der genannten Problematiken sowie für Versuche einer Stärkung von gesellschaftlichen Integrationspotenzialen. Im Zuge der aktuellen Diskussionen um Rechtsextremismus und Gewalt sind in den Bereichen von Pädagogik und Sozialer Arbeit - auch in Reaktion auf solche Erwartungshaltungen - seit Ende der 80er Jahre verstärkt neue Ansätze entwickelt worden. Sie haben eine mittlerweile kaum noch zu überblickende Vielfalt von Strategien, Konzepten, Programmen, Projekten, Maßnahmen, Unterrichtseinheiten und Initiativen produziert. So erfreulich ihre Fülle sein mag, so stellt sich doch auch die Frage nach der Passgenauigkeit, der inneren Logik, dem konkreten Nutzen und der jeweiligen Reichweite der Ansätze. Die grob umrissenen Untersuchungsbereiche dieser Expertise werden daher durch die Fragen markiert: Wo werden welche pädagogischen und sozialarbeiterischen Ansätze verfolgt? Inwieweit sind sie auf den aktuellen themenspezifischen wissenschaftlichen Erkenntnisstand bezogen? Liegen brauchbare und perspektivengenerierende Evaluationen vor oder sind sie zumindest beabsichtigt oder in Planung? Und: Welche Erkenntnisbedarfe ergeben sich aus der Sicht und dem Entwicklungsstand der pädagogischen bzw. sozialarbeiterischen Praxis und wie könnte sie mithin von dem angestrebten Forschungsverbund profitieren? Das aus den skizzierten Ausgangspunkten abgeleitete Hauptziel der Expertise ist mithin die Erstellung einer kritischen Bestandsaufnahme existierender pädagogischer und sozialarbeiterischer Ansätze der Bearbeitung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt im Rahmen der Intention der Stärkung von Integrationspotenzialen. Teilziele sind die Sichtung politischer Programme und staatlich initiierter Aktivitäten, die auf Bundesund Länderebene existieren, die Eruierung der arbeitsfeldübergreifend registrierbaren Grundzüge pädagogischer und sozialarbeiterischer Herangehensweisen an den Problemkomplex, die Deskription der wichtigsten professionstypischen Praxiskonzepte, dabei die Prüfung dieser konzeptionellen Ansätze im Hinblick auf ihren Bezug zu grundlegenden und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie in Hinsicht auf praxisorientierende Forschungsbedarfe, die Erhebung des Stellenwerts und des konkreten Standes der Evaluation der Ansätze sowie die Bewertung der Themen des geplanten Projektverbundes vor dem Hintergrund der o.a. Analysen. Wie leicht ersichtlich, sind die zeitlichen und materiellen Rahmenbedingungen für die Erstellung dieser Expertise nicht geeignet, wissenschaftliche Evaluationen entsprechender Programme und Handlungsansätze selbst vorzunehmen. Eine quantitativ-repräsentative Anlage von Befragungen war im zur Verfügung stehenden Zeitraum und bei begrenzten finanziellen Ressourcen eben so wenig realisierbar wie eine den hohen Ansprüchen qualitativer Forschung Genüge leistende systematische und längerfristige Erhebungs- und Auswertungsarbeit. 7 Die Expertise erzielt daher ihren Erkenntnisgewinn auf der Basis einer eigenständigen, zeitlich kompakten, gründlichen und gut strukturierten Recherche. Sie stützt sich in ihrer Vorgehensweise schwerpunktmäßig auf: die Auswertung themenrelevanter wissenschaftlicher Literatur, die Auswertung von verschriftlichten praxisorientierten Strategiediskussionen, insbesondere aber von Konzept-, Programm-, Projekt-, Maßnahmen- und Initiativdarstellungen sowie von Bildungs- und Unterrichtseinheiten, die Recherche bei ausgewählten Einrichtungen und Initiativen vor Ort und Gespräche mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, den interdisziplinären Austausch und die interdisziplinäre Beratung mit Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsextremismus-, Gewalt- und Integrationsforschung sowie der Evaluationsforschung und Internet-Recherche. Sind somit einleitend knapp die Ausgangspunkte, wichtigsten Ziele und zentralen Inhalte der Expertise sowie die Vorgehensweise bei ihrer Erstellung umrissen, so werden in einem ersten Kapitel die wichtigsten politischen Programme mit pädagogischer und/oder sozialarbeiterischer Orientierung erörtert, die von Bund und Ländern aufgelegt wurden und noch aktuell wirksam sind (1.). Soweit die Länder keine speziellen Programme besitzen, werden zumindest die Grundzüge der von ihnen mittels politischer Entscheidungen und Rahmensetzungen geprägten Ausrichtungen von Aktivitäten markiert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass pädagogische und sozialarbeiterische Maßnahmen und Projekte in ihrer Ausrichtung ganz erheblich (Förderungs-)Vorgaben der öffentlichen Hand folgen (müssen) und daher in bedeutendem Maße von diesen mitkonturiert werden. Sie stellen insofern einen unübersehbar wichtigen Aspekt aus der Praxis heraus kaum oder schwer zu beeinflussender politischer Strukturbedingungen pädagogischen/sozialarbeiterischen Handelns dar. Das zweite Kapitel markiert allgemeine pädagogische und sozialarbeiterische Grundlagen, auf die sich Aktivitäten der professionellen Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt explizit oder (zumeist) implizit beziehen (2.). Es beschreitet dabei den Weg vom Abstrakten zum Konkreten und bereitet damit die Darlegung und kritische Diskussion einzelner Konzepte im anschließenden Hauptkapitel vor. Um basale disziplinäre und professionsbezogene Denk- und Herangehensweisen offen zu legen, in die die Aktivitäten eingebettet sind, werden zum ersten die fundamentalen Paradigmen skizziert, auf denen entsprechende Ansätze beruhen (2.1). Zum zweiten werden die richtungsweisenden Strategien benannt, die mit diesen Diskurskontexten in Verbindung stehen (2.2). Zum dritten wird geklärt, in welche konkreten Angebotsformate pädagogische und sozialarbeiterische Strategien gegossen werden (2.3). Praktische Pädagogik und Soziale Arbeit erhalten ihre wissenschaftliche Unterfütterung im wesentlichen durch die zentralen Bezugsdisziplinen der Erziehungs- wie Sozialarbeitswissenschaft. Beide sind als Handlungswissenschaften konzipiert, so dass das Theorie-Praxis-Verhältnis zur Klärung ansteht (2.4). Insofern sich professionelle pädagogische und soziale Praxis einer Bewertung unterziehen müssen, ist zu klären, was unter einer wissenschaftlichen Standards genügenden Evaluation zu verstehen ist (2.5). Nachdem so ein allgemeiner Überblick über die Typen und wichtigsten Bezugspunkte pädagogischen/sozialarbeiterischen Handelns innerhalb des hier vorrangig interessierenden Handlungsbereichs verschafft wurde, werden Grenzziehungen vorgenommen, die aus fachlicher Sicht erforderlich sind (2.6). 8 Kapitel 3 bildet das Zentrum der vorliegenden Arbeit (3.). Hier werden die Konzepte der pädagogischen und sozialarbeiterischen Bearbeitung von Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit sowie die darin aufscheinenden Absichten der in diesem Kontext angestrebten Stärkung von Integrationspotenzialen erörtert. Alltagssprachlich formuliert finden sich hier Antworten auf die Fragebatterie: Was wird von wem, seit wann, wo, für wen, ggf. mit wem, auf welcher Analysebasis, unter welchen Rahmenbedingungen, mit welcher Zielsetzung, wie, mit welchem Erfolg und bei welchen Erfolgskriterien und Prüfindikatoren angeboten? Es wird also vor allem jeweils sowohl – in Erweiterung der bekannten Konzeptdefinition von Geißler/Hege (1978) - der sinnhafte Zusammenhang von Ausgangsanalyse, Zielen, Zielgruppen, Inhalten, Methoden und Rahmenbedingungen offen gelegt und geprüft, als auch – hierbei aktuelleren Überlegungen zu (sozial)pädagogischen/ arbeiterischen Konzeptentwicklungen folgend (vgl. z. B. Deinet 1999, Deinet/Sturzenhecker 1996) – der Gesichtspunkt der Evaluation der Konzepte berücksichtigt. Es soll keine bloße Addition mehr oder minder zufällig ausgewählter Projekt- und Maßnahmenbeschreibungen erfolgen. Ebenso wenig soll die Angebotspalette, die Leistungsfähigkeit oder gar ein Versagen bestimmter Träger ins Licht gerückt werden. Vielmehr wird im Endergebnis eine Übersicht über allgemeine konzeptionelle Tendenzen im jeweiligen Arbeitsfeld geliefert. Nicht zuletzt um die Anschlussfähigkeit an die anderen (soziologischen, psychologischen und politikwissenschaftlichen) Expertisen sicherzustellen, wird insbesondere dabei auch neben den schon genannten Konzeptionsfaktoren auf die Bearbeitung der Aspekte von Hintergrundsprozessen für Anerkennungszerfall und Flucht in die Gewalt, sozialräumlichen Kontextbedingungen, Interaktionsprozessen und Interaktionsdynamiken, biographischen Komponenten und Verläufen sowie der Bedeutung von Wissen, Information und Bildung geachtet. Dabei werden auch eventuelle innerdeutsche Ost-West-Differenzen untersucht. Ein weiteres Kapitel (4.) bezieht die erarbeiteten Erkenntnisse auf den angestrebten Forschungsverbund. Geklärt wird, inwieweit seine Anlage versprechen kann, bestehende Forschungslücken aufzuarbeiten und wichtige Forschungsdesiderate anzugehen. Außerdem werden weiterreichendere Forschungsbedarfe aus der Perspektive der vorgenommenen Analyse pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxis benannt. In der Umsetzung von Resultaten dieser Expertise wäre zu prüfen, inwieweit sie u.U. durch ergänzende Projekte im Forschungsverbund selber oder an ihn angelagert aufzuarbeiten sind. Das Schlusskapitel (5.) liefert eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Argumente und Erkenntnisse. Das Literaturverzeichnis (6.) führt nur die im Text verwendeten Schriften, ein weiteres Verzeichnis (7.) die benutzten Internetadressen an. Der folgenden Anhang (8.) enthält eine kommentierte Zusammenstellung der interessantesten Internetadressen zum Thema.1 1 Die Gliederung der Expertise weicht z.T. vom Expertisen-Exposé ab. Dies ist eine Konsequenz aus den im Verlaufe ihrer Erarbeitung angestellten Recherchen. Vor allem zwei Änderungen wurden erforderlich: Zum einen zeigte sich, dass die gegenwärtige Projektelandschaft deutlich von politischen Programmen bestimmt wird. Folge dessen ist, dass ein thematisch entsprechend ausgerichtetes Kapitel (1.) zusätzlich aufgenommen wurde. Zum anderen erwies sich eine eindeutig abgrenzbare Zuordnung von Praxiskonzepten zu den unterschiedlichen pädagogischen bzw. sozialarbeiterischen Handlungsfeldern in der ursprünglich angedachten Differenzierung als kaum möglich und letztlich wenig sinnvoll, weil in jüngster Zeit eine Reihe von Konzepten immer stärker über ihre angestammten Handlungsfelder hinaus neue Adaptionen finden (z.B. das in Kap. 3.1.2 erörterte BetzavtaKonzept oder das in Kap. 3.1.11 diskutierte Anti-Aggressivitäts-Training) und insgesamt 9 arbeitsfeldübergreifende Ansätze an Bedeutung zunehmen; nicht zuletzt auch deshalb weil die Förderprogramme auf Kooperation, Vernetzung und Methodenvielfalt Wert legen. 10 1. Politische Programme mit pädagogischer bzw. sozialarbeiterischer Ausrichtung Pädagogische und sozialarbeiterische Praxis existieren prinzipiell nicht im luftleeren Raum. Ganz wesentlich sind ihre Aktivitäten u.a. von den politischen Rahmenbedingungen abhängig, die ihnen gewährt werden. Entwicklungen in (sozial)pädagogischen/-arbeiterischen Feldern zeigen sich deshalb - ähnlich wie diejenigen im zivilgesellschaftlichen Bereich – neben dem Angebot, das von Stiftungen ausgeht, auch im allgemeinen erheblich von den jeweiligen programmatischen Ausrichtungen und den ihnen folgenden finanziellen Mittelangeboten und -vergabekriterien der politischen Entscheidungsträger beeinflusst. Dies betrifft sowohl ihre Inhalte und ihren Umfang als auch ihre zeitliche Struktur, weil einschlägige Einrichtungen und Initiativen wie ihre Maßnahmen und Projekte im Regelfall auf die (Mit-)Finanzierung durch öffentliche Gelder angewiesen sind. Insofern müssen auch die pädagogischen bzw. sozialarbeiterischen Bearbeitungsweisen von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit vor diesem Hintergrund betrachtet werden. Dies gilt umso mehr als in den vergangenen Jahren verschiedene thematisch einschlägige Sonderprogramme aufgelegt wurden und auch in ihrem Rahmen in jüngerer Zeit deutlich mehr Gewicht auf Evaluation gelegt wird. Im folgenden sollen die wichtigsten politischen Vorgaben und Programme zentriert auf die Bundes- und Länderebene erörtert werden. Da im Rahmen dieser Expertise keine historische Darstellung beabsichtigt sein kann, beschränken wir uns dabei auf entsprechende aktuelle Entwicklungen.2 2 Interessant wäre sicher auch eine Sichtung derjenigen Ansätze, die im gesellschaftlichen Raum von Unternehmen, Gewerkschaften, Kirchen, Stiftungen u.ä. gesellschaftlich relevanten Gruppierungen bzw. Einrichtungen angeregt oder umgesetzt wurden und werden. Im Rahmen dieser Expertise kann dies nicht systematisch erfolgen. Beispiele finden sich aber im Umfeld des Beschlusses der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zur "Dekade zur Überwindung von Gewalt" (vgl. exemplarisch www.oekumene-ack.de; www.renovabis.de; www.wcc-coe.org; www.christen-und-juden.de, www.basta-net.de/aktionen/aktionen3.html, www.paritaet.org/via/kjp-sind.htm), beim Verein "Gesicht zeigen!", der im August 2000 auf Initiative prominenter PolitikerInnen gegründet wurde und neben Wettbewerben, Kampagnen und Demonstrationen auch ein sehr informatives und praxisnahes "Handbuch für Zivilcourage" (2001) gemacht hat (vgl. auch www.gesichtzeigen.de), bei der "Aktion Courage" (vgl. www.aktioncourage.org und deren Aktion "Schule ohne Rassismus"; vgl. dazu aber auch Kap. 3.1.5), besonders ungewöhnlich bei den Initiativen "Kochen gegen rechts" (www.howru.de) und "Saufen gegen rechts" (vgl. www.saufengegenrechts.de), der "stern"-Initiative "Mut gegen rechte Gewalt", die u.a. mit 1 Mio. DM "exit" Deutschland finanziert (vgl. dazu auch Kap. 3.1.15), in Broschüren wie Arbeiterwohlfahrt 2001, DGB 2000, 2001, Ver.di 2001, EUMC 2001, 80f., in den 2002 herausgegebenen Materialien der IG Bauen – Agrar – Umwelt für den Berufsschulunterricht oder unter Internetadressen über Gewerkschafts- bzw. Unternehmensinitiativen wie www.fassmichnichtan.de, www.itunternehmen-gegen-r...e, www.naiin.de; vgl. außerdem Muster für Betriebsvereinbarungen in: Gesicht zeigen 2001, 46ff.; vgl. des Weiteren auch die "Migrationspolitischen Handreichungen" des DGB (1998) sowie Brüggeman/Riehle 2000 zu betrieblichen Strategien. Neuen 'drive' bekommt die Debatte durch die zur Verwirklichung des Art. 13 des Amsterdamer Vertrages von 1997 verabschiedeten EG-Richtlinien 2000/43 "zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft" vom 29.06.2000 bzw. 2000/78 "zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf" vom 27.11.2000 sowie durch das "Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen" (2001-2006). Die neuen Regelungen auf europäischer Ebene definieren u.a. rassistische und ethnische Diskriminierungen näher, sehen eine Beweislastumkehrung, Ombudsleute bzw. die Einrichtung von AntiDiskriminierungsstellen in den Mitgliedsstaaten vor und eröffnen die Möglichkeit zu einer Normbereinigung, die zu prüfen gestattet, inwieweit unterschiedliche Behandlungen von Personen aus Gründen der Staatsangehörigkeit noch angebracht sind Die Richtlinien müssen bis Juli bzw. Dezember 2003 von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat dementsprechend bereits im Dezember 2001 einen Gesetzentwurf für ein Anti-Diskriminierungsgesetz vorgelegt, das das Verbot von Diskriminierung auch zivilrechtlich regeln soll. Erste Reaktionen der Anti-Diskriminierungsarbeit begrüßen grundsätzlich die Initiative zu einem Anti-Diskrimierungsgesetz, halten die im Entwurf vorgesehenen Regelungen aber mit Verweis auf weitergehende Gesetze in anderen europäischen Ländern für unzureichend. Vor allem wird gefordert, ein 11 1.1 Programme des Bundes Im Zentrum der politischen Bemühungen der sozialdemokratisch-grünen Bundesregierung zur Eindämmung bzw. zum Abbau von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsextremismus steht das im Jahre 2001 in Kraft gesetzte Programm "Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus". Sie antwortete damit auf eine Welle der Rechtsextremismus-Debatte, die aus verschiedenen Gründen seit Mitte der 90er Jahre bedrohlich auflief. Zu ihnen gehören: der wachsende Zulauf Jugendlicher zu rechtsextremen Parteien, die Verbreitung von sog. "Kameradschaften", die Versuche Rechtsextremer, zunächst im lokalen Umfeld – vorwiegend in Ostdeutschland - politisch-kulturelle Hegemonie über die Herstellung "national befreiter Zonen" auszuüben, innovative und gleichzeitig schwer kontrollierbare Verbreitungsformen rechtsextremer Musik und Propaganda über das Internet und enorme Wahlerfolge der rechtsextremen DVU bei der sachsen-anhaltinischen Landtagswahl im April 1998. Die einschlägige Diskussion schwoll nach ihrem zwischenzeitlichen Abebben durch die Anschläge im Sommer des Jahres 2000, die neuerliche Rekordmarke von rd. 15.000 Straftaten rechtsextremer Kontur im gleichen Jahr, die nach Verfassungsschutzrecherchen registrierbare starke Zunahme gewaltbereiter Rechtsextremisten und die auf sie folgende NPD-Verbots-Diskussion so weit an, dass politische Reaktionen nicht ausbleiben konnten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem noch von der konservativ-liberalen Bundesregierung zwischen 1992 und 1996 aufgelegten "Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt" (AgAG), das auf die erste Phase der seit Ende der 80er Jahre, verschärft aber später durch die gewaltsamen Fanaltaten von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen ausgelösten Debatte reagierte, ist das neue Programm insgesamt nicht nur auf den Osten, sondern auf ganz Deutschland bezogen. Insofern ist es auch weniger als AgAG mit der allgemeinen Zielsetzung belastet, nicht-staatliche Jugendhilfestrukturen auf dem Gebiet der in dieser Hinsicht Anfang der 90er Jahre unverkennbar unterentwickelten ehemaligen DDR aufzubauen. War das alte Sonderprogramm außerdem noch auf die Problematik von physischer Gewalt zugeschnitten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um politisch konturierte rechtsextreme oder linksextreme oder sich unpolitisch verstehende Violenz handelte, so ist das neue Programm spezifischer auf die der Demokratie drohenden 'Gefahr von rechts' bezogen. Die von ihm entfalteten Aktivitäten können deshalb auch breiter Mentalitäten, Einstellungen und Haltungen zum Gegenstand machen, die 'unterhalb' der Aufmerksamkeitsschwelle liegen, die für politische Gewaltsamkeit gilt. Es geht insgesamt von der Einschätzung aus, dass Extremismus kein bloßes Randproblem der deutschen Gesellschaft darstellt, bei seiner Bekämpfung daher neben Repression vom Bund Normbereinigungsverfahren in den verschiedenen Rechtsbereichen zu beginnen, die Aufnahme konkreter Diskriminierungstatbestände in das Strafrecht vorzunehmen und eine ausreichend starke Sanktionierung entsprechender Delikte sowie insbesondere die gesetzliche Verankerung und flächendeckende Einrichtung von Anti-Diskriminierungsstellen, denen auch Verbandsklagekompetenz eingeräumt werden soll, bzw. die Einrichtung von Stellen mit Ombudsfunktion vorzunehmen (vgl. zu diesem Komplex: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 180/22-26, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 303/16-22; Forum gegen Rassismus/Nationaler Runder Tisch, Arbeitsgruppe Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung 2001; Netz gegen Rassismus, für gleiche Rechte 2000, 2001; Stellungnahme der Antidiskriminierungsiniativen aus NRW zum Gesetzesentwurf zur Verhinderung von Diskriminierungen im Zivilrecht vom 10.12.2001in: www.nrwgegendiskriminierung.de sowie Kap. 3.1.17). 12 über die Länder bis zu den Kommunen ein integriertes Vorgehen von Wirtschafts-, Sozial-, Arbeitsmarkt-, Kinder-, Jugend-, Familien-, Bildungs-, Kultur- und Medienpolitik erforderlich und das Engagement gesellschaftlich relevanter Gruppen zu fördern ist. Dabei wird explizit eine präventive Jugendarbeit priorisiert und sowohl die politische (offenbar weniger die pädagogische) Auseinandersetzung mit offensichtlichen Problemgruppen als auch die Unterstützung zivilen Engagements bei Jugendlichen, die rechtsextremen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Auffassungen fern- und entgegenstehen, intendiert. Das Programm ergänzt bisherige Fördermöglichkeiten der Prävention von Gewalt und Rechtsextremismus, die z.B. im Rahmen des Kinder- und Jugendplanes des Bundes, Projekten der Ausländer- und Aussiedlerintegration, Programmen der Jugendsozialarbeit oder des Programms "Soziale Stadt" gegeben waren/sind. Es hatte 2001 drei Teile (eingehender vgl. www.bmfsfj.de/dokumente/Struktur/ix_28765.htm und Xenos 2001), die inzwischen etwas verändert worden sind: In einem ersten Programmteil werden unter dem Titel "Xenos" – Leben und Arbeiten in Vielfalt" bis zum Jahre 2006 Projekte gefördert, die sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft richten und die das gemeinsame Lernen und Arbeiten von Deutschen und Nicht-Deutschen unterstützen (die ersten 98 Projekte werden seit kurzem in Kurzbeschreibung auf der Website www.xenos-d.de vorgestellt). Der Arbeitsmarktbezug der Projekte ist dabei ein Muss. Insbesondere sollen zivilgesellschaftliche Strukturen und lokale Kooperationen und Partnerschaften gestärkt werden. Dazu sind Förderschwerpunkte in den folgenden Bereichen vorgesehen: "Integrierte lokale Projekte, mobile Beratungsteams, Expertenpools und Kleinprojekte", "Qualifizierung von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen", "Maßnahmen in Schule, Beruf und Betrieb" sowie "Information und Sensibilisierung". Es standen/stehen 2001 25 Mio. DM, danach 25,56 Mio. Euro jährlich aus dem Europäischen Sozialfonds dafür zur Verfügung. Länder, Kommunen, die Bundesanstalt für Arbeit oder Träger bzw. TeilnehmerInnen müssen eine Kofinanzierung in gleicher Höhe aufbringen (Ausnahme Kleinprojekte bis 10.000 Euro). Die technisch-administrative Umsetzung liegt z.Zt. noch in den Händen des Bonner "Europabüros für Projektbegleitung GmbH" (efp). Ein Mitarbeiter von efp beziffert die Zahl der Projektanträge, die Evaluationen vorsehen, auf 10% bis 20%. Ihr Volumen schwankt danach in einer Marge, die im Schwerpunkt zwischen 8.000 einerseits und 30.000 bis 50.000 Euro andererseits liegt. Genauere Kenntnisse liegen nicht vor. Offiziell aufgrund vergaberechtlicher Unzulässigkeiten in der Vertragsgestaltung zwischen BMA und efp, die von europäischer Ebene moniert worden waren, hat das BMA zum 30.06.2002 allerdings alle Verträge mit efp gekündigt (vgl. dazu die Informationen unter www.xenos-d.de). Das Arbeitsministerium wird nun die Abwicklung selber durchführen. In Teil 2 waren – einmalig für 2001 in den Kinder- und Jugendplan des Bundes eingestellt und deshalb als Anschubfinanzierung oder für kurzfristige Projekte gedacht – Gelder für "Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus" ausgewiesen worden, die grundsätzlich nicht als Kofinanzierung für das Xenos-Programm in Frage kamen. Die insgesamt 30 Mio. DM untergliedern sich in 15 Mio. DM, die für Politische Bildung nach dem sog. "Königssteiner Schlüssel" an die Länder verteilt werden, 5 Mio. DM für die Implementierung lokaler Aktionspläne gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenhass im Rahmen der Programmplattform "Entwicklung 13 und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten" mit insgesamt 60 geförderten Jugendämtern, 6 Mio. DM für Maßnahmen der bundeszentralen Träger der Jugendbildung und 4 Mio. DM für die Finanzierung von modellhaften Projekten von bundesweiter Bedeutung. Maßnahmebereiche lagen vorrangig in drei Feldern: Maßnahmen mit medialer Breitenwirkung, Unterstützung der Jugendbildungsarbeit und Initiierung von (kommunalem) Engagement. Nahezu 1600 Projekte konnten unterstützt werden, bei Dominanz von Kleinprojekten mit weniger als 10.000 DM. Nur eine Handvoll von ihnen hat eine evaluative Begleitung vorgesehen; Berichte darüber liegen allerdings noch nicht vor. Eine Programmdokumentation nimmt die Leipziger Arbeitsstelle des Deutschen Jugendinstituts vor. Der Abschlussbericht wird Ende April 2002 vorliegen. Eine Datenbank (MaReG) mit Kurzbeschreibungen von z.Zt. rd. 1000 dieser Projekte und good-practice-Beispielen (letztere ab Frühjahr 2002 ausgewähltt) ist seit Anfang des Jahres 2002 unter www.dji.de (Button 'Projekte gegen Rechts') im Internet aufzurufen. Der dritte Teil besteht aus dem Teil-Programm "civitas – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern" (2001: 10 Mio. DM). Wie der Name schon sagt, ist es nur auf die Gebiete der ehemaligen DDR bezogen. Es dient der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus durch eine Stärkung der demokratischen Kultur und die Förderung von Modellprojekten zur Beratung, Ausbildung und Unterstützung von Initiativen gegen Rechtsextremismus (2001: 5 Mio. DM) sowie zur Beratung von faktischen oder potenziellen Opfern rechtsextremer Straftaten (2001: 5 Mio. DM). Das Programm soll zur Stabilisierung und Weiterentwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen im Gemeinwesen beitragen, weil Demokratisierungsprozesse als von ihnen abhängig betrachtet werden. Es soll ferner die Professionalisierung von Beratungsstrukturen vorantreiben. Die Förderbereiche erstrecken sich auf Mobile Beratungsteams (insgesamt sechs mit jeweils zwischen 200.000 und 300.000 DM p.a. Fördersumme; inhaltlich dazu siehe Kap. 3.1.14), die Beratung von Opfern bzw. potenziellen Opfern (acht Stellen, ihre dezentralen Untergliederungen nicht gerechnet, mit pro Stelle ähnlich hoher Förderung) und Hilfen für örtliche Initiativen (jeweils 1.000 bis 50.000 DM für z.Zt. 321, z.T. auch nur eintägige Projekte) sowie den Aufbau von Vernetzungsstrukturen. Geförderte Projekte sind mit Angaben zu Namen, Antragstellern, Orten und Datum der Förderentscheidungen im Internet unter www.jugendstiftung-civitas.de (Button Förderprojekte) aufzurufen. Anträge können eine Laufzeit bis zu 3 Jahren vorsehen. Mit der Umsetzung des Programms ist eine Servicestelle betraut, die gemeinsam von der "Stiftung Demokratische Jugend" und der "Amadeu-Antonio-Stiftung" getragen wird. Sie soll auch Ergebnisse und Erfahrungen auswerten und dokumentieren. Die beiden Stiftungen entscheiden unter Hinzuziehung eines Programmbeirats über die Bewilligung von Anträgen. Eine evaluative wissenschaftliche Begleitung des Programms ist vorgesehen, für 2001 vergeben und mit einem formativ-prozessorientierten Selbstverständnis versehen (vgl. 14 Rommelspacher u.a. 2002). Evaluationen einzelner Maßnahmen sind sehr selten, weil sie auch kaum beantragt wurden. Es scheint z.Zt. nicht ganz klar zu sein, inwieweit die Evaluation des Gesamtprogramms auch die Evaluation der einzelnen MBTs, Opferberatungsstellen und zivilgesellschaftlichen Projekte abzudecken vermag. Im gesellschaftlichen Raum ergänzt die "AG Netzwerke gegen Rechtsextremismus" die Stärkung demokratischer Strukturen in den Neuen Bundesländern. In ihr haben sich seit 2000 die "Amadeu-Antonio-Stiftung", das "Anne Frank Zentrum", die Vereine "Gegen Vergessen – Für Demokratie" e.V., "Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt" e.V. und das "Netzwerk für Demokratie und Courage" e.V. sowie die "Stiftung Demokratische Jugend" und das "Zentrum Demokratische Kultur" zusammengeschlossen. Für das Jahr 2002 ist das Programm "Jugend für Toleranz und Demokratie" verändert worden: Den ehemaligen Teil 2 ersetzt das Teil-Programm "entimon" (altgriechisch: "Würde", "Respekt"). Hier werden 10 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Sie konzentrieren sich ebenfalls auf Maßnahmen der politischen Bildung. Eine wissenschaftliche Begleitung – weiterhin dokumentarisch und nicht evaluativ angelegt – wird wie beim ehemaligen Teil 2 (2001) von der Leipziger Arbeitsstelle des DJI durchgeführt. "Civitas" wird wie "Xenos" weitergeführt und auf 10 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Förderschwerpunkte bleiben dieselben. Für Evaluation sollen in 2001 rund 250.000 Euro zur Verfügung stehen. Eine Ausschreibung dafür ist Ende Februar erfolgt. Weitere Fördermaßnahmen von Projekten der Rechtsextremismusbekämpfung sind, abgesehen von dem schon laufenden "Odysseus", ein Programm der EU, das mit einem Gesamtvolumen von 12 Mio. Euro für die Jahre 1998-2002 Zuschüsse für Aus- und Fortbildung, Austausch, Studien- und Forschungsarbeiten und Informationsverarbeitung bis zur Höchstförderungsgrenze von 60% in den Themenbereichen Asyl und Einwanderung in Aussicht stellt – ebenfalls arbeitsmarktorientiert – von "Equal", der Fortsetzung der von 19941999 gelaufenen Gemeinschaftsinitiativen "ADAPT" und "Beschäftigung", zu erwarten. Equal ist ein EU-Programm, das die Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Arbeitenden und Arbeitssuchenden bekämpfen will und dabei auf transnationale Entwicklungspartnerschaften setzt. Für 2000-2006 stehen europaweit 2,847 Mrd. Euro, davon 514,5 Mio. Euro für Deutschland, bereit. Die neun Schwerpunktbereiche sind in vier Paketen gegliedert: Erhöhung von Beschäftigungsfähigkeit (hier auch explizit: Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit), Entwicklung von Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit, Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie Unterstützung der Integration von Asylbewerbern (in Deutschland fließen 7% der Gelder in diesen Bereich). Die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus wird als Querschnittsaufgabe in allen Bereichen betrachtet. Als Koordinierungsstelle in Deutschland war ebenfalls die efp vorgesehen. Auch der auf Equal bezogene Vertrag ist aber zum 30.06.2002 gekündigt worden. Das Antrags- und Auswahlverfahren läuft noch. Transnationale Vereinbarungen sollen bis 01.04.2002 vorgelegt werden. Auf europäischer Ebene gehört außerdem das Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen zur Palette der Unterstützungsmöglichkeiten für Antirassismus-Arbeit. Für den Zeitraum von 2001-2006 beträgt das Budget 100 Mio. Euro. Mit ihm werden 3 Aktionsbereiche bearbeitet: die Analyse und Bewertung von Diskriminierungen (1.), die Entwicklung von Handlungskompetenzen zur Bekämpfung von Diskriminierungen (2.) und die Sensibilisierung für den Kampf gegen Diskriminierungen (3.). 15 Im gesellschaftlichen Raum haben sich auf Bundesebene mehrere Initiativen gegründet, die sich die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zum Ziel gesetzt haben. Das "Forum gegen Rassismus" bildet seit dem Jahre 2000 den nationalen Runden Tisch, über den auch andere Länder der EU verfügen. Ein "Bündnis für Demokratie und Toleranz" hat sich am 23. Mai 2000, dem Verfassungstag, gegründet. Von Regierungsseite aus angeregt und deshalb anfänglich teilweise als Ausfluss autoritärer Vorstellungen einer staatlich gelenkten Zivilgesellschaft verdächtigt, gehören ihm mittlerweile über 900 Gruppen und Einzelpersonen an (vgl. www.buendnis-toleranz.de). Derzeit ausgestattet mit einer Finanzierung von 1,3 Mio. DM sichtet und sammelt es Vorhaben und Vorschläge, beteiligt sich an Kampagnen, dokumentiert Beispiele bürgergesellschaftlichen Engagements und vernetzt, berät resp. unterstützt entsprechende Gruppen. Zuletzt hat es zur Sammlung von "best-practice"-Modellen aufgerufen und unter 270 Bewerbungen 40 Initiativen mit Preisen von insgesamt 200.000 DM ausgezeichnet. Zentraler Aktionstag für das Bündnis ist der 23. Mai, zu dem – bereits am Vortag – gut 300 einschlägig aktive Jugendliche aus ganz Deutschland eingeladen werden, um sich dort auf Diskussionsforen und kulturell-kreativ mit dem Thema auseinander zu setzen. In diesem Rahmen wird öffentlichkeitswirksam auch der Preis des "Botschafters der Toleranz" vergeben. Die Veranstaltung soll der öffentlichen Propagierung des Verfassungskonsenses dienen. Neuerdings tut das Bündnis kund, dass allerdings "mindestens genauso wichtig" wie diese "bisherigen Schwerpunkte" "die alltägliche Kleinarbeit" ist (www.buendnis-toleranz.de/Aufgaben-und-Ziele-.571.8206/.htm, 3). Mehr als anderen bundeszentralen oder bundesweit tätigen Trägern, auf die hier aus Platzgründen nicht im einzelnen eingegangen werden kann, fällt durch den Zuschnitt der Aufgaben auf politische Bildung der pädagogische Umgang mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit einerseits der Bundeszentrale für politische Bildung, andererseits "Gemini", dem Zusammenschluss der Träger politischer Jugendbildung auf Bundesebene zu. "Gemini" trat bspw. im Herbst 2001 mit Aktionswochen zur "Ermutigung zur Zivilcourage – gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit" hervor. Die Bundeszentrale hat nach internen Umstrukturierungen der Organisation 2001 eine Projektgruppe "Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt" eingerichtet. Sie investierte im Haushaltsjahr 2001 insgesamt 8,8 Mio. DM in a) Darstellungen und Analysen des Rechtsextremismus (ca. 20% der Summe), b) Unterstützungen von Handlungs- und Aktionsformen (ca. 50%) und c) Informationsangebote (ca. 30%). Die strategischen Grundlinien der Planung für 2002 sehen vor, vor allem solche Einzelprojekte zu unterstützen, die den "Aufstand der jungen Anständigen" direkt befördern, die Veranstaltungen dort zu platzieren, wo es faktische Berührungen mit rechtsradikalem Denken, Handeln oder mit entsprechenden Haltungen gibt und insofern innovativ zu wirken, als mit Zielgruppen und Zielsetzungen operiert wird, die anderenorts nicht berücksichtigt werden. Angezielt ist u.a. die Unterstützung beim Aufbau Mobiler Beratungsteams in Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, pädagogische Prävention im Jugendstrafvollzug und die Durchführung von Jugendkulturprojekten. Bisherige Erfahrungen mit den Programmen "Xenos" und "Civitas" können sich aufgrund der kurzen Existenzdauer der Programme noch nicht auf Evaluationen stützen. Bis heute ist eine Evaluation des "Xenos"-Programms noch nicht vergeben und liegt zu "civitas" nur ein unveröffentlichter Zwischenbericht sowie seit neuestem der Abschlussbericht zur Aufbauphase des Programms (vgl. Rommelspacher u.a. 2002) vor. Ein erster Erkenntnisgewinn ist daher nur auf der Basis einer zeitlich kompakten, explorativen Recherche zu erzielen. Sie stützt sich in ihrer Vorgehensweise neben der Auswertung themenrelevanter wissenschaftlicher Literatur und verschriftlichter praxisorientierter Strategiediskussionen auf Recherchen bei ausgewählten Einrichtungen und Initiativen vor Ort 16 und Gespräche mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie den interdisziplinären Austausch und die interdisziplinäre Beratung mit Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsextremismus-, Gewalt-, Integrations- und Evaluationsforschung. Perspektiven von PraktikerInnen auf die beiden Programme beinhalten danach jetzt schon Kritik am Bundesprogramm. Ihre Stichhaltigkeit kann hier nicht in jeder Hinsicht geklärt werden; erwähnt werden soll sie aber dennoch, da sie die Stimmungslage zu spiegeln scheint, die in der Praxis, oder zumindest größeren Teilen davon, herrscht. Sie zu ignorieren, hieße ihre Bearbeitung zu verunmöglichen. Bezüglich "Xenos" wird von manchen ExpertInnen bemängelt, dass man seitens der Bundesregierung hier Etikettenschwindel betreibe, weil der Öffentlichkeit suggeriert werde, es würden zusätzliche Mittel zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zur Verfügung gestellt. Tatsächlich jedoch liege nur eine neue thematische Akzentuierung bei der Vergabe von Fördergeldern vor, die seitens der EU ohnehin zur Verfügung gestellt worden wären. Des weiteren wird die mit der Herkunft der Mittel verknüpfte inhaltliche Bindung an arbeitsmarktorientierte Projekte als zu eng für eine breite Erschließung von Zielgruppen wahrgenommen. Die Kritik vermerkt, dass der unterstellte Zusammenhang von arbeitsmarktbezogener Deprivation und Rechtsextremismus bzw. Fremdenfeindlichkeit nicht so eindeutig sei wie die Anlage des Programms es unterstelle (vgl. auch Boehnke/Baier 2001, bes. 45f.). Diese Kritik relativiert sich indes, wenn man die geförderten Projekte etwas näher in Augenschein nimmt (vgl. www.xenos-d.de): Es findet sich eine Menge an Maßnahmen, die in Betrieben und auch außerhalb davon mit Auszubildenden, Facharbeitern und MultiplikatorInnen durchgeführt werden und bei denen durch die Förderungen bestimmte thematische Akzente im Sinne des Programms gesetzt werden können, auf die man ohne Sondermittel wohl hätte verzichten müssen. Moniert wird daneben, dass die Antragsbedingungen für kleinere Träger und Initiativen schwer zu durchschauen seien und diese deshalb von einem Einstieg in das Programm abgeschreckt würden (so etwa der Beirat des "Bündnisses für Demokratie und Toleranz" in einem Beschluss vom 02.04.2001). Die Bewilligungskriterien seien ebenfalls undurchsichtig. Schließlich wird z.T. auch die – inzwischen ja, wie erwähnt, gekündigte - Abwicklung über das efp für problematisch gehalten. Das Projektbüro scheint vielen im Verhältnis zu seiner sichtbaren Leistung als zu groß dimensioniert. In Rede stehende Overhead-Kosten von 10% der Programmmittel werden als unverhältnismäßig hoch eingeschätzt. Zudem wurde im Sommer/Herbst 2001 ein Antragsstau beklagt. Im Oktober 2001 lagen in der Tat 1.300 Anträge vor, war aber nicht einmal ein Zwanzigstel von ihnen bearbeitet. Inzwischen (Stand: 25.01.02) sind 117 Xenos-Projekte mit einem Fördervolumen von 32,22 Mio. Euro bewilligt, weitere 41 Projekte befinden sich im Prüfungsverfahren. In Hinsicht auf "civitas" liegen zum einen der o.e. Zwischenbericht (vgl. Zwischenbericht 2001) zum anderen der Bereicht der wissenschaftlichen Begleitung über die Aufbauphase von Juni – Dezember 2001 (vgl. Rommelspacher u.a. 2002) vor. Sie können nicht mehr als eine grobe Orientierung bieten, weil wegen der kurzen Laufzeit "Prozess-" und "Ergebnisqualität" noch nicht untersucht und die explizite Evaluationsabsicht der "Wirkungsanalyse und Erfolgskontrolle" (vgl. ebd., 2) noch nicht umgesetzt werden konnten. Als Ergebnisse einer Felderkundungsphase mit offenen Gruppengesprächen mit MitarbeiterInnen von geförderten Projekten in der Mobilen Beratung und bei Opferberatungsstellen und Fragebogen-Erhebungen bei diesen Projekten vor Ort wird zum einen positiv die Richtigkeit der Anlage des Programms herausgestellt. Die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen erweist sich nach Einschätzung der interviewten MitarbeiterInnen als eine sinnvollere Herangehensweise als die Konzentration auf soziale 17 Arbeit mit Problemgruppen. In diesem Bereich liegen auch die meisten Anträge vor (fast 50% von fast 600; Stand: November 2001). Es zeigt sich, dass die Antragszahl deutlich dort zunahm, wo Mobile Beratungsteams im Einsatz waren und Initialzündungen für die Mittelbeantragung sowie professionelle Hilfestellungen bei der formalen Antragstellung leisten konnten. Sie sind nun – wie auch Opferberatungsstellen - in allen neuen Ländern und Berlin eingerichtet. Während Einschätzungen zu lokalen Projekten wegen ihrer zumeist kurzen Laufzeiten und auf Gund des Einsetzens von Evaluationsbemühungen teilweise erst nach ihrem Abschluss schwierig zu sein scheinen, werden von den EvaluatorInnen erste Erfolge mit MBTs und Opferberatungsstellen berichtet. Sie liegen demnach "in erster Linie in einem gestiegenen Vertrauen der durch Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit betroffenen Menschen in die Arbeit der Projekte und in positiven Rückmeldungen von verschiedenen Kooperationspartnern. Sie zeigen sich aber in einer deutlichen Ausweitung der bestehenden Netzwerke und der Formierung zahlreicher neuer Bündnisse sowie einer kontinuierlich steigenden Anzahl von Anfragen für Fortbildungen durch die Projekte. Insgesamt konnten die Mitarbeiter/innen unter den Akteuren und Kooperationspartnern ein wachsendes Problembewusstsein für den Wert eines zivilgesellschaftlichen Zusammenlebens sowie für die Gefährdungen eines solchen wahrnehmen. Dieser Erfolg ist nach Einschätzung der Mitarbeiter/innen nicht zuletzt auf ihre Beratungstätigkeit zurückzuführen. Eine Wirkungsanalyse im Zuge der Projektevaluation sollte diese Einschätzungen fundieren und die Entwicklung anhand der damit benannten Erfolgskriterien überprüfen" (ebd., 131f.). Einerseits wird man in solchen Feststellungen wegen des schwierigen Umfelds, in dem sich die Projekte bewegen ("anhaltendes bzw. immer weiter anwachsendes Misstrauen in die demokratische, zivilgesellschaftliche Ordnung" als "vorherrschende Mentalität" in den neuen Bundesländern (ebd., 28) sowie MBT-feindliche Haltungen bzw. Ignorierungs- und Verharmlosungstendenzen bei den politischen Entscheidungsträgern (vgl. z.B. ebd. 27f., 36f.)), positive Signale erblicken können; andererseits sagen sie über konkrete extremismusreduzierende Effekte noch nichts aus. Ferner sind laut Zwischenbericht (2001) Probleme zu vermerken. Sie liegen zum ersten darin, dass viele Anträge qualitativ unzureichend sind. Speziell die Anträge im Bereich interkultureller Kompetenzförderung "zeugen" "von großer Unerfahrenheit", AusländerInnen werden hier eher "als Objekte betrachtet" (ebd., 5) und stereotypisiert. Auch aus dem Bereich von Schule und Schulumfeld kamen "wenig qualitativ wirklich gute Anträge" (ebd., 6). Zum zweiten führt die Komplexität der über "civitas" geförderten Arbeitsfelder leicht zu Überforderungen der MitarbeiterInnen. Zum dritten tritt die Schwierigkeit auf, geeignetes Personal rekrutieren zu können. Folge waren erhebliche Startverzögerungen (vgl. auch Rommelspacher u.a. 2002, 39, 43). Mit zunehmender Laufzeit zeigt sich zudem ein "großer Beratungsbedarf" zivilgesellschaftlicher Akteure, den zu befriedigen, die Personalkapazität der MBTs schon jetzt nicht ausreicht. Neben diesen Berichtserkenntnissen melden PraktikerInnen Kritik an. Nennenswert erscheint vor allem der Hinweis, dass das Civitas-Programm eine Handschrift trage, die deutlich bestimmte, im Umfeld der beteiligten Stiftungen vorhandene institutionelle Praxisinteressen mit den ihnen inhärenten inhaltlichen Präferenzen durchscheinen lasse. Dazu wird die tendenzielle Abwendung von der aufsuchenden Sozialen Arbeit mit rechten und rechtsextremen Jugendlichen gezählt. Fachkräfte in Leitungspositionen der Praxis vermissen wissenschaftliche Bezüge. Dies könne dazu führen, dass Praxis isoliert von wissenschaftlichen Debatten und Erkenntnissen relativ unreflektiert vor sich hin werkele, die einzelnen Maßnahmen ohne wissenschaftliche Begleitung und Beratung blieben und so ein Theorie-Praxis-Transfer unterbleibe, der 18 angesichts der Innovativität mancher Ansätze (z.B. Aufbau und Aktivierung zivilgesellschaftlicher Strukturen, Opferberatung) als besonders wichtig zu betrachten sei. Diese Perspektive erfährt durch die o.e. Bedarfe von MitarbeiterInnen nach theoretischer und sonstiger Fortbildung Verstärkung. Manchen ist auch unklar, inwieweit die im allgemeinen übliche personelle Trennung zwischen Angehörigen des Bewilligungsgremiums und dem Kreis der Antragsteller durchgehalten wird, scheint es ihnen doch so, als würden Stiftungs- bzw. Beiratsmitglieder zumindest in entscheidenden Rollen bei Organisationen, die Anträge stellen, mitarbeiten. Außerdem wird beklagt, dass insgesamt zu wenige Anträge einlaufen. Drei Gründe werden dafür vermutet: Zum ersten: Die Grundversorgung in den neuen Bundesländern fehlt, so dass in Einzelprojektförderung wenig Sinn gesehen wird und auch gar nicht in ähnlichem Umfang wie im Westen Deutschlands die MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen, die Anträge schreiben könnten; zum zweiten: Die Öffentlichkeitsarbeit für "civitas" hätte optimaler laufen können; zum dritten: Die Motivation, bei "Civitas" Anträge zu stellen, ist z.Zt. abgeflaut, weil man sich bereits in der Hoffnung auf eine zügige Bearbeitung und rasche Bewilligung von Xenos-Anträgen enttäuscht sieht. In Hinsicht auf Teil 2 des Programms "Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus" gibt immerhin der von Ende November 2001 stammende unveröffentlichte Zwischenbericht an das Bundesjugendministerium auf der Basis der Auswertung von Daten aus 45% der geförderten Projekte schon recht klare Tendenzen zu erkennen. Danach liegt der deutliche Schwerpunkt der Maßnahmentypen auf Seminaren, Workshops und Workcamps mit Kindern und Jugendlichen (45%) und Aktionstagen bzw. Projekten mit direkter öffentlicher Wirkung. (23,4%). Ausschließlich auf die Zielgruppe Kinder sind nur 2,7 %, zur Hälfte kulturpädagogische Konzepte, gerichtet. Über 80% beziehen aber in irgendeiner Weise Jugendliche mit ein. Meist handelt es sich um Bildungsmaßnahmen im engeren Sinne. Die Förderbereiche wurden also mit starker Gewichtung auf der Unterstützung der Jugendbildungsarbeit abgedeckt. Aktionstage und andere Projekte von öffentlicher Breitenwirkung nehmen etwa ein Fünftel der Maßnahmenanzahl ein. Lokale Aktionspläne, eigentlich ebenfalls als ein zentraler Förderungsbereich gedacht, tauchen nur zu 3% auf (vgl. exemplarisch für Mainz: Wink u.a. 2002). Methodisch dominieren vor dem interkulturellen und dem Konfliktlösungs-Ansatz mit jeweils gut 19% die bildungs- und kulturorientierten Ansätze (37,4% bzw. 27,4%). Der geschichtsorientierte Ansatz ist noch bei 11,3% der Projekte vertreten. Der geschlechtsspezifische Ansatz schneidet mit 3,6 % am schlechtesten ab, wobei noch zu bedenken ist, das ganze 2 Projekte der Arbeit mit Jungen bzw. jungen Männern galten. Ähnlich niedrig ist der Anteil geschlechtsreflektierender Ansätze im Bereich der MultiplikatorInnenschulungen, wo immerhin etwa ein Drittel der Angebote auf Ansätze zur gewaltfreien Konfliktlösung entfallen. Gezielt auf Haupt- und BerufsschülerInnen bezogene Projekte waren nur mit 8,8% vertreten. Auch hier steht etwa ein Drittel der Maßnahmen unter der Überschrift 'gewaltfreie Konfliktlösung'. Wie weit Projekte unmittelbar mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen arbeiten, wird nicht ersichtlich. Nach Auskunft von DJI-MitarbeiterInnen der Dokumentationsstelle gibt es sie nicht. Von der Zentrierung des Programms auf politische Bildung her ist eine solche Arbeit in diesem Rahmen aber auch nicht unbedingt erwartbar. Im gesamten Bundesprogramm wird eine Säule vermisst, die der Fortbildung der ProjektmitarbeiterInnen gewidmet ist, ähnlich wie dies im AgAG-Programm über den Informations-, Forschungs- und Fortbildungsdienst Jugendgewaltprävention (IFFJ) realisiert wurde (vgl. auch Heitmann 2002). 19 1.2 Programme und Aktivitäten der Länder Auf der Ebene der Bundesländer findet sich bei grundsätzlicher Einigkeit über die Notwendigkeit einer Doppelstrategie aus Repression und sozialarbeiterischen bzw. bildungsbezogenen Maßnahmen insgesamt eine Vielzahl an teilweise in Umfang und Schwerpunktsetzung deutlich differierenden Ansätzen und Programmen (vgl. im exemplarischen Überblick auch: Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 2001; zweiwochendienst Bildung/Wissenschaft/Forschung 13-14 u. 15/2000; KODEX: Kommunale Datenbank gegen Gewalt, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit unter www.kommunen-gegen-gewalt.de/DSTGB.asp mit z.Zt. 425 knapp skizzierten Projektbeispielen; Datenbank des Förderprogramms "Demokratie lernen" mit rd. 1.800 Projekten; Projekte, die für die allgemeine Gewaltprävention, dabei u.a. auch die Rechtsextremismus- und Fremdenfeindlichkeits-Bekämpfung als vorbildhaft eingeschätzt werden, finden sich auch unter www.kriminalpraevention.de des Deutschen Forums für Kriminalprävention zusammengestellt, vgl. auch BKA 2000; eine umfassende Zusammenstellung einzelner Maßnahmen der Länder wird zur Zeit vom Bundesinnenministerium vorbereitet und soll noch im Frühjahr der Öffentlichkeit zugänglich sein).3 Baden-Württemberg Baden-Württemberg geht zum einen – wie alle anderen Länder und der Bund auch – mit repressiven Maßnahmen gegen rechtsextremistische Umtriebe vor. Neben einer vergleichsweise engen Kooperation von Polizei und Verfassungsschutz ist diesbezüglich insbesondere die seit August betriebene Intensivierung von polizeilichen Maßnahmen wie die Fortschreibung der "Personenliste rechtsextremistischer Skinheads" erwähnenswert. Präventive Anstrengungen erstrecken sich auf die offene Gefährderansprache polizeibekannter gewaltbereiter Rechtsextremisten, die Ansprache potenzieller Szeneeinsteiger und deren Eltern, die Schaltung eines Hinweistelefons für Informationen über rechtsextremistische Aktivitäten, eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsanstrengungen in der Kooperation mit Schulen und im Rahmen der kommunalen Kriminalprävention sowie ein beim LKA angesiedeltes Aussteigerprogramm (dazu vgl. näher Kap. 3.1.15). Wie einem "Gemeinsamen Appell der Innenministeriums zur Intensivierung Kommunalen Landesverbände und des von vernetzten Maßnahmen gegen 3 Der Themenstellung der Expertise entsprechend wird hier der Akzent auf die Darstellung von Initiativen und Programmen gelegt, die unmittelbar und explizit für Pädagogik und Soziale Arbeit bedeutsam und nachhaltig angelegt sind. Generalpräventive Ansätze der Arbeitsmarkt-, Wohnungs-, Stadtentwicklungs-, Sozial-, Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik werden dabei nicht berücksichtigt; nicht weil ihnen Bedeutsamkeit und Wirkung abzusprechen wäre, sondern weil sie das ohnehin äußerst komplexe Bild der 'gefahrenen' Gegenstrategien noch unübersichtlicher gestalten würden. Gleiches gilt für Landesaktivitäten, die im Kontext von EU-und Bundesprogrammen vorgenommen werden. Es wird dessen ungeachtet hier auch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Herausgearbeitet werden soll vielmehr der jeweilige Schwerpunkt der regierungsseitigen Förderungs- und Aktionsinitiativen und – soweit möglich - ihre landesspezifische Kontur. Repressive Maßnahmen der Sicherheitsbehörden finden nur insoweit Erwähnung als sie landestypische Gewichtungen zwischen pädagogisch-sozialarbeiterischen und repressiven Maßnahmen oder Anknüpfungspunkte zwischen beiden Bereichen verdeutlichen. 20 Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus" vom Januar 2001 zu entnehmen ist, werden Schwerpunkte in der kommunalen Kriminalprävention als Plattform für lokale Projekte in der Vernetzung staatlicher Maßnahmen, gezielten Ausstiegshilfen und im Ausschöpfen der Möglichkeiten bürgerschaftlichen Engagements gesehen. Für die kommunale Kriminalprävention werden in 2001 und 2002 insgesamt 1,53 Mio. Euro im Rahmen der "Zukunftsoffensive III – Junge Generation" zur Verfügung gestellt. Damit werden 46 Projekte in 35 Gemeinden gefördert. Die Finanzierung ist als Anschubfinanzierung gedacht und soll nachhaltigen, qualitativ hochwertigen, gut vernetzten und übertragbaren Maßnahmen gelten. Zudem fördert das LKA im gleichen Rahmen in Höhe von 455.000 Euro pädagogisch orientierte Projekte (z.B. theaterpädagogische Maßnahmen, interaktive Lernspiele, Kino-Specials). Neben einem im Ländervergleich relativ gut ausgebauten Netz Mobiler Jugendarbeit, eines Ansatzes, der über Streetwork, Einzelfallhilfe, Gruppen- bzw. Clubarbeit und Gemeinwesenarbeit gerade auch auf delinquente und delinquenzgefährdete Jugendliche ausgerichtet ist (vgl. Landesarbeitsgemeinschaft 1997, 2002 und Kap. 3.1.7), werden weitere Akzente vor allem in zwei Bereichen gesetzt: Zum ersten engagiert sich im Bereich der außerschulischen Bildung die Landeszentrale für politische Bildung neben den für diese Einrichtungen typischen Aktivitäten beim modellhaften Aufbau eines sog. "Team Z" (Z = Zivilcourage). Dafür standen 2001 300.000 DM und stehen 2002 80.000 Euro zu Verfügung; eine Weiterführung des Projekts in 2003 steht allerdings in Aussicht. Es handelt sich um ein Team von z.Zt. ca. 25 freien MitarbeiterInnen, das neben der Durchführung eigener Aktionen, Workshops und Seminare Bildungseinrichtungen und MultiplikatorInnen vor Ort beraten und ggf. schulen soll. Nach einem absolvierten Basistraining in Streitschlichtung und Konfliktlösung (vgl. Kap. 3.1.4) im Umfang von 70 Stunden (orientiert am Modell von Kurt Faller) steht das Team seit Herbst 2001 in 4 Regionalgruppen aufgeteilt für die Praxis (gleichzeitig im Sinne von training on the job), d.h. konkret für 10 bis 12 Vorhaben, mit dem Ziel zur Verfügung, Streitschlichtung ab Frühjahr 2002 als Teil der Einrichtungsprogramme zu installieren. Die Nachfrage überstieg schon zu diesem Zeitpunkt etwa um das Sechsfache die Möglichkeiten des Team Z. Eine experimentierende Evaluation (qualitativ) hat das Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Tübingen übernommen. Ergebnisse liegen angesichts der Zeitplanung des Projekts noch nicht vor, können aber wohl im Sommer 2002 erwartet werden (vgl. Zwischenbericht Modellprojekt "Team Z"). Zum anderen wurde gegen Ende des Jahres 2000 ein "Netzwerk gegen Gewalt an Schulen" gegründet. Mit ihm wir die intensive Zusammenarbeit von gesellschaftlich relevanten Gruppen, sozialen Einrichtungen, Polizei und Schule angezielt. Insbesondere die Anwesenheit der Polizei an Schulen soll gestärkt werden und "ein Stück weit Normalität werden" (Innenminister Schäuble am 19.12.2000). Die Erhöhung der Zahl der Jugendsachbearbeiter bei der Polizei innerhalb von drei Jahren von 530 auf ca. 900 wird ebenso in diesem Zusammenhang gesehen wie die vom Landtag im Jahre 2000 bewilligten 6,5 Mio. DM für 91 Sozialarbeiter an Haupt-, Förder- und Beruflichen Schulen. Als die im engeren Sinne pädagogischen Hauptaufgaben des ansonsten nicht über eigene Mittel verfügenden Netzwerkes werden die Entwicklung sozialer Kompetenzen, der Abbau destruktiven Sozialverhaltens bei Schülern und Schülerinnen sowie die Verhinderung eines Abgleitens in Kriminalität genannt. Die Ziele sollen u.a. durch die Initiierung von Schulentwicklungskonzepten zur Gewaltprävention umgesetzt werden. Ein seit September 2000 unter dem Dach des Kultusministeriums angesiedeltes "Kontaktbüro Gewaltprävention" mit zwei Lehrkräften, die jeweils mit einem halben Deputat freigestellt sind, koordiniert die Arbeit (zur Projektübersicht vgl. www.leu.bw.schule.de/allg/gewalt/projekte.html). 21 In Relation zur Summe der vom Land ausgewiesenen Sondermittel investiert die Landeshauptstadt Stuttgart verhältnismäßig stark in die pädagogische Gewaltbekämpfung bzw. die Förderung von "Toleranz und Miteinander" bei Jugendlichen. Von Oktober 2001 bis Oktober 2002 werden einmalig mit rd. 850.000 DM aus dem Fond "Zukunft der Jugend" 40 gewaltpräventive Projekte an Schulen (diese setzen einen Schwerpunkt auf Streitschlichtung und soziales Lernen und werden voraussichtlich in 2002 weitergefördert) und 24 Projekte der außerschulischen Jugendarbeit gefördert. (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart GRDrs 816/2001; zu weiteren exemplarischen Projekten der Bildungs- und Sozialarbeit in Baden-Württemberg vgl. auch Metzger 2001). Bayern Das Bundesland Bayern setzt bezüglich der Bekämpfung von Rechtsextremismus in erster Linie auf staatliche Repression (vgl. auch zum folgenden detaillierter: www.stmi.bayern.de/infothek/rechtsextrem/massnahmen/htm). Dafür wird eine enge Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz propagiert. Sie schlägt sich nicht nur in der Erstellung abgestimmter Lagebilder nieder, sondern führt auch dazu, dass Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, die durch den offensiven Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel (z.B. Platzierung bzw. Anwerbung von V-Leuten in der rechten Szene) erworben werden, lückenlos an die Polizei weitergereicht werden, so dass eine starke polizeiliche Präsenz an Treffpunkten und bei Aktionen wie Veranstaltungen von Rechtsextremen gewährleistet werden kann. Eine enge Zusammenarbeit mit Behörden, die für die Genehmigung von Versammlungen zuständig sind, die extensive Nutzung der Möglichkeit von vereinsrechtlichen Verboten, Unterbindungsgewahrsam, verdeckte und offene polizeiliche Überwachung von Veranstaltungen, kommunale Kriminalprävention, Sicherheitspartnerschaften, der Einsatz von Sicherheitswacht u.ä.m. sollen einen Verfolgungsdruck aufbauen, der zu einer Verdrängung und Zerschlagung der Szene führt. Im Ministerratsbeschluss vom 01.08.2000 fordert Bayern darüber hinaus die Ahndung von Straftaten Heranwachsender nach dem Erwachsenenstrafrecht, die polizeiliche Videoüberwachung von Straßen und Plätzen und eine Erweiterung des Artikels 10 des Grundgesetzes dahingehend, dass a) Post- und Telefonüberwachung bei Anhaltspunkten für schwere Straftaten auch dann ermöglicht wird, wenn eine Einzelperson und nicht eine terroristische Vereinigung verdächtigt wird und b) die Möglichkeit der Verwertung von Erkenntnissen aus Post- und Telefonüberwachungen auch für Partei- und Vereinsverbote explizit klargestellt wird. Als Initiative im Bereich Migration weist die Internetselbstdarstellung www.bayern.de ausdrücklich auf die im Juli 2000 verabschiedeten "Eckpunkte zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung" hin. Pädagogische bzw. sozialarbeiterische Bekämpfungsstrategien nehmen sich vergleichsweise dünn aus, sieht man einmal von den in Bayern platzierten und über den Bayerischen Landesjugendring mittels des Programms "move now!" verteilten rd. 2,6 Mio. DM des zweiten Teils des Bundesprogramms "Jugend für Toleranz..." ab. Hierin spiegelt sich die Auffassung des bayerischen Kultusministeriums wider, Rechtsextremismus sei an Bayerns Schulen "eine Randerscheinung" (zweiwochendienst 13-14 u. 15/2000, 1). Das seit 1993 existierende Gesamtkonzept zur Bekämpfung des politischen Extremismus sieht thematisch einschlägige Maßnahmen an Schulen und Hochschulen vor, deren Umfang allerdings schwer ersichtlich ist. Daneben werden im Paket "Maßnahmen gegen Rechtsextremismus" (vgl. ebd.) Gedenkstätten-Besuche – für Gedenkstättenarbeit ist seit 1997 die LzpB zuständig – und 22 Akte der Solidarität mit jüdischen Mitbürgern (Friedhofspflege, Denkmalschutz etc.) in Höhe von insgesamt mehreren Mio. DM ausgewiesen. Unter dem Stichwort "Ausländerintegration" wurde im Sommer 1999 eine interministerielle Arbeitsgruppe einberufen, die sich auch mit fremdenfeindlich motivierter Gewalt und deren Bekämpfung beschäftigt. Eine von der Staatsregierung gegründete Stiftung "Bündnis für Kinder – gegen Gewalt" dient dem Kinderschutz und "verschenkt" jede Woche eine Veranstaltung zur Gewaltprävention (vgl. www.buendnis-fuer-kinder.de). Berlin Die Berliner Maßnahmen gehen größtenteils aus einer Studie hervor, die die im Februar 1994 eingerichtete Landeskommission "Berlin gegen Gewalt" im Sommer 1999 vorlegte (vgl. www.sensjs.berlin.de ). Sie stellt aufgrund ihrer Recherchen in den Zuständigkeitsbereichen der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, der Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen sowie der Bezirksämter fest, dass eine Vielfalt von Aktivitäten unternommen wird, aber dennoch "insbesondere im Ostteil der Stadt Weimarer Verhältnisse drohen" (ebd., 14), selbst wenn rechtsextreme Einstellungen sich nur in Ausnahmefällen mit registrierter Gewaltsamkeit verbinden. Man konstatiert – die Antwort auf die Kleine Anfrage Nr. 3697 von 1998 zitierend: "Rechtsextremistische Verhaltensweisen und Symbole sind in diese Teile der Jugend der Jugendkultur eingedrungen und Teil des Alltagsdiskurses geworden" (ebd., 16). Daher erscheint es weiterhin "dringend geboten, mit Maßnahmen der präventiven Jugendhilfe, aber auch im Schulunterricht auf allen Ebenen korrigierend einzugreifen" (ebd., 14). Sie seien "sehr wesentlich" und "unverzichtbar" (ebd., 17). Bemängelt wird, dass keine systematische Erfassung, Koordinierung und Abstimmung der Vielzahl von Einzelmaßnahmen erfolgt, so dass Synergieeffekte nicht zu erzielen sind. Eine Wirksamkeitsüberprüfung erfolge nirgends. Am 12.09. 2000 hat der Senat ohne konkrete Aussagen hinsichtlich seiner Finanzierung ein Zehn-Punkte-Programm gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus beschlossen. Danach sollen u.a. die Gefährdungen durch das Internet genauer beobachtet und bekämpft, Präventionsmaßnahmen auf Dauer gestellt, Ansätze der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen intensiviert, ressort- und institutionenübergreifende Strategien gefahren und die von der Landeskommission geforderte Koordinationsstelle "Rechtsextremismus" eingerichtet werden. Einzelheiten und ihre Umsetzung sind den Drucksachen 14/700 und 14/1457 zu entnehmen. 2001 wurden zusätzlich 1,5 Mio. DM für Jugendprojekte zur Verfügung gestellt, die auf Demokratieerziehung, Gewaltprävention und Rechtsextremismusbekämpfung abziel(t)en. Das so finanzierte "Berliner Aktionsprogramm für Demokratie und Toleranz" (vgl. www.jugendnetz-berlin.de/respect/index2.htm) bietet in der gemeinsamen Trägerschaft von Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport, Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, Deutscher Kinder- und Jugendstiftung und Stiftung Demokratische Jugend verschiedene Bausteine an. Sie sehen vor die Veranstaltung von Jugendforen mit Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen und ethnischen Milieus, ein thematisch ausgerichtetes Internetportal, 23 Arbeit mit "rechten Kids" (Berliner Mittel als Komplementärmittel für Xenos) und ihre Evaluation, Begegnungen und Aktivitäten von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft (250.000 DM Berliner Mittel, in gleicher Höhe Bundesmittel), einen Landeswettbewerb, der die landesweit bedeutsamsten "Best-practice-Beispiele" prämiert, Medienseminare für JournalistInnen, Anti-Aggressionstrainings und Mediationsausbildung im Sportbereich und Kooperationsprojekte zwischen Schule, Jugendhilfe und Sport (vor allem Multiplikatorenschulungen und schulische Peer-Mediations-Projekte). Nach aktueller Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und PDS wird das Programm bis 2006 mit 500.000 Euro per annum weitergeführt. Brandenburg Die Regierung des Landes Brandenburg hat am 23.06.1998 ein Handlungskonzept "Tolerantes Brandenburg" beschlossen. Es ist "kein zusätzlich aufgelegtes Förderprogramm", sondern beabsichtigt, "Mobilisierung gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit als Schwerpunkt der alltäglichen Arbeit" zu etablieren (Ministerium für Bildung... 2001d, 6). Im Zentrum steht die bürgergesellschaftliche Unterstützung der kommunalen demokratischen Gegenöffentlichkeit. Dazu wird das 1997 gegründete "Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit" als zivilgesellschaftlicher Partner des Handlungskonzepts mit anfänglich 150.000 DM ab 1999 rd. einer halben Mio. DM jährlich gefördert. Neben den bundesweit beachteten repressiv ausgerichteten "Mobilen Einsatztrupps gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit" (MEGA) der Polizei und Aus- und Weiterbildungsansätzen zum Zwecke der Sensibilisierung für Diskrimnierungen für die Polzei im Rahmen von NAPAP (vgl. dazu auch Kap. 3.1.17) erfolgen besondere Akzentsetzung in sechs pädagogisch bzw. sozialarbeiterisch bedeutsamen Bereichen: Mobile Beratungsteams (z.Zt. 1 zentrale Geschäftsstelle und 5 Regionalbüros) in Trägerschaft der Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule e.V. dienen der Unterstützung der kommunalen Öffentlichkeit bei der Arbeit "gegen rechts" und Gewalt. Durch die Zusammenarbeit mit und die Beratung, Vernetzung oder auch Fortbildung von PolitikerInnen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen, Polizei, zivilgesellschaftlichen Gruppierungen etc. vor Ort soll ein Beitrag zu einer gewalt- und diskriminierungsfreien Gemeinwesenentwicklung, insbesondere auch zur Entwicklung kommunaler Integrationsstrukturen für Zuwanderer, geleistet werden. Im Jahre 2001 flossen 2,5 Mio. DM aus Landesmitteln in die mobile Beratung (vgl. eingehender: Ministerium für Bildung...o.J.; 2001a). Die starke Nachfrage der Teams belegt den großen Beratungsbedarf der lokalen Akteure. Zehn Regionale Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule mit z.Zt. 55 hauptamtlichen Kräften – eine davon auch als zentrale Geschäftsstelle und Antidiskriminierungsstelle arbeitend – sollen die Entwicklung von Toleranz und Solidarität und den Abbau von Fremdenangst (mit)bewirken. Im Vordergrund der Arbeit stehen interkulturelle Projekte in Schule und Jugendhilfe sowie die Opferberatung. Ein "Beratungssystem Schule" ist seit Sommer 1999 gegen die Gewalt an Schulen gerichtet. In z.Zt. 16 kreisbezogenen, bei den Staatlichen Schulämtern angesiedelten Beratungsbüros, die aus dem Schulrat, einer koordinierenden Lehrkraft, einem Schulpsychologen und einem Mitarbeiter der Regionalen Arbeitsstelle für 24 Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule (RAA) bestehen, werden auf Schulen und Lehrkräfte zielende Koordinations-, Beratungs- und Fortbildungsaufgaben gebündelt (vgl. eingehender: Ministerium für Bildung... o. J.; 2001b). Die LAG politisch-kulturelle Bildung Brandenburg bietet "Trainings für Weltoffenheit und Toleranz" u.a. für Beschäftigte in den Kommunalverwaltungen und Übungsleiter aus Sportvereinen an. Ein im März 2000 gegründeter Landespräventionsrat trägt die "Sicherheitsoffensive Brandenburg" (2001: 500.000 DM). Die Gelder fließen vor allem in Forschung und Weiterbildung. Z.B. wird der Fernlehrgang "Konzepte der Gewaltprävention" daraus finanziert. Überwiegend ehrenamtliche KoordinatorInnen (beim Start im August 2000 130 bei 1.500 brandenburgischen Gemeinden) sollen sicherstellen, dass zentral oder regional geplante Maßnahmen auch tatsächlich vor Ort "ankommen". Sie sehen sich in der Funktion, "an die Menschen heranzukommen" und vermögen durchaus einzelne Erfolge vorzuweisen, auch wenn bislang eine Evaluation ihrer Tätigkeiten ebenso ausbleibt wie die der anderen Aktivitäten innerhalb des Handlungskonzepts (vgl. Ministerium für Bildung... 2001c). Die Möglichkeiten einer Evaluation des Handlungskonzeptes werden gegenwärtig diskutiert (Näheres zum Konzept und ausgewählten Projekten wie "KICK-Brandenburg" – eine Kooperation von Jugendhilfe und Polizei in mehreren Städten -, "KIT" – Aufbau von ehrenamtlichen Kriseninterventionsteams durch einen Zusammenschluss mehrer Jugendverbände des Landes -, das vom Caritasverband getragene Projekt "Boxenstopp" – Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainings in Verbindung mit erlebnispädagogischem "Kartracing" findet sich in den in diesem Abschnitt angegebenen Literaturhinweisen sowie in: Ministerium für Bildung... 1998 und 1999). Erwähnenswert ist daneben die im September 2000 mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnete "Aktion Noteingang", die von jungen Leuten in Bernau gegründet, inzwischen auch in anderen Ländern verbreitet wurde und staatliche Institutionen wie Geschäftsbetriebe mit Erfolg auffordert, durch schwarz-gelbe Aufkleber an den Eingängen zu signalisieren, von rechtsextremer Gewalt Verfolgten Zuflucht zu bieten (vgl. kurz: www.djb-ev.de/noteingang).4 Bremen Die Aktivitäten des Landes Bremen gehen zu einem großen Teil aus dem vom Senat Ende des Jahres 2000 vorgelegten und auf den Zeitraum 1993 – 2000 bezogenen Dritten Bericht über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Lande Bremen hervor. Auf der Basis einer Analyse, die explizit auf Prozesse des "Anerkennungszerfalls" (vgl. Dritter Bericht... o. J., 15) bezug nimmt, wird die Vermittlung von Anerkennung als Leitziel betrachtet. Daraus leiten sich vier strategische Ziele ab: die Vermittlung von Anerkennung in "Bildung und Arbeit" (1.), eine Verstärkung der "Werte-Orientierung" (2.), die Vermittlung positiver "Lebensperspektiven", um "Bindungsund Orientierungslosigkeit" entgegenzusteuern (3.) und die Verbesserung von "Wohnungs- und Wohnumfeldsituationen" (4.). 10 Leitlinien für das operative Handeln sieht sich die Landespolitik verpflichtet (vgl. ebd., 50ff.): 4 Eine ähnliche Initiative wurde übrigens jüngst bundesweit von Geschäftsleuten gegründet, die bedrohten Kindern derart ihre Hilfsbereitschaft anzeigen wollen. 25 1. "Unmissverständlich öffentlich Position beziehen" 2. "Jedes Ressort mit seinen Möglichkeiten in die Pflicht nehmen" 3. "Präventive, deeskalative und repressive Techniken einsetzen" 4. "Koordinieren und Vernetzen" 5. "Kooperationen aufbauen" 6. "Ressourcen sichern" 7. "Dialoge in Gang setzen" 8. "Innovative Impulse aufnehmen" 9. "Controlling durchführen" 10. "Kontinuität gewährleisten". Freilich wird zu Punkt 9 eingeräumt, dass die eingesetzten Instrumente noch verbesserungsbedürftig sind. Aus den in dem Bericht aufgeführten Maßnahmenkatalog der Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik, der schulischen und außerschulischen pädagogischen und sozialarbeiterischen Ansätze, der Wohnungspolitik und der Förderung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten können die folgenden Maßnahmen insofern herausgehoben werden, als sie der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit eine spezifisch bremische Kontur verleihen: Schulen innerhalb von sozialen Brennpunkten werden zusätzliche Lehrerdeputate zugewiesen, um einen erhöhten "Sozialstrukturbedarf" mittels fachbezogener oder sozialer Zusatzangebote zu befriedigen; Komplementärfinanzierungen von Xenos-Projekten, etwa Unterstützung lokaler Initiativen, Aufbau von Anlauf- und Vernetzungsstellen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und präventive Jugendmedienarbeit in Hinsicht auf rechtsextreme Gefährdungen durch Internetangebote; Verstärkung erfahrungs- und handlungsorientierten Lernens in der Schule; Unterstützung von Schulen u.a. in dieser Hinsicht durch das Landesinstitut für Schule und den dort verorteten Modellversuch "Gewalt in Schule und Gesellschaft – Entwicklung, Erprobung und Evaluierung von präventiven und deeskalierenden Strategien für den Unterricht an beruflichen Schulen"; Landeskoordination des Projektes "Schule ohne Rassismus" der Aktion Courage durch die Landeszentrale für politische Bildung Verstärkung sozialpädagogischer Arbeit schwerpunktmäßig an Hauptschulen; Institutionalisierung der Antidiskriminierungsarbeit bei der Stelle der Ausländerbeauftragten; Aufbau von Konfliktschlichtungsprojekten innerhalb und außerhalb von Schulen. "(V)or allem" wird eine "Verstärkung der präventiven Jugendarbeit" angestrebt, also erfahrungsorientierter "Arbeit mit sogenannten 'Normaljugendlichen'" und "Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen ohne feste Cliquenbildung". Für die "Arbeit mit rechtsextremen Cliquen" wird seit nunmehr deutlich über einem Jahrzehnt "erfolgreich" das Konzept der "akzeptierenden Jugendarbeit" (vgl. dazu näher Kap. 3.1.7) eingesetzt (alle Zitate ebd., 17/18). Im Jahre 2000 flossen 420.000 DM in diese Arbeit. In Vorbereitung (Stand Frühjahr 2002) befindet sich ein Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus des Senators für Bildung und Wissenschaft. Hamburg 26 Der bis zur letzten Neuwahl regierende Senat des Stadtstaats wies der Jugendhilfe "grundsätzliche Bedeutung" "für die Abwehr von rechtsradikalen und fremdenfeindlichen Tendenzen" zu (Drucksache 16/5707, hier: 9; vgl. zum folgenden auch Drucksache 16/5001), wobei angemerkt wird, dass "die Grenzen zwischen Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen, die sich allgemein gegen Gewalt von Jugendlichen, und solchen, die sich gegen Gewalt von Jugendlichen mit neonazistischem und rechtsradikalem Hintergrund richten, fließend sind" (ebd., 4). In diesem Zusammenhang wurde(n) in 2001 eine Reihe von in Form und methodischer Anlage z.T. sehr unterschiedlichen Veranstaltungen durchgeführt, die über das Bundesprogramm "Jugend für Toleranz und Demokratie" finanziert wurden, MultiplikatorInnenschulungen für MitarbeiterInnen der Jugendarbeit organisiert (u.a. auch "Eine Welt der Vielfalt"; s. Kap. 3.1.2), seit 1997 in Kooperation von Jugendinformationszentrum und Polizei die Aktion "Gemeinsam gegen Angst und Gewalt" (u.a. Erstellung einer Broschüre mit Opfer- und Zeugentipps) durchgeführt vom Landesjugendring alternative Stadt- und Hafenrundfahrten mit dem Schwerpunkt der NS-Information angeboten. Unbeschadet des Ausgangspunkts, Unterricht wie Schulleben insgesamt so gestalten zu müssen, dass die Prävention von Rechtsextremismus als Aufgabe aller Fächer und Aufgabengebiete erfüllt werden kann und der Unterricht über den Nationalsozialismus fest im Lehrplan verankert ist, wurden im Bereich von Schule speziell angeboten: diverse LehrerInnenfortbildungen zur Förderung der interkulturellen Kompetenz (u.a. "Eine Welt der Vielfalt" und "Das sind wir"; vgl. dazu Kap. 3.1.2 und 3.1.17 ), von den TeilnehmerInnen mehrheitlich positiv beurteilte MultiplikatorInnenschulungen für Streitschlichterprogramme – pro Schule je zwei Lehrkräfte (insgesamt arbeiten ca. 40 Hamburger Schulen an der Umsetzung des Konzepts), Antigewalttrainings und Trainings in Mediation, Fortbildungsangebote zur "Förderung der zivilen Konfliktfähigkeit" und Zivilcourage (durch das Institut für Lehrerfortbildung, IfL, im Umfang von 24 Seminaren à ca. 20 TeilnehmerInnen im Schuljahr 2000/2001), ein Innovationsfonds zur Förderung von Schulprojekten, der 15 Schulen Mittel in Höhe von 152.600 DM für Gewaltprävention zur Verfügung stellte. Ferner wurden etwa 70 Polizeibeamte für den gewaltpräventiven Einsatz an Schulen ausgebildet (wo auch der Landesverfassungsschutz informiert) und wurde die Aktion gegen Handy-Raub "Ich bin registriert" in Kooperation von Lehrkräften und Polizei durchgeführt. "Soziales Lernen" gilt als fester Bestandteil des Methodentrainings in allen Schulformen. Daneben gibt es Sportveranstaltungen an Schulen (Mitternachtsbasketball u.ä.) und diverse Aktionen unter Titeln wie "Für Demokratie" und "Gegen Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt" u.ä. Die Projektagentur "Pro Demokratie" soll die Stärkung demokratischer Strukturen innerhalb von Schulen als Servicestelle unterstützen. Die Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung unterstützt daneben Angebote freier Träger, der LzpB – die daneben ein umfangreiches Angebot zum Rechtsextremismus-Thema macht -, der VHS – die auch "Anti-Gewalt-Trainings" und "Mediation" anbietet – und der JVHS (Junge Volkshochschule) zur Förderung der zivilen Konfliktfähigkeit und der Zivilcourage, Wettbewerbe und Preise wie "Demokratisch handeln", "Jugend debattiert" und 27 den 1998 erstmals ausgeschriebenen "Bertini-Preis" für junge HamburgerInnen mit Zivilcourage. Die Behörde für Inneres organisierte Präventivaktionen wie "Jugend" (seit 1997), "Wer nichts tut, macht mit" (1998) und seit 1996 "Sicherheitspartnerschaften Bürger – Polizei", um Eigenverantwortung im Quartier zu stärken; das LKA richtete eine Info-Hotline zum Problem Rechtsextremismus ein. Im Sportbereich engagieren sich gut 60 Vereine in der sportlichen Sozialarbeit, 23 von ihnen in der Arbeit mit Aussiedlern. Das Projekt "Integration durch Sport" erweitert den Personenkreis und zielt speziell auf soziale Brennpunkte. Hessen Das Bundesland Hessen hat – wohl auch weil die Belastung zumindest mit entsprechenden Straftaten im Ländervergleich relativ gering ist – kein Sonderprogramm für Rechtsextremismus- und Gewaltbekämpfung aufgelegt. Eine landesweite Koordination von Aktivitäten findet nicht statt. Zwischen 1994 und 1996 lief jedoch ein "Hessisches Jugendaktionsprogramm gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit", das über fünf Modellprojekte und 15 weitere kleinere Projekte einige Anstöße liefern konnte, die in die alltägliche Arbeit übernommen werden konnten (vgl. Hafeneger 1995; Klose u.a. 2000). Die Präventivaufgaben werden gegenwärtig am ehesten durch den unter Federführung des Justizministeriums arbeitenden Landespräventionsrat zusammengeführt, der u.a. auch eine Arbeitsgruppe zum Thema "Gewalt und Minderheiten", früher: "Gewalt gegen Minderheiten", hat. Die von ihm zuletzt in den Jahren 1998 und 2000 herausgegebenen Reports lassen erkennen, dass er nicht nur einen jährlichen Landespräventionspreis verleiht und seine Aufgabe darin sieht, kommunale Präventionsgremien anzuregen und zu unterstützen, sondern auch in der Entfaltung von Sportaktivitäten (z.B. "Sport mit Aussiedlern"; vgl. auch Kap. 3.1.8), in der Qualifizierung der Übungsleiter (dies waren schon Akzentsetzungen im jugendaktionsprogramm-geförderten Projekt "Auszeit"; vgl. Curth/Kelm/Mathern 1996; Klose u.a. 2000) sowie in der mobilen Sozialarbeit besonders wichtige Ansatzpunkte erblickt, um soziale Integration, insbesondere von sozial Benachteiligten, zu befördern und Gewalt im öffentlichen Bereich zu begegnen (vgl. Dritter Bericht 1998; Vierter Bericht 2000). Das Innenministerium beschränkt sich gegenwärtig darauf, die Fußballfanprojekte in Frankfurt, Offenbach und Darmstadt, gelegentlich kleinere Integrationsprojekte von Sportvereinen mit Ausländern und Aussiedlern sowie mit 50.000 Euro aktuell das vom Hessischen Fußballverband ausgehende Projekt "Integration – Toleranz für eine friedliche WM 2006" zu unterstützen. Hessische Gewaltpräventionsprojekte sind – wie andere aus den Bundesländern BadenWürttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, NRW und Sachsen – am "Netzwerk Verantwortungsübernahme und Gewaltprävention" beteiligt. Einzelbeschreibungen von Projekten mit insgesamt großer inhaltlicher und methodischer Spannbreite sind z.B. unter www.verantwortung.de im Internet abzurufen. Das Hessische Institut für Lehrerfortbildung in Frankfurt setzt den Schwerpunkt der Gewaltprävention einerseits auf Mediation und Konfliktschlichtung. Im Programm "Mediation und Schulprogramm" wurden seit 1997 bislang, orientiert an dem von Kurt Faller ausgearbeiteten Modell (vgl. auch Kap. 3.1.4), 165 Schulen in entsprechende Projekte einbezogen. Ziel ist die Ausbildung von Schüler-Streitschlichtern und die Integration der damit vermittelten Konfliktlösungskompetenzen in das jeweilige Schulprogramm, um eine nachhaltige schulische Konfliktkultur zu entwickeln. Ein zweiter, damit verknüpfter 28 Schwerpunkt betrifft die Entwicklung von demokratischer Schulqualität. Geplant ist z.Zt., in das BLK-Modell "Demokratie lernen" (vgl. Kap. 3.1.5) mit 18 allgemeinbildenden und 6 beruflichen Schulen 'einzusteigen'. Weitere gewaltpräventive Projekte arbeiten mit dem Olweus-Programm (zwischen 1996 und 1999 an 5 Schulen umgesetzt; vgl. auch Kap. 3.1.5), oder mit anderen Schwerpunktsetzungen, z.B. theaterpädagogischen und geschlechtsbezogenen. Im Bereich der Jugendhilfe beschränkt man sich im wesentlichen auf die Umsetzung des Bundesprogramms "Jugend für Demokratie und Toleranz". Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Schulkooperations-Projekt des Frankfurter Anne Frank Hauses, in dem in Reaktion auf die öffentliche Debatte vom Sommer 2000 und die an die Jugendbildungsstätte gerichtete Aufforderung, verstärkt tätig zu werden, auf die modernisierten Erscheinungsformen des Rechtsextremismus weniger durch historische Bildung (vgl. Kap. 3.1.1) als u.a. durch Aufgreifen lebensweltorientierter Themen der Jugendlichen und Zivilcourage-Trainings (vgl. Kap. 3.1.6) mit Schülern und Schülerinnen geantwortet wird (vgl. auch Sachbericht 2001). Das Kinderbüro Frankfurt bietet in Zusammenarbeit mit dem Jugendbeauftragten der Frankfurter Polizei für SchülerInnen der Sekundarstufe I, schwerpunktmäßig für Jungen, ein Coolness-Training an, das seit einigen Jahren auch in die Elternarbeit sowie die Erzieherinnen- und Lehrerfortbildung eingeht. Es handelt sich um ein Gewaltvermeidungstraining, das auf einem genauen Erkennen von Gewaltsituationen und ihren Eskalationsbedingungen aufbaut (vgl. auch Kap. 3.1.11). Mecklenburg-Vorpommern Im Nachgang zum Erlass des Innenministeriums zur Bekämpfung des Rechtsextremismus vom Juni 1999, der u.a. die Einrichtung der MAEX-Gruppen (Mobile Aufklärung Extremismus) in den 5 Polizeidirektionen des Landes vorsah, beschloss die Regierung des Landes im Mai 2000 ein 7-Punkte-Programm zum repressiven und präventiven Kampf gegen Rechtsextremismus. Darin wird "unnachsichtige Härte" für rechtsextremistische Gewalttäter ebenso gefordert wie die Befähigung von Jugendlichen, "verführerische rechtsextremistische Parolen zu durchschauen und sich von ihnen zu distanzieren". Im präventiven Bereich werden insbesondere Schule, Jugendarbeit und bürgergesellschaftliche Initiativen in die Pflicht genommen bzw. ermuntert (vgl. Punkte 5., 6. und 7.). Neben repressiven Maßnahmen unter dem Motto "Keine Toleranz für Intoleranz" ist erwähnenswert: Die Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) bietet ein Extra-Projekt "Bürger und Polizei gemeinsam gegen Rechtsextremismus" an, wo Informationen (u.a. Verhaltenstipps, Tipps für Eltern, Hinweise auf die "Aktion-tu-was") und Präventionsprojekte abrufbar sind. Ein schon 1994 gegründeter "Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung", der über eigene Haushaltsmittel (2002 und 2003 je 295.100 Euro Landesgelder) zur Förderung von Präventionsprojekten verfügt (näherer Informationen: www.kriminalpraevention-mv.de), hat eine Arbeitsgruppe "Extremismus" eingerichtet, die eine "kritische Integration" rechtsextremistisch orientierter Jugendlicher empfiehlt. Ein Handlungsrahmen "Demokratie und Toleranz" (vgl. www.mvregierung.de/im/pages/demokratie.htm) sieht u.a. im einzelnen vor: die Verstärkung bürgergesellschaftlichen Engagements in Hinsicht auf Zivilcourage und eine entsprechende Förderung von Projekten durch die LzpB im Rahmen des Sonderprogramms "Pro Zivilcourage gegen Gewalt", mit dem im Jahre 2000 und 2001 bei einer Ausstattung von jährlich 300.000 DM je etwa 60-70 Veranstaltungen (vergleichsweise stark historisch-aufklärend akzentuiert), u.a. auch die 29 Gründungskonferenz für "Netzwerke für Demokratie und Toleranz in M.-V." durchgeführt wurden; im Bereich von Schule neben thematischer Akzentuierung des Schulunterrichts und der LehrerInnenfortbildung, Gewaltprävention auf dem Schulhof, der Empfehlung das in Sassnitz geltende Springerstiefelverbot (vgl. (www.kultus-mv.de) zu übernehmen, Sport gegen Gewalt, Vernetzung von Jugendhilfe und Schule sowie Ausbildung von jugendlichen Streitschlichtern der Einsatz von sozialpädagogisch geschultem Personal an den beruflichen und allgemeinbildenden Schulen des Landes. Bis zum Jahresende 2002 soll im Rahmen der im August 1999 gegründeten Landesinitiative Jugend- und Schulsozialarbeit eine Zahl von 1000 Beschäftigungsverhältnissen erreicht werden; in der Jugendarbeit die verstärkte Unterstützung von "Projekten und Initiativen, die sich der Gewaltprävention und der Bekämpfung des Rechtsextremismus widmen" sowie die Aufforderung an die Jugendarbeit, das Konzept der "kritischen Integration" zu "prüfen und auszufüllen"; die Verstärkung der Bemühungen um einen Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, nicht zuletzt über das "Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit"; die Prüfung, inwieweit die von den Unternehmen gestartete "Initiative der Wirtschaft gegen Gewalt und Extremismus" "nicht Bestandteil der Präventionsförderung im Bereich Rechtsextremismusbekämpfungen werden kann" und die damit eingebrachten Mittel entsprechend verausgabt werden können. Niedersachsen Die Aktivitäten des Landes Niedersachsens gehen im Überblick aus einer "Zusammenstellung der seit August 2000 eingeleiteten Maßnahmen und Projekte zur Bekämpfung des Rechtsextremismus" vom September 2001 hervor (vgl. www.niedersachsen.de/pdf/zusammenstellungPraevention.pdf), die eine Umsetzung der Landtagsentschließung "Für Demokratie und Menschenrechte – Gegen Gewalt und Fremdenhass" (LT-Dr. 14/1845) beinhaltet. Daraus und aus weiteren Recherchen lässt sich u.a. ersehen: Das Innenministerium fördert neben den von ihm zu verantworteten repressiven Maßnahmen – ausgehend von der Einschätzung, dass Rechtsextremismus „kein gesellschaftliches Randphänomen“ darstellt (vgl. www.niedersachen.de/MI_Integration.htm) – verstärkt präventive Ansätze. Dazu gehört u.a.: die Ansprache von erkannten Rechtsextremisten, die „GoSports“-Aktion mit 40 Veranstaltungen im Jahr, die „Sport als Mittel gegen wachsende Gewaltbereitschaft in der Jugend“ (vgl. ebd.) einsetzt, das Projekt „Sport mit Aussiedlern“, das vom Landessportbund durchgeführt wird, die Schaltung einer polizeilichen Hotline für die Meldung rechtsextremer Straftaten, die Initiierung und Unterstützung des Landespräventionsrates mit seiner seit Frühjahr 2001 eingerichteten Kommission "Prävention rechter Gewalt" sowie das Schließen von „Sicherheitspartnerschaften“ zwischen Polizei, Justiz, Bau- und Gesundheitsämtern, Sozial- und Jugendbehörden, Schulen, Kirchen, Vereinen, Unternehmen und Nachbarschaften (lt. Runderlass des MI vom 24.07.1998). Die Justiz hat ein Präventionsprogramm "Gewalt – nein!" aufgelegt, das gezielt die sozialarbeiterische Kompetenz von GerichtshelferInnen bei der einzelfallorientierten Aufarbeitung von Gewalttaten und ihre Mitarbeit in örtlichen Netzwerken nutzen will. 30 Schulische Prävention von Gewalt und Rechtsextremismus wird von Seiten des niedersächsischen Kultusministeriums insbesondere durch Maßnahmen verfolgt wie (vgl. Drucksache 14/2262) die Aufstockung des Angebots von Lehrerfortbildungskursen zur Thematik, eine verstärkte Berücksichtigung der Thematik bei der Überarbeitung der Rahmenrichtlinien, die Erarbeitung von Handreichungen und Unterrichtsmaterialien vor allem durch das MK, die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung und das Niedersächsische Lehrerfortbildungsinstitut, seit 1992 die Auslobung des Schülerfriedenspreises, die Ausbildung von MediatorInnen als MultiplikatorInnen für den Schuleinsatz und die von Schülern und Schülerinnen als Konfliktlotsen (letztere nach Stand von Februar 2001 in 8 Städten und einem Landkreis), die Ausbildung von fast 2 Dutzend LehrerInnen an der FH Nordostniedersachen/Universität Lüneburg zu Präventionsfachkräften, die Förderung der Kooperation von Schulen mit Einrichtungen und Vereinen des Gemeinwesens, den Einbezug von 30 niedersächsischen Schulen des Sek.I- und Sek.II-Bereiches in das bundesfinanzierte Projekt „Soziale Schulqualität und Devianz“ (Kooperationspartner IFK und IBBW; vgl. Kap. 3) und das Einbringen der Ergebnisse in Fernlehrgänge im Rahmen der schulinternen Lehrerfortbildung (SCHILF), weitere Projekte (z.B. „Betzavta“, PIT, KIK und Anti-Gewalt-Trainings; vgl. inhaltlich dazu die entsprechenden Unterkapitel von Kap. 3.1) sowie Foren an einzelnen Schulen, oft in Kooperation von Schule und Jugendhilfe. Das Finanzierungsvolumen dafür lässt sich nicht angeben, weil entsprechende Mittel nicht themenspezifisch ausgewiesen werden. Das Ministerium für Arbeit, Frauen und Soziales fördert mit 4,8 Mio. DM, davon 1 Mio. DM EU-Mittel, das Präventions- und Integrationsprogramm (PRINT), mit dem an 47 Standorten seit Mai 2001 Projekte der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher und des Abbaus von Fremdenfeindlichkeit aufgebaut werden, leistet Informations- und Aufklärungsarbeit (u.a. bei NLI-Trainingskursen nach dem Konzept "Eine Welt der Vielfalt" für Schüler und Schülerinnen; vgl. inhaltlich dazu Kap. 3.1.2), nimmt Koordinationsaufgaben des "Niedersächsischen Bündnisses gegen Ausländerfeindlichkeit und für Interkulturelle Verständigung" wahr, fördert Aktivitäten der Landesinitiative "Jugend in Niedersachsen für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz" (2000 in Höhe von 1,37 Mio. DM; Einzelheiten vgl. www.niedersachsen.de/pdf/zusammenstellungPraevention.pdf). Die Landeszentrale für politische Bildung veranstaltete in den Jahren 2000 und 2001 28 Tagungen, Konferenzen, Seminare u.ä. zum Themenbereich „Gewalt und Rechtsextremismus“, organisierte eine Tour des „widu-Theaters“ mit einer „Aufführung gegen rechtsradikale Gewalt“ (Titel des Stücks: „Angst im Kopf“) in 48 Orten des Landes bei durchschnittlich 200 Schülern und Schülerinnen als ZuschauerInnen (vgl. inhaltlich zu theterpädagogischen Projekten Kap. 3.1.9), 31 hat die Landeskoordination der Aktion „Schule ohne Rassismus“ inne (vgl. dazu Kap. 3.1.5), die bis Ende des Jahres 2001 etwa ein Dutzend Schulen des Landes entsprechend auszeichnete; weitere 50-60 befinden sich im Bewerbungsverfahren unterstützt neben der einrichtungsüblichen Herausgabe von thematischen Publikationen und der Erstellung eines Teamer- und ReferentInnenverzeichnisses auch Initiativen und Einrichtungen vor Ort im Rahmen des landesweiten „Aktionsbündnisses gegen Rechts“ mit 1,1 Mio. DM jährlich (2001-2003) bei einer Kofinanzierung durch Eigen- bzw. andere Drittmittel von etwa einer weiteren Mio. DM. Damit konnten 2001 136 Projekte eines breiten methodischen Spektrums (von historischen Projekten über Theaterprojekte und Workshops bis hin zu Medienprojekten) finanziert werden, wobei der "Ansturm der Antragsteller" "überraschte" (ebd., 13) und "ohne weiteres" eine weitere Mio. an Fördergeldern hätte verausgabt werden können. Nordrhein-Westfalen Das Bundesland NRW bündelt seine Aktivitäten der Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in einem gegen Ende des Jahres 2000 vorgelegten "Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus". Anknüpfend an eine Situationsanalyse, die explizit "Desintegration", "(i)ndividuelle Verunsicherung und Zukunftsängste, Perspektivlosigkeit, das Gefühl sozialer Isolation und Anerkennungsdefizite" als "Nährboden" für Anfälligkeit ausmacht (vgl. Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfallen 2000, 19 bzw. 6), werden Schwerpunkte in folgenden Bereichen gesetzt (ebd., 10): "Beobachtung der Szene, kriminalpräventive Maßnahmen, Schutz gefährdeter Personen und Objekte, Strafverfolgung Aufklärung, Information und Multiplikatorenschulung Jugend-, Bildungs- und Familienpolitik soziale Integration und interkulturelle Verständigung Ursachenforschung Vernetzung von Projekten und Initiativen unterschiedlicher Träger". In den hier vorrangig interessierenden Bereichen der Bildung, der Verhinderung sozialer Ausgrenzung und der Förderung interkultureller Verständigung und des Wissenstransfers sind als konturverleihend hervorzuheben: die Orientierung der Lehrerfortbildung weniger an Fachlehrer-Schulung denn an ganzen Kollegien oder Teilgruppen von ihnen und die Mitwirkung von Verfassungsschutzmitarbeitern dabei, die Fortführung der Vorhaben einer Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, die Vernetzung der Aktivitäten von Polizei, Schule und Jugendhilfe, etwa in Form von "Vertrauenspartnerschaften", die Unterstützung des Programms "Schule ohne Rassismus", das einen Schwerpunkt in NRW hat, die Umsetzung des 1996 zwischen Regierung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung und Kommunen geschlossenen "Ausbildungskonsens NordrheinWestfalen" und die Landesinitiative "Jugend in Arbeit", die Förderung gezielter Projekte der Gewaltprävention bei Trägern der Jugendhilfe mit ca. 4 Mio. DM pro Jahr, die Einrichtung freiwilliger Schulsportgemeinschaften in "Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf", andernorts "soziale Brennpunkte" genannt, die Förderung von 27 RAAs, die Förderung eines "Landeszentrums für Zuwanderung" mit 13 MitarbeiterInnen als Transferstelle zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik und die 32 Förderung des "Informations- und Dokumentationszentrums Ausländerfeindlichkeit" (IDA-NRW), der beabsichtigte Ausbau der Antidiskriminierungsarbeit auf der Basis der bei neun Modellprojekten gesammelten Erfahrungen, die Förderung von bürgerschaftlichen Gemeinschaftsprojekten in städtischen Lebensräumen, für die zwischen 2001 und 2004 10 Mio. DM vorgesehen sind, die Förderung von interkultureller Erziehung im Elementarbereich (5 Modellprojekte) und interkultureller Weiterbildung bei kleinen und mittleren Unternehmen im Rahmen des BLK-Modellversuchs "Lebenslanges Lernen", die Unterstützung des "Arbeitskreises der Ruhrgebietsstädte", durch den Aktivitäten der Jugendämter koordiniert werden. Besondere bundesweite Aufmerksamkeit hat NRW durch die im September 2000 von der Landesregierung beschlossene Sofortmaßnahme erregt, den Kommunen des Landes insgesamt rd. 21,1 Mio. DM und den Kreisen je 100.000 DM für Projekte und Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Gewalt und für Toleranz und Respekt zur Verfügung zu stellen. Damit konnte eine Vielzahl von Aktivitäten angeregt und finanziert werden. Eine Übersicht steht erst dann zur Verfügung, nachdem am 30.03. 2002 die Verwendungsberichte vorgelegt wurden und eine anschließende Sichtung erfolgt ist (vgl. aber schon: www.NRWGegenRechts.de und als Überblick über Arbeitsschwerpunkte antirassistischer und interkultureller Projekte in NRW: Informations- und Dokumentationsstelle 2000). Ähnlich wie z.B. in Brandenburg werden die staatlichen Initiativen von einem Partner begleitet, der eine bürgergesellschaftliche Vereinigung, genauer: eine Vernetzung von ca. 300 Organisationen, Unternehmen, Schulen und Vereinen, darstellt. Im Falle NRWs ist dies das im August 2000 durch den Ministerpräsidenten aus der Taufe gehobene "Bündnis für Toleranz und Zivilcourage – gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit" (vgl. www.nrw.de/zivilcourage). Bei der Staatskanzlei ist eine Stabsstelle dafür eingerichtet worden. Rheinland-Pfalz Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat im August 2000 Sofortmaßnahmen gegen Rechtsextremismus beschlossen. Sie umfassen neben repressiv ausgelegten Initiativen, Einmal-Aktionen, Aufrufen (vgl. z.B. www.mainzer-appell.de) und die Gründung des bürgergesellschaftlich orientierten "Aktionsbündnisses gegen Rechtsextremismus und Gewalt" u.a.: die Gründung eines landesweiten Kriminalitätspräventionsrats, der die Aktivitäten der z.Zt. 71 kriminalpräventiven Räte inhaltlich bereichern und bündeln soll, die Bekämpfung rechtsextremer Milieus unter Fußballzuschauern, u.a. mittels der FritzWalter-Stiftung, die Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Zusammenarbeit gegen Rechtsextremismus und Internetkriminalität. Hinzu kommen in Rheinland-Pfalz kriminalpräventive Maßnahmen der Polizei. Sie liegen insbesondere in: der Erarbeitung spezieller Module gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit für die Präventionsprojekte "Prävention im Team" (PIT) (vgl. näher dazu: Pädagogisches Zentrum 2000; vgl. Kap. 3.1.5) und "Erlebnis, Aktion, Spaß und Information" (EASI), dem Aufbau "Kommunaler Bündnisse gegen rechts", der Zivilcourage-Kampagne "Wer nichts tut, macht mit" und in der Kooperation von Polizei und Schule. 33 Maßnahmen des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, die mit Landesjugendplanmitteln durchgeführt werden, zielen vor allem auf: Schulsozialarbeit an Hauptschulen in sozialen Brennpunkten (18 Kräfte landesweit), Jugendberufshelfer, die in 3 Kreisen ausgestiegene Jugendliche an den Arbeitsmarkt heranführen, Beratungs- und Integrationsdienste bzw. –projekte in 9 Städten und Gemeinden für benachteiligte junge Menschen und Migranten. Das Bildungsministerium sieht die schulische Bearbeitung von Gewalt und Extremismus als unterrichtliche, schulbezogene und therapeutische Aufgabe. Es unterstützt u.a. seit 1989 einen ressortübergreifenden Arbeitskreis zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fachtagungen, Seminare, Publikationen (u.a. eine Reflexionshilfe zur "Entwicklung schulischer Anerkennungsverhältnisse"; vgl. Bertram/Helsper/Idel 2000), Lehrerfortbildungen und Schulprojekte (u.a. seit 1992 das Projekt "Wer, wenn nicht wir?"; vgl. www.werwenn.de, seit 1994 die Aktion "Sport und Spiel statt Gewalt auf dem Schulhof" an fast 300 Schulen; vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 2000; seit 1998/99 das Programm zur Primärprävention "PROPP", das sich an die Klassenstufen 5 und 7 richtet und pro Schuljahr innerhalb von 40 Schulstunden in gegenwärtig rd. 150 Schulen ein Trainingsprogramm zur Stärkung von Selbst- und Sozialkompetenz wie der Konfliktbewältigung bietet; seit 2000 die Aktion "Menschenrechte leben – Menschenpflichten annehmen"), die derzeit laufende Revision von Lehrplänen in Hinsicht auf eine stärkere Integration des interkulturellen Aspekts wie der Gewaltprävention und eine Projektgruppe "Interkulturelle Bildung – Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit", die am "Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung" (IFB) Handlungskonzepte erarbeiten soll, und Streitschlichterprogramme in z.Zt. etwa 50 Schulen. Die Landesbeauftragte für Ausländerfragen brachte einschlägige Broschüren auf den Markt und förderte u.a. 36 Projekte im Umfang von 120.000 DM schwerpunktmäßig zum Thema "Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit". Die Landeszentrale für politische Bildung zeichnet u.a. für das bundesweit breit beachtete MultiplikatorInnenpaket "Nein – Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Rechtsextremismus" (vgl. Literaturverzeichnis) und die Publikation "Nicht wegschauen – eingreifen" verantwortlich. Bemerkenswert ist, dass laut einem Bericht über 1999 und 2000 durchgeführte Modellseminare zum Thema "Für Freiheit – ohne Rechtsextremismus" mit SchülerInnen berufsbildender Schulen, die vorgenommene "Reduzierung des kognitiven Lernens zu Gunsten einer handlungsorientierten Vorgehensweise" sich als "richtig erwiesen" hat, "positive Resonanz" von den Schulen und von SchülerInnen kam und der Einbezug von Schulsozialarbeitern als "unbedingt" wünschenswert erachtet wird. (vgl. Bericht...2000, hier: 9, 10). In der Landeshauptstadt Mainz existiert seit neuestem ein lokaler Aktionsplan "Jugend für Toleranz und Demokratie", der nach momentanem Stand allerdings erst in einer kleinen, abgeschlossenen lokalen Analyse besteht, die die Voraussetzung für die Schaffung einer Netzwerkstruktur und konkreter Maßnahmen klären helfen will (vgl. Wink u.a. 2002). Saarland 34 Neben repressiven Maßnahmen der Sicherheitsbehörden, dem wie in jedem anderen Bundesland existierenden Aussteigertelefon (vgl. Kap. 3.1.15), den gängigen Thematisierungen der Thematik Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Unterricht der Schulen und Einzelaktionen und –veranstaltungen ist in Bezug auf das Saarland erwähnenswert: Am 23.08.2000 haben der Landtag und die Landesregierung eine parteiübergreifende Kampagne "Gegen Extremismus – Für ein tolerantes Saarland" beschlossen. Eine landesweite Initiative "Gegen Rassismus – Für ein tolerantes Saarland" hat sich am 27.11.2000 gegründet und fungiert als "Runder Tisch". Mit Erlass vom 02.01.01 wurde die Bestellung eines Landesbeauftragten für pädagogische Prävention beim Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft veranlasst, der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen u.a. auch bei ihrer Anti-Rassismusarbeit unterstützen soll. Das Innen- und Sportministerium propagiert kommunale und interregionale Kriminalprävention und einen Saarländischen Präventionspreis, fordert die Polizeibehörden auf – wie an einigen ausgewählten Schulen bereits erfolgt – an Modellprojekten mitzuwirken, die Gewaltprävention mit erlebnisorientiertem Schwerpunkt (vgl. Kap. 3.1.8), Coolness- und Zivilcourage-Training (vgl. Kap. 3.1.11 und 3.1.6) oder MultiplikatorInnen-Schulung zum Inhalt haben, startet gemeinsam mit dem Bildungsministerium die Initiative "Sport und Prävention", die im März 2001 zur Gründung des Vereins "wir im Verein mit dir" e.V. führte, der in Kooperation mit Vereinen, die Jugendarbeit leisten, Multifunktionsplätze gerade in sozialen Brennpunkten einrichtet, speziell Grundschulkinder mit Sportvereinen bekannt macht und umfangreiche Fortbildungen für BetreuerInnen anbietet (vgl. auch inhaltlich dazu Kap. 3.1.8.). Sachsen Wird im Bereich repressiver Maßnahmen neben den Aktivitäten des Landesamtes für Verfassungsschutz der "Kern des Bekämpfungskonzepts" (Drucksache 3/2461-2, 2; vgl. diese Drucksache auch zum folgenden) in der schon 1991 gebildeten Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) des Landeskriminalamtes gesehen und eine Mischform von Repression und Prävention den polizeilichen "Skin-Zügen" und den seit 1997 im Einsatz befindlichen Mobilen Einsatz- und Fahndungsgruppen (MEFG) zugeschrieben, die mit durchschnittlich 30 Beamten pro Abend bzw. Nacht gezielt an Treffpunkten der rechtsextremistischen Szene und möglicherweise von ihr rekrutierbarer Jugendlicher Präsenz zeigen und dort offensiv Kontrollen vornehmen, so sollen die Sicherheitsbehörden eher präventive Wirkung entfalten durch vor allem: 400 Polizeibeamte und weitere Verfassungsschutzmitarbeiter, die in Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen Informationsveranstaltungen abhalten und als Ansprechpartner fungieren, Projekte "Sport und Gewalt", die Teilnahme am Bund-Länder Projekt "Fairständnis", die Ausschreibung des polizeilichen Präventionspreises "Ideen wanted. Jugend gegen Gewalt", die im Innenministerium eingerichtete "Koordinierungsstelle Prävention" und die z.Zt. in über 60 Kommunen existierenden kriminalpräventiven Gremien. Im Bereich von Pädagogik und Sozialer Arbeit 35 laufen im Rahmen der allgemeinen Jugend- und Bildungsarbeit ohne Sonderfinanzierung zahlreiche Veranstaltungen zu Gewalt- und Rechtsextremismusprävention bzw. zum Thema Fremdenfeindlichkeit (z.B. auch bei der sächsischen LzpB), setzt(e) das sächsische Sozialministerium ohne landesseitige Kofinanzierung das TeilProgramm "Maßnahmen gegen Gewalt und Rechtsextremismus" des Bundes-Programms "Jugend für Toleranz..." mit ca. 837.000 DM um (Einzelheiten s. Drucksache 3/3571-2, vor allem Anlage 1 u. 2), läuft als themenspezifisches Landesprogramm von 2001 bis 2002 das auf Antrag der CDU beschlossene "Landesmodellprojekt" "Sächsische Jugend für Demokratie" mit 750.000 DM an zur Verfügung stehenden Mitteln. Mit ihm ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung betraut. "Ein weiterer Großteil der für Maßnahmen gegen Rechtsextremismus ausgegebenen Haushaltsmittel" ist lt. Sächsischer Staatsregierung "nicht konkret bezifferbar, da diese über polizeiliche Strukturen, wie Sonderkommission Rechtsextremismus, Mobile Einsatz- und Fahndungsgruppen, Fortbildungsmaßnahmen und Einsatz von Bediensteten mit Präventionsaufgaben realisiert werden und damit nicht konkret ausgewiesen werden" (Drucksache 3/4867-2, 3). Das sächsische "Netzwerk für Demokratie und Courage" ist ein Verein, der – auf der Basis eines Vorläuferprojekts, das bereits 1998 startete – seit dem Jahr 2000 aktiv ist und zu etwa 2/3 über Xenos, zu 1/3 über die Mitglieder (gewerkschaftliche und kirchliche Initiativen, Jugendverbände und aktive Einzelpersonen) finanziert wird. Er engagiert sich unter dem Motto "Jugend für Jugend" für themenspezifische Projekttage, vor allem in Schulen, baut z.Zt. und demnächst weiterhin sein Angebot aber auch vermehrt in den Bereichen von Bildung und Qualifizierung, Beteiligungsprojekte in lokaler Partnerschaft, Beratung von Initiativen und Projekten, interregionale und internationale Arbeit auch über Sachsen hinaus in anderen Bundesländern (bisher schon Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Thüringen, wo sich ein ähnlicher Verein "Netzwerk für Demokratie - Courage zeigen" gegründet hat) aus (vgl. auch www.d-a-s-h.org/Dossier/Dossier3/3_05.shtml). Sachsen-Anhalt Die Rechtsextremismus-Bekämpfung hat in Sachsen-Anhalt nach dem guten Abschneiden der DVU (12,9%) bei der Landtagswahl 1998 eine gesteigerte Bedeutung erhalten. 1999 hat die kürzlich abgewählte Landesregierung das "Handlungskonzept für ein demokratisches, weltoffenes Sachsen-Anhalt" verabschiedet (vgl. Staatskanzlei 1999). Eine Stabsstelle in der Staatskanzlei koordiniert die Arbeiten. Im Zentrum steht die Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements zur Stärkung der Demokratie und die Integration ausländischer Mitbürger und Minderheiten. Das Handlungskonzept soll eine Verbindung bisheriger Programme der Landesregierung innerhalb der Jugend-, Bildungs- und Integrationsarbeit sowie der Kriminalitätsbekämpfung mit neuen Initiativen darstellen. Es enthält 10 Punkte, als deren Ausflüsse besonders die folgenden Arbeitszusammenhänge erwähnenswert erscheinen: Ein zivilgesellschaftlich angelegtes "Netzwerk Demokratie und Toleranz in SachsenAnhalt" soll die staatlicherseits angeregten Initiativen in der Bevölkerung verankern helfen und sie mit ihr abstimmen lassen. Der Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte und Strukturen dienen seit 1999 durchgeführte, zuletzt allerdings kaum noch tagende regionale Runde Tische. Die Landesförderung für den Aufbau und die Stabilisierung zivilgesellschaftlicher Strukturen betrug 1999 1,2 Mio., 2000 1,7 Mio. und 2001 2,0 Mio. DM zur Förderung des im Mai 1999 gegründeten Vereins "Miteinander e.V. – Netzwerk 36 für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt" (vgl. auch www.miteinanderev.de). Für 2002 ist dieselbe Summe wie für 2001 zugesagt. "Miteinander" (Geschäftsstelle in Magdeburg) übernimmt landesweite Vernetzungsaufgaben und bietet in z.Zt. vier Regionalen Zentren (Gardelegen, Aschersleben, Roßlau, Weißenfels) Serviceangebote, vor allem in Hinsicht auf Beratung und Fortbildung für lokale zivilgesellschaftliche Kräfte und initiiert sie dort, wo sie sich bislang kaum entfaltet haben, etwa im ländlichen Raum. Zu den Aufgaben gehören auch die ursprünglich im Handlungskonzept den Mobilen Unterstützungsteams (MUT) zugedachten Angebote für Kommunen, Institutionen, Unternehmen und NGOs, die den Umgang mit Rechtsextremismus, Gewalt und ihren Tätern in den lokalen Strukturen verbessern helfen. Sie gehen zu mindestens ¾ in Kooperationsprojekte mit sozialen und pädagogischen Einrichtungen ein, bei denen neben finanzieller Unterstützung überwiegend auch eine inhaltliche Zusammenarbeit zu Stande kommt. Insofern wirken die "Miteinander"MitarbeiterInnen einerseits ähnlich wie die der Mobilen Beratungsteams, bleiben aber nicht wie diese externe BeraterInnen und begleiten auch nicht kommunale Prozesse über den Zeitraum von mehreren Wochen hinweg. Neben der Einrichtung eines Dokumentations- und Informationszentrums, das u.a. vor allem einrichtungsbezogene Fortbildungsangebote für Fachkräfte und MultiplikatorInnen organisiert und für sie auch konkrete Handreichungen und Beratungen bei der Umsetzung von Projekten bereithält, betreibt "Miteinander" auch die Beratung von Opfern (rechtsextremer) Gewalt. Zur Zeit sind mobile Opferberatungsstellen, in ihrer Mehrzahl in Trägerschaft von "Miteinander", in Gardelegen, Dessau (hier in Trägerschaft des Multikulturellen Zentrums), Halle, Halberstadt, Magdeburg und Weißenfels eingerichtet, wobei in Halle und Halberstadt – hier befindet sich auch eine Zentrale Anlaufstelle für AsylbewerberInnen – nur an einem Tag pro Woche Beratung in anderen sozialen Einrichtungen angeboten wird. Zur finanziellen Unterstützung von Opfern verfügt "Miteinander" über einen spendenfinanzierten Opferfonds. Im Bereich der Jugendarbeit hat das Feststellenprogramm, das mit dem Ziel verfolgt wird, personelle Kontinuität in den Jugendeinrichtungen zu sichern, der Ausbau von Schulsozialarbeit (p.a. 4 Mio. DM) und das Fortbildungsangebot des Landesjugendamtes ("Umgang mit rechtsorientierten Jugendlichen und Fremdenfeindlichkeit") neben weiteren Einzelveranstaltungen der Behörde herausgehobene Bedeutung, auch wenn die beiden erstgenannten Förderbereiche eher allgemein strukturschaffende und nicht themenspezifisch ausgelegte Funktionen haben und unklar ist, ob und wie die beabsichtigte Überführung der Kosten in kommunale Verantwortung erfolgen kann. Im Bereich der Kriminalprävention sind u.a. zu nennen: die Gründung eines Landespräventionsrats am 06.09.1999 mit einer seit 2001 eingesetzten Arbeitsgruppe zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, in der allerdings mehr ministerielle Vertreter als NGOs sitzen, die bereits seit 1994 bestehende landesweite "Koordinierungs- und Ermittlungsgruppe Rechts" (KEG-R), eine LKA-Hotline für Hinweise aus der Bevölkerung, eine spezielle Jugendberatung bei den Jugendkommissariaten der Polizei, diverse Anti-Gewaltprojekte, z.B. im Sportbereich, die Einleitung des Landes-Aussteigerprogramms durch aufsuchende Gespräche mit gewaltbereiten Rechtsextremisten. 37 Der 1999 und 2000 zu verzeichnende Rückgang rechtsextremistischer Gewalt-Straftaten im Lande wird von den Verantwortlichen im Zusammenhang mit diesen Anstrengungen gesehen. Innerhalb des Schulbereichs wird gesteigerter Wert auf soziales Lernen, Partizipation und dabei handlungsorientierte und fächerübergreifende Ansätze gelegt sowie die interkulturelle Bildung und Begegnung verstärkt. Eine Reihe von Projekten thematisiert Demokratie und Toleranz und die Aufarbeitung der NS-Zeit. Die Lehrerfortbildung wird entsprechend ausgerichtet. Ein seit 1997 jährlich ausgelobter "Schülerfriedenspreis" soll einschlägiges Engagement prämieren. Die Förderung der Eine-Welt-Häuser in Magdeburg und Halle, des multikulturellen Zentrums in Dessau und der Interkulturellen Projektkoordination Halle (IKAP) als zentralen Integrationseinrichtungen in den drei großen Städten soll Basisstrukturen für die Integrationsarbeit schaffen. Ein "Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit" – analog dem bundesweiten "Bündnis für Arbeit" zusammengesetzt – betreibt – u.a. im Rahmen von Xenos – die Stärkung des internationalen Austausches im Rahmen der Berufsausbildung. Besondere landesspezifische Bedeutung erhält diese Initiative für mehr Weltoffenheit und Toleranz auch dadurch, dass in den vergangenen Jahren 170 ausländische Unternehmen 30.000 Arbeitsplätze geschaffen haben, aber nur 5.400 Ausländer und Ausländerinnen im Bundesland leben. Im Bereich der außerschulischen politischen Bildung bietet die LzpB von Sachsen-Anhalt diverse Seminare, Workshops und Publikationen sowie ein "Theaterprojekt gegen Rechts" mit dem Hannoveraner Klecks-Theater an, das im Herbst 2001 in 12 Schulen des Landes von je etwa 100-120 Schülerinnen gesehen wurde (vgl. zu theaterpädagogischen Projekten inhaltlich auch Kap. 3.1.9). Als Kofinanzierung von Xenos hat das Land im Jahre 2001 1,2 Mio. DM zur Verfügung gestellt, die allerdings wegen des späten Projektestarts nicht mehr abgerufen werden konnten. In den kommenden Jahren sollen voraussichtlich 3,5 Mio. DM eingebracht werden. Schleswig-Holstein Neben repressiven Maßnahmen als erstem strategischen Feld (wie Einrichtung von Sonderdezernaten bei Staatsanwaltschaften, Einsetzung spezieller polizeilicher Ermittlungsgruppen) versucht das Land auf der Grundlage einer Analyse, die die Ursachen von Rechtsextremismus u.a. explizit dem "Verlust von Anerkennung, sozialen Sicherheiten und sozialem Zusammenhalt" (vgl. Drucksache 15/493, 48) zuschreibt, Wirkung zu erzielen auf zwei weiteren strategischen Feldern, nämlich durch Präventionsarbeit und die (Weiter-) Entwicklung einer demokratischen Öffentlichkeit. Dazu zählt vor allem: die Teilnahme an den Kampagnen "Fairständnis" und "Gesicht zeigen", die Gründung eines zivilgesellschaftlich verankerten "Gesellschaftlichen Bündnisses gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus" auf Anregung der Ministerpräsidentin im vergangenen Herbst, die Einrichtung eines Landesrats zur Kriminalitätsverhütung mit einem Schwerpunkt auf Rechtsextremismusbekämpfung, den Beginn der Erarbeitung eines umfangreichen Integrationskonzeptes für MigrantInnen, das im Frühjahr 2002 vorliegen soll, die Schaltung eines Bürgertelefons zum Thema Rechtsextremismus, Schwerpunktsetzungen in der (politischen) Erwachsenenbildung (v.a. über den Landesverband der VHSn, Bildungsstätten und die LzpB), zielgruppenspezifisch insbesondere bei Kursen zum 38 nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses und bzgl. der Kooperation der Einrichtungen mit Kriminalpräventiven Räten (weiteres dazu ebd., 49ff.), in der Jugendarbeit und –bildung durch diverse Projekte der politischen Jugendbildung, Streetwork (z.B. in Rendsburg), Kooperation von Jugendhilfe und Schule, interkulturelle und internationale Ansätze, Anti-Aggressionstrainings, Partizipationsprojekte (vgl. inhaltlich zu diesen Akzenten die Unterkapitel von Kap. 3.1). Von Juni 2000 bis März 2001 wurde eine Bestandsaufnahme der im Lande durchgeführten allgemein gewaltpräventiven Maßnahmen in Pädagogik und Sozialer Arbeit vorgenommen. Sie ergibt zusammen mit weiteren Planungen der Landesregierung: die von den Befragten Jugendpflegern, Jugendringen etc. gesehene Notwendigkeit, Gewaltprävention vernetzt und langfristig anzulegen und Schwerpunkte in Kindertagesstätten und bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus zu setzen. Dazu kann dienen, die Etablierung von nachhaltig wirksamen Konfliktlotsenund Streitschlichtungsprogrammen an Ende 2000 mehr als 60 Schulen (mit dem Selbstattest, hierbei mit anderen Ländern gemeinsam eine Vorreiterrolle zu spielen; vgl. ebd.), die Dokumentation des seit 1994 bis 1998 an 61 Schulen durchgeführten OlweusGewaltpräventionsprogramms und die Möglichkeit, dies weiterzuführen, die Weiterführung der seit 1997 betriebenen Revision der Lehrpläne in Hinsicht auf eine verstärkte Auseinandersetzung mit den Themen "Gewalt", "Fremdenfeindlichkeit" und "Rechtsextremismus" (ein Fünftel der Schulen setzt sich bislang im Rahmen von Projekttagen mit den Thematiken auseinander; vgl. ebd. 60f.), Schwerpunktsetzung in Schulen auf interkulturelle Bildung; u.a. gemeinsam mit dem Anne-Frank-Haus Umsetzung des Konzepts "Das sind wir" und seit 1997 Umsetzung von PIT (s. Kap. 3.1.5) im Sek.I-Bereich, modifiziert in Grundschulen, eine Intensivierung von Elternarbeit, die Verbreiterung der Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe, die seit 1995 angegangene Öffnung von Schule zu schulbezogenen Netzwerken, die auch Freizeitpädagogik und außerschulische Bildung und Beratung beinhalten, um einer Fokussierung auf Problemgruppen entgegenzuwirken und breit präventive Ansätze der Etablierung eines demokratieförderlichen Schulklimas zu 'fahren', Beteiligung an "Schule ohne Rassismus", der Ausbau thematisch einschlägiger Fortbildungsangebote im "Landesinstitut SchleswigHolstein für Praxis und Theorie der Schule", die kooperative Arbeit von lokalen Kriminalpräventiven Räten und Runden Tischen als Planungs- und Koordinationsgruppen vor Ort, das Aktionsprogramm "Kinderfreundliches Schleswig-Holstein" und das Präventionsprogramm "Schleswig-Holstein – Kinder stark machen". Thüringen Ein Thüringer Handlungskonzept, das etwa dem von Brandenburg oder Sachsen-Anhalt gleichen würde, existiert nicht. Eine Erklärung des Innenministers in der 25. Plenarsitzung des Thüringer Landtags über die "Bekämpfung von Extremismus und politisch motivierter Gewalt" lässt aber die Konturen der Thüringer Politik erkennen. Danach hat angeblich das repressive Vorgehen der Polizei (seit März 2000 Konzept EBK) zu einer deutlichen Verunsicherung der Szene geführt. Dessen ungeachtet wird eine ressortübergreifende 39 Zusammenarbeit propagiert, um auch stärker präventiv angelegte Maßnahmen zur Geltung kommen lassen zu können: Das Justizministerium hat schon 1995 eine Initiative gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit ins Leben gerufen. Mit dem Kultusministerium gemeinsam wird der rechtskundliche Unterricht in den Schulen intensiviert. Die Jugendstation in Gera soll durch zügige Reaktion auf Straftaten Jugendlicher u.a. auch mit zur Verhinderung der Ausbreitung von rechtsextremen Straftaten beitragen. Das Kultusministerium räumt sozialem Lernen, Demokratieerziehung und der Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Rechtsextremismus durch eine entsprechende Lehrplangestaltung Raum ein (zur inhaltlichen Bedeutung vgl. Kap. 3.1.3 und 3.1.5). Die Landeszentrale entfaltet thematisch einschlägige Veranstaltungen im außerschulischen Bereich. Die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora betreiben historische Aufklärung (vgl. inhaltlich dazu Kap. 3.1.1). Das Innenministerium beteiligt sich u.a. seit 1992 an der von den Innenministern von Bund und Ländern 1992 gestarteten Kampagne "Fairständnis" und hat ab August 2000 eine Beratungs-, Informations- und "Koordinierungsstelle für Gewaltprävention" mit 13 MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Ministerien eingerichtet, die auch ein Info-Telefon betreibt und einen mobilen Beratungsdienst offeriert (vgl. www.gemeinsam-gegengewalt.de). Jährlich ca. 70 interkulturelle Projekte werden durch die Ausländerbeauftragte seit 1993 gefördert. Das Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit sorgt für die thematisch zugespitzte Fortbildung von MitarbeiterInnen in der Jugendhilfe und unterstützt Bestrebungen der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule. Die Stadt Jena hat ein eigenes "Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Intoleranz" durch den Runden Tisch der Stadt am 27.06.2001 beschlossen. In ihm werden stadtbezogen wünschenswerte Maßnahmen beschrieben. Außerdem wird eine kommunale Koordinierungsstelle entsprechender Aktivitäten gefordert. 1.3 Fazit Von der Anzahl der einbezogenen Projekte her bislang am umfassendsten für die Evaluation (sozial)pädagogisch ausgerichteter politischer Programme gegen Gewalt und Extremismus bei Jugendlichen ist der Endbericht über das AgAG-Programm. Dabei handelt es sich um die Auswertung des von der Bundesregierung aufgelegten Programms, das von 1992-1996 rd. 140 Projekte im Osten Deutschlands einschloss (vgl. Böhnisch u.a. 1996). Allerdings geht sie schwerpunktmäßig auf die infrastrukturellen Effekte des Programms ein. Direkte "AntiGewalt-Effekte" werden nur sehr grob beschrieben: Man meint zwar eine "deeskalierende Wirkung" feststellen zu können und konstatiert die Wichtigkeit der Projekte als "Kontrastund Differenzprogramm zu extremen Gruppierungen und ihrer Magnetwirkung", vermag diese aber nicht auf die Wirksamkeit bestimmter pädagogischer Strategien zurückzuführen, sondern verweist – etwas nebulös – auf die Wirkung der "Projektdynamik selbst" (ebd., 196; vgl. auch Hafeneger 1995, 506). 40 Für eine Gesamteinschätzung und -bewertung der neueren Bundes-Programme ist es noch zu früh, vor allem deshalb, weil sie erst seit kurzem laufen und Evaluationen weder für das gesamte Programm, noch für seine Teile oder einzelne seiner Maßnahmen vorliegen. Gleichwohl wird seine Anlage bereits an manchen Stellen als unglücklich bzw. optimierungsbedürftig betrachtet. Dies betrifft, abgesehen von prinzipiellen Bedenken bezüglich der Befristung der Förderzeiträume (vgl. Heitmann 2002; Kohlstruck 2002), vorrangig zwei Bereiche: Zum einen erscheint der Wissenschafts-Praxis-Zusammenhang zu wenig berücksichtigt. Der Stellenwert von Evaluation wird anscheinend (zu) niedrig angesiedelt. Dies gilt vor allem in Hinsicht auf die Auswertung von Erfahrungen mit einzelnen Maßnahmen. Nur ein geringer Teil der insgesamt geförderten Maßnahmen sieht überhaupt Evaluation vor. Bei den Evaluationen der Programme bestehen offenbar – sehen wir dabei von den eben nicht evaluativen, sondern schlicht dokumentarischen Arbeiten des DJI ab – nicht unerhebliche Startprobleme. Absehbar ist, dass sie die Aussagekraft der Evaluationen in Mitleidenschaft ziehen, weil eine systematische Einbindung in die Planung bzw. eine stringent verfolgte Prozessbegleitung von Anfang an nicht mehr möglich ist. Damit muss von vornherein eine wie auch immer im einzelnen methodisch durchführbare 'Vermessung' der Ausgangssituation unterbleiben und wird die Auswahl an denkbaren Methoden der Evaluation deutlich eingeschränkt. Zum anderen fehlt dem Programm ein Erfahrungsaustausch- und Fortbildungsstandbein, mit dem sowohl das Problem der Weiterqualifizierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie der Kooperation der Projekte miteinander als auch das der Anbindung ihrer Praxiserfahrungen an wissenschaftliche Diskurse angegangen werden könnte (vgl. auch Heitmann 2002). Dabei ist nicht nur an Qualifizierungsdefizite in ostdeutschen Teams zu denken, sondern auch zu berücksichtigen, dass im Xenos-Programm Träger aus dem Bereich der Arbeitsmarktqualifizierung vertreten sind, deren MitarbeiterInnen im allgemeinen nicht auf den reflektierten pädagogischen Umgang mit Rechtsextremismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt spezialisiert sind. Unbeschadet dessen wirkt sich das weitreichende Fehlen von Austausch- und Fortbildungsstrukturen insbesondere bei "Civitas" absehbar negativ aus, zumal hier neuartige Ansätze mit komplexen Anforderungsstrukturen angegangen werden und die MitarbeiterInnen jetzt schon "umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Supervision" "fordern" (Rommelspacher u.a. 2002, 63, vgl. auch ebd., 58). Sie sehen in ihrer großen Mehrheit die Notwendigkeit zur Aneignung theoretischer (75% der MitarbeiterInnen) und methodischer (53%, bei den MBTs sogar 67% der MitarbeiterInnen) Kompetenzen (vgl. ebd., 67f.). Unterstellt man die Absicht der Geldgeber, mit dem Programm – zumal in Ostdeutschland auch strukturbildende Funktionen erfüllen zu wollen, wie dies mit dem AgAG-Programm z.T. gelungen ist, so ist der Umstand mangelnden Flankenschutzes durch Vernetzungs-, Kooperations- und Fortbildungsgelegenheiten auch in dieser Hinsicht als Hindernis zu betrachten. Dies ist um so unverständlicher, als man im AgAG-Programm – substanziiert in den Aktivitäten des "Informations-, Forschungsund Fortbildungsdienstes Jugendgewaltprävention" (IFFJ) – keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Die Kompensation beider Schwachstellen wäre jeweils mit der Etablierung von programmbegleitenden Diskurskontexten und ihrer Verzahnung sowohl untereinander als auch mit den Debatten politischer Entscheidungsträger und allgemeiner Sozialer Arbeit anzugehen. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass im Vergleich zu AgAG durch die Ausrichtung des Programms eher Zielgruppen erreicht werden, die nicht selber als Problemträger auftreten. Insbesondere im Programmteil Civitas, aber auch jetzt schon absehbar in Teil 2, dem stark auf 41 politische Bildung orientierten Segment, werden junge Leute, die als besonders schwierig gelten, kaum erreicht. Arbeit mit rechtsextrem Orientierten und rechtsextrem unmittelbar Gefährdeten gerät zugunsten der Stärkung von zivilgesellschaftlichen Strukturen und Opferhilfe ins Hintertreffen. Hier lauert die Gefahr, dass eher die Selbstbestätigung der Demokraten und die "Aufklärung der Aufgeklärten" betrieben wird als konkrete Arbeit mit Problemgruppen. Soziale Arbeit in und mit rechten Szenen wird nach dieser Einschätzung voreilig verkannt, als Zeichen falsch verstandener Akzeptanz gewertet und pauschal als 'Glatzenpflege auf Staatskosten' diskreditiert. Wo sie beharrlich betrieben wird, wird dann von Bedenkenträgern das missverständliche Etikett der "akzeptierenden Jugendarbeit" aufgeklebt und die Arbeit damit als programminkompatibel markiert. In diesem Fall wird dann flugs das angebliche "Scheitern" der Arbeit mit faktischen und potenziellen Tätern konstatiert, bevor man sich überhaupt näher mit der Praxis aufsuchender Arbeit in rechts orientierten Jugendszenen befasst hat. Manche befürchten schon einen Rückfall in eine Pädagogik der Ausgrenzung und die Politik des Abschreibens dieser Jugendlichen, wie sie noch bis in die Anfänge der 90er Jahre betrieben wurden. Es erhebt sich dann die Frage, wie ohne Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit Re-Integration überhaupt noch bewerkstelligt werden kann. Es gilt sich zu vergewissern: "Veränderung – ein Zentralbegriff der Pädagogik – braucht als Basis eine wertschätzende Beziehung. Diese Haltung nimmt die Person als solche an, aber nicht das Geschehene oder die begangene Tat" (Heitmann 2002, 150). Wurde die Täterlastigkeit von AgAG mit dem neuen Programm, insbesondere mit Civitas, vielleicht durch Opferlastigkeit ersetzt und damit 'das Kind mit dem Bade ausgeschüttet'? Bezüglich der Inhalte, der Anlage und des Umfangs von Landes-Programmen und – Aktivitäten ist insgesamt festzuhalten: Ungeachtet der Diskussion um Sonderprogramme lassen sich, auch wenn einzelne Strategien noch sehr konventionell zugeschnitten sein mögen (vgl. z.B. die NPD-Verbotsdiskussion oder die Versuche einer Intensivierung der historischen Bildung über den Nationalsozialismus zur Bearbeitung des modernisierten Rechtsextremismus) - in der Summe bilanzierend – bestimmte Neuausrichtungen der Gewalt- und Rechtsextremismus-Bekämpfung registrieren. Dies betrifft das Vorgehen von Sicherheitsbehörden, aber auch von Pädagogik und Sozialer Arbeit. Von staatlichen Stellen werden inzwischen neben repressiven Maßnahmen überall verstärkt auch präventive Maßnahmen 'gefahren' und meist über ressortübergreifende Arbeitsgruppen und/oder Koordinierungsstellen aufeinander abgestimmt. Die Sicherheitsbehörden haben ihre diesbezüglichen Angebote in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Sie sind über ihre Vertreter vermehrt in Schulen präsent und arbeiten auch zunehmend mit der Öffentlichkeit und Sozialer Arbeit insgesamt, im besonderen aber mit der Jugendhilfe zusammen. Diese Kooperation betrifft vor allem die Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Runden Tischen, Kriminalpräventiven Räten und – vor allem bezüglich der Polizei – zusätzlich an Aktionen, die im Kontext von Gewaltprävention stehen wie Sportturniere u.ä. Themen- und problemfokussierte Inhalte der Pädagogik und Sozialen Arbeit streuen – wie erwähnt und im einzelnen oben dargestellt – breit, lassen aber dennoch gewisse Schwerpunktsetzungen erkennen. Sie betreffen vor allem die folgenden Punkte: Innerhalb von Schule werden seit den letzten 1 bis 2 Jahren deutlich vermehrt Programme und Konzepte verfolgt, die eine Revision der Lehrpläne in Hinsicht auf eine stärkere Berücksichtigung der Themenfelder Rechtsextremismus, Minderheiten- und speziell Fremdenfeindlichkeit sowie Gewalt und Gewaltfreiheit generell vornehmen, 42 allgemein soziales Lernen fördern und personale Kopetenzen stärken wollen (vgl. zu entsprechenden Konzepten Kap. 3.1.3), insbesondere aber konstruktive Konfliktlösung, Streitschlichtung und Mediation im Zentrum haben (vgl. 3.1.4), die Öffnung der Schule zum Gemeinwesen, aber auch für Polizei und Verfassungsschutz betreiben und/oder Demokratie-Lernen auf die eine oder andere Weise (z.B. "Demokratie Lernen", "Schule ohne Rassismus"; vgl. inhaltlich Kap. 3.1.5) propagieren und umsetzen. Im außerschulischen Bereich sind schwerpunktmäßig Ansätze zu konstatieren, die einschlägige thematische Akzentsetzungen in den Angeboten der Jugend-, BildungsKultur- und Sozialarbeit, insbesondere auch in der MultiplikatorInnenfortbildung (vor allem von Lehrpersonen und Fachkräften der Sozialen Arbeit, hier insbesondere der Jugendarbeit, weniger noch der Sport- und sonstigen Vereinsfunktionäre) vornehmen, über die Ausschreibung von Wettbewerben, Kampagnen und Preisen Anstöße geben wollen (vgl. dazu Kap. 3.1.13), eine grundsätzliche Verbesserung der Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und Jugendhilfe intendieren, die dauerhaft angelegte gemeinwesenorientierte Vernetzung von Gruppen der Zivilgesellschaft, politischen Verantwortungsträgern, sozialen Einrichtungen und Ordnungs- bzw. Sicherheitsbehörden bzw. der jeweiligen Elemente dieser Gruppierungen untereinander anstreben (vgl. dazu Kap. 3.1.14), regionale bzw. mobile Beratung für die lokalen Akteure anbieten (vgl. ebd.), interkulturelle Angebote ausbauen und z.T. auch eine Institutionalisierung der Antidiskriminierungsarbeit realisieren (vgl. dazu Kap. 3.1.17). Die im Osten Deutschlands verschärft zu Tage tretende Problemlage rechtsextremer Gewaltsamkeit wird hier offensichtlich – jedenfalls in den Ländern mit SPD-geführten Regierungen – wohl aufgrund der besonderen geschichtlichen und aktuellen Ausgangslage deutlicher noch als im Westen damit gekontert, dauerhaft tragfähige zivilgesellschaftliche Strukturen zu etablieren, die nicht zuletzt auch die Funktion übernehmen können, eine Gegenöffentlichkeit als Antwort auf die Bestrebungen von Rechtsextremen zur Erkämpfung "national befreiter Zonen" herstellen zu können, damit zusammenhängend viel systematischer als im Westen mit Hilfe der Etablierung von mobilen Beratungsteams angegangen, auch als Herausforderung für die Entwicklung von Ansätzen der Gewöhnung an gewaltfreies interkulturelles Zusammenleben begriffen, noch stärker als im Westen Deutschlands mit historischer Aufklärung über den Nationalsozialismus zu beheben versucht, vermutlich deshalb, weil hier Informationslücken aufzuarbeiten sind, die durch die Verengung der diesbezüglichen politischen Bildung zu DDR-Zeiten entstanden sind und – mit wesentlicher Hilfe von Civitas – flächendeckend mittels Opferberatung bearbeitet (vgl. auch Kap. 3.1.16). Es drängt sich der Eindruck auf, dass SPD-geführte Landesregierungen eher dazu neigen, die Aktivitäten in themenspezifischen Aktionsprogrammen oder Handlungskonzepten zu bündeln. Ihnen werden dann im bürgergesellschaftlichen Raum i.d.R. von Regierungsseite aus angeregte Kooperationspartner in Gestalt von "Bündnissen" o.ä. zur Seite gestellt. Schon daran wird deutlich, dass dem Problem selbst und präventiven Ansätzen sowie der Schaffung 43 demokratischer (Gegen-)Öffentlichkeit im besonderen ein hoher Rang eingeräumt wird. Unionsgeführte Regierungen gewichten demgegenüber zumeist repressive Maßnahmen der Polizei und des Verfassungsschutzes stärker und sehen Prävention einerseits zwar als eine zu verstärkende Aufgabe der Sicherheitsbehörden, andererseits aber augenscheinlich im allgemeinen als nicht so bedeutsam, dass außerhalb des Regelangebots von Schule und Jugendhilfe weitergehende spezielle Maßnahmenförderungen als dringend notwendig erachtet würden. Sieht die Opposition in einer solchen Politik im Regelfall unverzeihliche Unterlassungssünden, so werden z.T. entsprechende Aktionsprogramme vom politischen Gegner ausdrücklich mit dem "Aktionismus"-Verdacht belegt (vgl. z.B. Thüringer Landtag 2000, 1688). Genaue Angaben über die in den öffentlichen Haushalten jeweils für die Rechtsextremismus-, Fremdenfeindlichkeits- und Gewaltbekämpfung eingesetzten Mittel lassen sich nicht machen. Wo keine Sonderprogramme aufgelegt werden, wird darauf verwiesen, dass entsprechende Aktivitäten innerhalb der Regelförderung – etwa auch durch gezielte thematische Schwerpunktsetzungen – entfaltet werden. Sie sind deshalb in ihrem finanziellen Umfang nicht exakt zu beziffern. Eine solche Politik sieht sich durch das Argument gestützt, Gewaltund Rechtsextremismus-Bekämpfung als Querschnitts- und Daueraufgabe betrachten zu müssen und deshalb kurzfristige Aktionsprogramme für Augenwischerei zu halten. Wo Sondergelder fließen, werden zwar mehr oder weniger deutliche politische Signale gesetzt. Es ist damit aber nicht gesagt, dass nicht auch in der laufenden pädagogischen und sozialarbeiterischen Arbeit thematisch einschlägige Angebote gemacht werden oder Gelder womöglich nur 'umgetopft' werden, indem sie in der Regelversorgung gestrichen und unter dem Rubrum "Rechtsextremismus- und Gewaltbekämpfung" o.ä. ausgewiesen werden. Solcher "Verprojektierung" sind bei ungesicherter kontinuierlicher Förderung der allgemeinen Jugendarbeit kontraproduktive Effekte zuzuschreiben (vgl. Kohlstruck 2002). Mindestens in einem Teil der Praxis gilt es als offenes Geheimnis, im Kampf um öffentliche Gelder Adressaten der Arbeit 'antragslyrisch' geradezu als tatsächliche oder potenzielle Gewalttäter stigmatisieren zu müssen, um die Regelversorgung zu retten. Z.T. verbirgt sich hinter Sonderprogrammen auch – wie schon bei AgAG – die Absicht, Regelförderung über sie in Gang zu setzen bzw. aufrecht zu erhalten. Insider vermuten, dass in den neuen Ländern bis zu 2/3 der allgemeinen Jugendarbeit über thematisch spezifizierte Sonderprogramme gefördert werden. Evaluationen der Bundes-Programme sind – wie erwähnt – vorgesehen bzw. in Auftrag gegeben, aber noch nicht abgeschlossen oder wenigstens bis hin zu Zwischenergebnissen vorangetrieben. Evaluationen der Landes-Programme, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen könnten, werden zwar in manchen Fällen erwogen (etwa in Brandenburg), liegen aber gegenwärtig nicht vor. Für einzelne Maßnahmen existieren sie nur in Ausnahmefällen (vgl. dazu näher Kap. 3.1). Ähnlich sieht im übrigen auch der Stand der Evaluation von kommunalen Projekten aus. Zwar sind die Städte und Gemeinden stolz darauf, in 1.800 Gemeinden und Städten kommunalpräventive Räte vorweisen, jedes Jahr insgesamt, also nicht nur zur Gewalt- und Rechtsextremismusbekämpfung, gut 10 Mrd. DM für den Bereich der Jugendhilfe ausgeben und 1 Mrd. DM für die Förderung von Sportvereinen ausweisen zu können, was jedoch letztlich dabei 'herauskommt', bleibt im allgemeinen unausgewertet. Gleiches gilt für Deutschland im strengen Sinne auch hinsichtlich verstärkter Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit. Allerdings lassen amerikanische Studien ihre Effektivität erkennen (vgl. Sherman 1993) 44 Aufgrund dieser Ausgangslage lässt sich über erzielte Wirkungen kaum Schlüssiges aussagen. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten höchst fraglich ist deshalb auch der nicht selten in Reden von PolitikerInnen auftauchende Hinweis auf eine Verbindung des jeweils verfolgten oder auch unterlassenen Konzepts mit Effekten der Reduktion, der Stabilisierung oder der Zunahme von rechtsextrem und fremdenfeindlich motivierten Taten oder Wahlergebnissen. Solche argumentativen Verknüpfungen sehen über die Vielzahl von denkbaren Einflüssen hinweg, die für das eine oder das andere verantwortlich zeichnen können. Außerdem haben sie im Regelfall nicht die unterhalb registrierter Straftaten bzw. Stimmenprozente liegenden politischen Haltungen und Einstellungen im Blick, die als Vorfeld und Resonanzraum für einschlägige Handlungen aufzufassen sind. Schon diese wenigen Problemanzeigen machen deutlich, wie schwierig die Anlage von Evaluationen politischer Programme ist und mit welchen Problemen die Befriedigung des Interesses an Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen zu kämpfen hat (vgl. dazu auch Kap. 2.5). Dennoch führt kein Weg an der Erhöhung des Stellenwerts von Evaluation vorbei, um die Qualität der Leistungen, ihre Zielorientierungen, Durchführungsweisen, Ergebnisse und Wirkungen systematisch überprüfen zu können. Schließlich müssten daran Geldgeber einerseits wie Träger und Mitarbeiterschaft andererseits gleichermaßen Interesse haben. Bei den einen mag dabei die Intention dominieren, rationale finanzielle und konzeptionelle Steuerungsprozesse vornehmen zu können. Bei den anderen mag das formative Anliegen an Optimierung überwiegen. Trotz solch verschiedener und z.T. gegensätzlicher Erwartungen wird sich weder die Öffentliche Hand noch die Sozialarbeit resp. die Pädagogik leisten können, mit jener Unbekümmertheit, ja teilweisen Willkürlichkeit Strategien und Konzepte zu verfolgen, wie sie bisher üblich ist. Droht erstere ansonsten an Kostendruck, Effizienz und Ausgabendisziplin zu scheitern, so stehen die Zweitgenannten am Abgrund der Delegitimation. Um der Arbitrarität von sog. 'Ansätzen' entgegenzusteuern, stellt sich z.B. aus Sicht von Förderungspolitik konkret die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, Programme von vornherein so anzulegen, dass zumindest bei längerfristig laufenden Maßnahmen grundsätzlich bei Antragstellung und –bewilligung von einer Sicherstellung von Evaluation in geeigneter Form ausgegangen werden kann. Hierzu wäre dann prinzipiell ein bestimmter Prozentsatz der Förderungssumme vorzusehen. Könnte so Maßnahmenevaluation stärker gesichert und verbreitert werden, so wäre noch genereller zu prüfen, inwieweit zum einen der Vermutung von Irrationalität und zum anderen der zumindest festzustellenden Intransparenz von Entscheidungen über Programmstrukturen entgegengearbeitet werden könnte. Hier böten sich Meta-Analysen an, die die Bedingungen, unter denen Programme etabliert werden, also den Konstruktions- und Implementationsprozess von Programmen, zu untersuchen hätten. Das Interesse von Förderpolitik an solchen Studien müsste in dem Maße wachsen wie sie den an sie gerichteten Vorwurf, letztlich nur dem 'muddling through'-Prinzip zu folgen, als ungerechtfertigt empfindet und aktiv die Herstellung von Transparenz betreiben will. Ein Handlungsbedarf ergibt sich aus politischer Sicht aber spätestens dann, wenn etwa im Diskussionszusammenhang des Bundesprogramms "Jugend für Toleranz und Demokratie", aber auch in der Debatte um Sonderprogramme der Länder, unterstellt wird, die Randlage der Evaluation innerhalb dieser Programme sei Beleg dafür, dass ein wirkliches Evaluationsinteresse auf Seiten der Politik gar nicht bestehe, weil man sich im Grunde mit Symbolpolitik zufrieden gebe. Danach geht es PolitikerInnen nur darum, möglichst medienwirksam irgendein Handeln als Reaktion auf akute Problemlagen vorweisen zu können, ohne sich um seine Problemadäquatheit ernsthaft zu scheren. Schlussfolgeorientierte, also ohne politischen Entscheidungsdruck agierende wissenschaftliche Evaluation (vgl. Wottawa/Thierau 1990) wäre nicht zuletzt auch dazu geeignet, diesem Vorwurf den Wind aus den Segeln zu nehmen. 45 2. Pädagogische und sozialarbeiterische Grundlagen Sämtliche Konzepte pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxis stehen zwangsläufig in einem disziplinären und professionellen Diskurszusammenhang, der auf sie selbst Auswirkungen zeitigt. Ihn in seiner gesamten Bandbreite nachzuzeichnen, ist hier ebenso wenig die wesentliche Aufgabe wie seine theoretischen Verästelungen und historischen Bezüge im einzelnen aufzuzeigen. Vielmehr erscheint eine Selektion bestimmter Aspekte hinreichend, die in unserem Falle nach dem Kriterium der Praxisrelevanz vorgenommen wird. Im Hinblick auf Kampagnen, Wettbewerbe, Projekte, Initiativen, Bildungs- bzw. Unterrichtseinheiten und sonstigen Maßnahmen im Themenbereich Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zeigen sich insbesondere Einflüsse, die aus paradigmatischen Überlegungen (2.1), damit in Verbindung stehenden strategischen Ausrichtungen (2.2) und gestaltgebenden Formaten (2.3) erwachsen. Hinzu kommen Überlegungen aus der Debatte um den Theorie-Praxis-Transfer (2.4). Daneben wirkt zunehmend die Diskussion um Evaluation und Qualitätsentwicklung prägend (2.5). Schließlich werden Professionsverständnisse wirksam, die zu Grenzziehungen in Hinsicht auf die prinzipielle Reichweite von Pädagogik und Sozialer Arbeit führen (2.6). In der vom Kernthema dieser Arbeit gebotenen Kürze sind diese Punkte im folgenden deshalb knapp zu erörtern. 2.1 Paradigmen Praktische Pädagogik und Soziale Arbeit werden von fundamentalen Paradigmen mitgesteuert, die disziplinär verhandelt und professionell wirksam werden. Beide Professionen stützen sich auf zentrale Bezugswissenschaften: die Pädagogik im Kern auf die Erziehungswissenschaft, die Soziale Arbeit entweder auf die freilich noch im Prozess eines disziplinären Selbstfindungsprozesses befindliche Sozialarbeitswissenschaft (vgl. Puhl 1996; Bango 2001) oder dort, wo ihr der Rang einer eigenständigen Disziplin noch nicht zugesprochen wird, ebenfalls auf die Erziehungswissenschaft; dies trotz ihrer breiteren Fundierung durch multidisziplinäre Sichtweisen, die im wesentlichen auch soziologische, psychologische, politologische und rechtswissenschaftliche Erkenntnisse einbeziehen,. Forschen wir dessen ungeachtet in den einschlägigen Debatten dieser Disziplinen nach solchen paradigmatischen Denk- und Herangehensweisen, die Implikationen u.a. gerade für den von uns untersuchten themenspezifischen Problem- und Praxisbereich beinhalten, so stoßen wir auf zwei, sich in ihren Ausläufern teilweise auch innerhalb der jeweils anderen Disziplin wiederfindende Diskurse: innerhalb der Erziehungswissenschaft auf die Kontroverse über den Stellenwert von "Wissen" und "Erfahrung", genauer: von "Wissensvermittlung" auf der einen und "Erfahrungslernen", "Aneignung" und Lernen als selbstgesteuerte Wirklichkeitskonstruktion auf der anderen Seite, innerhalb der Sozialarbeitswissenschaft – hier gedacht einschließlich einer erziehungswissenschaftlich grundierten wissenschaftlichen Sozialpädagogik – auf die Debatte um die Ablösung des "Hilfediskurses" durch den "Gestaltungsdiskurs" (vgl. z.B. Niemeyer 1999, mit Bezug auf die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements durch Soziale Arbeit auch Möller 2002a). Die zwischen diesen Polen angesiedelten Spannungsfelder drücken auch den pädagogischen und sozialarbeiterischen Anstrengungen zur Behebung der zerstörerischen sozialen und 46 politischen Folgen von Desintegrationsprozessen sowie den Bemühungen zur Stärkung von Integrationspotenzialen ihren Stempel auf. Zentraler Gegenstand der Erziehungswissenschaft ist unstrittig das Lernen bzw. die Vermittlung von Lernstoff und/oder von Methoden und Techniken des Lernens selbst. Wer immer sein Subjekt sein mag – etwa ein Individuum, eine Gruppe oder eine Organisation -: Lernen bringt eine Veränderung der Ausgangslage mit sich: je nach der von ihm berührten Ebene z.B. eine Veränderung der Kognitionen, eine Veränderung des Fühlens, eine Veränderung von Verhalten und/oder eine Veränderung von Strukturen (vgl. auch: Berlin/Marsh 1993). Wenn auch der Erwerb von Wissen als zentrales Steuerungsmedium von Lernprozessen verstanden werden kann (vgl. z.B. Geißler 1995), so wird doch zunehmend gerade in Bezug auf Verhalten und Strukturgestaltung in Zweifel gezogen, dass allein der Aufbau von neuen kognitiven Wissensbeständen Veränderung mit sich bringt. Im Bereich der interkulturellen Bildungsarbeit markiert schon die Arbeit von Harison und Hopkins (1967) die Abkehr von einem seminaristischen Universitätsmodell des Lernens. Aktuell weist explizit u.a. mit Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus etwa Nunner-Winkler (vgl. z.B. kurz zusammenfassend 2001) für den Bereich moralischen Lernens auf die Unabhängigkeit der kognitiven Dimension moralischen Wissens von der motivationalen Dimension moralischen Wollens hin. Die damit erforderliche Überwindung des Wissensvermittlungsparadigmas entspricht einem in Deutschland verstärkt seit den 70er Jahren innerhalb der Bildungsarbeit propagierten Erfahrungsansatz (Negt, Belardi u.a.), der propagiert, an konkreten TeilnehmerInnenErfahrungen mit gesellschaftlichen Konflikten anzusetzen, um über exemplarisches Lernen zur Erkenntnis gesamtgesellschaftlicher Strukturen zu gelangen. Der Gedanke wird seit den 80er Jahren zunehmend aneignungstheoretisch weiterverfolgt und konkretisiert (vgl. z.B. Kade 1989, 1999; Schäffter 1995; für die Jugendarbeit zuletzt: Deinet 1999) und mündet im vergangenen Jahrzehnt in konstruktivistische Vorstellungen (vgl. v.a. Arnold 1993; Arnold/Siebert 1995; kurz auch: Siebert 1996). Die Pointe liegt in der letztgenannten Fassung darin, Lernen als "Wirklichkeitskonstruktion, Weltanschauung, Erzeugung eines Weltbilds" (Siebert 1999, 24) zu verstehen, das traditionelle Verständnis von "Wissen" hingegen – in seiner Wahrheit beanspruchenden, "affirmativen und bestätigenden Funktion" und sofern es nicht als "kognitive Operation, als Kompetenz des Subjekts" (ebd., 112) verstanden wird – als das genaue "Gegenteil" dazu (ebd., 22). Das konstruktivistische Konzept will explizit die "Konstruktionsperspektive" gegenüber der "Vermittlungsperspektive" ("Wissensbestände werden Wissensanwendern vermittelt"; ebd., 112) stärken (ebd., 35), denn "Mitteilen lassen sich Informationen, nicht aber Bedeutungen" (ebd.). Letztere nämlich stehen im Mittelpunkt, weil nicht das gelernt wird, was doziert wird, sondern das, was Bedeutung für die Lernenden hat. Der Konstruktivismus stellt insofern einen Beitrag zu einem Paradigmenwechsel dar: "zu einer Wende von einer normativen zu einer interpretativen Weltanschauung" (ebd., 15). Er bestärkt damit die Teilnehmer- und Subjektorientierung sowie die Selbststeuerungsrelevanz der Bildungsarbeit und ihre Biographizität. Didaktisch folgt daraus, die alte "Belehrungsdidaktik" durch eine "Ermöglichungsdidaktik" zu ersetzen (vgl. auch Arnold 1993). Da allerdings durchaus die Gefahr gesehen wird, durch diesen "autodidactic turn" das "en-passant-Lernen" überzubetonen und die Bedeutung von Professionalität,, Didaktik und Institutionalisierung für nachhaltige Lernprozesse zu vernachlässigen, plädiert Arnold seit Ende der 90er Jahre für einen künftigen "facilitative turn", zu dem neben mehr aufsuchenden Bildungsstrategien vor allem auch verstärkte Aufmerksamkeitszuwendungen zu methodischen Qualifizierungen für Selbsterschließungskompetenzen einerseits und pädagogische Überlegungen zur Strukturierung von Lernarrangements andererseits gehören (vgl. Arnold 1999). 47 Innerhalb der Sozialarbeitswissenschaft wird im Zuge historischer Selbstvergewisserung als vorherrschende Denk- und Herangehensweise der Sozialen Arbeit das Paradigma der "Hilfe" ausgemacht (vgl. z.B. Niemeyer u.a. 1997; Niemeyer 1994, 1999; Wendt 1995; Gängler 1995; Engelke 1999). Seit den Anfängen der Profession in der Armen- und Jugendfürsorge sowie der Wohlfahrtspflege (vgl. im Überblick dazu z.B. Schilling 1997), für die frühen Vertreter der "Fürsorgewissenschaft" (vgl. z.B. Klumker 1918; Scherpner 1962; Polligkeit u.a. 1929) und für das noch immer nachwirkende Berufsbild des "professionellen Altruisten" (Dewe u.a. 2001, 55ff.) war die persönliche Hilfe – dabei vielfach als "Urkategorie des menschlichen Handelns" (Scherpner 1962, 122) verstanden – der zentrale Begriff der berufspraktischen und disziplinären Gegenstandsbestimmung. Zwar wird seit den 70er Jahren des zwanzigsten Jahrhundert im Zusammenhang mit der Thematisierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse und ihrer Interessen "Kontrolle" als Gegenpart im Doppelmandat Sozialer Arbeit ins Spiel gebracht (vgl. Hollstein 1973; zusammenfassend: Müller 2001) und eine offensive Sozialpädagogik gefordert (vgl. Giesecke 1973), bleibt aber die Hilfe-Thematik weiterhin noch bestimmend (vgl. Bango 2001). In jüngerer Zeit wird in wachsendem Maße in Zweifel gezogen, ob das Professionsverständnis und die Aufgabenfelder Sozialer Arbeit gegenwärtig noch durch das "Hilfe"-Paradigma adäquat markiert werden können. Die Kritik macht sich u.a. an der Diagnose veralteter Rollenverständnisse der berufsmäßigen Akteure Sozialer Arbeit, verkrusteter Strukturen ihrer Institutionen, problemzentrierter Engführungen ihrer Theorien und tendenzieller Entmündigung ihrer AdressatInnen sowie der Beobachtung einer sukzessiven Ausweitung ihrer Arbeitsfelder und AdressatInnen sowie damit zusammenhängend einer Herausforderung zur Um- bzw. Neuorientierung ihrer Arbeitsprinzipien fest. Nicht nur dass im Zuge der seit den 80er Jahren erstarkenden neuen Selbsthilfebewegung fürsorgerische und altruistisch motivierte berufliche Selbstdefinitionen, die sich letztlich auf das Ethos der Hilfsbereitschaft als existentieller menschlicher Grundhaltung berufen, auf dem Rückzug befindlich sind, aber ebenfalls der sozialingenieurhafte Habitus des administrativ eingebundenen Expertokraten im Zusammenhang der Kritik an lebensweltfremdem Interventionismus an leitbildgebender Akzeptanz einbüßt (vgl. Dewe u.a. 2001): Je stärker theoretische Fassungen den KernGegenstand Sozialer Arbeit als Dienstleistung begreifen (vgl. BMFSJ 1994), vor allem aber den Subjektstatus der AdressatInnen hervorheben, und je deutlicher Sozialpädagogik als eine "Pädagogik des Sozialen" (vgl. Natorp 1899 a,b; Niemeyer 1999) bzw. Soziale Arbeit als eine Arbeit am Sozialen verstanden und gesellschaftstheoretisch und/oder bildungstheoretisch begründet wird (vgl. z.B. Graf 1996), desto mehr verliert das "Hilfe"-Paradigma an Bedeutung (vgl. Gängler 1995; Niemeyer/Schröer/Böhnisch 1997). Die Kritik an Klientelisierung, De-Autonomisierung, Entrechtung, Bevormundung, fürsorglicher Belagerung, Verwaltung ja gar Instrumentalisierung der Adressaten Sozialer Arbeit zu Zwecken der Identitäts- und Existenzsicherung sowohl professioneller Helfer als auch ihrer Institutionen birgt Tendenzen der Abkehr vom klassischen Helfer-Klient-Verhältnis in sich. Der Bedeutungszuwachs von Prävention gegenüber Intervention lässt professionelle Funktionen des Einschreitens und der Kontrolle in den Hintergrund treten und fordert neue, etwa solche der sozialen Planung, des sozialen Managements und der Vernetzung – nicht allein der sozialen Einrichtungen, sondern auch der AdressatInnen untereinander und der AdressatInnen mit den sozialen Einrichtungen – heraus. Entsprechend steigt der Stellenwert von Arbeitsprinzipien wie Ressourcenorientierung, Empowerment, Gemeinwesenorientierung sowie Netzwerk- und Milieuarbeit. Neue und im Ausbau befindliche Arbeitsfelder wie die Förderung bürgerschaftlichen Engagements, die Unterstützung politischer Partizipation (bspw. von Kindern und Jugendlichen oder auch von weiteren Gruppierungen mittels 48 Agenda-21-Prozessen) oder die soziale Kulturarbeit stellen ein Professionsverständnis in Frage, das in der Nachfolge von Gertrud Bäumer (vgl. Bäumer 1929) Soziale Arbeit als Ausfallbürge für versagende oder nicht existente Primär- und Sekundärsozialisation versteht und sich damit wesentlich über die Zielgruppen der Benachteiligten und das Vorhandensein von Problemfällen definiert. Was Zeitpunkt, Breite und Zielgruppenbezug pädagogischer und sozialarbeiterischer Maßnahmen betrifft, sind interventive von präventiven Ansätzen zu unterscheiden. Während erstere solche Formen von Eingriffsverhalten umfassen, die eine bereits eingetretene Problem- oder Konfliktsituation fachlich erforderlich erscheinen lassen, gewinnt der Präventionsgedanke seine Attraktivität durch die in ihm niedergelegte Intention, rechtzeitig, d.h. bevor Problemlagen sich manifestieren, tätig zu werden. Prävention hat sich als Strukturmaxime von Jugendhilfe beschleunigt im Gefolge des Achten Jugendberichts (BMJFFG 1990) und zunehmend generell gerade innerhalb der letzten Dekade auch im Zusammenhang mit Überlegungen zu einer Effektivierung der Kriminalitäts- und Gewaltbekämpfung durchgesetzt (vgl. auch die in Kap. 1 skizzierten Programme). Der Begriff wird vor allem in Hinsicht auf Vorbeugestadien und Bezugsebenen binnendifferenziert. Im Hinblick auf ersteres werden primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterschieden. Primäre Prävention beinhaltet Maßnahmen, die dazu dienen, Lebensverhältnisse zu schaffen, in denen zwar nicht unbedingt Konfliktfreiheit herrscht, in denen aber Mechanismen zur Verfügung stehen und Kompetenzen erworben werden können, um Konflikte angemessen zu lösen (vgl. z.B. Schmälzle 1993). Es geht um die Verhinderung der Entstehung von Risikokonstellationen ganz allgemein, noch nicht bezogen auf eine gefährdete Gruppe oder Person (vgl. Lösel 1982). Dabei wird davon ausgegangen, dass Maßnahmen, die die Gestaltung von lebenswerten Verhältnissen anzielen, nicht allein bezogen auf ein bestimmtes Problem wirken, sondern genereller unerwünscht abweichendem und sog. sozial auffälligem Verhalten vorbeugen (vgl. z.B. Grüner/Hilt 1998). Sekundäre Prävention betrifft "Hilfe in Situationen, die erfahrungsgemäß belastend sind und sich zu Krisen auswachsen können" (BMJFFG 1990, 85). Man hat also eine Risikosituation für eine Gruppe oder Person bereits festgestellt und setzt an der Bearbeitung bzw. an der Abwendung dieses Risikos an. Der Achte Jugendbereicht führt hier die "Maßnahmen der Beratung, der vorbeugenden Unterstützung, vor allem aber auch gezielte Hilfen zur Erschließung von Ressourcen und Beziehungen zu Selbsthilfeinitiativen" (ebd.) an. Anknüpfungspunkte tertiärer Prävention sind konkrete Problemlagen von Personen oder Gruppen. Sie werden mit dem Ziel der Verhinderung eines möglichen Rückfalls oder anderweitiger zukünftiger Normverstöße angegangen. Die Aufgaben erstrecken sich auf nachsorgende Betreuung, Resozialisierung und gezielte Erziehungsmaßnahmen (vgl. auch Böllert 1996). Bezugsebenen von Prävention können Personen(gruppen) einerseits und Strukturen andererseits sein. Geht es im Falle des ersteren um die Entwicklung von Handlungskompetenzen, die sozial inakzeptable Verhaltensweisen vermeiden sollen, so versucht strukturbezogene Prävention, äußere Faktoren von Lebensumständen so zu konstellieren, dass Auslöser, Anlässe und Gelegenheiten zu unerwünschtem Verhalten in Schach gehalten werden (vgl. ebd.). Der Präventionsgedanke sieht sich aus verschiedenen Gründen Kritik ausgesetzt. Vor allem fünf Gründe werden diskutiert: 49 Erstens ist fraglich, ob sich nicht unter dem Deckmantel eines weit gefassten PräventionsBegriffs auch solche Maßnahmen verbergen können, die auf repressive Strategien (Beispiel: Unterbringung von gewalttätigen Jugendlichen in geschlossenen Heimen) setzen. Der für Bildung, Erziehung und Soziale Arbeit fundamentale Gedanke individueller und sozialer Unterstützung könnte so ad absurdum geführt werden. Zweitens setzt das Interesse an sekundärer Prävention voraus, bestimmte Personen oder Gruppen als Risikofälle betrachten zu müssen. Eine solche Kategorisierung beschwört die Gefahr der Etikettierung und Stigmatisierung herauf. Sie würde dann Labelingprozesse auslösen oder verstärken, von denen man weiß, dass sie sich kontraproduktiv zu tragfähigen Problemlösungen verhalten. Drittens ist eine Kolonialisierung der Lebenswelt zu befürchten, die dazu führen könnte, dass unter der Legitimation von Prävention Eingriffe in Lebensumstände von Subjekten durchgeführt werden, ohne dass diese von den Subjekten gewollt und mitgetragen werden. So gesehen stützt der Präventions-Impetus eine pseudo-fachliche Perspektive, die vermeint, ohne ein Klienten-Mandat auskommen zu können. Viertens birgt der inflationäre Gebrauch von Prävention als zentraler Legitimations-Vokabel pädagogischer und Sozialer Arbeit das Risiko eine Subsumierung professioneller Anstrengungen unter dieses Paradigma. Der Eigensinn von Leitideen wie Persönlichkeitsentfaltung, Bildung, Kreativitätsentwicklung u.ä.m. wird dadurch unterhöhlt und zu Gunsten von Defizit- und Defensivorientierung geopfert. Darauf bezogene Angebote geraten unter Rechtfertigungs- und Finanzierungsdruck und werden dazu gedrängt, ihr Überleben dadurch zu sichern, dass sie sich in den Dienst von Prävention stellen. Fünftens bleibt ungeklärt, wie Präventionswirkungen zu evaluieren sind (vgl. auch Lindner/Freund 2001). Nichtsdestotrotz: Alles in allem befindet sich die Präventions-Idee in einem kräftigen Aufwind, gerade auch bezüglich der Bekämpfung von Rechtextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt sowie der Verhinderung von sozialer Desintegration. Der Bedeutungszuwachs hängt auch damit zusammen, dass ein moralisierendes Intervenieren, die Ausgrenzung von Problemträgern aus pädagogischen Sphären (z.B. die bis in die Anfänge der 90er Jahre hinein betriebene Deklaration von Jugendhäusern als "nazifreie Zonen") und Versuche der informationistischen Aufklärung "Rechter" erfahrungsorientierten Ansätzen gewichen sind. Befördernd wirkt auch, dass ein reaktionistisches Hilfe-Verständnis Sozialer Arbeit zunehmend von Unterstützungsvorstellungen abgelöst wird, die auf weitgehend selbstgesteuerte Gestaltungsprozesse aktiver Subjekte vertrauen, in denen die Konstruktion des Sozialen offensiv und nicht zuletzt über zivilgesellschaftliches Engagement betrieben wird. 2.2 Strategien Im Rahmen der oben knapp skizzierten paradigmatischen Spannungsfelder sind nicht nur Aufweichungen überkommener Leitideen und Tendenzen zu ihrer Neubestimmung zu registrieren. Vielmehr zeitigen die auf dieser Ebene zu verzeichnenden fachdiskursiven Entwicklungen ihre Folgen auch für die Gestalt der grundlegenden strategischen Ziele, mit denen professionelle Arbeit betrieben wird. 2.2.1 Wissensvermittlung und ihr Bezug zu Information, Aufklärung, Bewusstmachung, argumentativer Überzeugung und kognitiv-moralischer Reflexion 50 Solange Bildung sich darauf konzentriert, Kognitionen zu ändern, liegt es nahe, eben dies mittels Informationsangeboten zu versuchen. Soweit dabei pädagogisch vorausgesetzt wird, Sachverhalte aus dem Bereich der Unkenntnis oder gar des Unbewussten hervorheben und sie erhellen zu müssen, erhalten diese Angebote den normativen Impetus der Aufklärung bzw. der Bewusstmachung. Insbesondere bei politischen und politisch relevanten Sachverhalten, wie sie im Umfeld von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsextremismus zu finden sind, lassen sich unter diesen Voraussetzungen die Strategien der argumentativen Überzeugung und der moralischen Stabilisierung resp. moralischen Korrektur und unter Umständen auch Verbindungen von beidem favorisieren. Wo innerhalb entsprechender Settings auf argumentative Überzeugung abgehoben wird, verfolgt man das strategische Ziel, Denkinhalte und Denkweisen, die pädagogisch für unangemessen gehalten werden, durch angemessenere zu ersetzen. Meist stillschweigend wird dabei vorausgesetzt, dass solche Einstellungsänderung auch in gleicher Richtung verhaltensbeeinflussend wirkt. Der Fundus, aus dem die Argumente bezogen werden, kann die Historie, die Gegenwart oder die Zukunft sein. Hinter dem Historisieren steht die Auffassung, dass derjenige, der die Geschichte kennt, seine Schlussfolgerungen aus ihr für die Gegenwart zieht und zwar so, dass er motiviert wird, danach zu trachten, Beiträge dazu zu liefern, dass Entwicklungen, die sich historisch als problematisch erwiesen haben, vermieden werden können. Werden aktuelle Entwicklungen ins Zentrum gerückt, werden in erster Linie darauf bezogene wissenschaftliche und statistische Daten bemüht, Selbstpositionierungen von für die AdressatInnen vertrauenswürdigen Personen eingebracht oder Pro-/Kontra-Diskussionen geführt, die mit handlungsrelevantem Effekt neue Kenntnisse vermitteln, Argumentationslogik schulen und neue Einsichten produzieren sollen. Wenn Zukünftiges zum Thema gemacht wird, steht im allgemeinen das Ziel dahinter, das Subjekt zu motivieren, aktuelle Einstellungs- und Verhaltensweisen auf ihre Tauglichkeit für das weitere Leben hin zu überprüfen. Die Strategie der Anregung von kognitiv-moralischer Reflexion zielt darauf ab, einer utilitaristischen Verwendung neu gewonnener Kenntnisse andere Kriterien entgegenzusetzen. Indem mit Werten wie dem Recht auf Gleichbehandlung, Fürsorgeverpflichtungen, Gerechtigkeit und Solidarität bekannt gemacht und ggf. exemplarisch auf positiv zu bewertende Formen ihrer Umsetzung in der Realität hingewiesen wird, wird intendiert, sie zu plausibilisieren, "einsichtsfähig" zu machen und damit ihre Internalisierung zu ermöglichen. 2.2.2 Erfahrungslernen und sein Bezug zur Vermittlung funktionaler Äquivalente, ganzheitlichen Settings und Qualifizierung personaler und sozialer Kompetenzen Angebote des Erfahrungslernens gehen davon aus, dass rein kognitiver Wissenserwerb Verhaltens- und Strukturveränderungen nicht zu erzielen vermag. Unterstellt wird, dass es Erfahrungen und nicht bzw. nicht primär und entscheidend ideologische Überzeugungen sind, die zu den als problematisch erachteten Orientierungen und Verhaltensweisen führen. Dabei lässt sich auf den Befund der Einstellungsforschung verweisen, der besagt, dass die Wirkungen von Einstellungen einer Person auf ihr Handeln eher schwach ausfallen und nicht stärker eingeschätzt werden können als umgekehrt die Wirkungen von Handlungen auf Einstellungen (vgl. schon LaPiere 1934 und Wicker 1969; aktuell und speziell zu antidemokratischen und rechtsextremen Potenzialen auch Bromba/Edelstein 2001, 51 f.). Deshalb wird die Strategie verfolgt, solche pädagogischen und sozialarbeiterischen Settings aufzubauen und vorzuhalten, die im Stande sind, gleichsam Erfahrungen durch Erfahrungen zu ersetzen. Es wird angenommen, dass die Motivationen, die zu Gewalt und 51 undemokratischen Haltungen verleiten, nicht durch Bedürfnisse nach Aggression oder gar Triebe, Interessen an der Unterwerfung und Ausgrenzung anderer Personen und ähnliche Handlungsanreize zu Stande kommen, sondern entsprechende Verhaltensweisen als ungelenke Befriedigungsformen von Bedürfnissen aufzufassen sind, die im Kontext der Versuche von Lebensbewältigung bzw. Realitätskontrolle zu deuten sind. Eine Pädagogik bzw. Sozialarbeit der funktionalen Äquivalente zielt deshalb an, die Funktionen, die das als problematisch erachtete Verhalten für das Subjekt erfüllen soll, in gleichwertiger Weise anderweitigen, nunmehr nicht oder wenigstens weniger individuell und sozial schädigenden Befriedigungsqualitäten zuzuführen (vgl. auch Böhnisch 1994, 1997, Möller 1999a). Im Bereich von Erziehung und Bildung wird daher ein Arrangement angestrebt, das "ganzheitlich" orientiert ist, d.h. das die Subjekte gleichermaßen kognitiv wie emotional und konativ anspricht. Dementsprechend wird aktives Agieren in den Mittelpunkt gerückt und auch eine körperlich-sinnliche Erfahrung zu vermitteln gesucht. Entweder geschieht dies in nahezu experimenteller Weise innerhalb von pädagogischen "Laboratorien" in Gestalt von Trainings und aktionsorientierten Bildungseinheiten von meist mehr oder weniger kurzzeitpädagogischem Charakter oder es werden längerfristig angelegte alltagseingebundene Projekte verfolgt, die unmittelbar die Vorteile von gewaltfreier Konfliktlösung und von Demokratie erlebbar zu machen beabsichtigen. In jedem Fall wird intendiert, Reflexionsprozesse in Gang zu setzen bzw. zu stützen, die nicht allein kognitiv basiert sind. Sie sind darauf gerichtet, personale und soziale Kompetenzen zu entwickeln, von denen angenommen wird, dass sie Schutzfaktoren gegenüber unsozialem und undemokratischen Orientierungen bilden. Zu nennen sind insbesondere Fähigkeiten zu Perspektivenwechsel, Empathie, Rollendistanz, Verantwortungsübernahme, verbaler Konfliktregelung sowie Frustrations-, Ambiguitäts- und Ambivalenztoleranz. Wo über Erziehung und Bildung im engeren Sinne hinaus Sozialisation professionell zu gestalten gesucht wird, werden zum einen über einen längeren Zeitraum hinweg auf der Ebene individueller Qualifizierung und gruppenbezogener Arbeit kontinuierliche Anstrengungen unternommen, eine Demokratie und Gewaltfreiheit zuträgliche reflexiv organisierte und durch die Anwendung der o. g. Kompetenzen befruchtete Eigenregie von Sozialisationsprozessen zu ermöglichen bzw. zu unterstützen und dehnen sich zum anderen Pädagogik und soziale Arbeit, die Grenzen ihres traditionellen Zuschnitts sprengend, in den Bereich von strukturellen Maßnahmen aus. Der erstgenannte Typus zielt über eine häufig aufsuchende, alltagseingebundene Begleitung auf die Qualifizierung der lebensweltlich gewachsenen Interaktionszusammenhänge und Gruppen zu einem so weit wie möglich gefährdungsfreien Erfahrungskontext. Eine sukzessive Ablösung der Adressaten, die sich in ihrem Tempo und Ausmaß an dem Umfang von (wieder)gewonnener Lebensbewältigung bzw. Realitätskontrolle orientiert, soll Klientelisierung vorbeugen und Autonomisierungsprozesse fördern. Im zweiten Fall werden entweder in unmittelbarer Zusammenarbeit mit AngebotsnutzerInnen und durch diese selbst Verbesserungen der strukturellen Lebensbedingungen angestrebt oder erweitert sich der Bezug auf die jeweilige Zielgruppe bzw. den Adressaten-, Besucher- oder Teilnehmerkreis um Strategien, die auch abseits von direktem Klientenkontakt in Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung, Ordnungskräften, sozialen und pädagogischen Einrichtungen sowie verwandten Professionen Verbesserungen des Sozialisationskontextes zu erzielen suchen. Auf dieser Ebene wird Erfahrungslernen über Gestaltungsprozesse angesteuert (vgl. dazu näher Kap. 2.2.4). 2.2.3 Helfen als opfer- und täterbezogene personale Zuwendung 52 Das Paradigma der Hilfe zieht im Schwerpunkt eine personenbezogene Strategie nach sich; dies in einem doppelten Sinne: Zum einen verstehen die professionellen Helfer ihre eigenen Offerten mehr als personales Angebot denn als sachliche Leistung. In ihm spielen die Echtheit und Authentizität des Helfers wie diejenige der Begegnung von Mensch zu Mensch entscheidende Rollen (vgl. auch Scherpner 1962; Dewe u.a. 2001). Man setzt vorrangig auf persönliche Zuwendung und Beziehungsarbeit. Ziel ist dann zunächst ein möglichst unproblematischer Kontaktaufbau zu Viktimisierten bzw. Viktimisierungs-Gefährdeten und zu Problemträgern. Die allmähliche Etablierung eines informell-lebensweltlichen Interaktionsformen ähnlichen Vertrauensverhältnisses wird angestrebt. Zum anderen betrifft der personale Bezug auch die Adressatenorientierung: Entweder stehen diejenigen, die als Problemverursacher betrachtet werden, oder die unter den Problemen Leidenden im Mittelpunkt der Arbeit. Erst in zweiter Linie sind es die Sachverhalte, die diese Menschen (mit)konstituieren, die von Interesse sind. Die im Regelfall an erster Stelle stehende Opferperspektive begründet sich hier in einer ethischen Verpflichtung. Sie reklamiert die Notwendigkeit der Umsetzung basaler Werte der menschlichen Gesellschaft für sich und strebt in erster Linie die Linderung von Ausgeliefertsein, Verletzung, Verängstigung und Not an. Insoweit wird sie eher defensiv wirksam und agiert meist ex post. Präventive Ansätze des Opferschutzes versuchen die Beschränkung auf Reaktionismus zu überwinden, indem sie bekannte Gefahrensituationen für potenzielle Opfer zu entschärfen, gewaltfreie Gegenwehr anzutrainieren und längerfristig eine Kultur der Solidarisierung und des Helfens zu etablieren trachten. Im erstgenannten Fall werden z.B. öffentliche Kontrollmechanismen (re)aktiviert, Überwachungskräfte eingesetzt oder Fluchträume zur Verfügung gestellt, im zweiten Fall Verfahren der De-Eskalation und der gewaltfreien Konfliktlösung geschult, im dritten Fall Lernprozesse in Gang gesetzt, die sich sowohl auf die ethisch-moralische Motivation und einen Zugewinn an Mut als auch auf die Vermittlung von innovativen Ideen und Techniken der strukturellen Gefahrenabwehr oder –reduktion erstrecken. Die Zielsetzung der opferorientierten Hilfe-Strategie findet ihre Grenze mindestens darin, dass sie zwar bei breiter Anlage noch Anlässe und Gelegenheiten der Viktimisierung zu beeinflussen vermag, nicht jedoch auf deren eigentliche Ursachen einwirken kann. Täterorientierte Strategien versuchen dieses Manko zu kompensieren, indem sie realen oder potenziellen Tätern Hilfen anbieten. Sie zielen primär, sekundär oder tertiär präventiv auf eine Stabilisierung und Kompetenzerweiterung der Persönlichkeit, auf die Entlastung des Lebensumfelds von tatauslösenden Faktoren und ggf. auf Resozialisierung. Vordergründig konzentriert sich die sozialarbeiterische Tätigkeit auf das (Wieder-)Einfädeln in einen strukturierten Alltagsablauf sowie in das Schul-, Ausbildungs- und/oder Arbeitssystem, das Finden adäquaten Wohnraums, die Reduktion familiärer und weiterer interpersonaler Konflikte, den Aufbau neuer Kontakte mit neuartigen Interaktionsqualitäten, die Regelung von Schulden, die Hilfe bei Auseinandersetzungen mit der Polizei und gerichtlichen Verfügungen sowie die Entstigmatisierung als Gewalttäter, Krimineller, Delinquent oder Devianter. Dahinter steht die Auffassung, dass eine "Normalisierung" der Lebensführung und des Lebenskontextes letztlich auch zu einer Normalisierung von Orientierungen und Verhalten führt. Des weiteren wird darauf abgehoben, individuell und ggf. auch milieu- und cliquenbezogen Kompetenzentwicklungsprozesse in Gang zu setzen, die die Fähigkeit zu pluralen Situationsdeutungen verbessern, die Attraktivität von Provokationsverhalten verringern, den gespürten Zwang zur Reaktanz abbauen und, zumal in kritischen Situationen, ein erweitertes Handlungsrepertoire entfalten helfen. Teilweise wird aber auch spezifizierender die Annahme unterlegt, dass soziale Desintegration und der Verlust von 53 sozial akzeptierten Anerkennungsmedien vermieden und bekämpft sowie soziale Integration und neue Anerkennung über partikularistische Bezüge hinaus eröffnet werden muss. Die Zielsetzung der täterorientierten Hilfe-Strategie sieht sich allerdings mit dem Argument konfrontiert, den öffentlichen oder den vom Opfer gehegten Interessen an Sanktion und Sühne entgegenzulaufen, deshalb ethisch-moralisch zweifelhaft zu sein, UnterstützungsRessourcen ungerecht zu verteilen, womöglich sogar kontraproduktiv zu wirken und so unerwünschtes Verhalten zu stützen, zumal ein angenommenes Helfersyndrom gegenseitige Abhängigkeiten verstärke und u.U. Identifikationen und Koalitionen mit dem Klientel Vorschub leiste. Wo eben dies diagnostiziert wird, geraten professionelle Helfer in die Rollen von Kollaborateuren. 2.2.4 Gestaltungsinteressen in ihrem Bezug auf die Strategien infrastruktureller Arbeit, politischer Einmischung, Sozialraumorientierung, Milieubildung, Netzwerkarbeit und Partizipationsförderung Strategische Zielsetzungen von Pädagogik und Sozialer Arbeit, die in das Paradigma der Gestaltung eingebunden sind, richten sich vor allem auf die Entdeckung neuer wie die Mobilisierung bisher ungenutzter Ressourcen. Dabei kann es sich um sachliche oder personale Ressourcen handeln. In jedem Fall weitet sich das überkommene Verständnis pädagogischer und sozialer Berufstätigkeiten als unmittelbar personenbezogene Dienstleistung auf infrastrukturelle Aufgaben aus. Dahinter steht der Gedanke, dass Problem- und Konfliktkonstellationen nicht erschöpfend mittels individueller und gruppenbezogener Veränderungen beseitigt werden können, sondern strukturelle Ursachen der Symptomatiken angegangen werden müssen. So weit pädagogische und soziale Arbeit sich nicht nur in Defensivrollen von Problementsorgerinnen ergehen, reklamieren sie offensiv auch ihre Zuständigkeit für prinzipielle Aufgaben der Gestaltung des Sozialen, ohne dass akut drängende Problemanlässe offen zu Tage getreten sein müssen. Ihrem Mandat wird dann auch das Recht, ja die Verpflichtung zu politischer Einmischung zugesprochen (Mielenz 1983). Vor allem anomietheoretische Deutungen von (politischer und unpolitischer) Gewalt legen diese Strategie nahe. Danach nämlich kann Gewalt als ein Anpassungsverhalten an anomische Strukturen gedeutet werden, die durch die vorherrschenden gesellschaftlichen und institutionellen Weichenstellungen ständig produziert und reproduziert werden: Auflösungen von regulativ wirkenden Zweck-Mittel-Verhältnissen, so dass Situationen der Normlosigkeit entstehen, in denen vorweisbarer und in Besitz, Prestige und Konsumvermehrung gemessener Erfolg die Mittel seines Erreichens in die Unbedeutsamkeit verdrängt. Prozesse der Planung und Gestaltung des Gemeinwesens, der in diesem Rahmen notwendigen kooperativen Vernetzung mit sozialen bzw. pädagogischen Einrichtungen, staatlichen Institutionen und Gruppierungen der Zivilgesellschaft sowie die Beratung und das Coaching insbesondere kommunaler politischer Entscheidungsträger und sonstiger Akteure zielen darauf ab, primär- oder sekundärpräventiv äußere Lebensbedingungen zu konstituieren, die möglichst weitreichend gewalt- und extremismusprotektive Sozialisationserfahrungen ermöglichen. Der Vermeidung sozialer Desintegration und Diskriminierung von Minderheiten sowie der Erzielung und Stärkung sozialer Integrations- und Anerkennungspotenziale wird hierbei im allgemeinen eine hohe Bedeutung beigemessen, angesichts des Diskriminierungs- und Desintegrationspotenzials im Kontext von Migrationserfahrungen insbesondere in Bereichen multi- und interkultureller Arbeit. Nicht nur, aber gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche wird dabei eine sozialräumliche Perspektive verfolgt. Sie reagiert auf die moderne Monofunktionalisierung und Durchstrukturierung von Raum mit dem Versuch, Räume zu sichern. Sie sollen 54 Aneignungsformen gestatten, in denen die Entwicklung motorischer Fähigkeiten, die Veränderung von Situationen und die Erweiterung von Handlungs(spiel)räumen möglich bleibt (vgl. Deinet 1999). Bezugspunkt des Handelns ist in der Regel der unmittelbare Nahraum der AdressatInnen, ihr Stadtteil, das Dorf, das Quartier, der Straßenzug, der Häuserblock etc.. Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt werden aus dieser Sichtweise auch wesentlich auf ungestillte räumliche Aneignungsbedürfnisse zurückgeführt. Das Verschwinden von Natur aus dem öffentlichen Raum durch Urbanisierung, das Zurückdrängen von Bewegungsflächen durch ausufernde Bau- und Verkehrsprojekte, die Verdichtung der Wohnbebauung bei mangelhafter sozialer Infrastruktur u.ä. Prozesse mehr beschneiden danach die Chancen auf freie Entfaltung und produzieren eine subtile Form von neuer sozialer Kontrolle, ja Enge. Dem so geschaffenen Druck scheint durch Raumgewinne zu entraten sein, die durch expansives Verhalten und die territoriale Ausgrenzung sog. Fremder zu erzielen sind. Dem Gefühl der Beengung scheint dadurch entgegengetreten werden zu können, dass regelrechte Befreiungsschläge geführt werden, die auch als körperliche Entgrenzung erlebbar sind. Eine sozialverträgliche, wenn nicht sogar eine dem Sozialen förderliche Raumgestaltung muss auf der (sozial)pädagogischen Skala der Relevanzen so gesehen einen vorderen Rang einnehmen. Der Ansatz der "Milieubildung" (vgl. Böhnisch 1994, 1997, 1998, Seifert 1998) spezifiziert die sozialräumliche Perspektive noch einmal, indem er diejenigen sozialen NahraumElemente in den Fokus rückt, die durch sozio-emotionale Gegenseitigkeitsstrukturen gekennzeichnet sind. Er macht sich ihre Qualifizierung zu eigen. Damit will er die per Individualisierung wegbrechenden traditionellen Milieufunktionen, soweit sie für ein sozialverträgliches Leben unverzichtbar erscheinen, wie z.B. sozialer Rückhalt und Geborgenheit, in modifizierten Formen durch neu geschaffene, den Modernisierungen des Lebens angemessene Gegenseitigkeitsbeziehungen von sozio-emotionaler Qualität erhalten. Der Aufbau von Netzwerken kann als ergänzende Strategie begriffen werden (so bei Böhnisch 1994, 1997): Damit Milieubildung nicht die Tendenz zur Abkapselung von Milieus unterstützt oder sogar regressive Milieus stabilisiert, erhalten diese eine Öffnung durch den Netzwerkanschluss. Mit ihr wird die Erwartung verbunden, die Milieuangehörigen auch mit nicht milieuspezifischen Werten, Normen und Interaktionsweisen in Kontakt zu bringen und darüber eine Horizonterweiterung zu bewerkstelligen, die die Integration in nicht partikularistische gesellschaftliche Bezüge erleichtert. Bindungsmittel sind hier die Interessen der einzelnen und nicht mehr die emotionale Kohäsion. Inakzeptable soziale Abweichung bis hin zu Gewaltsamkeit wird vor dem Hintergrund des Gestaltungs-Paradigmas auch als Folge verweigerter Mitsprache und Mitbestimmung gedeutet: Wer auf legalem bzw. legitimem Wege kein Gehör findet, nicht zur Erfüllung seiner Interessen und Bedürfnisse gelangen kann und gleichzeitig den Rückzug der Erwartungen nicht zu betreiben gedenkt, mag dazu tendieren, illegale und illegitime Mittel einzusetzen. Solche Defizite sollen deshalb durch das Einräumen von mehr Teilhabe und Beteiligung verringert werden. Chancen auf die öffentliche Artikulation von Ansprüchen zu vergrößern, Teilnahmemöglichkeiten an gesellschaftlichen Diskursen zu verbreitern und Kanäle politischer Mitwirkung und –entscheidung zu erweitern bzw. neu zu eröffnen, sind daher vornehmliche Ziele eine partizipationsorientierten pädagogischen und Sozialen Arbeit. Sie hat somit System- und Sozialintegration gleichermaßen im Blick und scheut sich nicht vor Mobilisierung und Aktivierung von Engagement. 55 Die Grenzen einer an Gestaltungsinteressen festgemachten strategischen Ausrichtung pädagogischer und sozialer Arbeit scheinen gegenwärtig an einem für sie noch unzureichend entwickelten beruflichen Selbstverständnis und an einem in seinem Schlepptau noch schmalen, relativ unausgefeilten fachlichen Handlungsrepertoire, spätestens jedoch dort auf, wo sich politische Entscheidungen fachlicher Argumentation verschließen und auf autonome Zuständigkeiten berufen. Insgesamt sind die strategischen Zielsetzungen bei Trägern und Umsetzungspersonal zwar mit vagen Vorstellungen von einem zu erreichenden Idealzustand verbunden. Unterhalb weit ausgreifender Globalziele wie "Schaffung gewaltfreier Verhältnisse", "Demokratisierung der Gesellschaft", "friedliches Zusammenleben der Völker und Kulturen" u.ä.m. werden – anders als dies in der Wirtschaft Usus ist – Visionen für einen absehbaren Zeitraum von vielleicht 10 bis 15 Jahren aber nicht konkretisiert, so dass mit festgelegten Zeitperspektiven und Indikatoren verbundene Strategieüberprüfungen bislang nicht üblich sind und Prozesse der Um- oder Neuorientierung zäh verlaufen. 2.3 Formate Paradigmatische Grundorientierungen und strategische Ausrichtungen führen im Verein mit politischen Vorgaben, organisatorischen Rahmenbedingungen, dem Reservoir an personellen Ressourcen und Kompetenzen sowie Trägertraditionen zu bestimmten Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der Formate der pädagogischen und/oder sozialarbeiterischen Angebote. Formate stellen komplexe Vermittlungs- und Erfahrungskontexte dar, die auf jeweils bestimmte Weise Orientierung und Handlungskompetenz verschaffende Tätigkeiten wie Analysieren, Reflektieren und den Erwerb bzw. die Entwicklung von Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten gewichten. Die Spezifik, in der sie Lernen als Veränderung von Kognitionen, Emotionen, Handlungsweisen und Strukturen ermöglichen, setzt der konkreten Konzeptentwicklung einen operativen Rahmen, der damit auch erhebliche Implikationen für Inhalte, Design, Dauer, Orte, Methodik, Didaktik, Arbeitsprinzipien etc. in sich birgt (vgl. Kap. 3). Die in dem uns interessierenden Themenfeld eingesetzten Formate lassen sich innerhalb eines Feldes platzieren, das sich in einem Achteck zwischen den Eckpunkten von Unterrichtung, Begegnung, Training, personaler Unterstützung, Einzelansprache, (Re-)Produktion, Recherche und Strukturverbesserung aufspannt. Einzelne Konzepte weisen zwar bezogen auf diese Formate zumeist bestimmte Schwerpunktsetzungen auf, suchen zum Teil aber auch ihre Überlappungsgebiete für sich zu nutzen. Formate der Unterrichtung haben ihre Heimat im Paradigma der Wissensvermittlung. Sie favorisieren dabei einen bestimmten Typus: den des Herantragens kognitiv verarbeitbarer Informationen. Idealtypisch liegt eine weitreichende Fremdsteuerung der Lernenden durch die pädagogische Kraft vor. Die Informationsgegenstände werden durch sie ausgewählt. Methodisch dominiert die direkte Instruktion. Die Aneignung des vorgegebenen Lernstoffs steht im Mittelpunkt. Erzielte Wissenszuwächse erstrecken sich auf Informationsbestände von allgemeiner, vergleichsweise abstrakter Bedeutung. Theoretisches Begreifen prägt den Lernprozess, unmittelbare Erfahrung bleibt ausgeblendet (vgl. dazu auch die Charakterisierung von "Bildungsformaten" bei Leenen 2001). Formate der Unterrichtung bewähren sich dort, wo es um kompakte, effiziente und – jedenfalls kurzfristig – effektive Informationsweitergabe über Sachverhalte geht. Die Erzeugung von Handlungsmotivation im Sinne einer Nutzung dieser Informationen für eigenen Zwecke dürfte als eher schwach eingestuft werden können. 56 Formate der Begegnung stehen diesem Ansatz deutlich gegenüber (vgl. ebd.). Sie sind innerhalb des Bildungsbereichs dem Paradigma des Erfahrungslernens zuzuordnen. Hier begnügt sich die Fachkraft zunächst damit, Plattformen zu schaffen, auf denen Teilnehmer und Teilnehmerinnen miteinander in Kontakt kommen und sich austauschen können. Vorrangig ist der Gedanke des Voneinanderlernens. Entsprechend solcher Teilnehmerorientierung steuern sich die Lernenden eher selbst. Statt Instruktion steht entdeckendes Lernen auf dem Plan. Zentrale inhaltliche Relevanzen werden nicht von einem von außen eingebrachten Lernstoff vorgegeben. Sie erschließen sich vielmehr prozesshaft durch die gruppendynamisch hergestellte intersubjektive Verschränkung der einzelnen subjektiven Bedeutungen. Wissen kommt als konkretes Struktur- und Handlungswissen von größtenteils unmittelbarer Interaktionsrelevanz zum Zuge. Sein Fundus ist die unmittelbare Erfahrung. Angenommen wird, dass der durch die Orientierung an Teilnehmerrelevanzen gegebene (potenzielle) Lebensweltbezug solches Lernen mit deutlich mehr Verhaltenswirksamkeit ausstattet als dies bei Formaten der Unterrichtung der Fall ist. Formate der Begegnung könnten aber auch dort erblickt werden, wo im Rahmen eines modernen Hilfe-Paradigmas Sozialer Arbeit lebensweltliche Systeme der Unterstützung oder des selbstgeregelten Interessenausgleichs aufgebaut und abgesichert werden. Sie liegen auch vor, wenn im Rahmen des Gestaltungs-Paradigmas Vernetzungen von AdressatInnen zu Stande kommen, ohne dass gegenseitige Unterstützung das Hauptmotiv der Begegnung abgibt wie bspw. bei der Förderung bürgerschaftlichen Engagements. In beiden Fällen zieht sich die Fachkraft auf die Rolle einer Beraterin, Moderatorin und ggf. Konfliktmanagerin zurück. Soziale Strukturbildungen bauen sich in gruppendynamischen Prozessen auf, die der Selbststeuerung der an ihnen Beteiligten unterliegen Trainingsformate vermitteln zwischen Begegnungs- und Unterrichtungsformaten (ähnlich auch Leenen 2001). Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft liegt hierbei im wesentlichen darin, durch bestimmte methodische Vorgaben, die sie im allgemeinen in einen Gruppenkontext einbringt, eine Situation zu schaffen, in der dann zunächst Raum für kompaktes, intensives, ganzheitlich angelegtes und sensibilisierendes Erfahrungslernen entsteht. Es entsteht eine laborähnliche Situation, die zumeist ein reales Alltagsgeschehen simuliert. Die Teilnehmenden sind darin als Handelnde gefragt. Unter Umständen werden sie unter Rechtfertigungsdruck gesetzt. Austausch und Auseinandersetzung in der Gruppe der TeilnehmerInnen dienen der Bereicherung der jeweils individuell gemachten Erfahrungen, ihrer allmählichen Einordnung und Strukturierung. Dies wird verstärkt durch – je nach Training – mehr oder weniger starke Gesprächslenkungen und theoretische Inputs seitens der Leitungsperson. Fragen des Transfers der gemachten Erfahrungen in den Alltag spielen eine große Rolle. Formate der personenbezogenen Unterstützung haben ihren Gravitationspunkt im Paradigma der Hilfe. Zu unterscheiden sind die beiden Typen der Alltagshilfe und des therapeutischen bzw. therapeutisch orientierten Settings. Alltagshilfe legitimiert sich durch eine objektiv gegebene, fast immer aber auch subjektiv geäußerte Bedürftigkeit der Subjekte. Sie findet im lebensweltlichen Kontext der AdressatInnen statt und erfordert im allgemeinen eine längerfristige Begleitung, da sie – soweit nicht nur Formalien zu regeln sind, und dies ist der Normalfall – ein Vertrauensverhältnis zwischen Fachkraft und "Klient" voraussetzt. Personale Unterstützung kann als Einzelfallhilfe wie als Gruppenarbeit stattfinden. Im Verlaufe ihrer Verstetigung eröffnen sich Gelegenheiten zu Gesprächen über Grundorientierungen, innere Haltungen, Einstellungen und Meinungen. Sie werden entweder zu argumentativ geführten Diskussionen über Inhalte genutzt oder auch als Anknüpfungspunkte für die Entdeckung nicht problembelasteter Vorlieben und Interessen verstanden, über die dann neue Zugänge zum 57 Subjekt und neue Chancen interaktiver Anbindung im Sinne von Netzwerkarbeit ergriffen werden können. Zudem sind an diesen Stellen Diskursformen bekannt zu machen, die Bedürfnis- und Interessenartikulation, soziale Bindungswünsche und den Ausgleich gegensätzlicher Auffassungen auf lebensgeschichtlich neuartige Weise positiv erlebbar machen. In dem Maße wie peer-support professionelle Hilfe zu ersetzen vermag, löst sich das Leitbild des klassischen Hilfe-Paradigmas auf und wird seine Idealtypik durch so entstehende Begegnungsformate verwischt, die eher dem Gestaltungs-Paradigma und der Priorisierung von Erfahrungslernen folgen. Therapeutische bzw. therapieähnliche Formate beziehen sich innerhalb des uns interessierenden Themenbereichs im wesentlichen auf den Abbau von Aggressivität. In einem zeitlich und räumlich vordefinierten Rahmen werden unter Einsatz spezieller Methoden und gesteuert von der pädagogischen Fachkraft in bestimmten Folgen Schritte unternommen, die darauf zielen, Verhaltensbereitschaften und das tatsächliche individuelle Verhalten zu verändern. Außerdem sind, allerdings noch kaum ausgebaute Opferbegleitungen zu erwähnen. Formate der Einzelansprache beziehen sich auf Angebote, die das Subjekt individuell ohne Gruppenkontext nutzen kann, um neue Informationen zu erhalten ("Wissensvermittlung") oder auch neue Erfahrungen zu machen ("Erfahrungslernen"). Es handelt sich um verschiedene Formen schriftlicher Publikationen (Bücher, Zeitungsartikel, Broschüren etc.) sowie um vorwiegend visuelle (Plakate, Flyer), auditive (Hörfunk, Musikstücke) und audiovisuelle Produkte (Filme, Internetangebote). Dem gemäß werden zwar Inhalte vorgegeben, bleibt der Aneignungsprozess selbst aber im Gegensatz zu einer gruppengebundenen Kulturund Medienpädagogik unsicher und im Falle seiner Realisation unstrukturiert. Eine Ergebniskontrolle erscheint schwierig. Rechercheformate liegen in Projekten vor, bei denen die TeilnehmerInnen ausgewählte Sachverhalte dadurch in Erfahrung zu bringen suchen, dass sie eigene 'Forschungs'anstrengungen unternehmen, bei denen sie gleichermaßen kognitiv wie emotional und konativ gefordert sind. Geschichtswerkstätten, Spurensuche-Projekte, Passantenbefragungen, Archivbesuche, Umfragen mit Mikrofon und Kamera etc. räumen Aktivierung, Mobilisierung, Handlungsorientierung und (im allgemeinen) alltagseingelagerter Eigenerfahrung Vorrang ein. Selten richten sich diese Formate an einzelne (z.B. bei manchen Wettbewerben), meist werden sie an Gruppen adressiert. Inhalte werden nur grob vereinbart. Sie differenzieren sich im Prozess des Recherchierens aus. Angebote dieses Typs erhalten erfahrungsgemäß ihre Attraktivität vor allem bei Kindern und Jugendlichen oft durch die Struktur des Formats selbst und/oder die eingesetzten Medien. Von hoher motivationaler und inhaltlicher Bedeutung ist aber – für AnbieterInnen wie für TeilnehmerInnen – im Regelfall auch die Publikation der Rechercheresultate für eine wie auch immer im einzelnen geartete Öffentlichkeit. Eine Produktorientierung kennzeichnet (darüber hinaus) Formate, die auf die Herstellung oder Wiederherstellung von Objekten oder die Produktion von spezifischen Kompetenzen zielen. Gegenständliche (Re-)Produktionsformate betreffen gruppenbezogene Aktivitäten, die sich auf die (Wieder-)Herstellung von Dingen und Präsentationsobjekten konzentrieren. Das Spektrum reicht von der Renovation von Wohnungen über die Herstellung von Verkaufsobjekten und die Produktion von Medien bis hin zur Aufführung z.B. von Theaterund Musikstücken. Im Mittelpunkt steht immer eine gemeinsame 'Arbeit', die im wesentlichen nicht als abstrakte Lernarbeit, sondern als Produktion begriffen wird. AnbieterInnen dient sie als Vehikel der Heranführung an ein bestimmtes Thema, der handlungsorientierten und ganzheitlichen Auseinandersetzung damit und oft auch der Herstellung von Öffentlichkeit für 58 das Thema über das zu erstellende Produkt. Auch hier werden Inhalte fast immer nur grob vorgegeben und differenziert sich im Verlaufe des Herstellungsprozesses eine konkrete Herangehensweise weitgehend selbstgesteuert durch die TeilnehmerInnen aus. Eine zweite Variante hat mit spezifischen Absichten die Qualifizierung der Teilnehmenden zum Ziel. Im Gegensatz zu einem Lernen, das auf die Entwicklung allgemeiner Kompetenzen (z.B. soziales Lernen, verbale Konfliktfähigkeit u.ä.) fokussiert, soll hier ein Fähigkeitslevel erreicht werden, das die Lernenden nach Durchlaufen entsprechender Maßnahmen am Ende in Stand setzt, konkrete Aufgaben zu übernehmen (z.B. Jugendliche als AusstellungsführerInnen oder schulische Streitschlichter). Die Orientierung am Endprodukt 'Qualifikation' fordert eine vergleichsweise hohe Verbindlichkeit ein und baut deshalb auf anderen Formaten auf. Formate der Strukturverbesserung streben die Optimierung von Rahmenbedingungen lebensweltlicher Erfahrung an. Sie beziehen in einer bestimmten Variante die in den betreffenden Strukturen lebenden Subjekte partizipatorisch ein. Für die Umsetzung von Gestaltungsinteressen im Alltag schaffen sie Spiel- und Aktionsräume und bieten dafür Beratung, (Weiter- und Fort-)Bildung, Moderationskompetenzen u.ä. an. In einer anderen Variante arbeiten sie über weite Strecken weniger direkt mit den Gruppierungen, denen die angestrebten Verbesserungen in erster Linie zugute kommen sollen. Vielmehr bilden sie Kooperationszusammenhänge von VertreterInnen öffentlich agierender, insbesondere sozialer und pädagogischer Einrichtungen und gesellschaftlich relevanter Gruppierungen. Im Sinne des Gestaltungs-Paradigmas wird hier entweder beschränkt auf multiprofessionelle Zusammenarbeit oder in Verbindung von professionellen Kräften und BürgerInnen bspw. mittels Fach- und Stadtteilkonferenzen oder Runder Tische planerisch und organisatorisch für gewaltfreie Rahmenbedingungen des Zusammenlebens Sorge getragen. Ihren Schwerpunkt haben diese Formate im lokalen und sublokalen Bereich. Sie werden als Ergänzungen zu anderen Formaten betrachtet, weshalb die Personen, die sie tragen, nahezu alle auch mit anderen Formaten befasst sind, ja diese meist als ihr Kerngeschäft begreifen. Formate setzen sich in bestimmte Maßnahmendesigns wie Unterrichtsstunden, Informationsund Diskussionsveranstaltungen, Kurse, Kursreihen, Seminare, Workshops, aufsuchende Arbeit, Beratung, Qualifizierung, Fortbildungen, Kongresse, Aktionstage, Projekttage, Labors, (Stadtteil-)Feste, Bewegungs-, Sport- und Spielangebote, Begegnungsreisen, Workcamps, Medien-, Kultur- und sonstige Projekte, Publikationen, Ausstellungen, Foren, Aktionsplanung und Vernetzungsaufbau um. Sie legen die äußere Form fest, die vor allem die zeitlichen, räumlichen und sozialen Rahmenbedingungen bestimmt. 2.4 Theorie-Praxis-Verhältnis Pädagogik und Soziale Arbeit stellen Praxisfelder dar, die sich bestimmter Weise zu ihren Bezugswissenschaften Erziehungswissenschaft und Sozialarbeitswissenschaft verhalten. Wenn – wie beabsichtigt – Praxis, hier Praxiskonzepte des Umgangs mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt, auf ihre Bezüge zu wissenschaftlichen bzw. theoretischen Erkenntnissen untersucht werden soll, erhebt sich die Frage, wie das Verhältnis von Theorie und Praxis grundsätzlich begriffen werden kann. Wir thematisieren damit eine Problemstellung, die man im Osten Deutschlands zu DDR-Zeiten – auch wohl aus ideologischen Gründen – schlicht anwendungsoptimistisch mit der Hypostasierung der Handlungskette Praxis-Theorie-Praxis gelöst zu haben glaubte, zu der dagegen im Westen 59 Deutschlands seit den 70er Jahren ausgedehnte Debatten geführt werden. Ohne sie auch nur annähernd vollständig hier nachzeichnen zu wollen, sei festgehalten: Nachdem mindestens bis zum Beginn der siebziger Jahre ein Anwendungsoptimismus vorherrschte, der von der Überlegenheit wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion gegenüber anderen Formen des Wissenserwerbs ausging und ihr dem gemäß die Funktion einer Anleitung für die Praxis zuschrieb, verbreitete sich in der Folgezeit eher ein "Anwendungspessimismus". Er stützte sich auf die Beobachtung, dass die Fülle sozialwissenschaftlichen Wissens, die man in den 70er und 80er Jahren produziert hatte, kaum verwertet wurde, wobei Gründe dafür sowohl in der bloßen Instrumentalisierung von Wissenschaft für Legitimationszwecke von Politik als auch im Zuge der Verwendungsforschung (vgl. v.a. Beck/Bonß 1989) vermehrt in der qualitativen Differenz von Wissenschaft und Praxis gesehen wurden. Sie liegt vor allem darin, dass Wissenschaft handlungsentlastet ist und sich außerhalb praktischer Entscheidungszwänge ansiedeln kann. Mehr als die einzelne konkrete Situation interessieren sie Regelhaftigkeiten bzw. Generalisierungen und Abstraktionen. Inzwischen zeichnet sich auch gerade aufgrund der Resultate der Verwendungsforschung eine "realistische Wende" ab. Sie betont die Andersartigkeit und eben nicht die qualitative Hierarchisierung wissenschaftlichen und anderweitigen Wissens und betont, dass der Transfer wissenschaftlichen Wissens in die Praxis nicht als "maschinell-technische" "Anwendung" nach dem Kinderlied-Motto "die Wissenschaft hat festgestellt..., drum..." erfolgt. Vielmehr entwickeln sich durch "örtlich, zeitlich und sozial versetzte Interpretationsprozesse" von PraktikerInnen gefiltert, über einen längeren Zeitraum hinweg und in zahlreichen Instanzen Verwendungsweisen, die "ein aktives Mit- und Neuproduzieren" von Erkenntnissen beinhalten (alle Zitate ebd.). Die autonome Rolle der Praxis in diesem Prozess wird gestärkt durch die weiterhin zunehmende Verwissenschaftlichung öffentlich geführter Diskurse und alltäglicher Deutungen. Die mediale Verbreitung von empirischen Forschungsergebnissen und theoretischwissenschaftlichen Deutungen besitzt dabei allerdings eine beachtenswerte Vermittlungsfunktion (vgl. Schetsche 1996). Sie steuert nicht unwesentlich Selektion und Aufmerksamkeit für wissenschaftliche Produkte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ihr Nachrichtenwert von diversen Faktoren abhängt, die den Informationsgehalt selbst und die Umsetzung der Information betreffen. Zu den wichtigsten gehört ein für MedienvertreterInnen erkennbarer Bezug auf aktuelle Diskurse, die Prominenz von Akteuren, der Konfliktgehalt der Information, der Grad der Thematisierung eines Normenbruchs und z.T. die geographische Nähe des geschilderten Vorgangs. Präsentationsformen wie Personalisierung, Dramatisierung, Emotionalisierung, Moralisierung o.ä. schaffen jeweils spezifische Rezeptionsbedingungen. Von ihnen ist nicht nur der Alltagsmensch betroffen; auch die Fachpraxis zeigt sich gekennzeichnet durch die zunehmend mediale Vermittlung der Szientifizierung institutioneller Entscheidungen und beruflichen Handelns. Deshalb erhöht sich nicht nur der Stellenwert von Agenda des Alltagsdiskurses für sozialwissenschaftliche Themenzuwendungen. Es werden vor allem auch Rückkoppelungen von Praxis-Deutungen in die wissenschaftliche Sphäre relevanter, ja Inhalte und teilweise auch methodische Aufarbeitungen von wissenschaftlichen Themenstellungen werden stärker auch von PraxisInteressen lenkbar. Die Rolle wissenschaftlicher Aufarbeitungen liegt dennoch darin, ohne Anwendungsdruck Wissen zu produzieren, das für praktische Verwendungen zur Verfügung gestellt werden kann. Sie erfüllt sie hauptsächlich dadurch, dass sie in kritischer Distanz zur Praxis detaillierte Beschreibungen und deutende Reformulierungen von Sachverhalten liefert und/oder Methoden und Instrumente für die Selbstbeobachtung der Praxis entwickelt. 60 2.5 Evaluation Pädagogik und Soziale Arbeit selbst und ihre Geldgeber im besonderen sind daran interessiert, die Qualität ihrer Leistungen, Zielorientierungen und Wirkungen zu überprüfen, um sie fortentwickeln zu können. Evaluation steht unter diesem Leitziel. Was meint Evaluation genauer, auf welche Objekte kann sie sich beziehen, welche Methoden nutzt sie, welche Standards sind einzuhalten und wie ist ihr Entwicklungsstand in Deutschland einzuschätzen? Man versteht unter Evaluation nicht nur die schlichte Festsetzung des Wertes einer Sache, eines Prozesses oder eines Programms (vgl. Suchman 1967; Scriven 1980), sondern im wissenschaftlichen Bereich "eine systematische, auf vorliegenden oder neu erhobenen Daten beruhende Beschreibung und Bewertung von Gegenständen der sozialen Wirklichkeit" (Beywl/Schepp-Winter 2000, 17), die dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Forschungsmethoden und –techniken angepasst ist (vgl. auch Wottawa/Thierau 1990). Der wissenschaftliche Charakter von Evaluation erschließt sich darüber hinaus durch den Umstand, schlussfolgeorientiert angelegt zu sein, d.h. Arbeitsschritte und Ergebnisse nach wissenschaftsinternen Kriterien vorzunehmen bzw. vorzulegen und sich nicht den exmanenten Interessen entscheidungsorientierter Auftraggeber zu unterwerfen (vgl. Cronbach/Suppes 1969). Im Unterschied zu anderen fachlichen Formen des Feedbacks wie Supervision, Praxisberatung und Organisationsberatung, insbesondere aber im Gegensatz zu Rückmeldeformen wie Presseberichten u.ä. vermeidet sie Verzerrungen durch eine unsystematische oder ausschließlich aus dem praxisimmanenten Blickwinkel von Evaluierten getroffene Auswahl von Aspekten sowie durch Kurzfristigkeit bzw. unsystematische Zeitintervalle. Evaluation gilt in diesem Sinne im allgemeinen als eine Variante von Praxisforschung. Als Begleitforschung wäre sie dann zu verstehen, wenn sie in Längsschnittanlage auf die Untersuchung von Prozessen fokussierte. Sieht man einmal von solchen Nutzungserwartungen von Auftraggebern ab, die auf die Erhöhung von Kontrolldruck, die Delegation von Entscheidungsverantwortung und die Durchsetzung ohnehin geplanter Vorhaben gerichtet sind, kann Evaluation sinnvoll als Planungs-, Implementierungs-, Organisations- und Entscheidungshilfe eingesetzt werden. Grundsätzlich hat sich eine Unterscheidung zwischen einem "formativen" Evaluationstypus (auch "prozessorientierte" Evaluation oder "Programm-" bzw. "Gestaltungsevaluation" benannt) oder einem "summativen", "bilanzierenden" Evaluationstypus (auch als "produktorientierte" Evaluation oder "Ergebnisevaluation" bezeichnet) eingebürgert (vgl. auch v. Spiegel 1993). Das Interesse formativer Evaluation ist auf die Schaffung von Optimierungsgrundlagen für den Evaluationsgegenstand gerichtet (vgl. z.B. auch Schrödter 2002). In Hinsicht auf Maßnahmen und Maßnahmenbündel steht hier entweder die Frage adäquater Planung, geschickter Implementierung oder optimaler Organisation im Vordergrund. Summativ-bilanzierende Evaluation soll demgegenüber vorrangig der Entscheidung über Fortführung, Beendigung, Ausweitung oder Rückbau und ggf. der Auswahl zwischen alternativen Wegen der Zielerreichung dienlich sein (zu weiteren Differenzierungen von Evaluationsschwerpunkten nach Rahmenbedingungen, Zielorientierungen, Zeitperspektiven, Nutzenüberlegungen, Bearbeitungsformen und Formen der Meta-Evaluation vgl. kurz Wottawa/Thierau 1990, 27ff.). Gegenstände von Evaluierung können u.a. politische und pädagogische Programme, also Maßnahmenbündel, Einzelmaßnahmen, Personal und Teilnehmer, Organisationen und ihre 61 Strukturen, Produkte, Umgebungsfaktoren, Methoden und Techniken, Tätigkeitsstile und Evaluationen selbst (mittels Meta-Evaluation) sein. Entsprechend differieren ihre jeweilige Komplexität, ihre Schwerpunktsetzungen und Binnendifferenzierungen. Fragestellungen von Evaluationen können prinzipiell auf Strukturen, Prozesse und Ergebnisse (aber auch – wie von Maja Heiner vorgeschlagen – auf Konzepte und Inputs) ausgerichtet sein (vgl. Donabadian 1982). Auftraggeber sind im Vergleich dieser Fragerichtungen meist stärker als die in bestimmten Maßnahmen und Programmen beschäftigten MitarbeiterInnen selbst an den Ergebnissen interessiert. Was indes unter einem "Ergebnis" zu verstehen ist, muss differenziert geklärt werden. Abgesehen von der gerade Mittelgeber bewegenden Frage nach der Effizienz der mit seiner Erzielung verbundenen Arbeiten ist bei geplanten Evaluationen zu bestimmen, ob es mehr um Zielerreichungs- oder mehr um Wirkungskontrolle gehen soll. Steht das Interesse an Erkenntnissen über den "Output" oder eher das an Erkenntnissen über den "Outcome" im Zentrum? Die Frage lässt sich noch weiter differenzieren: Reichen statistische Daten über Nutzerzahlen, sozio-demographische Zusammensetzungen der Nutzergruppierungen, Nutzungszeitpunkte, Nutzungsdauern usw.? Ist darüber hinaus auch die Akzeptanz einer Maßnahme bzw. eines Programms bei den NutzerInnen von Interesse? Soll nach ihrer Zufriedenheit gefragt werden? Lässt sich diesbezüglich auf die Einschätzung der Programm- bzw. MaßnahmemitarbeiterInnen vertrauen? Oder sollen tatsächliche Lernerfolge erfasst werden? Wenn ja, sind sie als Wissenszuwachs messbar? Zeigen sie sich in der Änderung vormaliger Einstellungen und der Gewinnung von neuen Überzeugungen? Lassen sie sich als Verhaltensveränderungen erfassen? Falls ja: Sind diese Verhaltensveränderungen auch außerhalb des Maßnahmen- bzw. Programmsettings im Alltag vorhanden? Wie nachhaltig sind sie? Führen darüber hinaus Maßnahmen bzw. Programme auch zu grundlegenden, überindividuellen, etwa organisationalen Umstrukturierungen? Termini wie "Erfolgskontrolle", "Effizienzüberprüfung" "Ergebnisprüfung" oder "Wirkungsanalysen" sind mithin nicht mit Evaluation identisch, sondern nur (unterschiedliche) Aspekte evaluativer Studien. Dementsprechend macht es auch Sinn einen Evaluationsbericht als u. U. Wirkungsanalysen vornehmenden, outcomeorientierten "Bericht über Evaluationszweck, Fragestellungen, Datenerhebung, Ergebnisse und Schlussfolgerungen" von einer Dokumentation als "Aufzeichnung programmstatistischer Daten" und "durchgeführter Aktivitäten" und einem Sachbericht als "Verwendungsnachweis" für den Zuwendungsgeber zu unterscheiden (Beywl/Schepp-Winter 2000, 95). Methodische Zugriffe lassen sich in klassischen und alternativen Designs auffinden (vgl. v. Spiegel 1993). Sie beeinflussen z.T. erheblich die Aussagekraft von Ergebnissen. Zu den klassischen, an einem positivistischen Wissenschaftsverständnis orientierten Ansätzen zählen experimentelle und quasi-experimentelle Strategien sowie nicht-experimentelle Verfahren und komparative Programmevaluationen. Experimentelle Strategien operieren mit der Gegenüberstellung von Versuchs- und Kontrollgruppe(n). Während man die Experimentalgruppe einem "treatment" aussetzt, bleibt die Kontrollgruppe ohne Behandlung. Indem nun anhand von Messungen entlang vorher festgesetzter Kriterien Differenzbestimmungen zwischen den Gruppierungen vorgenommen werden, sollen möglichst signifikante Effekte des treatments herausgearbeitet werden. Eine quasi-experimentelle Versuchsanordnung bietet sich an, wenn das Evaluationsobjekt nur ex post untersucht werden kann. Man überprüft mit Hilfe statistischer Auswertungsverfahren gezielt Alternativhypothesen und bildet Vergleichsgruppen, beim mathching-Verfahren etwa aus "statistischen Zwillingen", also aus Personen, die in Hinsicht auf bestimmte relevante Merkmale der Untersuchungsgruppe gleichen. 62 Zu nicht-experimentellen Verfahren gehören Vorher-Nachher-Vergleiche oder post-factumMessungen bei verschiedenen Gruppen. Der Verzicht auf Kontroll- und Vergleichsgruppen lässt Kausalitätstests nach positivistischer Manier nicht möglich erscheinen, so dass sie eher zu heuristischen Zwecken eingesetzt werden. Komparative Evaluationen von Einzelmaßnahmen oder Maßnahmenbündeln werden dadurch angegangen gesucht, dass Träger mit gleicher Aufgaben- und Zielstellung bei der Ausführung ihrer Programme miteinander in Hinsicht auf differierende Effekte oder Effektstärken verglichen werden. Die genannten Ansätze ziehen neben den bekannten unerwünschten Effekten von Tests (z.B. Hawthorne-Effekt oder Pretest-Sensitivierung) eine lange Reihe von Schwierigkeiten nach sich: Aus berufsethischen Gründen erscheint es Fachkräften pädagogischer und sozialer Arbeit kaum oder gar nicht vertretbar, einer bestimmten Gruppe, die dann als Kontrollgruppe einer experimentellen Anlage in Frage käme, eine von ihnen von vornherein als sinnvoll erachtete Behandlung oder Maßnahme vorzuenthalten. Eine Zufallsauswahl im strengen Sinne erscheint praktisch unmöglich, weil innerhalb der Sozialen und zumindest auch der außerschulischen pädagogischen Arbeit Teilnahme oder Nichtteilnahme erfahrungsgemäß oft von schwer zu kontrollierenden Motivationen (etwa Sympathiebeziehungen) abhängen. Bei manchen Programmen, zumal bei persuasiven der Informations- und Überzeugungsarbeit, erscheint eine quantifizierende Messung von Effekten zur Feststellung ihres jeweiligen Nutzens wenig sinnvoll oder doch zumindest eine erhebliche Verengung von Nutzenvorstellungen vorauszusetzen. Das Konstanthalten fachlichen Handelns über einen längeren Zeitraum, eben den Untersuchungszeitraum hinweg, ist kaum zu bewerkstelligen; dies auch deshalb, weil die Kompetenz einer Fachkraft in diesen Feldern – im Regelfall auch von ihr selbst – darin gesehen wird, ihr Handeln situationsadäquat zu variieren. Fraglich bleibt, ob die jeweiligen Kontroll- und Vergleichsgruppen tatsächlich für einen Vergleich taugen oder ob sie sich nicht vielleicht durch unsichtbare Merkmale (z.B. Motive, Grundhaltungen) so unterscheiden, dass diese sich in nicht kontrollierbarer Weise auf die Versuchsanordnung auswirken. Bei vergleichenden Programmevaluationen kommt die Schwierigkeit hinzu, dass trotz halbwegs übereinstimmender Ziel- und Aufgabenstellung von Trägern theoretische Vorstellungen, Problemdefinitionen, Kompetenzen des Personals, Tätigkeitsstile, Rahmenbedingungen und andere Faktoren so unterschiedlich sein können, dass der Versuch signifikanter Dimensionierung der zu prüfenden Variablen unterlaufen zu werden droht. Letztlich unbeantwortet bleibt auch, wie die gesellschaftlichen Einflüsse im allgemeinen und die des unmittelbarer Umfelds im besonderen auf Versuchsteilnehmer längerfristig angelegter Untersuchungsreihen zu kontrollieren sind und ob experimentell festzustellende Wirkungen sich auch in realen Lebenskontexten zeigen würden. Im Rahmen einer dem handlungstheoretischen Paradigma folgenden "interpretativen", "qualitativen" oder besser: "rekonstruktiven" Sozialforschung (vgl. dazu z.B. Bohnsack 1999; Kromrey 1994; Böttger 1996; Hitzler/Honer 1997) wird deshalb ein anderer Ansatzpunkt gewählt. Mindestens sechs Prinzipien charakterisieren ihn: Eine Offenheit gegenüber den Eigenarten der ProbandInnenden, den Untersuchungsgegenständen, den Untersuchungssituationen, und den Untersuchungsmethoden impliziert erstens ein exploratives, Hypothesen generierendes (statt testendes) Verfahren. Zweitens wird der Forschungsprozess als Interaktionsprozess zwischen ForscherInnen und Erforschten angelegt. Sein Ziel ist die Erstellung von Konstruktionen zweiter Ordnung, also von Rekonstruktionen der Konstruktionen erster Ordnung der von ihnen Beforschten. Drittens sind auch die zu untersuchenden Phänomene in ihrer Prozesshaftigkeit und Historizität einzufangen. Zum vierten wird analytische Reflexivität eingefordert, also ein Verhalten, das das Vorverständnis und seine jeweiligen Fortschritte im Forschungsprozess jeweils ausweist und auf das Gegenstandsverständnis bzw. auf das in weiteren Phasen jeweils erweiterte Gegenstandsverständnis bezieht. Fünftes schließlich wird Respekt für den Einzelfall und seine 63 idiographischen Konturen reklamiert. Zum sechsten gilt die Auflage, Verfahrensschritte und – regeln weitmöglichst zu explizieren, um Transparenz über den Prozess des Erkenntnisgewinns herzustellen. Die klassischen Gütekriterien von Forschung wie Repräsentativität, Validität, Reliabilität, Objektivität und Verallgemeinerbarkeit werden hier entweder fallen gelassen oder gänzlich modifiziert (vgl. Flick 1987). Mit dem Einsatz qualitativer Methoden geht z.B. der Verzicht auf quantitative Repräsentativität einher. Validität wird anders, nämlich über ökologische, kommunikative, argumentative, kumulative und praxisorientierte Validierung herzustellen versucht (vgl. etwa Lamnek 1995, 152ff.), Reliabilität wird als "Stimmigkeit" begriffen (vgl. Bogumil/Immerfall 1985). Objektivität wird als Fiktion betrachtet und durch die Verknüpfung der Gütekriterien des Bezugs auf die subjektiven Relevanzen der untersuchten Subjekte, der Gegenstandsangemessenheit der Methode, der Anwendbarkeit der Forschungsresultate und in erster Linie der Herstellung eines intersubjektiven Konsenses ersetzt. Diesen Grundausrichtungen entsprechend werden Verfahren verfolgt, die die Beforschten und ihre Deutungen direkt in die Evaluationsarbeit einbeziehen, also die Rollentrennung zwischen ForscherInnen und Forschungsobjekten (tendenziell) aufheben. So interessiert man sich z.B. in der Sozialarbeitsforschung auch für die Sinnzuweisungen und Bedeutungszuschreibungen von "KlientInnen" und setzt mit Bezug auf Fachkräfte auf Monitoring-Verfahren. Sie dienen freilich der Reflexion und in deren Folge der reflektierten Planung, Durchführung und Auswertung der eigenen Tätigkeiten, nicht aber Absichten, die mit bilanzierend-summativen Evaluationen verbunden sind. Zwar werden noch oft qualitative und quantitative Ansätze gegeneinandergestellt, insgesamt aber löst sich die Tendenz zu Absetzung und Konfrontierung immer mehr auf und wird eine Verbindung quantitativer und qualitativer Methodik als aussichtsreich betrachtet. Evaluation wird von den Evaluierten selbst bzw. von denjenigen, die für ein Evaluationsobjekt (z.B. eine Organisation oder ein Programm) Verantwortung tragen, oftmals als eine heikle Angelegenheit betrachtet. Sie wird dann als Kontrolle, Überprüfung, externe Bewertung, ja z.T. sogar als eine Art Betriebsspionage wahrgenommen, die u.U. zu Kompetenzabsprache, Versetzung, Degradierung oder gar Entlassung führen kann, in jedem Fall aber droht, Handlungsspielräume und Autonomiegrenzen zu beschneiden. Die amerikanische Evaluationsforschung – repräsentiert durch das "Joint Commitee on Standards for Educational Evaluation" und die "American Evaluation Association" – hat nicht zuletzt aus diesem Grund normativ gefasste Leitprinzipien und berufsethische Standards formuliert, die Bedingungen für die Systematik, die Professionalität, die Aufrichtigkeit/Integrität von Untersuchungen, die Verantwortung für das Gemeinwohl und die Einhaltung menschlichen Respekts gegenüber Evaluationsbeteiligten (als "Prinzipien") sowie für die Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Korrektheit und Genauigkeit (als "Standards") von Evaluationsforschung festlegen (vgl. JCS 1994; AEA 1995; deutsch: Sanders/Beywl 1999). Während sozialwissenschaftliche Evaluation in den USA eine lange Tradition besitzt, soweit ausgebaut ist, dass Diskussionen über ihre disziplinäre Eigenständigkeit geführt werden und mehrere Berufsverbände für EvaluatorInnen existieren, kann ihr Entwicklungsstand in Deutschland nur als dürftig bezeichnet werden. Waren in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits gegen Ende der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts – bezeichnenderweise im Bildungswesen – erste Evaluationsbemühungen auf wissenschaftlicher Grundlage in Gang gekommen und verbreiteten sich diese Ansätze dort in den 30er Jahren, so bezogen sie sich nach dem Kriege vor allem auf das Marketing sowie die Wahl- und Medienforschung, dehnten sie sich aber in den 60er Jahren verstärkt auf die Untersuchung sozial-politischer Reformprogramme aus und erlebten seit den 70er Jahren 64 – anfänglich eher aufgrund von Reformeuphorie, später mehr unter dem Druck von "zerobased-budgeting" (Freeman/Solomon 1984, 138) – einen regelrechten Boom und gelten als die sozialwissenschaftliche Wachstumsbranche schlechthin, einerseits in Hinsicht auf die Untersuchung von Sozialexperimenten, andererseits in Hinsicht auf modernes Verwaltungsmonitoring (vgl. auch Rossi 1984; kurz: v. Spiegel 1993, 29ff.). In Deutschland hingegen wurde sozialwissenschaftliche Evaluation bis zu den siebziger Jahren kaum genutzt. Im Anschluss an Hellstern und Wollmann (1984) lassen sich bis Mitte der achtziger Jahre, wo nach den Schätzungen der Autoren immerhin doch 15-20% der gesamten sozialwissenschaftlichen Studien Evaluationsprojekte waren, fünf Entwicklungslinien festmachen, von denen vor allem die erste für die Bereiche pädagogischer und sozialer Arbeit wichtig ist. Anfänge von Evaluation als Versuch systematischen Lernens sind hierzulande danach in den späten sechziger und im Übergang in die siebziger Jahre zu registrieren. Die sozialdemokratisch geprägte Reformpolitik wollte über wissenschaftliche Begleitung modellhafte Erziehungs- und Bildungsprogramme auf ihre Qualität prüfen, um wissenschaftlich basierte Entscheidungen über ihre verbreiterte Einführung treffen zu können. Evaluation wurde primär als Instrument rationaler politischer Steuerung begriffen. Da indes schon bis Mitte der 70er Jahre der verwertbare Ertrag der anfänglich noch stark positivistisch angelegten, auf die Kontrolle von Versuchen zentrierten Forschung eher bescheiden ausfiel, konnten sich Ansätze entwickeln, die einerseits versprachen, dem politischen Interesse an rascher Implementation von unmittelbar anwendungsrelevanten Innovationen stärker genügen zu können und die andererseits wissenschaftsintern von den Attraktivitätsgewinnen handlungstheoretischer Traditionen profitieren konnten: Eine aktionsorientierte Handlungsforschung trat mit der Intention auf den Plan, statt distanzierte Produktbewertung anzustellen, praxisverpflichtet und engagiert für eine gelingende Implementation von reformerischen Vorhaben einzutreten. Für den vormaligen Verdacht sozial-technologischer Indienstnahme handelt(e) sich diese Richtung allerdings das Monitum ein, die grundsätzlich unterschiedlichen Aufgaben und Rationalitäten von Wissenschaft und Praxis zu ignorieren und damit die spezifische Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion preiszugeben. Eine zweite zeitgleich verlaufende Entwicklungslinie konturiert Evaluation als eine Art von Rückmeldeschleife für die Herstellung und Sicherung eines möglichst sachadäquaten Regierungs- und Verwaltungsapparats. Im Vordergrund stehen hier also Interessen der (Re)Organisation regierungspolitischen bzw. staatlichen Handelns. Ab Mitte der 70er Jahre rückte zum dritten vermehrt Evaluation als ein Mittel der nutzenorientierten Steuerung von öffentlichen Finanzen und in diesem Zusammenhang der Kostenreduzierung in den Blick. Seitdem seit den achtziger Jahren immer deutlicher wird, dass die Grenzen des Sozialstaates nicht nur fiskalische sind, sondern die Normalisierung von Lebensführung mittels staatlich gewährter Hilfen auch kulturell-normativ befragt und verschärft eine Aufblähung von sozialen Hilfeeinrichtungen zu lebensweltfernen "Wohlstandskonzernen" kritisiert wird, wird viertens Evaluation vermehrt auch mit Zwecken des Abbaus von "Bürokratismus" und angeblicher Überregulierung belegt. Fünftes schließlich verbindet sich nach Hellstern/Wollmann (1984) mit Evaluationsarbeiten die Erwartung, planerische Fehlentscheidungen vermeiden und über regelmäßige Berichterstattung über die Bewährung neu geschaffener gesetzlicher Grundlagen die Kontrollfunktionen politischer Entscheidungsträger stärken zu können. Im Verlaufe der 90er Jahre, verstärkt in ihrer zweiten Hälfte, gewinnt Evaluationspraxis in den Bereichen von Erziehung und Bildung im Umfeld der Debatte um Qualitätsmanagement, also um Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (vgl. Heiner 1996 a, 20), an Bedeutung. Insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe wird mit Nachdruck – z.B. durch die "Qualitätsinitiative" der Bundesregierung – Leistungs-, Ziel- und Wirkungsorientierung auf den Prüfstand gestellt (vgl. die Heftreihe "Qs", die seit Mitte der 90er Jahre vom BMFSFJ 65 herausgegeben wird sowie Heiner 1998). Diskussionen um Neuere Steuerungsmodelle, Total Quality Management und die DIN ISO 9000 rufen zwar nicht unerhebliche Widerstandsreaktionen auf den Plan und lösen wegen der Prägung solcher Modell durch fachfremde Interessen an Verwaltungsvereinfachung und aufgrund der ökonomistischen Ausrichtung privatwirtschaftlicher Entlehnungen (vgl. z.B. Pollit/Bouckaert 1995; Engel/Flösser/Gensink 1996) Abwehrhaltungen aus (vgl. auch die Kritik der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung an DIN ISO–Normen in KGSt 6/1995, 45: "Überbetonung des Qualitätsnachweises bei Vernachlässigung der Qualität selbst"), fordern aber andererseits doch die Entwicklung fachlich adäquater Alternativen heraus. Dabei spielen formative Ansprüche, qualitative Methoden und Selbstevaluation herausragende Rollen (vgl. v. Spiegel 1993; Heiner 1996, 1998). Gleichwohl hat sich bis heute Evaluation längst noch nicht als integraler Bestandteil der Konzeptentwicklung, geschweige denn der Praxis, durchgesetzt. Selbst wenn man registrieren kann, dass im Zuge des Anlaufens der Xenos- und CivitasProjekte der Stellenwert von Evaluation gerade auch für die in dieser Expertise speziell fokussierten Arbeitsbereiche in allerjüngster Zeit enorm im Anwachsen begriffen ist, so ist doch – soviel an dieser Stelle als Vorblick auf Kap. 3 – der Einschätzung von Wagner/van Dick und Christ (2001) zuzustimmen, die besagt: "Evaluationsstudien zur Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen fremdenfeindliche/antisemitische Einstellungen und Gewalthandlungen sind selten" (ebd., 324), ja "(s)elbst unter Rückgriff auf die internationale Literatur ist die Zahl qualitativ hochwertiger Evaluationsstudien" sogar "sehr gering" (ebd., 272). Hinzu kommt das Manko: "Viele Studien stammen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Übertragbarkeit auf deutsche Verhältnisse ist wegen der sehr unterschiedlichen Verhältnisse und Lebensbedingungen von ethnischen Gruppen in beiden Ländern schwierig" (ebd., 324). 2.6 Professionsimmanente Grenzen Staatliche Reaktionen auf den Konnex von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt lassen sich in Anlehnung an Husbands (2002) grob in drei Typen klassifizieren, die jeweils auf spezifische Zielgruppen gerichtet sind: 1. Primär auf Kontrolle setzende Strategien vertrauen in erster Linie auf die Durchsetzung legislativer und exekutiver Vorschriften und die Sanktionierung von Abweichungen davon. Ggf. werden sie durch eine von VertreterInnen der legalen Politik geäußerte Ächtung der Problemträger und das Gewährenlassen von oder Aufrufen zu öffentlichen Gegendemonstrationen ergänzt. Sie zielen auf organisierte und nicht-organisierte Straftäter, politische Parteien und sonstige Zusammenschlüsse der extremen Rechten, sind also auf Symptomträger bezogen. 2. Reaktionen, die vorrangig Sozialpolitik in Anspruch nehmen, versuchen über ein makroökonomisches Management sowie über eine entsprechend orientierte regionale und kommunale Politik Veränderungen zu bewirken. Sie intendieren eine Veränderung der Verursachungskontexte der Symptome. Dementsprechend sind ihre Bemühungen auf Wähler undemokratischer Parteien und Listen, Sympathisanten von solchen Vereinigungen und Menschen ausgerichtet, die deren programmatische Inhalte teilen, ohne deshalb unbedingt als Wähler oder Sympathisanten in Erscheinung zu treten. 66 3. Erziehung und Bildung in den Mittelpunkt stellende Antworten setzen Schwerpunkte auf sozialarbeiterisch flankierte Aussteigerprogramme für Gewalttäter und Kader, auf soziale Hilfen für rechtsextrem Orientierte, Fremdenfeinde und Gewaltakzeptierende, die sich unterhalb der Schwelle organisierter Aktivisten befinden, auf die Herstellung einer demokratischen (Gegen-)Öffentlichkeit und die Zerstörung der Reputation rechtsextremer Organisationen in Teilen der Bevölkerung sowie auf breit angelegte inner- und außerschulische Strategien, die ein von Multikulturalität und Gewaltfreiheit geprägtes Zusammenleben stützen und so die Attraktivität rechtsextremer und gewaltorientierter Angebote bei potenziell Ansprechbaren abzubauen versprechen. Die Kategorisierung ruft in Erinnerung, dass die pädagogisch-sozialarbeiterische Herangehensweise nur eine unter mehreren gesellschaftspolitisch bedeutsamen Reaktionsformen ist. Sie bringt bestimmte Chancen mit sich, bleibt aber auch in ihrer Reichweite begrenzt. Der in den vergangenen 10-15 Jahren geführte Fachdiskurs über professionstypische Grenzen von pädagogischen und sozialarbeiterischen Aktivitäten gegen die Gemengelage von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus lässt – so unterschiedlich einzelne Ansätze im einzelnen auch ausfallen mögen – einen Konsens erkennen, der in Punkten zusammengefasst werden kann, die Gefahren einer Fehlausrichtung oder Überschätzung markieren (vgl. Möller 1994, 1996): 1. Pädagogisierungsgefahr: Pädagogik und Soziale Arbeit können und dürfen nicht als Ausfallbürgen für Untätigkeiten oder Fehler der Politik herhalten. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sind zuvörderst politisch und sozio-ökonomisch induzierte Probleme, die nicht allein pädagogisch-sozialarbeiterisch zu lösen sind. Strukturelle Defizite sind nur sehr begrenzt über Anstrengungen von pädagogischer und Sozialer Arbeit zu beheben, selbst wenn sie infrastrukturelle Arbeit zu ihren Aufgaben zählen. 2. Delegitimationsgefahr : Ebenso wenig wie im allgemeinen organisierte Rechtsextreme pädagogisch beeinflusst werden können, sind kurzfristige Erfolge beim Abbau langfristig sozialisatorisch erworbener Gewaltakzeptanzen und tiefsitzender Ideologien innerhalb ihres Unterstützerund Sympathisantenkreises erreichbar. Der Aufbau integrationsförderlicher 'innerer' Haltungen bei Personen und Gruppen und 'äußerer' Lebenskonstellationen von 'Strukturen' ist ein zeitaufwendiges Unterfangen, weil Sozialisation per definitionem prozesshaft als stetig neu zu unternehmende wechselseitige Auseinandersetzung des aktiven Subjekts mit seiner Umwelt verläuft. Im Wettbewerb um schrumpfende Finanzierungsmittel für Jugend- bzw. Sozialarbeit und Erwachsenenbildung sollten potenzielle Träger von Maßnahmen rasche und dabei andauernde Wirkungen nicht suggerieren, zumal dann, wenn über die Form der Nachweise keine Klarheit hergestellt ist. 3. Gefahr der Stigmatisierung der jungen Generation: Es ist zu beobachten, dass die öffentlichen und leider auch fachlichen Debatten um Gewalt und Rechtsextremismus ganz überwiegend als Debatten um "Jugendgewalt" und um das Thema "Jugend und Rechtsextremismus" geführt werden. Damit gerät die Diskussion in eine gefährliche Schieflage. Zwar ist die Gewaltbelastung der jungen Generation und ihr überproportionaler Anteil an der Zahl rechtsextremer Straftäter nicht zu leugnen. Ein differenzierter Blick gibt jedoch leicht zu erkennen, dass es primär die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren sind, die rechtsextremen Parteien zu 67 Wahlerfolgen verhelfen und das Gros der rechtsextremen Straftäter stellen. Im Hinblick auf nationalistische, antisemitische und fremdenfeindliche Einstellungen zeigt sich eine vergleichsweise höhere Anfälligkeit älterer Menschen (vgl. Stöss 1999; Ahlheim/Heger 2000; Terwey 2000; Stolz 2000). Soziale Arbeit und Pädagogik "gegen rechts" erschöpfen sich deshalb nicht in Jugendarbeit und Schulaktivitäten. 4. Marginalisierungsgefahr: Nicht nur rechtsextrem auffällige Randgruppen Jugendlicher sind als Zielgruppen pädagogischer und sozialarbeiterischer Aktivitäten zu betrachten. Sie stellen nur die Spitze eines Eisbergs an Elementen von rechtsextremen und fremdenfeindlichen Haltungen dar. Die breite Akzeptanz von Bestandteilen antidemokratischer Auffassungen, insbesondere die Verbreitung von Ungleichheitsvorstellungen, bildet das Vorfeld und den gesellschaftlichen Resonanzraum und somit einen wesentlichen Stabilisierungsfaktor. Deshalb müssen auch die "Stinos" (die augenscheinlich "Stinknormalen") über die allgemeine Jugendarbeit, die Schulen und zivilgesellschaftliche Initiativen erreicht werden. 5. Reaktionismusgefahr: Interventionistisches Reagieren auf akute Problemlagen ersetzt keine langfristig angelegte Prävention. Die Bemühungen von Pädagogik und Sozialer Arbeit müssen dauerhaft in ein Netz koordinierter Initiativen von Instanzen wie Familienerziehung, institutionelle Kinderbetreuung, Nachbarschaftshilfe, Jugendschutz, Schule und Schulsozialarbeit, Erwachsenenbildung, Gemeinwesenarbeit sowie kommunalpolitische und zivilgesellschaftliche Initiativen eingebunden werden. Sie bedürfen darüber hinaus politischer und ökonomischer Flankierung. 6. Depolitisierungsgefahr: Die Probleme im Kontext von Rechtsextremismus, Minderheitendiskriminierung, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit eignen sich nicht dazu, als Unterpunkte unter die allgemeine "Gewalt"-Debatte subsumiert zu werden. Sie drohen dadurch als Sozialisations-Schwierigkeiten tendenziell normalisiert und ihrer politischen Konturen entkleidet zu werden. 2.7 Fazit Pädagogische und sozialarbeiterische Praxiskonzepte stehen im Kontext allgemeiner, d.h. nicht unbedingt themen- und problemspezifischer, disziplinärer und professioneller Denkmuster und Diskurse. Ihr Kennzeichen ist nicht das Fehlen von richtungsweisenden Utopien, wohl aber ein Mangel an konkretisierbaren Visionen, aus denen sich strategische und operative Zielsetzungen ableiten und in konkrete Handlungsschritte umsetzen ließen. Allerdings zeichnen sich durchaus Bewegungen in den grundlegenden Paradigmen ab. Sie geben Ersetzungen oder zumindest Erweiterungen traditioneller Orientierungen zu erkennen. Registrierbar ist der Bedeutungsgewinn von Erfahrungslernen gegenüber Wissensvermittlung und von Gestaltungsperspektiven gegenüber dem Hilfe-Ethos. Entsprechend verschieben sich die Schwerpunkte der dominierenden Strategien. Während Strategien der Informierung, Aufklärung, Bewusstmachung, argumentativer Überzeugung und der Erzielung kognitiv-moralischer Reflexion ebenso wie die am Hilfe-Ethos ankoppelnde Strategie der persönlichen Zuwendung auf dem Rückzug befindlich sind, verbuchen Strategien der Vermittlung funktionaler Äquivalente für Problemverhalten, ganzheitliche Settings und Qualifizierungsbestrebungen personaler und sozialer Kompetenzen 68 Attraktivitätszuwächse und werden zur Durchsetzung von Gestaltungsinteressen infrastruktureller Arbeit, politischer Einmischung, Sozialraumorientierung, Milieubildung, Netzwerkarbeit und Partizipationsförderung vermehrt Chancen zugesprochen. In der Folge erhalten die disziplinär favorisierten Formen der Herstellung von Vermittlungs- und Erfahrungskomplexen spezifische Prägungen. Im Achteck von Unterrichtung. Begegnung, personenbezogener Unterstützung, Einzelansprache, Training, Recherche, Produktorientierung und Strukturverbesserung gelten zunehmend vor allem solche Formate als fortschrittlich, die lebensweltnah, sozialräumlich und ressourcenorientiert agieren, ganzheitlich-integrierend verschiedene Persönlichkeitsfacetten ansprechen, Selbststeuerungspotenziale des Lernens ermöglichen und nutzen, gebrauchswertschaffend wirken und strukturelle Umsteuerungen beinhalten. Nachhaltigkeit gilt als entscheidendes Qualitätskriterium. Vernetztes Vorgehen erscheint daher als conditio sine qua non. Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist vielfach noch unklar. Dessen ungeachtet ist davon auszugehen, dass es sich um Sphären handelt, in denen unterschiedliche Rationalitäten gelten. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, dass Wissenschaft im Gegensatz zur Praxis keinem Handlungs- und Entscheidungsdruck ausgesetzt ist. In dieser relativen Distanz zu Praxisproblemen kann die Gefahr eines Rückzugs in den Elfenbeinturm wissenschaftlicher Forschung erblickt werden. Sie versetzt aber auch in die Lage, Praxisprobleme aus einem exmanenten Blickwinkel zu verfolgen und Deutungen produzieren zu können, die den unmittelbar in der Praxis Gefangenen so nicht zugänglich sind. So betrachtet kommt Wissenschaft die Funktion zu, den Interpretationshorizont von PraktikerInnen zu erweitern und darüber hinaus die aufgrund ihrer Beobachtungstätigkeit entwickelten Methodiken in adäquater Modifizierung für die Selbstbeobachtung der Praxis zur Verfügung zu stellen. Dies impliziert andererseits, sich als scientific community auch durch jene Interpretamente und (Selbst-)Re-flexionsformen bereichern zu lassen, die nur den unmittelbar in Praxis involvierten zugänglich sind und sie als Anregungen aus der Kommunikationsgemeinschaft der Praxis zu integrieren. Der Stand der pädagogischen und sozialarbeiterischen Evaluationsforschung ist von den verbreiteten Unsicherheiten im Verhältnis von Wissenschaft und Praxis gekennzeichnet. Das weitflächige Fehlen von Evaluationsforschung und die riesigen weißen Flecken im Bestand des Wissens über erzielte Leistungen, Zielerreichungen und Wirkungen sind auch als ihr Ausfluss zu verstehen. Immerhin zeichnet sich verstärkt seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre und noch deutlicher im Zuge der in Kap. 1 dargestellten politischen Programme ein steigendes Interesse an Evaluation ab. Freilich fällt dieses wenig homogen aus. Bedarfe nach formativ-optimierenden Unterstützungsleistungen stehen solche nach bilanzierendsummativen Klarstellungen entgegen. Stellen sich schon aus dieser Sicht hoch bedeutsame Fragen nach den Graden und damit auch den Grenzen der Beeinflussbarkeit von Menschen und Strukturen, so stößt die intendierte (wie die nicht-intendierte) Veränderung, die das Lernen von Individuen und Organisationen per definitionem mit sich bringt, auch auf professionsimmanente Grenzen. Sie werden nicht nur durch Fehldeutungen von zu bearbeitenden Problemen, sondern auch durch interne und externe Fehleinschätzungen der professionellen Funktion und der Reichweite der von ihr erzielbaren Veränderungen, aber auch durch solche professionellen Selbstverständnisse gezogen, die den infrastrukturellen und politischen Aspekt pädagogischer und Sozialer Arbeit unterbelichten oder gar ganz ausblenden. 3. Pädagogische und sozialarbeiterische Praxiskonzepte Der Versuch einer Bestandsaufnahme von Praxiskonzepten wirft eine Reihe von Fragen auf. Von ihnen sind vier besonders vordringlich: Zum ersten erhebt sich die Frage, wie – wenn 69 schon keine Vollerhebung möglich ist – eine Auswahl erfolgen kann, die zwar nicht den Anspruch auf Repräsentativität im quantitativen Sinne erheben kann, aber doch die Grundgesamtheit in ihrer Typik widerzuspiegeln vermag. Zum zweiten stellt sich das Problem, wo die thematischen Grenzen gezogen werden sollen, mit denen berücksichtigungswerte von zu vernachlässigenden Ansätzen getrennt werden. Zum dritten ist die Schwierigkeit ihrer sinnvollen Kategorisierung zu lösen. Zum vierten ist zu bestimmen, unter welchen Gesichtspunkten ihre Durchmusterung zu erfolgen hat. Der erstgenannte Punkt ist aus der qualitativen Forschung wohlbekannt. Zumeist wird ihm mit der Strategie des "theoretical sampling" begegnet (vgl. Glaser/Strauss 1967); d.h.: gezielt werden solche Fälle ausgewählt, die unter theoretischen Gesichtspunkten von besonderem Interesse sind und bspw. geeignet erscheinen, Theorien zu konterkarieren bzw. zu modifizieren. In Bezug auf unser Vorhaben macht diese Strategie keinen Sinn. Wir gehen eine Lösung stattdessen dadurch an, eine möglichst breit angelegte, wenn auch erheblich zeitraubende Recherche bei z.B. Ministerien, Landesjugendämtern, Bildungseinrichtungen etc. sowie im Internet, kontinuierliche Rückversicherungen über das sukzessive entstehende Gesamtbild bei Kollegen und Kolleginnen aus Wissenschaft und Praxis sowie eine Such- und nunmehr auch Präsentationsstrategie zugrunde zu legen, die konzeptionelle Elemente (z.B. Inhalte, Evaluationsaspekte) gegenüber trägerorientierten Darstellungen oder länder- bzw. regionenspezifischen Verteilungen priorisiert. Damit wird der Versuch gemacht, über schon vorhandene, sammelsuriumsartige Zusammenstellungen hinauszukommen (wie z.B. BKA 2000, aber auch andere) und deutlicher inhaltliche Konturen und Bewährungsgrade von Ansätzen erkennbar werden zu lassen. Aktualitätsbezug wird dabei gegenüber detaillierter Nachzeichnung historischer Entwicklungen pädagogischer und sozialarbeiterischer Traditionen Vorrang eingeräumt. Das Problem der thematischen Grenzziehung ist im Hinblick auf den von uns fokussierten Themenbereich von hoher Bedeutung. Fakt ist, dass sich in praxi keine klaren Unterscheidungen zwischen etwa sogenannten Anti-Gewalt-, Anti-Rassismus- und AntiRechtsextremismus-Projekten treffen lassen (siehe auch Kap. 1). Der Umstand nur ungefährer Gegenstandsbestimmung gebiert nicht selten die Schwierigkeit, Konzepte nicht wirklich zielgenau auslegen zu können und deshalb beispielsweise im Zielkatalog Einstellungs- von Verhaltensveränderung nicht scheiden zu können. Ähnlich ungenau bleibt dann, an welcher Stelle und in welchem Stadium des Auf- oder Abbauprozesses von rechtsextremer, fremdenfeindlicher und/oder gewalthaltiger Orientierung Konzepte zu intervenieren beabsichtigen. Deshalb sind definitorische Abklärungen zentraler Begrifflichkeiten wie der genannten und zusätzlich noch von Termini wie Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Ethnozentrismus, Nationalismus, Rassismus, Xenophobie, Faschismus etc. und die Bestimmung ihres Verhältnisses zueinander eigentlich unerlässlich (vgl. zu aktuellen entsprechenden definitorischen Ansätzen z.B. Boehnke/Baier 2001 Herrmann 2001; Neugebauer 2001; Möller 2001b). Schließlich hängt auch der Wert einer Evaluierung davon ab, dass Programmziele exakt benannt und ihnen zugeordnete Erfolgsindikatoren festgelegt werden. Auf der anderen Seite scheint eine gewisse Unschärfe auch Sinn zu machen, weil Gewaltakzeptanz, auch in unspezifischer Form – diesbezüglich insbesondere bei jüngeren Jugendlichen (vgl. Möller 2000a) – ein wesentlicher Bestandteil von Rechtsextremismus ist, ihre Bearbeitung insofern auch als Beitrag zur Rechtsextremismus-Bekämpfung begriffen werden kann. Ähnlich verhält es sich bei Konzepten, die sich darauf konzentrieren, fremdenfeindlichen Einstellungen zu begegnen. Letztere bilden bekanntlich einerseits den Kern der Ungleichheitsvorstellungen des modernisierten Rechtsextremismus, enthalten andererseits aber auch mehr oder minder deutlich verschiedene Formen der Gewaltakzeptanz (bspw. autoritär-nationalisierende Ausgrenzungsforderungen, die als systemisch-strukturelle 70 Gewalt deutbar sind), zumindest aber Vorformen von Gewaltakzeptanz mit fließenden Übergängen zu eben dieser. Die Problematik thematischer Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands vergrößert sich noch, wenn der Blick zudem auf Konzepte ausgedehnt wird, die sehr allgemein beanspruchen, interventiv oder präventiv Syndromen sozialer Desintegration und Folgeproblemen verweigerter Anerkennung durch Integrationsofferten und durch die Vermittlung von Chancen zu Anerkennungserwerb begegnen zu wollen. In dieser Hinsicht beschränkt sich unsere Analyse und damit auch die in diesem Kapitel erfolgende Darlegung auf solche Ansätze, die Integrations- und Anerkennungsangebote vor dem Hintergrund der Problematik von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit platzieren. Das Kategorisierungsproblem wird dadurch verringert, dass darauf verzichtet wird, eine von der Selbstbezeichnung bzw. –einordnung der Konzepte grundsätzlich abweichende, ihnen gegenüber äußerliche Typisierung stringent bspw. entlang paradigmatischer Anbindungen und strategischer Zielsetzungen oder auch inhaltlicher, methodischer oder handlungsfeldbezogener Kriterien vorzunehmen. Wir orientieren uns im weiteren an Arbeitsfeld-, Konzept- und Methodenbezeichnungen, die disziplinär und professionstypisch gängig sind und insofern konsensfähig sein dürften. Dabei muss in Kauf genommen werden, dass die Abgrenzungen der Konzepte untereinander nicht immer gänzlich trennscharf ausfallen und auch nicht jeweils auf der selben Ebene erfolgen. Verschiedene Ansätze setzen verschiedene konzeptionelle Schwerpunkte; dies derart, dass sie dem jeweiligen Ansatz eine spezifische Kontur verleihen. So beziehen sich unsere Kategorisierungen sowohl auf Ansätze, die auf spezifische Inhalte fokussieren (z.B. historische Bildung, Streitschlichtung, soziales Lernen), ihre Angebote auf bestimmte Zielgruppen ausrichten (Mitglieder der rechten Szene in der Aufsuchenden Arbeit, Aussteigerprogramme, Opferberatung), ihr Selbstverständnis aus der Zentrierung auf den Einsatz von i. w. S. bestimmten Methoden beziehen (Sport, Kultur, elektronische Medien etc.) als auch auf solche, die ein bestimmtes Arbeitsfeld in den Mittelpunkt rücken (z.B. schulumfassende Programme) oder nur ein spezifisches Format oder Design (Wettbewerbe, Trainings, Unterrichtseinheiten etc.) als Ankerpunkt wählen. Dieser Umstand kann indes nur aus einer überspitzten akademischen Perspektive heraus bemängelt werden, bildet er doch die Praxis viel adäquater ab, als ein exmanent erstelltes begriffliches 'Schubkastensystem' dies könnte. Denn zum einen greift der pädagogische Praktiker/die Praktikerin faktisch nicht (immer) aufgrund analytischer Vorüberlegungen, bewusster paradigmatischer Orientierungen oder langfristiger strategischer Planungen zu dem einen oder anderen Konzept. Er/sie lässt sich vielmehr oft von pragmatischen Motiven wie Fördervorgaben, arbeitsfeldspezifischen Bedingungen, zeitlichen, finanziellen und räumlichen Ressourcen, Vorkenntnissen, eigenen Kompetenzen und eigenem methodischen Zutrauen oder äußeren Anlässen leiten. Zum anderen sind Überschneidungen von Ansätzen von jeher Gang und Gäbe und werden konzept- und arbeitsfeldübergreifende Kooperationen, Methodenmischungen und Vernetzungen zum Aufbau eines möglichst breitbandigen, einzelne Elemente verzahnenden Ansetzens geradezu gesucht. Das Ordnungsprinzip wird auch durch bislang schon vorhandene Kategorisierungsversuche von Maßnahmen bzw. Konzepten des pädagogischen und sozialarbeiterischen Umgangs mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gestützt. So gehen Möller (1996), Schubarth (2001; stark angelehnt an die allerdings inzwischen veraltete Zuordnung von Möller 1996), Beutel u.a. (2001, vgl. v. a. 8f.) und auch die KollegInnen des DJI Leipzig bei der Erstellung der Datenbank MaReG (s.o.) ähnlich vor, auch wenn die MaReG-Klassifizierungen selbst aus unserer Sicht nicht ganz zureichend sind; dies u.a. deshalb, weil die dort benutzten Begriffe "Art der Maßnahme" bzw. "Methodischer Ansatz" entweder zu unspezifisch sind ("Art" in welcher Hinsicht?) oder sie Konzepte bzw. "Ansätze" wie Erlebnispädagogik oder geschlechtsreflektierende Arbeit als bloße "Methoden" erscheinen lassen und zudem bei ihnen 71 – wahrscheinlich wohl auch der Beschränkung auf Maßnahmen von Teil 2 des Programms "Jugend für Toleranz und Demokartie" geschuldet – der für die Arbeit mit rechtsextrem orientiertem Klientel so wichtige Bereich der aufsuchenden Arbeit gar nicht vorkommt. Die Gesichtspunkte der Analyse sind am besten nach den Bestandteilen auszurichten, denen pädagogische und sozialarbeiterische Konzepte zugewiesen werden. Pädagogische und sozialarbeiterische Konzepte können in Anlehnung an Geissler/Hege (1978) als der sinnhafte Zusammenhänge von Zielen, Inhalten, Methoden und ggf. noch Verfahren und Techniken begriffen werden. Als weitere wichtige Faktoren kommen die Analyse der Ausgangsbedingungen, die Rahmenbedingungen sowie die Zielgruppen- bzw. Adressatenorientierung hinzu. Von Interesse sind in unserem Zusammenhang zusätzlich äußere Aspekte wie die Maßnahmendesigns, die Trägerschaften, die Kooperationskontexte und die Handlungsfelder, in denen agiert wird. Einem zeitgemäßen Verständnis von Konzeptionsentwicklung entsprechend muss darüber hinaus der Evaluation von Konzepten besondere Beachtung geschenkt werden. Die folgende Erörterung durchforstet deshalb die aufgeführten Konzepte jeweils unter diesen Aspekten. Ihre schlichte Deskription wird dabei ergänzt durch eine kritische Reflexion ihrer Problemadäquanz und ihres Evaluationsgrades. Die Sichtung orientiert sich diesbezüglich vor allem an drei forschungsbezogenen Aspekten: Zum ersten wird untersucht, ob und ggf. inwieweit das jeweilige Konzept auf wissenschaftlich-theoretische Erkenntnisse über die Ursachen der bearbeiteten Problematik sowie über Distanz(ierungs)faktoren explizit oder implizit Bezug nimmt und/oder ob es pädagogische Theorien verarbeitet bzw. sich an sie anschlussfähig zeigt. Zum zweiten wird geprüft, ob und ggf. inwieweit wissenschaftlich produzierte empirische Erkenntnisse wahrgenommen und zur Grundlage gemacht werden. Zum dritten wird eruiert, ob und inwieweit Evaluationswissen berücksichtigt wird, sei es, dass die Resultate oder Methoden von Evaluationen anderer Konzepte in irgendeiner Weise – etwa modifiziert – in die jeweilige Konzeptentwicklung eingehen, sei es dass eigene Evaluationsanstrengungen unternommen werden oder gar bereits entsprechende (Zwischen)Ergebnisse vorgelegt werden können. 3.1 Vorherrschende Konzepte und ihr Bezug auf vorliegende Forschungsergebnisse Vor dem im Voranstehenden gezeichneten Hintergrund lassen sich – ohne Fortbildungskonzepte, die wir, dem Rahmen dieser Arbeit geschuldet, außer Betrachtung lassen – insgesamt 17 Praxiskonzepte ausmachen, die die gegenwärtigen pädagogischen und sozialarbeiterischen Anstrengungen in dem hier fokussierten Problembereich charakterisieren (vgl. auch zu z.T. schön älteren Ansätzen zu entsprechenden Überblicken: Herdegen 1992; Lukas u.a. 1993; Außerschulische Bildung 2/1993; Vahsen u. Mitarb. 1994; Möller 1996; Möller/Schiele 1996; Schubarth 2001; Metzger 2001). Es handelt sich um historische Bildung (1), Unterrichts-, Seminar- und Trainingseinheiten zur Demokratie- und Toleranzerziehung (2), Konzepte der Schulung personaler Kompetenzen und des allgemeinem sozialen Lernens (3), Mediation und Streitschlichtung (4), schulumfassende Programme (5), Maßnahmen zur Deeskalation und Entwicklung von Zivilcourage (6), aufsuchende Arbeit in recht(sextrem)en Szenen und Cliquen (7), 72 körper- und bewegungsorientierte Konzepte von Erlebnis-, Abenteuer- und Sportpädagogik (8), kultur- und medienpädagogische Konzepte (9), geschlechtsreflektierende Ansätze (10), gewalttherapeutische Ansätze (11), Partizipationsförderung (12), Kampagnen, Wettbewerbe und Aktionen (13), Anstrengungen zur Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen (14), Aussteigerprogramme (15), Opferberatung (16) sowie Soziale Arbeit mit MigrantInnen, interkulturelle Ansätze und Antidiskriminierungsarbeit (17).5 Im folgenden werden sie unter den oben beschriebenen Aspekten dargelegt und diskutiert.6 3.1.1 Historische Bildung Das Konzept "Historische Bildung" bildet einen Kategorisierungstypus, dessen Gravitationszentrum inhaltsbezogen definiert ist. Es handelt sich mithin um eine Form pädagogischer Arbeit, die dem Lerngegenstand herausgehobene Bedeutung zollt und durch ihn seinen Prägestempel aufgedrückt bekommt. Dementsprechend wurzelt es ursprünglich im Paradigma der Wissensvermittlung und verfolgt informatorische und aufklärerische Strategien, in denen Bewusstmachung und historisch-moralische Reflexion von hervorragender Bedeutung sind. Freilich versucht es schon seit längerem, in jüngerer Zeit aber verstärkt, auch Erfahrungslernen Geltung zu verschaffen und ganzheitliche Settings für seine Zwecke zu nutzen. Das für die dem Wissensvermittlungsparadigma verhaftete, 'alte' historische Bildung charakteristische Format der Unterrichtung wird damit zunehmend von dem der Begegnung (mit Zeitzeugen z.B.), der Recherche (Spurensuche-Projekte, Geschichtswerkstätten z.B.) und teilweise auch der Produktion (z.B. Beteiligung an der Erhaltung von Gedenkstätten) verdrängt. In Bezug auf die Bearbeitung von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rechtsextremismus und die im Kontext dieses Komplexes verortete politisch motivierte oder zumindest so getönte Gewalt dominieren zwei inhaltliche Differenzierungen: die historische Aufklärung über den europäischen Faschismus, insbesondere aber den Nationalsozialismus in Deutschland und die von ihm ausgegangenen Gräuel zum einen und die Rekonstruktion moderner Migrationsschübe, vor allem die der sog. 'Gastarbeiter'zuwanderung und des Asylbewerber'zustroms' nach Deutschland zum anderen. 5 Wir diskutieren hier zum einen nur solche Konzepte ausführlicher, die gegenwärtig aktuell und gängig sind. Deshalb werden bspw. Arbeits- und Wohnprojekte, wie sie im Nachgang der 'Wende' der Ostberliner Sozialdiakon Heinisch mit Ausstiegswilligen betrieb, nicht berücksichtigt (vgl. dazu aber Heinisch/Thiel 1996). Zum anderen bleibt die Erörterung auf Konzepte und konkrete Handlungsansätze beschränkt, die spezifisch auf eine Reduktion von Gewaltsamkeit und minoritätenfeindlichen bzw. rechtsextremen Orientierungen zielen. Deshalb wird auch nicht gesondert auf allgemeine Entwicklungen wie z.B. den Ausbau von ganzen Arbeitsfeldern wie Schulsozialarbeit, der neben anderen Erwartungen auch die Hoffnung auf gewalt- und extremismusreduzierende Effekte entgegengebracht wird, eingegangen. 6 Die Reihung der Konzepte gibt keine Verbreitungsgrade, Wertigkeiten oder historisch-chronologischen Abfolgen wieder. 73 Zu den am stärksten dem etablierten nachkriegsdeutschen Antifaschismus verhafteten Konzepten sind jene Maßnahmen zu zählen, die nach wie vor die pädagogische Auseinandersetzung mit dem historischen Faschismus, insbesondere mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, ins Zentrum rücken. Das zentrale Argument heißt hier im Zusammenhang mit der Bekämpfung aktueller Phänomene: Im Rechtsextremismus unserer Tage wirkt die 'Last der Vergangenheit' nach. Wenn aber politisch-kulturelle Traditionsbezüge und organisatorische wie personelle Kontinuitäten über Generationen hinweg ihren Einfluss entfalten, müssen genau sie von vornherein verunmöglicht oder abgebaut werden, um "dem Faschismus das Wasser ab(zu)graben" (Hafeneger u.a. 1981). Dabei geht es pädagogisch nicht (mehr) nur darum, verdrängte Fakten der deutschen Geschichte ans Licht zu zerren und in das Bewusstsein zu heben, ein lückenhaftes Geschichtsbild mit Informationen und neuen Wissensbeständen aufzufüllen, Verbindungslinien bis in die Gegenwart offen zu legen und/oder Reflektionen anzuregen, die in politisch-moralische Empörung gegenüber der NS-Politik und ihren Akteuren münden können. Deutlicher als früher wird in jüngerer Zeit auch die Frage gestellt: Wie hätte ich mich damals verhalten? Mit anderen Worten: Zivilcourage wird zum Thema gemacht (vgl. z.B. Steil/Panke 2001; auch: Zwaka 2002). Sind damit die grundlegenden Ziele beschrieben, so sind die Zielgruppen zumeist jugendlichen Alters. Mehrheitlich handelt es sich um Schulklassen, die im Rahmen des Unterrichts – lt. Lehrplänen häufig im 8ten und 9ten Schuljahr – mit der Problematik konfrontiert werden. Ansätze im außerschulischen Bereich nehmen sich demgegenüber zahlenmäßig eher bescheiden aus. Dies hängt wohl damit zusammen, dass Motivation zur Teilnahme an politischer Bildung sich, zumal bei jungen Leuten, nur wenig über das Interesse an Inhalten aufbaut. Sozial benachteiligte, unmittelbar rechtsextrem Gefährdete oder gar rechtsextreme Jugendliche zählen nur in Ausnahmefällen zu den Adressaten (vgl. dazu Behn u.a. 1995; Richter/Wagner 1996; Nickolai 1996a, b; ver.di publik 01/2002). Die Inhalte konzentrieren sich auf die Vernichtungspolitik der 'Nazis'. Andere Bereiche der nationalsozialistischen Politik, der Alltag im Nationalsozialismus oder die jüdischen Kulturtraditionen werden noch wenig aufgearbeitet, auch wenn das Interesse an und die Zuwendungen zu solchen Themen steigen. Nachdem im Westen Deutschlands die nationalsozialistische Vernichtungspolitik vor allem auf den an den Juden begangenen Genozid fokussierte und zu DDR-Zeiten der Nationalsozialismus vor allem als Versuch der Ausmerzung seiner politischen Gegner, insbesondere der Kommunisten thematisiert wurde (vgl. Heinemann/Schubarth 1992), wird der pädagogische Blick heute zusätzlich auch zunehmend anderen verfolgten gesellschaftlichen Gruppierungen (Sinti und Roma, Homosexuellen, Behinderten u.a.m.) zugewandt. Soweit sich historische Bildung methodisch nicht auf kognitivistisch verkürzte politische Informierung, distanziert-seminaristische Aufarbeitungen und politisch-moralische Belehrung beschränkt (vgl. Tiedemann 1996), baut sie auf das Wecken emotionaler Betroffenheit und eigenes aktives Handeln der TeilnehmerInnen. Solche Ansätze finden sich am ehesten im außerschulischen Bereich in der Trägerschaft von Einrichtungen der politischen Bildung, wenig im schulischen Unterrichtsalltag (wo sie jedoch auch rasch an die strukturellen Grenzen des Unterrichtungsformats stoßen; vgl. Meseth/Proske 2002), dort i.d.R. allenfalls bei schulischen Sonderprojekten (Gedenkstättenbesuche, die schulische Richtlinien schon z.T. seit Ende der 70er Jahre empfehlen), bei denen dann vielfach auch mit außerschulischen Einrichtungen und Initiativen kooperiert wird (vgl. etwa Kandzora 1995 und die Beispiele von "best practice" in Beutel u.a. 2001, 35-43 außerdem als guten Überblick www.lernen-ausder-geschichte.de; Brinkmann 2000; einen umfassenden Überblick über die deutschen Gedenkstätten bieten die beiden Bände Puvogel/Stankowski 1995 und Endlich u.a. 1999): 74 Über Besuche ehemaliger Konzentrationslager und praktische Gedenkstättenarbeit (vgl. Ehmann u.a. 1995), z.B. im Design von teils mit internationaler Teilnehmerschaft besetzten Workcamps (vgl. auch Wittmeier 1997), soll eine politisch-historische Aufklärung erfolgen, existentielle Betroffenheit von nationalsozialistischen Gräueln erzeugt, ein Gefühl und die Praxis der historischen Verantwortung wachgehalten und die Reflexion aktueller politischer Entwicklung auf historischem Hintergrund initiiert werden (vgl. Maier 1998). Einige Ansätze gehen in konkrete Arbeit über wie z.B. die Initiative von Gruppen der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, Apotheken in den Herkunftsstädten ehemaliger Zwangsarbeiter (Minsk, Witebsk, Brest) einzurichten (vgl. auch die Aktivitäten von "Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V." z.B. www.gegenvergessen.de oder Gegen Vergessen Nr. 30/2001) In Projekten der "Spurensuche" arbeiten (Jugend-)Gruppen werkstattähnlich die konkrete lokale oder regionale NS-(Alltags-)Geschichte mittels eigener Nachforschungen auf. Oralhistory-Interviews mit Zeitzeugen, die Sichtung von Archiven, Fotos und Akten u.ä.m. setzen eine ganzheitliche Aktionsorientierung dem abstrakten Stofflernen und –diskutieren im Rahmen der klassischen politischen Bildung entgegen (vgl. z.B. Landesjugendring Niedersachsen 1997; Heidötting-Shah/Kather 2002; auch www.spurensucheonline.de/projekte und die Projekte der Hauptpreisträger des Victor-Klemperer-Preises 2001). Lesungen, Theateraufführungen mit historischen Bezügen und Ausstellungen, die professionell gemacht sind oder auch im Sinne einer produktorientierten Formatierung des pädagogischen Angebots aus "Spurensuche"-Projekten resultieren können, präsentieren Geschichte in anschaulicher Form. Sie suchen nicht allein abstrakt zu informieren, sondern auch – wie die gegenwärtig durch Deutschland und Österreich tourende WehrmachtsAusstellung – die Verantwortung für das Gestern bei nachwachsenden Generationen wach zu halten. Als besonders innovative "good practice" präsentiert sich die deutschsprachige Version der internationalen Wanderausstellung des Anne Frank Hauses, Amsterdam "Anne Frank – eine Geschichte für heute". Das vom Berliner Anne Frank Zentrum für Deutschland betreute Projekt hat das Ziel, über die persönliche Geschichte Anne Franks Interesse an der NS-Zeit zu wecken, aber auch – weitgesteckter – "über Parallelitäten zwischen Gestern und Heute nachzudenken" und "für eine gerechtere Gesellschaft aktiv zu werden" (so der Prospekt der Ausstellung). Im Rahmen einer Dialog-Didaktik wird Wert auf das Gespräch zwischen BesucherInnen und Begleitpersonen gelegt. Das Prinzip "Jugendliche für Jugendliche" sieht dabei auch vor, dass durch ein begleitendes Seminarprogramm speziell vorbereitete Jugendliche als AusstellungsführerInnen auftreten können (vgl. insgesamt auch www.annefrank.de; ähnlich auch die Begleitangebote im Nürnberger Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände; vgl. Prölß-Kammerer 2002). Eine nicht mehr überschaubare Vielzahl an elektronischen und Print-Publikationen, ebenfalls als Produkte von Rechercheprojekten denkbar, meist aber professionell hergestellt, vertieft historisches Wissen (so auch bspw. als Begleitmaterial zum Anne Frank Ausstellungsprojekt; vgl. die CD-ROM "Anne Frank Haus – ein Haus mit einer Geschichte"). Die Produkte mögen als Ergebnis eines handlungsorientierten Projekts eine weitere Beschäftigung mit historischen Themen anregen. Als Internet-Angebote verstehen sie sich auch als Konterpart zu Adressen, die Jugendliche auf nationalsozialistische bzw. anderweitig fremdenfeindliche, rassistische und/oder gewaltverherrlichende websites sowie zu mit historischen Reminiszenzen operierenden Computerspielen locken wollen (vgl. z.B. die CD-ROM "Dunkle Schatten" des BMI oder das bannerformatierte "ploppattack" auf der Seite von "blick nach rechts"; www.bnr.de) In einigen Städten werden alternative Stadtrundfahrten – in Hamburg, wo eine entsprechende Aktivität schon seit fast 25 Jahren vom Landesjugendring ausgeht und 75 mittlerweile etwa 100.000 TeilnehmerInnen gefunden hat bspw. auch als Hafenrundfahrten – angeboten, die mit Stätten der nationalsozialistischen Herrschaft bekannt machen und insbesondere Verfolgung und Widerstand thematisieren. Auch hier besteht nicht zuletzt die Absicht "auch präventiv zu wirken" (so als Bespiel für viele: Arlt o.J., 9; weitere Infos: [email protected]). Die "Projektwerkstatt Erinnerungskultur" wagt sich – anscheinend bei großer Resonanz unter SchülerInnen – experimentell daran, Humorpädagogik gegen rechte Ideologien einzusetzen, um "emotionale Zugänge gerade auch zu diesem Thema" zu nutzen. Es geht darum, "die Ideologie der Nazis zu entblättern, ohne den Nationalsozialismus zu verniedlichen" und damit den Rat des britischen Historikers Ian Kershaw zu verfolgen, die Deutschen sollten mehr über Hitler lachen, denn: "Wer wird sich einer Ideologie verschreiben, über die gelacht wird" (Neue Westfälische 01./02.11.2001). Kritiker am geschichtsorientierten Ansatz monieren die von ihm unterstellte Bruchlosigkeit faschistischer Überlieferung und die Tauglichkeit historischer Analogieschlüsse. Sie diagnostizieren stattdessen eher Modernisierungen rechtsextremen Denkens und Handelns, z.B. in Richtung auf Ethnopluralismus, die Konstruktion neuer Gegnerschaften (Migranten), das Verlegen auf systemisch-strukturelle Gewalt, die Ablösung von Eroberungs- durch Verteidigungs-Mentalitäten, neue Organisationsformen u.ä.m. (vgl. Möller 1989, 1993). Zudem bemängeln sie die kognitivistischen Verengungen, unter denen vor allem der schulische Geschichtsunterricht immer noch leidet und bezweifeln, dass unter diesen Bedingungen nachhaltige und verhaltenswirksame Haltungen entstehen können. Ferner erscheint manchen von ihnen fraglich, ob rechts(extrem) Orientierte nach verschultem Unterricht oder auch schulisch mehr oder weniger 'erzwungenen' Gedenkstättenbesuchen im Klassenverband nicht eher kontraproduktive Wirkungen an den Tag legen und geschichtliches Wissen überhaupt, gleich über welche Periode, vor aktuellen politischen Fehlern zu schützen vermag. Was also ist vom historischen Ansatz des NS-Aufklärung, was von den Bedenken seiner Kritiker zu halten? Prüfen wir, wo theoretische Anbindungen gegeben sind, empirische Erkenntnisse Klärungen herbeiführen können und Evaluationsergebnisse vorliegen: Soweit jenseits von alltagstheoretischen Hypothesen über Kontinuitätsbezüge von Minderheitenfeindlichkeiten heute einerseits und faschistischer Ideologie in ihren historischen Ausformungen und machtpolitischen Niederschlägen andererseits wissenschaftlichtheoretische Anknüpfungen vorgenommen werden, nehmen sie – wenigstens punktuell – auf die klassische Autoritarismusforschung bzw. ihre Nachfolgelinien Bezug (vgl. vor allem Adorno 1968, 1969, 1973). Danach sind autoritäre, ethnozentrische, antisemitische und faschistische Orientierungen eines Individuums in individuellen "Charakterstrukturen" verankert, die sich als "autoritäres Syndrom" begreifen lassen und die eine Disposition – nicht die Zwangsläufigkeit – zur Ausprägung entsprechender Haltungen in sich tragen (vgl. näher ebd., 45f). Die Herausbildung dieses Charakters wird auf frühkindliche Sozialisationserfahrungen zurückgeführt. Im Mittelpunkt steht das Misslingen einer stabilen Über-Ich- bzw. Gewissensbildung: Die Aggressivität des Kindes gegenüber dem Vater wird nicht in einem stabilen und zugleich flexiblen Über-Ich aufgehoben. Es bildet sich keine autonome moralische Instanz heraus, so dass die Person zu einem externalisierten Über-Ich Zuflucht nimmt, das klare Orientierung über eine rigide Schwarz-weiß-Moral zu versprechen scheint. Je stärker gesellschaftliche Auffassungen und Autoritäten, die als Mehrheitsmeinungen bzw. legitime Meinungsführer dechiffriert werden, z.B. autoritäre Aggression zu betonen scheinen, um so entgrenzter kann die Feindseligkeit gegenüber ihren Zielgruppen ausfallen, wird von der autoritären Persönlichkeit doch eine hohe Konformitätsverpflichtung ihnen gegenüber 76 empfunden. Psychologistischer Verengung vorbeugend, aber dennoch nicht die Zentrierung auf individuelle Merkmale aufgebend, wird in soziologischer, kapitalismuskritischer Perspektive, vor allem in der mit Horkheimer veröffentlichten und zeitlich parallel entstandenen "Dialektik der Aufklärung" als sozio-ökonomischer Hintergrund autoritärer "Anfälligkeiten" eine "kollektive Ich-Schwäche" diagnostiziert, die im Zeitalter der "großen Konzerne" über eine Ersetzung des Gewissens durch "Verbände" und das "Schema der Massenkultur", durch "Gremien und Stars" (vgl. Clemenz 1998, 142) zustande kommt. Die Kritik an dem Ansatz (vgl. im Überblick, aber genauer: Möller 2000a sowie Boehnke/Baier 2001, 56-63) bringt in Anschlag, dass eher eine dogmatische Geisteshaltung als charakterliche Strukturen für die Übernahme ethnozentrischer und rechtsextremer Einstellungen verantwortlich zu sein scheinen (vgl. Rokeach 1960), dass situative Faktoren, etwa Regierungsverhalten und ökonomische Krisen einen großen Einfluss haben können (vgl. Wacker 1979; Oesterreich 1993, 1996, 1997, 1998; Ottomeyer 1997) und dass die Langzeitwirkung frühkindlicher Erfahrungen, die das Autoritarismuskonzept unterstellt, eher unwahrscheinlich ist. Nach Altemeyers schon etwas ältern empirischen Befunden (vgl. 1988) besteht allenfalls ein sehr schwacher Zusammenhang zwischen elterlichen Erziehungsstilen und rechtsextremen Einstellungen. Neuere Studien aus psychoanalytischer Sicht nehmen (vgl. z.B. Streek-Fischer 1992; König 1998) stärker die Sozialisationsfolgen lebensbiographisch weniger weit zurückliegender Phasen jugendlicher Rechtsextremer in den Blick. Hingewiesen wird dann auf die Auswirkungen des Versagens weiterer Erziehungspersonen und auf Prozesse schulischen Scheiterns als "punktuellen Beschädigungen der Subjektivität" (König 1998, 202). Angenommen wird, dass die Gleichaltrigengruppe unter Aufgabe des Entwicklungsinteresses an "Eigenständigkeit" "Elternersatzfunktionen" (Streek-Fischer 1992, 756) übernimmt und nun familiale Konflikte auf der Straße reinszeniert und schulische Ohnmachterfahrungen durch Stärke- und Machtdemonstrationen kompensiert werden sollen. Einige Autoren machen darauf aufmerksam, dass im Zuge eines sich abzeichnenden "Wertewandels" und sich liberalisierender Erziehungspraktiken die Familienstrukturen sich innerhalb der letzten Jahre erheblich gewandelt haben und der klassische bürgerliche Sozialcharakter als Modell erodiert (vgl. z.B. Paul 1979; Dubiel 1988). Das Muster der autoritären Unterwerfung und der Verpflichtung auf konventionelle Konformitätszwänge scheint auf dem Rückzug zu sein, das Muster autoritärer Aggression demgegenüber an Rang zu gewinnen (vgl. z.B. auch Hopf u.a. 1995; Rieker 1997). So wie die empirische Validierung der psycho-analytisch inspirierten Theoreme höchst defizitär ist (vgl. Boehnke/Baier 2001), so ist auf der Basis empirischer Vermessungen der gegenwärtigen Rechtsextremismus- und Minderheitenfeindlichkeits-Problematik zweifelhaft, ob die bei ihren personalen Auslösern zu Grunde liegenden Einstellungen und Verhaltensweisen tatsächlich im wesentlichen Ideologien beinhalten, die faschistischem bzw. nationalsozialistischem Gedankengut entspringen. Zwar sind nationalsozialistische Anleihen im gedanklichen, verbalen und symbolischen Repertoire wie im Auftreten rechtsextremer Parteien, Organisationen und "Kameradschaften", verschärft innerhalb des neo-nationalsozialistischen Sektors des von ihnen gebildeten Spektrums, unübersehbar, jedoch stellen diese Vereinigungen nur die Spitze eines Eisbergs an antidemokratischen Gefährdungen von rechts dar. Dies gilt selbst dann, wenn man neben ihren Mitgliedern auch noch ihre Wähler berücksichtigt (vgl. SINUS 1981; Stöss 1993; Niedermayer/Stöss 1998; Stöss 2000). Hinzu kommt, dass die modernisierte Neue Rechte, 77 trotz aller geschichtsrevisionistischen Einsprengsel, z.T. ausdrücklich das "Heil ohne Hitler" sucht. Noch deutlicher indes wird die Absetzung vom Verdacht, nationalsozialistische Ideen verfolgen zu wollen, dort unternommen, wo rechtsextreme und fremdenfeindliche Haltungen im Umfang am deutlichsten zum Ausdruck gelangen: in der unorganisierten Szene und ihrem Sympathisantenumfeld, in dem bekanntlich gerade Jugendliche und junge Erwachsene stark vertreten sind. Dabei muss – abgesehen davon, dass einer derartige Strategie dem lebenslagen- und bedürfnisorientierten Ansatz moderner (Sozial)pädagogik diametral entgegensteht – im allgemeinen nicht unterstellt werden, dass es sich hierbei um einen geschickten Schachzug handelt, der die eigentlichen Motive und Absichten nur verstellen soll. Denn die Empirie von Rechtsextremismus und Minderheitenfeindlichkeit in heutiger Gestalt zeigt u.a. deutlich: Antisemitische Einstellungen sind zwar nicht restlos verschwunden, jedoch haben sie sich im Vergleich der Generationen bei den Jüngeren deutlich reduziert. Sie dominieren nicht mehr in Legitimationszusammenhängen von Ausgrenzungspostulaten gegenüber Minoritäten. Zudem haben sie sich qualitativ verändert: Weitaus weniger wird Antisemitismus heute von rassistischen und religiös motivierten Ressentiments bestimmt. Sie sind zugunsten eines "sekundären Antisemitismus" in den Hintergrund getreten, der sich aus der kritischen Sicht auf einen angeblich zu stark selbstbezichtigenden und dadurch unnötig Kosten verursachenden Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands ergibt (vgl. Bergmann 2001). Auch die Straftatenstatistik macht unmissverständlich klar, dass der kriminelle und gewaltsame Rechtsextremismus meist nicht antisemitisch, sondern zu mindestens zwei Dritteln fremdenfeindlich motiviert ist (vgl. Verfassungsschutzberichte 1991 ff.). Eine Bewunderung nationalsozialistischer Führungspersönlichkeiten ist nur bei kleinen Minderheiten vorhanden. Der Auffassung, der Nationalsozialismus sei im Grunde eine gute Idee gewesen, die nur schlecht ausgeführt worden sei, wurde nie weniger zugestimmt als heute (vgl. von Borries 2002). Fremdenfeindlichkeit heute hat sicherlich brutale und menschenverachtende Dimensionen, sie begrenzt sich dennoch weit überwiegend darauf, eine rigorose Zuwanderungsbegrenzung und ggf. die radikale Ausweisung von Ausländern zu fordern (vgl. Bergmann 2001). Hier liegen bemerkenswerte Unterschiede zur NS-Zeit und zur NS-Ideologie. Judenfeindlichkeit im Nationalsozialismus war die gezielte Ausrottung zunächst inländischer Rechtstitelbesitzer. Sie wurde staatlich propagiert und auf brutalste Weise durchgeführt. Fremdenfeindlichkeit heute hingegen trifft zuvörderst Menschen, die – rechtlich betrachtet – keine Inländer sind; sie wird von ihren Trägern in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit nicht mit Vernichtungs-, sondern mit räumlichen und sozialen Ausgrenzungsforderungen versehen; so sehr man sich auch veranlasst sehen mag, von 'links' den Jahrzehnte alten Vorwurf einer 'Blindheit des Staates auf dem rechten Auge' weiter aufrecht erhalten zu müssen, einen faktisch produzierten bzw. stillschweigend hingenommenen 'strukturellen Rassismus' zu brandmarken und/oder in vereinzelten Aussagen von Funktionsträgern rechtsextreme Anklänge auszumachen: Eine der NS-Politik auch nur in Ansätzen vergleichbare, unverhohlene Propagierung von Fremdenfeindlichkeit und sonstigen rechtsextremen Positionen wird man staatlichen Stellen nicht nachweisen können. (Nicht nur) insofern ist die sog. 'Ausländerfeindlichkeit' heute etwas strukturell anderes als es der Juden- und sonstige Minoritätenhass des Nationalsozialismus war. 78 Schon deshalb sind Analogieschlüsse zwischen nationalsozialistischer Verfolgungspolitik und gegenwärtigen Phänomenen von Minderheitenabneigung und –ausgrenzung schlechterdings nicht möglich. Wer pädagogisch auf sie vertraut, setzt auf falsche Pferd. In eklatantem Gegensatz zu dem hohen Stellenwert, den historische Bildung und speziell Gedenkstättenpädagogik im öffentlichen Bewusstsein und erfahrungsgemäß insbesondere für Lehrpersonen und PolitikerInnen in Hinsicht auf Erinnerungsarbeit, Aufklärung über den Nationalsozialismus, politisch-moralisches Lernen und auch die Bekämpfung des Rechtsextremismus genießt (vgl. auch Müller 1996, 8, Ehmann 2000; Morsch 2001), liegen Evaluationserkenntnisse kaum vor. Eine seit längerem angekündigte Bestandsaufnahme (von Thomas Leithäuser und Rolf Vogt) über den pädagogischen Umgang mit den Themen "Nationalsozialismus" und "Holocaust" im Unterricht ist wegen Finanzierungsschwierigkeiten noch nicht begonnen worden. BesucherInnenforschungen bei Gedenkstätten, die über statistische Zählungen hinausreichen, liegen z.Zt. nur für Dachau (vgl. Fröhlich/Zebisch 2000) und Sachsenhausen (vgl. Müller 1996, auch Morsch 2001) vor. Die Dachauer Studie erfasste mittels standardisiertem Fragebogen innerhalb von jeweils 2 Wochen im August/September und September/Oktober 1999 in zwei Wellen 1.551 von insgesamt 21.650 in diesen Zeiträumen gezählten Besuchern. Die aufgrund methodischer Probleme bei der Erfassung nicht repräsentative Untersuchung (z.B. Fragebögen nur auf deutsch und englisch vorliegend, trotz zahlreicher BesucherInnen aus anderen Sprachräumen; insgesamt 54% ausländische BesucherInnen) zielte im wesentlichen darauf ab, auf der Basis der Erhebungen Vorschläge für die beabsichtigte Neukonzeption der Gedenkstätte zu machen. Entsprechend ist sie neben der Erhebung soziodemographischer Daten eher an Bewertungen der Bestandteile der GedenkstättenInfrastruktur (Texte, Fotos, Einsatz elektronischer Medien bis hin zu Parkmöglichkeiten, Busverbindungen etc.) interessiert. Sie stellt ein überproportional junges Publikum mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren fest, das weniger als die Älteren mit der Erwartung kommt, historisches Wissen zu erwerben als eine "emotionale Orientierung" zu erfahren. Zu 86% handelt es sich um ErstbesucherInnen. Man bleibt im Schnitt 130 Minuten und gibt zu 82% an, der Besuch habe sich gelohnt. Die Datensammlung verbleibt insgesamt auf einem Niveau, das über Wirkungen des Besuchs auf das politische Bewusstsein keine Aussagen gestattet. Die in Sachsenhausen Mitte der 90er Jahre durchgeführte, für die Gedenkstätte als repräsentativ geltende Studie mit knapp 800 BesucherInnen erhob ebenfalls "harte" (demographische Struktur, Aufenthaltsdauer usw.) und "weiche" Daten (Einschätzungen der BesucherInnen), geht aber im Hinblick auf die Interpretation von Wirkung(sbedingung)en weiter. Besonders bemerkenswert in Hinsicht auf erstgenannte facts erscheint, dass das Publikum zwar – wie in Dachau - überproportional jung ist – sicher auch hier wegen zahlreicher Besuche, die im Klassenverband erfolgen -, BesucherInnen mit formal niedrigen Schulabschlüssen und Angehörige aus der Arbeiterschicht aber nur wenig vertreten sind. Insofern scheinen gerade diejenigen Gruppierungen, die sich für den Rechtsextremismus unserer Tage besonders anfällig zeigen, nur schwer erreicht werden zu können (vgl. auch Ehmann 2000, bes. 183). Auffällig ist zum zweiten, dass im Bereich der abgefragten subjektiven Einschätzungen kaum Kritik geäußert wird; dies obwohl selbst nach Ansicht von Gedenkstätten-MitarbeiterInnen – nicht nur in Sachsenhausen – eine solche z.B. gegenüber den meist noch sehr konventionell aufgemachten Ausstellungspräsentationen durchaus angebracht wäre. Die geäußerte Zufriedenheit wird auf einen "moralischen Druck" zurückgeführt, der einen "Rückgriff auf scheinbar erwünschte Antworten" produziert, ja geradezu als "'Kritikverbot'" erlebt wird (ebd., 8; vgl. auch Dammer/Stein 1995). Ergebnisevaluationen, die den Befragungszeitpunkt unmittelbar im Anschluss an den Gedenkstättenbesuch platzieren, sollten daher skeptisch betrachtet werden. Sie scheinen eher zu Positivfärbungen zu verleiten, weil angenommen werden kann, "daß es der längeren 79 Reflexion bedarf, um zu einer Kritik zu kommen" (ebd., 9) bzw. um tatsächliche Wirkungen halbwegs valide erheben zu können. Revisionen der zumeist deduktiven Gedenkstätten- und Ausstellungsdidaktik sind nach den Sachsenhausener Evaluationen des Besucherverhaltens in den letzten 5 Jahren unerlässlich, will man das Konzept des offenen Lernorts wirksam für eine Besuchergeneration umsetzen, die zwar die Authentizität der Stätte emotional erfahren will, sich dafür aber nur im Durchschnitt zwei Stunden Zeit nimmt, viele der gebotenen Informationen daher nur flüchtig wahrnehmen kann und nur in Ausnahmefällen zu Wiederholungsbesuchen neigt (6% bis 12%; vgl. Fröhlich/Zebisch 2000, bei Gedenkstätten, etwa 25% bei anderen Open-air-Museen; noch seltener - nämlich zu 1 %, - um sich mit Spezialfragen und Detailausstellungen zu befassen; vgl. Morsch 2001). Reformierungen müssen dabei zugleich aufpassen, nicht einer "Hollywoodisierung" des Gedenkstättenbesuchs im Sinne einer massenkulturellen Verwendung für unterhaltenden "thrill" Vorschub zu leisten. Auch noch eher tentative Wirkungsstudien zur NS-Gedenkstättenarbeit stimmen eher skeptisch, zumindest hinsichtlich der Annahme direkter extremismusreduzierender Effekte bei jungen Leuten. Mag man die ernüchternden Ergebnisse der von Oktober bis Dezember 1989 durchgeführten Buchenwald-Studie mit 350 Schülern und Schülerinnen aus achten Klassen – vier Wochen nach dem Besuch "ein spürbarer Rückgang des Interesses der Schüler an Fragen zur Zeit des Faschismus", ein "leicht angestiegenes Akzeptanzpotenzial für faschistische Ideologiefragmente", doppelt soviel Änderungen in Richtung auf Zustimmung (bei 30%) wie in Richtung auf Ablehnung (15%) der Aussage "Der Faschismus hatte auch seine guten Seiten", "kaum Wirkungen bei Desinteressierten" und z.T. auch zu Sensibilisierung und Betroffenheitserzeugung "gegenteilige Effekte" (vgl. dazu: Schubarth 1990) – noch auf die Problematik der DDR-spezifischen NS-Aufarbeitung oder die Wirren der Wendezeit zurückführen, so konstatieren jedoch auch Fischer und Anton (1992) bei ihren 40 Explorationen von Gedenkstättenbesuchen thüringischer und hessischer SchülerInnen in Breitenau, Hadamar und Buchenwald: "Es ist davon auszugehen, dass – wenn überhaupt – nur selten direkte, monokausale Zusammenhänge zwischen Einstellungsveränderungen und dem Besuch einer Gedenkstätte feststellbar sind" (ebd., 10). Schon im Vorwort von Schacht und Siegel, den Leitern der Landeszentralen für politische Bildung von Hessen und Thüringen, heißt es: "Die Jugendlichen heute haben eine sehr große biographische Distanz zu den Verbrechen des Nationalsozialismus. Der Besuch einer Gedenkstätte bewirkt deshalb noch nicht automatisch Lernprozesse, die gegen entsprechende politische Einstellungsmuster immunisieren." Zwar wird registriert, dass "Mädchen mit größerer emotionaler Betroffenheit" reagieren, Jungen es dagegen schwer fällt, ja es ihnen in der Besuchergruppe unmöglich ist, ihre demonstrative Coolness abzulegen, insgesamt aber "läßt" die "emotionale Irritation" "sehr schnell nach" (ebd., 109). "Die Erfahrungen bleiben nur kurz an der Oberfläche" (ebd., 116); "Augenblicksbetroffenheit" wird erzeugt. Die Jugendlichen selbst äußern sich skeptisch über die Abschreckungsfunktion des Besuchs im Hinblick auf rechtsextreme Anfälligkeiten. "Die Gedenkstätten dienen den Befragten als Vergewisserung des eigenen Standpunktes" (ebd., 125), eine Feststellung, die im Hinblick auf Besuche mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen geradezu erschrecken muss (vgl. auch Welzer 2001). Damit ist keineswegs ausgesagt, dass historische Bildung generell sinnlos ist. Die Kenntnis des historischen Nationalsozialismus ist für die Entwicklung von Geschichtsbewusstsein unverzichtbar. Verantwortung – nicht Schuld -, die aus der Geschichte auch den Nachgeborenen erwächst, kann kaum anders wachgehalten werden. Unter – u.a. auch empirisch erst noch über diesbezügliche Evaluationen zu prüfenden – (vor allem auch methodisch-didaktischen) Umständen (z.B. der Wahrnehmungs-, Perspektivenwechsel-, 80 Empathie- und Diskursschulung; vgl. als gute Anregung dazu Kößler 2000; zu Quellenarbeit, perspektivischem Schreiben, Gedenkbuch, Multimedia auch Behrens/Reichling 2002; insgesamt zur Diskussion um neue Ansätze auch zusammenfassend: Bildung und Wissenschaft 1/2001) mag auch bei TeilnehmerInnen entsprechender Bildungsprozesse eine Wertschätzung demokratischer Verhältnisse und eine Haltung der Zivilcourage aufgebaut und stabilisiert werden. Wenn sich auch deren Nachhaltigkeit erst noch zu erweisen haben wird: Zu vermuten ist, dass dies am ehesten dann gelingt, wenn ein erfahrungs- und handlungsorientiertes Setting aufgebaut wird, in dem TeilnehmerInnen sich auch emotional und konativ angesprochen fühlen. Historische Bildung über den Faschismus sollte jedoch nicht mit dem Anspruch überfrachtet werden, entscheidend den modernisierten Rechtsextremismus zurückdrängen zu können oder gar den Königsweg demokratischer Stabilisierung zu bahnen (vgl. auch Ehmann 2000; Fröhlich/Zebisch 2000; Miteinander e.V./Zentrum für Antisemitismusforschung 2001). Dies gilt um so stärker, als angesichts der Multikulturalisierung der Gesellschaft und insbesondere von Schulklassen pädagogisch schwierige Herausforderungen zu bewältigen sind, die in Instrumentalisierungsgefahren von Geschichte "für je unterschiedliche Formen von Identitätspolitik im Kampf um Macht und Anerkennung" und im "Wettstreit um das Monopol auf den Opferstatus" zwischen einheimischen Deutschen und Angehörigen von Migrantenfamilien gründen (vgl. illustrativ und exemplarisch Fechler 2000, hier: 225). Wenden wir uns nun dem zweiten Typus historischer Bildung in dem von und bearbeiteten Themenumfeld zu: der Aufarbeitung der neueren Migrationsgeschichte. Hierzu liegen weit weniger Ansätze vor. In ihrer Mehrheit scheint sich die Thematisierung der historischen Aspekte der Ausländerbeschäftigung und –einwanderung in Deutschland noch dem Wissensvermittlungsparadigma verpflichtet zu fühlen, sich dem gemäß auf Unterrichtungsformate zu stützen und auf kognitive Information zu beschränken. Handlungsfeld ist dann im wesentlichen der Schulunterricht mit den ihm eigenen didaktischen und methodischen Gewohnheiten und Grenzen. Sie werden selbst dann kaum gesprengt, wenn Lehrkräfte auf Unterrichtsmaterial zurückgreifen, das über das Standard-Lehrbuch für die jeweilige Klassenstufe hinausgeht. Didaktische Hefte und andere Vorlagen zur historischpolitischen Bildung sind nach wie vor – wie PraktikerInnen oft formulieren – 'arg kopfbestimmt' und wenig geeignet, die Schüler und Schülerinnen 'dort abzuholen, wo sie stehen'. Unmittelbarer Lebensweltbezug fällt in den gängigen Produkten dieses Genres fast durchgehend unter 'Fehlanzeige'. Im außerschulischen Bereich finden sich nicht mehr als vereinzelte Versuche, ganzheitlicher an die Thematik heranzugehen. Erwähnenswert, weil innovativ und vielversprechend erscheint in Hamburg die in Kooperation mit SchulpraktikerInnen betriebene Entwicklung von alternativen Hafenrundfahrten für Kinder und Jugendliche ab etwa 10 Jahren zu Themen wie "Bananen und Schokolade", "Hamburg und die Dritte Welt" und "Migration und Rassismus" beim "Werkstatt3Bildungswerk", in Nürnberg die aus der Offenen Jugendarbeit erwachsene und seit 1993 umgesetzte Idee der politischen Wanderung, bei der u.a. Wanderungen zum Thema "Einwanderer in Mittelfranken" unternommen und in einem "Ein-Wander-Führer" dokumentiert wurden (vgl. Eismann u.a. 1997), in Krefeld die durch das Jugendamt veranstalteten "Weltreisen durch die Stadt", bei denen Kinder, Jugendliche und Familien das Zuhause verschiedener deutscher und ausländischer Familien kennenlernen und mit ihnen Kontakte knüpfen können (vgl. Informations- und Dokumentationsstelle 2000). 81 Historische Aufarbeitungen der jüngeren Migrationsgeschichte können für sich in Rechnung stellen, dass sie empirisch nachweisbar auf den Kernbereich des heutigen Rechtsextremismus und der ihn begleitenden und umgebenden politischen Ausgrenzungsforderungen gegenüber Minoritäten, die Fremdenfeindlichkeit nämlich, zielen (vgl. Verfassungsschutzberichte 1991 ff.). Die Fragen, die generell an die Bedeutsamkeit geschichtlichen Wissens und geschichtlichen Bewusstseins für die politische Orientierung des/der Einzelnen in der Gegenwart gestellt werden können, betreffen indes auch diesen Ansatz: Bringt mehr historisches Wissen mehr Orientierungs- und Handlungssicherheit? Kann historisches Bewusstsein die Sinnfälligkeit demokratischer Regelungen verdeutlichen? Führen historische Kenntnisse über Minderheiten zu mehr Anerkennung, Toleranz und ggf. zusätzlich Solidarität mit ihnen? Können u.U. nur flüchtige Kontakte zu einzelnen MigrantInnen generelle Vorbehalte aufbrechen? Oder muss nicht eher davon ausgegangen werden, dass sie politisch ebenso wenig folgenreich bleiben, wie die Akzeptanz des persönlich bekannten, einzelnen "guten Juden" durch manche durchaus nationalsozialistisch geprägte Deutsche in der Hitler-Zeit? Die Fragenliste ließe sich mühelos weiterführen. Ihre Fortsetzung kann hier aber unterbleiben, denn Antworten werden erst dann vorliegen, wenn Evaluationen entsprechender Konzepte unternommen worden sind. Dies ist bislang nicht der Fall. 3.1.2 Unterrichts-, Seminar- und Trainingseinheiten ("Bausteine") zur Demokratieund Toleranzerziehung An Unterrichts-, Seminar- und Trainingseinheiten gegen Rechtsextremismus und Gewalt und zur Demokratie- und Toleranzerziehung herrscht wahrlich kein Mangel. In den letzten 10, 12 Jahren hat es eine regelrechte Inflation bei der Produktion und Verbreitung entsprechender Hefte, Loseblattsammlungen und Bücher gegeben. Obwohl also quantitative Defizite in dieser Hinsicht nicht bestehen, stellt sich dennoch die Frage, welches qualitative Gesamtbild sich ergibt und wie problemangemessen die einzelnen Ansätze eigentlich sind. Sehen wir uns im folgenden einzelne Konzepte etwas genauer an, und zwar solche, die aktuell in der praktischen Arbeit als besonders wichtig eingeschätzt werden und entsprechend verbreitet sind! Sie bewegen sich in einem Spannungsfeld, das von dem Viereck mit den schlagwortartig zu bezeichnenden Winkeln 'argumentative Überzeugung', 'spielerische Erfahrung' 'interkulturelle bzw. antirassistische Trainings' und 'lebensweltliche Gestaltung' gebildet wird. Eine erste Gruppierung von Konzepten vertraut im wesentlichen auf die Durchsetzungsfähigkeit des besseren Arguments. Deshalb sind die kognitiven Anforderungen, die sie stellen, vergleichsweise hoch (vgl. etwa die für allem für den Schulgebrauch konzipierten didaktischen Hefte des Wochenschau-Verlags "Deutschland von rechts", 1994, "Jugend und Gewalt", 1993 und 1997 sowie "Rassismus und Antisemitismus", 1999; ferner, teils schon im Titel programmatisch ihre argumentative Grundorientierung ausweisend: Kultusministerium NRW 1990; Heitmeyer 1991; Jäger 1992, 1993; Ahlheim/Heger/Kuchinke 1993; Arbeitsgemeinschaft 1994; Tiedemann 1996; Arbeitsgemeinschaft o.J.; Ahlheim/Heger 1999; Büttner 1999; Hufer 2000; Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 2000; Benz 2001; Lanig 2001; Osborg 2001 sowie www.linksruck.de/litera/agr und www.nefkom.net/loester/fakten1.htm). Der eine (noch größere) Teil von ihnen hängt eher noch der Information über wissenschaftliche Erkenntnisse, der Auswertung statistischer Daten, der Analyse von Texten, der Deutung von Schaubildern und Diagrammen, der Diskussion von Pro- und Contra-Thesen und ähnlichen methodisch-didaktischen Verfahren an 82 und bleibt damit noch weitgehend dem Paradigma der Wissensvermittlung verbunden wie dem Format der Unterrichtung verhaftet. US-amerikanische Studien weisen solchen Versuchen zwar gewisse Kurzzeit-Effekte der Reduktion von Vorurteilen nach (vgl. Stephan/Stephan 1984; McGregor 1993, Aboud/Fenwick 1999). Offen bleibt allerdings, als wie anhaltend sie sich erweisen. Ein anderer (kleinerer) Teil operiert mit Trainingsformaten. Sie üben argumentative Schlagfertigkeit im Beobachten, Analysieren und Nachspielen von konkreten Situationen der Konfrontation mit antidemokratischen Parolen ein (besonders deutlich und gegenwärtig stark nachgefragt z. B. im Training von Hufer 2000). Während der erste Typus die Frage unbeantwortet lässt, wie ein Umschlag von Wissen in Handeln erfolgen, also das Problem des Alltagstransfers gelöst werden soll, bietet das Trainingsformat immerhin eine alltagsnahe Laborsituation, dessen Schonraumcharakter für die Erprobung lebensweltlich brauchbarer Anwendungen des Gelernten genutzt werden kann (zu Evaluationen dieses Formats vgl. weiter unten). Weniger argumentativ als spielerisch ist ein anderer Typus von Bildungseinheiten angelegt. Er besteht aus meist kleinen Übungen, von oft 20 bis 60 Minuten Dauer, in denen Emotionales, Phantasie, Kreativität und Kommunikatives im Vordergrund stehen (vgl. exemplarisch die sehr anwendungsbezogenen Handreichungen: Posselt/Schumacher 1993; Spiele 1996). Damit bildet er den Gegenpol zu vornehmlich kognitive Leistungen voraussetzenden und einfordernden Einheiten. Er vermag damit zwar weniger Wissen zu vermitteln, dafür aber eher die 'ganze' Persönlichkeit der TeilnehmerInnen anzusprechen. Zudem erweist sich die Anlage als Vorteil bei der Zielgruppenerschließung. Menschen niedrigerer schulischer Formalqualifikation, sprachlich weniger Gewandte und jüngere AdressatInnen (einschließlich Kinder) sind so leichter zu interessieren. Freilich lässt die offene Form pädagogische Ergebnisse weniger vorausplanen, bleibt die thematische Aufarbeitung wenig systematisch und können Reflexionsprozesse zwar angeleitet, aber nicht pädagogisch gesteuert und durchstrukturiert werden. Das hier dominierende Format der Begegnung setzt zwangsläufig im Gegensatz zu Unterrichtungsformaten auf die Autonomie der AdressatInnen für die Eigensteuerung des Prozesses, den sie durchlaufen, und macht deshalb auch den Output von ihr abhängig. Das Paket von zur Zeit 3 Konzepten, das die Bertelsmann-Stiftung in Kooperation mit dem Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) im Rahmen des Stiftungsprojekts "Erziehung zu Demokratie und Toleranz" anbietet, pendelt zwischen den Polen von kognitiver Wissensvermittlung und 'ganzheitlich-spielerischem' Erfahrungslernen. Es handelt sich um "Betzavta", "Eine Welt der Vielfalt" und "Achtung (+) Toleranz". Der den 3 Konzepten gemeinsame Ansatz besteht darin, auf das ganzheitliche Individuum in seinem alltäglichen Umgang mit Menschen zu fokussieren, Demokratie als Lebensform erfahrbar werden zu lassen und dies in der konkreten Seminarsituation zu erproben. Fünf Ziele stehen im Vordergrund: Die Pluralität von Werten und Überzeugungen soll als Gewinn erfahrbar werden (1). Die Anerkennung des prinzipiell gleichen Rechts auf Entfaltung für alle Menschen soll bewirkt werden (2). Konflikte sollen als Chance zur Erweiterung des eigenen Handlungsrepertoires erlebt werden können (3). Toleranz soll praktisch erfahren werden (4). Partnerschaftliche Kommunikation soll eingeübt werden (5). "Betzavta" (deutsch: "gemeinsam" oder "miteinander") ist ein vom israelischen Adam-Institut adaptiertes Konzept, das, dort bereits ab 1986 entwickelt, seit 1997 in Deutschland als nachträglich zu ergänzendes "Praxishandbuch für die politische Bildung" in Loseblattform vorliegt (vgl. Miteinander 1997). Seine Absicht liegt darin, einen Beitrag zur Demokratieerziehung dadurch zu leisten, dass die TeilnehmerInnen in Stand gesetzt werden, gesellschaftliche Verhältnisse von kultureller Heterogenität – wie sie ja für Israel mit seinen 83 ethnisch verschiedenen Einwanderern und der arabischen Bevölkerung, aber auch zunehmend für das faktische Einwanderungsland Deutschland typisch sind – positiv so zu bearbeiten, dass allen Menschen das gleiche Recht auf Freiheit zugestanden wird. Konkret geht es inhaltlich um demokratische Prinzipien, das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit, Grundrechte, Gleichheit vor dem Gesetz und Wege demokratischer Entscheidungsfindung. Die Didaktik folgt einer Tradition des jüdischen Lernens: dem zunächst polarisierenden Disput. Sie sieht spielerische Übungen vor, in denen TeilnehmerInnen in einem ersten Schritt mit der eigenen Ablehnung von Gleichberechtigung konfrontiert werden, in einem zweiten Schritt feststellen, dass Gleichberechtigung von ihnen nur dann als nützlich erkannt wird, wenn sie eigenen Interessen dient und in einem dritten Schritt die Anerkennung von Gleichberechtigung als generellem Prinzip, das unabhängig von dem Fakt, ob es eigenen Interessen nützt oder nicht, Geltung beanspruchen kann, erlernen sollen. Einer Konfliktsituation mit verschiedenen Handlungsalternativen ausgesetzt, soll der Konflikt in ein Dilemma, also in die Begegnung mit sich widersprechenden eigenen Interessen und Bedürfnissen, transformiert werden, um schließlich Lösungskonzepte zu erarbeiten, die von demokratischen Prinzipien getragen werden. Das Konzept bzw. bestimmte seiner Teile, eignet/eigenen sich für eine gruppenbezogene Bildungsarbeit mit Kindern (ab acht Jahren), Jugendlichen und Erwachsenen in außerschulischen und – seit 1999 entsprechend ausgebaut – auch schulischen Handlungsfeldern. Mehr als 1000 MultiplikatorInnen sind mittlerweile mittels relativ kurzer Seminarbesuche als Betzavta-TrainerInnen ausgebildet. Wie viele von ihnen das Programm aber tatsächlich anwenden ist nicht bekannt. Mehr als rd. ein Viertel der Ausgebildeten dürfte es z.Zt. schätzungsweise nicht sein. Eine Auswertung des Konzepts liegt gegenwärtig nur durch diejenigen Erfahrungen vor, die die Trainer und Trainerinnen, die an der Implementierung des Programms beteiligt waren, in Testseminaren mit mehreren hundert TeilnehmerInnen gesammelt haben und die in die im Praxishandbuch abgedruckten Empfehlungen für seine Anwendung eingeflossen sind. Eine gründlichere Evaluation, allerdings beschränkt auf die Befragung von MultiplikatorInnen, wird zur Zeit an der PH Freiburg unternommen. Ergebnisse sind frühestens im Herbst 2002 zu erwarten. PraktikerInnen, die mit dem Konzept arbeiten, wissen gleichwohl jetzt schon um seine Grenzen. Sie liegen vor allem in zwei Punkten: Zum ersten eignet sich das Konzept wegen seiner relativ hohen Anforderungen an das Sprachverständnis seiner Adressaten nur eingeschränkt für den Einsatz in multi- oder interkultureller Arbeit. Zum zweiten wird es als relativ kopflastig eingeschätzt. Dem begegnet das neuere, ebenfalls in kopierfreundlicher Aktenheftung – und auch als CDROM – vorliegende Konzept "Achtung (+) Toleranz" (Ulrich 2000), das ähnliche Ziele verfolgt und didaktisch auch darauf aufbaut, in der Realität nachempfundenen Konfliktsituationen tolerantes Handeln und partnerschaftliche Kommunikation zu erlernen, bei Themenschwerpunkten auf Toleranz, Demokratie, Vorurteile und Zivilcourage jedoch deutlicher auf dem Prinzip des ganzheitlichen Lernens basiert und explizit bausteinemäßig "Kopfübungen" mit Erlebnis- und Erfahrungsorientierung verbindet (vgl. auch die Selbsteinschätzung ebd., Anhang). Ob seine Teile jedoch tatsächlich (wie ebd., 22, Fn. 13 behauptet) "sicher" "für die Arbeit mit radikalen und gewaltbereiten Jugendlichen" tauglich sind und sich "gerade zum Einsatz mit Zielgruppen, die ablehnende Positionen zu Demokratie, Toleranz und Menschenrechten vertreten" eignen, darf bezweifelt werden; dies zumindest solange, bis eine noch eher tentative interne Evaluation der Testphase weitergeführt worden ist und dabei auch die o.g. Zielgruppen einbezogen hat. 84 In gleicher äußerer Aufmachung präsentiert sich "Eine Welt der Vielfalt" (vgl. Bertelsmann Stiftung 1998). Es handelt sich hierbei um eine Adaption eines Trainingsprogramms des "A World of Difference-Institute" der US-amerikanischen Anti-Defamation League in der Adaption für den Schulunterricht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Im Mittelpunkt steht interkulturelles Lernen. In fünf handlungs- und erfahrungsorientiert angelegten Lektionen sollen Schüler und Schülerinnen u.a. über Medien wie malen, Collagen erstellen, Masken basteln, Gedichte schreiben, Interviews durchführen usw. sich selbst als Individuen schätzen und Selbstwertgefühl entwickeln (1), Ähnlichkeiten und Unterschiede bei Menschen über segregationsvermeidende, kooperative Arbeitsformen erkennen (2), kulturelle Vielfalt kennen (3), "das Wesen von Klischees, Vorurteilen und Diskriminierung und deren Auswirkungen auf Individuen und Gruppen verstehen" (ebd., 14) (4) und Bekämpfungsstrategien entwickeln (5) lernen. Neu dabei ist und gleichzeitig dem Interesse an möglichst lebensweltnahem Agieren folgt, dass Ortswechsel heraus aus dem Schulgebäude und hinein in das Gemeinwesen empfohlen werden und die Zusammenarbeit mit den Eltern gesucht wird. Dies entspricht im übrigen – allerdings noch sehr tentativ – dem theoretischen Ausgangspunkt des Konzepts, wonach Diskriminierung nicht nur dem individuellen Interesse an der Sicherung von Macht und Einfluss für die eigene Person folgt, sondern auch Ausfluss institutioneller Faktoren ist und deshalb individuelle Veränderung mit der Veränderung institutioneller Kontexte zu verbinden ist (vgl. Pettigrew 1986; Sausjord 1997; Wilpert 2001). Wie bei den anderen beiden Konzepten finden auch hier MultiplikatorInnenschulungen statt: Ein begleitendes Fortbildungsangebot für Lehrpersonen wird an den Fortbildungsinstituten der meisten Bundesländer angeboten. Ähnlich wie bei den anderen Bertelsmann/CAP-Konzepten wurden Auswertungen von Testseminaren durchgeführt, deren Ergebnisse in das Praxishandbuch eingegangen sind. Weitere Evaluation ist zur Zeit im Gange. Das Konzept dazu ist noch in Entwicklung und wird erstmals im Herbst 2002 fachöffentlich vorgestellt werden. Ein internationales Netzwerk für Evaluation erarbeitet zur Zeit einen Workshop, der NGO-VertreterInnen in Stand setzen soll, Selbstevaluationen durchzuführen. Weitere Anstöße durch die Bertelsmannstiftung sind durch ein noch im Aufbau befindliches Referat zu Fragen des Umgangs mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu erwarten (zur Anlage der Evaluation der Bertelsmann-Projekte im Bereich der Toleranz- und Demokratieerziehung vgl. ganz kurz im Überblick auch: Ketterle 2001). Amerikanische Langzeitevaluationen laufen noch; europäische Evaluationen eines 2-3jährigen "A Class of Difference"-Projekts mit 12stündigen Workshops für Lehrpersonen – diese sind auf europäischer Ebene bislang noch eher Zielgruppe als SchülerInnen – an 30 Schulen in Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden zeigen immerhin, dass ¾ der Lehrpersonen ihre persönliche Einstellung durch die Teilnahme berührt sehen und aus ihm konkrete Anregungen und Übungen für den Unterricht mitnehmen können. Den theoretischen Hintergrund der Bertelsmann/CAP-Handreichungen bildet ein Toleranzkonzept (vgl. Feldmann/Henschel/Ulrich 2000). Es versteht Toleranz als eine "Maxime für die individuelle und ethisch motivierte Entscheidung, einen Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung des anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu regeln" (ebd., 14). Geübte Toleranz setzt also einen Konflikt voraus, bleibt gewaltlos und basiert auf der Anerkennung von Gleichberechtigung. Das erstgenannte Kriterium beugt der Kritik am Toleranzbegriff vor, er schließe auch Haltungen der Gleichgültigkeit mit ein. Das letztgenannte Kriterium vermag zwischen einem Konflikt(er)dulden zu unterscheiden, das auf Nutzen- und Risikoabwägung beruht und deshalb nur scheinbare Toleranz darstellt, und einem Konfliktaushalten, das auf Einsicht und prinzipieller Anerkennung des gleichen Recht auf freie Entfaltung fußt. Gilt Gewaltanwendung auf der einen Seite des Toleranzbegriffs als Inbegriff von Intoleranz so geht Toleranz auf der anderen Seite in "Solidarität, Nächstenliebe 85 oder Zivilcourage" erst dann über, wenn ein "Bedürfnis nach Ausgleich von Ungerechtigkeit", "Barmherzigkeit" oder der "Schutz eigener und fremder Rechte" inauguriert ist. Individuelle Toleranzkompetenz baut dem gemäß neben Toleranzwissen auf spezifischen Fähigkeiten auf: "Dialog- und Kommunikationskompetenz, die Fähigkeit, sich in den Standpunkt eines anderen zu versetzen, die Fähigkeit, Modelle konstruktiver und demokratischer Konfliktregelungen anzuwenden" (ebd., 25). Als Konsequenz für eine Umsetzungsstrategie dieser Überlegungen in die politische Bildung ergibt sich ein Vier-Schritte-Modell: die Bewusstmachung eigener Deutungs- und Handlungsmuster (1.), das Infragestellen dieser Muster (2.), das Angebot von Alternativen (3) und die Konstruktion neuer Deutungs- und Konfliktlösungsmuster (4) (vgl. ebd., 32). Auch wenn – wie erwähnt – Evaluationen nur in Ansätzen vorliegen, kann aus erziehungswissenschaftlich-theoretischer Sicht der Ansatz als vielversprechend eingestuft werden: Er weist theoretische Fundamentierung auf, gewichtet die Bedeutung von Identitätserfahrung - u.a. Selbstwertgefühl, Perspektivenwechsel und kommunikativer Kompetenz - hoch (zur Bedeutsamkeit dieser Aspekte vgl. z.B. Frey/Haußer 1987; Pate 1988; Schwind/Baumann u.a. 1990; Fend 1994; Hopf u.a. 1995; Schmidtchen 1997; Olweus 1997; Petermann u.a. 1997; Dann 1997; Mansel/Hurrelmann 1998; Schubarth 2000), setzt zunehmend auf Handlungsorientierung und Erfahrungslernen, spricht neben kognitiven vermehrt auch emotionale und konative Orientierungsaspekte an, bietet methodische Vielfalt und zeigt Ansätze, die Fesseln traditioneller Formatierungen (schulischer 45-Minuten-Takt des Unterrichts, Lernen ausschließlich im Schulgebäude) durch mehr zeitliche und räumliche Flexibilisierung, Schülerorientierung und Öffnung zum Gemeinwesen abzustreifen. Allerdings bleiben die Konzepte noch insoweit klassischer Bildungsarbeit verhaftet, als ein Übergang in unmittelbare Gestaltungs-Aktion im allgemeinen unterbleibt. Eine Nachhaltigkeit von Lerneffekten ist daher nicht ohne weiteres anzunehmen. Das Angebot auf dem 'Markt' von "antirassistischen" und "interkulturellen" Trainings ist inzwischen so schwer übersehbar, dass IDA, die bundeszentrale Servicestelle für Antirassismusarbeit, sich schon im vergangenen Jahr veranlasst sah, den Durchblick "durch den Dschungel von Trainings" mittels einer "Checkliste" für OrganisatorInnen zu gewährleisten (abgedruckt auch in: Landeszentrum 2001, 89-93). Im folgenden geht es deshalb nicht darum, diese Trainingslandschaft vollständig zu vermessen.7 Stattdessen werden anhand besonders verbreiteter Trainings die Kernpunkte herausgearbeitet, die sie kennzeichnen.8 Die Ziele der Trainings ähneln sich stark, auch wenn die einen (vorerst) mehr ethnischkulturelle Differenzen, die anderen wie auch immer geartete Kongruenzen und Konvergenzen verschiedener Menschengruppen betonen. Im Zentrum des Zielkatalogs steht das Bestreben, kulturelle Pluralität als gesellschaftliche Bereicherung erleben und sich selber in interkulturellen Bezügen adäquat einbringen zu lernen. Die Trainings sollen – so betrachtet – ein gewaltfreies, gleichberechtigtes und verständigungsorientiertes multi- bzw. interkulturelles Zusammenleben ermöglichen. 7 Dieser Beschränkung in der Darstellung fällt eine ausführlichere Beschäftigung mit anderen interessanten Konzepten zum Opfer (für die Vielzahl der im Angebot befindlichen Konzepte stehen Bezeichnungen wie Information Trainings, Cultural Awareness Trainings, Cross-cultural-orientation Programs, Cross-cultural Sensivity Trainings, Cultural communication trainings, Race-relation Trainings, Race Awarenesse Trainings, Equality Trainings, Organizational Change Trainings, Multicultural Trainings, Anti-Racism Trainings und Diversity Trainings; vgl. auch Führing 2000). 8 Hier ist auch nicht der geeignete Rahmen, die Diskussion über die Vor- und Nachteile von als 'antirassistisch', 'multikulturell', 'interkulturell' oder gar 'antikulturrassistisch' betitelten Ansätzen aufzunehmen (vgl. dazu im kurzen Überblick Attia 2000). 86 Von den Zielgruppen her sind mindestens drei Gruppen zu unterscheiden: Trainings, die sich vornehmlich an Angehörige der ethnisch-kulturellen Mehrheit richten, versuchen diese 'anti-rassistisch' zu schulen. D.h. sie werden für implizite und offene Stereotypisierungen, Abwertungen und Diskriminierungen sensibilisiert, die von der eigenen Person und ihrem sozialen Umfeld oder auch von Institutionen ausgehen (vgl. z.B. Bund gegen ethnische Diskriminierung 2002, siehe auch Kap.3.1.17). Auf der Basis einer Gerechtigkeits- und Fürsorgemoral sollen darüber hinaus Handlungsstrategien zum Abbau des sich darin ausdrückenden Anerkennungvorenthalts entwickelt werden. Eine bestimmte auf das interkulturelle Management ausgerichtete Variante richtet sich vornehmlich an Führungskräfte von Organisationen und Institutionen. Es gibt jedoch auch Ansätze von peereducation für Schüler und Schülerinnen (vgl. Heigl 1996). Trainings, die vornehmlich oder auch ethnisch-kulturell gemischte Gruppen ansprechen, stellen die Begegnung, die gegenseitige Information und den Austausch von Erfahrungen und Deutungsmustern in den Mittelpunkt. Gelegentlich münden sie auch in kooperative Projekte ein. Primär an Minoritäten gerichtete Trainings versuchen, z.T. angelehnt an Vorbilder des Schwarzen-Bewusstseins-Trainings aus USA (vgl. Osei 2001), das Bewusstsein für den Wert der eigenen ethnischen, nationalen und kulturellen Wurzeln zu wecken und/oder wach zu halten und verstehen sich mehr als andere teilweise ausdrücklich als Empowerment-Ansatz (vgl. Chouhan 1999). Mindestens fünf methodisch-didaktische Grundmodelle interkultureller Trainings lassen sich ausmachen (vgl. Flechsig 2000, der vier benennt und Grosch/Gross/Leenen 2000, die sogar auf 10 kommen, wobei der im folgenden an fünfter Stelle genannte Typ nicht einmal mitgerechnet ist). Sie unterscheiden sich u.a. im Grad der Strukturierung der Lernsituation, ihrer räumlichen Ansiedelung, ihrer zeitlichen Perspektivik und ihrer Alltagsnähe: Ein erstes Modell setzt auf die Fallmethode. Die TeilnehmerInnen erhalten eine Fallbeschreibung, bilden und bewerten dazu Hypothesen und erstellen eine vorläufige Beurteilung. Das zweite Modell besteht aus Wahrnehmungs-, Selbsteinschätzungs- und Interaktionsübungen. Das dritte Modell basiert auf Simulationen. Einzelpersonen oder Gruppen werden dabei in eine Situation versetzt, die für die Begegnung von Angehörigen verschiedener Kulturen typisch ist und einen Konflikt bereithält, der zu lösen ist. Sie spielen entlang vorbereiteter kultureller Skripte Rollen und werten anschließend ihre Spielerfahrungen aus. Eine vierte Version öffnet das Trainingsformat hin zu Rechercheformaten. Es werden anhand von vorher entwickelten Leitfäden Erkundungen von Kulturen – im Regelfall im Inland – unternommen, dokumentiert und anschließend im Plenum diskutiert. Der fünfte Typ von Trainings beinhaltet inter- und transkulturelle Lernprojekte. Sie sind im Vergleich zu anderen komplexer angelegt. In internationalem Zuschnitt werden ausländische Kooperationspartner gesucht, mit denen man gemeinsam ein Projekt durchführt und auswertet. Der Trainingscharakter wird hierbei mit Begegnungsund Strukturgestaltungsformaten aufgefüllt. Am verbreitetsten dürften z.Zt. hierzulande Trainings sein, in denen methodisch Übungen, biographische Reflexionen, Kleingruppenarbeit, Rollenspiele und simulative Settings im Vordergrund stehen. Besonders en vogue ist gegenwärtig in Deutschland das eyetoeye-Training. Es handelt sich um ein vor rund 30 Jahren erstmals in USA durch Jane Elliott entwickeltes Programm. Nach der Ermordung von Martin Luther King sah sie sich damals als Lehrerin an einer Schule in 87 Iowa mit der Aufgabe konfrontiert, die Tat ihren ausschließlich weißen, christlichen Schülern und Schülerinnen zu erklären. Getreu dem indianischen Motto "Großer Geist, bewahre mich davor, je einen anderen Menschen zu verurteilen, bevor ich nicht eine Meile in seinen Mokassins gelaufen bin" entschied sie sich dazu, ihren Schülern und Schülerinnen durch ein bestimmtes pädagogisches Setting die Erfahrung zu vermitteln, wie diejenigen sich fühlen, die im damaligen US-Amerika nicht weiß und nicht christlich sozialisiert waren. Sie teilte ihre Klasse in "Braunäugige" und "Blauäugige" ein. Die Blauäugigen wurden so behandelt, wie Nicht-Weiße und Nicht-Christen traditionellerweise oft in der abendländischen und amerikanischen Gesellschaft behandelt werden. Auf sie wurden – ohne mit ihnen sonderlich aggressiv umzugehen – alle negativen Eigenschaften, die Dunkelhäutigen und MigrantInnen zugeschrieben werden, projiziert: Unterlegenheit, Dummheit, Unsicherheit u.ä.m. Während die Braunäugigen vorher informiert und freundlich behandelt wurden, erhielten die Blauäugigen klare und strikte Anweisungen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen (z.B. zugewiesene Plätze einzunehmen, Intelligenztests zu absolvieren), wobei die unzureichende Lösung dieser Aufgabe mit herabsetzenden Kommentaren ("Die Blauäugigen sind eben zu dumm, um....") belegt wurden. Das Ergebnis dieses, in der Nachfolge der Ursprungsversion bis heute vielfach angewendeten eintägigen Trainings: Die "Blauäugigen" fühlen sich nach kurzer Zeit tatsächlich so wie sie behandelt werden und machen entsprechend viele Fehler. Die erlebte Herabsetzung nagt an ihrem Selbstbewusstsein, was sie wiederum demotiviert, störrisch und lernunwillig macht. Sie bestätigen mit ihrem Verhalten letztlich die Vorurteile, die ihnen entgegengebracht werden (vgl. Schlicher, J./Günther, R./Schütze, D./Thiele, K. 1998, das kurze Beispiel bei Koch 2001 und www.eyetoeye.org). Das Ziel besteht darin, zu zeigen, dass Verhalten gelernt wird und entsprechend auch wieder verlernt werden kann. Der Ansatz will jahrhundertealte Konditionierungen und pauschale Diskriminierungsstrukturen verdeutlichen. Das Training für 15 bis 30 Personen wird seit 1996 auch in Deutschland in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Volkshochschulen, Verwaltungsstellen, sozialen Organisationen und Vereinigungen sowie Unternehmen durchgeführt, im Regelfall eintägig. Die Angebote werden seit Juli 1997 von "eyetoeye" (i2i) in Marburg und Jena koordiniert. Der Verein hatte bis November 2001 TrainerInnen für 250 Trainings und mehr als 50 Präsentationen vermittelt. Insgesamt nahmen an diesen Veranstaltungen mehr als 10.000 Menschen zwischen 16 und 65 Jahren teil. Die Kritik bemängelt einen Missbrauch von Macht durch die TrainerInnen, der entweder dazu führt, dass das autoritäre Verhalten des/der AnleiterIn sich verselbständigt und gerade kontraproduktive Effekte hervorruft, oder bewirkt, dass letztlich eher Betroffenheitsgesten und Gefühle der Hilflosigkeit resultieren als ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selbst und Selbstanfragen an das eigene Alltagsverhalten. Sie vermerkt, dass die vom Training aufgebaute Täter-Opfer-Dichotomie unrealistisch ist, weil Angehörige benachteiligter Gruppen selbst oft Bestandteile vorherrschender Ideologien übernehmen und so "Mittäterschaft" möglich wird. Sie empfindet eine Starrheit des Konzepts, die sich auch darin ausdrückt, dass die realen Erfahrungen von Teilnehmenden, etwa die Erfahrungen deutscher Jugendlicher, in ihrem Freizeitalltag eher von Migrantenjugendlichen dominiert zu werden als umgekehrt sie dominieren zu können, dadurch ausgeblendet werden, dass die Autochthonen schematisch jeweils als TäterInnen, die Allochthonen als Opfer konzipiert werden. Nach dieser Ansicht wird so die Wirkmächtigkeit von Widerständen geleugnet. Schließlich hält sie die Entwicklung von Handlungsperspektiven und Alltagstransfers für unterbelichtet. Sie plädiert stattdessen für Ansätze, die das Empowerment von Machtlosen betreiben, Rassismus multiperspektivisch thematisieren und dabei dialogische Methoden nutzen (vgl. Lang/Leiprecht 2000). 88 So plausibel diese Kritik zunächst klingen mag: Amerikanische Evaluationen des Konzepts unterstreichen seine Effektivität (vgl. Breckheimer/Nelson 1976; Byrnes/Kiger 1992). Sie sind aber nicht ohne weiteres auf europäische Verhältnisse übertragbar, u.a. deshalb weil in Amerika Hautfarben eine andere Rolle spielen als hier oder auch die Bedeutung des Islam eine andere ist als beispielsweise in Deutschland und auch weil die Trainings (deshalb) landesspezifisch modifiziert werden müssen. Deutsche Evaluationen sind gegenwärtig in Arbeit, aber noch nicht abgeschlossen und publiziert. Das Pädagogische Zentrum in Aachen (Frau Aden) wertet gegenwärtig 10 Trainings mit verschiedenen Zielgruppen (ca. 200 Personen) primär quantitativ aus. Es werden sowohl Erwachsene, die meist aus eigenem Antrieb kommen, als auch Jugendliche, die das Training im Rahmen des Schulunterrichts absolvieren, einbezogen. Erhebungen wurden in verschiedenen Trainingsphasen, zu Beginn des Trainings, an seinem unmittelbaren Ende und 4-6 Wochen nach Trainingsabschluss, vorgenommen. Erste Ergebnisse zeigen: Es wird bei den Teilnehmenden ein hoher Grad an emotionaler Reaktion freigesetzt. Das Training erleichtert es offenbar, eigene Unterdrückungserfahrungen offen zu thematisieren. Alle TeilnehmerInnen nehmen nach Abschluss des Trainings das Thema "Diskriminierung" ernster als früher. Allerdings: Der konfrontative Ansatz stößt in Deutschland auf Widerstände. Generell muss sich das Training die Frage gefallen lassen, ob es nicht in dem von ihm verwendeten methodischen Ansatz veraltet ist. Zudem treten Transferprobleme zu Tage, weil USA-Rassenprobleme andere Konfliktlagen mit sich bringen als dies die europäische Fremdenfeindlichkeit tut. Letztlich ist auch die Nachhaltigkeit der mit dem Training verbundenen Lernprozesse fraglich. Es zeichnet sich ab, dass sich eher solche Personen mit dem Thema weiter beschäftigen, die schon vorher dafür sensibilisiert waren, wogegen diejenigen, die sich nur kurz damit konfrontiert fühlen, es eher als ein Muss-Thema auffassen und froh sind, wenn die Zwangsbeschäftigung mit ihm, die das Training auferlegt, vorbei ist. Hierbei handelt es sich vor allem um Jugendliche. In jedem Fall sollten Qualitäts-Standards entwickelt werden, entlang derer die Ausbildung von TrainerInnen erfolgt. Dies erscheint wegen der starken persönlichen Betroffenheit, die das Training meist erzeugt, und der pädagogischen Notwendigkeit, mit ihr aufmerksam und konstruktiv umzugehen, unverzichtbar. Eine zweite, explizit formative Evaluation qualitativer Art wird – basierend auf Auswertungen, die der Oevermannschen objektiven Hermeneutik folgen - gerade im Rahmen eines Dissertationsvorhabens an der Universität Bielefeld vorgenommen. (Zwischen)Ergebnisse gibt es erst in Ansätzen (vgl. Schrödter 2002). Das US-amerikanische NCBI (National Coalition Building Institute) bietet ein schon seit Mitte der 80er Jahre entwickeltes "Peer Training" an, das dem Schätzenlernen von Diversität gewidmet ist (vgl. kurz Brown/Mazza 2000). Es begründet seine einzelnen Methoden jeweils theoretisch. Sechs Punkte sind in dieser Hinsicht charakteristisch: Ausgehend von der Erkenntnis, dass Menschen zu Kategorisierungen und Verallgemeinerungen neigen, um Komplexität zu reduzieren, werden Teilnehmende zunächst aufgefordert, in Paarkonstellationen spontane Assoziationen zu verschiedenen ethnischen, nationalen, kulturellen, geschlechtsspezifischen, altersspezifischen oder regionalen Gruppierungen in unzensierter Weise zu benennen und so zu entdecken, dass niemand gegen Pauschalisierungen gefeit ist (1.). Da Stereotypisierungen auch dadurch aufrecht erhalten werden, dass die von ihnen Belegten diese internalisieren und so Solidarisierungen innerhalb der eigenen Gruppierung untergraben werden können, sollen diese – wiederum in Paarkonstellationen und zwar durch wechselseitige spielerische Projektion der der eigenen Gruppe gegenüber empfundenen Vorurteile auf das Gegenüber – benannt und dadurch in ihrem unterdrückerischen Charakter offen gelegt werden (2.). In zwei weiteren Schritt werden die eigenen Diskriminierungserfahrungen der Teilnehmenden zum Gegenstand gemacht (3. 89 und 4.). Dahinter steht die Erkenntnis, dass Menschen selbst benachteiligt worden sein müssen, bevor sie andere diskriminieren und dass diese Ungerechtigkeitserfahrungen daher am eigenen biographischen Beispiel zu thematisieren sind. Eine fünfte Methode zielt auf die Entwicklung der Fähigkeit ab, diskriminierende Äußerungen, die im Beisein der Person fallen, gezielt zu unterbrechen (5.). Schließlich – und hier erhält das Training den Charakter der oben beschriebenen Argumentationstrainings – werden kontroverse Themen in ProContra-Diskussionen durchgespielt, um adäquate und im Alltag taugliche Argumentationslinien in ähnlichen Real-Situationen zu finden. Evaluationen der Methodik haben das nicht nur theoretisch, sondern auch mit dem gesunden Menschenverstand leicht nachvollziehbare Resultat ergeben, dass nicht allein Selbstaufklärungen von Einstellungen und Überzeugungen, sondern erst Veränderungen des Alltags, die durch solche Eingriffe möglich werden, von Teilnehmenden als entscheidende Fortschritte und Erfolge des Trainings-Programms gewertet werden (vgl. Sales 1984). Das Gesamtbild zur Evaluation antirassistischer bzw. interkultureller Trainings bleibt noch ein nahezu leeres, farbloses Blatt. Dass sein auf Deutschland bezogener Teil allenfalls erste Skizzen erkennen lässt, wir dann verständlich, wenn man berücksichtigt, dass zahlreiche Trainings wie entscheidende Anstöße für das Trainingsformat generell aus den USA kommen, wo "cross-cultural-orientation programs" (Brislin/Pedersen 1976), "cross-cultural sensivity trainings" (Pruegger/Rogers 1994), "culture assimilator" (Stotland/Katz/Patchen 1959; Cushner/Brislin 1996), "cultural communication trainings" (Brislin/Yoshida 1994), "multicultural trainings" (Ridley/Mendoza/Kanitz 1994), "race relation trainings" (Day 1983) "race awarenesse trainings", "cultural diversity training" (Sue 1991), "diversity and difference training" (Sims/Sims 1993) und "anti-racism trainings" (Katz 1978) seit längerem verbreitet sind und dennoch der dortige Stand ihrer Evaluation als dürftig eingeschätzt wird (vgl. Kinast 1998). Dessen ungeachtet ist mit Grosch/Gross/Leenen (2000) davon auszugehen, dass Trainings um so besser sind, je deutlicher und differenzierter sie stillschweigende kulturelle Annahmen an die Oberfläche des Bewusstseins befördern, Wahrnehmung schulen, dialogisches Lernen und kooperatives Arbeiten fördern und die Eigeninitiative der Lernenden unterstützen. Im Kontext des Gestaltungs-Paradigmas sind sie ferner daraufhin zu beurteilen, inwieweit es ihnen gelingt, den Transfer trainingsimmanenter interkultureller Verständigung und antirassistischer Lernprozesse in den Alltag zu gewährleisten. In Hinsicht auf letzteres ist der zentrale Befund einer recht großen, 400 Trainingsanbieter umfassenden Evaluation von Anti-Diskriminierungsmaßnahmen (Information Trainings, Cultural Awareness Trainings, Equality Trainings, Organizational Change/Multicultural Trainings, Anti-Racism Trainings und Diversity Trainings) in den Niederlanden interessant (vgl. Abell 2001). Danach kritisieren die TeilnehmerInnen den oft mangelhaften Praxisbezug von Trainings. Dort, wo bereits innerhalb des Trainingssettings über die Änderung von Einstellungen hinausgegangen werden konnte, erfolgen durchweg positive Rückmeldungen. Der konstatierte Trend zum Typ des Management Diversity-Trainings wird deshalb als positiv betrachtet, weil hier in erster Linie gezielt Verantwortungsträger in Institutionen angesprochen und damit strukturelle Veränderungsprozesse angestoßen werden (können). Nachhaltigkeit setzt allerdings – auch dies eine Einsicht aus der niederländischen Studie – den Abschied von kurzfristigen, mehr oder minder zufällig und ohne geplante Folgemaßnahmen stattfindenden Trainings voraus. Die Transformation von Gelerntem in konkrete Gestaltungsprozesse ist das Anliegen noch stärker handlungsorientierter Bildungsformen und Projekte, wie sie in Deutschland recht frühzeitig schon z.B. im Umfeld der vom Jugendamt der Evangelischen Kirche von Westfalen-Lippe initiierten, pädagogisch begleiteten und dokumentierten Ansätze entwickelt wurden (vgl. Projekthandbuch Rechtsextremismus 1989; Posselt/Schumacher 1993, 90 Neuauflage 2001; im Hinblick auf die Durchführung von Umfragen und anderen Erhebungen zur Thematik durch SchülerInnen der Sek. II auch Sander/Hülshörster 1998; ein ähnlich handlungsorientiertes Heft des Wochenschau-Verlag ist in Vorbereitung). Dieser Typus beschränkt sich nicht auf die Erörterung von Ideologien und Versuche ihrer argumentativen Aushebelung. Ebenso wenig verbleibt er im Spielelabor. Vielmehr konzentriert er sich auf Vorschläge und Anleitungen für konkrete Aktionen, die Rechercheformate annehmen (Interviews, Video- Erkundungen, Archivarbeit), aber auch das Terrain der klassischen Pädagogik verlassen und in politisches Handeln übergehen können (Mahnwachen, Demonstrationen, Plakatierungen, öffentliche Solidaritätsbekundungen mit Verfolgten, Inszenierung öffentlicher Events, Forumtheater, Denkmalsenthüllungen etc.). Dabei ist nicht nur die Zielgruppe der ohnehin Aufgeklärten im Visier. Stattdessen wird davon ausgegangen, dass konkretes Tun bei Kindern und Jugendlichen, die sich auf der Suche nach Orientierung befinden, Lerneffekte mit sich bringt, die die Sinnhaftigkeit demokratischen Handelns unmittelbar erlebbar machen und so die Motivation stärken, demokratisches Wissen in tätige politische Moral umzusetzen. Manche der Projekte gehen so weit, dass sie sich nicht auf punktuelle bzw. kurzfristige Aktionen beschränken, sondern eine nachhaltige Veränderung lebensweltlicher Strukturen anstreben. Der Ansatz geht von der Devise aus, dass der Mensch vielleicht 20% von dem verinnerlicht, was er hört, aber 98% von dem, was er selber gemacht hat, wobei diese Quantifizierungen freilich mehr der Illustration dienen als wissenschaftlich belegt werden (vgl. Spiele 1996, 120). Besonders weitreichend ist ein in Deutschland noch eher wenig bekannter französischer Ansatz, der des französischen Soziologen und Psychologen Charles Rojzman und seines programmatisch benannten Zentrums "Impatiences démocratiques" in Arles (vgl. kurz Eisfeld/Ott 2000). Ausgehend von dem Wissen, dass Rechtsextremismus und Gewalt keine Randerscheinungen der Gesellschaft sind, sondern in ihrer Mitte wurzeln, schlägt er eine Gesellschaftstherapie vor, für die die Wiederherstellung zerstörter Beziehungen im Gemeinwesen den Kernpunkt bildet. Zielgruppe sind deshalb primär die Angehörigen von Institutionen. Sie sollen mit potenziellen oder faktischen Konfliktparteien (Jugendlichen, PolizistInnen, SozialarbeiterInnen, Geschäftsleuten etc.) im Gemeinwesen sog. "Kooperationsgruppen" bilden, die Vorschläge für gewaltfreies Gemeinwesenleben ausarbeiten und sich untereinander dabei vertraglich zu kontinuierlicher Teilnahme verpflichten, dafür aber auch vom regulären Dienst freigestellt bzw. befristet beschäftigt werden. Die Vorteile, die in diesem Herangehen gesehen werden, sind doppelseitig: Menschen, die als 'Störenfriede' wahrgenommen werden, werden in kollektive Lösungen einbezogen und Institution können bürokratischer Erstarrung entraten. Experimentell wie es sich versteht, legt dieses lebensweltintervenierende wie auch das spielerische Herangehen weniger Wert auf eine wissenschaftlich exakte Evaluation. Wichtiger sind ihm Rückmeldungen aus der Praxis. Legt man diesbezüglich die Nachfragen nach einschlägigen Materialien zu Grunde, so fallen sie ausgesprochen positiv aus. Allerdings will es scheinen, als konzentrierten sie sich auf die außerschulische Pädagogik mit Kindern und Jugendlichen und besonders engagierte Lehrkräfte. SchulpraktikerInnen halten demgegenüber – wie es scheint – gewohnheitsmäßig und strukturkonform eher an zeitlich zum traditionellen Schulablauf passenden Unterrichtseinheiten fest. Erwachsenenbildung präferiert – jedenfalls in ihrer deutlichen Mehrheit – ebenfalls weiterhin Unterrichtungsformate (Vorträge, Kursreihen, Diskussionsveranstaltungen etc.). Wenn somit die Evaluation von Unterrichts-, Bildungs- und Trainingseinheiten, trotzt ihrer weiten Verbreitung noch recht dürftig ausfällt, bleibt wenigstens aus theoretischer Sicht festzuhalten: 91 Aus der Perspektive des aktuellen Stands der wissenschaftlichen Rechtsextremismusforschung muss eine kognitivistisch verkürzte Bildungsarbeit als aussichtslos eingeschätzt werden. Rechtsextreme Orientierungen bestehen gerade im Jugendalter nicht (nur) aus ideologischen Überzeugungen. Sie sind vielmehr (jugend)kulturell-symbolisch und emotional konturiert. Sie entstehen im wesentlichen aus bestimmten Alltagserfahrungen. In sie ist die Person als 'ganzer Mensch' eingebunden (vgl. Heitmeyer u.a. 1992, 1995; Möller 2000a). Von daher ist auch im Bildungsbereich der Hebel dort anzusetzen. Dies bedeutet nicht, dass der argumentative Diskurs nicht entwickelt werden müsste. Er ist gerade im Umgang mit ideologisch verfestigten Rechten unabdingbar (vgl. Wagner/Richter 1996). Es zeigt sich jedoch deutlich, dass mehr Demokratiewissen nicht linear zu mehr demokratischem Handeln führt. Dort, wo Wissen über eigene Erfahrung zu Stande kommt, hat es gute Chancen internalisiert und zur Richtschnur des eigenen Handelns gemacht zu werden. Pädagogisch käme es daher darauf an, Wissens- über Erfahrungsproduktion anzustoßen. Im Kontext von Bildung sind deshalb Trainings-, Begegnungs-, Recherche- und Produktionsformate erfolgversprechend. Designs, die spielerische Elemente beinhalten, an unmittelbaren lebensweltlichen Erfahrungen anknüpfen und lebensweltliche Gestaltungsinteressen wecken und befriedigen, kommen am ehesten einem modernen ganzheitlichen Lern-Verständnis entgegen, wobei allerdings zum einen auch eine mögliche Überforderung vorausschauend bedacht und vermieden werden und zum anderen die Einbettung einzelner Einheiten in ein langfristig angelegtes Gesamtkonzept erfolgen muss. Dieses hat Arbeit am Bewusstsein mit Arbeit am konkreten Sein zu integrieren. Letzteres ist um so wichtiger, weil allein mit der Änderung von individuellem Denken noch keine Veränderung Ungleichheit und Gewalt stabilisierender Strukturen und Institutionen verbunden ist. Unbeschadet dieser ersten Einschätzungen bleibt die Evaluation von Unterrichts-, Bildungsund Trainingskonzepten ein dringliches Desiderat. Wenn schon für die Niederlande, wo AntiDiskriminierungsarbeit und –trainings eingesessener sind, festgestellt werden muss, dass Trainingsanbieter nur kaum und dabei noch unsystematisch Indikatoren für Erfolg angeben können (vgl. Abell 2001), so kann die Situation in Deutschland diesbezüglich wohl noch als eher schlechter eingeschätzt werden. Und generell gilt für Programme zur Verbesserung von Intergruppen-Beziehungen, also auch für Ansätze, die über Trainingskonzepte hinausgehen, hierzulande erheblich zugespitzt das, was Stephan/Stephan (2001a, b) nach umfassenden Meta-Analysen sogar für die diesbezüglich viel weiter entwickelte Forschungslandschaft in den USA feststellen: "more research on the outcomes of intergroup relations techniques is needed" (ebd., 4). Bei ihrer selbst für die USA in dieser umfassenden Anlage einmaligen Meta-Evaluation von sechs Typen von "intergroup relation programs" ("multicultural education programs", "diversity trainings", "intergroup dialogue programs", "cooperative learning groups", "intergroup conflict resolution techniques", "moral education programs") stellen sie nämlich fest: Leichte, aber signifikante positive Veränderungen von Einstellungen und Verhaltensweisen lassen sich zwar unmittelbar nach dem Durchlaufen des jeweiligen Programms und auch noch später auffinden, allerdings ist nicht angebbar, ob spezifische Programmkomponenten, die Art und Weise des Umgangs mit dem Programm oder andere denkbare Faktoren für Erfolg im Sinne der Zielerreichung generell oder auch für die Nachhaltigkeit von intendierten Effekten ausschlaggebend sind. Der Autor und die Autorin fordern deshalb, Forschungsanstrengungen vor allem in drei Evaluationsbereichen zu unternehmen: Effektivitätsprüfungen, Untersuchungen zur Verbesserung der Prozessqualität und vergleichende Studien, um die relative Effektivität verschiedener Programme und Techniken überprüfen zu können. Die enormen Defizite innerhalb des deutschen Forschungsstandes lassen keinen anderen Schluss zu und fordern eine erhebliche Verstärkung von Evaluationsbemühungen unübersehbar heraus. 92 3.1.3 Konzepte der Qualifizierung personaler Kompetenzen und des allgemeinen sozialen Lernens Konzepte zur Qualifizierung personaler Kompetenzen und des allgemeinen sozialen Lernens9 können sich auf die zahlreichen theoretischen und empirischen Befunde berufen, die einen engen Konnex zwischen unzureichend entwickelten Mechanismen und Kompetenzen der subjektiven Erfahrungsstrukturierung und dem Verfolgen ausgrenzender, gewalthaltiger und extremistischer Positionen und Verhaltensweisen konstatieren (vgl. Frey/Haußer 1987; Schwind/Baumann u.a. 1990; Olweus 1991, 1997; Tennstädt 1991; Tennstädt/Dann 1992; Klosinski 1993; Böhnisch 1994; Fend 1994; Smith/Sharp 1994; Balser/d'Amour 1995; von Borries 1995; Hopf u.a. 1995; Petermann u.a. 1997; Menschik-Bendele/Ottomeyer 1998; Möller 2000a, 2001; Lutz 2000, Schubarth 2000). Folglich zielen sie darauf ab, bei Individuen und Gruppen (z.B. in Schulklassen) Kompetenzerhöhungen zu erzielen, die insbesondere Qualifizierungen von Wahrnehmung, Selbstausdruck, Kommunikation, Interaktion, Urteilen und Reflexion beinhalten. Entsprechendes Lernen betrifft also Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Schlüsselqualifikationen. In Anlehnung an die Definition sozialer Kompetenz von Bloomquist (1996) ist davon auszugehen, dass sie dazu dienen sollen, umweltbezogene und persönliche Ressourcen gezielt so einsetzen zu können, dass eine optimale Entwicklung ermöglicht wird. Im Mittelpunkt steht die Arbeit an grundlegenden Kompetenzen wie Frustrations-, Ambivalenz- und Ambiguitätstoleranz, Rollendistanz, Reflexivität, Perspektivenübernahme, Empathie, verbalem Interessenausgleich, gewaltfreier Konfliktregelung und Verantwortungsübernahme. Dem adäquaten Umgang mit Emotionen, motorischen Antrieben und ihrer Abstimmung mit der kognitiven Informationsverarbeitung sowie mehr oder weniger explizit auch dem moralischen Lernen werden dabei herausragende Rollen zugewiesen. Basierend auf lerntheoretischen Grundlagen und operierend mit Modellernen, Rollenspielen, verstärkenden Verhaltensrückmeldungen und z.T. Einübungen des Alltagstransfers bestehen die im Umlauf befindlichen Konzepte größtenteils aus Trainingsformaten. Sie bieten Spiele und Übungen, die bausteinartig miteinander kombiniert werden können. Zumeist werden sie primärpräventiv oder in Verbindung von Primär- und Sekundärprävention eingesetzt. Kompetenztrainings liegen für alle Altersgruppen vor (vgl. über die im folgenden diskutierten Ansätze hinaus auch: z.B. Korte 1996; Pölert-Klaasen 1997, 1998; Ministerium für Kultus 1999; Portmann 1998; Akin 2000; Böhner 2000; Reiners 2000). Trainings für Kinder fokussieren – seit etwa 20 Jahren in Deutschland verbreitet (vgl. Petermann/Petermann 2000a) - insbesondere auf den Ausbau von Selbstsicherheit und Selbstbehauptung. Das Programm von Hanewinkel u.a. (1994; vgl. auch Aßauer/Hanewinkel 2000) sieht elf eineinhalbstündige Einheiten für die fünfte und sechste Klasse vor. Es zielt im wesentlichen darauf, eigene Verhaltensunsicherheiten wahrnehmen, Mimik und Gestik deuten, eigene und fremde Ansprüche erkennen, Kritik annehmen, mit Misserfolg umgehen und so letztlich Selbstsicherheit gewinnen zu können. Das "Sozialtraining in der Schule" der Arbeitsgruppe um Petermann (1999) richtet sich an die dritte bis sechste Klasse und umfasst einen vergleichbaren Zeitraum (10 Sitzungen à 90 Minuten). Deutlicher noch zählt es die Entwicklung von Perspektivenwechselfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Kooperation als Alternative zu aggressivem, ängstlichem oder sozial isoliertem Verhalten zu seinen Zielen, womit es sich nicht prinzipiell von dem älteren, mehr sekundärpräventiven speziellen Antiaggressionstraining für Kinder (vgl. Petermann/Petermann 2000c) unterscheidet. Evaluationen belegen aggressionsreduzierende Effekte (vgl. Petermann u.a. 1997). 9 Wenn hier von Konzepten allgemeinen sozialen Lernens die Rede ist, meint dies Ansätze, die nicht spezielle Schwerpunktsetzungen, etwa auf interkulturelles Lernen (vgl. dazu auch Kap. 3.1.17) oder Streitschlichtung (vgl. Kap. 3.1.4), vornehmen, sondern eher unspezifische, basale Kompetenzen schulen. 93 Kompetenztrainings für Jugendliche existieren in Deutschland kaum länger (vgl. Pielmaier 1980). Sie beanspruchen im allgemeinen nur unwesentlich mehr Zeit als die Trainings mit Kindern, unterscheiden sich auch in weiten Teilen der Zielsetzungen kaum, legen jedoch oft altersbedingt mehr Wert auf den Ausbau von Selbstkontrolle und Ausdauer, sind methodisch dem Alter angepasst und ventilieren Inhalte, die dem Jugendliche interessierenden Themenkreis von Berufsorientierung, Partnerschaft(splanung), Freizeitaktivitäten etc. entspringen. Das von Petermann/Petermann entwickelte Training (2000b) setzt auf eine Kombination von Einzel- (fünf Sitzungen) und Gruppentraining (zehn zweistündige Sitzungen in Gruppen von 5 bis 6 Personen). Positive Verhaltenseffekte gelten als empirisch belegt. Vor allem als Effekte des Gruppentrainings werden ein Abbau des Problemverhaltens und ein Aufbau neuer Verhaltensweisen beobachtet (vgl. ebd.). Das für die Sekundarstufe I entwickelte Unterrichtsprogramm von Lerchenmüller (vgl. 1986, 1987; Lerchenmüller-Hilse 1996) versteht sich ausdrücklich als Delinquenzprophylaxe. Als Ziele werden erweiterte Fähigkeiten bezüglich Urteilsfähigkeit, Beziehungs- und Empathiefähigkeit, kommunikativen Kompetenzen, Rollendistanz und Ambiguitätstoleranz angegeben. Es umfasst 26 Unterrichtsbausteine à jeweils einer Doppelstunde. Handlungsorientiert, auf die Erfahrungswelt von Schülern und Schülerinnen bezogen und unter Einbezug affektiver Auseinandersetzung sollen die Teilnehmenden anhand der Diskussion von Bild- und Kurzgeschichten, Videos, Rollenspielen, Kleingruppenarbeit etc. lernen, Peergruppen-Druck zu widerstehen und die Folgen gewalttätigen Handelns z.B. im Cliquenverbund rechtzeitig zu durchschauen. Das Einräumen von "Meckerstunden" sowie die begleitende Beratung des/der KlassenlehrerIn lösen den kontextbezogenen Anspruch des Trainings ein, wonach die atmosphärischen Lernbedingungen in Klassenverband und Schule positiv mit beeinflusst werden sollen. Auswertungen des Programms mit achten Klassen von Real- und Hauptschulen über ein halbes Jahr hinweg in den achtziger Jahren ergeben die gewünschten Lerneffekte: eine Verbesserung des Klassenklimas, der Qualität der SchülerLehrer-Beziehung und vor allem ein Anstieg der Empathiefähigkeit sowie der kommunikativen und speziell konfliktlösungsorientierten Kompetenzen auf Seiten der Schülerschaft. Allerdings unterstreichen sie auch zur Erzielung nachhaltiger Wirkungen die Notwendigkeit einer dauerhaften und frühzeitigen (spätestens in der Grundschule ansetzenden) Implementation sozialen Lernens in der Schule und der Entgrenzung einer Engführung sozialer Lernprozesse auf reine Trainingsprogramme (vgl. ebd.). Eine aktuelle Weiterentwicklung des Trainings von Petermann/Petermann (FIT FOR LIFE; vgl. Jugert u.a. 2001a, b), weiterhin auf der theoretischen Grundlage des Modell sozialkognitiver Informationsverarbeitung von Dodge (vgl. 1993; Crick/Dodge 1994), ferner der Lerntheorie Banduras (vgl. 1986) und allgemeiner jugendpsychologischer Erkenntnisse zielt neben der Verbesserung des Lern- und Arbeitsverhaltens der TeilnehmerInnen explizit auf die Prävention und Reduktion von sozialen Konflikten und Verhaltensstörungen. Es wendet sich an sozial benachteiligte Zielgruppen. 13 Module (von "Gesundheit", "Selbstsicherheit" und "Körpersprache" über "Gefühle" und "Kommunikation" bis zu u.a. "Einfühlungsvermögen und "Fit für Konflikte 1 und 2") sind vorgesehen, um "Scheinkompetenzen" wie z.B. "Aggression", "Extremismus" und "Delinquenz" als "Ausdruck misslingender Bewältigung von Entwicklungsaufgaben des Jugendalters" (vgl. ebd., 40) abzubauen und durch tragfähige soziale Kompetenzen wie "Aufmerksamkeit und Ausdauer, Lern- und Leistungsmotivation, Selbst- und Fremdwahrnehmung, stabiles Selbstbild, Selbstkontrolle und Selbststeuerung, sorgsames Umgehen mit dem eigenen Körper, Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, Einfühlungsvermögen (Empathie, Perspektivenübernahme), Kommunikation, Kooperation, Entscheidung und Planung (Beruf, Leben, Zukunft), Annehmen von Lob und Kritik, 94 Überwinden von Misserfolgen, rationales (gewaltfreies) Verhalten in Konflikten" (ebd., 42f.) zu ersetzen. Quantitative Auswertungen liegen für Rückmeldungen von im Durchschnitt 19jährigen Jugendlichen aus berufsvorbereitenden Maßnahmen sowie von BeobachterInnen (Lehrpersonen, TrainerInnen, Sonstige) in einem Prä- und Posttestdesign (Jugendliche: N= 118 plus N= 96 Kontrollgruppe beim Ausfüllen des ersten Fragebogens), für Jugendliche zudem ein Follow up nach drei Monaten (N=56 in der Experimentalgruppe, N= 39 in der Kontrollgruppe) vor. Auf dieser sehr schmalen Datenbasis und bei von den EvaluatorInnen eingestandnermaßen erheblichen methodischen Problemen bei der Datenerhebung (rd. 30% statistische Mortalität zwischen Prä- und Posttest) zeigt sich, dass die Selbsteinschätzung des eigenen Aggressivitätsniveaus in Prä- und Posttest (Follow up-Ergebnisse werden nicht präsentiert) bei der Experimentalgruppe gleich bleibt und nur von einem positiven Effekt des Trainings insofern ausgegangen werden kann, als das selbst zugeschriebene Aggressionsniveau der Kontrollgruppe im selben Zeitraum ansteigt. Es verwundert deshalb nicht, wenn die Autorengruppe – allerdings ohne nähere Begründungen anzuführen - meint: "In der Hauptsache sollte sich eine Evaluation des FIT FOR LIFE-Trainings auf die Fremdbeurteilungen stützen" (ebd., 81). Ebendiese werden allerdings ihrer Zahl nach nicht ausgewiesen, beziehen sich in nicht nachvollziehbarer Weise auf "N=69 bis N=78 Jugendliche" (ebd., 83), werden in völlig unklarer Weise mit einer vorher nie erwähnten Gruppe von "ZweitbeobachterInnen" in Beziehung gesetzt und können doch letztlich nicht eine signifikate Aggressionssenkung ausmachen (vgl. ebd., 82ff.). Die unzureichende Qualität dieser (Selbst)Evaluation sollte weniger als Argument gegen die Effektivität dieses Trainings oder vergleichbarer Ansätze der Kompetenzenschulung verwendet, denn als (ungewolltes) Plädoyer für seriöse externe Evaluationen gewertet werden. Das in Deutschland bekannteste und auch im Kontext von Deeskalationstrainings (vgl. dazu Kap. 3.1.6) in Auszügen benutzte Training für Erwachsene ist das erstmals bereits 1983 von Pfingsten und Hinsch vorgelegte "Gruppentraining sozialer Kompetenzen" (GSK) (vgl. Pfingsten/Hinsch 1998). Es basiert auf kognitiver Verhaltenstherapie, nutzt entsprechend Selbstinstruktions- und Problemlöseverfahren und verknüpft diese mit Rollenspielen und Entspannungstechniken. Wissenschaftlich geprüfte Effekte sind nicht bekannt; PraktikerInnen greifen jedoch gerne, auch bei Arbeit mit jüngerem Klientel, auf die Übungen des GSK zurück. Ebenfalls für Erwachsene (Eltern, Lehrkräfte) wie für Kinder und Jugendliche lässt sich das Gordon-Konflikttraining nutzen (Gordon 1990a, b). Hier wird davon ausgegangen, dass Konflikte in sozialen Geflechten zur Normalität gehören, sie aber prinzipiell ohne Niederlage und Gesichtsverluste für die an ihnen Beteiligten gelöst werden können. Lösungen sollen in sechs Schritten angegangen werden: Identifikation und Definition des Konflikts (1.), Entwicklung von Alternativen (2.), kritische Bewertung der Alternativlösungen (3.), Entscheidung für die beste annehmbare Lösung (4.), Ausarbeitung von praktikablen Lösungswegen (5.) und spätere Überprüfung der Angemessenheit der gefundenen Lösung (6.). Propagiert wird vor allem das Aussenden von Ich-Botschaften, um Selbstauskünfte über das eigene Befinden zu ermöglichen und schuldzuweisende Du-Botschaften zu vermeiden. Zentral ist in diesem Zusammenhang die Verwendung einer Sprache der Akzeptanz, die verbal, gestisch und mimisch die Bereitschaft zu aktivem Zuhören und zu Ernstnehmen des Gegenübers signalisiert. Für den Bereich von Schule berichten Lehrkräfte von positiven Wirkungen vor allem auf Argumentationsfähigkeiten und die Kompetenzentwicklung von Perspektivenübernahme. Maßnahmen zur Moralentwicklung zielen im Kontext der Bearbeitung von Ungleichheitsvorstellungen darauf ab, dass die TeilnehmerInnen zur moralischen Reflexion ihrer Auffassungen über Minderheiten gebracht werden. 95 Im Rahmen der auf Rokeach (1971) zurückgehenden sog. value confrontation techniques werden sie individuell aufgefordert, diejenigen 10 Werte nach dem Grad ihrer Wichtigkeit aufzulisten, die für sie persönlich am bedeutsamsten sind. Im allgemeinen wird dabei der Werte der Freiheit weit höher eingeschätzt als der der Gleichheit. So wird problematisiert, mit welcher moralischen Berechtigung, der Wert der eigenen Freiheit höher eingeschätzt werden darf als der der Freiheit der anderen. Mit dem Verweis auf selbst vertretene moralische Werte werden in dieser Weise fremdenfeindliche Auffassungen konterkariert. Für Studierende konnten Katz und Ivey (1977) und Altemeyer (1994) explorativ nachweisen, dass die auftretenden kognitiven Dissonanzen durch eine Absenkung der vormaligen Vorurteile reduziert wurden. Ob dies auch für jüngere Leute (aus anderen Milieus und in Handlungsfeldern außerhalb von Universitäts-Labors, z.B. Jugendarbeit und Schule) und vor allem auch längerfristig gilt, bleibt weiteren Evaluationen zu untersuchen vorbehalten. Eher auf die Qualifizierung der Sozialkompetenz der Lehrkräfte gerichtet ist das Konstanzer Trainingsmodell (vgl. Tennstädt 1987). Es vermittelt Lehrpersonen spezifische Fähigkeiten für die Reaktion auf Unterrichtsstörungen und im Unterricht auftauchende Aggressionen. Im wesentlichen geht es um die Verbesserung der Wahrnehmung von Störungen und Aggressionen, ihrer Erklärung und Einordnung sowie des Verhaltens in Entscheidungssituationen, konkreter pädagogischer Gegensteuerungen und der Einschätzung des Handlungserfolgs. In Trainingstandems, zu denen zwei oder mehrere KollegInnen gehören, werden gegenseitige Unterrichtsbesuche organisiert, Konfliktsituationen beobachtet, Lösungen dokumentiert und besprochen. Die empirische Evaluation belegt eine Steigerung des Selbstvertrauens im Umgang mit Konfliktsituationen bei Lehrpersonen und eine wohl deshalb auch höhere Bereitschaft zu konsequentem Einschreiten ihrerseits bei gleichzeitigem Rückgang strafender Maßnahmen. Des weiteren zeigt sich ein Anwachsen des Interesses an Schule und der Leistungsbereitschaft bei SchülerInnen, eine Verbesserung des Klassen- und Kollegiumsklimas sowie vor allem eine Senkung aggressiven Schülerverhaltens um rd. ein Viertel; dies jedoch nur im unmittelbaren Unterrichtsgeschehen, nicht allgemein auf Schulebene und auch nicht speziell in Hinsicht auf rechtsextrem und/oder fremdenfeindlich motivierte Aggression. Eine Beschränkung der Wirksamkeit von solchen Trainings des sozialen Lernens liegt darin, dass sie schwerpunktmäßig auf personaler Ebene ansetzen und institutionelle wie darüber hinaus reichende strukturelle Bedingungen weitgehend ausblenden. Dies gilt auch, wenn sie als Klassenprogramme ausgelegt sind oder im Rahmen von Projektwochen und Fortbildungen auf Schulebene verfolgt werden. Zumeist individualistisch- und/oder gruppentherapieorientiert angelegt, priorisieren sie zwar potenziell ganzheitliches Erfahrungslernen vor dem Ansatz bloßer Wissensvermittlungen, folgen aber der Spur des Hilfeparadigmas und nutzen die Potenziale des Gestaltungsparadigmas nicht aus. Weiterführend erscheint demgegenüber ein relativ neuartiges Programm des sozialen Lernens, das das Trainingsformat überwindet und Soziales Lernen durch das Versetzen von TeilnehmerInnen in fremde Lebenswelten und die Teilnahme am Alltag der ihr Angehörigen dort zu erreichen trachtet. So vermittelt etwa die Stuttgarter "Agentur Mehrwert" (früher: "Modellprojekt soziales Lernen") seit 1996 vornehmlich junge Menschen aus Schule, Jugendarbeit und Ausbildungsunternehmen, aber auch Manager aus Betrieben, für bestimmte Zeiträume (als Anstoß und für Schlüsselerlebnisse u.U. nur für drei bis fünf Tage) in soziale Einrichtungen. Ausgehend von der gesellschafts- (speziell individualisierungs-)theoretisch begründeten Einsicht "Eine funktionierende Gesellschaft braucht ein Gegengewicht zu Ökonomie und Leistung" (Keppler u.a. 1999, 13) versteht sich das neue Lernarrangement als vernetzungsförderlicher "Beitrag zur Gestaltung einer 'Neuen Kultur des Sozialen'" (ebd., 23). 96 Es soll über die Eröffnung von Begegnungsmöglichkeiten mit Behinderten, Alten und sozial Benachteiligten Schlüsselqualifikationen und Sozialkompetenz, ja "Sozialkapital" in der Zivilgesellschaft stärken. Eine über zwei Jahre (November 1996 bis Juni 1998) hinweg vorgenommene wissenschaftliche Begleitung erfasste per halbstandardisierter FragebogenUntersuchung die Einschätzungen von 408 (von insgesamt 441) jungen Menschen im Alter zwischen 13 und 24 Jahren in 21 Projekten. Zusätzlich wurden 253 Tagebücher und Praktikumsberichte ausgewertet. Weitere Interviews blieben ohne systematische Auswertung. Die Ergebnisse zeigen nicht nur, dass die Mehrzahl der Teilnehmenden angibt, neue Erfahrungen gemacht (über zwei Drittel), neues soziales Wissen erworben (deutlich über die Hälfte) und an sozialer Sensibilität gewonnen zu haben (je nach Fragebereich rd. 30% bis rd. 55%), sondern sie können auch als Zugewinn an "Verständnis und Toleranz" gedeutet (vgl. ebd., 57) und für über die Hälfte der Teilnehmenden als Eröffnung eines neuen Zugangs für soziales Engagement gelesen werden (vgl. ebd., 79). Dessen unbeschadet bleibt die Nachhaltigkeit der gefundenen Effekte zu überprüfen (vgl. zu aktuellen Projekten auch: Mehrwert 2002). 3.1.4 Mediation und Streitschlichtung Mediation führt den Gedanken bloßer Deeskalation (vgl. dazu Kap. 3.1.6) insofern weiter, als sie sich nicht mit der situationsfokussierten Aufarbeitung eines einzelnen Konflikts zufrieden gibt, sondern ihre TeilnehmerInnen darüber hinaus in konstruktive Formen der Konfliktregelung einführen will, die ihnen auf Dauer eine eigenständige, gemeinschaftliche und gewaltfreie Schlichtung ermöglichen. Im Kern handelt es sich um ein kommunikatives Verfahren der außerjustiziellen10, informellen Vermittlung von (keinesfalls: Ermittlung bei) Streitfällen durch unparteiische Dritte, das seit den 60er Jahren in den USA verbreitet wird (vgl. Besemer 1996). Es stellt einen geschützten Raum für ein Gespräch (ggf. auch eine Serie von Gesprächen) zur Verfügung, in dem ein unmittelbarer Kontakt der Streitparteien zu Stande kommt, ihre Anliegen auf den Tisch kommen, ihre den Konflikt betreffenden Gefühle ausgedrückt, die wirklichen und durch das Konfliktgebaren der Akteure womöglich verdeckten Interessen geklärt und gegenseitige Verstehensbemühungen in Gang gesetzt werden können. Die Rolle der vermittelnden Person liegt dabei darin, den Streitenden einen Weg zu einer einvernehmlichen Lösung aufzuzeigen, die beide Seiten (ggf. auch mehr als zwei Seiten) gleichermaßen zufrieden stellen kann. Sie enthält sich dabei jeglichen Urteils oder gar Schuldspruchs und richtet ihre Anstrengungen darauf, die Streitenden selbst in Stand zu setzen, selbstständig Lösungen zu finden, die optimalerweise eine "win-win-Situation" beinhalten (vgl. Fisher/Ury/Patton 1993). Der erzielte Konsens wird in einer Vereinbarung festgehalten. Mediation kann mit Einzelpersonen wie mit Gruppen erfolgen. Angewandt wird sie in verschiedenen Feldern, z.B. bei Scheidungsangelegenheiten (vgl. z.B. Duss-von Werdt 1995; Friedman 1996), in familiären Konflikten (Proksch 1998; Bannenberg 1999), Nachbarschaftsstreitigkeiten, Mietauseinandersetzungen oder anderen Rechtsstreitigkeiten bzw. in Strafsachen (etwa im Rahmen der Umsetzung von "restorative justice"; vgl. Pelikan 1999), Arbeitsplatz- und betrieblichen Ausbildungskonflikten (Bundesinstitut für 10 Als außerjustizielles Verfahren ist Mediation nur dann aufzufassen, wenn der Täter-Opfer-Ausgleich (s. Kap. 3.1.11) nicht als Mediation verstanden wird. Entgegen der auch international durchaus gebräuchlichen Verwendung des Begriffs "Mediation" eben dafür beziehen wir uns hier im Unterschied dazu auf Verfahren, die darauf verzichten, die unzweifelhafte Feststellung des Tathergangs in Verbindung mit einem Schuldurteil vorzunehmen; dies deshalb, weil solche Vorgehensweisen in wichtigen pädagogischen bzw. sozialarbeiterischen Feldern (vor allem in Schule) vorherrschen. 97 Berufsbildung 1998), politischen Konflikten, etwa zwischen Bürgerinitiativen und Verwaltung, interkulturellen Auseinandersetzungen (vgl. Haumersen/Liebe 1999) aber zunehmend auch im Kontext von Täter-Opfer-Ausgleich und vor allem bei Auseinandersetzungen zwischen Kindern (vgl. auch Scholl/Korell 2001) und Jugendlichen (vgl. Hauk-Thorn 2001) oder zwischen jungen Leuten und Erwachsenen im schulischen und außerschulischen Bereich (vgl. Walker 1991, 1995a, b; Faller/Kerntke/Wackmann 1996; Faller 1998; Jefferys-Duden 1999, 2000, 2001a, b; Jefferys-Duden/Noack 2000;). Wie aus Kap. 1 ersichtlich, erfreuen sich einschlägige Zusatzausbildungen z.Zt. großer Nachfrage, vor allem von Lehrern und Lehrerinnen. Der MediationsGuide 2000, ein von der Kölner Zentrale für Mediation herausgegebenes Verzeichnis von MediatorInnen, weist über 500 Personen aus. Bei dieser Zahl ist zu berücksichtigen, dass es noch keine rechtlich geschützte Berufsbezeichnung für MediatorInnen gibt und die Diskussion um Mindeststandards noch geführt wird. Voraussetzung für den Beginn von Mediation ist, dass die Konfliktbeteiligten nach ihrer eigenen Einschätzung an die Grenzen ihrer eigenen Konfliktlösungskompetenzen gestoßen sind und beide Seiten freiwillig am Mediationsverfahren teilnehmen (vgl. aber zur Relativierung des Freiwilligkeitsprinzips die unten stehenden, kurzen Ausführungen zu Schulmediation). Die Schritte des Verfahrens gliedern sich in die Vorphase, das Mediationsgespräch und die Umsetzungsphase (vgl. Besemer 1999). In der Vorphase geht es darum, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bekommen; denn längst nicht immer suchen beide Seiten von sich aus und womöglich auch noch gemeinsam das Mediationsgespräch. Wird ein Konflikt von einem/r der Beteiligten an den Mediator/die Mediatorin herangetragen und dies mit dem Wunsch nach Vermittlung verbunden, so sucht der Mediator/die Mediatorin die andere Partei auf, um sie zur Teilnahme an einem Vermittlungsgespräch zu bewegen. Unter Umständen hört aber die Mediationsperson auch nur von Dritten von einem Konflikt. In diesem Fall würde sie versuchen, beide Parteien zu kontaktieren, um sie zu einer einvernehmlichen Problemlösung zu motivieren. Die Freiwilligkeit der Teilnahme bleibt dabei jedoch grundsätzlich zu wahren. Das Mediationsgespräch soll an einem neutralen Ort geführt werden. Schon die Sitzordnung soll eine Kommunikationsatmosphäre ermöglichen, die ein Gespräch 'auf gleicher Augenhöhe' erlaubt und eine offene und vertrauensfördernde Grundlage schaffen kann. Zu Beginn klärt der Mediator/die Mediatorin die Parteien über den Ablauf, die eigene Rolle und die Grundregeln auf. Er/sie versichert sich noch einmal der Freiwilligkeit der Teilnahme und der Bereitschaft zur Lösungssuche. Unbeschadet dessen, dass spezielle Regeln für die folgende verbale Auseinandersetzung vereinbart werden können, gelten Ausredenlassen und jeglicher Gewaltverzicht nicht nur während des Gesprächs, sondern insgesamt während der Mediationsphase als unverzichtbar. Nach der Einleitung erhalten die Konfliktparteien nacheinander die Gelegenheit, ungestört von Unterbrechungen ihre jeweiligen Sichtweisen darzulegen. Es folgt die Phase der Konflikterhellung: Hintergründe der konfliktbehafteten Auseinandersetzung, die in verborgenen Gefühlen und Interessen liegen, sollen aufgeklärt und benannt werden. Das Aussenden von Ich-Botschaften und das Paraphrasieren des vom Gegenüber Gehörten sind dabei wichtige Methoden. Ist so die Basis für gegenseitiges Verstehen geschaffen, sollen anschließend – u.a. zunächst über brainstorming – Möglichkeiten der Problemlösung in den Blick genommen und ausgelotet werden. Sind sie gefunden, wird eine zumeist schriftlich festgehaltene Übereinkunft geschlossen, die nicht nur die Lösung, sondern auch die Möglichkeiten der Überprüfung ihrer Umsetzung durch die Beteiligten selbst enthält. Sollte dies erforderlich erscheinen, können die MediatorInnen allerdings auch in Ergänzung zu diesem Grundmuster Einzelgespräche mit den Beteiligten einschieben, um Klärungen voranzutreiben. 98 In der Umsetzungsphase nimmt die Mediationsperson nach einem gewissen Zeitraum noch einmal Kontakt mit den vormaligen Streithähnen auf, um nach der Tragfähigkeit der gefundenen Lösung(en) zu fragen und ggf. Korrekturen vorschlagen zu können. Grenzen des Einsatzes von Mediation liegen vor, wenn sich der Streit in einer akuten Phase befindet, die Streitenden kein Interesse an einer einvernehmlichen Lösung ihres Konflikts besitzen, eine der Seiten nicht freiwillig mitmacht, Gewaltsamkeit oder Bedrohungen virulent sind, gravierende und nicht zu überbrückende Machtunterschiede zwischen den streitenden Parteien bestehen, bloße Ja-/Nein-Entscheidungen zu treffen sind, grundsätzliche Wertorientierungen oder grundlegende Rechte (z.B. Recht auf Gleichheit, Gewaltfreiheit) zur Verhandlungsdisposition gestellt werden, nicht ein Mindestmaß an Verbalisierungsfähigkeit und kommunikativer Selbstbehauptungsfähigkeit vorausgesetzt werden kann und kein hinreichender Zeitraum für die Erzielung einer einvernehmlichen Lösung zur Verfügung steht. Mediation wird gerade auch als Chance in der Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen gesehen. Ihr wird zugeschrieben, wichtige Lernprozesse einleiten bzw. aufrecht erhalten zu können, die nachweislich (vgl. Möller 2000a, 2001) eine Distanzierung von gewaltsamem Handeln begünstigen. Dazu gehören "transformative" Funktionen wie: das Verbalisieren von Emotionen, die Übernahme der Perspektive von Anderen, die Entwicklung von Empathie, Verbesserungen der Fremdwahrnehmung im interpersonalen Verhältnis, die Erhöhung der Selbstkontrolle, das Führen diskursiver Interaktionen, das Verdeutlichen der Bedeutung von gegenseitiger Achtung, Akzeptanz und Toleranz, das Erlernen gewaltfreier, eigenständiger Selbstbehauptungsund Auseinandersetzungsformen sowie Konfliktlösungen (vgl. auch Simsa 2001, bes. 10ff., 82ff.). Insofern sind sie nicht nur gleichsam defensiv auf die Aufarbeitung vergangener Auseinandersetzungen gerichtet, sondern führen offensiv und mit Zukunftsbezug in ein konstruktives, gewaltfreies Agieren ein (vgl. auch Mücke/Korn 2000) Zunehmend wird Mediation in der pädagogischen und sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nach Vorbildern aus Großbritannien und vor allem den USA, wo entsprechende Ansätze schon seit den 80er Jahren verbreitet und in den letzten 10 Jahren weiter ausgebaut wurden, auch als Peer-Mediation konzipiert (vgl. Faller/Kerntke/Wackmann 1996; JefferysDuden 1999, 2000; Jefferys-Duden/Noack 2000; Simsa 2001). An Schulen werden dann mittels entsprechender Bildungsprogramme für Schüler und Schülerinnen (in Hessen von 30 bis 40 Unterrichtseinheiten) AGs von "StreitschlichterInnen" bzw. "Konfliktlotsen" eingerichtet. Erwachsene PädagogInnen fungieren begleitend als "Coaches". Modellversuche an einzelnen Schulen existieren mittlerweile in allen Bundesländern; in Hessen sind (und werden) Projekte besonders stark verbreitet (vgl. Simsa/Schubarth 2001). Aus solchen Versuchen ist bekannt, dass das Prinzip der Freiwilligkeit nicht immer durchgehalten wird (vgl. Simsa 2001, bes. 76ff.). Aus der Stellung von Mediation zwischen Recht und Pädagogik erwächst, dass sie teilweise in Ordnungsmaßnahmeverfahren überführt wird. Konkret: Es 99 wird mit Sanktionen gedroht, wenn Mediation nicht in Anspruch genommen wird. Mediation ist dann keine Alternative mehr zum Schulordnungsrecht, sondern wird als eines seiner Elemente genutzt. Der theoretische Ausgangspunkt wird nicht in allen Konzeptausarbeitungen ersichtlich. Manche bestehen nur mehr oder weniger aus einer Aneinanderreihung von Techniken, Handlungsanweisungen und spielerischen Übungen, die vor allem zur Ausbildung von MediatorInnen und StreitschlichterInnen und zur Arbeit in Schulklassen und Jugendgruppen dienen. Zu Grunde liegt aber wohl im allgemeinen ein positiver Konfliktbegriff: "Nicht der Konflikt an sich ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wird" (Faller/Kerntke/Wackmann 1996, 11). Konflikten wird aus dieser Sicht "Lern- und Wachstumspotenzial" (ebd., 12) unterstellt. Oft bezieht man sich auf den österreichischen Unternehmens- und Organisationsberater Friedrich Glasl und seine Definition von Konflikt: "Sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Aktoren (Individuen, Organisationen, Gruppen usw.), wobei wenigstens ein Aktor Unvereinbarkeiten im Denken/Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen mit dem anderen Aktor (anderen Aktoren) in der Art erlebt, daß im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor (die anderen Aktoren) erfolgt" (Glasl 1997, 14 f.; vgl. auch Glasl 2000). Wo Peers einbezogen werden, knüpft man an Erfahrungen mit Peer-Education an und leitet aus ihnen ab, dass sich Kinder und Jugendliche zumindest in bestimmten Bereichen ihres Verhaltens eher an Gleichaltrigen als an Erwachsenen orientieren. Unterlegt wird das Konzept des Modell-Lernens. Wenn Streitschlichtung in ein generelles Konfliktmanagement einmünden soll (wie ebd.), zielt man auf mehr ab als die Veränderung individuellen Verhaltens. Es wird die Absicht verfolgt, zu strukturellen Wandlungen beizutragen, die es Initiativen und Organisationen, insbesondere auch pädagogischen Einrichtungen wie Schulen und Jugendzentren, erlauben, Mechanismen zu entwickeln, die Konflikte möglichst frühzeitig konstruktiv zu lösen gestatten. Mit solchen Ansätzen der Struktur- und Organisationsentwicklung sollen klimatische Bedingungen geschaffen werden, die einer Präventionskultur zuträglich sind. Zu ihnen gehört neben der Etablierung des Mediationskonzepts im engeren Sinne auch (vgl. Faller 1998; Simsa 2001): der Ausbau sozialen Lernens in Form von mehr kooperativem, projekt- und handlungsorientiertem Lernen, die Entwicklung von Aufmerksamkeit für in den verschiedenen Phasen von Gruppen- und Klassenbildung sich wiederholenden Situationen (Klassenbildung, Gruppenprozesse), für die damit für alle Beteiligten verbundenen Orientierungsprobleme und für deren systematische Bearbeitungsformen, die Verankerung von Mediation im Schulprogramm, die Kooperation von Schule und Jugendhilfe und die Öffnung der Schule gegenüber dem Gemeinwesen. Entwicklungen sollten dabei nicht 'von oben' gesteuert werden, sondern beteiligungsressourcen- und prozessorientiert angelegt sein (vgl. Faller 1998, 209). Dies meint: Die Menschen, die von den Veränderungen betroffen sind, sollten aktiv in den Planungs-, Durchführungs- und Entscheidungsprozess einbezogen werden. An den vor Ort vorliegenden positiven Ansätzen, Erfahrungen und Kompetenzen sollte angeknüpft werden, statt ein von woanders entlehntes Modell überzustülpen. Und: Der Weg der Zielerreichung ist wichtig. Er sollte in Etappen einteilbar sein, die eine Kontrolle von Fortschritten und ggf. auch Verirrungen erlauben. 100 Evaluation empfehlen umfassende Mediationskonzepte zwar dringlich. Im Hinblick auf wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Evaluation von Mediations-Konzepten ist – wie bei anderen Konzepten auch – dennoch weitgehend Fehlanzeige zu vermelden. Ein aktueller Bericht der "Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention" des Deutschen Jugendinstituts (DJI) bestätigt: "Hinweise auf Ergebnisse wissenschaftlicher Begleitung oder Selbstevaluation finden sich nur vereinzelt" (Gabriel u.a. 1999). In Bezug auf die mediative Klärung rechtsextrem aufgeladener Konflikte ist schon dies ein Euphemismus. Immerhin aber liegen einige erste Erfahrungen in Hinsicht auf allgemeine Gewaltprävention durch Mediation aus wissenschaftlichen Begleitungen vor. Die zweijährige Begleitung des hessischen Modellprojekts von Konfliktmanagement an Schulen ergibt in dieser Hinsicht mit Bezug auf 39 Schulen: Die Schulen vermelden mehrheitlich (30 Schulen) eine "Verbesserung des Klassenklimas", eine "Erhöhung von Konfliktlösungskompetenz" und dabei auch eine Verringerung von Aggressionen (Simsa 2001, 41). Chancen auf Erfolge steigen in dem Maße wie längerfristige Implementationen (als ideal wird eine Laufzeit von 4 bis 5 Jahren bis zur endgültigen Etablierung betrachtet) vorliegen. Mit peer-mediation wurden – allerdings wurden hier nur insgesamt 102 Konfliktfälle in 50 Mediationsgesprächen an zwei Schulen ausgewertet – gute Erfahrungen gemacht: Danach interessieren sich vor allem Mädchen für den StreitschlichterInnen-'Job' und nehmen vor allem ältere Kinder bzw. jüngere Jugendliche (5. und 6. Klasse) Mediation in Anspruch. Allerdings betrifft nur etwa ein Viertel der Fälle körperliche Angriffe; die anderen Konfliktfälle beinhalten 'weichere' Streitpunkte und – formen (z.B. Meinungsverschiedenheiten). Immerhin kommt es in 86% der Fälle zu Vereinbarungen und haben die Konfliktlotsen das Gefühl, mit ihrer Arbeit das Gewaltniveau verringern zu können (vgl. Simsa 2001; Stahlberg 1998, 17). Freilich kann daraus nicht geschlossen werden, mit Mediation sei nun der Königsweg für Gewaltprävention und rechtzeitige –intervention gefunden. Erfahrungen aus anderen Programmen zeigen: Auch wenn der Anteil konstruktiver Konfliktlösungen zunimmt, kann die Zahl der destruktiven Konfliktbearbeitungsformen hoch bleiben (vgl. Noack 1998; Simsa 2001). Erfahrungsberichte, die erfreulicherweise positive Effekte (Erhöhung des Zusammengehörigkeitsgefühls von Klassen und nach durchlaufener Mediation steigende Bereitschaft, ernsthafte Konflikte zu vermeiden) vermelden, sind viel zu ungenau (vgl. Jefferys-Duden/Noack 2000; Jefferys-Duden 1999). Detaillierte Forschung ist unbedingt erforderlich. Denn: "Es fehlen weitgehend theoriegeleitete und empirisch valide Untersuchungen zur Gewaltprävention an Schulen. Dies gilt insbesondere für die Schulmediation, die bisher weder eine systematische Erfassung der verschiedenen Modelle, noch einen inhaltlichen Vergleich der unterschiedlichen Programme verzeichnen kann. Evaluationsstudien mit einer langfristigen wissenschaftlichen Begleitung von Mediationsprojekten zur Messung der Effizienz der jeweiligen Ansätze gibt es zurzeit nicht" (Simsa 2001, 87). Aus einer regional (auf Frankfurt und Umgebung) beschränkten ExpertInnen-Befragung unter MediatorInnen lässt sich weniger über konkrete Wirkungen, immerhin aber einiges über gängige Anwendungsrahmen und Desiderata entnehmen (vgl. Schmauch 2001a, b). Danach sind Konfliktanlässe häufig u.a. auch Kämpfe um Positionen, Ränge und Anerkennung. Sie sind nicht selten auch durch ethnisch konturierte Abgrenzungen aufgeladen. Um sie adäquat anzugehen, erscheint den Befragten nicht nur eine Implementierung von Streitschlichtungsarbeit in den Regelbetrieb pädagogischer Einrichtungen, sondern weiter ausgreifend im Sinne eines systemischen Verständnisses auch ein Transfer – ggf. auf den jeweiligen Praxisbereich hin abgewandelter - mediativer Prinzipien und Elemente in die Alltagsarbeit von Schule und Jugendarbeit erforderlich (vor allem Schulung der Wahrnehmung, Regelgebrauch, Sensibilisierung für Sprache als Macht- und 101 Kommunikationsmittel), wobei auch Grenzen darin gesehen werden, gesellschaftliche Sozialisationsbereiche wie Familie, Betrieb und Straße erreichen zu können. Der z.B. in Bochum und in Bielefeld-Sennestadt erstem Anschein nach mit Erfolg erprobte Einsatz von jugendlichen Coolness-ExpertInnen zur Prävention und Schlichtung von Streitereien im ÖPNV (insbesondere in Schulbussen) dürfte in dieser Hinsicht nur ein allererster Schritt sein (vgl. auch kurz: Fluter 2/2002, 45). Bis zur Entwicklung geeigneter Beeinflussungsstrategien weiterer Bereiche des Aufwachsens werden die o.e. Transferprobleme wohl so weit bestehen bleiben, dass der Gedanke einer flächendeckenden Verbreitung mediativer Grundannahmen, Methoden und Verfahren konstruktiver Konfliktregelung mit Widerständen rechnen muss. 3.1.5 Schulumfassende Programme Schulumfassende Programme – dies meint in diesem Zusammenhang Bündel von Maßnahmen, die nicht (nur) an einzelne Schüler und Schülerinnen oder einzelne Klassen adressiert sind (wie etwa Beratungsarbeit, Unterrichtseinheiten und -formen), sondern die jeweilige Schule als ganze erfassen. Zu unterscheiden sind im wesentlichen drei Ansätze: erstens solche, die eher auf Einstellungsbereiche abheben, zweitens Ansätze, die auf die Prävention und adäquate Intervention von gewaltförmigem Verhalten zielen und drittens weiter gesteckte Programme, die insgesamt eine Demokratisierung der Schulkultur anstreben. Aus der Vielfalt der im Umlauf befindlichen Ansätze werden im folgenden solche ausgewählt, die Auswertungen vorweisen können oder wenigstens aktuell von hoher Bedeutung sind und für Evaluationen besonders lohnend erscheinen (vgl. zu weiteren Ansätzen zusammenfassend: Schubarth/Ackermann 1997; Schubarth 2000). Als Ansatz, der in erster Linie den Abbau von Vorurteilen und die Verbreitung von antirechten Einstellungen betreibt, ist das schon seit 1990 zunächst an bayerischen Schulen praktizierte Anti-Rassismus-Training (A.R.T.) für Schüler und Schülerinnen zu nennen (vgl. Heigl 1996). Anders als die Bezeichnung vermuten lassen könnte, enthält es nicht nur Übungen und Simulationen zur Reflexion von Fremdheitserfahrungen und Entwicklung kreativer Ansätze des Umgang mit ihnen. Über die Formatierungsgrenzen eines Trainings hinaus regt es auch die Selbsttätigkeit von Schülern und Schülerinnen an, indem nicht allein im Sinne von Peer-Education jüngere SchülerInnen (ab der sechsten Klasse) von älteren (ab der neunten Klasse) trainiert werden, sondern z.B. auch von ihnen Besuche in Flüchtlingsunterkünften, multikulturelle Schulfeste, Ausstellungen oder Flugblattaktionen organisiert werden. Eine systematische Evaluation existiert jedoch nicht. Bekannter, verbreiteter und breitrahmiger angelegt ist das inzwischen mehrfach preisgekrönte Programm "Schule ohne Rassismus" der seit 1992 bestehenden "Aktion Courage e.V.". Es handelt sich um eine ursprünglich 1988 im belgischen Antwerpen als Reaktion auf Wahlerfolge des rechtsextremen Vlaamse Blok entwickelte, 1994 in die Niederlande und ab Sommer 1995 auch nach Deutschland importierte Idee. Im wesentlichen ausgehend von der Initiative von SchülerInnen (nach ersten Beobachtungen überproportional stark von Mädchen) beinhaltet sie den Gedanken, einen breit angelegten Prozess der Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Rassismus in Schulen voranzutreiben, an dessen Ende die Verabschiedung eines Regelwerkes für eine "Schule ohne Rassismus" steht (vgl. näher Handbuch 1996, 50ff.), das von mindestens 70% der an der jeweiligen Schule Beteiligten (Lehrkörper, SchülerInnenschaft, HausmeisterInnen, Reinigungspersonal etc.) unterzeichnet worden sein soll und als positives Signal für den Willen zu Diskriminierungsbekämpfung und unter Umständen auch für weiterreichende Demokratisierungsinteressen publikumswirksam in eine entsprechende Außendarstellung münden soll. Die Regeln sind durchaus 102 niederschwellig angesetzt. Sie enthalten im wesentlichen die Selbstverpflichtung, rassistische Propaganda im Schulrahmen nicht zu dulden, Diskriminierung und Rassismus in der 'eigenen' Lehranstalt nicht zuzulassen, Initiativen zur interethnischen Verständigung zu ergreifen und kontinuierlich dem gemäße Projekttage durchzuführen sowie in der Bewegung "Schule ohne Rassismus" mitzuarbeiten. Eine Bundeskoordination und regionale Service-Stationen dienen der Unterstützung des Prozesses durch Vernetzungsangebote, Eingabe von Projektideen, Materialienhinweise, Tipps für Handlungsschritte, Überzeugungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring usw. (vgl. dazu auch ebd. sowie Schule ohne Rassismus 1996). Inzwischen (Stand Januar 2002) sind 87 Schulen (davon 74 im Westen der Republik) "Schulen ohne Rassismus" und befinden sich zahlreiche weitere Schulen in einem entsprechenden Selbstverständigungsprozess (vgl. insgesamt auch www.aktioncourage.org). Eine Evaluation des Projekts liegt nicht vor. Dies ist um so bedauerlicher, als die lebensweltnahe schüler-, verständigungs- und handlungsorientierte Vorgehensweise mit ihrem Einbezug der verschiedenen Ebenen der Institution Schule wie ihres öffentlichen Umfelds den Ansatz aus theoretischer Sicht als durchaus erfolgversprechend erscheinen lässt. Zu prüfen ist allerdings, inwieweit der schon programmatisch ausgedrückte Impetus des Antirassismus auch zu oberflächlichem Engagement oder gar zu demonstrativer Gleichgültigkeit oder – ähnlich wie bei historsicher Bildung zum Nationalsozialismus beobachtet (vgl. Kap. 3.1.1) – zu Abwehrhaltungen z.B. bei 'rechten' SchülerInnen führen kann. Anti-Gewalt-Programme sind im allgemeinen nicht spezifisch auf die Reduktion von fremdenfeindlicher bzw. sonstiger minoritätenfeindlich motivierter und rechtsextremer Gewalt orientiert. Sie streben vielmehr die Herstellung und Erhaltung eines möglichst gewaltund angstfreien Schulklimas und dafür die Etablierung von demokratischen Konfliktregelungsstrukturen an. Bereits seit Mitte der 90er Jahre wird - zunächst in Schleswig-Holstein, später auch in Rheinland-Pfalz – "Prävention im Team" (PIT) angeboten. Hinter dem Titel verbirgt sich ein neben die Problematiken von "Sucht" und "Diebstahl" (in Schleswig-Holstein) bearbeitendes auch zentral auf "Gewalt" abzielendes Unterrichtsprogramm für die Klassen 6 bis 8 aller allgemeinbildenden Schulen. Sein Kern besteht in einem dreiphasigen Programm von mindestens 12 Unterrichtsstunden, das von Lehrkräften und Polizeibeamten, ggf. auch unter Hinzuziehung von Schülern und Teilen der Elternschaft, durchgeführt wird, wobei die KlassenlehrerInnen die einführende Rolle, die PolizistInnen die Vertiefungsphase und beide Berufsgruppen in Phase drei die Anleitung und Moderation von bestimmten Wahrnehmungs-, Kommunikations-, Interaktions- und Kooperationsübungen für die Schüler und Schülerinnen übernehmen. Als anspruchsvolle Ziele werden weit ausgreifend eine "Stärkung des Normenbewusstseins, Erfahrung, Erprobung und Aneignung sozialer Kompetenzen, Auf- und Ausbau des Selbstbewusstseins, des Selbstwertgefühls und der Eigenverantwortlichkeit, Entwicklung von Einsicht in konstruktive Konfliktlösungsmöglichkeiten, Förderung von Fähigkeiten zu gewaltfreien Problemlösungen, Verbesserung des sozialen Klimas in der Klasse, Wecken von Verantwortung für gefährdete Mitschüler" (Pädagogisches Zentrum 2000, 29) benannt. Eine vom Institut für Soziologie der Universität Mainz in den Jahren 1999 und 2000 durchgeführte Evaluation an 17 rheinland-pfälzischen Schulen, davon 10 mit dem Themenschwerpunkt "Gewalt" befragte in einem Vorher-Nachher-Design rd. 600 beteiligte Schüler und Schülerinnen, ex post ferner 35 Lehrkräfte und 17 Polizeibeamte. Als bei Lehrerund Schülereinschätzungen übereinstimmendes Ergebnis wird festgehalten, dass zwar Einsichtsfähigkeiten gestiegen sind und gewaltförderliche Einstellungen gesunken sind - vor allem bei Hauptschülern – (vgl. ebd., 124), die Klassengemeinschaft gestärkt, vermutlich auch die Integration ausländischer SchülerInnen, ohne dass dies explizit beabsichtigt gewesen wäre, gefördert (ebd., 162) und Berührungsängste gegenüber der Polizei abgebaut werden konnten (ebd., 225), konkrete Verhaltensänderungen in Richtung auf Reduktion des realen 103 Gewaltlevels aber kaum festgestellt werden können (vgl. ebd., 62). Verbesserungen werden im verstärkten Einbezug außerschulischer Aktivitäten, der zeitlichen Ausdehnung des Projekts, dem intensiveren Eingehen auf Diskussionswünsche von SchülerInnen und der Herstellung von mehr Transparenz im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit der in Phase drei anstehenden spielerischen Übungen gesehen; Vorschläge, die auch als Defizitmarkierungen wenig langfristig angelegter, stark unterrichtlich beschränkter, unzureichend schüler-, lebenswelt- und handlungsorientierter und mangelhaft vernetzter Ansätze betrachtet werden können. Umfassender als dieses Projekt und auch als die im Abschnitt zu Mediation und Streitschlichtung benannten Ansätze (vgl. Kap. 3.1.4) versteht sich in das Programm "Konflikt-Kultur", das in der Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz in der Erzdiözese Freiburg entwickelt wurde (vgl. Grüner/Hilt 1998). Es bietet ein am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiertes "Paket" an, in dem neben der Implementation von Mediation und Streitschlichtung auch das Vorgehen des Täter-Opfer-Ausgleichs, Krisenintervention in schwierigen Gruppensituationen und Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz, u.a. mittels Teamentwicklung, enthalten sind. Evaluationen liegen allerdings nicht vor. Als besonders erfolgversprechend hat sich das nach dem norwegischen Schulforscher Olweus benannte Mehr-Ebenen-Programm gezeigt. Auf lerntheoretischer Basis visiert es durch elternund lehrergestützte Maßnahmen auf Schul-, Klassen- und SchülerInnen-Ebene an, den Kreislauf von Angst und Gewalt zu durchbrechen. Auf individueller Ebene sieht es intensive Gespräche zwischen Lehrpersonen und an Gewalt beteiligten SchülerInnen sowie zwischen Lehrpersonen und den Eltern dieser SchülerInnen, Hilfen für familiäre Problemsituationen, Diskussionsgruppen für Eltern von Tätern und Opfern und ggf. auch Klassen- und Schulwechsel von SchülerInnen vor. Auf Klassenebene werden sanktionsflankierte Regeln gegen Gewalt in Absprache zwischen SchülerInnen und Lehrkräften aufgestellt, regelmäßige klasseninterne Gespräche zum Umgang mit diesen Regeln durchgeführt, inhaltlich spezifizierte und handlungsorientierte Behandlungen der Thematik im Unterricht vorgenommen, allgemeine soziale Lernprozesse gefördert und die Kooperation mit ElternvertreterInnen intensiviert. Auf Schulebene werden mittels einer Erhebung das Ausmaß und die Problemstellen von Gewalt in der Schule festgestellt, ein Pädagogischer Tag zur Diskussion der Ergebnisse und ihrer Konsequenzen anberaumt und auf einer sich anschließenden Schulkonferenz ein schulspezifisches Anti-Gewalt-Programm verabschiedet, das etwa eine Optimierung der Pausenaufsicht, die Umgestaltung des Schulhofes (vgl. dazu auch die positiven Erfahrungen mit einer Aggressionsreduktion in Rheinland-Pfalz durch das Projekt "Sport und Spiel statt Gewalt auf dem Schulhof: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 2000), die Einrichtung eines Kontakttelefons, die Durchführung thematisch einschlägiger schulinterner Lehrerfortbildungen und spezifische Kooperationsformen mit den Eltern beinhalten kann. Evaluationen des Olweus-Programms konnten einen deutlichen Rückgang von Gewaltsamkeiten um bis zu 50% innerhalb von 24 Monaten (bei der Durchführung eines von Schule zu Schule modifizierten Olweus-Programms in Schleswig-Holstein allerdings nur um 1,5 % bis zu 7,6 % innerhalb eines Jahres beim Mobbing; vgl. Knaack/Hanewinkel 1999) ausmachen (vgl. Olweus 1991; 1996). Sie ergeben darüber hinaus einen Zugewinn an sozialer Kompetenz (wie Aufeinander-Eingehen, Sicht-Füreinander-Einsetzen) auf Seiten der Schüler und Schülerinnen (vgl. Hanewinkel/Knaack 1997, 302; Olweus 1996, 71). Noch stärker auf die Etablierung von Schule als ganzheitlichem Lebensraum zielt das seit 1993 an Berliner Grund- und Hauptschulen gepflegte Konzept "Lebenswelt Schule" (vgl. Hensel 1995; Senatsverwaltung für Schule 1995). Es beabsichtigt, das eingeschränkte 104 Verständnis von Schule als bloßer Agentur der Wissensvermittlung zu überwinden und reklamiert deshalb einen erweiterten Erziehungsauftrag für sich. Zum ihm gehört die Einflussnahme auf die soziale und räumliche Gestaltung der Schule, die Verlebendigung des Lernens, die Öffnung von Schule in den Freizeitbereich hinein und die Qualifizierung des Integrationsvermögens der Schule. Wichtigste Einzelziele sind die Erhöhung des beschädigten Selbstwertgefühls von SchülerInnen mit geringem Schulerfolg (differenzierter Unterricht, erlebnispädagogische Elemente u.a.m.), die Erhöhung der Identifikation aller Beteiligten mit 'ihrer' Schule (Schulband, Feste etc.), die Entwicklung sozialer Handlungskompetenzen und gewaltfreier Konfliktregelungsformen (Streitschlichtung) und Angebote im Übergang zum außerunterrichtlichen Bereich (Cafeteria, Aktionen etc.). Erfahrungen zeigen, dass an den vier Modellschulen die Gewaltbereitschaft gesenkt und bei den Beteiligten das Selbstverständnis einer guten Schule aufgebaut werden konnte. Allerdings macht der dafür aufgebrachte personelle Ressourcenbedarf (z.B. Kooperation von mehreren SpezialistInnen, Beteiligung von Studierenden, SozialpädagogInnen, Eltern und zivilgesellschaftlichen AktivistInnen bei hohem persönlichen Einsatz) eine flächendeckende Übertragung eher unwahrscheinlich und lässt das Projekt daher realistischerweise eher an sozialen Brennpunkten empfehlenswert erscheinen (vgl. Schubarth/Ackermann 1997). In die Lücke mangelnder Verbindung von Ursachenanalyse, pädagogischem Handeln, dessen Evaluation und ihrer Rückmeldung in die Praxis stößt gegenwärtig das noch laufende Projekt "Unsere Schule...". Seit Frühjahr 2001 (bis August 2003) gemeinsam vom Potsdamer Institut für angewandte Familien- Kindheits- und Jugendforschung e.V. (IFK) und dem Göttinger Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V. (ibbw) durchgeführt, befragt es zunächst Schüler und Schülerinnen an 250 Schulen in 10 Bundesländern u.a. zu den Themenbereichen "Rechtsextremismus", "Ausländerfeindlichkeit" und "Gewalt", um der jeweiligen Schule präzise Angaben über die Situation vor Ort liefern zu können. In einem zweiten Schritt werden auf der Basis dieser Ergebnisse Qualitätsentwicklungen angestoßen und Fortbildungsangebote (vor allem Lehrmaterialien und Fernlehrgänge für Lehrpersonen) entwickelt. Eine Folgebefragung ab dem Frühjahr 2003 soll den Effekten der Fortbildungen im Schulklima und für die Schulentwicklung nachgehen. Sie wird an die Schulen zurückgespiegelt. Publizierte (Zwischen-)Ergebnisse liegen noch nicht vor. Insgesamt betrachtet stellt sich somit die Situation der Evaluation von schulischen Gewaltpräventions- und –interventionsprogrammen, mehr noch von 'Anti-RassismusAnsätzen', erheblich defizitär dar (vgl. Schubarth 1998, 154ff). Die Befunde können dahingehend zusammengefasst werden, dass diejenigen Projekte Erfolg im Sinne einer signifikanten Reduktion von Gewaltproblemen bzw. im Sinne der Herstellung eines vergleichsweise niedrigen Gewalt- und Ausgrenzungsniveaus vorweisen können, die mehrere Ebenen einbeziehen – Nolting/Knopf (1998) benennen etwa die schulbezogene, curriculare sowie täter- und opferbezogene -, diesbezüglich zumindest auf der Ebene der Schülerpersönlichkeit und der schulinternen Interaktionen (Schulkultur) operieren und dabei (vgl. Olweus 1991, 1997; Tennstädt 1991; Tennstädt/Dann 1992; Smith/Sharp 1994; Petermann u.a. 1997; Dann 1997; Schubarth/Ackermann 1997; Lutz 2000; www.b.shuttle.de/b/frbayer-os/proj-ued.htm; zu speziellen Anforderungen an den Grundschulunterricht zusammenfassend: Schubarth/Ackermann 1997): SchülerInnen ein positives Selbstkonzept mit angemessenen Formen der Selbstbehauptung und der Identitätsentwicklung vermitteln, differenzierte soziale Wahrnehmung schulen, sozialverträglichen Gefühlsausdruck erlernbar machen, Empathie entwickeln, 105 ein positiv erlebtes, auf einem breiten Werte- und Normenkonsens aufruhendes und über die Einhaltung von Regeln erhaltenes Schulklima ermöglichen, über kooperativ-kommunikative Umgangsstile Informationsfluss und Transparenz sichern und eine Atmosphäre sozialen Lernens erzielen, die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung entwickeln, Kompetenzerweiterungen und Qualifizierungen aller Beteiligten anstreben, konzeptionell, kollegial, koordiniert und selbstreflexiv handeln, ressourcenorientiert vorgehen und emotionale Zugehörigkeiten, Verantwortlichkeiten, ja Bindungen an Gemeinschaften vermittels Partizipations-, Selbststeuerungs- und Anerkennungsmedien herstellen. Davon, dass für entsprechende Umsetzungen Schulsozialarbeit hilfreich und unter Umständen gänzlich unverzichtbar ist, kann ausgegangen werden (vgl. auch ebd.). Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit, diese Dimensionen um die Perspektive der Einflussnahme auf die sozialökologische Schulumwelt zu erweitern (vgl. auch Forschungsgruppe Schulevaluation 1998), also die Öffnung und Vernetzung von Schule zu betreiben. Projekte der Öffnung der Schule zum Gemeinwesen beinhalten wichtige gewaltpräventive und -interventive Potenziale. Dies kann auch die Evaluation eines Modellprojekts "Stadtteil und Schule" belegen (vgl. Mutzeck/Faasch 1998), die über 3 Jahre hinweg die gemeinwesenbezogenen Vernetzungsanstrengungen von Schulen, Jugendhilfe, psychosozialen Beratungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Vereinigungen als Reaktion auf überproportionale Kriminalitätsbelastungen und Gewaltauffälligkeit von Kindern und Jugendlichen sowie im Nachgang zu "rechtslastigen Wahlergebnissen" (ebd., 8) in einem Lübecker Stadtteil wissenschaftlich begleitete. Nach den Beobachtungen der Beteiligten gelang es, durch Intensivierung, teilweise gemeinsame Planung und Abstimmung von Beratungs-, Freizeit- und Therapieangeboten, spezifisch ausgerichtete Projekte an Schulen und kooperative Unterrichtsprojekte der Netzwerkpartner, die allgemeine Gewaltbereitschaft und –tätigkeit der jungen Generation zu senken, das Schulklima zu verbessern und eine stärkere Integration der auffälligen Schüler und Schülerinnen zu erzielen. Explizit wird im Evaluationsbericht festgehalten, dass "Präventionsarbeit langfristig angelegt sein muß", "kooperative Umsetzungsstrategien immer erfolgreicher als Einzelmaßnahmen waren", "die häufig weitreichenden Kompetenzen von Nichtprofessionellen (Nachbarn, Trainer, Freunde)" gerade beim Einbezug von Eltern "erfolgreich genutzt werden" können und "rein schulisch orientierte Einzelmaßnahmen zur Erziehungshilfe auf Dauer wirkungslos bleiben" (ebd., 176f.). Eine enge Zusammenarbeit von Schul- und Sozialpädagogik wird für unabdingbar gehalten, auch über Schulsozialarbeit hinaus. Inhaltlich und strukturell besonders umfassend als demokratiepädagogisches Schulentwicklungsprogramm setzt das im Frühjahr 2002 zunächst in 12 Bundesländern mit je sechs bis 20 beteiligten Schulen startende BLK-Modellprogramm "Demokratie lernen und leben" an (vgl. Edelstein/Fauser 2001; Regionale Arbeitsstelle 2001). Es will neue "Gelegenheiten für verständnisintensives Lernen" stiften, die "gleichzeitig der individuellen Entwicklung und der demokratischen Umgestaltung der Schule dienen" (Edelstein/Fauser 2001, 16). Auch wenn es die allgemeine schulische Demokratieerziehung nicht eingeengt für die Prävention von und Intervention bei Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit instrumentalisiert sehen will (vgl. ebd., 8), wird zentral auf den "grundlegenden und empirisch nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Demokratieerfahrung und Gewaltverzicht (verwiesen): Wenn Kinder und Jugendliche die Erfahrung machen, dass in Schule und Erziehung Mitwirkung, demokratisches Handeln und 106 Verantwortungsübernahme erwünscht sind und als wichtig anerkannt werden, sind sie für Gewalt und Rechtsextremismus weniger anfällig als Jugendliche, denen diese Erfahrung versagt bleibt" (ebd., 21). Deshalb wird die "schüleraktive" Transformation der "dominante(n) Form des reproduktiven unterrichtlichen Lernens" und eine Ablösung der von Jugendlichen als "abstrakt" und "lebensfern" erlebten "wissensbezogenen Didaktik" durch ein "erfahrungsgeleitetes und Erfahrung vermittelndes Lernen" angezielt (ebd., 23). Dazu sollen bestimmte Strukturelemente – Module, Themen und Schwerpunkte – dienen. Module meinen die "institutionellen Entwicklungsbereiche der Schule", konkret: den Unterricht, Projekte als "zentrale didaktische Handlungsform" (ebd., 25), die partizipationsorientierte Erfahrung von "Schule als Demokratie" (z.B. über Ausbau der bestehenden und Aufbau neuer Mitbestimmungsmöglichkeiten sowie Konfliktmediation bzw. Streitschlichtung) und das Erleben von "Schule in der Demokratie" durch ihre Öffnung zum Gemeinwesen, Community Education (vor allem Aktivierung partnerschaftlicher Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Akteuren) und Service-Learning (z.B. Durchführung von Projekten mit realem Nutzen für die Schule und/oder die Gemeinde). Institutionelle Schwerpunkte werden in den Bereichen von Grundschulen (hier vor allem: toleranter Umgang mit Differenz) und beruflicher Bildung (hier u.a.: kooperative Selbstorganisation und –verantwortung von Lernen in Projekten und Ausbau beruflicher Schulen zu "regionalen Kompetenz- bzw. Berufsbildungszentren") gesetzt. Themensetzungen finden – und dies macht das Vorhaben für den hier diskutierten inhaltlichen Zusammenhang von besonderer Relevanz - unter den Stichworten "interkulturelles Lernen" und "Gewaltprävention" statt. Unter dem zuletzt genannten Label wird für den Aufbau von Unterstützungsnetzwerken zwischen Schule, Elternhaus und Jugendhilfe, für sozio-emotionale Entwicklungsinterventionen u.a. zur Gegensteuerung von Empathiedefiziten bei SchülerInnen und für Peer-Mediation plädiert. Für interkulturelles Lernen wird eine "Integrationspädagogik" vorgeschlagen, die strukturelle Integrationsbemühungen mit persönlichen und kulturellen "Verhaltensassimilationen" verbindet und ebenfalls die Kooperation schulischer und außerschulischer Akteure aktiviert (ebd., 50). Das Programm wird von einer Fort- und Weiterbildung der Professionellen begleitet, die insbesondere auf die Förderung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, der intrinsischen Motivation und der sozialen Kompetenz bei SchülerInnen abhebt. Dazu gehört neben dem bereits Genannten explizit auch die Förderung von Fähigkeiten zu Perspektivenwechsel, das Training von Zivilcourage und die Einübung in demokratisches Diskutieren. Die Aktivitäten sollen in einen mehrdimensional kooperativ vernetzten Prozess der Schulentwicklung eingebettet werden, die der Idee des der einzelnen Schule ein spezifisches Profil verleihenden Schulprogramms folgt. Das heißt Aktivitäten der Gewaltund Extremismusprävention und der darüber hinaus weisenden Demokratieerziehung sollen wie andere Schulaktivitäten auch in einen Prozess der gemeinsamen Verständigung über die übergreifenden Grundauffassungen und Handlungsziele der Institution Eingang finden, der von einer Ist-Analyse ausgeht, auf dieser Basis Handlungsprinzipien und priorisierte Arbeitsvorhaben samt Zeitplanungen festlegt, Fortbildungsplanungen entwirft, Evaluationen und Qualitätssicherungen vorsieht und kontinuierliche Fortschreibungen bzw. Überprüfungen der Ansprüche und ihrer Realisierung verlangt. Eine Evaluation des Gesamtprogramms ist unter miteinander verflochtenen formativoptimierenden und bilanzierend-summativen Dimensionen prozessbegleitend bis in die Berichtsphase im Jahre 2007 hinein vorgesehen. Die plausible, weil langfristige, breite, d.h. auch das schulische Umfeld detailliert berücksichtigende und auf den aktuellen Forschungsstand stringent bezogene Anlage des Programms lässt höchst aufschlussreiche Befunde über geeignete pädagogische Gegenstrategien in Schule und in Einrichtungen, die Kooperationsbeziehungen mit ihr aufnehmen, erhoffen. Denn mit Schubarth (vgl. 2000, bes. 165) lässt sich auf der Basis des vorhandenen Kenntnisstandes festhalten, dass 107 Präventionsansätze nicht durch zeitlich knapp bemessene Aufklärungsversuche im Rahmen von Paketen mit Unterrichtseinheiten zum Erfolg zu führen sind, sondern längerfristiger Veränderungen in den Lebens- und Lernwelten von Kindern und Jugendlichen bedürfen, sie dabei ganzheitlich auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Stabilisierung einer autonom-balancierenden eigenständigen Identität der jungen Menschen bezogen sein müssen und in Strukturen eingelagert werden sollten, die positive Demokratieerfahrungen begünstigen. Aussichtsreiche schulische Konzepte umfassen deshalb inhaltliche, methodische, personelle und institutionelle Aspekte, vor allem: die Implementierung neuer Inhalte und Formen des Unterrichts, die Unterstützung und Stabilisierung der Identitätsbildungsprozesse der Schüler und Schülerinnen, die Optimierung der Kommunikations-, Interaktions-, Partizipations- und Kooperationsprozesse sowohl innerhalb der Schule wie auch zwischen Schule und dem Umfeld (z.B. Zusammenarbeit mit Gemeinweseneinrichtungen und Jugendhilfe), das Ingangsetzen und die Qualifizierung von Schulentwicklungsprozessen. Insgesamt zeigt sich, dass die Verhaftung schulischer Ansätze in den Paradigmen der Wissensvermittlung und der Hilfe für einzelne von Gewalt und Extremismus als Täter oder Opfer Betroffene aufgebrochen, in Richtung auf eine Ausdehnung von Erfahrungslernen und strukturverändernden Gestaltungsprozessen verändert und in stärker ganzheitliche, selbstgesteuerte, handlungsorientierte und forschende Formatierungen in flexiblen, Kontinuität ermöglichenden und vernetzten Designs gelenkt werden muss. 3.1.6 Maßnahmen zur Deeskalation und Entwicklung von Zivilcourage Deeskalation beabsichtigt die präventive Verhinderung oder situative Unterbrechung direkter Gewaltausübung und ihrer Verschärfung, ohne schlicht nur beschwichtigend oder in jedem Fall konfliktvermeidend wirken zu wollen. Sie setzt also prophylaktisch und situativ an, umfasst auch Maßnahmen nach der gelungenen Deeskalation, indem der auslösende Konflikt von den Beteiligten unter Begleitung von Fachkräften nachträglich bearbeitet wird, sie führt aber im Gegensatz zur Mediation noch nicht prinzipiell in gewaltfreie Formen der Konfliktregelung ein, sondern schafft vielmehr nur die Voraussetzungen dafür, im weiteren konstruktive Konfliktlösungen verfolgen zu können (vgl. auch Korn/Mücke 2002). Dazu sollen neben De-Eskalationsstrategien, die speziell von Kommunalpolitik, Polizei, Staatsanwaltschaft (vgl. z.B. Landesgruppe 1998) und im Alltag von Einrichtungen der Jugendhilfe von (sozial)pädagogischen Fachkräften angewandt werden können (vgl. Schwabe 1996), in jüngerer Zeit auch arbeitsfeld- und konfliktunspezifisch durch entsprechende Trainings – oft entwickelt als Ausfluss der Friedens- und Menschenrechtsbewegung (vgl. z.B. Aktionshandbuch 1993; Beck u.a. 1994; Blum/Knittel 1994; Koppold 1996; Blum/Beck 2000) – die aktuell oder potenziell an einer Konfliktsituation Beteiligten in die Lage versetzt werden, die eigenen Reizschwellen und persönlichen Aggressionsauslöser bewusst in den Griff zu bekommen. Wichtige Ziele sind in diesem Zusammenhang die Schulung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, vor allem über die Sensibilisierung für eigene und fremde Körpersprache, die Stabilisierung von Selbstsicherheit im Verhalten durch 108 die Reflexion eigener Unsicherheiten, das Erkennen der Notwendigkeiten von Grenzsetzungen und die Vermittlung positiver Erfahrungen eigener Kraft z.B. mittels Stimmeinsatz und Körperhaltung in Bedrohungssituationen, die Stützung von Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit über die Reflexion ansozialisierter persönlicher Kommunikationsmuster, das Einüben dialogischer Kommunikation in schwierigen, gewaltbelasteten Situationen und die Herstellung von Konsensentscheidungen sowie die Absicherung des eigenen Handelns über das Kennenlernen verschiedener Interventionsmöglichkeiten in unterschiedlichen Situationen und das Erlernen von Techniken kreativer Lösungssuche. Methodisch bedient man sich neben eher am Rande stehenden theoretischen Inputs vorwiegend ganzheitlich angelegter und handlungsorientierter Übungen und Rollenspiele, die aus verschiedenen Ansätzen von Psychologie und Pädagogik entlehnt sind (Themenzentrierte Interaktion, Erlebnispädagogik, Gestaltpsychologie, Theater der Unterdrückten etc.). Die Gruppengröße schwankt zwischen unter 10 und ca. 35 Personen; im Durchschnitt wird ein Trainer/eine Trainerin für ca. 10 – 15 Teilnehmende vorgesehen. Im allgemeinen werden 2- 3 Tage veranschlagt, kurze halbtägige Schnupper-Inputs im Rahmen von Tagungsworkshops sind aber wegen der großen Nachfrage keine Seltenheit. SOS-Rassismus-NRW und das Villigster Deeskalationsteam bieten eine 30-tägige berufsbegleitende Ausbildung als TrainerIn an (vgl. Amt für Jugendarbeit 2000; Villigster Deeskalationsteam Gewalt und Rassismus 1999), demnächst wohl über die in Gründung befindliche "Akademie zur Deeskalation von Gewalt und Rassismus (Gewalt-Akademie NRW)". Zivilcourage gilt als eine gewaltfreie (eben "zivile") "demokratische Tugend". Sie bezeichnet nicht nur den "Mut, öffentlich die eigene Überzeugung zu äußern" (Singer 1992, 40), sondern auch ein u.U. für die eigene Person riskantes gemeinwohlorientiertes Eingreifen dort, wo Unrecht geschieht. Von bloßem "Mut" unterscheidet sie sich dadurch, dass sie "im Dienst von Überzeugungen und Idealen eigene wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile riskiert" (Brockhaus 1991). Gegenüber "zivilem Ungehorsam", der für exakt umschriebene Fälle schwerwiegender Ungerechtigkeit, nach Ausschöpfung aller anderen legalen Mittel und ohne Gefährdung der Verfassungsordnung (vgl. Rawls 1975, 401f.) – im Regelfall in kollektiven Aktionen – "politische Ziele, denen eine hohe Legitimität zugesprochen wird, gegen staatliches Handeln durchzusetzen" versucht, ist Zivilcourage als "individuelles Verhalten in einer singulären Situation" abzugrenzen (Ostermann 2000, 5). Schulung von Zivilcourage zielt darauf ab, Menschen in Stand zu setzen, zu ihrer Meinung zu stehen, auch dann, wenn sie nicht mehrheitlich geteilt wird, vor allem aber auch gerade im Umfeld von Fremdenfeindlichkeit dann einzuschreiten, wenn andere Menschen angegriffen werden. Dahinter steht die durch einzelne Beobachtungen belegte Auffassung, dass Angreifer am ehesten dann von einem Opfer ablassen, wenn sie gewärtigen müssen, dass andere Personen sich mit dem Opfer solidarisieren und zur Verteidigung seines Rechts auf Unversehrtheit einzustehen bereit sind (Adressen von Anbietern entsprechender Trainings finden sich in: Gesicht zeigen 2001, 233f.). Eine entsprechende Haltung ist nicht voraussetzungslos zu aktivieren; vielmehr baut sie auf persönlichen Faktoren auf wie (vgl. Frey/Schäfer/Neumann 1999; Singer 1992, bes. 136ff.; Meyer/Hermann 2000; Ostermann 2000): einer adäquaten Analyse der Bedrohungssituation, moralischer Reflexion, Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme – auch über den Rahmen partikularistischer Gruppierungen hinaus, 109 Bearbeitung eigener Ängste, Fähigkeiten zur Loslösung von Autoritätsgehorsam und Gruppen- bzw. generell Konformitätsdruck, Kenntnissen der Selbst- und Fremdverpflichtungen zu Hilfeleistungen, spezifischen Hilfefertigkeiten, z.B. Artikulations-, Dialogund Argumentationsfähigkeiten, einem gewissen Grad an Misserfolgstoleranz und sozialisatorisch, insbesondere familiär und schulisch vermittelten positiven Erfahrungen von Gewaltlosigkeit, Toleranz, Anteilnahme, 'Wärme', Solidarität und Selbstwirksamkeit. Hinzu kommen (vgl.: Meyer/Hermann 2000) soziale Faktoren wie: die soziale und politische Wertschätzung der angegriffenen Person, die persönliche und soziale Nähe der angegriffenen Person zum potenziellen Eingreifer, die soziale Position und der Status des potenziellen Eingreifers, das Handeln von Umstehenden, das öffentliche und institutionell verbreitete Klima für couragiertes Einschreiten, gesamtgesellschaftliche Faktoren wie die Verbreitung bestimmter moralischer Überzeugungen, Gleichheitsbzw. Gerechtigkeitsvorstellungen und Fürsorgeverpflichtungen, Autoritätsbeziehungen, Gruppenbindungen, strukturelle Gewaltformen, soziale Chancen etc. Von daher sind die in mehreren Versionen im Umlauf befindlichen 'gutgemeinten' Flyer mit Tipps zu Zivilcourage (vgl. z.B. die Faltblätter von "Mach meinen Kumpel nicht an!" e.V., SOS-Rassismus-NRW, Innenministerium NRW), Ausschreibungen (vgl. Informations- und Dokumentationszentrum 2000, 43ff.) und Postkartenkampagnen (z.B. der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg unter dem Motto "Ich sehe nicht weg!") zwar erste Anfänge, reichen aber für eine vertiefte Verankerung des Gedankens und der Praxis couragierten Einschreitens in Bedrohungssituationen nicht aus. Pädagogische Ansätze, die darüber hinausgehen, liegen für den schulischen – teils sogar den grundschulischen (vgl. Linke 1999) – und den außerschulischen Bereich vor, teils in Zusammenhang mit Trainings zur Deeskalation (s.o.), teils auch im Zusammenhang mit handlungsorientierter politischer Bildung (vgl. z.B. "Betzavta": Miteinander 1997, 95ff.). Sie fußen auf der Überzeugung, dass Zivilcourage erlernbar ist, sind aber größtenteils noch sehr tentativ angelegt. Einschlägige Projekte und Trainings üben u.a. ein (vgl. Beck/Müller/Painke 1994; AUS 1995; Gugel 1996; Lünse/Rohwedder/Baisch 1998; Linke 1999; Hron/Klemm 2000), zunächst kleine Schritte zu wagen, Anmachsituationen adäquat einschätzen und ihnen schnell begegnen zu können, die eigene Angst anzunehmen und zu bearbeiten, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu entwickeln, eigene Wertvorstellungen entwickeln, äußern und in Argumentieren und Handeln umsetzen zu können, Rückhalt in der Gruppe von Umstehenden zu suchen, gewaltlose Durchsetzungsstrategien in Konflikten zu entwickeln, über Perspektivenwechsel und empathisches Einfühlen die 'Wahrheit' des Anderen verstehen zu lernen, sich die Rechtslage zu erarbeiten. 110 Zivilcouragiertem Handeln lässt sich alltagsperspektivisch eine hohe, wenn auch situativ schwankende Erfolgswahrscheinlichkeit zuschreiben. Dennoch ist es weder selbst noch in seinen Schulungsformen wissenschaftlich als Anti-Gewalt-Maßnahme evaluiert. Daher sind auch leider die genauen Bedingungen (z.B. Anzahl der Angreifer, Verhalten des Opfers, Kompetenzen des Helfers, Reaktion der bystander etc.) unbekannt, unter denen es tatsächlich ausgrenzungs- und gewaltreduzierend wirken kann. Insofern erscheint es auch wohlfeil, einerseits das moralische Postulat der Zivilcourage von Seiten der Politik an die Bevölkerung aufrechtzuerhalten, andererseits aber Konstellationen für Erfolgswahrscheinlichkeiten entsprechenden Handelns im Dunkel zu belassen. Nicht unproblematisch sind in diesem Zusammenhang auch pädagogische Maßnahmen der Steigerung von Zivilcourage, wenn sie nicht genau angeben können, unter welchen Bedingungen aller Wahrscheinlichkeit nach ein Einschreiten den Selbstschutz gefährden und/oder zusätzliche Eskalationen produzieren kann. Dabei handelt es sich um Gefährdungen, die aus den weitflächigen Blindstellen evaluativer Erforschung couragierten Handelns und seines Erlernens resultieren. 3.1.7 Aufsuchende Arbeit Aufsuchende Arbeit stellt einen spezifischen Ansatz der Jugend(sozial)arbeit dar. Seine Pointe besteht darin, nicht zu warten, bis das Klientel in Räumlichkeiten der Jugendarbeit kommt (Komm-Struktur), sondern eine sog. Geh-Struktur aufzubauen, also als PädagogIn resp. SozialarbeiterIn dort hin zu gehen, wo Jugendliche sich aufhalten und treffen. Orte der Arbeit können somit Plätze, Straßen, Parks, Kaufhäuser, Kneipen, Spiel- und Sportplätze, Bushaltestellen, Diskotheken, Konzerthäuser etc. sein. PädagogInnen mischen sich zunächst als BeobachterInnen, dann als Gäste in die Lebenswelten Jugendlicher ein. Das Konzept erhält seine Eigenart also durch die Art der Zugangsweise zu seinen AdressatInnen. In Bezug auf rechtsextrem orientierte bzw. im Umfeld rechtsextremer Rekrutierungsversuche angesiedelte Cliquen bietet es sich deshalb an, weil hier mit einer 'Klientel' zu arbeiten versucht wird, die meistens schon durch die Raster anderer sozialer Einrichtungen (bspw. der offenen Jugendarbeit) gefallen ist und deshalb erhebliche Schwellenängste ihnen gegenüber aufgebaut oder schlicht Hausverbote auferlegt bekommen hat. Der Ansatz wird mit rechtsextrem orientierten AdressatInnen – im Regelfall (und nur erfolgversprechend) aus der unorganisierten Szene – seit Ende der 80er Jahre, verstärkt dann seit der ersten Hälfte der 90er Jahre verfolgt. Er trug wesentlich dazu bei, die vormalig unter PädagogInnen und SozialarbeiterInnen gängige Vorstellung, man könne mit 'Rechten' nicht arbeiten und die aus ihr resultierende symbolische oder faktische Einrichtung "nazifreier Zonen" innerhalb der Sozialen Arbeit abzulösen. Seine VertreterInnen reklamier(t)en dabei das Argument für sich, ohne eine Hinwendung zu diesen Jugendlichen, sie gänzlich ungeschützt der Ansprache durch 'rechte Rattenfänger' überlassen und insoweit den Offenbarungseid pädagogischer und Sozialer Arbeit schwören zu müssen. Bei Jugendlichen wurde von ihnen eine ideologische Sättigung oder gar Festlegung rechtsextrem konturierter Positionierungen nicht beobachtet. Zudem sei die Etikettierung und Stigmatisierung als "Neonazis", "Ausländerfeinde" u.ä.m. kontraproduktiv, liefere sie doch ohnehin identitätsunsicheren jungen Leuten nach dem Motto "Lieber ein Nazi als sonst gar nichts" ein willkommenes Identitätsangebot. Sozialwissenschaftliche Forschungen stützen die beiden zuletzt genannten Argumente mittlerweile stark (vgl. zusammenfassend: Möller 2000a). Zielgruppe sind zwar die Angehörigen beider Geschlechter. Faktisch wird aber wegen des deutlichen maskulinen Überhangs in der recht(sextrem)en Szene, speziell in ihrem durch sozial auffälliges Verhalten in Erscheinung tretenden Segment, ganz stark überwiegend mit 111 Jungen bzw. jungen Männern gearbeitet (vgl. aktuell auch Hafeneger u.a. 2002; zur Arbeit mit Mädchen vgl. aber: Lutzebäck u.a. 1995; Engel/Menke 1995; Bruhns/Wittmann 2002). Die Anzahl der Projekte schwankt; dies nicht zuletzt auch deshalb weil sie meist in 'Feuerwehrfunktion' dann zu Hilfe gerufen werden, wenn rechtsextreme Jugendliche offen agieren, die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam geworden ist, polizeiliche Mittel sich als unbrauchbar erwiesen haben und (Kommunal-)PolitikerInnen eine skandalträchtige Eskalierung zu vermeiden suchen. Außerdem sind die Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen meist befristet und nicht nur wegen der Klientel wenig attraktiv. Es gibt hier viele ABM- und BSHG-Stellen. Eine genaue Übersicht existiert nicht. Gegenwärtig dürften jedoch bundesweit nicht mehr als höchstens ein paar Dutzend Projekte laufen, nachdem – angeregt durch das AgAG-Programm und mitbedingt durch sein Auslaufen – bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre hinein noch mehr existierten. Zum Teil verbergen sie sich hinter dem politisch unspezifischen Label der 'Anti-Gewalt-Arbeit'. Die Philosophie der neuen Bundesprogramme, insbesondere von Civitas, erschwert es zudem auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, öffentlich zu ihrem Ansatz zu stehen (vgl. Heitmann 2002), so dass auch Selbstdefinitionen als Projekt mit rechten Cliquen eher vorsichtig gehandhabt werden. Eine eindeutige paradigmatische Zuordnung zu den Eckpunkten des oben aufgezeichneten pädagogisch-sozialarbeiterischen Diskursrahmens fällt schwer. Scheint deutlich zu sein, dass das Konzept bei Abwägung der Relevanz von Wissensvermittlung einerseits und Erfahrungslernen andererseits sein Schwergewicht auf die Waagschale des Erfahrungslernens legt – und zwar so, dass es seine Ganzheitlichkeit aus der Verortung im Alltag bezieht -, so pendelt es zwischen dem Angebot von Hilfe und dem von Gestaltungschancen hin und her. Der Versuch, Formate zuzuordnen, lässt deutlich werden, dass es sich um ein sehr komplexes Konzept handelt: Personale Unterstützung und Strukturverbesserung sind zwar von vorherrschender Bedeutsamkeit, jedoch werden projektförmig durchaus auch andere Formate aktiviert. Strategien kognitiver Information, damit verbundener politisch-moralischer Aufklärung und argumentativer Überzeugung werden – wenn überhaupt – allenfalls rudimentär in relativ späten Phasen gelungenen Vertrauensaufbaus und eher punktuell eingesetzt. Im Vordergrund steht zunächst eine auf Täter oder potenzielle Täter bezogene personale Zuwendung, die sich als Hilfe versteht und zentral auf die Vermittlung funktionaler Äquivalente für Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und andere Formen sozialer Abwertung und Ausgrenzung zielt. Der Ansatz baut auf der Analyse auf, dass die genannten Problem-Syndrome – auch konkret in der Lebensrealität ihrer Träger – in Erfahrungen politischer und sozialer Desintegration und daraus folgenden Anerkennungszerfalls verankert sind und daher ursachenbezogene Soziale Arbeit auf die Beseitigung sozialer Desintegration und die (Wieder-)Herstellung von sozialer Integration, Partizipation und Anerkennung gerichtet sein muss. Die Hilfsangebote sind deshalb nicht auf die Probleme bezogen, die 'die Rechten' der Gesellschaft schaffen, sondern auf jene, die sie selber haben. Zentrale Ziele und Handlungsansätze liegen auf sechs Feldern (ausführlicher: Krafeld/Möller/Müller 1993): Das Leben von auffällig rechtextrem orientierten Jugendlichen ist vielfach durch existentielle Instabilitäten, Konflikthaltigkeiten und andere Schwierigkeiten der Alltagsbewältigung gekennzeichnet. Diese rufen erhebliche Orientierungs- und Integrationsschwierigkeiten hervor, die wiederum durch fundamentalistische Gewissheiten rechter Couleur zugekleistert werden sollen. Deshalb wird zunächst einmal eine Sozialisations- und Alltagshilfe angeboten. Es geht dann um die Vermittlung von Arbeitsplätzen, von Wohnraum, von Therapieplätzen, um Aufarbeitung von zurückliegenden Straftaten, Ämterbegleitung u.ä.m. 112 Anliegen Sozialer Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen ist, dass sich die bei ihnen verbreiteten individuellen Selbstdurchsetzungsstrategien hin zu kooperativ verfasster Selbstorganisation öffnen. Cliquen werden deshalb zunächst nicht als 'Banden', 'Gangs' und Keimzellen rechtsextremer Selbstvergewisserung betrachtet. Statt nur als Gefährdungszusammenhänge sollen sie als Ressource zum Bezug von Kooperativität, Solidarität und Verantwortungsübernahme, manchmal als der letzte Ankerpunkt innerhalb eines sozialen Lebenskontextes, der ohne ihn das Individuum völliger Atomisierung freigäbe, in den Blick kommen. Insofern eine gewaltfreie Lebensgestaltung, die auf tragfähigen Beziehungsgeflechten aufbauen kann, bestimmter Voraussetzungen bedarf, wird das Erschließen und Entwickeln von zeitlichen, materiellen und sozialen Ressourcen verfolgt. Da es in beträchtlichem Ausmaß Gemeinschaftssurrogate und Kameradschaftsofferten sind, die Jugendliche in rechte Bezugsgruppen locken, sollen insbesondere zwischenmenschliche Verhältnisse erfahrbar gemacht werden, die zu pflegen sich lohnt. Vermittels Beziehungsarbeit sollen nicht nur Kontakte in die Szene hinein geschaffen und Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden. Sie dient auch dazu, Beratungs- und Verständigungszusammenhänge zu schaffen, die in der alltäglichen Lebensumwelt von Straße, Clique und (oft zerrütteter) Familie nicht existieren. Ausgewählte Aktivitätenangebote zielen nicht auf ein bloßes 'Beschäftigen' mit 'sinnvollen' Alternativen zu Pöbelei, Krawall und Randale ab. Vielmehr gelten sie als Medien, die den Jugendlichen über Erfahrungen gewaltfreien körperlichen Agierens, sozialer Wertschätzung und Gemeinschaftlichkeit Ressourcen- und Selbstwertzuwächse bescheren sollen. Ein spezifisches methodisches Repertoire wird nicht bemüht. Vielmehr werden diverse Methoden bedürfnis- und situationsorientiert eingebracht (etwa aus Erlebnis- und Sportpädagogik, Kulturarbeit, Deeskalations- und Anti-Gewalt-Trainings). Um der Pädagogisierungsgefahr zu entraten (die z.B. Hafeneger 1993 sieht), werden Strategien politischer Einmischung verfolgt. Sie haben zum Ziel, die politisch beeinflussbaren Lebensbedingen der Klientel im unmittelbaren Gemeinwesen und darüber hinaus so mitzugestalten, dass ein gewaltfreies Aufwachsen möglich wird. Der zuletzt genannte Punkt – aber auch Punkt 2 und 3 – verdeutlicht die Relevanz infrastruktureller Arbeit innerhalb des Konzepts und offenbart, dass im konzeptionellen Hintergrund das Hilfe- vom Gestaltungsparadigma ergänzt wird. Hilfe wird hier einerseits als personale Akzeptanzofferte verstanden, andererseits aber auf Dauer als Hilfe zur Selbsthilfe angelegt. Drei Ansätze markieren das Konzept: die "akzeptierende" bzw. "gerechtigkeitsorientierte" Jugendarbeit (vgl. Krafeld 1992a, b, 1996, 2001a, b, c), das Konzept "Milieubildung" (vgl. Böhnisch 1994, 1997; Seifert 1998) und die Mobile Jugendarbeit (vgl. vor allem Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit 1997; Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork 2002). Sie sind durchaus auch als Ergänzungen untereinander aufzufassen, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen liegen, indem sie eine personale Zugangsweise ("akzeptierende" Jugendarbeit), eine weiterreichende, auf die (Re)Konstruktion von sozialen Strukturen fokussierende Handlungsperspektive (Milieubildung) und ein jugendarbeiterisches Arbeitsfeld (Mobile Jugendarbeit) umreißen. Im Zusammenhang mit dem pädagogischen Rechtsextremismus-Umgang wird am breitesten öffentlich diskutiert – wenn man den Diskussionsprozess in seinen Einzelheiten verfolgt (dazu auch Krafeld 2001, 276 f.), wahrscheinlich gerade auch wegen der pointierten Selbstbezeichnung - das im Umfeld von Franz Josef Krafeld und der von ihm begleiteten Praxisprojekte in Bremen entstandene Konzept der "akzeptierenden Jugendarbeit". Einen 113 Begriff aufgreifend, der in anderen Feldern Sozialer Arbeit längst geläufig ist (vgl. "akzeptierende Drogenarbeit"), in Bezug auf rechtsextrem Orientierte aber ausgesprochen provokativ wirkt, setzt es die oben erwähnten Handlungsansätze mit spezifischer Akzentuierung um (vgl. v. a. Krafeld 1996). Ausgegangen wird von den zentralen Grundsätzen, dass wohlmeinende Belehrungen nicht gegen Erfahrungen ankommen, dass Ausgrenzungen aus den Bereichen von Pädagogik und Sozialer Arbeit Veränderungsmöglichkeiten verbauen, dass die subjektiven (politischen) Deutungen der Jugendlichen als Versuche zu werten sind, innerhalb ihrer Lebenswelt handlungsfähig zu bleiben und diese Deutungen in ihren Lebenszusammenhängen subjektiv funktional sind, dass sie durch Defizite sozialer Akzeptanz, sozialer Integration und demokratischer Beteiligung verursacht sind und dass deshalb zum einen pädagogisch diesen jungen Leuten gegenüber menschlich Akzeptanz zu zeigen ist, aber auch im Sinne von 'Verstehen, aber nicht einverstanden sein' (Bauriedl 1993; Gall 1997) "personale Konfrontation mit dem tiefgreifenden Anderssein" der PädagogInnen in ihren "Grundhaltungen, Wertorientierungen und Verhaltensweisen" erfolgen soll (vgl. ebd., 15) und dass zum anderen politische Einmischungen für und mit den Jugendlichen zur pädagogischen Aufgabe gehören. Daraus ergeben sich neben der oben schon als Handlungsebenen erwähnten Beziehungsarbeit und der infrastrukturellen Arbeit zwei weitere konkrete Handlungs- und Zugangsweisen: Bestehende Cliquen sollen als Selbstorganisationseinheiten Jugendlicher verstanden werden, die aus ihrer Sicht dazu dienen, "in einer Welt, in der sie sich ungeheuer vereinzelt fühlen, selbst soziale Zusammenhänge zu schaffen" (ebd., 19). Soziale Arbeit mit Rechten hat deshalb "cliquenorientiert" (vgl. Krafeld 1992b) zu erfolgen. Nicht Zerschlagung, sondern Arbeit mit ihnen heißt die Devise. Durch das Angebot von Räumen soll den Jugendlichen der Druck, der auf sie durch die gesellschaftliche Monofunktionalisierung von Raum und die Sanktionierung anderweitiger Raumaneignung ausgeübt wird, genommen werden. Sie sollen über eigene Treffs verfügen, aber auch darüber hinaus gewaltfrei Entfaltungsräume in ihren Wohnumfeldern gewinnen können. Die ab Herbst 1992 vernehmlich einsetzende Kritik an "akzeptierender Jugendarbeit mit Rechten" führt im wesentlichen zwei Argumente an, die jedoch erheblich unterschiedliches Gewicht haben: Eine eher oberflächliche, zumeist außerfachliche, nämlich von Medienvertretern getragene Kritik macht sich an der Verwendung des Adjektivs "akzeptierend" fest. Sie moniert, dass es Akzeptanz gegenüber Rechtsextremen nicht geben dürfe und führt Einzelfälle vor, in denen es entweder Rechtsextremen gelungen ist, als Sozialarbeiter für "Arbeit mit Rechten" eingestellt zu werden (so ein viel diskutierter Tagesthemen-Beitrag am 24.09.1992), oder wo schlecht oder gar nicht ausgebildete Kräfte unter dem Label "akzeptierender Jugendarbeit" entsprechende Jugendclubs betreuen, dies aber völlig konzeptionslos tun (vgl. Leif 1992). Eine Kritik an der Konzeption als solcher liegt also gar nicht vor. An dieser Stelle rächt sich die Missverständlichkeit des Begriffs "akzeptierend" im Umgang mit rechtsextrem Orientierten auf zweierlei Weise: Zum ersten drückt er die wichtige, ja zentrale Unterscheidung zwischen der Akzeptanz als Person und der Akzeptanz der von ihr vertretenen Haltungen und Verhaltensweisen nicht aus und öffnet damit im öffentlichen Diskurs Fehldeutungen Tür und Tor (vgl. dazu: Heitmann 2002; Norddeutsche Antifagruppen 2000, aber auch: Voß 1993). Zum zweiten erweist er sich als fatal, wenn einzelne 114 MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit öffentlich als Fachkräfte auftreten, dies aber faktisch aufgrund fehlender Qualifikation gar nicht sind. Fachkräftemangel und Qualifizierungsdefizite (vgl. Heitmann 2002), verschärft im Osten Deutschlands, aber nicht nur dort (vgl. Bremen 1995), führen so zu Diskreditierungen eines Konzepts, das nur dem Namen nach verfolgt, in seinen Bestandteilen aber offensichtlich gar nicht gekannt wird. Ein zweiter Kritikpunkt nimmt Bezug auf die spezifische Situation in Ostdeutschland. Er vermerkt, dass 'Rechtssein' dort unter Jugendlichen zum Bestandteil eines als 'ganz normal' angesehenen "lifestyles" geworden ist und sich in manchen Städten die rechtsextreme Strategie der "national befreiten Zonen" als erfolgreich erwiesen hat (vgl. Wagner 1998, 1999a, b). Die Diagnose einer solchen Zuspitzung der Gefährdungslage zieht die vor allem im Civitas-Programm umgesetzte Argumentation nach sich, dass der Aufbau demokratischer Gegenöffentlichkeit und die Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen sinnvoller, wenigstens aber zunächst vorrangig ist. F.J. Krafeld hat auf diese Kritik mit der Umbenennung seines Ansatzes von "akzeptierender" zu "gerechtigkeitsorientierter" Jugendarbeit reagiert (vgl. Krafeld 2000). Er verbindet damit "wichtige Präzisierungen und Pointierungen" (Krafeld 2001a, 287). Sie betreffen die Ansicht, dass Jugendarbeit sich "für die Rechte derer einsetzen muss, die verdrängt werden", die Gefahr einer kumpelhaften Anbiederung an rechtsextreme Jugendliche vermieden werden und das pauschale Gutheißen von cliqueninhärenten Verhaltensmustern unterbleiben muss (vgl. ebd., 288). Der zuletzt genannte Gesichtspunkt ist geeignet, auch jene Kritik aufzunehmen, die das bei Krafeld zu konstatierende, nahezu uneingeschränkt positive Verständnis von Cliquenorientierung mit dem Hinweis auf die Stabilisierungsfunktion, die Cliquen bei rechtsextremer und gewaltakzeptierender Positionierung erfüllen (vgl. z.B. Bohnsack u.a. 1995; Thornberry 1996; Ulbrich-Herrmann 1998; Kühnel 1998; Tillmann u.a. 1999; Eckert u.a. 1999; Möller 2000a, 2001a; Wahl u.a. 2001; Kerner u.a. 2001; Hafeneger u.a. 2002), bemängelt und dafür plädiert, nachdrücklicher als bislang in dieser Arbeit üblich Ablösungsprozesse in die Wege zu leiten (vgl. Wagner 1999; Möller 2002b). Eine konzeptionelle Neuorientierung ist mit dem Austausch von Bezeichnungen freilich noch nicht vollzogen; dies erst recht nicht, wenn mit den Forderungen nach Beziehungsarbeit, dialogischer Kommunikation zwischen PädagogInnen und Jugendlichen und der Dimension der politischen Einmischung Plausibles, aber doch Altbekanntes in leicht veränderter Diktion wiederholt (vgl. auch Krafeld 2001b) und neuerdings zudem mit der Metapher der "Zivilgesellschaft" angereichert wird (vgl. 2001c). Eine im engeren Sinne wissenschaftliche Evaluation "akzeptierender" bzw. neuerdings "gerechtigkeitsorientierter" Jugendarbeit liegt nicht vor. Auf der Suche nach einem geeigneten theoretischen Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen bieten sich die Überlegungen von Lothar Böhnisch (v.a. 1994 und 1997) zur "Milieubildung" an. Auf der Basis einer hier nicht darstellbaren, weil rahmensprengenden gesellschaftstheoretisch eingebetteten Interpretation aktueller gesellschaftlicher Gewaltphänomene und ihrer Hintergründe, für die Gewalt "nicht nur Ausdruck sozialer Desintegration, sondern gleichzeitig Medium sozialer Integration" (ebd.,149) ist (mit den primären Bezugspunkten von Individualisierungs- und Anomietheorie), sowie einer gründlichen sozialpolitischen Funktionsbestimmung aktueller sozialpädagogischer/-arbeiterischer Arbeit, die die aktuelle Krise der Wohlfahrtsgesellschaft und ihrer Normalitäts- und Normalisierungsversprechen analysiert, entwickeln sie einen arbeitsfeldübergreifenden Ansatz (vgl. zusammenfassend auch Möller 1999a). 115 Milieubildung meint danach den sozialen Prozess der strukturierenden Entwicklung eines sozialen Kontextes, der die biografisch verfügbare "räumlich und zeitlich begrenzte Nahwelt, ein besonderes psychosoziales Aufeinanderbezogensein, eine typische, meist gruppen- oder gemeinwesenvermittelte Gegenseitigkeitsstruktur, die emotional relativ hoch besetzt ist" (Böhnisch 1994, 217) umfasst (vgl. zur Abgrenzung von "Milieu" gegenüber "Gemeinschaft", "Alltag" und "Lebensstil" auch ebd. 199ff, 213ff., 218ff.). PädagogInnen vermögen ihn meist nur in geschlossenen Settings selbst zu initiieren; ansonsten ist ihre Funktion eher die einer stützenden und begleitenden Strukturierung. Soziale Arbeit zielt auf "offene Milieubildung", also auf eine Milieukonstruktion, die sich einerseits nach außen nicht die hermetische Abschirmung von der Außenwelt und anderen Milieus zum Ziel setzt und andererseits auch nach innen den gegenseitigen Respekt vor den integren Rechten der einzelnen Milieuangehörigen wahrt. Das Gegenbild dazu wären "regressive Milieus" z.B. ethnozentrischen oder autoritären Zuschnitts, die Kohäsion und Integrationsdruck über Unterdrückung und Ausgrenzung herstellen (vgl. Böhnisch 1994, 203 ff.; 1997, 280). Milieubildung besitzt nach Böhnisch vier Entwicklungsdimensionen: Eine "personal-verstehende" Dimension versucht im Sinne eines akzeptierenden Ansatzes die subjektive Funktionalität von Milieu für ihre Angehörigen zu entschlüsseln und damit Ressourcen ausfindig zu machen, auf die sich pädagogisch aufbauen lässt. Eine "aktivierende Dimension" betreibt die "Qualifizierung" des Milieus dahingehend, dass die darin versammelten Kompetenzen und Ressourcen handlungspraktisch für eine sozialintegrative Weiterentwicklung des Milieus aktiviert werden. Sie hat sich vor allem an zwei ethischen Leitlinien zu orientieren: an der "Autorität" gegenseitigen Respekts ("Respekt vor dem Wert Anderer"; ebd., 241) und an einer "reflexiven Ethik", für die "moralische Reflexivität" "in der Frage nach den Folgen des eigenen Tuns liegt" (ebd., 254). Die "pädagogisch-interaktive" Dimension reflektiert die Stellung des/der PädagogIn im Milieu, vor allem ihre/seine Erreichbarkeit und ihre/seine Fähigkeit, Plattformen des interaktiven Austausches zu schaffen, die ein Milieuklima des "Vertrauens", des "Gemeinschaftlichen", wenn nicht sogar der "Geborgenheit" sich entwickeln lassen können (vgl. zu diesen Begrifflichkeiten Böhnisch 1997, 282; 1994, 190ff., 199ff.). Die vierte Dimension besteht in "Ressourcenmanagement über die Milieugrenzen hinaus". Milieubildung geht an dieser Stelle in "Netzwerkbildung" über. Während Milieubildung auf den lebensweltlichen Nahbereich abzielt, in dem Gemeinschaftlichkeit und Gleichsinnigkeit emotional basiert sind, ist sozialpädagogische Netzwerkorientierung auf den Verbindungsbereich ("Mesobereich") zwischen Lebensweltlichem und SystemischGesellschaftlichem bezogen und aktiviert in Erweiterung der Milieuperspektive einen Austausch der Interessen. Es "wird eine 'zweite Ebene' eingezogen, d.h. die milieuverhaftete emotionale Dimension wird um die Interessendimension in ihren Grenzen erweitert, geöffnet und damit aktiviert" (ebd., 284). Gerade für cliquenförmige und ethnozentrisch angelegte Milieuformen gewaltakzeptierender Jugendlicher wird dadurch die Strategie verfolgt, "Erfahrungen (zu) vermitteln, daß man trotz seiner Lage den Anderen etwas zu bieten hat und daß andere Interesse an einem haben (Selbstwertdimension), daß man mehr davon hat, wenn man sich nicht über Gewalt und Abwertung Anderer oder in sozialer Isolation abgrenzt und abschirmt, sondern Beziehungen zu Anderen – auch Fremden – für sich nutzen kann und daß sich über ein solch milieuöffnendes Beziehungsnetzwerk bisher einander als fremd und ungleich Gegenüberstehenden ein neues Aktivitätsniveau öffnet" (ebd., 284f.). In dieser Weise bringt sich der/die PädagogIn in der Rolle eines/r sozialen AgentIn ein: Man bewegt sich "über den direkten Hilfebezug zu den KlientInnen hinaus ins Sozialräumliche" (ebd., 287). 116 Eine kritische Sicht auf Böhnischs Ansatz fördert folgende für unseren Zusammenhang wichtige Stärken zu Tage (zu kritischen Punkten siehe Möller 1999a): Auf der gesellschaftstheoretischen Ebene schafft der Ansatz einen unmittelbaren Anschluss an die individualisierungstheoretische Diagnose der Auflösung traditioneller Milieus. Das Erfordernis von sozialpädagogisch strukturierter Milieubildung ergibt sich ja – gesellschaftstheoretisch betrachtet – aus dem allmählichen Wegbrechen von lebensweltlichen Milieufunktionen, die nicht verzichtbar erscheinen. Die Kehrseite von Pluralisierung als Chance von Individualisierung ist nämlich das Risiko der Atomisierung bzw. des Rückzugs in regressive Milieus. Mit dem Angebot pädagogisch gestützter Übergangs-Milieus – dies ist der bessere Begriff als "Ersatz-Milieus", weil damit suggeriert werden könnte, 'neue' Milieus könnten mehr oder weniger nahtlos 'alte' Milieufunktionen übernehmen und weil das Missverständnis auftauchen könnte, Sozialpädagogik stelle diese Milieus selber her, liefere sie quasi als Ersatz an die Betroffenen und sei für ihre Abstützung auf Dauer unerlässlich – nimmt Sozialpädagogik diese zentrale historische Herausforderung auf. Durch die sozialpolitische Analyse von (post)wohlfahrtsstaatlicher Politik und die Diagnose einer Entstrukturierung und Pluralisierung sozialer Integration öffnet Böhnisch die Sicht auf Gewalt als Integrationsmedium: Gerade weil andere, befriedigende Formen der sozialen Integration fehlen, wird danach eine segmentierte Integration über Gewaltförmigkeit angestrebt. Auf der Ebene sozialpädagogischer Konzeptentwicklung legt Böhnisch ein Modell vor, das zentral die Erfordernisse individueller Handlungsfähigkeit und sozialer Integration systematisch aufeinander bezieht: Es bezieht damit nicht nur Individuelles und Soziales aufeinander, sondern erweist sich damit auch – im übrigen ebenfalls an anderen Stellen, vor allem bei der Akzentuierung der Bedeutung von Selbstwert und Anerkennung – als kategorial anschlussfähig an vergleichsweise gut abgesicherte theoretische Überlegungen wie empirischen Befunde (vgl. insgesamt Schubarth 2000; Interdisziplinärer Forschungsverbund 2001). Es bewegt sich auf der Ebene der Pädagogik funktionaler Äquivalente. Sie schließt ein, ein als problematisch erachtetes Verhalten in seiner Funktionalität für das Subjekt zu entschlüsseln, um Alternativen von vergleichbarer Funktionalität außerhalb von Problembereichen anbieten zu können. Es handelt sich um ein Konzept, das nicht nur auf Jugendarbeit zugeschnitten ist, aber gerade auch Jugendliche als Zielgruppe ins Visier nimmt. Es ist ebenfalls nicht problemspezifisch zugeschnitten, verweist aber an vielen, im obigen aus Platzgründen nicht immer erwähnten Stellen speziell auf sozialpädagogische/-arbeiterische Reaktionsnotwendigkeiten und –möglichkeiten in Bezug auf Gewaltprobleme und ethnozentristische Ausgrenzungshaltungen. Es reflektiert – mehr als in diesem kurzen Abriss darstellbar – alle eingeführten kategorialen Begrifflichkeiten und wichtigen Aussagen in Hinsicht auf ihre geschlechtsspezifische Bedeutung. In der Verbindung von Milieubildung und Netzwerkorientierung führt es die Notwendigkeit vor, eine akzeptierende Haltung cliquenorientierter Jugendarbeit (vgl. Krafeld 1992a, b) durch die Perspektive der Milieuöffnung zu ergänzen und zu begrenzen. Freilich gilt, dass Böhnisch bestenfalls theoretisch zu plausibilisieren, aber nicht empirisch zu erhärten vermag, dass der Ansatz der Milieubildung ertragreich sein kann, auch und gerade als pädagogische Umgangsweise mit den Problemen von Gewalt und Rechtsextremismus bei Jugendlichen. 117 Wenn er für die u.a. sozialpädagogisch zu bewerkstelligende Erweiterung von Handlungsfähigkeit, Selbstwert und soziale Anerkennung plädiert, benennt er zwar fundamental wichtige Distanz- und Distanzierungsfaktoren, kann aber nicht mit hinreichender Seriosität erfahrungswissenschaftlich fundierte Aussagen über die alters- und geschlechtsspezifische Profilierung dieser Faktoren sowie die sozialen und individuellen Bedingungen ihrer Prozessierung treffen. Das sozialpädagogische Konzept kann deshalb an dieser Stelle von ihm nicht ausdifferenziert werden. Eine Evaluation von Projekten, die mit dem Konzept arbeiten, liegt außerdem bisher nicht vor, sieht man von der in dieser Hinsicht nicht sonderlich ertragreichen wissenschaftlichen Begleitung des AgAG-Programms ab (s.o.). Das Konzept der Mobilen Jugendarbeit bietet ein – mit Schwerpunkt in Baden-Württemberg – besonders weit entwickeltes Konzept der aufsuchenden Sozialarbeit. Stärker als die Offene Jugendarbeit, die Jugendbildungsarbeit und Jugendverbandsarbeit als die anderen großen außerschulischen Arbeitsfelder von pädagogischer Arbeit mit Jugendlichen dies tun (können), strebt es die Reduktion von Jugenddelinquenz und kriminalisierenden Kontakten generell, aber u.a. auch von Phänomenen rechtsextremer Tendenzen bei Jugendlichen an (vgl. Piaszczynski 1993; Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit 1997; Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork 2001; Gangway 2001). Theoretisch knüpft Mobile Jugendarbeit an US-amerikanische Studien (z.B. Spergel 1966), sozialräumliche Konzepte und in Hinsicht auf Rechtsextremismus am deutlichsten an individualisierungstheoretisch inspirierte Forschungen (vgl. schon Heitmeyer 1987) an. Vorgehensweisen, Zielgruppen und Aktivitätsfelder lassen sich im Überblick wie folgt beschreiben: Im Sinne von Lebenslagen- und Lebensfeldorientierung wird der Fokus auf die lebensbestimmenden Existenzbedingungen und Orte des Aufwachsens von Jugendlichen gelegt. Die dort entstehenden bzw. auftretenden Bedürfnisse und Problemlagen junger Leute aufgreifend, soll Kontaktaufbau und Beziehungsarbeit im Sozialraum geleistet werden, um Gefährdungen 'gelingender' Sozialisation und soziale Benachteiligungen vermeiden bzw. abbauen zu helfen. Besondere Bedeutung erhält dabei die Orts- und Stadtteilorientierung. Sie meint nicht nur eine sozialräumliche Bezugnahme der Arbeit mit Jugendlichen im engeren Sinne, sondern auch das gezielte Anstreben einer Kooperation mit anderen sozialen Einrichtungen im Einzugsbereich. Sie wird gerade auch mit dem Ziel unternommen, deren Öffnung für die Lebenslagen sog. 'schwieriger' Jugendlicher, der hauptsächlichen Adressatengruppierung Mobiler Jugendarbeit, zu erreichen. Im Zentrum der Aktivitäten stehen vier miteinander verbundene Felder: Streetwork, Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe und Gemeinwesenarbeit. Der mobile Charakter des Ansatzes kommt vor allem durch Streetwork zum tragen. Mehr oder weniger regelmäßig werden Jugendcliquen des Einzugsgebiets an ihren Treffpunkten (z.B. Straßenecken, Parks, Kaufhäuser, aber auch Schulhöfe) aufgesucht. In der Praxis führt solche Straßensozialarbeit, da sie im Regelfall über kurz oder lang mit dem Angebot von Räumen – meist im Gebäude der jeweiligen Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit – verbunden ist, nicht allein zu losen Kontakten zu Cliquen, sondern auch zu dauerhafteren Bindungen zwischen SozialarbeiterIn und Jugendlichen (zu Zielen, Leistungsangeboten, Rahmenbedingungen, Qualitätsmerkmalen und Standards von Straßensozialarbeit vgl. auch eingehender und zugleich praxisbezogen: Gangway 2001). Es findet nun eine sog. Clubarbeit statt. Dahinter verbirgt sich eine einrichtungsgebundene Arbeit mit lebensweltlich gewachsenen Cliquen, immer häufiger aber auch mit in ihrer Zusammensetzung auch pädagogisch beeinflussten Gruppen. Ziel ist es, den Zusammenhalt der Jugendlichen - wenn man so will: die Selbstheilungskräfte der Gruppe - zu stärken, indem 118 das Identitätsverständnis eines relativ geschlossenen Clubs aufgebaut wird. Dem dienen nicht nur eine Namensgebung, die Regelmäßigkeit von Treffs, gemeinsame Unternehmungen und die Abstimmungsprozesse darüber, sondern auch die Erarbeitung eines Regelwerks für das Clubleben und gemeinsame Entscheidungen über die eventuelle Aufnahme neuer Mitglieder. Durch die damit gegebenen persönlichen Kontakte zur pädagogischen Bezugsperson des Clubs können Vertrauensbeziehungen wachsen, die erfahrungsgemäß relativ rasch in Einzelfallhilfen bzgl. von Problemen mit z.B. Schule, Arbeit, Eltern, Polizei, Gericht etc. münden. Da innerhalb des Konzepts sog. Jugendprobleme als Ausdruck von Problemen des Gemeinwesens begriffen werden, verbietet sich eine ausschließlich jugendzentrierte Arbeit. Phänomene wie Gewalt, Kriminalität oder Drogenkonsum, die sich bei jungen Leuten zeigen, werden als Indizien dafür gewertet, dass die Sozialraumbedingungen Jugendlicher nicht im Lot sind, d.h. ein von gravierenden Problemen freies Aufwachsen nicht gewährleisten. Entsprechend wird mittels Vernetzung und politischer Einmischung (bspw. über Stadtteilkonferenzen und Runde Tische) nicht allein eine Reduktion akuter Konfliktlagen, sondern auch eine nachhaltige Verbesserung der Sozialisations-Ressourcen des Gemeinwesens angestrebt. Dazu gehört basal auch, das Gemeinwesen mit seiner Verantwortung für die Lösung von Jugendproblemen und darüber hinaus für die offensive Gestaltung möglichst gewaltfreier Sozialisationsverhältnisse zu konfrontieren und seine Einrichtungen und Vereinigungen in geeignete Bearbeitungsstrategien entsprechend einzubinden (ggf. auch über eine (Teil-)Trägerschaft der Mobilen Jugendarbeit vor Ort gemeinsam mit Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden u.ä.). So wie eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Evaluation des gesamten Ansatzes Mobiler Jugendarbeit nicht vorliegt, so sucht man auch Evaluationsergebnisse einer in seinem Rahmen stattfindenden sozialen Arbeit mit Recht(sextrem)en vergeblich. Dies gilt noch trotz erster Ansätze ihrer Etablierung – primär unter dem formativen Gesichtspunkt der Optimierung der eigenen Arbeit, z.B. in Stuttgart oder Berlin - durch Feldanalysen, Teamtagebücher und –besprechungen, systematische Arbeitsdokumentationen der einzelnen MitarbeiterInnen, Interviews mit NutzerInnen der Angebote in den jeweiligen Handlungsfeldern, quantitativ-statistischen Erhebungen und nach Evaluations- bzw. Qualitätsentwicklungsaspekten strukturierte Jahresberichte (vgl. Gangway 2001). Nicht nur Mobile JugendarbeiterInnen und deren Anstellungsträger selber, sondern vielerorts auch Polizei und Politik bezeugen allerdings seine delinquenzreduzierende Funktion, die teilweise (z.B. in Stadtteilen Stuttgarts) auch schon kriminalstatistisch belegt worden ist. Ungeachtet dessen, dass die Evaluation aufsuchender Arbeitsansätze insgesamt erheblich unterentwickelt ist: Aus den statistischen Erhebungen von Gangway e.V. weiß man, dass rund 80% der befragten SozialarbeiterInnen in Ostdeutschland mit 'rechtem' Klientel arbeiten. Und die Veröffentlichungen von Krafeld/Möller/Müller (1993, 1996) und Klose u.a. (2000) bieten immerhin annähernd verallgemeinerbare Zusammenfassungen der bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre gemachten Erfahrungen von Projekten in rechten Szenen. Schwerpunktmäßig mit qualitativer Auswertung von Gruppendiskussionen mit MitarbeiterInnen und von Dokumentationsbögen operierend, können sie allerdings auch keine Erfolgsvermessung im engeren Sinne bieten. Danach erreicht aufsuchende Arbeit eher Jungen (so auch die statistischen Auswertungen des AgAG-Programms, die bei den erreichten 6.500 – 8.000 Jugendlichen unter 16 Jahren 70% Jungen verzeichnen). Es zeigt sich im allgemeinen – freilich nicht bei allen Jugendlichen, die betreut werden – während der Projektlaufzeiten eine Auflösung rechtsextremer Verankerungen und eine Reduktion der Intensität von Gewalthandlungen – so auch im AgAG-Projekt -, wobei sich freilich bislang nicht differenziert angeben lässt, ob dieser Orientierungsumschwung überhaupt mit Sicherheit auf 119 pädagogische Interventionen und, wenn ja, auf welche zurückzuführen ist. Dessen ungeachtet scheint weniger kognitive Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit erfolgversprechend zu sein als das Angebot von Räumen sowie einer lebensweltorientierten Alltags- und Sozialisationshilfe, gepaart mit politischen Einmischungsstrategien, die die Problem- und Konfliktlagen entsprechend orientierter Jugendlicher zu entschärfen trachten. Ob aufsuchende Arbeit in rechten Szenen jedoch mehr erreichen kann als eine durchschnittliche Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten, also etwa auch nachhaltig in Kraft bleibende Umorientierungen auf der Einstellungsebene, bleibt vorläufig dahingestellt (vgl. auch Scherr 1993). Außerdem ist bis heute die wichtige Frage unbeantwortet, in welcher Weise mittels geschlechtsreflektierender Jungen- und Männerarbeit der weit überproportionale Anteil von Jungen und Männern in der recht(sextrem)en Szene angegangen werden kann (vgl. auch Möller 2000c). Als Fazit ergibt sich: Auch wenn im engeren Sinne aufsuchende Arbeit in rechten Szenen evaluative Bewährungsproben mangels solcher Bestrebungen und eindeutiger Zurechnungskriterien für Erfolg noch nicht bestanden hat, ist das Konzept weithin anerkannt, aus der Landschaft deutscher Jugendarbeit nicht mehr wegzudenken und weiter entwicklungsfähig. Dies bestätigt auch die Einschätzung des Auswärtigen Amtes in seinem 15. Bericht der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 9 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 16.06.2000 (vgl. www.auswaertiges-amt.de/infoservice/download/pdf/mr/bercerd.pdf, 35). Dem kann auch die Beobachtung nicht entgegengehalten werden, wonach fremdenfeindliche und gewalttätige Jugendliche besonders häufig von der Jugendhilfe betreut werden (vgl. z.B. Frindte u.a. 2001). Bekanntermaßen hält Jugendhilfe ihre Maßnahmen gerade für benachteiligte und besonders gefährdete Jugendliche vor, so dass die Wahrscheinlichkeit, bei Tätern Jugendhilfe-Sozialisation zu registrieren, deutlich überproportional ist. Daraus abzuleiten, Jugendarbeit mit rechten Cliquen erfülle geradezu kontraproduktive Funktionen, wie dies Wagner u.a. (2001, 315) andeuten, entbehrt der Grundlage. Evaluationen sind gleichwohl dringend geboten. Dies gilt um so mehr, als sich aus einer amerikanischen Totalerhebung von 254 Programmen in 53 (Groß-)Städten über die Effektivität von repressiven und problemgruppenzentriert-sozialarbeiterischen Strategien der Reduzierung von Jugendgewalt ergibt, dass die Verantwortlichen sie solange für relativ unwirksam halten wie sie nicht durch 2 weitere Strategien ergänzt werden: die Schaffung von besseren Lebenschancen für junge Leute und die Mobilisierung der sozialen Umfelder und der gesamten zivilen Öffentlichkeit (vgl. Spergel/Curry 1990). 3.1.8 Körper- und bewegungsorientierte Konzepte von Erlebnis-, Abenteuer- und Sportpädagogik Die pädagogische Vermittlung spannender und abenteuerlicher Erlebnisse hat sich bekanntlich seit längerem (vgl. z.B. Weber/Ziegenspeck 1983; Ziegenspeck 1983; Fischer u.a. 1985; Bauer 1985), meist rekurrierend auf Kurt Hahns "Erlebnis-Therapie" aus körperlichem Training, Projektarbeit, Expedition und Dienst am Nächsten, teils als Methode, teils eigenständiges Arbeitsfeld in der Jugendarbeit etabliert. Als Umgangsweise mit gewalttätigen und speziell rechts(extrem) orientierten Jugendlichen (vgl. z.B. Behn/Heitmann o.J.; Nickolai 1991) bietet sie sich deshalb an, weil sie beansprucht, solche Erfahrungshintergründe des Aufwachsens aktiv angehen zu können, die auch als Ursachenfaktoren und Auslösezusammenhänge für politisch rechts gewirkte Gemeinschaftssehnsüchte und gewalthaltige Randale ausgemacht werden können, wie z.B.: Denaturalisierung, Urbanisierung und Monofunktionalisierung von Räumen; 120 Durchrationalisierungen und Verregelungen von Zeit, Lernprozessen, Anerkennungsformen und sozialen Beziehungen; Bewegungsarmut und Mangel an Naturerfahrungen; Dominanz von Erfahrungen aus zweiter Hand, vor allem über Konsum, Medien und Pädagogisierung; Vereinzelung, Vereinsamung und Orientierungs- wie Sinnverlust. Erlebnis- und Abenteuerpädagogik will dagegen, etwa in steiler Felswand oder auf hoher See, eine kontrafaktische Gegenkultur setzen, die unmittelbare, ganzheitliche und überschaubare Lernsituationen mit Ernstcharakter und Entscheidungsdruck offeriert (vgl. Thiersch 1993). Sie erfordern u.a.: Sich-Einlassen auf Natur-Umgebungen, Vitalisierung des Körpers, Mitgestaltung der Situation statt Konsum, ganzheitliche Erfahrung von Freizeit und Arbeit, Kooperation, Selbstorganisation und gewaltfreie Konfliktregelung in der Gruppe. Die TeilnehmerInnen sollen dabei lernen (vgl. Becker 1993), sich eigeninitiativ, aktiv und konstruktiv mit der Welt auseinander zu setzen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Situationen mit eigenen Fähigkeiten kontrollieren zu können, Hilfe und Sicherheit im Gemeinschaftsgefüge zu erfahren, eine kritische Reflexion eingeschliffener Auffassungen, Rollen und Verhaltensweisen vorzunehmen, mit Stressanforderungen umgehen zu können, Toleranz, Akzeptanz und Rücksichtnahme zu zeigen. In Abgrenzung zu rechtsextremen Angeboten von action und Abenteuer gibt es (vgl. Fischer u.a. 1985) kein Befehl-Gehorsam-Prinzip, keine aus der Selbstverantwortung entlassende Hierarchie, keine Angebote simpler Gewissheiten und Weltbilder, keine Mutproben und individualisierenden Wettkämpfe. 'Gute' Erlebnispädagogik mit 'schwierigen' Jugendlichen in Jugendhilfemaßnahmen fühlt sich dabei Erfolgsvariablen und Standards verpflichtet, wie sie Klawe (1998, 480) auflistet: Strukturelle Faktoren: Entscheidungsprozeß und Partizipation der Adressaten Auswahl der Zielgruppe Freiwilligkeit der Teilnahme Zeitliche und räumliche Distanz zum Milieu Angemessene Vorbereitung der Maßnahme Kontinuität und Qualität in den Beziehungen Alltagsbezug, Nachbetreuung und Transfer Fachaufsicht, Kontrolle und Supervision Qualifikation der Betreuer/-innen Besondere Bedeutung des Auslands Interne Faktoren Ausreichender Raum zum Handeln 121 Transparenz des Handlungsfeldes Erfahrungen und Umgang mit Grenzen Flexibilität und individuelle Ausrichtung Beschulung oder Ausbildung Die Kritik an einer Bekämpfung des Rechtsextremismus- und Gewalt-Problems mittels Erlebnispädagogik zitiert zum einen die bekannten Einwände gegenüber der Erlebnispädagogik: Sie sei bloße Kurzzeitpädagogik, löse das Problem des Transfers in den Alltag nicht und mache bestenfalls abenteuersüchtig. Bezogen auf rechtsextreme Klientel werden zum anderen zusätzliche Gefahren darin erkannt, dass hier rechte Männlichkeitsmythen über das Aufsuchen von Grenzsituationen körperlicher Belastbarkeit eher verstärkt werden, Natur- und Lagerfeuerromantiken deutschtümelnd "umkippen" und körperliche Trainings zudem für Krawallaktionen genutzt werden könnten (Möller 1996). Themenspezifisch fokussierende Evaluationen zu den gewaltpräventiven oder –interventiven Effekten von Erlebnispädagogik liegen im deutschen Sprachraum nicht vor. Selbst Evaluationen von Erlebnispädagogik überhaupt sind rar. Nach unseren Recherchen ist eine der letzten Arbeiten dieser Art die methodisch triangulative Totalerhebung von Jagenlauf (1990, 1992), die sich auf die Aktivitäten der erlebnispädagogischen Einrichtung "Outward Bound" zwischen 1985 und 1989 bezieht, im Regelfall 12-tägige Kurse mit – auch nach regionaler Herkunft – heterogen zusammengesetzten Gruppen. Danach "überschätzt die generelle Wirksamkeit kurzzeitpädagogischer persönlichkeitsbildender Maßnahmen", wer glaubt, im erlebnispädagogischen Labor Gelerntes könne "mit einem Test als signifikante Verhaltensveränderung gemessen werden" (Jagenlauf 1992). Dessen unbeschadet ist nach dieser Studie Erlebnispädagogik ein "Impuls-Effekt" zuzusprechen. Er besteht für mindestens ca. die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen darin, sich "für einige Zeit" nach der Kursteilnahme mit den eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen auseinander zu setzen und die Lebensgewohnheiten wie "die sozialen Beziehungen neu zu bewerten oder zu ändern" (ebd.). Konkret steigt vor allem die Fähigkeit zu Ausdauer und sozialem Umgang, Selbstsicherheit, Körperbewusstsein und Sorgfalt. Allerdings wird u.a. zweierlei eingestanden: zum ersten, dass noch zu erklären ist, ob die Effekte nicht einfach durch "flow" (vgl. Csikszentmihalyi 1985), also schlicht durch das Erfahren von Gipfelerlebnissen und nicht spezifisch durch ihre pädagogische Begleitung zustande kommen; zum zweiten, dass Wirkungen bei spezifischen Gruppen, z.B. solchen "mit ungenügenden Interaktionsfähigkeiten" (Jagenlauf 1992), also gerade von Klientel, das sich im Dunstkreis rechtsorientierter und gewaltbereiter Jugendgruppen findet (vgl. z.B. Möller 2000a, 2001), ununtersucht blieben. Gewisse Aufschlüsse lassen sich allerdings gerade für 'schwierige', wenn auch nicht unbedingt 'rechte', gewalttätige oder fremdenfeindliche Jugendliche aus den Ergebnissen einer 1998 abgeschlossenen zweijährigen Evaluationsstudie zur "Erlebnispädagogik in den Hilfe zur Erziehung" gewinnen (vgl. Klawe 1998). Danach sind nach Wahrnehmung der betroffenen Jugendlichen Gefühle gewonnener Selbstwirksamkeit die wichtigste Erfahrung in erlebnispädagogischen Projekten. Stellt man in Rechnung, dass Gewaltsamkeit häufig gerade auch sie und die damit verbundenen positiven Emotionen und Körpererfahrungen vermitteln helfen soll (vgl. Sutterlüty 2000; Eckert/Steinmetz/Wetzstein 2001), lässt sich Erlebnispädagogik als Pädagogik funktionaler Äquivalente begreifen. Allerdings setzen erwartbar positive Wirkungen bestimmte Konstellationen des settings voraus. Es sind nämlich (wohl nicht nur) im Bereich der "Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung" (ISE; siehe § 35 KJHG) kontraproduktiv: 122 hoher Zeitdruck, verbunden mit einer kurzen Zeitspanne zwischen der Entscheidung und der Realisierung einer Maßnahme (40% der Entscheidungen für eine erlebnispädagogische Maßnahme der Jugendhilfe werden in aktuellen Krisensituationen gefällt), institutionelle Handlungsbedarfe, insbesondere Unterbringungszwänge, die zu einer Instrumentalisierung erlebnispädagogischer ISE als Ersatz für geschlossene Unterbringung führen, unzureichende Partizipation des Adressaten im Hilfeplanverfahren, ungesicherte Vorbereitung, Kontinuität und fachliche Beratung der Betreuung, überzogene und unreflektierte Erwartungshaltungen an die Beziehung zwischen Jugendlichem und Fachkraft sowie die Entwicklung einer alltagstransferierbaren Beziehungsfähigkeit und mangelnde Vorbereitung der back-home-Situation durch Außerachtlassen von Veränderungserfordernissen im Herkunftsmilieu. Daraus ist die Schlussfolgerung zu ziehen, Erlebnispädagogik nicht als 'Königsweg' zu betrachten, sondern im Repertoire einer Vielzahl von Maßnahmen dann zum Zuge kommen zu lassen, wenn eine individuelle Indikation dafür erstellt werden kann, Rahmenbedingungen stimmig sind, zusätzlich Veränderungsprozesse und Aktivierungen von Ressourcen im Lebensweltzusammenhang des Jugendlichen erfolgen und Kooperationen gesucht werden, die erlebnispädagogische Maßnahmen systemisch einbinden. In Nordamerika ist die Evaluationslandschaft auch in Bezug auf Erlebnispädagogik ausgedehnter, obwohl Davis-Berman/Berman/Capone (1994) in ihrer Untersuchung aller erlebnispädagogischen Programme der Mitglieder der "Association of Experiental Education" bemängeln, dass tragfähige, Kontrollgruppen einbeziehende Methoden zur Evaluation außerhalb simpler Pre-Post-Testverfahren selbst hier kaum vorhanden sind. Immerhin ergeben verschiedene Studien mit 'schwierigen', delinquenten und straffällig gewordenen Jugendlichen (vgl. Kelly/Baer 1968; Boudette 1989; Durgin/McEwen 1991; Bartel 1996), dass vor allem Selbstvertrauen und Gruppenfähigkeit gesteigert werden zu können scheint und delinquentes Verhalten zurückgeht (zu weiteren, z.T. allerdings auch weniger positiven Untersuchungsergebnissen vgl. auch Rehm 1998). Dies gilt zumindest, wenn gut ausgebildete TrainerInnen zur Verfügung stehen, adäquate Selbstwirksamkeitserlebnisse durchlaufen worden sind und eine Nachbetreuung gegeben ist (vgl. ebd.). Durchaus ähnlich wie erlebnis- und abenteuerpädagogische Konzepte argumentieren Ansätze im Bereich des Sports. Allerdings stehen hier naturgemäß stärker Überlegungen zu Körperlichkeit und Bewegung im Vordergrund. Insbesondere dort, wo eine rechtsextreme Ideologie in eigene physische Gewaltsamkeit übergeht, konstatiert man aus dieser Sicht eine Fehlleitung körperlicher und motorischer Bedürfnisse (vgl. auch Klose u.a. 2000, 42 ff.). Als Hintergrund dessen wiederum gilt eine im Laufe des Zivilisationsprozesses sich herausbildende allgemeine Überbetonung rationaldistanzierender Kulturtechniken und körperferner abstrakt-symbolischer Lerninhalte für die nachwachsende Generation. Technische Innovationen entlasten die muskuläre Beanspruchung im Bereich der Arbeit, das ausgebaute Verkehrswesen beschneidet ursprüngliche motorische Erfahrungen, körperliche und sinnliche Erfahrungen werden immer mehr durch telekommunikative Surrogate ersetzt (vgl. Pilz 2002a). 123 Der Monotonie von anregungsarmen Nah- und Bewegungsräumen des jugendlichen Aufwachsens in verkehrsgerechten Städten sind vorwiegend Jugendliche aus sozialen Randlagen ausgesetzt. Sie treibt körperlich spürbare Erlebnisdefizite hervor, die nach Kompensation durch Risikohandlungen von hoher Erlebnisintensität rufen; um so mehr als der gesellschaftlich akzeptierte Bereich körperlicher Betätigung, der Sport, immer mehr zum Zuschauersport verkommt, als Schulsport zu veröden droht sowie selbst technisiert und konsum-kulturell vereinnahmt wird. Als Risikohandlung par excellence aber bietet sich Gewaltsamkeit an, denn: die Teilnahme an ihr kann relativ voraussetzungslos erfolgen, weil der Körper als Kapital eingesetzt werden kann; sie wird über mediale Vorbilder symbolisch-kulturell deutbar; sie bietet Attraktionserwerb und Durchsetzungserlebnisse jenseits gesellschaftlicher akzeptierter Leistung; sie verspricht sinnlich-emotionale Erlebnisse höchster Intensität bis hin zu Euphorie und zur Lust (vgl. Buford 1992); sie testet die Grenzen körperlicher Belastbarkeit aufs äußerste; sie erfordert den ganzen Menschen, den "ganzen Kerl" und sie schafft Nähe und Körperkontakt unter Männern. Sport wird zugesprochen, demgegenüber "große Möglichkeiten" der primären, sekundären und tertiären Gewaltprävention zu eröffnen. "Durch sportlichen Aktivität können (Hervorhbg. i. Orig.): Aggressionen und motorischer Betätigungsdrang 'gesteuert' abgearbeitet, als Äquivalent zur Problematisierung vorhandene körperliche Fähigkeiten positiv eingesetzt, mit vertrauter Betätigung Schwellenängste gegenüber dem sonstigen Angebot abgebaut, die Beziehungen von Jugendlichen (vor allem aus Randgruppen) untereinander, zu ihrer Umwelt und zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geübt und verbessert, die Identifikation mit den sozialen Einrichtungen (z.B. Jugendzentrum) verbessert, bzw. oft erst hergestellt und verstärkt werden, das Akzeptieren vorhandener Regeln erlernt, Erfolgserlebnisse erzielt werden" (Pilz 2002a). Aus sportwissenschaftlicher Sicht muss aber vor voreiligen Erwartungshaltungen gewarnt werden. "Sport wirkt wie eine Schutzimpfung gegen soziale Auffälligkeit" (Jochen Welt, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung; ähnlich Christian Pfeiffer), "Gerade der Sport kann ... dazu beitragen, vorhandene Vorurteile und Angst vor Fremden abzubauen" (Bundesinnenminister Otto Schily) und "Sportvereine sind in unserer Gesellschaft Integrationsfaktor Nummer eins" (Manfred von Richthofen, Präsident des Deutschen Sportbundes; zit. n. Pilz 2002) – solchen Hoffnungen ist aus dieser Sicht mit größter Skepsis zu begegnen. Denn in der Jugendarbeit der Sportvereine klaffen offensichtlich Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander (vgl. auch die Wanderausstellung "Tatort Stadion. Rassismus und Diskriminierung im Fußball" des "Bündnisses aktiver Fußballfans" (BAFF)). Im Gegensatz zu der dem Sport zugedachten Integrationsfunktion sind besonders gefährdete Jugendliche aus gesellschaftlichen Randlagen und in schwierigen Lebenssituationen hier deutlich unterrepräsentiert (vgl. Deutsche Sportjugend 1998; Brettschneider/Kleine 2001). Zudem muss wohl mit Grupe (2000) zwischen "Sportkultur" und einer "Kultur des Sports" unterschieden werden. Während der letztgenannte Terminus die traditionelle Werte des Sports (Fairness, Teamgeist usw.) umschreibt, meint "Sportkultur" die Realität des Sports mit all ihren positiven, aber auch negativen Begleiterscheinungen. Diesbezüglich kann nicht darüber 124 hinweggesehen werden, dass sich innerhalb von "Sportkultur" auch eine Kultur der Gewalt realisiert. Ihre Reproduktion wird nicht zuletzt durch die "Moral des fairen Fouls" (Pilz 1999) gesichert. Ein Umschlagen von "Sportkultur" in problematische Verwendungen von Sport kann wohl auch deshalb leicht erfolgen, weil der Sport selbst mit Lorenz triebtheoretisch als "Ventil für gestaute Aggressionen", ritualisierte und zeremonielle Kampfform, ja als "Krieg ohne Schießen" (Orwell) begriffen werden kann (vgl. zum Zusammenhang von triebtheoretischen Erklärungen und gewaltpräventiven Konsequenzen in Hinsicht auf die Befriedigung von Abenteuer- und Bewegungsbedürfnissen durch Erlebnis- und Sportpädagogik kurz: Schubarth 2000, 14f.). Auch im Hinblick auf das Management multikultureller Konflikte im Sport bestehen erhebliche und sich zuspitzende Probleme (vgl. Bröskamp/Alkemeyer 1996; Klein/Kothy 1998; Pilz/Schick/Yilmaz 2000). Insofern kann nicht verwundern, wenn eine aktuelle Evaluation der Jugendarbeit von Sportvereinen ernüchtert. Nach ihr lässt sich "eine gewaltpräventive Funktion des Sportvereins aus den vorliegenden empirischen Daten zur Prävalenz devianten und delinquenten Verhaltens jedenfalls nicht ablesen" (Brettschneider/Kleine 2001, 492). Diesen Kalamitäten ist aus sportwissenschaftlicher Perspektive nur entgegenzusteuern durch die Thematisierung und Abarbeitung gewalt- und extremismusförderlicher Elemente in der Sportkultur, die Öffnung von Sportvereinen in das Gemeinwesen, auch gerade für 'schwierige' Personengruppen, insbesondere Jugendliche, die sozialpädagogische Qualifizierung von Funktionären und Übungsleitern, die stärkere Ausrichtung des Schulsports an den jugendkulturellen Bewegungsformen der Schüler und Schülerinnen (vgl. z.B. Kottmann/Küpper/Pack 1997; Illi u.a.1998; KlupschSahlmann 1999) die Intensivierung der Kooperation von Sportvereinen mit Einrichtungen pädagogischer und Sozialer Arbeit, etwa mit Schulen und der Jugendarbeit, die Vernetzung sportlicher Aktivitäten mit anderen gewalt- und extremismuspräventiven Maßnahmen, politische Einmischung, um bewegungsfreundliche Umwelten sicherzustellen. Gewaltpräventive sportpädagogischen Gegensteuerungen erfolgen vor allem über (Liegel o.J., 38; vgl. auch z.B. Kuhn 1994; Pilz 2002a): das Ernstnehmen jugendlicher Bewegungsbedürfnisse und das Anknüpfen an jugendlichen Bewegungskulturen, die eben nicht (nur) in Sportvereinen ausagiert werden (vgl. Brinkhoff/Sack 1996), den Aufbau einer "experimentierfreundlichen Bewegungsinfrastruktur im nahen Wohnumfeld", die niederschwellige "Durchführung erlebnisintensiver, risikoangereicherter Bewegungsprogramme" mit "spannungserzeugenden Anforderungen städtischer und naturnaher Bewegungsräume", "Projekte, in denen Körper- und Bewegungsaktivitäten in ihrem Zusammenhang, z.B. zu Ernährungsgewohnheiten, zu Gesundheitsverhalten oder zu ästhetischen Praxen, thematisiert werden" und dabei konsequent, aber ohne Ausgrenzungs-Pädagogik gegen Gewalt einschreiten und einen geschlechterdifferentem Blickwinkel anlegen, der Gegenentwürfe zur Marginalisierung von Mädchen im Sportleben sowie äquivalente Alternativen zu maskulinen Hegemonialstrukturen aufzeigt. Einmalige Veranstaltungen sind dabei einer nachhaltigen Verbesserung nicht förderlich. 125 Wo entlang dieser Linie außerhalb der Sportvereine (oder außerhalb von Haftanstalten; dazu und zur Evaluation vgl. Wolters 1994; siehe auch das Kapitel zu gewalttherapeutischen Ansätzen) sportbezogen sozialarbeiterisch gearbeitet wird, geschieht aus der Jugendhilfe heraus für eine breite Adressatengruppierung vor allem aufsuchende Arbeit mit Trendsportarten (Inline-skating, streetsoccer, MitternachtsBasketball etc.), nicht selten in Kooperation mit der Polizei (vgl. z.B. Hamburger Sportjugend 1998; Gesicht zeigen 2001, 200ff.; Pilz 2002b), kümmern sich Fan-Projekte um (vornehmlich junge) Sportbegeisterte (siehe dazu auch die Aktion der Schalker Fan-Initiative gegen Rassismus; vgl. kurz: Gesicht zeigen 2001, 81f.), erfolgt in Kooperation mit Schulen eine Heranführung an eine eher spaß- als leistungsbezogene neue Bewegungskultur und 'New Games' (vgl. etwa Klose u.a. 2000) oder es werden mit spezifischerer Zielgruppenfokussierung gezielt sportliche Angebote für sozial Marginalisierte und Gewaltgefährdete in sozialen Brennpunkten angeboten (etwa im Hamburger Projekt "Integration durch Sport"). Damit sollen neue Formen sozialer Anerkennung (vgl. auch das Ergebnisprotokoll der Konferenz der Sportminister der Länder vom 5. November 1993; zit. n. Pro Jugend 4/1996) über Umlenkungen von Aggressivität in sozial akzeptierte Formen körperlichen Ausagierens erarbeitet werden. In verschrifteten Zielsetzungen entsprechender Projekte, die der Intention der GewaltBekämpfung dann auch noch leicht unvermittelt die Absicht einer Anti-Wirkung gegenüber Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit anhängen, finden sich Vermittlungsabsichten gehäuft in Stichwortreihungen wie "sinnvolle Freizeitangebote", "positive Wertvorstellungen", "soziales Verhalten", "Fair play", "Achtung gegenüber dem Nächsten", "Rücksichtnahme", "überschüssige Energien sinnvoll abbauen", "Kinder von der Straße holen" (hier exemplarisch für viele zitiert aus: Seehausen 1995) oder "Entwicklung positiver Lebenskonzepte", "Förderung der Lebenskompetenz", "Entwicklung von sozialer Verantwortung", "Kritikfähigkeit", "Konfliktfähigkeit" und "Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls" (Sportjugend Niedersachsen 2002). So wenig sich in solchen Auflistungen pädagogische Reflexivität und konzeptionelle Sättigung im Sinne der Stiftung eines sinnhaften Zusammenhangs zwischen Zielen, Inhalten, Methoden und Evaluationen widerspiegeln, so offen bleibt, inwieweit vollmundige und noch zusätzlich z.T. problematische ("Kinder von der Straße holen") Versprechungen wie diese weit ausgreifende Erwartungshaltungen wecken bzw. am Leben halten, die womöglich gar nicht einzulösen sind oder sogar zu ordnungspolitischen Instrumentalisierungen des Freizeitsports führen; dies derart, dass die jugend-, körper- und bewegungskulturellen Dimensionen des Sports problemfixiert überblendet werden. Brettschneider/Kleine (2001) jedenfalls raten auf der Grundlage ihrer Evaluation "zur Zurückhaltung, wenn es um programmatische Behauptungen zur persönlichkeitsformenden Kraft des Sports geht" (ebd., 492). Sicherlich mit Recht fordern sie eine verstärkte Evaluation. Eine kritische Sicht auf sportpädagogische Projekte führt eine Reihe der o.a. Argumente gegen die Erlebnispädagogik ins Feld, moniert das angesichts der Komplexität des Rechtsextremismus-Syndroms eingeschränkte, eigentlich unpolitische Handlungsfeld und problematisiert eine eventuelle bloße Aggressivitätssublimierung. Evaluationen, die die genannten Erwartungshalten der Protagonisten, aber auch die ihnen gegenüber erhobenen Vorwürfe prüfen könnten, liegen auch hier nur begrenzt vor und kommen zumeist nicht über den Charakter von Erfahrungsberichten hinweg. 126 Aus den in den hessischen Modellprojekten gewonnenen Erfahrungen mit sportbezogenen Angeboten lässt sich immerhin auf derartiger Erkenntnisbasis dreierlei festhalten: Dem Projekt "Auszeit" gelang es, "schwierige Jugendliche" in Sportvereine zu reintegrieren. Allerdings handelte es sich hierbei überwiegend um männliche Migranten, also keine 'rechten' Jugendlichen. Über Kooperationen mit Schulen konnten mittels Sport verschiedene ethnische Gruppen (Türken, Russlanddeutsche), die sich ablehnend gegenüber standen, miteinander in Kontakt gebracht werden. Wie weit dies zu einer dauerhaften Entkrampfung des Verhältnisses beitragen konnte und Modellcharakter beanspruchen kann, bleibt aber offen. Mobile Sportangebote im öffentlichen Raum erreichen vornehmlich männliche Migrantenjugendliche. Letzteres macht deutlich, dass Sport per se noch längst nicht Integration mit sich bringt, zumal bisweilen festgestellt wird, dass deutsche Jugendliche aus Angst wegbleiben, wenn der Teilnehmerkreis zu 80%-90% aus ausländischen Jugendlichen besteht (vgl. dazu die Erfahrungen mit Mitternachtssport bei Pilz 2002b). Dessen unbeschadet werden delinquenzund gewaltreduzierende Effekte solcher Angebote festgestellt. Wie weit sie allerdings über die polizeilich bestätigte Beobachtung hinausgehen, dass während der Laufzeit des Events selbst entsprechende Vorkommisse zurückgehen, bleibt fraglich, zumindest bis genauere Evaluationen entsprechender Projekte vorliegen. Auch die mittlerweile seit 20 Jahren bestehende (Fußball-)Fan-Projektarbeit (vgl. im Überblick dazu: Gabriel/Schneider 1999) ist bislang in Hinsicht auf die Umsetzung von zwei ihrer vordringlichsten Zielsetzungen, nämlich Eindämmung von Gewalt und Abbau extremistischer Orientierungen, unevaluiert geblieben - ganz im Widerspruch zu den im 1993 verabschiedeten "Nationalen Konzept Sport und Sicherheit" ausgedrückten Absichten. Zwar liegen erfolgsbestätigende Äußerungen aus Politik und Polizei vor11, letztlich bleibt aber bislang nicht wissenschaftlich exakt bestimmbar, ob und inwieweit für den Rückgang von Gewalthandlungen bei jungen Fußballfans auch oder sogar eher repressive Maßnahmen bzw. das Zusammenspiel von präventiv-sozialarbeiterischen und repressiv-polizeilichen Strategien, das das "Nationale Konzept Sport und Sicherheit" vorschreibt, verantwortlich sind. Eine aktuelle empirische Untersuchung von Lösel u.a. (2001) über Hooliganismus deutet an, dass gerade die Kooperation von kontrollierend-repressiven und sozialarbeiterischen Maßnahmen erfolgversprechend ist. Allerdings handelt es sich hierbei um Aussagen, die auf der Basis der Einschätzungen von ExpertInnen (24 Gruppendiskussionen mit insgesamt 205 Hooliganismus-ExpertInnen und 172 nach der Delphi-Methode per Fragebogen vorgenommene Einzelbefragungen) und einer verschiedene Instrumente (biographische Interviews, Persönlichkeits- und Einstellungsfragebögen, Test und klinische Diagnoseverfahren) einsetzenden Erhebung bei 33 Hooligans getätigt werden, also nicht Resultate einer kontrollierten Wirkungsevaluation darstellen (vgl. ebd., bes. 153ff.). Zudem muss - wie auch außerhalb der Sportarenen - trotz der im nationalen Konzept gebündelten 11 So erklärte z.B. Innenminister Behrens (NRW) am 18.01.2000, "dass es gelungen ist, den Zulauf zu gewaltbereiten Gruppen zu verringern. Es war ein wesentliches Ziel der Fanpropjekte, ein Abgleiten Jugendlicher in das Umfeld von Gewalttätern zu verhindern. Das ist uns ganz offensichtlich gelungen"; ähnlich auch die Darstellung des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit NRW, wonach "Fussball-FanProjekte inzwischen eine unverzichtbare Struktur hinsichtlich der Gewaltprävention, des Abbau von Fremdenfeindlichkeit und der Entwicklung von Rechtsextremismus" geworden sind und auf ihre Arbeit die geringere Auffälligkeit von Hooliganismus, Vandalismus und gewalttätigem Handeln sowie das Nichtvorhandensein eines "spektakulären Fall(s) von Gewalttätigkeit und Rechtsextremismus in den Bundsligastadien NRWs" zurückzuführen sind; vgl. MFJFG NRW 2000; vgl. zur Selbsteinschätzung der Projekte auch: Dembowski 1998, 25, wonach zumindest "eine Sensibilisierung für rechtsgerichtete Tendenzen erreicht worden" ist. 127 Bemühungen von Polizei und Sozialarbeit "eine Zunahme rechtsextremistischer Orientierungen im Fußballfanumfeld" (Pilz 2000) registriert werden. Dass Personen solche Haltungen in ihrer Außendarstellung mittlerweile weniger zu erkennen geben als früher, sich bspw. angepasster kleiden und seltener Glatzen tragen, kann über Vorurteile, Feindbilder und Fremdenfeindlichkeit in den Köpfen nach übereinstimmender Auffassungen der Zentralen Infostelle Sporteinsätze der Polizei und der Koordinationsstelle der Fanprojekte nicht hinwegtäuschen. Für die Qualitätssicherung und eine Wirksamkeitssteigerung der professionellen Fanarbeit erscheint eine formative Evaluation dringend geboten. Da"(o)hne systematische Evaluationen... nichts objektiv über verschiedene Arbeitskonzepte und ihre Wirkung ausgesagt werden" (Lösel u.a. 2001, 157) kann, fordern Lösel u.a. darüber hinaus "eine vermehrte kontrollierte Wirkungsevaluation" (ebd., 165); dies auch von solchen Maßnahmen, die repressiven bzw. kontrollierenden Charakter haben. So unbestimmt also bislang die Erfolge sportbezogener Ansätze sind: Ziemlich sicher dürfte schon heute das gelten, was die Evaluation des schleswig-holsteinischen Projekts "Sport gegen Gewalt" als "Hauptergebnis" herausstellt: "Sport alleine bringt 's nicht" (vgl. Grenz/Sielert 1996). Danach sind aus einer Fülle an Schwierigkeiten mindestens vier hervorzuheben – und zu lösen, wenn Gewaltreduktion durch Sport Erfolg haben soll: Akut gewalttätige Jugendliche kommen nicht in die Angebote, leicht gewaltbereite überwiegen. Positive Verhaltensveränderungen werden weniger durch den Sport als solchen denn vielmehr über das mit ihm gegebene Gruppenerleben verantwortet. Sensibilisierungen für Gewaltformen, die unterhalb des "Hauens" liegen, sind bei ungeschulten MitarbeiterInnen von Sportvereinen selten. Und: Persönliche und pädagogische Qualifikationen von MitarbeiterInnen sind "entscheidend für den gewaltpräventiven Erfolg" (ebd., 12). Wenn deshalb in Hinsicht auf Qualifizierung der ProjektmitarbeiterInnen hier vor allem auf eine Schulung von Wahrnehmungs-, Analyse-, Reflexions-, Empathie- und Handlungsfähigkeit (vgl. ebd., 13f.) abgehoben wird, ist damit ein auch aus der Sicht anderer sportwissenschaftlicher Analysen und Evaluationen (s.o.) nach wie vor dringlich zu einzulösendes Desideratum angesprochen. Aus der Sicht der Studie von Lösel u.a. (2001) kommt für die Arbeit mit gewaltbereiten Sportfans – aber wohl nicht nur mit ihnen – hinzu, dass Intervention und Prävention auf mehreren Ebenen zu geschehen hat. Danach erscheint eine Vernetzung der Anstrengungen von Vereinen und sozialpädagogischer Fanarbeit mit denen der kommunalen Kriminalprävention, der Medien und vor allem auch mit Maßnahmen zur Förderung der biografisch frühen erzieherischen Gewaltbearbeitung in Familie, Kindergärten und Schule angezeigt (vgl. ebd., bes. 157ff.); letzteres vor allem deshalb, weil zum ersten eine Verjüngung der gewaltbereiten Szene konstatiert werden muss und zum zweiten bei ihren Angehörigen deutlich erkennbare Risikokumulationen durch biographisch schon in der Kindheit einsetzende ungünstige Erziehungs- und Sozialisationserfahrungen vorliegen (vgl. ebd.; auch Möller 2000a, 2001a). 3.1.9 Kultur- und medienpädagogische Konzepte Kultur- und medienpädagogische Konzepte haben generell in der sozialen und pädagogischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den letzten zwei Jahrzehnten einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Er ist ganz offensichtlich Reflex auf Modernisierungsentwicklungen, die ihren Ausgang bei der Entwicklung technischer 128 Innovationen im Bereich der Computer- und Unterhaltungselektronik nehmen, im Zuge ihrer Verbreitung jedoch zugleich enorme Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Sozialen zeitigen. Pädagogische und sozialarbeiterische Relevanz wird ihnen nicht nur in der Debatte um die Auswirkungen medialer Gewaltdarstellungen (z.B. in Videos und Computerspielen) auf reales Handeln und um einen entstehenden "digitalen Graben" innerhalb der Gesellschaft und in ähnlichen Diskursen über die Gefährdungen aufgrund von sozialen Spaltungen der "Informationsgesellschaft" zugeschrieben. Es wird auch darauf verwiesen, dass soziale Zugehörigkeit und Selbstausdruck neue Gestalten annehmen: Insbesondere für Jugendliche spielen jugendkulturelle Zuordnungen und die oft in ihrem Kontext stehenden medialen Ausdrucksmöglichkeiten immer deutlicher entscheidende Rollen bei der sozialen und personalen Identitätsentwicklung. Eine an den Bedürfnissen, Interessen und Lebenswelten des Klientels orientierte Pädagogik und Sozialarbeit sieht sich deshalb herausgefordert, auf diesen Gebieten neue Ansatzpunkte zu entwickeln. Das Hauptargument ist klar: Wer Zugang zur jungen Generation sichern will, muss sich auf die von ihr ausgehenden bzw. bei ihr attraktiven kulturellen Stilisierungen und ihr Mediennutzungsverhalten einstellen. Bei den dieser Devise folgenden pädagogischsozialarbeiterischen Annäherungen hat sich trotz gelegentlicher Rückfälle in die Kurzschlüssigkeiten der Bewahrpädagogik längst ein praktischer Konsens etabliert: die Favorisierung eines handlungsorientierten Ansatzes. Anders als der faktisch angesichts globaler Mediennetze noch kaum durchzusetzende gesetzliche Jugendschutz, aber auch in Absetzung von der klassischen Medienkunde und der konventionellen kritischen Medienanalyse fragt er weniger danach, was die Medien mit den Menschen machen, als danach, was die Menschen mit Medien bewerkstelligen können. Er gefällt sich auch weniger in kulturkritischem Lamento, sondern propagiert stattdessen die aktive kulturelle Produktion durch TeilnehmerInnen in sozialarbeiterischen und pädagogischen Lernarrangements. Insofern handelt es sich um mehr als nur neuartige Zugänge und Inhalte. Auch methodisch verlagert sich das Schwergewicht von Verbot, Zugangsbeschneidung, Aufklärung und Wissensvermittlung auf Handlungsorientierung, Erfahrungslernen und die damit in Verbindung stehenden affektiven Prozesse (nicht zuletzt: "Spaß"). In ihrer Ergebnissen sind solche Aktivitäten mehr als andere auf die Herstellung von Öffentlichkeit hin angelegt. Sie erlauben damit die Publizierung eigener Expressivität und interessengeleiteter Anliegen über die nahweltlichen face-to-face-Bezüge hinaus, ihre Produkte sind als politisch-sozial relevante Stellungnahmen zu deuten und nehmen insofern Einfluss auf das gesellschaftliche Klima. Es liegt daher nahe, auch in Hinsicht auf die pädagogische Bearbeitung von Problematiken wie Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und Gewalt auf kultur- und medienpädagogische Impulse zu setzen. Von ihrer Zugangsweise her versprechen sie den 'Nerv' jugendlichen Alltagslebens und der sich in ihm dokumentierenden Interessen, personalen Identitätskonstruktionen und sozialen Zuordnungen junger Leute zu treffen und dabei auch diejenigen Aspekte zu erreichen, die im Bereich politischer Latenz liegen. Indem sie die kulturelle bzw. mediale Produktion in den Vordergrund rücken, erscheinen sie selbst im Kontext der politischen Bildung nicht einseitig inhaltlich festgelegt. Sie transportieren damit neben dem Politischen immer noch gleichsam einen zweiten Inhalt. Die verbreitete Abneigung gegenüber etablierter Politik und ihren konventionellen Ausformungen trifft sie deshalb nicht so leicht. Andererseits sind sie gerade an die in kulturellen Überformungen bestehenden modernisierten Existenzweisen des Politischen anschlussfähig, wie sie sich auch nicht zuletzt im Umfeld der Amalgamierung rechtsextrem konturierter und gewaltförmig auftretender jugendkultureller Elemente mit politisch-ideologischen Haltungen, wie etwa bei den Skinheads, aber auch – in ganz anderer politischer Ausrichtung – in der HipHop-Szene finden. Ihre methodischen Chancen für Erfahrungslernen und Gestaltungserleben sind offensichtlich, so dass bei ihren Zielgruppen die Assoziation einer leicht auf Ablehnung stoßenden politisch-moralisierenden Aufklärungspädagogik 'von oben herab' zumeist erst gar 129 nicht aufkommt. Hinzu kommt die emotionale Ansprache, die kreative, kulturelle und mediale Aktivitäten beinhalten. Sie können an ein Verständnis von Politik anknüpfen, das es aus der Sphäre rationalistisch-argumentativer Diskurse in Richtung auf symbolische Stilisierungen und eventartige Erlebnisformen öffnet. Mediale und kulturelle Aktionen und Produktionen enthalten darüber hinaus Publikationspotenziale, die sie für einen Transport von politischen Auffassungen und Diskussionsangeboten aus dem gesellschaftlichen Mikro- in den Mesound Makrobereich prädestiniert erscheinen lassen. Davon abgesehen verstehen sich die Angebote auch oft als Vermittlungsformen von Selbst- und Sozialkompetenz bzw. von Schusselqualifikationen.12 Insoweit kann es nicht verwundern, wenn zur pädagogischen und sozialarbeiterischen Bekämpfung von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen, vorwiegend aber mit Kindern und Jugendlichen, alte und neue Medien wie Theater(spiel), Musik, Tanz, Film, Video, Foto, Plakatdruck, Comics, Literatur und Textproduktion, Internet sowie bildnerische Kunst zum Zuge kommen. Einzelprojekte sind in ihrer Vielzahl mittlerweile unüberschaubar (vgl. exemplarisch www.bkj.de/mutproben). Formate und Designs, in denen kulturelle und mediale Aktivitäten entweder mit dem methodisch-didaktischen Stellenwert von Techniken und Verfahren im Sinne kultureller Sozialarbeit irgendwie zur Geltung kommen oder von vornherein als eigenständiger Inhalt sozialer Kulturarbeit im Mittelpunkt stehen, differieren in ihrem Umfang und in der Intensität der abverlangten Teilnahme erheblich. Designs reichen von Konzerten oder Ausstellungs-, Musical-, Film- und Theaterpräsentationen, die vorwiegend konsumierende Zielgruppen ansprechen, über 90-minütige Schnupperworkshops mit eigenaktiven Anteilen und - z.T. im ersten Schritt als Einzelansprache konzipierte – Internetangebote bis hin zu Projekten, bei denen im Gruppenzusammenhang über mehrere Wochen oder sogar Monate hinweg ein eigenes Produkt (z.B. CD, Video, Theaterstück) erstellt und oft auch veröffentlicht wird. Zumeist sind die Vorhaben im außerschulischen Bereich angesiedelt, nicht selten kommen sie aber auch in Kooperation mit Schulklassen zustande. Die Träger entstammen meistens der Medienpädagogik bzw. der kulturellen oder politisch- bzw. sozial-kulturellen Bildung und verfügen über Personal, das verhältnismäßig oft auch nicht-pädagogische Qualifikationsprofile aufweist. Dem gemäß bestehen die eingebrachten Fachkompetenzen häufig eher in Fähigkeiten und Fertigkeiten des technischen und didaktischen Umgangs mit bestimmten Medien und/oder kulturellen Praktiken als in thematisch-inhaltlichen Bezügen auf die Problematiken von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Im Regelfall herrscht ein professionelles Selbstverständnis vor, das dem Umgang mit Medien und kultureller Praxis pädagogischen Eigensinn zuschreibt und diese Aktivitäten nicht für übergeordnete pädagogisch-thematische Interessen instrumentalisiert sehen will. Musical- und Theaterprojekte firmieren nicht selten unter einem Titel wie "Theater gegen rechts". Darunter werden zum Teil Tourneen professioneller oder semiprofessioneller Schauspieltruppen – oft mit Diskussionen oder Rollenspielaktionen (für SchülerInnen) im Anschluss an die Aufführungen – verstanden, als auch Wettbewerbe und Projekte angeboten, die Kinder und Jugendliche dauerhafter zu darstellendem Spiel animieren (so etwa die unter diesem Rubrum stehende und vom Bundesprogramm "Jugend für Toleranz und Demokratie" geförderte Aktion von Bund Deutscher Amateurtheater, Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater und Bundesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel in der Schule, bereits seit 1996 das Kindertheater "S.O.S. in Feuerland" der Spiel- und Theaterwerkstatt Villigst oder – als 12 So weist das den TeilnehmerInnen an der Musical-Produktion "Voll das Leben" ausgestellte Zertifikat auf den Erwerb von Kompetenzen hin wie "gute Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit und Bereitschaft im Team zu arbeiten...Abstraktions- und Reflexionsfähigkeiten..., die Fähigkeit, zu Problemlösungen beizutragen". 130 Beispiele für Musical-Produktionen die im Ruhrgebiet auftretende Aufführung "Voll das Leben" oder "Rapomania") und ggf. mit der Teilnahme an Festivals belohnen (vgl. aktuell etwa das UNESCO-Weltkindertheater-Festival im Juni 2002 in Lingen (Ems) unter dem Titel "Dialog zwischen den Kulturen" mit 400 Kindern aus 20 Ländern und 20.000 erwarteten BesucherInnen). In ähnlicher Weise wird Theaterspiel zur allgemeinen Gewaltprävention eingesetzt. So entwickelten bspw. der Bundesverband Theaterpädagogik e.V. und das Theaterpädagogische Zentrum Köln die mobile Produktion "Schönes Wochenende", die als Begleitmaßnahme zur Reform des Rechts auf gewaltfreie Erziehung (§ 1631, Abs. 2 BGB) angesehen wird, das Theaterpädagogische Zentrum Lingen erstellte in Kooperation mit dem niederländischen Kindertheater "Benjamin" ein von einem Arbeitsheft begleitetes Stück über Gewalt an Schulen ("Game over – oder: Schikanieren ist kein Spiel") und die Bundesarbeitsgemeinschaft für das Darstellende Spiel in der Schule und das SchultheaterStudio Frankfurt konnten an mehr als 150 Schulen im Bundesgebiet über 4000 SchülerInnen mit ihren theaterpädagogischen Gewaltpräventionsworkshops erreichen. Gelegentlich wird auch mit dem Einbezug 'rechter' Jugendlicher experimentiert (vgl. Braun-Badie-Massud u.a. 1996). So gut solche Projekte angenommen werden, so positiv vereinzelte Rückmeldungen von BesucherInnen bzw. TeilnehmerInnen oder beteiligten Lehrkräften sind und so optimistisch einzelne Erfahrungsberichte klingen: Aussagen über messbare gewalt- bzw. extremismusreduzierende oder –präventive Effekte lassen sich nicht machen, erst recht nicht in Hinsicht auf Nachhaltigkeit. Wissenschaftliche Evaluationen fehlen. Der Einsatz von Musik "gegen rechts" und gegen Gewalt beschränkt sich nicht allein auf das Angebot von Konzerten und Tonträgern bekannter InterpretInnen mit entsprechend kritischen Texten. Neben dem bloßen Konsum wird "Gegenwind" der "jungen Musikszene gegen rechts" entfacht. (so das Motto der Landesarbeitsgemeinschaft Musik Nordrhein-Westfalen). Musikwettbewerbe für junge Leute (z.B. "Nicht hier geboren..." der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung Thüringen), musikalische Aktionstage (wie z.B. "beat gegen rechts" in Hamburg und ähnlich andernorts), Begegnungsfestivals (wie des Arbeitskreises Musik in der Jugend oder des Verbandes deutscher Musikschulen) wollen "Zeichen gegen Hass und Gewalt" setzen und "Botschaften" für "Toleranz und Aufgeschlossenheit gegenüber Fremden" aussenden. Sie vertrauen darauf, dass dies "viel wirksamer" gelingen kann "durch Initiativen für etwas... als durch noch so viele Aktionen gegen gesellschaftliche Fehlentwicklungen" (vgl. www.musikschulen.de). Auch außerpädagogische Akteure schreiben entsprechende Aktionen aus (vgl. etwa den im Jahre 2001 von AOK, VIVA und BMG Entertainment durchgeführten und mit einem Plattenvertrag ausgepreisten Talentwettbewerb "Rhythmus gegen Rassismus"; vgl. www.act2001.de). Während solche Angebote im allgemeinen nur bereits musizierende Kinder und Jugendliche ansprechen, geht die 1999 mit dem Projekte-Preis der Heinrich-Böll-Stiftung ausgezeichnete und 2001 als deutscher Beitrag für das internationale Jahr der UN "Dialog zwischen den Kulturen" ausgewählte Initiative "Rap für Courage" seit 1995 einen anderen Weg. Jugendgruppen bzw. Schulklassen bis zu 18 Personen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren werden innerhalb eines intensiven viertägigen Workshops befähigt, einen HipHopAct multimedial (Musik(video), Tanz) auf die Bühne zu bringen bzw. einen Song bis zur CDReife zu produzieren. Unterstützt werden sie dabei von einer professionellen HipHopFormation, den "Sons of Gastarbeita". Seit 1998 gibt es ein analoges Angebot nur für Mädchen: "Mädchen zeigen Courage". Über 1.200 Jugendliche konnten bis heute so erreicht werden. Neuerdings können ausgelöst durch die große Nachfrage nach dem Projekt auch speziell dafür als MultiplikatorInnen ausgebildete Fachkräften aus der Jugend(bildungs)arbeit eingesetzt werden. Die mit ihnen (N= 62; Stand Januar 2002) durchgeführten Fortbildungen wurden z.T. unter Einbezug jugendlicher Lehrender organisiert und projektintern sehr positiv 131 evaluiert. Nach Projektrecherchen setzen etwa 50% der TeilnehmerInnen das Gelernte innerhalb der eigenen Praxis in eigene Projekte um. Über die Wirksamkeit von "Rap für Courage" in Hinsicht auf die beanspruchte Protektion von Rassismus, Rechtsextremismus, Minoritätenfeindlichkeit und Gewalt ist damit allerdings noch nichts ausgesagt. Dies gilt auch für die CD- und Video-Clip-Produktionen im Rahmen einer handlungsorientierten Medienund Kulturarbeit "gegen rechts" in Nürnberg (vgl. Eismann u.a. 1997; Glöckler 2002) und anderswo. Evaluationen hätten u.a. die Vermutung zu prüfen, dass der HipHop-Stil nicht unbedingt rechtsextrem gefährdete Jugendliche anspricht, sondern eher geeignet erscheint, Migrantenjugendliche und ihre schon 'antirassistisch' gestimmten deutschen Freunde zu interessieren und in ihren multikulturell geprägten Lebensweisen und Auffassungen zu stabilisieren. Auch die möglicherweise aggressionsreduzierende Funktion kinästhetischer Bewegungsabläufe und ihre Verbindung mit musikalischen Projekten ist völlig unzureichend erforscht. Mit der Langzeitstudie von Bastian (2001) liegen zwar Belege dafür vor, dass Kinder, die ein Musikinstrument spielen lernen, nicht nur an intellektuellen Fähigkeiten gewinnen und kommunikativer werden, sondern auch ihre Gewaltbereitschaft absenken können, die "uneingeschränkt(e)" Übertragung dieser Forschungsergebnisse auf Wirkungen des Tanzens – wie sie z.B. von der LAG Tanz Berlin (2001) mangels tanzbezogener Forschungsresultate unternommen wird – erscheint auf dem Hintergrund des Interesses von tanzpädagogisch arbeitenden PraktikerInnen an Absicherung von unsystematischen Praxisbeobachtungen bei Projekten wie "Tanz in der Schule" nachvollziehbar, wissenschaftlich aber so vorerst nicht haltbar. Die vorgebrachte Vermutung, tanzen fördere nicht nur Gleichgewichtssinn, Raumorientierung, Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung, sondern auch körperliche Sicherheit und Selbstbewusstsein, reduziere im Falle gemeinsamer Folkloretänze Ängste vor anderen Kulturen und Tanzgruppen seien deshalb "Lernfelder für gelebte Demokratie und gesellschaftliches Engagement" (vgl. ebd.), steht dringlich zu wissenschaftlicher Überprüfung an. Das Medium Film wird nicht nur klassisch als Aufklärungs-, Anregungs- und Diskussionsfolie bei Vorführungen (vgl. etwa den seit zehn Jahren vom Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland vorrätig gehaltenen Katalog mit "Videos gegen Vorurteile und Gewalt" sowie das Datenbank-Projekt www.kino-gegen-Gewalt.bjfev.de), sondern verstärkt mittels Videotechnik handlungsorientiert eingesetzt. Das bereits seit zehn Jahren bestehende und mehrfach ausgezeichnete Wuppertaler Jugendvideoprojekt produziert mittlerweile etwa jährlich 150 Videos, die – auch über ein regelmäßiges Jugendvideomagazin - von etwa 5.000 bis 8.000 Jugendlichen in Wuppertal und vermittels des bundesweiten Vertriebs von etwa der Hälfte der entstehenden Produktionen von mehreren 100.000 jungen Leuten in Deutschland gesehen werden. Es zieht damit hierzulande die meisten ZuschauerInnen an. Für diverse Städte und Gemeinden hat es Modellcharakter entwickelt. Jugendvideoproduktionen zu den Themen "Interkulturelles", "Rassismus" und "Rechtsextremismus" nehmen etwa 10% ein (vgl. von Hören 1996). Interessant erscheint hier vor allem, dass der anfängliche aufklärerische Impetus der Produktionen immer stärker von einer pädagogischen Haltung abgelöst wird, die auf authentische kulturelle Selbstbeschreibungen zielt und die Information und Unterhaltung von Jugendlichen durch Jugendliche in den Vordergrund rücken lässt. Diese Umakzentuierung folgt der Ansicht, dass ein solches Vorgehen "größere präventive Wirkung" hat (persönliche Mitteilung von Andreas von Hören an den Verfasser). Verschiedene Projekte verbinden Musik, Tanz und/oder Theater mit ihm (neben dem schon erwähnten Projekt "Rap für Courage" bei der Erstellung von Videoclips z.B. auch die Projekte "Powerplay" und seit Herbst 2001 "Crossover", ebenfalls unter der Ägide der Spiel- und Theaterwerkstatt Villigst). Erheblich seltener sind 132 Dokumentarfilmprojekte zu Themen des historischen Faschismus zu finden, wie etwa der Lehrer Thilo Pohle in Rothenburg mit seinen SchülerInnen auf diese Weise Erinnerungen an die Nazizeit festhält. Wettbewerbe – wie etwa der seit 1988 vom Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland ausgeschriebene Preis "Jugend und Video" und seine letztjährige Fokussierung auf "Mut-Proben" - fungieren auch im Hinblick auf den Einsatz dieses Mediums oft als Initialzündungen. Nachhaltige Wirkungen sind allerdings weder für den Konsum von Filmen mit 'antirassistischem' bzw. gewaltreduzierendem Anspruch noch für intendierte Einflüsse des Produktionsprozesses auf die daran Beteiligten wissenschaftlich belegt. Literaturdiskussion und Textproduktion wird vergleichsweise selten und eher mit formal höher Qualifizierten angegangen (Ausnahme z.B. das Kinderbuch-Projekt "Was ist los in Feuerland?"). Beispiele finden sich im Kontext der Arbeit von "Stiftung Lesen", des "Arbeitskreises für Jugendliteratur" und der Internationalen Jugendbibliothek München. Das Programm "Wege zur Toleranz" der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung SachsenAnhalt e.V. umfasst zwischen den Jahren 2000 und 2002 mehrere Teilprojekte. Eines von ihnen "Teger.de – Texte gegen rechts" fordert Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 27 Jahren dazu auf, Texte (oder auch Songs) in verschiedenster Form – von Gedichten über Prosa bis zu SMS-Zeilen und Anrufbeantworter-Sprüchen - einzusenden und sie im Internet veröffentlichen zu lassen. Der Stand der Evaluation ist hier kein anderer als der bei den schon erwähnten pädagogisch-sozialarbeiterischen Ansätzen von Kultur- und Medienarbeit. Im Klartext: Auf wissenschaftlichem Niveau ist über Zielerreichung, Wirksamkeit und Wirkungen keine Aussage zu treffen. Bei Projekten bildnerischen Gestaltens (vgl. exemplarisch aktuell den "Park der (Kinder)Kulturen" anlässlich des Welt-Kindertheater-Festivals in Lingen), damit oft verknüpften Ausstellungen, des (Plakat- und Flyer-)Drucks (vgl. z.B. den "Druck gegen Gewalt" der Galerie Sonnensegel in Brandenburg; www.sonnensegel.de) – oft in Verbindung mit Fotografie -, bei Zirkusprojekten oder anderen, z.T. multikulturellen und bzgl. des Einsatzes diverser Genres, breitgefächerten künstlerisch inspirierten Aktivitäten (wie z.B. bei dem Projekt "Zeichen setzen" des Bundes deutscher Kunsterzieher oder bei den seit 1993 inzwischen über 300 Mal von "Instant Acts" organisierten Begegnungen und Aufführungen gegen Gewalt und Rassismus, bei denen ein rd. dreißigköpfiges internationales Ensemble unauffällige, aber auch z.T. rechtsextrem orientierte und gewaltgeneigte Jugendliche ab ca. 14 Jahren mit Kulturtechniken wie Theater, Batik, Trommeln, Trommelbau, Capoeira, afrikanischem Tanz, und Graffiti in Kontakt bringt, um über die Ansprache aller Sinne die Angst vor dem Fremden in die Neugier für das Fremde umzuwandeln) oder bei der phantasievollen, Plakataktionen, Tonbildcollagen, Internet und offlineDiskussionsveranstaltungen verknüpfenden österreichischen Aktion "Das ganz normale Bild" (vgl. www.geocities.com/Vienna/Choir/5849/dgn/ProBesch.html) ist der Erkenntnisstand nicht besser, gleichgültig ob es sich im einzelnen um Workshops, Wettbewerbe oder (Wander)Ausstellungen handelt. Naheliegenderweise hat im Rahmen medienpädagogischer Arbeit gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in jüngerer Zeit gerade auch der Umgang mit dem Computer und dem Internet einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Dieser ist als Reaktion auf mindestens zwei Entwicklungen zu verstehen: Zum einen erfreuen sich Computer und online-Aktivitäten gerade bei jungen Leuten rapide steigender Beliebtheit, zum anderen fühlt man sich durch Websites rechtsextremer Organisationen und sonstiger rechtsextremer Propaganda und Gewalt(z.B. mittels Computerspielen mit NS-Anleihen und/oder sonstigen extensiven Gewaltszenarien) sowie Angebote zum download von 133 Rechtsrock und von weiteren Gewalt verherrlichenden Musikstücken herausgefordert. Aktuell berichtet das nordrheinwestfälische Innenministerium von einer Vervierfachung der Anzahl der Homepages deutscher Rechtsextremisten im Vergleich zu 1999 auf z.Zt. 1.300. Zwar ist über die Wirkung solcher Offerten auf das Orientierungsverhalten der NutzerInnen – in deutlichem Kontrast zu ihrer scharfen Skandalisierung im öffentlichen Diskurs über sie, speziell in Verfassungsschutzkreisen, - nichts bekannt. Allerdings: Eine neuere, noch sehr tentative Untersuchung stellt fest, dass doppelt so viele (nämlich 40 %) der Jugendlichen mit rechtsextremen Tendenzen wie politisch unauffällige Jugendliche Spielkonsolen und Handys besitzen sowie öfter surfen, chatten und Netzspiele nutzen (vgl. Frindte u.a. 2002). Das Internet scheint also durchaus dazu geeignet zu sein, gerade diese Jugendlichen anzusprechen. Die z.Zt. deutschlandweit wohl bekannteste, wesentlich internetbasierte pädagogisch motivierte und begleitete Initiative ist "Step 21". Sie bietet – breit unterstützt von namhaften PolitikerInnen, weiteren Prominenten und Unternehmen - jungen Menschen ab ca. 13 Jahren ein Forum für Ideen und Engagement im Sinne von "Demokratie"entwicklung, "Weltoffenheit", "Toleranz", "Verantwortung"sübernahme, "Solidarität" und "Zivilcourage" (diese wie folgende Zitationen aus: www.step21.de). Die Zielsetzung des "Netzwerkes an Aktionen, Wettbewerben und Begegnungen" beansprucht darüber hinaus die Entwicklung u.a. von "Sozialkompetenz", Reflexivität, "Orientierungsfähigkeit" und "Medienkompetenz". Eine der beiden tragenden Säulen bildet die "Step 21-Box". Es handelt sich um ein interaktives Medienpaket für Jugendliche, das in jugendkultureller Aufmachung Lehr- und Lernmaterialien bereithält und vor Ort – etwa im Schulunterricht und in der Jugendarbeit oder im Internet eingesetzt werden kann. Die zweite Säule besteht aus dem Step 21-Netz. Sein inhaltlicher Kern besteht neben eher unterhaltenden Bestandteilen (z.B. "Games", "Comics", "Movies" und "Music" zum downloaden) vor allem aus Aktions- und Wettbewerbsangeboten, Workshops bzw. Weiterbildungshinweisen und einer Projektbörse (z.Zt. u.a. mit Vorschlägen für eine Internet-Zeitung und einen interaktiven "Kalender gegen Rechts"). Zu "Step 21" gehört auch die Kampagne "fairlink.de", die Jugendliche dabei unterstützen will, "'wachen Auges' mit dem Internet umzugehen". Unter Begleitung von je 21 jugendlichen "Toleranzschiedsrichtern" und erwachsenen "Coaches" erfolgt eine "Bestandsaufnahme der Erfahrungen deutscher Jugendlicher mit Extremismus, Rassismus und Menschenverachtung im Netz" und die Entwicklung von "Lösungs- und Projektansätzen", die einer ebenfalls zu erstellenden "Agenda zur Neudefinition der Werte wie Toleranz, Respekt und Verantwortung" folgen. Das pädagogische Konzept von "Step 21" setzt auf ein "selbstgesteuertes", "experimentelles", "problemlösendes" und "handlungsorientiertes" Lernen, vor allem im Umgang mit DilemmaSituationen, in denen "intellektuell, emotional und aktiv – mit Kopf, Herz und Hand" durch Einbringung individueller Einschätzungen in den Urteilsbildungsprozess der peergroup "um eine Orientierung gerungen und gestritten wird". "Inszenierend-narrativ" und gleichzeitig "handwerklich-technisch" möglichst gekonnt sollen in einem "ganzheitlichen Zugang" durch fragmentarische Vorgaben angestoßene Handlungsverläufe von Geschichten weiterentwickelt werden. Beteiligte Jugendliche und PädagogInnen werden aufgefordert, durch Rückmeldungen – wie in der Pilotphase 1999 bereits geschehen – zu einer Verbesserung von "Step 21" beizutragen. Eine abschließende Evaluation, die die Umsetzung der sehr ambitionierten Zielkataloge prüfen könnte, liegt nicht vor. Eine Evaluation der "Step 21-Box" wird z.Zt. an der Universität Münster im Rahmen eines Dissertationsvorhabens durchgeführt. Neben "Step 21" besteht inzwischen eine Reihe kleinvolumigerer Internetprojekte. Im zweiten Halbjahr 2001 fand z.B. das Projekt "Rechts rum?" als Innovationsprojekt des Landes NRW statt (bis Ende 2001 erreichbar unter: www.rechts-rum.org). Es verknüpfte, weil dies die Macher für "besonders effektiv" (Hermes/Wisser 2002, 275; vgl. auch Hermes 2002) halten, ein online-Rollenspiel mit face-to-face-Konferenzen am Runden Tisch in sechs Städten NRWs. Die Zielgruppe waren Jugendliche ab 16 Jahren, die sich in Schul-, VHS- und 134 Jugendarbeitsgruppen zusammengefunden hatten. Sie arbeiteten an Konfliktszenarien, innerhalb derer sie bestimmten Rollen (JournalistInnen, Kaufleute, Stadtverordnete, JugendhausbesucherInnen, Diskothekenbetreiber usw.) besetzten und "eine wie auch immer geartete Einigung im Interessenkonflikt" (ebd., 275) zu Stande bringen mussten. IDA-NRW nutzt eine alte IDA-Domain, die die antisemitische Seite www.skinheads.de verlinkt hat, unter dem dort angebrachten Button "...und tschüß..." zu "Aufklärung statt Verbote - ein Praxisbeispiel zum Umgang mit rechtsextremen Internetseiten" – so auch der Titel des staatlich geförderten Projekts. Schul- bzw. unterrichtsbezogen entstanden ist das an einem Dortmunder Gymnasium bestehende Projekt "Stirn bieten" (vgl. www.stirnbieten.de). Sein "Ziel ist die 'Schule ohne Intoleranz, Rechtsextremismus, Gewalt und Hass'" (ebd.). Neben einer Linkliste besteht es aus eine internetgebundenen Plakataktion, bei der SchülerInnen im wahrsten Sinne des Bildes mit einem Foto von ihren oberen Gesichtshälfte und einem begleitenden Ausspruch Gewalt die Stirn bieten und gegenüber Extremismus "Gesicht zeigen" können. Ferner werden in z.Zt. acht Lektionen Unterrichtsanregungen gegeben, die SchülerInnen auffordern, durch Recherche in bestimmten Internetseiten Fragen und Problemstellungen zu beantworten. Die Verantwortlichen können "eine große Breitenwirkung" (Fileccia 2002, 271) an ihrer Schule registrieren, konkrete Auswirkungen sind aber wissenschaftlich bislang unüberprüft geblieben (wie auch bei Spielen wie dem schon erwähnten "Dunkle Schatten" oder "ploppattack"). Bei der Site "www.exil-club.de" handelt es um eine Plattform (primär) für SchülerInnen, auf der Publikationen von ExilantInnen abrufbar, diskutierbar und durch eigene Publikationen von NutzerInnen ergänzbar sind. Angestrebt wird mit ihr neben der Schulung von Medienkompetenz die Entwicklung von "Toleranzkultur" und die Sensibilisierung für das Thema Asyl, Minderheiten und Andersdenkende. Angesichts der weitflächigen Evaluationsdefizite bei kultur- und medienpädagogischen Ansätzen und des Innovationspotenzials, das gerade dem Internet zukommt, darf man auf die Ergebnisse des Evaluationsprojekts gespannt sein, das ab Januar 2002 bis 2004 an der Universität Bielefeld durchgeführt wird. Ausstellungs- und museumspädagogische Ansätze werden ebenfalls – auch abgesehen von den im Rahmen einer Gedenkstättenpädagogik (dazu Kap. 3.1.1) verfolgten Projekten (zu einem Multimedia-Widerstands-Gedenkort-Projekt vgl. auch kurz zusätzlich Kolland/Bach 2001) – für Zwecke der Gewaltreduktion und des Abbaus bzw. der Vorbeugung von Fremdenfeindlichkeit eingesetzt. Die wenigstens können auf Evaluationen verweisen. Vergleichsweise umfassend liegen jedoch Auswertungen für den im Rahmen des Schwerpunkts "Gewaltprävention" angesiedelten BLK-geförderten Modellversuch "Begegnung mit dem Fremden" vor. Es handelt sich um ein Programm, an dem 1995 und 1996 insgesamt 22 kleinere, nichtstaatliche, oft in kleineren Orten gelegene BadenWürttembergische Museen (u.a. drei jüdische und mehrere Orts- und Heimatmuseen) beteiligt waren. Für sein Selbstverständnis war essentiell, "Museumspädagogik als ein (!) Element einer übergreifenden Bildungsinitiative, die sich der Förderung kultureller Toleranz in der Gesellschaft annimmt", zu verstehen (www.people.freenet.de/afeb/fremd.html; vgl. zum folgenden auch ebd. die Texte von Ulrich Paatsch zu den Themen "Arbeitsfelder interkultureller Museumsarbeit", "Museen und Fremdenfeindlichkeit" sowie "Museumspädagogischer Modellversuch Begegnung mit dem Fremden"). In vier Arbeitsfeldern wurden "Begegnungen mit dem Fremden in der eigenen Geschichte", "Begegnung mit fremder Kultur", "Begegnung mit dem Fremden in der Kunst", "Partizipation" im Sinne der Verbesserung der kulturellen Teilhabe von ethnischen Minderheiten und "Verständigung" angegangen. Als Fazit wird auf der Basis von Mitarbeitereindrücken, Äußerungen von Beteiligten aus (interkulturellen) Arbeitskreisen, die Ausstellungen mit vorbereiteten oder praktisch begleiteten, BesucherInnen- und Eltern135 Rückmeldungen von jugendlichen BesucherInnen festgehalten, dass das Aufspüren des "Eigenem im Fremden" von hohem Stellenwert ist, die biographische Methode "ausgesprochen aktivierend auf Besucher wirken kann und geeignet ist, eine persönliche Betroffenheit herzustellen", "erfahrungsorientiertem und entdeckendem Lernen große Bedeutung" zukommt, ein "Perspektivwechsel" zu ermöglichen ist, der "evtl. 'zu einfache' Geschichtsbilder in Frage stellt" und "die Begegnung mit dem Fremden in der Geschichte sehr viel an Wirksamkeit gewinnt, wenn sie begleitet wird von einer Begegnung mit Menschen fremder Herkunft heute". "Als förderlich erwies sich dabei, wenn schon in der Ausstellung Schnittstellen für aktuelle Aktionen und kleine Folgeprojekte enthalten waren." Deutlich wird auch, dass ein interkultureller Ansatz innerhalb von Museums- und Ausstellungspädagogik sich nicht darin erschöpft, pauschal auch ausländische Zielgruppen verstärkt anzusprechen, sondern ein "Integrationskonzept" auch auf "kulturelle Besonderheiten und Voraussetzungen der verschiedenen Nationalitäten" – stärker als im Modellversuch gelungen - eingehen und langfristig die aufgetretenen Schwierigkeiten überwinden muss, MigrantInnen in die Gruppierung der Ausstellungsmacher zu integrieren. In jedem Fall sollte nach den Erkenntnissen aus dem Modellversuch die Kooperation auch mit pädagogischen Einrichtungen wie Schule und Jugendhilfe gesucht werden, auch wenn eine Instrumentalisierung von Museumspädagogik für die Erledigung von Aufgaben, die in anderen Bereichen nicht bewältigt werden, abgelehnt wird: "Wenn vom Museumspädagogen im Kunstmuseum erwartet wird, daß er ausgleichend auf die Aggressivität von ausländischen Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft wirkt, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht existieren (z.B. wegen der beengten Unterbringung in Kasernenräumen)." Dennoch: "Ein neues, kommunikatives Museumsverständnis wächst gerade in der praktischen Erprobung solcher Tätigkeiten in den 'Grenzbereichen' der Museumspädagogik; also: hin zur Sozialpädagogik, hin zur Ausländerarbeit, hin zur Schule etc.". Freilich halten die Evaluatoren auch fest, dass bei den von ihnen befragten MuseumsmitarbeiterInnen "nur wenig darüber reflektiert wird, was Ausstellungen und andere museumspädagogische Aktivitäten überhaupt erreichen können und sollen.... Erst wenn dies geschieht – also wenn etwas präziser und sehr viel nüchterner festgehalten wird, was historische Ausstellungen bei Museumsbesuchern bewirken können – dann wird man auch zu verläßlicheren Aussagen über den Problemkreis 'Museum und Fremdenfeindlichkeit' kommen". An 15 von 22 Projektstandorten wurde für die BesucherInnen die Möglichkeit zu Feedback in Gestalt des Ausfüllens von ausgelegten "Meinungskarten" eingeräumt, wobei die methodische Problematik einer derartigen Nutzerbefragung durchaus erkannt wird. Aus den so gesammelten Reaktionen von ca. 800 Personen geht ein überwiegend positives Bild hervor. Allerdings wird die Erreichbarkeit von Zielgruppen bezweifelt, "die tatsächlich zum harten Kern mit ausländerfeindlichem Bewußtsein und Handeln zählen". Ferner fällt die vergleichsweise hohe Zahl von Anregungen zu begleitenden Aktivitäten auf. Sie geben zu erkennen, dass das Museum "als Kultur- und Kommunikationszentrum", als "öffentlicher und lebendiger Ort" gefragt ist, an dem "neue, auch spielerische Erfahrungen gemacht werden können". Die Rückmeldungen bestärken somit nicht nur das oben erwähnte "kommunikative Museumsverständnis", sondern auch die Attraktivität von erfahrungsorientierten, ganzheitlichen Lernstrategien und von aktivierenden und Begegnung ermöglichenden Formaten (zur jeweiligen projektspezifischen Resonanz vgl. "Museumspädagogischer Modellversuch Begegnung mit dem Fremden"). Alles in allem betrachtet zeigt sich auch in Bezug auf die konzeptionelle Richtung medienund kulturpädagogischer Projekte: Auf dem Hintergrund theoretischer Erwägungen und vereinzelter Bezugnahmen auf empirische Erkenntnisse über die Anfälligkeit für Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt sowie - in weitaus selteneren Fällen auch über Distanzierungsbedingungen von den genannten Problematiken erscheinen die in 136 diesen Bereichen verfolgten Ansätze durchaus erfolgversprechend. Eklatante Lücken tun sich allerdings in Hinsicht auf die Evaluation solcher Maßnahmen auf: Was tatsächlich, wie, mit welcher Reichweite und Nachhaltigkeit, unter welchen Bedingungen erwünschte Wirkungen erzielt, bleibt im Dunkeln. Wo Evaluation tatsächlich angegangen worden ist, bleiben methodische Probleme weitgehend ungelöst, so dass von einer Einhaltung wissenschaftlicher Standards nur mit erheblichen Abstrichen die Rede sein kann. 3.1.10 Geschlechtsreflektierende Ansätze Die beiden wichtigsten Ziele geschlechtsreflektierender pädagogischer und sozialer Arbeit gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt liegen darin in der Arbeit mit Jungen den Abbau von Vorstellungen und Strukturen maskuliner Hegemonie zu betreiben und in der Arbeit mit Mädchen kritisch den konventionellen weiblichen Sozialisationsstrang und die Entwicklung von Alternativen dazu in den Mittelpunkt zu rücken. Diese Zielsetzungen verdanken sich den zentralen Erkenntnissen, die die geschlechtsspezifisch auswertende Rechtsextremismus- und Gewaltforschung hervorgebracht hat. Danach ist unter quantitativen Aspekten ein deutlicher Jungen- und Männerüberhang im politischen Rechtsaußen-Lager zu registrieren: Rd. 2/3 der WählerInnenschaft rechtsextremer Parteien und Listen sind männlich. Dies gilt nicht nur in jüngerer Zeit, sondern auch schon für die ersten Erfolge von SRP und NPD in den 50er bzw. 60er Jahren der Bundesrepublik Deutschland. Der Befund ist daneben auch nahezu gleich für alle Typen von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen) und für unterschiedliche Organisationen und Wählervereinigungen innerhalb des rechtsextremen Spektrums. In der Mitgliedschaft rechtsextremer Organisationen bilden Männer bzw. Jungen im allgemeinen mindestens 3/4 des Potenzials, häufig auch mehr. Auf der Funktionärsebene entsprechender Vereinigungen sind sie mit einem noch einmal deutlich stärkeren Gewicht vertreten. Hier stellen sie meist 85 – 95% der Pöstcheninhaber. Innerhalb der unorganisierten Rechtsaußen-Szene, einer Gruppierung, die in den letzten Jahren nach Verfassungsschutzerkenntnissen stetig anwächst, insbesondere junge Leute anspricht und sich besonders gewaltbereit und militant geriert, sind fast ausschließlich (junge) Männer vertreten. Die wenigen weiblichen Szene-Angehörigen werden maximal auf 10 – 20% des Gesamtaufkommens geschätzt. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass sie sich eher in den Randbereichen der recht(sextrem)en Subkultur(en) aufhalten, meist eher über die Freundschaft bzw. Partnerschaft mit jungen Männern angebunden, kaum einmal als politisch eigenständig denkende und agierende Personen aktiv sind und sich ihr Dabeisein entsprechend fluktuativ gestaltet. Im absoluten 'Härtebereich' von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, also dort, wo nachweislich politisch motivierte (oder wenigstens so konnotierte) Gewalttaten begangen werden, findet sich eine noch erdrückendere maskuline Dominanz: Rd. 95% der entsprechend orientierten Gewalttäter der letzten Jahre sind männlichen Geschlechts (vgl. auch Eckert/Willems 1996). Auf der Einstellungsebene von Fremdenfeindlichkeit finden neuere Untersuchungen hingegen kaum noch einen zahlenmäßigen geschlechtsspezifischen Unterschied (vgl. z.B. Stöss 2000, bes. 32), ja registrieren z.T. sogar weibliche Probanden als fremdenfeindlicher (vgl. zusammenfassend: Boehnke/Baier 2001, 44), so dass der Schritt dazu, 137 Ungleichheitsvorstellungen mit Gewalt zu verbinden und so eine rechtsextreme Orientierung gleichsam 'im Vollbild' zu dokumentieren, auf Traditionen männlicher Sozialisation zurückzuführen zu sein scheint (so auch die Einschätzung ebd.). Ein Vergleich der Qualität rechtsextremer bzw. fremdenfeindlicher Orientierungen bei Jungen und Mädchen ergibt in Zusammenfassung eigener Forschungsbefunde (vgl. Möller 2000a) phänomenografisch zunächst hinsichtlich der weiblichen Jugendlichen: Rechtsextreme Orientierungen werden von Mädchen nicht nur seltener vorgebracht, sie werden bis auf seltene Ausnahmen (vgl. Bruhns/Wittmann 2001, 2002) von ihnen auch weniger offensiv-aggressiv und weniger offen gezeigt. Mädchen gerieren sich in ihren Ungleichbehandlungsforderungen (z.B. gegenüber Ausländern) weniger provokativ. Entsprechend klingen solche Orientierungen bei Mädchen weniger brüsk. Sie plädieren bspw. – wie verschiedene Studien zeigen - in deutlich geringerem Maße als Jungen für eine Parole wie "Ausländer raus!", sprechen sich aber in nahezu gleicher Anzahl wie sie für die "Verringerung des Anteils der Ausländer in Deutschland" aus. Rechtsgerichtete Mädchen begnügen sich eher als gleich orientierte Jungen damit, ihre Position verbal kenntlich zu machen. Manchmal ist ihr Gewaltdiskurs sogar zugespitzter (vgl. Bruhns/Wittmann 2001, 2002). Die Schwelle zu politisch verstandener Aktion scheint für sie höher zu sein. Wie damit schon angedeutet, kleiden Mädchen auch ihre Ausgrenzungsforderungen oder –aktionen im allgemeinen in geringere Härtegrade. Sie formulieren 'weicher' und (re)agieren weniger vehement. Werden von Mädchen Ungleichheitsvorstellungen geäußert, so wird sich im allgemeinen von ihnen Mühe gegeben, sie auch begründen zu können. Hinzu kommt, dass diese Begründungen subjektiv mit gleichsam 'moralischen Legitimationen' versehen werden. Bspw. wird für die Rückführung von AsylbewerberInnen bzw. die Abschaffung des Asylrechts eingetreten, um „unsere deutschen Penner und Obdachlosen“ mit den dann frei werdenden finanziellen Mitteln besser versorgen zu können. Rechtsextreme Orientierungen bei Mädchen wirken im Vergleich zu denen von Jungen weniger eskalativ. Dadurch, dass sie kaum oder gar nicht Provokationswert haben (sollen), wird auch seltener Gegenwehr (z.B. von ausländischen Cliquen) herausgefordert, über die dann eine Eskalationsspirale in Gang gesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang spielt eine bedeutende Rolle, dass Mädchen in geringerem Maße, in geringerer Stärke und insgesamt wechselhafter als Jungen in rechte Cliquen integriert sind, deshalb auch ihre womöglich vorhandenen einschlägigen, z.B. fremdenfeindlichen Orientierungen weniger durch Pöbeleien und handgreifliche Aktionen im Cliquenverbund an den Tag legen. Sie werden so zum ersten weniger auffällig, sind zum zweiten weniger in die Rituale und Automatismen von Cliquenhändeln involviert und sehen sich zum dritten weniger gezwungen, in diesem Kontext nach Halt und Schulterschluss im Kampf zu suchen. Die 'rechte' Gewaltakzeptanz hat im Einklang mit dem Geschilderten bei Mädchen fast immer eine andere Kontur. Dies nicht in dem Sinne, dass sie prinzipiell nicht vorhanden wäre. Allerdings liegt ihr Schwergewicht auf der Akzeptanz fremdausgeübter Gewalt. Nur sehr selten suchen Mädchen sich politisch mittels Faust oder Waffe selbst durchzusetzen. Weitaus eher und mindestens so stark wie Jungen setzen sie auf eine rabiat durchgreifende Staatsautorität. Oder sie delegieren ihre gewaltsamen Durchsetzungswünsche an ihre männlichen Altersgenossen. Dabei kann diese Delegation von Duldung über Billigung bis hin zu Stimulation von männlicher Gewalt als Stellvertretergewalt reichen. Bei all dem ist leicht nachvollziehbar, dass weibliche Jugendliche sich kaum handgreiflich mit männlichen Gegnern anlegen. 138 Dies bedeutet freilich nicht, dass sie nicht Ziel von Ausgrenzungsforderungen wären. Häufiger und deutlicher als männliche Jugendliche beklagen weibliche Jugendliche die von Nichtdeutschen ausgehende sexuelle Gewalt bzw. deren Bedrohlichkeit und konstruieren sie als Ab- bzw. Ausweisungsgrund. Dabei muss offen bleiben, ob sich hierin der Grad einer realen Bedrohung durch Nichtdeutsche widerspiegelt oder ob damit eine Ethnisierung von Sexismus betrieben wird. Im letzteren Fall würde ein allgemein bestehender männlicher Sexismus im Einklang mit einer auch an anderen Fronten der innergesellschaftlichen Auseinandersetzung erfolgenden Ethnisierung sozialer Konfliktlagen einseitig auf "Ausländer" attribuiert. Die Kontur der rechtsextremen bzw. fremdenfeindlichen Orientierungsbestände bei männlichen Jugendlichen ergibt sich zum einen aus dem im obigen Vergleich implizit angedeuteten geschlechtsspezifischen Gegenbild, zum anderen aber genauer durch folgende Phänomene: In bemerkenswerter Weise ausschlaggebend für das Entstehen und die Entwicklung rechtsextremer Selbst-Positionierungen ist bei Jungen die Einbindung in eine gleichgestimmte Clique. Nicht Cliqueneinbindung an sich, sondern eine bestimmte Anlage der hier vorfindlichen Gleichaltrigenbeziehungen bietet der Verkoppelung von Gewaltakzeptanz und Ungleichheitsvorstellungen ein Anwendungsfeld. Die stete Alltagspräsenz dieser Beziehungen und die hohe Bedeutung, die ihnen von Seiten der Jugendlichen attribuiert wird, sind geeignet, ein dauerhaftes Verhaltensmuster aufzubauen, zu verdichten und zu habitualisieren. Der Kern der Beziehungsstruktur liegt dann darin, dass man sich cliquenförmig in (meist größeren) jungendominierten Gruppen zusammenschließt, sich in diesen Verbünden an öffentlichen Orten aufhält, sich primär über die Gemeinsamkeit von Aktivitäten und jugendkulturellen Vorlieben definiert, einen traditionellen Männlichkeitsstil interpersonaler Dominanz begleitet von hohem Alkohol- und Zigarettenkonsum pflegt, Territorialkonflikte und ggf. andere interethnische Konkurrenzen mit männlichen 'ausländischen' Jugendlichen violent austrägt. Nur der letzte Punkt ist der, der 'rechte' Cliquen von anderen gewaltförmig auftretenden unterscheidet. Das 'Rechtssein' baut sich also im wesentlichen über eine Frontstellung gegenüber Gruppierungen männlicher ausländischer (oder prima facie "ausländisch" wirkender) Jugendlicher auf. Sie werden entweder in der Schule oder - häufiger - im Freizeitbereich als bedrohlich wahrgenommen. Der Männlichkeitsstil interpersonaler Dominanz besteht dabei darin, einen maskulin konnotierten Kampfesmut herauszustellen, bspw. über die Selbstinszenierung als Beschützer von Schwachen und vorgeblich Verfolgten der eigenen sozialen bzw. nationalen Einheit, die eigene heterosexuelle Potenz demonstrativ unter Beweis zu stellen bzw. bei tatsächlichen oder vermeintlichen Angriffen auf sie ohne Zögern spontan (mindestens potenziell) violente Wehrhaftigkeit zu zeigen, im Falle eines erlebten Angriffs auf sie, die Familienehre und dabei insbesondere die Ehre von Mutter und Schwestern stante pede zu verteidigen; dies dadurch, den wahrgenommenen Angreifer sofort vehement und ggf. unter Androhung oder Ausübung von Gewalt zurechtzuweisen. 139 Eine politische Färbung erhalten die Gewaltsamkeiten, die als Kraftprotzereien und Revierstreitigkeiten beginnen, erst damit, dass Ungleichheitsvorstellungen einbezogen werden. Man ethnisiert z.B. diese Ebene und greift damit auf Wahrnehmungsschemata zurück, die in einer nationalstaatlich verfassten Gesellschaft wie der deutschen den Globalisierungstendenzen der Arbeitsmärkte zum Trotz gang und gäbe sind. Setzt man das Auftreten von Gewaltakzeptanz und das von Ungleichheitsvorstellungen in ein zeitliches Verhältnis, so zeigt sich deutlich, dass die Entwicklung der letzteren im allgemeinen bei Jugendlichen gegenüber Gewaltbereitschaft und -tätigkeit nachgängig sind. Nicht weil Jugendliche bestimmte politische (latente oder manifeste) Überzeugungen hätten und sie real umsetzen möchten, setzen sie auf Gewalt. Vielmehr statten sie ihre maskulinistischen, von der Suche nach männlicher Identität bewegten Gewaltförmigkeiten mit einem zunehmend von ihnen selber politisch gedeuteten Motivationshintergrund und Legitimationshorizont aus. Von ihnen ausgehend entwickeln sie nach und nach an Schärfe gewinnende pauschalisierende Bilder von Fremden, weiten ihre Vorbehalte ihnen gegenüber aus und sind weniger zum Aufbringen von Verständnis ihnen und ihrer Lebenssituation gegenüber bereit. Dadurch wiederum scheint ihre Gewaltschwelle gegenüber 'Ausländern' zu sinken, was dann wieder zu einer Vermehrung von interkulturellen Konfliktsituationen für sie führt. Offenbar bildet (hier einmal ungeachtet weiterer wichtiger personaler und sozialer Faktoren des Erfahrungszusammenhangs und seiner durch das Subjekt vorgenommenen Strukturierung; dazu: Möller 2000a) die rechte Clique einen Kristallisationspunkt in vielerlei Hinsicht: In ihrem Rahmen findet nicht nur die nicht-rechte maskuline Selbstinszenierung mit den ihnen inhärenten Gewaltförmigkeiten statt, sie bietet auch einen sozialen Rahmen, in dem sich Mannhaftigkeit mit der der überkommenen Beschützer-Funktion entlehnten tatkräftigen Sorge um "Recht und Ordnung", mit nationaler Gesinnung und soldatischen Tugenden (Kameradschaft u.ä.) ausweisen kann. Auf der Suche nach männlicher Identität und im Interesse an einer Überwindung kindlicher Identität werden hier in Selbstorganisation Jugendlicher Angebote greifbar, die deshalb verlockend sind, weil sie traditionelle Männlichkeit auf eine Weise lebbar machen, die radikal ist und angesichts von mangelnder Selbstsicherheit gerade deshalb Selbstgewissheit verspricht. Sie suggerieren: Ein rechter Mann ist in jedem Fall ein echter Mann. Er ist diesbezüglich über jeden Zweifel erhaben. Im Cliquenkontext laufen Geschehnisse ab, die eine Vermittlung von Gewaltakzeptanz und Ungleichheitsvorstellungen begünstigen. Gewalthaltige interethnische Konfliktaustragungen sind die Ereignisse, über die sie erfolgt. Darüber kann eine gesellschaftliche und politische Selbstverortung erfolgen. In gewisser Weise kommen damit rechte Cliquen der Entwicklungsaufgabe entgegen, sich ein gesellschaftliches und politisches Werte- und Normensystem anzueignen und innerhalb dessen handlungsfähig zu werden. Rechte Cliquen bieten einen Standpunkt an, dessen Einnahme sich im wesentlichen über die Erfüllung von zwei intellektuell relativ anspruchslosen Voraussetzungen realisieren lässt: die Beteiligung an interethnischer Gewalt und das Zurschaustellen rechter Symbolik. Kaum irgendwo anders ist die politische Positionierung so einfach. Denn die Gesellschaft insgesamt, insbesondere die Medien, erleichtert sie dadurch, dass sie 'rechte' Jugendliche ganz weitreichend und nahezu vollständig genau über diese beiden Verhaltenselemente identifiziert. Insoweit kann es nicht ausbleiben, dass man sich als 'rechter Junge' nicht nur in Gegnerschaft zu Ausländern, primär männlichen ausländischen Jugendlichen, sieht, sondern auch in Frontstellung gegenüber "Linken" und "Autonomen", wobei 140 deren Definition im Kern über deren Ausländerfreundlichkeit, bestimmte Treffs und symbolische Ausstattungsmerkmale (lange und/oder gefärbte Haare, "linke" Rockmusik u.ä.m.) verläuft. Hier kann die gegenseitige Bestätigung der ihr Angehörigen in ihren Auffassungen und ihrem Handeln durch Wiederholungstendenzen der immer gleichen Konflikterfahrungen und darüber Angleichung der jeweiligen Deutungen der Einzelnen erfolgen. Indem die Clique zum eigentlichen Bezugspunkt der Aktivitäten und Meinungsbildungen wird - und dies für alle Beteiligten - zieht sie ihre Mitglieder in ihren Bann. Die Clique kann als Ort politischer Information fungieren. Eher selten und meist nur nach einer gewissen Lebensdauer der Gruppe hat diese Information den Charakter einer gegenseitigen (oder eher von außen heran getragenen) ideologischen Unterrichtung. Häufiger finden Elemente recht(sextrem)er Kultur (Fahnen, Plakate, CDs, Aufnäher u.ä.) Eingang. Sie bauen weniger ein ideologisches Gerüst als einen recht(sextrem)en Symbolraum auf; dies mit mindestens drei Folgen: Zum ersten verfestigt sich bei den in ihm Befindlichen die politische Selbstpositionierung. Zum zweiten nehmen auch Außenstehende eine Verdichtung der Rechtsorientierung wahr, zumal sie ja gerade im allgemeinen gewohnt sind, entsprechende Zuschreibungen über solche äußeren Signets vorzunehmen. Zum dritten verringert sich durch das Zusammenspiel beider Prozesse die Wahrscheinlichkeit von gegenseitigem Kontakt, Kommunikation und damit Verstehen. Die jugendkulturelle Einbindung in eine rechte Szene und Symbolik verleiht der Clique somit Stabilisierungskraft. Dies gilt um so mehr, als sich darüber automatisch Gegnergruppen auftun: Jugendkulturen, die als Feinde wahrgenommen werden, Rapper z.B., unter denen sich zahlreiche ausländische Jugendliche befinden. Trotz solcher Homogenisierungstendenzen nach innen kann nicht übersehen werden, dass nicht nur das rechtsorientierte Weltbild der einzelnen Mitglieder (noch?) nicht geschlossen ist, sondern auch die Clique insgesamt nicht immer ein Hermetik aufweist, die anders orientierte Jugendliche nicht duldet. Suchen wir nach Erklärungen für die hier nur sehr ausschnitthaft in Beschränkung auf einige besonders wichtige Phänomene wiedergegebene geschlechtsspezifische Kontur und Struktur rechtsextremer Orientierungen bei Jungen und Mädchen, so stoßen wir alsbald auf die Vermutung, Ursachen für die festgestellten Differenzen in den Eigenarten geschlechtsspezifischer Sozialisation suchen zu müssen. In Hinsicht auf Jungensozialisation und das Ziel des Aufbaus männlicher Identität scheint es, als wirkten noch weitgehend unverändert überkommene Männlichkeitstraditionen, ja fast archaisch anmutende geschlechtstypische Leitbilder fort. Sie zielen auf das Erbringen von Männlichkeitsbeweisen primär auf den von Gilmore (vgl. 1991) für männlich hegemonialisierte Gesellschaften (dazu: Connell 1999) festgestellten maskulinen Zuständigkeitsfeldern der Erzeugens von Nachwuchs sowie des Versorgens und Beschützens der eigenen sozialen Einheit. Insoweit männliche Jugendlich altersgemäß und sozial noch nicht in der Lage sind, lebendige Nachweise ihrer Zeugungsfähigkeit zu erbringen, sehen sie sich um so mehr aufgefordert, etwaige Zweifel an ihrer Potenz sowohl von vornherein auszuräumen als auch ihnen im Falle ihrer Äußerung strikt entgegenzutreten. Entsprechend wichtig erscheint ihnen meist die machtvolle Demonstration der eigenen Heterosexualität nach außen. Auf Anwürfe, die ein diesbezügliches Versagen beinhalten (könnten) (wie in gängigen Beschimpfungen wie "Du schwule Sau", "Du Wichser") reagieren sie entsprechend prompt reaktant. Eine ethnisierende Konnotation erhält dieser Mechanismus dann, wenn solche Mutmaßungen und 141 Beschimpfungen in interethnischen Auseinandersetzungen zum Zwecke gegenseitiger Diffamierung zwischen männlichen Jugendlichen eingesetzt werden uns sie mit ethnischnationalen Zuordnungen amalgamieren ("deutsche Wichser", "schwule Türkensau"). Da die eigenen Fähigkeiten zu Versorgungsleistungen gegenüber den Angehörigen der privaten Lebensform (z.B. der Familie) im Jugendalter ebenfalls in der Regel noch nicht unter Beweis gestellt werden können, wird über die Demonstration eines möglichst souveränen Umgangs mit Werkzeugen und Technik (heute vor allem mit Fahrzeug- und Informationstechnik) und ihren Erwerb das prinzipielle Vermögen vorgeführt, wertvolle Gebrauchsgüter in Besitz nehmen und sicher handhaben zu können. Damit können zumindest die Insignien eines männlichen Erwachsenenlebens vorgewiesen werden. Ihr Nichtbesitz und die Unfähigkeit, sie – wie auch immer - zu erwerben, kann beim Gegner als Soll auf dem Konto von Männlichkeitsbeweisen verbucht werden. Ökonomische Ungleichheiten zwischen Deutschen und Nichtdeutschen können in dieser Weise als Differenzen in der Kompetenzen oder dem Willen, für die 'Seinen' zu sorgen und damit sozial positiv legitimierte Männertugenden einzulösen, gedeutet werden. Beschützen schlägt sich als Charakteristik des männlichen Tätigkeitsspektrums bspw. in der Männer-Dominanz innerhalb der Streitkräfte oder der Strafverfolgungsbehörden nieder. Da männliche Jugendliche noch keine Gelegenheit haben, innerhalb dieser sozial akzeptierter Einrichtungen ihre Beschützerkompetenzen an den Tag zu legen, agieren sie sie vielfach über Waffensymbolik (u.a. bei Computerspielen) und Territorialkämpfe aus. Der in interethnischen Cliquenzwistigkeiten von Jugendlichen ausgetragene Kampf um Raum (z.B. um Straßenzüge und die Vorherrschaft in Wohnvierteln) stellt insofern nichts anderes dar als die Ethnisierung männlicher Konkurrenz. Auffällig ist nämlich, dass es (nahezu) rein männliche Händel sind, die hier ausgetragen werden. Auch von ihren Anlässsen, Ritualen und Automatismen her, sind sie weit eher als Versuche der Erbringung von Maskulinitäts- denn als ethnischen oder nationalen Zugehörigkeitsbeweisen angelegt. Die Tendenzen zur Individualisierung von Männlichkeit(en) haben offenbar auf diese pubertären Auseinandersetzungsformen noch kaum Einfluss, so dass tief verwurzelte Maskulinitätstraditionen nachwirken können, auf denen Ethnisierungen und Nationalismen aufbauen können, wenn, vor allem im Freizeit-, Schul- und Wohnbereich, entsprechende Gelegenheitsstrukturen bestehen. Fokussieren wir auf 'rechte' Mädchen, so scheinen für sie die Modernisierungen der Geschlechtervorstellungen stärker durchzuschlagen. Danach wirkt es so, als konkurrierten bei ihnen Faktoren des traditionellen weiblichen Sozialisationsstrangs mit Anforderungen einer altersspezifischen Identität, die im Kern auf den – früher nur männlichen Jugendlichen zugestandenen – Beweis von Eigenständigkeit bezogen ist. Auf der einen Seite zeigt sich: Im Sozialisationsverlauf auch von 'rechten' Mädchen entfalten die überkommenen Weiblichkeitszumutungen nach wie vor ihren Einfluss. Der Erwerb einer geschlechtsspezifischen Identität erfolgt danach über die Internalisierung von Eigenschaften wie Häuslichkeit, Fürsorglichkeit, Zurückhaltung, Friedfertigkeit, Unterordnung u.ä.m. Der hohe Wert dieser Elemente für die weibliche Identität wird bereits in der Mädchenkindheit vermittelt, bestimmt nahezu unverändert auch die biografische Phase der (weiblichen) Jugend und wird auch dem späteren Frausein zugesprochen. So ist erklärlich, dass Mädchen im Hinblick auf offen ausgrenzende Positionen und rechtsextreme bzw. fremdenfeindliche Aktionen weitaus zurückhaltender sind als Jungen und nicht die selbe Rigorosität bei der Durchsetzung ihrer Ungleichheitsvorstellungen zeigen. Auf der anderen Seite werden Mädchen in der Jugendphase auch mit Ansprüchen konfrontiert, die aus dem gesellschaftlichen Auftrag an diese biografische Phase resultieren und als solche mit den eben erwähnten Anforderungen an die Herausbildung einer geschlechtsspezifischen Identität des traditionellen Musters konfligieren. Es sind dies 142 Erwartungen, die angesichts einer gewissen Angleichung der Geschlechterlaufbahnen im Jugendalter nicht mehr auf männliche Jugendliche allein bezogen, sondern relativ geschlechtsneutral wirksam geworden sind und so heutzutage relativ neu auf die Masse der Mädchen zukommen: z.B. eigenständig außerfamiliale Kontakte zu erschließen, eigene Interessen durchzusetzen, offensiv Ansprüche zu stellen, Auseinandersetzungen einzugehen, kurzum: eine eigenständige Identität vorzuweisen. Im Spagat zwischen dem konventionellen weiblichen Sozialisationsstrang und seinen geschlechtsspezifischen Identitätselementen einerseits und den Herausforderungen der individualisierten Jugendsozialisation mit den Ansprüchen nach altersspezifischer eigenständiger Identität andererseits werden für Mädchen Handlungs- und Orientierungsprobleme heraufbeschworen, die schwer zu lösen sind. Dies gilt vor allem dann, wenn die zwei wichtigsten Sozialisationsinstanzen Schule und Elternhaus als Akzeptanzstellen oder gar Unterstützerinnen eigenständiger Identität ausfallen, keine entsprechenden (oder nur unzureichende) Angebote zum Selbstwertaufbau machen und lebbare Vorbilder für so etwas wie 'postkonventionelle Weiblichkeit' nicht vorhalten. Nach unseren Forschungen (vgl. näher Möller 2000a) wird dann die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Autonomisierung der eigenen Person über drei letztlich wenig tragfähige Wege angegangen wird: eine unkonstruktive, nur aus der defensive heraus erfolgende Revolte gegen elterliche und oder schulische Werte, ein Selbstpräsentation als 'sexualisierte Frau' und/oder eine Selbstpräsentation als Teilhaberin an Jungen-'Autonomie', letztere über die Kopie von Männlichkeitsmustern im Sinne einer "verqueren Emanzipation" (dazu: Möller 1995b) und/oder über die spontane und unreflektierte Solidarisierung mit den "eigenen" Jungen (z.B. der Clique oder Nation) und über das (dadurch zumindest und fast immer nur subjektive) Gleichwertigkeitserleben z.B. im Cliquenrahmen. Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen müssen vor diesem Hintergrund zum einen im Zusammenhang mit ihrer Funktion für die Identitätsbildung gesehen und zum anderen mit den Differenzierungen männlicher und weiblicher Identitätsentwicklung erklärt werden. Erfahrungen mit geschlechtsreflektierenden Ansätzen liegen in Bezug auf 'rechte', rechtsextrem orientierte und fremdenfeindliche Jugendliche nur sehr vereinzelt vor. Auch wenn die Dringlichkeit geschlechtsreflektierenden Arbeitens mit 'rechten' Jungen besonders groß erscheint (s.o.), stellt sich der Eindruck ein, dass, wenn überhaupt der Anspruch bzw. Versuch geschlechtsreflektierenden Arbeitens erhoben bzw. gemacht wird, er sich noch am ehesten auf die Zielgruppe der Mädchen/jungen Frauen bezieht (vgl. Lutzebäck u.a. 1995; Engel/Menke 1995). Die hierbei gesammelten Erfahrungen sind eher ernüchternd, vor allem aus drei Gründen: Zum ersten liegt bei den rechts(extrem) orientierten weiblichen Jugendlichen bzw. bei weiblichen Jugendlichen, die sich 'rechten' Cliquen zurechnen, ohne sich deshalb eigenständig entsprechend politisch positionieren zu müssen, eine im Vergleich zu anderen Mädchen/jungen Frauen nur geringe Bereitschaft zu geschlechtsspezifischen Aktivitäten vor. Dies scheint im übrigen auch für Mädchen in allgemein gewaltbereiten Gruppen zu gelten (vgl. Bruhns/Wittmann 2002). Zum zweiten - und hier liegt möglicherweise auch ein Grund für ersteres - sind gerade diese Mädchen vielfach derart in geschlechtshierarchische Verhältnisse innerhalb ihrer jungendominierten Cliquen und/oder innerhalb ihrer Paarbeziehungen eingebunden, dass sie sich dem Willen ihrer männlichen Freunde, auf solche Aktivitäten zu verzichten, unterwerfen. Zum dritten sind rechte Szenen und Cliquen nicht nur in der Qualität ihres Sozialklimas, sondern auch rein quantitativ stark männlich dominiert, so dass für gruppen- bzw. cliquenbezogene Angebote, die sich spezifisch an weibliche Jugendliche richten, oft 143 überhaupt nur 2, 3 oder 4 Mädchen übrigbleiben, eine Anzahl, die, vor allem angesichts der sonstigen Schwierigkeiten (s.o.) kaum die Bildung einer mit einiger Dauer bestehenden Kerngruppe zulässt (vgl. auch Hafeneger u.a. 2002). Dessen ungeachtet ist durch die Beschäftigung weiblicher pädagogischer Mitarbeiter eine geschlechtsreflektierende Einzelarbeit, allerdings meist eher punktuell, und auch eine Begleitung bei Ablöseprozessen möglich und erforderlich. Geschlechtsreflektierendes Arbeiten mit Jungen und (jungen) Männern (vgl. dazu Möller 1997) hat zwar gegenwärtig in der Konzeptionsdiskussion der sozialen und pädagogischen Arbeit keinen Exotenstatus mehr, ist aber nichtsdestoweniger in praxi kaum verbreitet. So gesehen ist die äußerst geringe Erfahrungsdichte mit entsprechenden Ansätzen in Bezug auf 'rechtes' und fremdenfeindliches Klientel nicht allzu verwunderlich. Hinzu kommt: Zwischen der Fachdebatte um Rechtsextremismus und Gewalt bzw. ihren Akteuren und den in diesem Feld tätigen männlichen Sozialpädagogen/-arbeitern einerseits und den Protagonisten von Jungen- und Männerarbeit bestehen z.Zt. noch wenig diskursiv-inhaltliche und personelle Überschneidungen, gleichwohl die oben skizzierte Problemlage dazu große Veranlassung gäbe. Außerdem sorgt der enge Konnex von bestimmten Facetten traditioneller Männlichkeit und Rechtsextremismus, Xenophobie bzw. Ausgrenzungshaltungen dafür, dass die Bereitschaft, Bezüge der Geschlechtsidentität infrage zu stellen, gerade bei männlichem Klientel in 'rechten' Szenen und Cliquen kaum vorausgesetzt werden kann. Das durchaus bei den im Arbeitsfeld beschäftigten Sozialpädagogen vorhandene Bemühen um geschlechtsreflektierendes Arbeiten mit 'rechten' Jungen und jungen Männern sieht sich deshalb eher auf situative Interventionen und die Arbeit mit Einzelnen verwiesen. Entsprechend bedarf sie eines anderen, bislang noch nicht entwickelten Verständnisses von Geschlechtsreflektion als es sich in der immer noch in den Kinderschuhen steckenden geschlechtsspezifisch verfahrenden Jungengruppenarbeit abzuzeichnen beginnt. Die geschilderte Situation fordert nicht zuletzt eine auch in der Arbeit mit anderen AdressatInnen leider erst jüngst in Gang gekommene Diskussion darüber heraus, inwieweit und in welcher Weise in geschlechtsheterogenen Zusammenhängen geschlechtsreflektierendes Arbeiten möglich ist und wie dieser Ansatz stärker als durchgängiges Arbeitsprinzip denn nur als Arbeitsform verankert werden kann (Möller 2000c). Insgesamt ist – trotz verbreiteter Einsicht in die Notwendigkeit eines geschlechtsreflektierenden Arbeitens, nicht nur speziell in Hinsicht auf die Bearbeitung rechtsextremer Orientierungen bei Jugendlichen, sondern auch bzgl. des pädagogischen und sozialarbeiterischen Umgangs mit gewaltbereiten und -tätigen Jugendlichen generell – dieser Ansatz so wenig verbreitet, dass es erst recht nicht verwundert, wenn Evaluationen nicht vorliegen. Gleichwohl ist er aus theoretischer und empirischer Sicht als außerordentlich erfolgversprechend einzustufen (vgl. auch Behn/Heitmann/Voß 1995; Dembowski 2000; Bruhns/Wittmann 2001, bes. 62; Bruhns/Wittmann 2002). 3.1.11 Gewalttherapeutische Ansätze Gezielt für sozial auffällig, u.a. auch rechtsextrem straffällig gewordene Jugendliche werden ambulante erzieherische Maßnahmen nach dem KJHG und dem JGG durchgeführt. Indem sie anstreben, die im Sinne des Resozialisierungsgedankens zumeist kontraproduktiven Folgen einer Haftstrafe für junge Menschen zu vermeiden, fühlen sie sich dem Hilfe-Paradigma verpflichtet, selbst wenn sie Verfahren und Techniken einsetzen, die provokativ-konfrontativ 144 angelegt sind. Neben der Weisung, sich einem Betreuungshelfer zu unterstellen (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 JGG), der Erziehungsbeistandschaft (§ 30 KJHG) und der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung (§ 35 KJHG) sind vor allem soziale Trainingskurse, der Täter-Opfer-Ausgleich (nach § 10 Abs. 1 Nr. 6 JGG) und soziale Gruppenarbeit (nach § 29 KJHG) zu nennen. Sie sollen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, schulischen und beruflichen Integrationsproblemen sowie Verhaltensproblemen helfen und Selbständigkeit wie Sozialkompetenz fördern. Soziale Trainingskurse sind zumeist auf 3 Monate befristete Maßnahmen, die 10 bis 12 Gruppenabende mit 1 oder 2 Wochenenden oder auch 1-wöchige Kurse im Rahmen eines Halbjahres umfassen. Als kurzfristige Crash-Kurse wird ihnen wenig Erfolg attestiert, zumal die Alltagssituation der Jugendlichen durch sie nicht verändert, die Transferproblematik nicht gelöst und Elternarbeit kaum praktiziert wird. Soziale Gruppenarbeit meint (idealerweise) die von einer pädagogischen Fachkraft zusammen mit Ehrenamtlichen über eine Zeit von 1 bis 2 Jahren hinweg begleitete Kleingruppe Jugendlicher mit einer Betreuungszeit von 4 bis 12 Stunden wöchentlich. Schon aufgrund ihrer langfristigen Anlage kann sie eher als der Trainingskurs das soziale Umfeld einbeziehen und z.T. auf lebensweltlichen Gruppenzusammenhängen aufbauen. In beide Typen hinein fällt u.a. auch das Gruppendynamische Aggressionsschwellentraining (GAT), das im Saale-Holzland-Kreis im Rahmen eines Tatbezogenen Interventionsprogramms für jugendliche Straftäter (TIPRO) von September 1999 bis Mitte 2001 60 Jugendliche zwischen 14 und 22 Jahren durchliefen. Ansatzpunkt ist der auf gut 40 Trainingsstunden angelegte Versuch, durch eine Erhöhung von Selbstaufmerksamkeit und die Markierung der für das aggressive Verhalten entscheidenden Tatablaufpunkte den Ausbruch von Aggression zu verhindern. Dazu werden gruppendynamische Prozesse genutzt, konfrontativ-provokative Methoden eingesetzt und in späteren Phasen auch Wissensvermittlungen versucht. Bislang liegen nur erste Tests durch den FAF-Test vor. Sie ergeben positive Effekte bezüglich Erregbarkeit und Spontanaggression, lassen aber das konkrete Ziel, eine Veränderung des aggressiven Verhaltens, unbeobachtet. Gerade diese Evaluationsinhalte erscheinen – auch den Verantwortlichen selbst – um so wünschenswerter als 84% der Absolventen nach Abschluss des Trainings in ein straftatenbegünstigendes Umfeld entlassen werden (vgl. Jende 2001). Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) stellt den Diversions-Gedanken des Vorrangs der außergerichtlichen Konfliktregelung, der Vermittlung zwischen Täter und Opfer sowie den der Wiedergutmachung in den Vordergrund. Formatspezifisch betrachtet legt er das Schwergewicht auf die Aspekte der Begegnung und der sozialen Unterstützung. Er zielt so Hilfe für Täter und Opfer gleichermaßen an. Über ein gemeinsames Gespräch und eine Entschuldigung des Täters, konkrete Arbeitsleistungen des Täters für den Geschädigten, gemeinsame Aktionen von Geschädigten und Tätern sowie symbolische VersöhnungsGeschenke soll das Entschädigungs- bzw. Wiedergutmachungs-Interesse des Opfers gesichert, eine Einstellung stigmatisierender Strafverfolgung oder eine Absehung von ihr erreicht, die Relevanz der Einhaltung gesellschaftlicher Normen verdeutlicht, ein Perspektivenwechsel ermöglicht und ein gangbares Konfliktregelungs-Modell erlernt werden. Der Täter-Opfer-Ausgleich wurde im Nachgang zur Etablierung der Viktimologie in den 70er Jahren seit Mitte der 80er Jahre in Deutschland erprobt und 1990 mit dem 1. JGGÄndG flächendeckend eingeführt (vgl. v.a. §§ 10, 45 und 47 JGG), im Erwachsenenstrafrecht 1994 ermöglicht (vgl. § 46a, § 49, Abs. 1; § 56b Abs. 2 Nr. 1 und § 59a Abs. 2 Nr.1 StGB), 1999 durch eine Änderung der Strafprozessordnung ausgebaut (vgl. § 153a und §§ 155a und b StPO) und im Zivilrecht ab 2000, entsprechende Landesregelungen vorausgesetzt, in Kraft gesetzt. In rd. 400 Einrichtungen wird er in organisatorisch unterschiedlichen Formen bei 145 großen regionalen quantitativen (Fallzahlen) und qualitativen (Orientierung an den TOAStandards der Deutschen Bewährungshilfe) Anwendungsdifferenzen durchgeführt (vgl. Wandrey 1999). Fast ¾ der Delikte machen Gewalt- und Körperverletzungsdelikte aus; fast 90% werden zu einem erfolgreichen Abschluss geführt. Ebenfalls in ¾ der Fälle kommt es zu einer persönlichen Begegnung von Täter und Opfer. Es wird noch erheblicher Spielraum der Zahl der TOAs nach oben gesehen, wenn von Rechtspraktikern davon ausgegangen wird, dass die Erfahrungen insgesamt positiv sind (vgl. auch Messmer 2000) und dass 15% – 30% aller anklagefähigen Jugendstrafverfahren durch Schlichtung abgeschlossen werden könnten (vgl. z.B. Spahn 2001). Umstritten ist die auch bei leichteren rechtsextremen Propagandadelikten in seltenen Fällen praktizierte Einschaltung von Diversionsmittlern, wie sie nach der Berliner Diversionsrichtlinie unmittelbar nach polizeilicher Vernehmung und nur telefonischer Absprache mit der Staatsanwaltschaft ohne eingehendere rechtliche Prüfung in Kooperation mit der Jugendhilfe im Interesse an einer schnellen Reaktion auf Straftaten Jugendlicher möglich ist (vgl. SPI 2001). Erfahrungen von TOAs mit rechtsextrem bzw. antisemitisch oder fremdenfeindlich motivierten Tätern liegen jedoch nur in geringer Zahl, meist bezogen auf leichtere Deliktformen und für Fälle vor, bei denen das/die Opfer vorwiegend Interesse an der Wiedergutmachung des materiellen Schadens hat/haben. Als Schwierigkeit erweist sich dabei oft dreierlei: Zum ersten spielt bei den 'Rechten' der ideologische Hintergrund der Taten insoweit eine oft entscheidende Rolle, als er die Bereitschaft zu Entschuldigung, Entgegenkommen und Wiedergutmachung erschwert, weil das Subjekt sich – stärker als bei einem nur instrumentell motivierten Delikt – in einem Zwiespalt sieht zwischen möglicher Einsicht oder zumindest Zweckverfolgung (Strafvermeidung) einerseits und ideologischer Überzeugung andererseits. Zum zweiten erweisen sich die Konformitätsverpflichtungen, die gegenüber der rechtsextremen Gruppe empfunden werden und aufgrund hierarchischer Gruppenstrukturen dem Delinquenten meist unmissverständlich deutlich gemacht werden, als Hindernisse für ein erfolgreiches Ausgleichsverfahren. Zum dritten scheint es aber auch schwierig zu sein, für öffentlich sichtbare Zeichen von Wiedergutmachung Kooperationspartner bei Organisationen zu finden, die tätiger Reue eines rechtsextrem motivierten Täters innerhalb ihrer Einrichtung Raum geben können. PraktikerInnen des TOA berichten dennoch von ähnlichen Erfolgsquoten wie bei nicht politisch motivierten Tätern. Exaktere evaluative Einschätzungen lassen sich aber aufgrund der geringen Fallzahlen und fehlender Aufzeichnungen von Fallbearbeitungen nicht anstellen. Vereinzelt vorliegende internationale Erfahrungen mit Ausgleichsverfahren geben zur Hoffnung Anlass, sie auch bei schwereren Gewaltdelikten und auch im Falle von fremdenfeindlichen Auseinandersetzungen einsetzen zu können. Ihr Erfolg ist danach nicht nur darin zu sehen, dem Täter härtere Strafgrade ersparen und ihn leichter resozialisieren zu können. Er liegt vor allem auch für das Opfer in dem Umstand, so die Tat besser verarbeiten zu können (vgl. Roberts 1995; Aertsen 1999; Gotsbachner 1999). Allerdings sind auch nachträgliche Bedenken von Opfern bekannt. So wird dann auch vor einer Schwächung der Rechtsstellung des Opfers gewarnt und die letztlich noch mangelhafte Nachweislage im Hinblick auf eine nachhaltige Positivwirkung auf das Unrechtsund Verantwortungsbewusstsein des Täters kritisiert (vgl. Eisenberg 2000). Das Anti-Aggressivitätstraining (AAT) ist eine sozialpädagogisch-psychologische Behandlungsmaßnahme für gewalttätige Wiederholungstäter. Ihr Kern besteht es aus einem 6 Monate währenden Curriculum von wöchentlich zwei ein- bis dreistündigen Sitzungen. Den zentralen methodischen Ankerpunkt bildet dabei die Technik des "Heißen Stuhls": Der Klient nimmt auf ihm Platz und erfährt eine stark konfrontativ und provokativ angelegte Behandlung. Sie besteht darin, dass die betreffende Person mit ihrer Tat, 146 ihrem sonstigen aggressiven Verhalten und den Folgen für die Opfer von Seiten der Therapeuten wie auch von Menschen, die die Behandlung bereits durchlaufen haben, konfrontiert wird. Diese Art der Gesprächsführung wird von einfühlsameren Einzelgesprächen und freizeitpädagogischen Maßnahmen ergänzt. Das Leitziel des Abbaus aggressiven Verhaltens wird durch die Orientierung an sechs Lerninhalten umzusetzen gesucht: 1. Einerseits wird die gewalttätige Unterwerfung von Opfern als Mittel des Selbstwertgewinns des Täters, als "Tankstelle des Selbstbewusstseins" thematisiert. Andererseits wird verdeutlicht, dass diese Form der Selbstwertsteigerung gesellschaftlich nicht akzeptiert und deshalb negativ sanktioniert wird. Im Sinne einer Kosten-NutzenAnalyse soll der Täter daher lernen, dass jede weitere Gewalttat Freiheitsverluste (Haftzeit) mit sich bringen wird. 2. Das Durchgehen von erlebten Situationen, die aggressionsauslösend waren, verfolgt das Ziel, dem Delinquenten seine individuelle Aggressivitätshierarchie bewusst zu machen, damit er den verspürten Zwängen gewalttätiger Reaktion in solchen Situationen zukünftig nicht mehr ausgeliefert ist und mit Handlungsalternativen wie Rückzug aus dem Geschehen oder Schlichtung einer Eskalation vorbeugen kann. 3. Der Betreffende soll in die Lage versetzt werden, ein Selbstbild aufzubauen, das die persönlichen Vulnerabilitäten respektiert. Das Idealselbst der Unangreifbarkeit durch Härte soll mit einem Realselbst konterkariert werden, das die eigene Verletzlichkeit eingestehen kann. 4. Neutralisierungstechniken, die Schädiger anwenden, um ihre Taten vor anderen und teils auch vor sich selbst zu legitimieren, sollen als inakzeptable Rechtfertigungsverfahren verstehbar werden. Eine Konfrontation mit den Opferfolgen soll Schuld- und Schamgefühle wecken. 5. Dadurch dass Ängste und Schmerzen des Opfers thematisiert werden, soll die Opferperspektive auch soweit übernommen werden können, dass Empathiefähigkeit erzeugt bzw. gesteigert wird. 6. Mittels Provokationstestes werden die persönlichen Aggressionsgrenzen im Schonraum des Behandlungssettings psychodramatisch getestet und desensibilisiert, um Reaktanzen systematisch bewusst zu machen und darüber abbauen zu können Das Training begreift sich erstens als Versuch der Förderung von Handlungskompetenz, die auf Empathie, Frustrationstoleranz, Ambiguitäts- und Ambivalenztoleranz sowie Rollendistanz aufruhen kann; es könnte die Sinnfälligkeit dieser Zielrichtung frustrationstheoretisch begründen (vgl. kurz: Schubarth 2000, 16 f.); zweitens als Förderung prosozialen Verhaltens über die Entwicklung von Fähigkeiten der Perspektivenübernahme und drittens als Weiterentwicklung des moralischen Bewusstseins in Richtung auf postkonventionelle Moralvorstellungen im Sinne Kohlbergs. Theoretischer Hintergrund ist ein lerntheoretisch-kognitives Paradigma. Danach ist Aggression als ein ubiquitär verbreitetes Verhaltensphänomen aufzufassen, das im Austeilen schädigender Reize gegen einen Organismus (oder sein Surrogat) besteht. Aus seiner Beobachtung ist Aggressivität als Bereitschaft zu aggressivem Verhalten ableitbar. Die Interventionen zur Aggressionsreduktion folgen den Grundsätzen einer konfrontativen Pädagogik (vgl. auch Redl 1979, 1987; Corsini 1994; Farelly/Brandsma 1994; Colla/Scholz/Weidner 2001), die sich selbst als ultima ratio versteht. Ein autoritativer Stil mit deutlichen Grenzziehungen im Sinne einer "klare(n) Linie mit Herz" wird als geeignete Umgangsweise gerade mit "sozialarbeits- und psychologiegesättigten Mehrfachauffälligen" betrachtet (vgl. www.prof-jens-weidner.de/konfron/konfron.html), zumal sie im Laufe ihrer 147 Sozialisation Achtung gegenüber durchsetzungsstarken Umgangsweisen entwickelt haben, Freundlichkeit aber gleichzeitig eher für Schwäche halten.. Der Einbezug von Peers in die Behandlung wird mit dem Prinzip "Jugend erzieht Jugend" in Verbindung gebracht, für dessen Sinnhaftigkeit die Konzepte von Korczak, Makarenko, Neill und Ferrainola angeführt werden (vgl. ebd.). Ziel ist es, eine Übereinstimmung von formeller und informeller Sozialisation zu erreichen. Die Trainings werden in Deutschland seit 1986 durchgeführt. Zuerst in der Jugendanstalt Hameln durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe (Heilemann u.a.) für 17- bis 25jährige Insassen entwickelt und in der ursprünglichen Form 'gefahren', wurde der Ansatz in den Jahren 1989-1991 durch Wolters sporttherapeutisch ergänzt, Ergänzungen die mit dem Ausscheiden J.-M. Wolters auf kleinere freizeitpädagogische Maßnahmen (Radfahr-Training) anschließend zurückgebaut wurden, um dann ab 1995 mit dem Ausscheiden J. Weidners und der (Wieder-)Übernahme durch Heilemann und anderen in ein weiter gestecktes Trainingsprogramm integriert zu werden, das auch Kurse zu Themen wie Rhetorik, Schauspiel, Deeskalation, ja sogar Flirten enthielt. Das AAT fand sie in den letzten Jahren bei steigender Nachfrage auch außerhalb des Strafvollzugs, etwa in verschiedenen Feldern pädagogischer und Sozialer Arbeit mit leichten Modifikationen als Anti-Gewalttraining (AGT) bzw. Coolness-Training (CT) Anwendung: z.B. in der Bewährungshilfe, sozialen Trainingskursen, im Umfeld des Täter-OpferAusgleichs, in der Jugendarbeit, in den Hilfen zur Erziehung, im schulischen Bereich (vgl. Weidner/Kilb/Kreft 1997). Es wird mit deutlich steigender Tendenz in über 20 Städten Deutschlands praktiziert. Das Stundenkontingent umfasst (vgl. Kilb/Weidner 2000) meist zwischen 40-50 Stunden (CT), 69 Stunden (AGT) bzw. 100 Stunden (AAT). Z.Zt. Sind 60 Fachkräfte nach Durchlaufen einer zweijährigen berufsbegleitenden Fortbildung im ISS Frankfurt als TrainerInnen zertifiziert; weitere 40 befinden sich in Ausbildung. Das AAT ist – wenn auch nicht hinreichend, so doch relativ gut – evaluiert. Erste statistische Auswertungen auf der Basis von Persönlichkeitstests (siehe Weidner 1990, 1993; Wolters 1992, Bauer-Cleve u.a. 1995; Brand-Saasmann 1999) ergaben, dass die Teilnehmer nach Durchlaufen des Programms „quantitativ und qualitativ weniger aggressiv handeln werden..., aber – trotz Behandlung – über dem durchschnittlichen Aggressionsniveau liegen“ (Weidner/Kilb/Kreft 1997, 90). Diese Evaluation wurden allerdings während der Haftzeit der Trainierten im Pre-/Post-Design durchgeführt. Neuere Evaluationen durch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), das eine Rückfallstudie zum AAT mit inhaftierten Gewalttätern der Jugendanstalt Hameln (1987 – 1999) durchführte, und durch das Frankfurter Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS) zu 18 im Jahre 1999 durchgeführten AATs und CTs bestätigen die Tendenz, lassen aber auch die vermutete und von Wolters (vgl. 1994, 93f.) explizit empirisch bestätigt gesehene Überlegenheit dieser Therapieform gegenüber anderen in Strafanstalten eingesetzten Praktiken bezweifelbar erscheinen. Durch die ISS-Studie weiß man über die Teilnehmer-Struktur: Das Klientel der Trainings ist im Bereich von AAT bzw. AGT ausschließlich männlich, ein Umstand der noch eher wenig konzeptionell berücksichtigt wird (vgl. Weidner 1997). Bei den eher auf Kinder zwischen 10 und 14 Jahren zielenden Coolness-Trainings fällt die statistische maskuline Dominanz etwas geringer aus. Bei 85% war ein Straftatbestand Grund der Teilnahme. Gut 40% der Teilnehmer sind Migranten, bei den 21-17jährigen sogar 56% Ausländer. Haupt- und Sonderschüler, Lehrlinge und Arbeitslose sind überrepräsentiert. Wirkungen werden in dieser Studie über Rückmeldungen von Teilnehmern, klientennahen Begleitpersonen (z.B. Eltern und LehrerInnen) und TrainerInnen erhoben. Danach halten sich 55% der Behandelten nach 148 Durchlaufen des Trainings für weniger reizbar und selbstbeherrschter; ein gleich hoher Anteil von Personen des sozialen Umfelds meint bei den Trainierten eine Gewaltreduktion und Gewalt vermeidende Konfliktlösungsstrategien erkennen zu können. Auch die TrainerInnen halten die Methode für hochwirksam, vor allem bei Jugendlichen, die anders nicht mehr zu beeinflussen sind (bei "Schlägern"), sind sich aber über Langzeitwirkungen nicht sicher. In jedem Fall plädieren sie für eine Einbettung der Methode in andere Angebote (z. B.: sport-, theater- und erlebnispädagogische). Mit diesem Postulat kommen sie im übrigen – wenigstens ein Stück weit – auch einer Kritik entgegen, die den punktuellen, episodenhaften Charakter von AATs bemängelt und ihre Einbindung in eine normativ prosozial ausgerichtete Lebensund ggf. Lern- und Schulkultur – wie sie etwa bei den Glen Mills Schools zu etablieren versucht wird (kurz dazu: Ferrainola 1999) – vermisst, die vor allem dann ihre Auswirkungen zeitigt, "wenn der Vorhang des offiziellen Programms gefallen ist" (vgl. Guder 1999, hier: 329). Das KFN (vgl. Ohlemacher u.a. 2001) analysierte die Legalbewährung von 73 jungen Leuten, die seit 1986 das Training durchlaufen haben, nach der Haft (bei nahezu 2/3 der Gruppe mindest 5 Jahre nach Haftentlassung) durch ein quasi-experimentelles Design mit einer Kontrollgruppe von "statistischen Zwillingen". Das zentrale Resultat: 63% der Probanden hatten einen Rückfall, aber nur 37% als Gewaltdelikt, davon etwas mehr als die Hälfte nur wegen eines Delikts und ebenfalls mehr als die Hälfte schon im ersten Jahr nach der Entlassung. Damit erreicht man Rückfallzahlen, die ähnlich denen von Glen Mills sind (vgl. Colla/Scholz/Weidner 2001; vgl. aber auch die wenig schmeichelhafte Rezension des Bandes und der mit ihm danach betriebenen "geschickten Verkaufsstrategie für AATs" von Förster 2001). Allerdings: Das AAT zeigte sich bzgl. einer Reduktion des Rückfallrisikos nicht überlegen gegenüber anderen in der JA praktizierten deliktspezifischen Maßnahmen (Sozialtherapie, Gesprächskreis Tötungsdelikte, andere Betreuung), die Angehörige der Kontrollgruppe durchlaufen haben (vgl. Kilb/Weidner 2000). Aus dem AAT heraus wurden auch "Betreuungsangebote" speziell für rechtsextrem orientierte Jugendanstalts-Bewohner entwickelt. Sie gehen weniger konfrontativ vor. Informationsvermittlung und Diskussion spielen eine größere Rolle. Zwar sind in einigen Fällen Differenzierungen in den Meinungsbildern und Szene-Ausstiege beobachtet worden. Mangels gründlicher Evaluation des Ansatzes bleibt aber offen, inwieweit sie auf diese Arbeit zurückzuführen sind (vgl. Geretshauser/Lenfert 1993; Geretshauser/Lenfert/Weidner 1993). Kritisch wird angemerkt, ob man hier die Therapeutisiererei politisch induzierter Sachverhalte versuche, aufgrund des lerntheoretischen Paradigmas aber an Einstellungshintergründe von Verhalten kaum heranreichen könne. Daneben wird angefragt, ob nicht eine evtl. erreichte psychische Stabilisierung von Tätern von ihnen später auch für dissoziales Verhalten genutzt werden könnte. Aus der Perspektive struktur-, aber auch desintegrationstheoretischer Analysen muss ferner generell bezweifelt werden, dass kurzzeitpädagogische und individuell begrenzt ansetzende Maßnahmen nachhaltige Veränderungen in der Führung des Alltaglebens bewirken können. 3.1.12 Partizipationsförderung Konzepte zur Förderung politischer und politisch relevanter Partizipation werden prima facie weniger mit der ausdrücklichen Intention auf den Weg gebracht, Gewalt, Minoritätenfeindlichkeit und Extremismus zu bekämpfen. Auf der anderen Seite wird in ihnen 149 eine große Chance zur Stärkung von Integrationspotenzialen und Demokratisierung erblickt, so dass mit ihnen mittelbar durchaus die Hoffnung auf gewaltreduzierende und extremismusprotektive Funktionen verbunden wird. Insbesondere Projekte mit Kindern und Jugendlichen werden in diesen Zusammenhang gestellt. Die in Deutschland und im europäischen Ausland (dazu kurz: Möller 2000b) geführte Debatte um geeignete Formen politischer Beteiligung von Jugendlichen und Kindern wurzelt in der unter DemokratInnen breit geteilten und sich in den letzten Jahren vertiefenden Überzeugung, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen Selbstverständlichkeit erlangen muss. Dahinter steht die Auffassung, dass in einer demokratisch verfassten Gesellschaft die aktive Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen unverzichtbar ist und dass die nachwachsende Generation biografisch möglichst frühzeitig nicht nur kognitives Wissen um demokratischpolitische Verfahrensregeln erwerben, sondern in die Lage versetzt werden soll, Demokratie möglichst alltagsnah, ganzheitlich und praktisch zu erleben und aktiv mitzutragen. Mindestens drei wichtige Ziele werden damit verfolgt: Zum ersten werden Kinder und Jugendliche als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen mit den ihnen zustehenden Rechten ernst genommen, so dass sie bereits heute an Entscheidungen beteiligt werden, von denen sie morgen als Erwachsene betroffen sein werden. Zum zweiten ist zu erwarten, dass durch die Mitwirkung der jungen Generation auch eine Qualifizierung von politischen Entscheidungen und der Arbeit der auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten Institutionen (z.B. Schule, Jugendhilfe) erreicht werden kann, wenn man Kinder und Jugendliche als ExpertInnen ihrer Lebenswelt mit ihren spezifischen Sichtweisen und Kompetenzen in Planungen und Entscheidungen einbindet. Zum dritten ist eine positive Sozialisationsfunktion im Sinne einer Gewöhnung an Demokratie und einer auf Erfahrung und daraus erwachsenden Einsicht beruhenden Übernahme ihrer Werte inauguriert. Dabei wird von z.T. als problematisch betrachteten neueren Entwicklungszügen im Verhältnis von Politik und nachwachsender Generation ausgegangen. Zu ihnen gehört u.a., dass bei gleichzeitig überdurchschnittlich gerade von Jugendlichen bekundeter Bereitschaft zu sozialem Engagement als "angewandter Liebe zur Welt" (Hannah Arendt) konventionelle staatsbürgerliche Formen der politischen Beteiligung (Wahlen, Mitarbeit in Parteien etc.) zunehmend mit Skepsis belegt werden, die Bindungskraft etablierter politisch-weltanschaulicher Organisationen nachlässt, die vermehrt in den 80er Jahren auf den Plan getretenen unkonventionellen Organisationsund Beteiligungsformen (Neue soziale Bewegungen, Bürgerinitiativen etc.) inzwischen ebenfalls an Attraktivität bei jungen Leuten einbüßen, politisches Engagement als Folge dessen entweder zurückgeht oder sich nahezu nur noch von Fall zu Fall bei themenspezifischer Betroffenheit und dann auch entsprechend kurzfristig andauernd entwickelt und sich so situations- und konjunkturabhängig, eher punktuell, personell hochfluktuativ und strukturell wenig stabil zeigt, erlebnisgesellschaftliche Überformungen des Politischen seine Prägung durch rationale – oder wenigstens Rationalität beanspruchende – Diskurse zu Gunsten ästhetisierender Expressivität und symbolisch-kultureller Stilisierung ablösen (vgl. Flaig 1993; Möller 1995a) nicht zuletzt in Verbindung damit Politikangebote des Rechtsaußen-Spektrums gerade von der jungen Generation Zulauf erhalten (vgl. Wippermann 2001) und so politische Integration in einer sich weiter differenzierenden und speziell auch multikulturalisierenden Gesellschaft immer schwieriger herzustellen ist. 150 Grundsätzlich lassen sich zwei Ebenen von Partizipation unterscheiden: 1. Lebensweltpartizipation Gemäß einem Politikverständnis, für das Handeln auch dann politisch relevant - und in diesem Sinne "politisch" - sein kann, wenn es nicht explizit in irgendeiner Weise auf die Strukturen des politischen Systems ausgerichtet ist (vgl. etwa Kaase 1992, 146), liegt politische Partizipation auch dort vor, wo sich eine Beteiligung gar nicht unbedingt selbst als politisches Tätigsein begreift und sich nicht auf Felder erstreckt, denen nach allgemein vorherrschendem Verständnis die Qualität des Politischen zugesprochen wird. In Bezug auf Kinder und Jugendliche hieße dies, dass von politischem Handeln auch dann gesprochen werden könnte, wenn sich ihr Tätigsein auf die Regelung von für sie selbst lebensweltlich relevanten Verhältnissen bezieht. Wenn Kinder und Jugendliche sich also einschalteten in z.B. die Planung der Angebote und in die konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugendarbeit vor Ort oder in die Prozessentwicklung ihrer Schule, wären sie politisch partizipativ tätig. 2. Systempartizipation Mit Systempartizipation ist das Handeln gemeint, das (auch) diejenigen politischen Strukturen berührt, die über lebensweltliche Verhältnisse hinausreichen und die Regelung vergleichsweise abstrakterer gesellschaftlicher Verhältnisse betreffen. In Bezug auf Kinder und Jugendliche betrifft es Angelegenheiten, deren Regelung über eine Aktivität im unmittelbaren sozialen Nahbereich des Quartiers hinausgeht und nur über Austausch und Auseinandersetzung mit Angehörigen anderer Lebenswelten, Milieus und ökologischer Zonen und mittels reflektierender Wahrnehmung außerlebensweltlich geltender Werte, Normen und Verfahrensweisen zu vollziehen ist: z.B. die Einbettung der stadtteilorientierten Jugendarbeit in ein städtisches jugendpolitisches Gesamtkonzept, Verkehrswegeplanung usw. Kommunalpolitische Modelle gehen in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung auf diese Ebenen ein. Man unterscheidet entweder allgemein Modelle direkter, advokatorischer und konsultativer Einflussnahme (vgl. Palentien/Hurrelmann 1998, 22) oder noch praxisorientierter institutionalisierte und verfasste, offene, projektbezogene und inzwischen auch internetbasierte Formen. Institutionalisierte bzw. verfasste Formen enthalten einerseits advokatorische Ansätze (Kinder- und Jugendbeauftragte, Kinderbüros, verwaltungsinterne Arbeitsgruppen, Kinderund Jugendkommissionen bzw. -ausschüsse etc.) der Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen durch Erwachsene und andererseits Modelle von Jugendräten und – parlamenten, in denen Jugendliche selbst für ihre Belange aktiv werden. Bei den offenen Beteiligungsformen handelt es sich um Modelle, die Kinder und Jugendlichen zu fixen Terminen die Möglichkeit geben, ihre Meinungen, Wünsche und Kritik gegenüber PolitikerInnen und Verwaltungsbediensteten - gegebenenfalls auch mittels Medien (z.B. Video) - zu äußern. Diese "Jugendforen", "Jugendhearings", "Kinderparlamente" oder "Runden Tische" versuchen also primär, den Kindern und Jugendlichen Artikulationsmöglichkeiten zu verschaffen. Durch die Anwesenheit von PolitikerInnen und Medien soll sichergestellt werden, dass möglichst viele der Anregungen auch umgesetzt werden. 151 Als projektbezogene Formen der verbesserten Wahrnehmung der Interessen von Kindern und Jugendlichen werden solche bezeichnet, die eine kurzfristige, gemeinwesenorientierte Beteiligung bei konkreten Aktionen und Planungsprozessen ermöglichen. Beispiele sind Spielplatz- und Schulhofgestaltung, Stadtteilbegehungen, Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an der Stadtteilsanierung bzw. Stadtteilgestaltung, Verkehrsplanung, Umweltprojekte, Freizeitangebote etc. Neue, sich erst in allerersten Ansätzen abzeichnende Formen stellen internetbasierte Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche dar (zusammenfassend dazu: Reif 1999) – wie sie sich z.Zt. etwa als lokale Projekte in Frankfurt a.M., Offenbach und Esslingen im Aufbau befinden und bundesweit übergreifend über "step 21" (näher dazu siehe das Kapitel zu medienpädagogischen Konzepten) anzuschieben versucht werden. Sie liegen – zumindest potenziell – in einem Schnittbereich von Alltags- und Systempartizipation und vermögen – jedenfalls theoretisch – direkte Einflussnahme (etwa über digitales Wählen von Jugend(gemeinde)räten, wie in Esslingen kürzlich erstmals in Deutschland praktiziert) und konsultative Prozesse miteinander zu verbinden. Sie können so auch verfasste und auf dauerhafte Mitwirkung angelegte Angebote mit offenen und projektorientierten verknüpfen. Die Diskussion der Modelle streicht verschiedene Vor- und Nachteile der einzelnen Formen heraus. Zu den wichtigsten diesbezüglichen Akzentuierungen gehören grob zusammengefasst: Das Setzen auf direkte Beteiligung von Minderjährigen am politischen Geschehen bringt für sich in erster Linie das Ernstnehmen von Kindern und Jugendlichen als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Anschlag. Die Hauptkritik bezieht sich darauf, in Frage zu stellen, dass solche Mitwirkung kinder- und jugendgerecht in kinder- und jugendgeeigneten Formen vonstatten gehen kann. Advokatorische bzw. verwaltungszentrierte Formen sehen ihren Vorteil vor allem in der durch sie gewährleisteten Präsenz von dauerhaften verfügbaren Ansprechpartnern, die aufgrund ihrer Einbindung in Verwaltungshandeln hohe Effektivität vorweisen können. Kritisch wird in diesen Formen eine tendenzielle Enteignung der Kinder von ihren eigenen Belangen und ihren darauf bezogenen Vertretungsrechten gesehen, die u.a. auch eine Haltung politischer Dienstleistungsorientierung unterstützen könne. Die offenen und projektorientierten Formen reklamieren für sich im Gegensatz zu advokatorischen Modellen eine Aktivierung der Betroffenen und im Vergleich zu institutionalisierteren und an Erwachsenengremien angelagerten Formen mehr Lebensweltnähe und eine kinder- und jugendgemäßere Methodik. Andererseits können sie keine dauerhafte Beteiligung installieren, fehlt ihnen die systematische Anbindung an die Institutionen der Kommunalpolitik und/oder sind aufgrund ihrer Informalität kaum in der Lage, die Kontrolle über die Umsetzung von geäußerten Anliegen in die Hände der beteiligten Kinder und Jugendlichen zu legen. Befürworter der Jugend(gemeinde)räte argumentieren vor allem damit, ein Modell zu favorisieren, dass Jugendlichen in systematischer Weise und dauerhaft kommunalpolitische Mitwirkung garantiert und dabei über effektiv nutzbare Zugänge zu den kommunalpolitisch wichtigen Erwachsenen-Gremien verfügt. Die Kritik verweist auf die Formalisierung der Beteiligung (förmliche Wahlen, Sitzungs"kultur" etc.), die einem unkonventionellen jugendlichen Politikverständnis und der Zeitperspektive von Jugendlichen nicht entspreche, auf die Mittelschichtszentriertheit der faktisch durch das Modell Angesprochenen (Stichworte: Gymnasiastenüberhang, wenig Jugendliche ausländischer Herkunft, Unterrepräsentation von Mädchen), auf den Vorenthalt wichtiger Mitwirkungsrechte, bisweilen gar auf eine Instrumentalisierungsgefahr der Jugendlichen für die Selbstdarstellungswünsche von PolitikerInnen ("babykissing") oder für die Rekrutierung politischer Jugendorganisationen und Parteien (vgl. auch Hermann 1996; Metzger 1996). 152 Die Nutzung des Internets gilt einerseits als Zukunftsoption. Die Verbreitung und leichte Zugänglichkeit dieser Technik sowie das Vorhandensein entsprechender Medienkompetenz vorausgesetzt, verspricht sie, Partizipationschancen dadurch auszuweiten, dass sie ein räumlich unabhängiges, zeitlich selbstbestimmtes, inhaltlich den Eigeninteressen folgendes, neue Kollektivbezüge schaffendes und auch in der Form des Ausdrucks eigengestalterisches Agieren erlaubt. Vorbehalte betreffen u.a. Zugangsprobleme, die die vorhandene soziale Ungleichheit in der Ausstattung mit moderner Technik und in ihrer Handhabungskompetenz betreffen, Befürchtungen, dem Verzicht auf face-to-face-Kontakte Vorschub zu leisten und so letztlich eine Individualisierung des politischen Handelns mit zu bewirken sowie Klagen über den tendenziellen Vorenthalt von Erfahrungen politischer Auseinandersetzungen aus erster Hand. Eine genaue quantitative Übersicht über kommunale Kinder- und JugendpartizipationsModelle gibt es für Deutschland z.Zt. leider nicht. Immerhin unterhalten nach einer allerdings nicht repräsentativen - Umfrage unter 158 bundesdeutschen Städten und Gemeinden knapp 30% der Städte und Gemeinden Beteiligungsformen wie Jugendforen, parlamente oder –räte (vgl. Lennep 1998). Die größer angelegte, nämlich rd. 400 Städte und Gemeinden einbeziehende und aktuellere Befragung des Deutschen Jugendinstituts kommt gar auf 38%, dabei überdurchschnittliche 48% in Klein-, 79% in Mittel- und 93% in Großstädten (vgl. Bruner u.a. 1999). Etwa ein Fünftel der Modelle erlaubt ein längerfristiges Engagement (vgl. ebd.). Hinzu kommen in – wegen ihrer Projektform - stark wechselnder und schon deshalb kaum zu ermittelnder Anzahl noch stärker in den Alltag von Kindern und Jugendlichen integrierte Beteiligungsmodelle in Kindertagesstätten, Schulen und Jugendverbänden (vgl. näher Bruner u.a. 2001) sowie erste Internetprojekte. Erwartet werden kann, dass die Zahl der Projekte durch die von der Bundesregierung im letzten Jahr ausgerufene Bundesinitiative "Beteiligungsbewegung" in kurzer Zeit deutlich ansteigt und inhaltlich neue Impulse erhält. In diesen Kontext gehört auch das Projekt "Ich mache Politik" (vgl. www.ich-machepolitik.de), das im wesentlichen dreierlei will: Jugendlichen ein "offenes Ohr" leihen. Dazu werden Gesprächsforen mit PolitikerInnen anberaumt (erstmals am 5.11.2001 mit BundespolitikerInnen) und "Politiktage" (im März 2002 in Berlin zum Kennenlernen von Bundespolitik) organisiert. Politische Beteiligung von Jugendlichen qualifizieren. Dafür finden an unterschiedlichen Orten in Deutschland verschiedene Aktions- und Projekttage statt. den politischen Tatendrang junger Leute unterstützen und fördern. Deshalb werden Projektideen gesammelt und über das Internet verbreitet. Die Erfahrungen mit Beteiligungsmodellen für Kinder und Jugendliche werden bei je nach Standpunkt und Interessenlage unterschiedlicher Bewertung einzelner Modellansätze insgesamt überwiegend positiv gesehen (vgl. z.B. Lennep 1998; Möller 1999b; Bruner u.a. 1999, 2001). Über Erfahrungs- bzw. Sachberichte und Dokumentationen (vgl. z.B. Hafeneger/Klose/Niebling 2001) hinausreichende Auswertungen liegen allerdings kaum vor. Eine Ausnahme bildet die Untersuchung zur "Wirkung und Qualität" von 152 projektorientierten Beteiligungsaktionen in Schleswig-Holstein (z.B. in Hinsicht auf Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in Stadtgestaltung, Verkehrs- und Freizeitraumplanung usw.). Genauer formuliert handelt es sich allerdings allenfalls um von Fachkräften vermutete, bestenfalls unsystematisch beobachtete Wirkungen. Auf der Basis eines Rücklaufs von 97 von Projektverantwortlichen (nicht von Kindern und Jugendlichen 153 selbst!) ausgefüllten und retrospektiv Einschätzungen für bereits abgeschlossene Projekte einholenden Fragebögen und ergänzenden 38 Interviews in sechs Projekten wird eine positive Bilanz gezogen. 30% der Projekte sehen sich u.a. auch als Beitrag zu "Präventionsmaßnahmen in der Kommune", wobei der inhaltliche Bezugspunkt der Prävention allerdings offen bleibt. Im Verhältnis 1:3 glauben die Antwortenden dieses Ziel eher nicht (24%) oder eben doch (76%) umgesetzt zu haben. Eher meint man mit den Projekten etwas für das "Erleben von Demokratie" (92%) und "von Einflussmöglichkeiten im kommunalen Raum" (89%) sowie für den Erwerb und die Weiterentwicklung "sozialer und politischer Kompetenzen" getan zu haben (vgl. Friedrich u.a. 2002a; Friedrich u.a. 2002b). Im wissenschaftlichen Sinne verlässlichere themenspezifische Evaluationen zu gewalt- bzw. extremismuspräventiven oder –reduktiven Funktionen existieren z.Zt. nicht. Einzelne Erfahrungsberichte von insgesamt wenig zahlreichen Beteiligungsprojekten mit ausdrücklich gewaltpräventivem Anspruch kommen – allerdings methodisch unzureichend und von den OrganisatorInnen selbst erstellt – ebenfalls zu positiven Ergebnissen. So wird von vandalismusreduzierenden Funktionen partizipativer Schulhofumgestaltung berichtet (vgl. Mitbrodt/Ahnemann 2001, wobei sich allerdings der Eindruck einstellt, dass eher - oder wenigstens auch - die Vermittlung von "Rädelsführern" in Jugendhilfemaßnahmen und ihre "Vereinzelung", also Maßnahmen gegen Leitfiguren von entscheidender Bedeutung waren). Ferner wird konstatiert, dass die Übergabe von Verantwortung an Jugendgruppen, die vorher als "Banden" stigmatisiert wurden, zu entsprechend verantwortlichem Umgang mit überlassenem Material (bspw. mit einem Streetball-Korb) führt. Allerdings werden bei Vorliegen eines konkreten Konflikts ergänzende "Vier-Augen- und Familiengespräche" für erforderlich gehalten (vgl. ebd.). In Bezug auf die in dieser Expertise fokussierte Thematik erscheint trotz des völlig ungenügenden Forschungsstandes immerhin die Erkenntnis erster Analyen (s.o.) heraushebenswert, dass die beteiligten Kinder und Jugendlichen soziale und politische Selbstbildungsprozesse durchlaufen, sie ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein aufgrund der erlebten Anerkennung ihrer Person zu entwickeln und zu stärken scheinen, eine produktive demokratische Gesprächskultur einüben können, Verschiedenheit zu akzeptieren lernen, Solidarität und Gemeinschaft erleben, Verantwortung übernehmen und Kompromissfähigkeit und gewaltfreie Konfliktschlichtung erlernen. Partizipationserfahrung kann insofern in der Tat als "Grundlage der Demokratie" (Bruner u.a. 2001, 88) verstanden werden, zumal damit Lernprozesse in Gang gesetzt werden, die solche Kompetenzen und Mechanismen der Erfahrungsstrukturierung und sozialen Interaktion stärken, die aus theoretischer und empirischer Sicht der Gewalt- und Rechtsextremismusforschung zu den protektiven bzw. distanzierenden Faktoren gezählt werden (vgl. Frey/Haußer 1987; Schwind/Baumann u.a. 1990; Olweus 1991, 1997; Tennstädt 1991; Tennstädt/Dann 1992; Klosinski 1993; Böhnisch 1994; Fend 1994; Smith/Sharp 1994; Balser/d'Amour 1995; von Borries 1995; Hopf u.a. 1995; Petermann u.a. 1997; MenschikBendele/Ottomeyer 1998; Möller 2000a, 2001; Lutz 2000, Schubarth 2000). Positive Entwicklungen sind aber an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die die Qualität von Beteiligungsmodellen betreffen. So unterschiedlich sie auch im einzelnen akzentuiert werden (vgl. z.B. Deutscher Bundesjugendring 1995; Landesjugendring Baden-Württemberg 1997; Hermann 1997, 1998; Landeswohlfahrtsverband Baden 1998; Tiemann 1998; 154 Stange/Wiebusch 1998; Forum Kinder- und Jugendpolitik 1999; Möller 2000b, Bruner u.a. 2001), gelten übereinstimmend mindestens die folgenden Erfolgsbedingungen: Es ist eine Pluralität von Kinder- und Jugendperspektiven sicherzustellen (etwa in Hinsicht auf die Berücksichtigung ethnischer, geschlechtsspezifischer und bildungsspezifischer Differenzen), und es sind altersangemessene Formen der Ansprache zu wählen. Die Beteiligungsquote partizipationsgewohnter Jugendlicher übertrifft nach empirischen Erfahrungen mit dem Jugendgemeinderatsmodell (vgl. Hermann 1996, Metzger 1996) deutlich die der partizipationsungewohnten Jugendlichen. Daraus folgt, dass es auch im Interesse der Förderung von Jugendpartizipation ist, lebensbiographisch betrachtet möglichst frühzeitig Beteiligungserfahrungen einzuräumen. Förderung von Jugendpartizipation erfolgt auch durch die Förderung von Beteiligungsmodellen für Kinder. Es ist sicherzustellen, dass die Gegenstände bzw. Inhalte und Themen politischer Beteiligung von den zu Beteiligenden selbst bestimmt werden. Es sind Arbeitsformen zu wählen, die eine altersangemessene Passung besitzen und der angestrebten sozialen Vielfalt der Beteiligten gerecht werden. Kinder- und Jugendbeteiligung kennt keinen Königsweg. Gerade die Vielfalt an unterschiedlichen Beteiligungsformen für unterschiedliche Lebens- und Interessenlagen ist zu fördern. Daraus folgt dann aber auch, die Vernetzung verschiedener Beteiligungsmodelle voranzutreiben (vgl. dazu den praxisorientierten und im Stuttgarter Modell ansatzweise umgesetzten Vorschlag eines "Partizipationsmix" bei Möller 1999b) Wo von Erwachsenen das Interesse an Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen geäußert wird, muss diese Mitwirkung auch mit faktischen Einflussmöglichkeiten verbunden sein. Beteiligungsmodelle haben Kindern und Jugendlichen Befugnisse und kommunalpolitisch relevante Rechte zu übertragen. Wenn Rechte übertragen werden, kann von einer Institutionalisierung der Beteiligung nicht abgesehen werden. Angesichts der Institutionen- und Institutionalisierungsdistanz der jungen Generation lautet die Grundregel allerdings: Soviel Institutionalisierung wie nötig, soviel Informalisierung wie möglich. Beteiligungsmodelle sollten von Anfang an sicherstellen, dass ihre Qualität gesichert bleibt bzw. fortentwickelt wird. Im Falle von Modellen mit neuartiger Struktur sollte eine wissenschaftliche Begleitung erfolgen. Alle Modelle bedürfen einer sozialpädagogischen Begleitung, die die Einhaltung der fachlichen Standards von Kinder- und Jugendbeteiligung überwacht und durch eigene Aktivitäten praktisch garantiert. Systempartizipation von Kindern und Jugendlichen muss auf alltagsdemokratischen Erfahrungen von Lebensweltpartizipation aufruhen. Wer also Systempartizipation auf demokratischem Wege ermöglichen möchte, muss auch für Alltagsdemokratie und Lebensweltpartizipation Sorge tragen. Einmal-Aktionen verpuffen. 3.1.13 Kampagnen, Wettbewerbe, Aktionen Seit den ersten Höhepunkten rechtsextremistischer Übergriffe zu Beginn der 90er Jahre wurde eine lange Reihe von Kampagnen, Wettbewerben und Aktionen ins Leben gerufen. Ihre Vielzahl ist inzwischen kaum noch zu überblicken (vgl. im einzelnen www.jugendwettbewerbe.com). Sie fordern Einzelne oder Gruppen, zumeist Jugendliche oder Kinder, auf, Toleranz zu üben oder sogar gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt und für Demokratie und Toleranz aktiv zu werden. Zum Teil sind sie schlichte Sticker-, Button-, Plakat- bzw. Spotkampagnen wie z.B. die Kampagne "Du willst Respekt. Ich auch", die nach dem Muster kommerzieller Reklame – 155 nicht selten über den Einsatz von Sport- und Show-Stars als Vorbildfiguren - einen WerbeEffekt für Toleranz und Fairness im Umgang miteinander erzielen sollen. Auch wenn nicht unterstellt werden muss, dass sie mehr die Betriebsamkeit und political correctness ihrer Betreiber öffentlichkeitswirksam dokumentieren sollen: Wie weit ein darüber hinausreichender Impetus der Demokratieförderung positiv aufgenommen wird, bleibt fraglicher als bei der Produktwerbung, denn der Kauf eines Waschmittels oder eines Schokoladenriegels berührt kaum grundlegende Überzeugungssysteme. Theorien differentiellen Lernens können zwar theoretisch-abstrakt die Sinnhaftigkeit des Angebots von positiven Lernmodellen für eine Herauslösung aus antisozialen Gruppen unterstreichen (vgl. Möller 1999a, Schubarth 2000, 31 ff.). Genauere empirische Evaluationen bestimmter Darstellungen von Vorbildfiguren in Öffentlichkeitskampagnen zur Reduzierung fremdenfeindlicher Einstellungen in der Bevölkerung liegen aber nicht vor (vgl. Wagner u.a. 2001, 287). Den Paradigmen gestalterischen und erfahrungsbezogenen Lernens verbunden, regt ein anderer Teil aber auch - formativ betrachtet - meist über mediale oder durch Multiplikatoren (v.a. Lehrpersonen) realisierte Ansprache zu eigentätiger Aktion und/oder zu noch mehr produktions- und/oder rechercheorientierten Prozessen (Wettbewerbe, Kampagnen) an. Sie setzten dabei darauf, dass über diesen Weg der Aktivierung und Erfahrungsproduktion auch Wissensaneignung erfolgt und dass deren Sinnhaftigkeit den Lernenden durch ihre Einbettung in den Projektzusammenhang unmittelbar einleuchtet. Beispiele für Kampagnen und Wettbewerbe sind "Demokratisch handeln", der seit 1990 veranstaltete Wettbewerb von Theodor-Heuss-Stiftung und Akademie für Bildungsreform, "Fairständnis" als die von den Innenministern ab 1993 durchgeführte "Aufklärungskampagne gegen Fremdenfeindlichkeit und Extremismus", die "Fair-play-Initiativen" von Bund, Ländern und Sport, der seit 1998 vergebene CIVIS-Rundfunkpreis mit u.a. einer eigenen Jugendjury, die von Jugendlichen produzierte Beiträge prämiert, der vom bundesweiten "Bündnis für Demokratie und Toleranz" und Partnern (Dresdner Bank, Aufbau-Verlag, ab 2002 auch der DFB) seit 2001 ausgeschriebene "Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb", der Wettbewerb "Du gegen rechts", bei dem der Bundestagspräsident die Schirmherrschaft übernommen hat, der seit 1999 bestehende Wettbewerb "Demokratie leben" oder auch der vom Bundespräsident gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung aktuell gestartete "Wettbewerb zur Integration von Zuwanderern". Sie haben mehr oder weniger das gleiche Muster, weshalb im folgenden nur ein schon älteres, längerfristig angelegtes und evaluiertes Kampagnen-Beispiel sowie ein ebenfalls schon seit den frühen 90ern durchgeführter und auf Erfahrungsauswertungen zurückgreifender Wettbewerb und zwei aktuelle Beispiele für Wettbewerbe etwas genauer beschrieben werden sollen. Die von einer Werbeagentur mit Kosten von 10 Mio. DM (bis Ende 1995) umgesetzte "Fairständnis"-Kampagne zielte im wesentlichen auf zweierlei: zum einen auf Aufklärung über Extremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus und zum anderen auf Wertebildung im Sinne der Vermittlung von Werten wie Achtung vor dem Leben überhaupt, der Menschenwürde, den Rechten anderer und dem Recht auf Unversehrtheit sowie Toleranz gegenüber Fremden und Ächtung von Gewalt als Mittel der Konfliktlösung außerhalb des staatlichen Gewaltmonopols. Als Zielgruppen wurden Jugendliche, speziell auch potenzielle Täter und deren Sympathisanten, und MultiplikatorInnen in den Blick genommen. Inhalt der Kampagne war die Verbreitung von jugendgemäßen Materialien und Medien wie Plakaten, Postern, Stickern, Fotoromanen, Hörfunk- und TV-Spots, Postkarten, bedruckten T-Shirts etc. sowie einem Computerspiel ("Dunkle Schatten"). Daneben wurden themenspezifische Bildungsmaßnahmen, vor allem mit MultiplikatorInnen aus dem schulischen Bereich zur Vorstellung der Materialien und zur Klärung der Bedingungen ihres 156 Einsatzes im pädagogischen Bereich, sowie länderspezifische Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen (z.B. Wanderausstellungen) durchgeführt. Eine Evaluation erfolgte, wurde aber erst im Dezember 1993 in Auftrag gegeben und in der ersten Hälfte des Jahres 1996 durchgeführt (Inhaltliches dazu s.u.). Das Förderprogramm "Demokratisch handeln" wendet sich seit 1990, im Laufe seiner Existenz von einer wachsenden Zahl von Bundesländern unterstützt, schwerpunktmäßig an Schulklassen und Schülergruppen und fordert sie zur Einsendung von Beiträgen auf, die auf den drei Ebenen von Unterricht, Schulleben und Gestaltung des Verhältnisses von Schule zu der sie umgebenden Gemeinde beispielhaft demokratische Erziehung mit praktischen Lernen verbinden. In einer jährlichen mehrtägigen "Lernstatt" werden ausgewählte Projekte eingeladen, zur öffentlichen Präsentation ihrer Arbeiten ermuntert, ausgezeichnet und in Kontakt mit PolitikerInnen und anderen Projekten gebracht. Daneben werden Porträts interessanter Projekte unter best-practice-Gesichtspunkten öffentlich und fachöffentlich publiziert (vgl. Beispiele in Beutel u.a. 2001; Beutel/Fauser 2001). Der erst nachträglich konstruierte (vgl. Beutel/Fauser 2001, 34) wichtigste theoretische Bezug des Ansatzes des Förderprogramms leitet sich aus dem Pragmatismus John Deweys ab. Danach ist Lernen erfahrungsgeleitete "generative Praxis" und basiert auf der Verbindung von Handeln und Reflexion. Schule sei deshalb als sozialer Erfahrungsraum aufzufassen, als die "Keimzelle" einer "Gesellschaft im Wachsen und Werden". Hier sei in einer "vereinfachten Umwelt" "Demokratie als Lebensform" spürbar (ebd. 28ff.). Die grundlegende These des Förderprogramms kann hier anknüpfen: "Für politische Bildung und Demokratie ist es unerlässlich, den Unterricht durch ein praktisches Lernen mit eigenem Tätigsein und durch eigene Erfahrung zu erweitern und zu bereichern" (ebd., 34). Es bedarf für ein "wirkliches Verständnis des Politischen" aus dieser Perspektive der unmittelbaren "Erfahrung von Interessengegensätzen und Interessenausgleich, von Widerständen und Niederlagen, von öffentlicher Auseinandersetzung und Rechenschaft, von Überzeugen und Überzeugtwerden, von Mehrheitssuche und Minderheitenschutz" (ebd.). Das gemeinschaftliche (genauer: "kooperativ individualistische") Engagement "für die Lösung von Aufgaben des Gemeinwesens" (ebd., 35) und nicht die individuelle Höchstleistung – wie oft bei anderen schulnahen Wettbewerben - steht deshalb im Mittelpunkt. In diesem Kontext werden auch die Chancen für Gegensteuerungen zu "Gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus bei Jugendlichen" (ebd.) gesehen. Da "gilt, dass Gewalt und rechtsradikale oder fremdenfeindliche Tendenzen bei Jugendlichen immer auch als mögliche Folgen fehlender Erfahrung der Zugehörigkeit, mangelnder Anerkennung und ungenügender Aufklärung zu sehen sind" (ebd.), könne die Projekterfahrung mit ihrer "Verbindung von Zugehörigkeit, Mitwirkung, Anerkennung und Verantwortung" (ebd.) für Schüler und Schülerinnen Gegengewichte bilden. Der "Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb" richtet sich an Gruppen, Klassen und Einzelpersonen zwischen 16 und 21 Jahren und fordert sie zur Erstellung von Texten Videos, Fotoromanen, Comics usw. zu einem Themenfeld auf, das mit dem Namen Victor Klemperers verbunden werden kann, 2001 unter dem Motto "Kreativ für Demokratie und Toleranz", 2002 unter dem Motto "WIR gewinnt – aktiv für bürgergesellschaftliches Engagement". Insbesondere werden Arbeiten zur NS-Zeit, zu Zivilcourage, zu Ausländerintegration und, vor allem in 2002, Berichte und Aktionen bürgerschaftlichen Engagements für einen demokratischen und toleranten Umgang erwartet. Hauptpreise sind Studienwochen in Berlin, London und Auschwitz. Die bisherigen Erfahrungen werden von den Veranstaltern als positiv eingeschätzt, weil die Resonanz mit 20.000 jungen Teilnehmern und Teilnehmerinnen "überwältigend" war und der Wettbewerb als "gelungener Anstoß (betrachtet wird), sich mit Fragen der Diskriminierung, der Ausgrenzung und der Fremdenfeindlichkeit zu befassen 157 sowie Gegenmaßnahmen zu ergreifen" (www.buendnis-toleranz.de/Aufgaben-und-Ziele.571.8206/.htm, 2). Der "Wettbewerb zur Integration von Zuwanderern" soll vom 31.01.2002 bis zum 10.05.2002 laufen und wird von prominenten, selbst positiv Zuwanderschaft biographisch verkörpernden Botschaftern wie u.a. der Pop-Gruppe "Bro 'Sis" und dem Boxer Vladimir Klitschko unterstützt. Er richtet sich an Gruppen, Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen und Netzwerke, die möglichst vernetzt, nachhaltig und kompetent erfolgreiche Ideen und Projekte integrierten Zusammenlebens umsetzen. Als Preise winken für 10 Gewinner je 7.500 Euro und eine Einladung zu einem Abschlussfest ins Schloss Bellevue am 22.08.2002 (vgl. www.integrationswettbewerb.de). Abgesehen von Erfahrungsberichten und Selbsteinschätzungen der Veranstalter existieren unabhängige Evaluationen, aus denen neben einfach zu erhebenden Ergebnissen auch Wirkungen von Wettbewerben, Kampagnen und Aktionen hervorgehen, m. W. kaum. Als Erfolg wird meistens ein hoher Bekanntheitsgrad des Wettbewerbs, der Kampagne bzw. der Aktion, eine hohe Teilnehmerzahl und die von einer Jury bewertete Kreativität der eingesandten Arbeiten ausgewiesen. Festzuhalten bleibt indes, dass ein hoher Bekanntheitsgrad nicht linear auf eine hohe Wirkung im Sinne der intendierten Ziele schließen lässt (diese kann im ungünstigsten Fall sogar kontraproduktiv sein), eine hohe Teilnehmerzahl zwar als Beleg für eine breite Streuung von inhaltlichen Anregungen gelten kann, aber nichts über die Tiefe und Nachhaltigkeit dieser Anstöße und ihren Transfer in das Alltagsleben der Teilnehmenden aussagt und die Kreativität der eingesandten Arbeiten eher ihre äußere Form und Aufmachung, längst nicht in jedem Fall aber auch die Ernsthaftigkeit und Intensität, mit der gearbeitet wurde, widerspiegelt. Gerade inhaltlich-qualitative Aspekte der Implementierung gewonnener Erfahrungen in das Alltagsverhalten lassen sich durch die gängigen Jury-Urteilsverfahren fast nie überprüfen. Hinzu kommt eine anzunehmende hohe Selektivität der Rezeption: Wer von vornherein positiv der Intention der Kampagne gegenübersteht, wird sie eher beachten als jemand, der ihren Inhalt skeptisch oder gar mit Abneigung betrachtet. Bereits rechtsextrem Orientierte werden daher wohl kaum in dieser Weise angesprochen werden können. Ebendies ist auch ein zentrales Ergebnis der Evaluation von "Fairständnis". Diese vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführte Untersuchung – wegen des verspäteten Beginns leider nur als ex-post-Analyse – stützt sich auf eine Auswertung von 827 beim BMI eingegangenen Zuschriften, überwiegend von Jugendlichen, teils aber auch von LehrerInnen und anderen MultiplikatorInnen, von 420 zufällig ausgewählten Beurteilungen und Kommentaren zum Computerspiel "Dunkle Schatten" sowie von 104 Telefoninterviews mit MultiplikatorInnen und ihre darin abgegebenen Einschätzungen über die Wirkungen der Kampagne bei der Zielgruppe der Jugendlichen. Neben dem schon erwähnten Resultat, gewaltbereite und fremdenfeindliche Jugendliche nicht unmittelbar erreicht zu haben, weil das Material bei dieser Zielgruppe kaum Interesse fand und der "pädagogische Zeigefinger" (zu) offensichtlich vorgehalten wurde, wird sogar festgestellt, in dieser Gruppierung eher Ablehnung als Nachdenklichkeit produziert zu haben. Stattdessen erreichte man eher die Bestätigung des eigenen Standpunkts und die Aktivierung von Engagement bei bereits sensibilisierten jungen Leuten. Aus den MultiplikatorInnen-Interviews geht hervor, dass auch nach deren Einschätzung die erwünschten Wirkungen bei rechtsextrem und fremdenfeindlich orientierten Jugendlichen nur dann zu erzielen sind, wenn man sich ihren Problemen zuwendet und langfristig mit ihnen arbeitet (vgl. Kiefl 1999). 158 Keine Evaluation im engeren Sinne, aber eine quantitativ angelegte Erfahrungsauswertung existiert zum Förderprogramm "Demokratisch handeln". Aus ihr lassen sich auch einige Befunde zur Bearbeitung des Themenfelds Gewalt und Rechtsextremismus ersehen. Danach sind von den zwischen 1990 und 1999 eingegangenen knapp 1.500 Einsendungen rd. ein Viertel auf die (inhaltlich weit abgesteckte) Themengruppe "Asyl, Gewalt, Minderheiten, Krieg/Frieden" bezogen – mit zunehmender Tendenz in den letzten Jahren und Überrepräsentanz der Einsendungen aus den östlichen Bundesländern. Auch wenn im Anschluss an die oben angeführten Ursachenzuschreibungen (mangelnde Partizipation, Zugehörigkeit, Anerkennung und Aufklärung) aus theoretischer Sicht die Einschätzung angeführt werden kann, "Schülerinnen und Schülern Verantwortung für die Gestaltung des Schulalltags und auch des Unterrichts zu übertragen,.... ist der wichtigste Präventionsbeitrag gegen Gewalt und Extremismus (Sturzbecher 2001, S. 6)" und so "ein direkter Zusammenhang zwischen Demokratie lernen in der Schule und Gewaltabstinenz" (ebd., 77) angenommen wird, bleibt mangels Wirksamkeitsprüfung offen, inwieweit die erhofften Effekte tatsächlich eingetreten sind. Wenn einerseits zu Recht davon ausgegangen wird, dass politisches Lernen längerfristiger Prozesse bedarf, andererseits die Quote der Wiederbewerbungen bei 17,6% liegt und auch nicht absehbar ist, ob die Wettbewerbsteilnahme nicht gemeldete weitere Projekte und/oder profilbildende Schulprogramme in nachhaltiger Weise angestoßen hat, bleiben gewalt- und extremismusreduzierende Wirkungen unklar. In dieser Hinsicht führt auch die strukturierte, aber nicht repräsentative Bestandsaufnahme von über 2000 Projekten (offensichtlich 1.800 von ihnen aus der Datenbank von "Demokratisch handeln") nicht weiter, die von Beutel u.a. (2001) unter dem Gesichtspunkt der Auswahl von "best-practice"-Modellen der Gewaltprävention zwischen Juli 2000 und März 2001 durchgeführt wurde. Die Recherche mündet im Ergebnis in jene Erkenntnisse, die im oben beschriebenen Erfahrungszusammenhang des Förderprogramms "Demokratisch handeln" als relevant erachtet werden. Ist noch nachvollziehbar, dass angegeben wird, auf "instruktive", "originelle" und "eindrucksvolle" Bespiele für schulische Reaktionen auf Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus gestoßen zu sein, so bleibt fraglich, nach welchen Kriterien unter ihnen "viele erprobte...Ansätze" ausgemacht, vor allem aber inwiefern sie als "wirksame" eingestuft werden konnten (ebd., 23), wurden doch weder von den RechercheurInnen selbst Evaluationen unternommen, noch erkennbar vorhandene Evaluationen berücksichtigt. Die Beurteilungskriterien für "best practice" – "Lernqualität", "Institutionelle Qualität", "Aktualität", "Originalität" (ebd., 7) - bleiben wohl auch deshalb recht unbestimmt und können den Vorwurf relativ willkürlicher Festlegung auf sich ziehen.13 13 "Best practice"-Kriterien sind nicht nur hier wenig ausgearbeitet. Im Gegensatz zu dem unübersehbar starken Trend, Praxisprojekte entsprechend zu kategorisieren (vgl. z.B. auch MaReG und die Zwischenberichte zum Civitas-Programm), sind die Bewertungsmaßstäbe, unter denen dies geschieht, unverhältnismäßig schwach elaboriert und 'weich'. Offenbar sind die Referenzpunkte, nach denen Praxis eingeordnet werden könnte, zu wenig ausgearbeitet. Hier scheinen deutlich Probleme auf, die in mindestens drei Feldern liegen: Zum ersten ist der Stellenwert der Ausrichtung von Praxis an den vorhandenen Erkenntnissen der Forschung zu Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu klären. Zu überprüfen ist dabei, inwieweit für 'gute' oder sogar 'ausgezeichnete' Praxis (neudeutsch: "good practice" und "best practice") nachzuweisen ist, dass sie dem aktuellen Stand sowohl der theoretischen als auch der empirischen Forschung entspricht, ja vielleicht sogar in einem Diskurszusammenhang mit ihr steht, in dem Praxisanregungen und –erfahrungen als Befruchtungen wissenschaftlichen Forschens wirksam werden können. Um in diesem Problemfeld Klärungen herbeizuführen, erscheint es unerlässlich, das Verhältnis von Theorie und Praxis zureichender zu bestimmen als dies bislang der Fall ist. Zum zweiten sind die Bezüge von Praxis zu dem auch themenunspezifisch bedeutsamen allgemeinen diskursiven und operativen Rahmen sowie zu praktikablen konzeptionellen Vorgehensweisen, die die zentralen Bezugswissenschaften, also vor allem Erziehungswissenschaft und Sozialarbeitswissenschaft, entwickeln, näher zu bestimmen. Hier wäre zumindest auf den Ebenen von Orientierungen an Paradigmen, Strategien, Formaten 159 So ergibt sich aus pädagogischer Sicht als entscheidende Frage, wie es gelingen kann, positive Kampagnen-, Aktions- und Wettbewerbserfahrungen auf Dauer zu stellen, um im besten Fall und vermutlich eher bei jüngeren Jugendlichen tatsächlich gegebene Initiativzündungen nicht verglühen zu lassen. Welche Unterstützungsmöglichkeiten außer symbolischer Anerkennung und Preisgeldern, die für die weitere Arbeit eingesetzt werden können, können Auslober noch zur Verfügung stellen? Eine Antwort auf diese Fragestellung wird um so dringlicher, als sich angesichts zunehmender Zahlen rechtsextremer und fremdenfeindlicher Vorkommnisse der Eindruck einstellen kann, dass gut gemeinte Kampagnen, Wettbewerbe und Aktionen wenig bis gar nichts fruchten und mehr der medienwirksamen Selbstdarstellung ihrer Träger als einer Veränderung antidemokratischer Auffassungen und Verhaltensweisen dienlich sind. Jedenfalls gilt: "Gelder..., die in Öffentlichkeitskampagnen gegeben werden, sind nicht damit zu rechtfertigen, dass solche Kampagnen besonders hilfreich im Sinne der Reduktion fremdenfeindlicher/antisemitischer Einstellungen sind" (Wagner u.a. 2001, 303). Gründliche Evaluationen der Ergebnisse von Kampagnen und Wettbewerben erscheinen dringend geboten. 3.1.14 Stärkung und Vernetzung zivilgesellschaftlicher Strukturen Vernetzung ist ein vorwiegend innerhalb des Gestaltungsparadigmas seit einigen Jahren gebräuchliches Modebegriff der pädagogischen und sozialarbeiterischen Diskussion. Hinter ihm verbirgt sich eigentlich zweierlei: Zum einen der Anspruch, die sog. KlientInnen untereinander in Verbindung zu bringen, zum anderen die Forderung nach Verknüpfungen zwischen Organisationen bzw. informellen Gruppen und ihren Aktivitäten. Obwohl sich die Karriere des Terminus wohl der Diskussion um soziale Netzwerke, ihre Analyse und ihre sozialpolitische und –arbeiterische Stabilisierung über Netzwerkarbeit in einer zunehmend von Individualisierung und Auflösungstendenzen von Sozialität geprägten Gesellschaft verdankt (vgl. Diewald 1990; Dewe/Wohlfahrt 1991; Röhrle 1994; Putnam 1995, 2002; Bullinger/Nowak 1998 Keupp 2000; Otto 2000), meint er in praxi weniger die Bemühungen, AdressatInnen sozialer und pädagogischer Arbeit zur Vermeidung von Vereinzelung und zur Erzielung verbesserter sozialer Einbindung miteinander zu vernetzen. Häufiger und manchmal sogar ausschließlich wird unter ihm die Herstellung und Absicherung von Kooperationsbeziehungen zwischen Fachkräften unterschiedlicher Handlungsfelder, ggf. noch erweitert um engagierte Laien in Projekten und Initiativen bzw. um Vertreter der Politik, verstanden. Vernetzungsbestrebungen im Kontext von Rechtsextremismus-, Gewalt- und Fremdenfeindlichkeitsbekämpfung folgen ganz weitgehend diesem eingeschränkten, aber vorherrschenden Verständnis. In ihrem Mittelpunkt steht die Absicht, professionell, konventionell-politisch und bürgerschaftlich Engagierte zusammenzubringen, damit sie ihre Aktivitäten und Maßnahmen aufeinander abstimmen und zu gemeinsamen Planungen voranschreiten können. An dieser Stelle liegt der Berührungspunkt mit dem den einschlägigen Aktivitäten formatverleihenden Anspruch, zivilgesellschaftliche Strukturen aufbauen zu helfen bzw. vorhandene zu unterstützen. Dabei vertraut man offenbar implizit auf das kritische Potenzial aktiver Öffentlichkeitsbildung, das dem Begriff der "Zivilgesellschaft" im und konzeptionellen Grundorientierungen (hierbei mindestens an Zielen, Inhalten und Methoden) Klarheit über die Bedeutung eines Bezuges auf sie zu schaffen. Zum dritten ist dringlich der Stellenwert von Evaluation abzuklären. Hier existiert eine weitflächige tabula rasa. Sie beeinträchtigt die Rationalität von Einordnungs- und Einstufungsvorhaben praktischer Maßnahmen erheblich. Sollten nicht Kriterien wie Zielerreichung, Wirksamkeit, Wirkung, Effizienz u.ä.m. entscheidend in den Bewertungsprozess von Praxis eingehen? Müsste dies nicht um so mehr geschehen, je stärker großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird? 160 Gegensatz zu dem der "bürgerlichen Gesellschaft" attribuiert wird (vgl. Sachße 2002) und kann sich darauf berufen, dass nach einem inzwischen klassischen Verständnis neben Vielfalt und Autonomie zivilgesellschaftlicher Strukturen die Zivilität des Verhaltens ihrer Mitglieder, also Gewaltlosigkeit und Toleranz, als drittes ihrer Merkmale angeführt wird (vgl. Dahrendorf 1992). Eine entsprechende Zielrichtung schlägt sich nicht nur in den zahlreichen "Runden Tischen", "Netzwerken", "Dokumentations- und Informationsstellen" sowie "Bündnissen für Demokratie und Toleranz" oder ähnlich betitelten Zusammenschlüssen Engagierter auf Bundes- Länder-, regionaler und kommunaler Ebene nieder. Sie prägt insbesondere auch explizit die Arbeit der vor allem im Osten Deutschlands inzwischen aktiven und dort auch unter diesem Namen antretenden "Mobilen Beratungsteams". Die ersten Einrichtungen dieser Art wurden bereits 1996 im Land Brandenburg gegründet. Die neuen Civitas-finanzierten Einrichtungen in Trägerschaft von RAA bzw. Sozialpädagogischem Institut (in Berlin), der Ev. Akademie und der RAA (in MecklenburgVorpommern) mit Regionalbüros in Greifswald, Waren und Schwerin, des Dresdner Büros für freie Kultur- und Jugendarbeit, einem Zusammenschluss von 26 Mitgliedsvereinen (in Sachsen) mit Regionalbüros in Pirna, Wurzen und Neukirchen und dem von Kirchen, DGB und anderen Organisationen getragenen Verein MoBiT (in Thüringen) mit Regionalbüros in Erfurt, Gotha und Saalfeld versuchen neben z.T. vorliegenden Eigenerfahrungen als Initiativen aus Vorlaufphasen von dem dort gewonnenen Erfahrungsschatz zu profitieren. Ihr Ziel besteht im wesentlichen darin, eine demokratische Kultur, vor allem im lokalen und regionalen Raum, so zu fördern, dass die Sensibilisierung für offene oder verdeckte Formen von Rassismus und sonstiger Ausgrenzung von Minderheiten geschärft wird, ein Klima von Weltoffenheit und Toleranz entsteht, die Verantwortung für das Gemeinwesen entwickelt und zivilcouragiertes Einschreiten gegen rechtsextreme Tendenzen gestützt wird. Zielgruppen finden sich somit primär in jenem Bevölkerungssegment, das sich selbst der in Opposition zu rechtsextremen Bestrebungen stehenden, demokratischen Öffentlichkeit verbunden fühlt. Insbesondere handelt es sich um: in die Kommunalpolitik eingebundene Verantwortungsträger, MultiplikatorInnen (z.B. Lehrpersonen, ErwachsenenbildnerInnen, Fachkräfte der Sozialen Arbeit) und bürgergesellschaftliche Initiativen und Organisationen. Durch das Angebot von thematisch-inhaltlicher Information, methodischen Ressourcen, Analyse, Dokumentation, Beratung, Moderation, Fortbildung und Vernetzung sollen die demokratischen Kräfte des Gemeinwesen in die Lage versetzt werden, Bestrebungen der Etablierung kultureller Hegemonie durch die Rechtsextremen kompetent und konsequent entgegentreten zu können. Wegen der noch kurzen Laufzeit der meisten Projekte ab Sommer bzw. Herbst 2001 lässt sich über Effekte noch nichts aussagen. Unabhängig davon lässt sich aus der Sicht der bisherigen Praxis, bspw. auch derjenigen mit dem 25 Mio. DM Programm für die Kommunen in NRW (s.o.), feststellen: Die Beratung von Kommunen bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und der Aktivierung von demokratischen Kräften der Selbsthilfe erscheint dringend geboten. Eine auf die konkrete Situation vor Ort bezogene, lebensweltnahe Qualifizierung und Beratung von pädagogischem und sozialarbeiterischem Personal sowie von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen muss allgemeine Analysen und Informationsveranstaltungen unbedingt ergänzen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Einsatz von Fördergeldern eher willkürlich und mehr oder minder beliebig erfolgt, innovative Ansätze der 'Basis' unvermittelt bleiben, 161 daher konventionelle, auf die aktuelle Problemlage von Rechtsextremismus nur unzureichend bezogene Strategien gleichsam 'blind' weiter'gefahren' werden, Aktivitäten nicht auf Kontinuität hin angelegt werden und damit letztlich der intendierte Effekt zu verpuffen droht. Die Stärkung zivilgesellschaftlicher Selbstorganisationsformen gewinnt dabei in Ostdeutschland insofern besondere Bedeutung, als die allgemeinen Quoten bürgerschaftlichen Engagements hier – wohl als Nachwirkung eines international festzustellenden West-OstGefälles zwischen liberal-marktwirtschaftlich und sozialistisch/kommunistischplanwirtschaftlich verfassten Staaten (vgl. Offe 2002, 279) – deutlich geringer ausfallen (vgl. Rosenbladt 2000, 29) und daher eine nachholende Entwicklung zu vollziehen ist. Der Ansatz der Mobilen Beratungsteams erfüllt insofern einen deutlich sichtbaren Bedarf. Allerdings gilt wohl auch: "Zivilgesellschaftliches Engagement... schafft (bestenfalls; Zusatz d. Verf.) eine politische Kultur, in der sich fundamentalistische Lösungen nicht entwickeln können", aber es "liefert uns kein 'Rezept' gegen Extremismus und Gewalt" (Keupp 2001, 12). Anders formuliert: Die Schaffung und Stabilisierung demokratischer zivilgesellschaftlicher Strukturen ist kein Allheilmittel, sondern erscheint geeignet, eine bestimmte Funktion innerhalb einer sinnvollen Gesamtstrategie zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und von sozialer Desintegration in seinem sozialen background zu erfüllen. Insbesondere besteht die Gefahr, dass bei einer einseitigen Zuspitzung des Engagements auf die Etablierung von sog. Gegenöffentlichkeit 'gegen rechts' die unmittelbare Ansprache der rechten Problemträger aus dem Blick gerät, die in der Civitas-Förderrichtlinie für MBTs immerhin angedeutet ist ("Erstkontakt für ausstiegswillige rechtsextreme Jugendliche und Vermittlung von professionellen Ausstiegshilfen für Angehörige der rechtsextremen Szene"). Nicht nur dass Organisationstätigkeiten obsiegen könnten: Der Vernetzungsgedanke erstreckt sich dann auch nicht mehr auf die soziale Vernetzung von Betroffenen. Eben diese aber erhält aus jener Analyse ihre Berechtigung, die soziale Desintegrationserscheinungen und Verluste nichtpartikularistischer sozialer Einbindung wie demokratiekompatibler Anerkennung als Faktoren von Wendungen nach rechts ausmacht. Die Strategie der Vermittlung funktionaler Äquivalente für Problemverhalten ist aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Sicht für eine nachhaltige Durchsetzung von Veränderungsinteressen unhintergehbar. 3.1.15 Aussteigerprogramme Für Rechtsextremisten, die sich aus ihrer Szene lösen wollen, halten der Bund und die Länder Aussteigerprogramme vor. Daneben besteht eine private Initiative namens "Exit", die beim Zentrum Demokratische Kultur eingerichtet ist und von der Illustrierten "stern" finanziert wird. Das Bundesamt für Verfassungsschutz startete im April 2001 sein Aussteigerprogramm. In seinem aktiven Teil hat es eine bundesweite Telefon-Hotline (0221/79262) sowie eine EmailAdresse für vertrauliche Kontaktaufnahmen geschaltet. Nach Verfassungsschutzangaben hat man im ersten halben Jahr ca. 730 Anrufe gezählt, unter ihnen zumeist Medienvertreter, Pädagogen und Eltern, aber nur 160 potenzielle Aussteiger. Mit "bis zu 70" von ihnen soll es "intensive Gespräche" gegeben haben, wobei "ein Teil" der Ausstiegswilligen die Szene bereits verlassen hat (vgl. www.verfassungsschutz.de). Im Regelfall handelt es sich um junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Zu zwei Dritteln kommen die Anrufer aus dem Westen, zu einem Drittel aus dem Osten Deutschlands (einschl. Berlin). Ein aktiver Teil des Programms sieht die direkte Ansprache von Führungsfiguren und langjährigen Kadern vor, von denen vermutet wird, sie seien zu einem Bruch mit der rechtsextremen Szene bereit. Diese müssen dann ein persönliches Gespräch mit einem 162 Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Köln oder Berlin durchführen, das die Ernsthaftigkeit der Ausstiegsabsicht belegen soll. Aussteiger bekommen ausdrücklich keine Ausstiegsprämie, sondern allenfalls Hilfen bei Arbeits- und Wohnungssuche und bei einem evtl. erforderlich werdenden Umzug angeboten. Daneben haben die Länder aufgrund eines Beschlusses der Innenministerkonferenz vom Mai 2001 – mit einer Ausnahme - eigene Aussteigerprogramme, vor allem für Ausstiegswillige, die im weitesten Sinne zu den Sympathisanten und 'Mitläufern' gezählt werden. Sie sind von Land zu Land jeweils unterschiedlich angesiedelt und werden verschieden gehandhabt. In ihrer jeweiligen Typik werden sie im folgenden selektiv-exemplarisch vorgestellt: In Bayern unterhält der Landesverfassungsschutz schon seit Februar 2001 ein Beratungs- und Hinweistelefon (01802000786) für Ausstiegsinteressierte und sucht auch von sich aus aufgrund von Hinweisen potenzielle ausstiegsbereite Rechtsextremisten auf. Gespräche mit gegenwärtig ca. 30 ernsthaft Interessierten wurden in einigen Fällen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Sachsen hat ebenfalls als Ergänzung zum Bundesprogramm beim Verfassungsschutz eine Hotline eingerichtet (0351/655655655), wo sich sowohl Aussteiger melden können, als auch Hinweise aus der Bevölkerung auf rechtsextreme Umtriebe gesammelt werden. Letztere sollen "das Abgleiten von Mitläufern und Sympathisanten in die ideologischen Vereinnahmungen des Rechtsextremismus verhindern" helfen (www.sachsen.de/de/bf/verwaltung/verfas-sungsschutz/aktuelles/index.html). Niedersachsens "Aussteigerhilfe Rechts" existiert seit dem 1. November 2001 und ist beim Justizministerium angesiedelt. Eine zentrale Anlaufstelle koordiniert die Arbeit. Im Mittelpunkt stehen Hilfestellungen zum Ausstieg für Straftäter, die in Justizvollzugsanstalten einsitzen und kurz vor der Haftentlassung stehen, zu Geldstrafen verurteilt wurden oder Bewährungsauflagen unterliegen sowie für einschlägig Beschuldigte in laufenden Strafverfahren. Zwei Szene-erfahrene Sozialarbeiter stehen dafür zur Verfügung. Ein Kontakttelefon gibt es nicht. Rheinlandpfalz besitzt ein Aussteigerprogramm, das zum einen eine Hotline (0800/4546000) für einen ersten anonymen Kontakt Ausstiegswilliger bietet, zum anderen aber auch gleichzeitig für Fragen von am Thema Rechtsextremismus allgemein Interessierter zur Verfügung steht. Über das im Landesjugendamt angesiedelte Projekt "(R)AUSwege" sollen gezielt junge Menschen, die auf der Suche nach Alternativen zu rechtsextremer Selbstverortung sind, angesprochen, Eltern beraten und LehrerInnen und SozialarbeiterInnen informiert und unterstützt werden. Ein konkretes Konzept existiert aber noch nicht. Nordrhein-Westfalen verfolgt ein Programm, das eine Arbeitsteilung zwischen Verfassungsschutz und Jugendarbeit vorsieht. Wer hier als Ausstiegsinteressierter die zugleich auch als "Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Bürger und Bürgerinnen" eingerichtete "Helpline" (0180 3 100 110) anruft oder sich auf anderweitigem Wege, bspw. durch Kontaktaufnahme aus Strafanstalten heraus, aus eigenem Antrieb meldet, wird entweder – sofern es sich nicht nur um einen offensichtlichen 'Mitläufer' handelt und/oder die Person älter als 27 Jahre ist – vom Verfassungsschutz weiter betreut oder – bei jüngerem Klientel, sofern es nicht der organisierten Aktivistenszene entstammt – an Betreuungsmöglichkeiten weiterverwiesen, die über die Aktion Jugendschutz NRW als koordinierende Stelle zur Verfügung gestellt werden. Zur Zeit wird überlegt, mit welchen 163 Qualifikationen die sie tragenden Fachkräfte aus unterschiedlichen Regionen des Landes ausgestattet werden müssen. In Baden-Württemberg hat im Rahmen eines zunächst auf ein Jahr befristeten Probelaufs das Landeskriminalamt die Federführung für das Aussteigerprogramm. Nach seinen Angaben fallen potenziell 1.180 Personen zwischen etwa 14 und 32 Jahren in die Zielgruppe, darunter auch Sympathisanten, die noch keine Straftaten begangen haben, aber z.B. als Mitglieder oder Sympathisanten der rechten Skinhead-Szene polizeilich beobachtet werden. Ca. 500 von ihnen wurden mittlerweile kontaktiert. Finanziert aus Eigenmitteln wird die sog. BIG-REX (Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechtsextremismus) eingesetzt, die gegenwärtig aus 4 Stamm- und 15 Ergänzungsbeamten besteht - unter ihnen auch Diplompsychologen und –pädagogen – und die in Abstimmung mit örtlichen Polizeidienststellen und im Zusammenwirken mit örtlichen Jugendsozialarbeitern die Herauslösung junger Leute – im Schwerpunkt von 16- bis 20jährigen – aus dem rechten Spektrum erreichen soll. Bei Bedarf wird u.U. nach Absprache zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft die Einstellung von Verfahren Ausstiegswilliger, in Zusammenarbeit mit Jugendämtern Diversion, der Schutz gegen Repressalien aus der rechten Szene (z.B. durch auswärtige Unterbringung) und die Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm zur Erhöhung der Ausstiegsmotivation bzw. der Aussagebereitschaft angeboten. Die Gewinnung von Aussteigern als Ausstiegsmultiplikatoren gilt als wünschenswert. Ein Erfahrungsbericht wird erst Mitte Juli 2002 vorliegen. Bisherige Erfahrungen zeigen aber zumindest dreierlei: dass allein die Schaltung von Telefon-Hotlines und Websites wenig bewirkt, weil sich hier weitaus mehr Medienvertreter u.a. am Thema Interessierte als wirklich Ausstiegsinteressierte Rechtsextremisten melden, dass ohne ein aktives Aufsuchen Gefährdeter die Zahl der zu Erreichenden gering bleiben wird, dass aus polizeilicher Sicht eine Zusammenarbeit mit Jugendbehörden und eine sozialarbeiterische Begleitung Ausstiegsinteressierter unabdingbar ist. Sachsen-Anhalts Programm ist ebenfalls beim LKA angesiedelt und geht ähnlich offensiv vor wie das von Baden-Württemberg. D.h. Zielgruppen sind neben vereinzelt oder wiederholt in Erscheinung getretenen Straftätern und Kameradschaftsangehörigen auch Sympathisanten der Szene. Sogar bloße Besucher bei Skinhead-Konzerten müssen mit Beobachtung und polizeilicher Ansprache ihrer Erziehungsberechtigten rechnen. Auch eine Einschaltung von Jugendbehörden ist beabsichtigt. Bis zum Frühsommer 2001 führte das LKA des Landes ca. 200 Gefährderansprachen durch, wobei man 100 Personen antraf, von denen man wiederum die Hälfte zu Gesprächen motivieren konnte. 13 Personen teilten mit, keine Straftaten mehr begehen bzw. ganz aus der Szene aussteigen zu wollen. Die private Initiative "Exit" wurde im August 2000 gegründet. Hinter ihr stehen vor allem der ehemalige Polizeibeamte Bernd Wagner – jetzt Leiter des Zentrum Demokratische Kultur und der Szene-Aussteiger Ingo Hasselbach. Vorbild ist das schwedische Modell, das wiederum auf den Erfahrungen des von 1995 bis 1997 entwickelten und dann förmlich gestarteten norwegischen Modells beruht (vgl. Bjorgo 2001; Bjorgo/Halhjem/Knudstad 2001). Dieses Modell begann dadurch, dass 1995 und 1996 in Oslo und Kristiansand eine rechtsextreme Jugendszene mit Mitgliedern von z.T. 13 Jahren oder sogar jünger zunehmend polizeiauffällig wurde. Daraufhin schlossen sich einige Eltern dieser Jugendlichen zu einem Eltern-Netzwerk zusammen und suchten die Beratung von Fachleuten, mit denen zusammen ein Projekt entwickelt wurde, das, staatlich unterstützt, aber 164 bei der Nicht-Regierungs-Organisation "Eltern für Kinder" angesiedelt, vorrangig drei Ziele verfolgte: Jugendliche bei Ablöseprozessen zu unterstützen, Eltern Betroffener primär auf lokaler Ebene zusammenzuführen und Professionelle mit Wissen über rechtsextreme und gewaltorientierte Cliquen und Methoden sozialer Arbeit mit ihnen zu versorgen. Die Eltern haben in dem Konzept eine zentrale Position inne. Sie wird in der Methode der strukturierten Eltern-Kind-Professionellen-Konversation deutlich: Nachdem der betreffende Jugendliche von einem pädagogischen oder polizeilichen Professionellen zu einem freiwilligen Gespräch mit seinen Eltern eingeladen wurde und beide Seiten darüber aufgeklärt wurden, was das Beibehalten des inkriminierten Verhaltens für Konsequenzen nach sich ziehen würde, wird die Motivation für das politisch abweichende Verhalten des Jugendlichen geklärt, nach funktionalen Äquivalenten gesucht und insgesamt eine Reorientierungsphase in Gang gesetzt, in der die Eltern eine wichtige begleitende Rolle spielen und in die auch andere Einrichtungen (Schule, Sozialarbeit) involviert sind. Die Erfolge sind ermutigend: Von den 100 in das Programm einbezogenen Jugendlichen mit 130 Elternteilen konnten 90% aus der rechten Szene herausgelöst werden. Freilich arbeitete das norwegische Projekt – wie auch ein davon inspiriertes, noch stärker präventiv ausgelegtes finnisches Projekt - mit eher jüngeren und noch wenig in der Szene verankerten Jugendlichen. Es kann sicher auch davon profitieren, dass die Größenordnung der aktiven rechtsextremen Szene in Norwegen mit rd. 100 – 150 Personen ausgesprochen klein und daher eine kontinuierliche Ansprache, ideologische Verankerung und dauerhafte Involvierung junger Leute selten bzw. unwahrscheinlich ist. Ältere, stärker und länger rechtsextrem involvierte Zielgruppen erreichte demgegenüber der schwedische Ableger des norwegischen Projekts. Er ist situiert in einem Staat, indem es mit rd. 3000 Rechtsextremen mindestens 20 mal so viele Neo-Nazis gibt wie in Norwegen. Das Modell startete Mitte 1998 rund um den schwedischen Neo-Nazi-Aussteiger Kent Lindahl (vgl. 2001) und andere Abtrünnige und kann deshalb auch vergleichsweise stark auf PeerBeratung fußen. Es arbeitet unmittelbar mit den Ausstiegsinteressierten, die sich bei ihm melden. Seine Evaluation fällt außerordentlich positiv aus (vgl. NCCP 2001, auch www.bra.se/web/material): Bis Mitte 2001 hatte es insgesamt 133 Personen – meist im Alter zwischen 18 und 25 Jahren - in einer 6- bis 12monatigen Betreuung. 125 von ihnen trennten sich von ihren rechten Kumpanen. Obwohl dieser Erfolg auch ganz wesentlich darauf zurückgeführt wird, dass hier mit ehemaligen Szene-Angehörigen als Ausstiegsberatern Leute mit nahezu demselben Erfahrungshintergrund und entsprechend hoher Glaubwürdigkeit zur Verfügung stehen, gilt eine stärkere Professionalisierung und Anbindung der Arbeit an andere lokale Akteure wie soziale Einrichtungen als wünschenswert. Das – wie erwähnt am schwedischen Vorbild orientierte – deutsche "Exit"-Modell betreibt keine aufsuchende Arbeit in Szenen, in denen Ausstiegswillige vermutet werden, sondern baut auf die Eigeninitiative von Ausstiegsinteressierten, die sich telefonisch oder über E-Mail melden. Mit einem multiprofessionellen Team aus 6 ganzen und einer halben Stelle werden z.Zt. (Mitte Januar 2002) rd. 90 Fälle bearbeitet, die aus 120 – 140 Anfragen resultieren und ungefähr zu zwei Dritteln 'Mitläufer' und zu einem Drittel Angehörige der Kern-Szene betreffen. Die meisten sind zwischen 17 und 27 Jahre alt und männlich. Zumeist handelt es sich um Fälle aus dem Westen Deutschlands oder aus Berlin, vermutlich deshalb, weil hier der Ausstiegsdruck vergleichsweise stärker sein dürfte als im Osten. Das Vorgehen umfasst drei Schritte: 165 Zunächst wird abgeklärt, ob eine Gefährdung vorliegt oder der Ausstieg auch ohne Begleitung vollzogen werden kann. In einem zweiten Schritt, der bei den meisten notwendig wird, wird ein Treffen ausgemacht, bei dem eine inhaltliche Auseinandersetzung um die politische Ideologie und die politische Ausstiegsmotivation stattfindet. Ggf. erfolgen weitere Gespräche dieser Art. Der dritte Schritt kümmert sich um die Wiedereingliederung des Ratsuchenden. Es wird ein so genannter "Helferplan" erstellt, der die individuelle Betreuung anleitet. Die Arbeit ist zeitintensiv, da Bedrohungen nicht selten sind und Arbeits- und Wohnungssuche 'konspirativ' erfolgen müssen. Neben der direkten Arbeit mit der Zielgruppe Rechtsextremer wird eine Stärkung des sozialen Umfelds betrieben, um den Ausstiegsdruck zu erhöhen bzw. beizubehalten. Dies geschieht zum einen über die Stabilisierung einer demokratischen Gegenkultur – hier sieht das Zentrum Demokratische Kultur seine Hauptaufgabe – und zum anderen über Exit-Eltern-Initiativen, die z.Zt. in 3 Regionalgruppen in Niedersachsen, Berlin und Baden-Württemberg organisiert sind. Nahezu ein Drittel der Ausstiegsinteressierten konnte Exit inzwischen nach eigenen Angaben zu einem vollständigen Bruch mit ihrer extremistischen Vergangenheit und zum Aufbau eines neuen Lebens bewegen. Gegenüber den Aussteigerprogrammen der staatlichen Stellen verweist "Exit" Deutschland auf die Differenz viel glaubhafter als diese ausschließen zu können, dass eine Weitergabe von Daten an staatliche Kontrollorgane erfolgt, sich ausdrücklich auch mit der rechtsextremen Ideologie von Szeneabtrünnigen auseinander zu setzen, auf eine Re-Demokratisierung der politischen Auffassungen Wert zu legen und nicht nur – wie bei Polizei und Verfassungsschutz vermutet wird – das Interesse an Gewaltreduktion, die auch ohne Einstellungsänderung vonstatten gehen kann, zu verfolgen, ein echtes Interesse am Ausstieg dadurch voraussetzen zu können, dass dem Aussteiger der erste Schritt der Ablösung durch die selbst gewählte Kontaktaufnahme zu "Exit" zugemutet wird und auf die im Team repräsentierten Peer-Erfahrungen und sozialarbeiterische Kompetenzen zurückgreifen und daneben Laienhelfer aktivieren zu können, die bei der Re-Integration in Arbeit und bei der Gewährung von Wohngelegenheiten behilflich sein können. Eine abschließende Einschätzung kann angesichts der kurzen Laufzeiten der Programme und fehlender Evaluation nicht gegeben werden. Gleichwohl deutet sich an: Rechtsextreme, die aussteigen wollen, ohne sich Strafverfolgungen ausgesetzt sehen zu wollen, werden im Regelfall kaum geneigt sein, sich ohne weiteres ausgerechnet an die Sicherheitsbehörden zu wenden, um bei ihrem Vorhaben Hilfe zu bekommen. ExpertInnen wissen längst, dass mit der Schaltung von Hotlines und Websites wenig Erfolg verbunden ist. Ohne sozialarbeiterische Kompetenzen der psycho-sozialen Begleitung Ausstiegswilliger versandet ein Ausstiegsprogramm, bevor es richtig begonnen hat. Es bedarf keines ausgeprägten wissenschaftlichen Spürsinns, um konstatieren zu können, dass Zahlenangaben über Kontakte und Ausstiegsbetreuungen wenig aussagekräftig sind. Sie sind abhängig von dem, was im einzelnen unter "Hilfe", "Betreuung", "Begleitung" oder ähnlichen Begriffen verstanden wird und sie sind letztlich nicht nachprüfbar. Ausstiegshilfe für rechte Kader ist ungeheuer zeitintensiv. Es stellt sich die Frage, ob Aufwand und Ertrag in einem akzeptablen Verhältnis stehen, wenn man gleichzeitig registrieren muss, dass jene Altersgruppe, die das Rekrutierungs- und damit auf Dauer 166 auch Stabilisierungsreservoir rechtsextremer Kameradschaften und Organisationen darstellt und mit der man in Norwegen ausgesprochen gute Erfahrungen bezüglich der Effektivität von Ausstiegshilfen gemacht hat, fast gar nicht erreicht wird: die Gruppe der jüngeren Jugendlichen, die noch wenig in der rechten Szene und ihrer Ideologie verwurzelt sind und daher eher pädagogischen und sozialarbeiterischen Einflüssen zugänglich sind. Bei diesen jüngeren Nachwuchs-Gruppierungen aus der Rand- und Sympathisanten-Szene erscheint es gänzlich unwahrscheinlich, ohne aufsuchende Strategien Sozialer Arbeit zum Erfolg zu kommen. Wie vor allem das baden-württembergische und sachsen-anhaltinische Beispiel deutlich macht, muss die Diskussion über grundsätzliche Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenarbeit von Polizei und Jugendarbeit geführt werden, gerade auch aus der fachlichen Sicht Sozialer Arbeit. Augenscheinlich überschneiden sich hier professionell beanspruchte Zuständigkeitsbereiche in kaum noch transparenter Weise. Wo Beratung aufhört und staatliche Kontrolle anfängt, ist kaum noch durchschaubar. Wie sollen sich polizeilich übernommene sozialpädagogische Aufgabenstellungen mit dem Erfordernis vertragen, Betroffene über das strafprozessuale Auskunftsverweigerungsrecht aufzuklären? Bürger- und datenschutzrechtlich bedenklich erscheint die Ausweitung des polizeilich-kontrollierenden Blicks auf Jugendliche, die bei bestimmten Szene-events (z.B. Konzerten) auftauchen, ohne deshalb als faktische oder potenzielle kriminelle Gefährder von Sicherheit und Ordnung an den Tag treten zu müssen. Verschärft gilt dies für das Aufsuchen von Eltern und anderer Erziehungskräfte im Umfeld dieser Jugendlichen. Muss man gewärtigen, dass hier unter dem Deckmantel von sozialarbeiterischer Tätigkeit Jugendkulturen polizeilich ausgeleuchtet werden können? Muss man in Umsetzung der polizeilichen Absicht, die von der Polizei Angesprochenen an soziale Einrichtungen weiterzuvermitteln, vielleicht gar befürchten, Soziale Arbeit werde als verlängerten Arm ordnungspolitischer Interessen instrumentalisiert, damit letztlich aus Sicht ihrer Klientel delegitimiert und ihrer Hilfefunktion beraubt? 3.1.16 Opferberatung Vor allem in Ostdeutschland existieren – in der Mehrzahl über Civitas angeschoben und insofern erst seit kurzem – Beratungsstellen für Opfer rechtsextremer Gewalt (Adressen unter www.opferperspektive.de). Es handelt sich im einzelnen um Einrichtungen in Neubrandenburg, Wurzen, Erfurt, Potsdam, Leipzig, Berlin, Dessau und Magdeburg, z.T. mit weiteren regionalen Untergliederungen in Borna, Dresden, Gardeleben, Gera, Görlitz, Halberstadt, Halle, Neubrandenburg, Rostock, Weißenfels und Wismar. Die Einrichtungen werden tätig, wenn außer der subjektiven Deutung der Opfer – zumeist AusländerInnen oder nicht-rechte deutsche Jugendliche - plausible Indizien für eine rechtsextreme Motivation bestehen. Sie bieten entweder auf Eigeninitiative hin durch aufsuchende, niederschwellige Arbeit oder bei selbst aufgenommener Ratsuche von Opfern vor allem: Hinweise auf rechtliche Möglichkeiten (evtl. z.B. Nebenklage), Unterstützung bei der Zeugensuche, Begleitung bei Behördengängen und bei Gerichtsverfahren, Vermittlung von ärztlicher und psychotherapeutischer Hilfe, materielle Unterstützung über Ressourcen wie gesetzliche Opferentschädigungsleistungen, Opferfonds, Prozesskostenhilfe und Kontaktaufbau zu Initiativen der Opferunterstützung vor Ort. 167 Außerdem betreiben sie die Vernetzung solcher Initiativen und leisten Dokumentations- und Öffentlichkeitsarbeit, im Falle der Einzelfall-Publikation nur in Absprache mit dem Opfer. Konzeptioneller Ansatzpunkt ist das Bemühen, den Weg "von der Analyse der Tätergesellschaft zur Förderung von Solidarisierungsprozessen mit den Betroffenen" zu gehen (so in der Selbstdarstellung von "Opferperspektive", einer schon seit Mitte 1998 arbeitenden 'Vorreiter'-Organisation in Brandenburg; vgl. – auch zum folgenden -: www.kamalatta.de/opferperspektive/Opferperspektive.html). Die Parteinahme für die von rechter Gewalt Betroffenen soll diese aus der passiven Opferrolle herausführen sowie Ohnmacht und Angst abbauen. Von kleinen symbolischen Gesten spontaner Anteilnahme bis zu konkreten praktischen Hilfen ist es das Ziel, dem Opfer seine Eingebundenheit in soziale Zusammenhänge zu bezeugen und Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein wiederherzustellen. Mittels Öffentlichkeitsarbeit sollen über die einzelfallbezogene Arbeit hinaus Ignoranz, Gleichgültigkeit und Verleugnung abgebaut, politische Sensibilisierungen erzielt, ein Klima der Einschüchterung verhindert, Solidarisierungsprozesse im sozialen Umfeld mit den Opfern, aber Entsolidarisierungsprozesse mit den Tätern ausgelöst, Bündnisse gegen Ausgrenzung aufgebaut, demokratische Strukturen gestärkt und rechte Machtpositionen geschwächt werden. Bestrebungen zum Aufbau rechtsextremer Hegemonie soll so gerade in den ostdeutschen Ländern konsequent entgegengetreten werden. "National befreite Zonen" als "No-Go-Areas" für potenzielle Opfer sollen verunmöglicht werden. Bei den UnterstützerInnen fällt dabei als Lernprozess ab, entweder die eigene Engagementbereitschaft 'gegen rechts' und darüber hinaus für die Sicherung demokratischer Verhältnisse generell bei sich zu entdecken – dies gilt insbesondere für Jugendliche aus der demokratischen Jugendszene - oder die "emotionale Verwurzelung antifaschistischer Überzeugungen" über das tatsächliche Praktizieren von Auffassungen zu stärken und "das Problem Rechtsextremismus nicht nur von der rational-analytischen Seite aus zu betrachten" (ebd., 6). In jedem Fall wird auch Gelegenheit gesehen, den "Gesamtzusammenhang zwischen rassistischer Gewalt, rassistischen Einstellungen und institutionalisierter Diskriminierung deutlich" (ebd.) werden zu lassen. Indem die Opferunterstützung als "Teil einer möglichen antifaschistischen Strategie" (ebd. 7) begriffen wird, wird das sie leitende Paradigma der Hilfe in den Kontext eines Gestaltungsparadigmas gestellt, für die die aktive Sicherung einer demokratischen Zivilgesellschaft zentral ist, insbesondere im lokalen Raum durch die Aktivierung der hier vorhandenen Strukturen, u.a. auch die Sensibilisierung der zuständigen Behörden und FunktionsträgerInnen. Beratung erhält insofern die Formate persönlicher Unterstützung und struktureller Verbesserung (vgl. zum obigen auch exemplarisch das Konzept von ABAD Thüringen e.V. und im Überblick die Förderleitlinien und den Zwischenbericht für "Civitas", v.a. 45-78). Eine entsprechend enge Zusammenarbeit erfolgt mit den Mobilen Beratungsteams. Generelle, dabei situativ ggf. zu modifizierende Handlungsempfehlungen für potenzielle Opfer wie sie Polizeidienststellen, aber auch Mediations-ExpertInnen (vgl. z.B. Korn/Mücke 2000) abgeben (weglaufen, den Täter nicht provozieren, Hilfe aus der Umgebung anfordern, mit vertrauten Personen die Situation aufarbeiten, durch Anzeige vor Wiederholung schützen, gefährliche Orte vermeiden), können als hilfreich bewertet werden, wenngleich sie im wissenschaftlichen Sinne in ihrer Effektivität bislang nicht evaluiert wurden. Wegen der Neuartigkeit des Ansatzes der Opferberatungsstellen liegen noch keine evaluativen Auswertungen für ihn vor. Die Projekte befinden sich zumeist noch in der Startphase, haben zwar die unmittelbare Beratungsarbeit schon begonnen, sind aber noch stark mit Fragen der Selbstorganisation, der Öffentlichkeitsarbeit (Sich-Bekannt-Machen), der eigenen lokalen und regionalen Vernetzung und der Weiterbildung bzw. Supervision der 168 eigenen MitarbeiterInnen, die nicht zuletzt wegen der hohen Kompetenzanforderungen und der eigenen psychischen Belastung als außerordentlich wichtig eingestuft wird (vgl. auch Zwischenbericht "Civitas", 46; Rommelspacher u.a. 2002), befasst. Erfahrungen der schon etwas länger arbeitenden Stellen in Brandenburg und Leipzig belegen den Bedarf an Beratung. So berichtet Brandenburg von einer Zahl an Betreuungen von ca. 100 Fällen p.a.. Zudem wird deutlich, dass mit der Etablierung der Beratungsstellen sich zunehmend auch Beratungsbedarfe zeigen, u.a. deshalb, weil Betroffene erst allmählich von der Möglichkeit der Beratung erfahren. Erschwerend kommt hinzu, dass psychosoziale und juristische Fachkompetenz innerhalb von Beratungsstellen in den neuen Bundesländern generell noch Mangelware ist und Kooperation daher nur eingeschränkt möglich ist (vgl. auch ebd.). Aus theoretischer und empirischer Sicht bietet sich eine speziell auf rechtsextreme Straftaten bezogene Opferberatung grundsätzlich vor allem dort an, wo entsprechende Straftaten gehäuft auftreten, die von ihnen betroffenen Minoritätengruppierungen von den vorhandenen unspezialisierten Beratungsstellen aufgrund höherer Zugangsschwellen, ihres stationären Charakters, Sprachproblemen von AusländerInnen o.ä. nicht oder nur unzureichend erreicht werden und zudem Mängel an bzw. in zivilgesellschaftlichen Strukturen zu konstatieren sind. Dies ist vorwiegend in den neuen Bundesländern der Fall. Die Verbindung von Hilfe- und Gestaltungsparadigma lässt den Ansatz aussichtsreich erscheinen. Er vermeidet eine individualisierende Sichtweise, indem er Übergriffe als Extremform weiter verbreiteter Diskriminierungsarten auffasst und die Bearbeitung eben dieser Hintergründe in sein Aufgabenspektrum mit einbezieht. Die Frage, was mit Tätern oder potenziellen Tätern jenseits von staatlicher Repression zu geschehen hat, lässt er allerdings ebenso unbeantwortet wie vorerst die nach einer Gewähr für die Nachhaltigkeit zivilgesellschaftlichen Engagements für Minderheitenschutz und Demokratisierung. 3.1.17 Soziale Arbeit mit MigrantInnen, Antidiskriminierungsarbeit interkulturelle Ansätze und Der pädagogische und sozialarbeiterische Umgang mit den Phänomenen der multikulturellen Gesellschaft – ein Begriff der etwa seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland geläufig ist – hat sich innerhalb der letzten zwei Dekaden zunehmend von der Blickverengung auf eine problemgruppenzentrierte Sozialarbeit mit MigrantInnen befreit. Die sog. "Ausländerpädagogik" bzw. "Ausländersozialarbeit" wurde – trotz mancher Beharrungstendenzen der Praxis der Migrationssozialdienste – nicht nur terminologisch von der Perspektive "interkultureller Arbeit" in den Hintergrund gedrängt. So unterschiedlich auch im einzelnen die theoretischen und praktischen Inhalte des "Interkulturalitäts"-Begriffs oder auch Absetzungen von ihm ausfallen, so bringt seine Verwendung in der Debatte dennoch den weitreichenden Konsens zum Ausdruck, dass Autochthone und Allochthone gleichermaßen Zielgruppen einer sozialen und pädagogischen Arbeit sind, die sich gegenseitige Achtung, Anerkennung, Toleranz und Integration über kulturelle Unterschiede hinweg zum Ziel setzt. Dahinter steht die Erkenntnis, soziale Integration innerhalb multikulturell zusammengesetzter Gesellschaften nicht über die bloße Assimilation der Eingewanderten erreichen zu können. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass die Herstellung von Gemeinsamkeit, oder wenigstens einer Basis für ihre Entwicklung, nicht ohne Veränderungen auch der Aufnahmegesellschaft möglich ist. Dürfte in dieser Hinsicht in Bezug auf die pädagogischen und sozialarbeiterischen Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft, zumal im Zuge von sich weiter ausbreitender Globalisierung, unter Fachkräften mehr oder weniger Übereinstimmung herrschen, so stellen sich einzelne Ansätze interkultureller Arbeit äußerst heterogen dar. 169 In einem Spannungsfeld zwischen Begegnungs- und Konfliktpädagogik sind im Interesse an ihrer Sortierung mit Auernheimer (2000) vier Motive interkultureller Ansätze festzustellen: Ein erstes Motiv kreist um die Bearbeitung von Fremdheitserfahrung und rückt die Verstehensproblematik in den Mittelpunkt. Eine (re-)konstruktivistischer Ansatz bringt dabei in Anschlag, dass Kulturen und Personen als "Sinnsysteme" ihre Beziehung zu anderen Systemen über Identitätsarbeit einerseits und Grenzziehungen andererseits bewerkstelligen müssen. Eine "Auflösung der Sinngrenzen", die durch Eigenheiten z.B. der Zeit- und Raumauffassungen, der Geschichte, der Entwicklungslogik und der jeweiligen Wahrnehmungstraditionen zu Stande kommen, kann danach nicht das Ziel sein. Nicht die Negation von Fremdheitsgefühlen führt weiter. Eher kommt es zur Erzielung von Verstehen auf die "Anerkennung von Grenzerfahrung" bei gleichzeitiger systeminterner Dauerreflexion und didaktisch deshalb auf Prozesse der Rekonstruktion von Selbst- und Fremd(heits)bildern an (vgl. Holzbrecher 1997; Schäffter 1997). Ein zweiter Motivkreis versteht interkulturelle Arbeit als Pädagogik, Soziale Arbeit bzw. Politik der Anerkennung. Es wird Bezug genommen auf gesellschaftstheoretische Analysen, die eine Individualisierung der Lebensführung in modernen Gesellschaften konstatieren. D.h. Individuen werden in zunehmendem Maße mit der Aufgabe konfrontiert, als Einzelwesen ihre personale und soziale Identität zu klären. Soziale, kulturelle und politische Verortung erwächst danach nicht mehr gleichsam naturwüchsig aus den strukturellen Vorgaben lebensweltlicher Milieus und anderer kollektiver Bindungen bzw. aus Glaubens- und Überzeugungssystemen. Auf der Voraussetzung der Differenzakzeptanz aufbauend, aber über sie hinaus gehend, gilt es deshalb, die Anerkennung des Rechts des bzw. der anderen (handele es sich um Personen oder Kulturen) ins Zentrum pädagogischer und sozialarbeiterischer Bemühungen zu rücken. Das Konzept der antirassistischen Erziehung markiert einen dritten Motivkomplex. Einerseits warnt es davor, Differenzbestimmungen bis hin zu Stereotypisierungen überzubetonen und so angebliche, vielleicht aber längst real überholte (wenn überhaupt jemals existente) kulturelle Eigenheiten festzuschreiben. Andererseits kommt es ohne die Voraussetzung einer Differenz zwischen unterdrückten und dominanten Kulturen nicht aus, wenn es rassistische Strukturen und Verhaltensweisen in den kolonialistisch-imperialistisch bzw. kapitalistisch geprägten Gesellschafen des Westens aufdecken und abbauen will. Deutlicher als andere Ansätze bezieht es die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft in den Prozess des Zurückdrängens von ethnisch-kultureller sozialer Ungleichheit und Diskriminierung ein. Ein vierter Ansatz setzt stärker auf den interkulturellen Dialog. Bei aller Anerkenntnis von Differenz sind demnach vor allem die gemeinsamen Bezugspunkte und Interessen verschiedener Kulturen herauszuarbeiten (vgl. Nieke 1995). Auf dieser Linie liegt etwa auch das Angebot des Berliner Anne Frank Zentrums für interkulturelle Unterrichtsprojekte. Die Materialien "Das bin ich – international" (für 4- bis 8jährige), "Das sind wir" (für 9- bis 12jährige) und "Das sind wir (2) – Das schaff ich schon" (für 13- bis16jährige) operieren mit einer Vielfalt an Methoden und Techniken (z.B. Lesebücher, CDs, Videos, Handpuppen, Lehrerhandbüchern, Karteikarten) und wollen, statt angebliche "typische Merkmale" der Angehörigen ethnischer Gruppierungen und Problemthematisierungen, die nicht selten auf Abwehrreaktionen stoßen, in den Vordergrund zu rücken, die Stärkung positiver Individualität und gegenseitiger Achtung von Kindern und Jugendlichen betreiben, indem sie die Kinder und Jugendlichen ermutigen, ihre Persönlichkeit so darzustellen wie sie selbst es möchten. So soll eine positive Wahrnehmung von kultureller und weltanschaulicher Vielfalt möglich werden, der das Erleben der Komplexität und der Einmaligkeit von Individuen zu Grunde liegt. Konkrete Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen aufgreifend, sollen Gemeinsamkeiten und Solidarisierungspotenziale erkennbar und positive Beziehungen von jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft so angeregt werden, dass sie sich nicht mehr dazu gedrängt sehen, das Wir-Gruppengefühl entlang 170 ethnischer Grenzen aufzubauen (vgl. kurz: van Dijk/Metzalar 1995; für ein vergleichbares, speziell aber für multilinguale Gruppen und transnational einsetzbares, eher auf Erwachsene zielendes Bildungskonzept, das die Bearbeitung von Sprachvielfalt ins Zentrum rückt, vgl. auch International Network 2001). In jedem Fall werden als Ergebnisse interkulturellen Lernens individuell und kollektiv Veränderungsschritte in Richtung auf die Entwicklung von interkultureller Kompetenz angestrebt. Sie beinhaltet eine Dialogfähigkeit, die ebenso auf der Anerkennung von Differenz wie auf der Bereitschaft zur Verständigung über Grenzen hinweg fußt und allen Beteiligten die Dauerreflexion ihrer Identitätsverständnisse und ihrer damit zusammenhängenden Abgrenzungsbestimmungen abverlangt. Insoweit ist es folgerichtig, wenn die UNESCO-Weltkommission "Kultur und Entwicklung" dazu auffordert, "Modelle interkultureller Erziehung von der Primarschule bis zur Hochschule einzuführen... das Bewußtsein für kulturellen Pluralismus...und für den Bedarf nach interkulturellem Dialog zu schaffen" (Deutsche UNESCO-Kommission 1997, 62). Ebenso konsequent und dazu vertiefend ist das Postulat, die Grundlagen für entsprechende Haltungen bereits in der Kindheits- und Jugendsozialisation zu schaffen. Dazu gehört die Aufwertung von allgemeinem sozialen Lernen zur Entwicklung von Fähigkeiten wie Offenheit im interpersonalen Umgang, Perspektivenwechsel, Empathie, Ambivalenzund Ambiguitätstoleranz, Rollendistanz, gewaltfreie Kooperations- und Konfliktfähigkeit, Verantwortungsübernahme schon ab dem Vorschulalter (vgl. exemplarisch: Böhm 2001) sowie die Entwicklung interkultureller (Hoch-)Schulkultur und interkultureller Curricula, mindestens in der vierfachen Dimensionierung von Selbstreflexionsschulung, multiperspektivisch basierter Verständigung, politischer Bildung und innerschulischen infrastrukturellen Maßnahmen, Aktivitäten, die in Organisationsleitbildern wie einem "Schulprogramm" niederlegbar sind. Interkulturelle Kompetenz ist so gesehen "bei Licht betrachtet nicht anderes als eine besonders differenzierte, um die kulturelle Komponente erweiterte Sozialkompetenz" (Grosch/Leenen 2000, 39). Damit wird deutlich, dass weder die Formate der Unterrichtung noch solche der Begegnung, die in der interkulturellen Arbeit vorherrschend sind, ohne weiteres zielführend sind. Denn für Formate der Unterrichtung gilt, dass die kognitiven Prozesse, die sie anzustoßen beabsichtigen, nur dann erfolgreich sind, wenn sie zum einen auf einem emotional entspannten sozialen Klima und lernförderlichen affektiven Motivkomplexen aufruhen können und zum anderen lebensweltorientiert ansetzen und durch handlungsorientierte Möglichkeiten für praktische Erfahrungen ergänzt werden (vgl. dazu auch die Empfehlungen "Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule" der Kultusministerkonferenz vom 25.10. 1996 sowie Niedersächsisches Kultusministerium 2000, 66-83 und die dortige Betonung der Relevanz von Empathieentwicklung und Perspektivenwechsel, umgesetzt in Handreichungen für konkrete Unterrichtsmodelle). Im Hinblick auf interkulturelle Begegnungen gilt als gesichert, dass sie die pädagogisch und sozialarbeiterisch gewünschten Effekte nur unter Einhaltung bestimmter Bedingungen mit sich bringen. Zu ihnen gehört (vgl. Allport 1954; Brewer/Miller 1984; Thomas 1994; Wagner/Avci 1994; Pettigrew 1997, 1998; Jonas 1998; Slavin/Cooper 1999; Wittig/Molina 2000; Dollase 2001): die Freiwilligkeit des Kontaktes, die Statusgleichheit der sich Begegnenden, die Möglichkeit der Wahrnehmung des jeweils Anderen als Individuum und nicht nur als austauschbarer Vertreter seiner Gruppe, die Verfolgung den Partikularinteressen übergeordneter gemeinsamer Ziele, die Betonung der Mitgliedschaft aller Beteiligten in einer gemeinsamen Gruppe (z.B. bei kooperativem Gruppenunterricht in Schulen positiv evaluiert; vgl. Wagner/Avci 1994; Slawin/Cooper 1999), 171 hinreichende Gelegenheiten für den Aufbau persönlicher Beziehungen und die normative Unterstützung des Kontaktes durch das institutionelle und sonstige Umfeld, relevante Autoritäten bzw. das politisch-soziale Klima. Dabei gilt es freilich, die transnationalen Muster der Selbsteingliederung der Angehörigen von Migrantenkulturen zu berücksichtigen, die die dualistische Gegenüberstellung von einheimischen Deutschen auf der einen und nichtdeutschen Einwanderern auf der anderen Seite obsolet werden lassen. Wo (vornehmlich junge) "Menschen eigene Migrationsprojekte" kleinräumig und/oder szeneförmig entwickeln (Beispiele: "Wir sind Frankfurter Türken" und deutsch-türkischer HipHop mit afroamerikanischen Anleihen), produzieren sie kulturelle Pluralisierungen jenseits globalisierter Einheitskultur: "Die kulturelle Praxis der Einwanderungsgesellschaft hält sich weder an die ethnischen Sortierungsmuster der etablierten Multikultur, noch lässt sie sich in einen interkulturellen Anpassungsdialog zwingen" (Römhild 2002, 11). Die Vielfalt an pädagogischen Theorie- und Praxisansätzen, die sich als "interkulturell" verstehen (dazu im Überblick z.B. Interkulturelles Lernen 2000), wäre unter diesen Kriterien kritisch zu prüfen. Hinzu kommt, dass Anerkennung und Integration ethnisch-kultureller Minderheiten nicht alleine Fragen von Bildung und Erziehung sind. Ohne infrastrukturelle Arbeit sind Anerkennungsdefizite nicht zu beseitigen und Integrationshindernisse nicht aus dem Weg zu schaffen. Gleiche Zugänge zu Arbeit, Wohnung und anderen relevanten materiellen Gütern zu eröffnen und die Teilhabe an politischen Entscheidungen zu vergrößern, ist deshalb ein wesentliches Ziel von Fachkräften in der Migrationsarbeit zum Abbau von Diskriminierungen und zur Verbreiterung interkultureller Kompetenzen, nicht allein in den Bereichen von Verwaltung und Beratung (vgl. zu konkreten Umsetzungen exemplarisch: Der Ausländerbeauftragte 2001 und das Modellprojekt "Transfer Interkultureller Kompetenz (TiK)"; vgl. www.Tik-iaf-berlin.de). Antidiskriminierungsarbeit ist in Deutschland im Gegensatz zu z.B. den Niederlanden, Großbritannien oder Schweden wenig etabliert. Aus Vorläuferinitiativen Ende der achtziger und im Verlaufe der 90er Jahre entstanden, besteht sie bis heute nur aus vereinzelten Initiativen und Anlaufstellen für von Diskriminierung Betroffene. Ohne dass endgültige Aufgabenbeschreibungen, Arbeitsprinzipien und Standards bereits existierten, zählt sie zu ihren Aufgabengebieten vor allem die Einzelfallberatung der von Diskriminierung Betroffenen, präventive Maßnahmen mittels Informations- und Sensibilisierungskampagnen, das Arrangement von interkulturellen Begegnungen, das Angebot von interkulturellen und antirassistischen Trainings etc. sowie die Einflussnahme auf politische Rahmenbedingungen durch die Beratung von Politik, Verwaltung, Institutionen und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen (vgl. Clayton/Wehrhöfer 2001). Handlungsfelder lassen sich vor allem in vier sich überschneidenden Bereichen ausmachen: Zum ersten strebt Antidiskriminierungsarbeit eine rechtliche Gleichbehandlung zur Fortentwicklung der Demokratisierung der Gesellschaft an. Sie kann sich dabei neuerdings einerseits auf die Richtlinienpolitik der EU stützen, mit der Art. 13 des Amsterdamer Vertrages von 1997 umgesetzt wird (vgl. näher Fn. 2), und sie kann andererseits die Umsetzung dieser Richtlinien in nationales Recht bis spätestens Ende 2003 erwarten. Angestrebt werden von ihr aber auch eine Revision des Staatsangehörigkeitsgesetzes, die Ausweitung von Minderheiten- und Bürgerrechten sowie Liberalisierungen in den Bereichen asylrechtlicher, ausländerrechtlicher und zuwanderungsrechtlicher Regelungen. Nicht zuletzt erhofft man sich von einem deutschen Antidiskriminierungsgesetz gesetzliche Grundlagen für die systematische und flächendeckende Einrichtung von Stellen für Gleichbehandlungsbeauftragte bzw. Ombudsfunktionen sowie von 172 Antidiskriminierungsbüros, auch wenn ein erster Entwurf der Bundesregierung dazu vom Dezember 2001 dies (noch?) nicht vorsieht. Zum zweiten werden Verbesserungen im Bereich von Bildung und Ausbildung angezielt. Sie sollen bewirken, dass die Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen des allgemeinen und des beruflichen (Aus-)Bildungssystems verringert und abgebaut werden. Verwiesen wird auf ungleiche Chancenstrukturen, die z.B. dazu führen, dass etwa doppelt so viele ausländische SchulabgängerInnen wie deutsche SchulabgängerInnen die Schule ohne Abschluss verlassen, dass die Beteiligung ausländischer Jugendlicher an der Berufsausbildung um etwa 25% unter der der deutschen liegt und MigrantInnen in Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung unterrepräsentiert sind (Ansätze finden sich z.B. in der Verabschiedung von schulischen Antidiskriminierungscodes nach niederländischem Vorbild; vgl. Nowitzki 2000). Zum dritten werden beschäftigungsorientierte Maßnahmen propagiert, die die Situation von MigrantInnen in Arbeit und Beruf sichern sollen. Dazu gehören insbesondere Erweiterungen der Zugangschancen zum Arbeitsmarkt, Abbau von Diskriminierungen am Arbeitsplatz, eine Ausweitung der Partizipation von Beschäftigten und der Abbau der überproportionalen Betroffenheit ausländischer ArbeitnehmerInnen von Arbeitslosigkeit überhaupt und von Langzeitarbeitslosigkeit im besonderen. Eine zunächst europaweite Einführung von Mindestnormen soll Konkurrenzdruck und der Gefahr einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen vorbeugen bzw. entgegenwirken. Zum vierten sollen Maßnahmen ergriffen werden, die das multikulturelle Zusammenleben im Alltag unterstützen. Migrations- und Einwanderungspolitik soll gleichsam auf kommunale Ebene heruntergebrochen werden. Dazu gehört, stadtplanerische Vorhaben auf die Erfordernisse einer multikulturellen Gesellschaft einzustellen, Zugänge von Nichtdeutschen zum Wohnungsmarkt zu verbreitern, die Gettoisierung von Wohnvierteln zu vermeiden, interkulturelle Ansätze der Sozialen Arbeit, besonders auch in der Kinder- und Jugendarbeit zu stärken, Beratungsmöglichkeiten vorzuhalten, Teilhabemöglichkeiten für Minderheiten an der Gestaltung von Rahmenbedingungen des Alltagslebens wie am Prozess der politischen Entscheidungsfindung zu vergrößern und individuell oder institutionell diskriminierende Behandlungen in Behörden abzubauen. Umsetzungsversuche werden über kommunale Antidiskriminierungscodes angestrebt (vgl. Nowitzki 2000). Sie liegen ferner auch in Ansätzen der Qualifizierung von VerwaltungsmitarbeiterInnen wie bei den jüngst insgesamt positiv evaluierten "Trainings für Toleranz und Weltoffenheit", die in Zusammenarbeit der LAG für politische und kulturelle Bildung in Brandenburg e.V. und IDA mit u.a. Behördenvertretern in Brandenburg durchgeführt und ausgewertet wurden, vor (nähere Informationen bei IDA). Modellhaft sind auch die in Berlin, Frankfurt und im Land Brandenburg durchgeführten Trainings mit Polizeibeamten. Im Rahmen des seit 1996/97 durchgeführten NAPAP-Projektes mit neuen beteiligten Ländern werden hier in Kooperation von Polizei, Bund gegen ethnische Diskriminierung in Deutschland e.V., der Trainingsoffensive e.V. und der Ausländerbeauftragten mehrtägige Trainings in der Aus- und Fortbildung von PolizistInnen durchgeführt und erfreulicherweise auch evaluiert (vgl. Bund gegen ethnische Diskriminierung 2002; Die Ausländerbeauftragte 2000; Kretschmer o.J.; Weiß 1999, 2001a, b). Die Auswertungen ergeben, dass die mit Elementen aus verschiedenen Bildungsprogrammen, u.a. "Betzavta", und aus Kompetenztrainings operierenden, vor allem auf eine Erweiterung der Fähigkeiten zu Selbstreflexion, Perspektivenwechsel, Empathie und interkultureller Kommunikationsfähigkeit zielenden Trainings notwendig sind, auch wenn sie, vor allem anfänglich, von großen Teilen der in der Ausbildung zu ihnen verpflichteten Teilnehmerschaft skeptisch bis ablehnend betrachtet werden und man sogar eine implizite Stigmatisierung von Polizeikräften als pauschal ausländerfeindlich allein in ihrer Existenz erblickt. Die Evaluation bleibt zwar – eingestandenermaßen – recht oberflächlich, und lässt "kein einheitliches Bild der Wirkung auf die Schüler (gemeint sind PolizeischülerInnen; d. Verf.) gewinnen" (z.B. Weiß 2001a, 13), aber doch immerhin erkennen, dass die angezielten 173 Qualifizierungen unumgänglich sind, intensiviert und verbreitert werden müssen und auch der gewählte Ansatz prinzipiell gewinnbringend und (z.B. in Hinsicht auf eine von den TeilnehmerInnen gewünschte größere Praxisrelevanz für den Polizeiberuf) weiter entwicklungsfähig ist. Abgesehen von den Anstrengungen der Grund- und WeiterQualifizierung von Verwaltungs- und Polizeibeamten: Zur Durchsetzung der Gesamtaufgaben in voller Breite wird die Herstellung und Stabilisierung zivilgesellschaftlicher Strukturen von bürgerschaftlichem Engagement und die Stärkung der demokratischen Öffentlichkeit für erforderlich gehalten, die ein Klima von Toleranz und gegenseitiger Akzeptanz sicherstellen sollen. Gesetzt wird auf Kampagnen zur Verbreitung eines öffentlichen Bewusstseins der Nichtdiskriminierung, Sensibilisierung für Diskriminierung, entsprechende Selbstverpflichtungserklärungen von Politik und Betrieben und Anerkennung von kultureller Pluralität (vgl. Netz gegen Rassismus, für gleiche Rechte 2000). Neben Vereinbarungen zum Abbau und zur Vorbeugung von Diskriminierungen in Arbeit und Beruf, insbesondere der Verabschiedung und Einhaltung von entsprechenden innerbetrieblichen Gleichbehandlungsgrundsätzen, wird Antidiskriminierungsarbeit gegenwärtig in professionalisierter Form in erster Linie von Projekten der Antidiskriminierungsarbeit getragen wie sie sich am fortgeschrittensten in Deutschland z.Zt. in den Antidiskriminierungsstellen bzw. Antidiskriminierungsbüros manifestieren. Bundesweit existieren allerdings - aufgrund des schon erwähnten Fehlens von gesetzlichen Regelungen – nur wenige dieser Stellen. Am weitesten entwickelt ist das Arbeitsfeld in NRW wo sich z.Zt. zehn Anlaufstellen mit Beratung und drei andere Antidiskriminierungseinrichtungen bzw. –initiativen in einem "Netzwerk für Chancengleichheit, gegen Diskriminierung ethnischer Minderheiten" zusammengeschlossen haben. Hier liegen auch bereits erste Evaluationen der Arbeit vor. Eine Untersuchung des Landeszentrums für Zuwanderung (vgl. Clayton/Wehrhöfer 2001) untersuchte neun Einzelprojekte, die im Rahmen der landeseigenen "Maßnahmen gegen Diskriminierung und zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus" von 1997-1999 mit rd. 700.000 DM p.a. modellartig gefördert wurden (und zum Teil heute wie einige andere kleinere Projekte der Antidiskriminierungsarbeit über das Förderprogramm "Maßnahmen und Initiativen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung sowie zur friedlichen Konfliktregelung in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf" weiterhin seitens des Landes gefördert werden). Ziele der Antidiskriminierungsprojekte waren und sind einerseits die Durchführung von Analysen zu Erscheinungsformen und Ursachen von Diskriminierung, andererseits und im Schwerpunkt aktive Maßnahmen der Beratung und Prävention. Die zentralen Evaluationsergebnisse laufen darauf hinaus, "die öffentliche Förderung von Antidiskriminierungsarbeit nachdrücklich zu befürworten" (ebd., 74). Dabei werden spezialisierte Antidiskriminierungsstellen auch deshalb als sinnvoll angesehen, weil sie "ein anderes Klientel (erreichen) als die bisherigen Migrationsfachdienste" (ebd., 63). Im einzelnen wird u.a. festgestellt: Die (allerdings nicht repräsentative) Auswertung von 215 gemeldeten und Diskriminierungsfällen ergibt, dass "in den weitaus meisten Fällen ... nicht Einzelpersonen als Verursacher von Diskriminierung, sondern öffentliche (41,4 Prozent) und private Institutionen (23,3 Prozent) verantwortlich gemacht" (ebd., 43) werden. 14 Nur in 29% der 14 Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Unter "Diskriminierung" wird von den Evaluatorinnen in Übereinstimmung mit der europäischen Rechtsprechung "die Anwendung unterschiedlicher Regeln auf vergleichbare Situationen" bzw. die "Anwendung derselben Regel auf unterschiedliche Situationen" verstanden. Neben der "unmittelbaren Diskriminierung", die vorliegt, "wenn eine Person aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere erfährt, erfahren hat oder erfahren würde" (Richtlinie 2000/43/EG) wird auch die "mittelbare Diskriminierung" einbezogen, die dann gegeben ist, "wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer Rasse oder ethnischen Gruppe angehören, in 174 Fälle wurden Einzelpersonen beschuldigt; die meisten Diskriminierungsfälle wurden im Bereich von Behörden verzeichnet. Am häufigsten werden "Herkunft" und "Staatsangehörigkeit" als Diskriminierungsgründe genannt. Der Befund macht deutlich, wie wichtig die Falldokumentation ist, um die Weiterentwicklung der Arbeit voranzutreiben. Nach niederländischen Erfahrungen ist erwartbar, dass solche Dokumentationen auch ausweisen werden, dass die Zahl der erfassten Fälle in dem Maße steigt, wie Antidiskriminierungsstellen etabliert und in der Öffentlichkeit bekannt gemacht sind. Die z.Zt. erfassten Fälle werden daher als "Spitze eines Eisbergs" (ebd., 68) gesehen. Auswertungen zur Beratungspraxis weisen aus, dass die Bearbeitungen von Einzelfällen einerseits eine "relativ hohe Zahl von 'ungelösten' Fälle(n)" aufweisen. Dies kann damit erklärt werden, dass gesetzliche Grundlagen fehlen, die den BeraterInnen gegenüber Behörden und beschuldigten Einzelpersonen den Rücken stärken könnten, die Arbeit selbst relativ neu ist, Ausbildungsangebote und Qualifikations- wie Qualitätskriterien fehlen und auch nicht – wie etwa in Belgien – die Drohung mit einem Gerichtsverfahren den Beschuldigten in eine Mediation drängen kann. Andererseits wird vermutet, dass Ratsuchende nicht unbedingt das Anliegen haben, eine Unterstützung zu erhalten, die über ein Gespräch mit der Fachkraft hinausgeht. Nicht alle wollen weitergehende Schritte tätigen. Möglicherweise ist die Eröffnung eigener Handlungsräume durch das Gespräch wichtiger als die Einleitung konkreter Maßnahmen durch die Fachkraft. Für den Bereich der präventiven Maßnahmen wird konstatiert, dass sich hier die "Zielerreichung" "nur schwer überprüfen" (ebd., 56) und sich die "Effektivität solcher Aktivitäten" "nicht ohne weiteres messen" (ebd., 70) lässt: "Die Erwartungen... sind hoch, ihnen sind aber in ihrem Wirkungsgrad Grenzen gesetzt ... Oft fehlt eine klare Vorstellung davon, wie genau die durchgeführten Maßnahmen zum Abbau bzw. zur Vorbeugung antirassistischer Diskriminierung (gemeint ist offenbar: rassistischer; K.M.) beitragen sollen. Einmal durchgeführt, werden die einzelnen Aktivitäten selten systematisch auf ihre Wirksamkeit hin ausgewertet. Die oft beabsichtigten Einstellungs- und Verhaltensänderungen können kaum durch punktuelle pädagogische und psychosoziale Maßnahmen erreicht werden" (ebd., 57). In dieselbe Richtung verweist die Evaluation hinsichtlich des Stellenwerts von interkulturellen Begegnungen: "Letztlich bleibt es unklar, wie diese Maßnahmen im Sinne des Abbaus von Vorurteilen wirken. Die Wirkungsforschung zeigt hier noch deutliche Forschungslücken, die ausgefüllt werden müssen (vgl. Jonas 1998: 151). Darüber hinaus ist auch der Transfer von entsprechenden Forschungsergebnissen in die Praxis bislang unzureichend" (ebd., 59). Dagegen gewinne "der Aspekt der Qualitätssicherung und der Wirksamkeit an Bedeutung": "Eine systematische Auswertung solcher Maßnahmen könnte hier zu ihrer Optimierung beitragen" (ebd., 70). Die Qualifizierung von Antidiskriminierungsfachkräften wird als verbesserungsbedürftig betrachtet. Und weil gilt: "Eine konzeptionelle Basis der Arbeit der Antidiskriminierungsprojekte ist nicht erkennbar, wird aber als notwendig für die Wirksamkeit der Aktivitäten erachtet" (ebd., 61), wird eine "klare und verbindliche konzeptionelle Grundlage" zu entwickeln gefordert sowie die Vernetzung mit ähnlichen Einrichtungen und die Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Behörden usw. propagiert, besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt, und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich" (ebd.). Zurecht wird nicht nur in diesem Kontext, sondern auch darüber hinaus in der deutschen Fachdiskussion darauf hingewiesen, dass der Begriff der "Rasse" in den europäischen Texten für den deutschen Diskurszusammenhang irreführend ist und statt "Diskriminierung aufgrund von Rasse" o.ä. eher von "rassistischer Diskriminierung" gesprochen werden sollte, weil das Adjktiv sich auf das Substantiv "Rassismus" beziehen lässt, und damit einen Begriff zum Referenzpunkt macht, der gerade die Unhaltbarkeit des sog. "Rasse"-Begriffs thematisiert. 175 um auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Antidiskriminierungsarbeit, auch gerade im lokalen Raum, Einfluss nehmen zu können. Auf der Grundlage dieses in seinem Umfang bundesweit einmaligen Evaluationsprojektes von Antidiskriminierungsarbeit haben die nordrhein-westfälischen Antidiskriminierungsprojekte ein Konzept zur Struktur der Antidiskriminierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen vorgelegt, das Modellcharakter auch für andere Bundesländer beanspruchen kann und im Rahmen der Diskussion um ein deutsches Antidiskriminierungsgesetz und die möglicherweise darin aufzunehmenden Regelungen zur flächendeckenden Errichtung von Antidiskriminierungsstellen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Konzept sieht eine regionale Verteilung von Antidiskriminierungsstellen für einen Umkreis von etwa 100 km (dies sind für NRW bspw. acht Büros) mit jeweils zwei dezentralen Zweigstellen und einer zentralen Koordinations- und Vernetzungsstelle vor. Die drei zentralen Arbeitsbereiche werden mit Beratungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit/Antidiskriminierungstraining und Vernetzungsarbeit umschrieben. Die Kosten werden mit ca. 2,3 Mio. DM p.a. berechnet (vgl. Diskriminierung 2000) Der sowohl in der Evaluation des Landeszentrums für Zuwanderung als auch in diesem Konzept betonte Gedanke der Vernetzungsarbeit kann sich auf eine vom Verband der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit (neu: Verband für interkulturelle Arbeit) (VIA e.V.) vom 01.12.2000 bis 30.11. 2001 durchgeführte, EU-finanzierte Studie stützen, die die Bedeutung horizontaler Vernetzung regionaler Beobachtungsstellen gegen Diskriminierung evaluierte, ihren hohen Stellenwert feststellt und insbesondere die Möglichkeit der Etablierung von Qualitätsstandards und von eigenständigen Profilen dieser Stellen auf diesem Wege betont (vgl. VIA 2002). Antidiskriminierungsarbeit in spezialisierten Stellen anzusiedeln und nicht den Migrationsfachdiensten zuzuordnen, erscheint sinnvoll, wenn man erste, allerdings noch sehr tentative und nicht repräsentative Studien zu deren Umgang mit Diskriminierungserfahrungen ihres Klientels zugrundelegt. Nach der vom Landeszentrum für Zuwanderung bei 20 Einrichtungen vorgenommenen Befragung der Sozialberatung für MigrantInnen (vgl. Bach/Clayton/Tunc 2000) zeichnet sich ab, dass diese generell wenig offensiv mit den ihnen zugetragenen Diskriminierungstatbeständen umgehen, vor allem dann, wenn die Beratungen nicht bei freien Trägern angesiedelt sind, sondern in kommunale Verwaltungsstrukturen eingebunden sind; ein Befund, der wenig verwundert, wenn man feststellt (s.o.), dass die meisten Diskriminierungen in Behörden erlebt werden. Außerdem erfassen sie diese nicht systematisch und formulieren auch "keine adäquaten Mindestanforderungen bzw. Qualitätskriterien" (ebd., 12). Ähnliche Ergebnisse erbringt eine bei 18 Bielefelder Beratungseinrichtungen durchgeführte fragebogengestützte Exploration (vgl. Mecheril u.a. 2001). Man muss bei zwei Dritteln von ihnen eine "konzeptuelle Abstinenz" (ebd., 300) registrieren und stellt "eine geringe Bedeutung" des Themas "Diskriminierung" fest. Erfahrungen werden danach eher auf dem Hintergrund des Theorems "kultureller Differenz" gedeutet als mit realer sozialer Ungleichheit in Verbindung gebracht. Dominanzsensibilität wird vermisst. Allerdings gehen die Wohlfahrtsverbände neuerdings in die Offensive. So hat der Deutsche Caritas Verband (DCV) mit immerhin 1.200 MitarbeiterInnen in der Migrationsarbeit im Herbst 2001 ein bis zum 15.11.2002 laufendes Projekt aufgelegt, in dem ein externes Institut unter dem Arbeitstitel "Blick nach innen" eine Ist-Analyse über den verbandsinternen Umgang mit Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskriminierung anstellen soll, um "Strategien zur Überwindung von betriebsinternen Ausgrenzungen" und "Qualitätsmerkmale für die interne Organisationsentwicklung... im Hinblick auf Antidiskriminierungsstrategien zu entwickeln" sowie damit die Installation (einer) verbandseigenen/r 176 Antidiskriminierungsstelle(n), Antidiskriminierungsbeauftragten und/oder Antidiskriminierungshotline voranzutreiben (vgl. Deutscher Caritasverband o.O. o.J.). Darüber hinaus wird an vier lokalen Standorten der Migrationsarbeit des Verbandes (Vechta, Brandenburg, Saarlouis und Görlitz) ab Herbst 2001 bis 30.09.2004 das Projekt "Caritas – Offener Umgang mit Fremden, Gleichstellung und Partizipation in der Arbeitswelt" durchgeführt. Drei wesentliche Ziele sind die Ansprache von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die "anfällig für fremdenfeindliches Gedankengut sind oder bereits der rechten Szene angehören", das Angebot von MultiplikatorInnenschulungen (Antirassismus-, Deeskalations- und Zivilcouragetrainings, Konfliktmanagement, gender training, interkulturelle Sensibilisierung) und die Verabschiedung von Selbstverpflichtungscodes und Betriebsvereinbarungen innerhalb der Caritasverbände (vgl. Das Projekt o.O. o.J.). Der Kölner Diözesanverband führt seit 2001 ein längerfristiges, fünfphasiges "Projekt Antidiskriminierungsarbeit" durch, dessen Phase 1 (Bestandsaufnahme entsprechender Aktivitäten des Verbandes) abgeschlossen ist und dessen zweite Phase noch andauert (bis September 2002). Nach der Bestandsaufnahme der typischen AntidiskriminierungsMaßnahmen der Caritas-Migrationsdienste ergeben sich 135 Maßnahmen, von denen allerdings nur 77 eindeutig AD-relevant waren und mehr als die Hälfte in den Bereichen der Information und der Begegnung angesiedelt sind. Öffentliches Eintreten gegen Diskriminierung (9 Maßnahmen), Erfassen von Diskriminierungsfällen (6) und Intervenieren bei Diskriminierungsfällen (4) machen allerdings gerade einmal 15% der Aktivitäten aus. So bleibt der eingeschränkte Antidiskriminierungsbegriff zweifelhaft, auf dem die Einschätzung fußt, dass innerhalb der Caritas-Sozialdienste bereits "Beachtliches an Antidiskriminierungsarbeit geleistet" würde und nur "die Verankerung von Antidiskriminierungsarbeit im Bewusstsein und Selbstverständnis der Migrationsdienste und ihrer MitarbeiterInnen" "noch steigerungsfähig" sei (vgl. Migrationsarbeit 2001).15 3.2 Fazit Eine zusammenfassende Sicht auf die – wie im einzelnen herausgearbeitet – durchaus heterogene 'Landschaft' pädagogisch bzw. sozialarbeiterisch akzentuierter konzeptioneller Ansätze der Rechtsextremismus-, Fremdenfeindlichkeits- und Gewaltbekämpfung in Deutschland, lässt sich wohl am ehesten dann gewinnen, wenn nach einer Einschätzung der Quantität solcher Herangehensweisen in einem ersten Schritt in einem zweiten Schritt über die einzelnen Ansätze hinweg ihre Gesamt-Qualität zu klären gesucht wird. Dabei erscheint es angezeigt, die Analyse an drei Prüfkriterien auszurichten: Zum ersten ist die sozialwissenschaftliche Referenz entsprechender Pädagogik und Sozialer Arbeit dahingehend zu klären, inwieweit sie auf theoretische Erkenntnisse und empirische Befunde der thematisch einschlägigen Forschung Bezug nimmt und wichtige Konzeptionsbestandteile wie Ziele, Inhalte und Methoden daran orientiert. Zum zweiten ist dasjenige zu bündeln, was sich an Bezugnahmen auf die allgemeinen diskursiven und operativen Rahmungen, welche die Fachdebatte der Leitdisziplinen von Erziehungswissenschaft und Sozialarbeitswissenschaft auch außerhalb der themenspezifischen Diskussion entwickelt, in paradigmatischen Grundlegungen, strategischen Zielsetzungen und Formatierungen findet und in konzeptionellen Ausarbeitungen bzw. Praxen niederschlägt. Zum dritten ist im Hinblick sowohl auf themenspezifische Studien als auch auf allgemeinere disziplinäre Debatten zu 15 In der "Arbeitshilfe" zu Phase 2 (Seite 3) findet sich im Abschnitt über die Zielbestimmung sogar die Formulierung: "Es soll den MitarbeiterInnen deutlich werden, dass bereits in der Vergangenheit quantitativ und qualitativ Wertvolles an Diskrimnierungsarbeit geleistet wurde – lediglich nicht unter diesem Label. (Die Inhalte sind heute unter dem Etikett Antidiskriminierungsarbeit gefragt und förderfähig. Deshalb sollte der Begriff zum alltäglichen Handwerkszeug werden, die Inhalte des Begriffs als Antidiskriminierungsarbeit 'verkauft' werden.)". 177 bilanzieren, wie weit Evaluationen, Evaluationsplanungen oder zumindest Bedarfe danach vorliegen. In einem abschließenden dritten Schritt sind dann kurz die zu ziehenden Konsequenzen und weitere Perspektiven zu bündeln. Quantitativ betrachtet ergibt unsere Analyse eine auf den ersten Blick erfreuliche Vielfalt an konzeptionellen Herangehensweisen. In ihnen schlägt sich eine Fülle an durchaus verschiedenen Ausgangspunkten und Ideen nieder. Nachdem bis weit in die 90er Jahre hinein der pädagogische und sozialarbeiterische Umgang mit Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und der in diesem Umfeld auftauchenden Gewalt vorwiegend spezialisierten Segmenten bestimmter Arbeitsfelder (vor allem z.B. Maßnahmen der historischen Bildung über den Nationalsozialismus und – eher als Folge der Ineffektivität historisierender Aufarbeitungsversuche und/oder der Ausgrenzung Betroffener aufsuchenden Strategien im Rahmen von Jugendarbeit) zugewiesen wurde, wächst in den letzten Jahren in verschiedenen pädagogischen und sozialarbeiterischen Handlungsfeldern die Bereitschaft, über Strategien des Umgangs mit der Problematik innerhalb des eigenen Arbeitsgebietes nachzudenken und entsprechende Ansätze zu entwickeln. Ob man dafür eher ein Abgehen von der Zentrierung der fachöffentlichen Diskussion auf die Organisationen des rechtsextremen Spektrums und sich verbreiternde Erkenntnisse über den "Extremismus in der Mitte der Gesellschaft" verantwortlich macht, darin schlicht Umleitungseffekte einer zunehmend projektorientierten Förderpolitik ausmacht oder noch andere Gründe erkennt: Festzuhalten bleibt, dass nicht nur konkrete Maßnahmen und Projekte zahlreicher geworden sind, sondern sich auch die Breite konzeptioneller Herangehensweisen ausgedehnt hat. Die Problematik ist damit ein Thema geworden, an dem man in nahezu keinem Arbeitsfeld von berufsmäßiger Pädagogik und Sozialer Arbeit mehr vorbeikommt. Sicherlich wird der Anstieg der fachöffentlichen Aufmerksamkeit der gesellschaftlichen Bedeutung der im Hintergrund stehenden Desintegrations-/Integrationsdynamik besser gerecht als die lange betriebene Zuweisung der 'Arbeit gegen rechts' und gegen Gewalt zu den Sphären von Strafverfolgung und Politik, allenfalls noch ihre Gettoisierung in eher marginalen Sektoren der Profession (Soziale Arbeit mit rechtsextremen Jugendlichen). Er reflektiert – bewusst oder unbewusst -, dass die in Rede stehenden Probleme Symptome für gesellschaftliche Krisen sind, die den Kernbestand der Demokratie betreffen. Die gegenwärtig zu konstatierende – wenn auch leider weiterhin deutlich medienkonjunkturabhängige - Breite des professionellen Engagements und die sich darin dokumentierende Bereitschaft der Professionellen und ihrer Institutionen, über die möglichen Ansatzpunkte einer Sicherung von Integrationspotenzialen und der Verhinderung von politischer und sozialer Desintegration im eigenen Arbeitsbereich nachzudenken, entspricht deshalb – grob betrachtet - der Dimension der Problematik. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass die vorhandenen Ansätze und konkreten Maßnahmen ausreichten. Mangelmeldungen sind auch schon unter rein quantitativen Gesichtspunkten angebracht. Wenn aber qualitative Aspekte noch hinzugezogen werden, kommt man nicht umhin, zu konstatieren, dass mindestens acht Handlungsfelder sich erheblich unterentwickelt darstellen.16 Teils handelt es sich dabei um einrichtungsbezogene Arbeitsfelder, teils um eher konzeptionell denn institutionell begründete Arbeitsgebiete: 1. Eltern- und Familienbildung Zahlreiche theoretische und empirische Studien zur Anfälligkeit für rechtsextreme Orientierungen, minderheitenfeindliche Einstellungen und Gewalt verweisen immer wieder auf die zentrale Bedeutung, die der Sozialisation und Erziehung in der Familie 16 Dass hier gerade auf acht Handlungsfelder eigegangen wird, heißt nicht, dass in anderen Feldern die Bedarfe als gedeckt anzusehen sind. Sie treten nur hier aus der Perspektive der vornstehenden Analysen besonders krass hervor. 178 zukommt (vgl. zusammenfassend: Möller 2000, 2001; Noack 2001; Boehnke/Baier 2001, bes. 66ff.). Bereits in der Kindheits- und Jugendphase werden offenbar die Fundamente gelegt, auf denen gewaltfreies Handeln und Wertschätzung demokratischer Verfahren des Interessenausgleichs aufbauen können. Umgekehrt sind hier auch bereits Gefährdungskonstellationen zu registrieren, die dem Aufbau von Affinitäten zu Ungleichheitsvorstellungen und Gewaltakzeptanz Vorschub leisten bzw. ihren Abbau erschweren oder gar verunmöglichen. Deshalb ist neben politischen Unterstützungen für Familien und familienähnliche private Lebensformen die Qualifizierung von Eltern für ihre Erziehungsarbeit von herausgehobener Bedeutung. Realiter ist hier allerdings eine weit aufklaffende konzeptionelle Lücke unübersehbar. Es fehlt nicht nur an Maßnahmeangeboten. Vor allem bleibt die Frage unbeantwortet, wie Erwachsenenbildung an diejenigen Teilnehmergruppierungen herankommt, von denen man gemeinhin meint, "dass sie es besonders nötig haben". Obwohl man ihn seit Jahrzehnten registriert und beklagt, ist der Mittelschichtsbias, der die einschlägigen Institutionen kennzeichnet, bislang kaum abgebaut worden. Abhilfe wird hier nur zu gewinnen sein, wenn Angebote strikt lebensweltorientiert an TeilnehmerInneninteressen und -bedarfe ansetzen. Um solche, auf dem Papier weit verbreiteten Postulate real umzusetzen, bedarf es vor allem neuer Zugangsweisen. Sie sind nicht ohne die starke Orientierung an den Themen und Problemen des Gemeinwesens und ohne mobile Ansätze zu erschließen. 2. Soziale und pädagogische Arbeit mit Kindern Auch wenn Jugendliche jene gesellschaftliche Gruppierung bilden, deren Angehörige besonders deutlich als Gewaltakteure und als Träger von aggressiv getönten Ungleichheitsvorstellungen in Erscheinung treten: Es liegen ernstzunehmende theoretische und empirische Hinweise darauf vor, dass Formen von Gewaltakzeptanz generell und Dispositionen zu Ausgrenzungshaltungen gegenüber Minderheiten im speziellen in Sozialisationserfahrungen wurzeln, die bereits in der Kindheitsphase gemacht werden (vgl. z.B. Noack 2001). Demographischen Entwicklungen geschuldet, zählen Kindergärten, Kindertagesstätten und Horte zu den multikulturellsten Einrichtungen des gesellschaftlichen Bildungs- und Betreuungssystems für die junge Generation. Als illusionär erweist sich die Ansicht, durch lebensgeschichtlich möglichst frühzeitigen, bloßen interethnischen Kontakt ließen sich ethnisch-kulturelle Konfliktlagen reduzieren. Eher scheinen sie sich insgesamt betrachtet lebensbiographisch 'nach vorn' zu verlagern, zumal davon auszugehen ist, dass erwachsene Betreuungspersonen ihre eigenen, mangels auf sie abgestimmter Angebote großenteils unreflektiert bleibenden Deutungen und Haltungen bewusst und unbewusst auf Kinder sozialisatorisch übertragen. Einer themenspezifischen Arbeit mit Kindern kommt neben Angeboten der ErzieherInnen- und Elternbildung daher innerhalb und außerhalb von Einrichtungen eine hohe Bedeutung zu. Dies gilt um so mehr, als davon auszugehen ist, dass die Erfolgsaussichten pädagogischer und sozialarbeiterischer Prävention mit der Frühzeitigkeit ihres Einsetzens steigen. Im Vergleich zur Relevanz der in diesem Bereich liegenden Arbeitsfelder nimmt sich die Anzahl und Intensität entsprechender Aktivitäten und Konzepte viel zu bescheiden aus. So wie der Gewalt- und RechtsextremismusDiskurs aus der Verengung auf eine Jugend-Debatte zu lösen ist, um Sensibilisierungen für die Anfälligkeiten von Erwachsenen und für die Notwendigkeiten von adäquat adressatenbezogenen Gegenmaßnahmen der Erwachsenenbildung zu erzielen, so ist er auch unumgänglich um die Perspektive auf Kinderproblematiken und auf entsprechende pädagogische und sozialarbeiterische Ansätze zu erweitern. 3. MultiplikatorInnenbildung 179 An Fortund Weiterbildungsangeboten zum Themenbereich Rechtsextremismus/Fremdenfeindlichkeit/Gewalt für professionelle PädagogInnen und SozialarbeiterInnen herrscht gegenwärtig von der Anzahl her kaum noch Mangel. Inhaltlich wird freilich oft – wie dies auch in manchen der o.e. Befragungen von TeilnehmerInnen entsprechender Angebote deutlich wird – ein mangelnder Praxisbezug beklagt. Daneben muss vor allem aber festgestellt werden, dass themenspezifische Weiterbildungsveranstaltungen für nicht-pädagogisches Personal bzw. für Ehrenamtliche fehlen. Zu denken ist hier insbesondere an VerwaltungsmitarbeiterInnen und PolizistInnen, aber auch an ÜbungsleiterInnen und FunktionärInnen in Vereinen und Sportclubs. Wünschenswert wäre, dass angesichts des großen Integrationspotenzials, das gerade bei letztgenannten schlummert, aber auch wegen der zunehmend an die Oberfläche tretenden Problematiken um Gewalt und ethnisch-kulturelle Konflikte (vgl. vor allem Kap. 3.1.8) diese Lücken geschlossen würden. Dazu bedürfte es ebenfalls einer deutlichen Ausweitung von gemeinwesenorientierten Perspektiven und aufsuchenden Strategien der Anbietereinrichtungen. 4. Beratung kommunaler Akteure, zivilgesellschaftlicher Vereinigungen und pädagogischer/sozialarbeiterischer Einrichtungen Wie die Nachfrage nach Mobilen Beratungsteams in den neuen Ländern, aber auch diejenige nach dem "Team Z" in Baden-Württemberg deutlich macht, ist eine Unterstützung kommunaler Akteure, zivilgesellschaftlicher Vereinigungen und Angehöriger pädagogischer und sozialarbeiterischer Einrichtungen, die nicht auf die 'Arbeit mit Rechten' oder die Abarbeitung ethnisch-kultureller Konfliktlagen spezialisiert sind, dringend geboten. Was vor allem gebraucht wird, ist eine Vor-Ort-Beratung, die auf konkrete Situationen, ihre Bedarfe und ihre Problemlagen bezogen sein kann und darauf zielt, Plattformen der Information, Kommunikation und Kooperation zu entwickeln und zu stabilisieren, auf denen die lokalen Akteure vernetzt tätig werden können. Da unter Hinweis auf die Nachfragesituation im Lande Baden-Württemberg und die – leider unbefriedigt gebliebenen Bedarfe bei nordrhein-westfälischen 1-DM-pro-EinwohnerInProgramm, hier vor allem aus kleineren Kommunen - davon auszugehen ist, dass die sich in den neuen Ländern zeigenden Beratungsbedarfe nicht nur für Ostdeutschland typisch sind, müssen auch in den westlichen Bundesländern entsprechende Beratungsangebote in den Regionen vorgehalten werden. Im Hinblick auf pädagogische Institutionen wäre es wünschenswert, wenn Lehrer und Lehrerinnen wüssten und sicher sein könnten, präventiv, vor allem aber auch im konkreten Konfliktfall Hilfe bei in ausreichender Zahl verfügbaren SchulpsychologInnen und speziell zuständigen und ausgebildeten Kollegen und Kolleginnen erhalten zu können. Entsprechende Stellen wären zu schaffen bzw. vorhandene Ressourcen inhaltlich zu qualifizieren und auszubauen. Die Kooperation mit sozialpädagogischer Kompetenz ist dabei geradezu unvermeidlich. 5. Erweiterung des Verständnisses von schulischem Lernen Noch (viel zu) selten, sind innerhalb von Schule pädagogische Selbstverständnisse verbreitet, die die eigene Einrichtung bzw. das eigene Arbeitsfeld nicht nur i.e.S. als wissensvermittelnde Lehranstalt bzw. als Medium des Qualifikationserwerbs für den Arbeitsmarkt begreifen. Die Konzentration auf Unterrichtungsformate wird den breiter ausgreifenden Herausforderungen, die heute an Schule herangetragen werden, nicht mehr gerecht. Sie sieht sich mit einem erweiterten Bildungs-, Erziehungs-, ja z.T. sogar Qualifizierungsauftrag für die Lebensgestaltung konfrontiert. Dass Konzepte des sozialen Lernens Eingang finden, Methoden von Mediation und gewaltfreier Konfliktregelung erprobt werden, Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe aufgenommen wird und schulumfassende Entwicklungsprogramme verfolgt werden, kann als Hinweis darauf 180 gewertet werden, dass die breitere Aufgabenstellung durchaus erkannt wird. Allerdings sind noch viel zu wenige Schulen entsprechend aktiv. Öffnungen von Schule zum Gemeinwesen erfolgen (zu) häufig nur aus Projektanlässen heraus und sind noch in (zu) seltenen Fällen Standard der Alltagsarbeit. Insbesondere fehlt es gegenwärtig deutlich an außerunterrichtlichen Aktivitäten (Sport, Jugendkultur, Musik etc.). Dabei gelingt es oft gerade über sie, Schule als einen für Jugendliche lebenswerten Lebensbereich erscheinen zu lassen, wo Selbstwertressourcen auch jenseits der zentralen und notenbewerteten Leistungsbereiche anzuzapfen sind. Erfahrungsgemäß (vgl. Möller 2000a, 2001a) können derartige Stabilisierungen des Selbstwerterlebens und der Identitätssuche Distanzierungen von Gewalt und rechtsextremen Orientierungen entscheidend stützen bzw. diesen von vornherein vorbeugen. Solange Anerkennungen nur in den klassischen Fächerzuordnungen entsprechenden Leistungsbereichen erwerbbar sind, sind im Falle ihres Zerfalls (dauerhaft schlechte Noten, Sitzenbleiben, Zwang zum Schulabgang) keine Bezüge für anderweitigen innerschulischen Anerkennungserwerb mehr vorhanden. Damit werden Belastungen der Frustrationstoleranz von Schülern und Schülerinnen heraufbeschworen, die bei zunehmendem gesamtgesellschaftlichen Leistungsdruck – und zwar im Sinne des Zwanges, die eigene Integration in gesellschaftliche 'Normalität' über die Dokumentation von individuell benoteter Leistung und zertifizierter Leistungsfähigkeit zu zeigen – immer schwerer individuell zu tragen sind. Stellt man nun aber das Anwachsen der Wahrscheinlichkeit von Vereinzelungstendenzen und eine geringe Rissfestigkeit von sozialen Netzen in der sich individualisierenden Gesellschaft in Rechnung, so werden in zunehmendem Maße aggressive Entladungen des aufgestauten Drucks denkbar; dies zumindest soweit sie nicht anderweitig verhindert oder aufgefangen werden. Auch in dieser Hinsicht muss sozialpädagogische Kompetenz in die Schule geholt werden, sowohl durch den 'Import' entsprechender Fachkräfte mittels Sozialarbeit, als auch durch eine Beseitigung der eklatanten und den heutigen Voraussetzungen des Lehrberufs nicht mehr gerecht werdenden Vernachlässigung sozialpädagogischer Komponenten in der Lehrerausbildung. Schul- und hochschulpolitisch sind die für solche Umorientierungen des pädagogischen Verständnisses erforderlichen Rahmenbedingungen zu garantieren. 6. Gemeinwesenentwicklung Nicht nur für Schule, auch für andere soziale und pädagogische Einrichtungen gilt, dass die Orientierung am Gemeinwesen auszubauen ist. Diese Empfehlung ist Ausfluss der Erkenntnis, dass die Ursachen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt vielfältig sind und aus einem Geflecht von Bedingungsfaktoren bestehen. Der Forschungsstand belegt, dass es wenig Sinn macht, auf der Suche nach Verantwortlichen den Schwarzen Peter zwischen Familie, Schule, Arbeitsbereich, Medien, Politik u.a.m. hin und her zu schieben. Daraus aber folgt, dass erfolgversprechende Bearbeitungen der Problematiken nur durch konzertierte Aktionen der Akteure dieser Arenen zu bewerkstelligen sind. Deshalb ist in der Tat eine Vernetzung unerlässlich. Sie kann sich aber nicht nur darauf beschränken, Institutionen in Austausch zu bringen, Kooperationszusammenhänge zwischen ihren Angehörigen zu stiften und Aktivitäten inhaltlich und terminlich aufeinander abzustimmen. Sie sieht sich vor allem vor die Aufgabe gestellt, tragfähige Formen von sozialem Mit-, Neben- und notfalls auch Gegeneinander zu entwickeln. Je mehr individuelle Lebensbewältigung von Prozessen der Globalisierung, Differenzierung, Individualisierung und Pluralisierung geprägt wird und damit nicht mehr auf die Fungibilität der überkommenen Mechanismen und Formen sozialer (Ein-)Bindung vertrauen kann, um so deutlicher kristallisiert sich die Notwendigkeit heraus, zumindest dort, wo diese Prozesse mit subjektiv erlebten oder objektiv existierenden Verlusten an Orientierungs-, Urteils- und Handlungssicherheit 181 verbunden sind, auch professionell die Rekonstruktion und ggf. auch Konstruktion des Sozialen zu betreiben. Angesichts dessen, dass eine Menge von ethnisch-kulturellen Konflikten im unmittelbaren Lebens- und Wohnumfeld aufbricht und - unbearbeitet bleibend – Ungleichheitsvorstellungen und Gewaltakzeptanz Vorschub leistet (vgl. ebd.), kommt der Entdeckung und Entfaltung sozialer und kultureller Ressourcen im Stadtteil, Dorf bzw. Wohnviertel erhöhte Bedeutung für Gegensteuerungen zu. Noch viel zu selten reagieren Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften - meist begrenzt auf Neuaufsiedlungsgebiete – mit der Einrichtung und Förderung von Gemeinwesenentwicklungsprojekten. 7. Geschlechtsreflektierendes Arbeiten In Kap. 3.1.10 musste resümierend festgestellt werden, dass geschlechtsreflektierendes Arbeiten einerseits ein gänzlich unverzichtbares Konzept pädagogischer und sozialer Arbeit (im übrigen nicht nur) 'gegen rechts' und gegen Gewalt ist, es an praktischen Umsetzungen aber erheblich mangelt, insbesondere in der Arbeit mit Problemträgern. Diese Unterbelichtung zieht insbesondere in Kindergarten, Schule und Jugendhilfe, aber auch in der Familien- und Eltern- sowie sonstigen Erwachsenenbildung fatale Konsequenzen, nämlich ein Weiterbestehen, wenn nicht Verschärfungen der Problemlage, nach sich. Die Behebung dieser Defizite in der konzeptionellen Orientierung von pädagogischen und sozialen Einrichtungen ist nicht nur eine Frage der individuellen Interessen und der Aufmerksamkeitszuwendungen ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Vielmehr muss sie auch und in erster Linie als eine der institutionellen Ausrichtung und der Ausbildung sowie der Weiterqualifizierung der Professionellen betrachtet werden. In dieser Hinsicht ist im Interesse ursachenbezogener Strategien gegen Jungen- und Männergewalt und des erheblichen maskulinen Überhangs in rechtsextrem orientierten Szenen und Organisationen nicht weiter hinnehmbar, dass innerhalb der LehrerInnenausund -fortbildung geschlechtsreflektierendes Arbeiten innerhalb und außerhalb des Unterrichts im Gegensatz zu analogen Ansätzen der Mädchenbildung so gut wie gar nicht zum Thema gemacht wird. Vergleichbares gilt, wenn auch nicht in dieser Zuspitzung, für die Aus- und Weiterbildung von Erziehern und von Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Hier kommt noch stärker als bei etwa der Grundschullehrerausbildung hinzu, dass männliche Auszubildende im Erzieherberuf bzw. männliche Studierende in Studiengängen der Sozialen Arbeit ganz deutlich in der Minderheit sind (in Hinsicht auf Sozialwesen beträgt ihr Anteil etwa 25% der Studierenden), so dass rein quantitativ schon schlechte Voraussetzungen vorliegen. Geklärt werden muss, wie gleichstellungspolitisch eine Förderung von Männern für soziale Berufe umzusetzen ist. Spätestens im Zuge und bei Gelegenheit von gender mainstreaming müssen die Problem- und Bedarfslagen von Jungen und Männern auch in den Institutionen der Pädagogik und der Sozialen Arbeit stärker als bisher gängig Beachtung finden und geeigneten Bearbeitungen zugeführt werden. 8. Förderung der politischen Partizipation von Kindern und Jugendlichen Um antidemokratischen Orientierungen vorzubeugen und Verantwortungsgefühl und Gemeinsinn zu schulen, werden Maßnahmen und Projekte der Partizipationsförderung auch im Kontext der pädagogischen und sozialarbeiterischen Bearbeitung von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit unternommen. Hier zeigt sich zum einen, auch unabhängig von dem Interesse an Extremismus- und Gewaltprävention bzw. – reduktion, dass eine zufriedenstellende Systempartizipation auf Erfahrungen von Alltagspartizipation aufruhen muss, gerade auch schon bei Kindern und Jugendlichen. In dieser Hinsicht bleiben nicht nur viele mögliche Ansatzpunkte ungenutzt; zu denken ist bspw. an die (modifizierte Re-)Etablierung von Selbstverwaltungsstrukturen in 182 Jugendzentren, an Ausweitungen schulischer Mitbestimmung und an Chancen kommunalpolitischer Beteiligung. Es zeigt sich auch, dass ohne eine – freilich zurückhaltend operierende - (sozial)pädagogische Begleitung durch Fachkräfte, Minderjährige ihre Partizipationsanliegen nicht oder kaum durchzusetzen vermögen (vgl. Möller 1999b, 2000b). Es bestehen also hier große und bisher unbefriedigte Bedarfe an fachlicher Unterstützung und Begleitung. Fokussieren wir nun stärker auf die qualitativen Aspekte der gefundenen Konzepte und prüfen wir sie nunmehr in der Gesamtschau hinsichtlich ihrer Bezüge auf den Stand der themenspezifisch einschlägigen Forschung, auf die Fachdebatten der Leitdisziplin(en) und auf ihre Evaluation! Insgesamt lässt sich der Eindruck wohl kaum von der Hand weisen, dass die theoretischen Referenzen der Praxiskonzepte im allgemeinen eher wenig ausgearbeitet sind. Theorien über die Ursachen von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt werden offenbar noch am umfassendsten innerhalb der Begründungszusammenhänge von Historischer Bildung (hier insbesondere das Autoritarismus-Konzept und seine Weiterentwicklungen; vgl. zur Kritik noch einmal Kap. 3.1.1), aufsuchender Arbeit (hier vor allem individualisierungstheoretische Erkenntnisse), Anti-Gewalt-Programmen in Schulen (vor allem beim Olweus-Programm) und bei den – allerdings kaum existierenden – geschlechtsreflektierenden Ansätzen (Bezugnahme auf theoretische Überlegungen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation) zur Kenntnis genommen. Seminareinheiten zur Demokratie- und Toleranzerziehung weisen zwar auch theoretische Basierung auf. Diese ist allerdings – wie auch die auf eine demokratische Schulentwicklung abhebenden umfassenden Schulentwicklungskonzepte - stärker demokratietheoretisch grundiert. Konzepte des allgemeinen sozialen Lernens begründen sich eher mit lerntheoretischen einerseits und identitäts- und persönlichkeitstheoretischen Überlegungen andererseits, können aber die Kompatibilität der letztgenannten mit theoretischen Erkenntnissen der Forschungen zu Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Anschlag bringen und insoweit ihre Einsetzbarkeit zu Zwecken der Gewalt- und Ausgrenzungsreduktion und –prävention vorbringen. Besonders schwach fallen die theoretischen Bezüge zumeist bei erlebnisabenteuer- und sportpädagogischen Ansätzen, bei den kultur- und medienpädagogischen Konzepten sowie bei Kampagnen, Wettbewerben und Aktionen aus. Auch die anderen Konzepte sehen sich jedoch gezwungen, ihren jeweiligen Ansatz zu großen Teilen über alltagstheoretische Deutungen zu legitimieren. Daher kommt man vielfach über das Niveau relativ theorieferner Plausibilisierungsversuche nicht hinaus. Bezeichnenderweise liegen Theoriereferenzen – soweit vorhanden – auch zumeist auf der Ebene der Zielbeschreibungen und damit in den vergleichsweise abstrakten Elementen von Konzeptualisierungen vor. Sie verblassen bis zur Unkenntlichkeit, wo Konkretisierungen gefordert sind und es mehr um das 'Eingemachte' geht, also bei der Darlegung von Inhalten, stärker aber noch bei Methoden, Verfahren und Techniken. Dies gilt auch – eher sogar noch verschärft – für die Bezugnahme auf empirische Befunde. Nur in Ausnahmefällen wird der Stand der Forschung als Ausgangspunkt genommen (besonders stringent und konkret intendiert z.B. bei dem Projekt "Unsere Schule..."). Ansonsten kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass empirisch-wissenschaftliche Befunde bestenfalls im nachhinein legitimatorisch als Belege für ein auch ohne sie zu Stande gekommenes Konzept, mehr noch: für einzelne seiner Bestandteile, primär – wie erwähnt – für Zielabsicherungen, angeführt werden. Noch öfter werden Praxiskonzepte erst gar nicht stringent auf Forschungsergebnisse bezogen. Sie scheinen insofern eher in den Traditionen der konzeptionellen Ausrichtung der jeweiligen Einrichtungen und/oder in den Qualifikationsprofilen und Interessen ihrer Mitarbeiterschaften, wenn nicht gar in Vorgaben 183 projekt- und themenzentrierter Förderpolitik zu gründen; ein Eindruck, der sich gerade im Kontext des Xenos-Programms mit seinen arbeitsmarktorientierten Projekten einstellen kann. Verantwortlich für dieses Nebeneinander von Theorie und Praxis scheinen im wesentlichen zwei Punkte zu sein: Zum ersten müssen theoretische und empirische Studien sich den Vorwurf gefallen lassen, den Themenkreis Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt ganz weit überwiegend in problemzentrierter Engführung anzugehen. Mit anderen Worten: Es dominiert die Suche nach Ursachen für Problemverhalten. Demgegenüber fehlt es an Forschungen, die die Bedingungen von Problemfreiheit oder wenigstens von relativer Problemferne untersuchen. Gerade für die sozialarbeiterische und pädagogische Praxis dürften Antworten auf die Frage, was Distanz zu oder Abwendungen von antidemokratischen Einstellungen und Problemverhalten bewirkt, viel weiterführender sein. Analoges gilt allgemeiner für die Untersuchung von Desintegrationsund Integrationspotenzialen sowie Anerkennungsbeziehungen. Damit hängt der zweite Punkt zusammen. Zum zweiten nämlich resultieren die Schwierigkeiten der Bezugnahme auch aus einem in seiner Funktion ungeklärten, ja häufig in konkreten Forschungszusammenhängen nicht einmal bestehenden Verhältnis von Theorie und Praxis. Fehlender, eher zufälliger im Rahmen von PraktikerInnenfortbildung ablaufender und dann meist auf einseitige Informationsfunktionen reduzierter Kontakt zwischen TheoretikerInnen und PraktikerInnen führt zu mangelhaften Kommunikationsbeziehungen, die wiederum Kooperationsbezüge in weite Ferne rücken lassen. Deshalb stehen auch grundlagenorientierte Forschungsansätze und anwendungsrelevante Studien in einem deutlichen Missverhältnis, in dem letztere ins Hintertreffen geraten sind. Zweifelsfrei sind gründliche Grundlagenkenntnisse unerlässlich, um pädagogische und sozialarbeiterische Strategien und Konzepte mit ihnen fundieren zu können. Dies darf aber nicht dazu führen, dass das Interesse der Praxis an Praxisorientierung und Anwendungsrelevanz zur Seite oder auf die lange Bank geschoben wird. Mit einer solchen Strategie begibt sich Forschung derjenigen Anstöße, die sie aus Praxisfragestellungen heraus befruchten können. Insofern bringt es die Diskussion nicht weiter, aus der Sicht der Wissenschaft die Theorieund Empirieferne der Praxis zu beklagen oder sich aus der Sicht von Praxis über die Abgehobenheit von Forscherinnen und ihre Elfenbeinturm-Mentalität zu beschweren. Aus relativer Kontaktlosigkeit und aus der Defensive wechselseitiger Distanzierung führt nur die Aufnahme kooperativ angelegter Theorie-Praxis-Diskurse heraus. Dazu bedarf es allerdings auch der Setzung von förderlichen Rahmenbedingungen durch die Politik. Dies betrifft die Forschungsförderung, es betrifft aber auch die Ermöglichung, Initiierung und Stützung von Zusammenarbeit im Kontext politischer Programme der Gewaltund Rechtsextremismusbekämpfung. Die vorliegenden Programme sind an dieser Stelle noch unzureichend entwickelt. Paradigmatische und strategische Orientierungen, die Debatten über geeignete Formatierungen und konzeptionelle Ansatzpunkte pädagogischer und sozialarbeiterischer Maßnahmen spiegeln sich durchaus in den einschlägigen Konzepten wider. Ja, es scheint sogar, als hätte dieser Arbeitsbereich innerhalb der letzten ca. 10 Jahre sogar prägend auf Grundorientierungen pädagogischer und Sozialer Arbeit Einfluss genommen. 1. Im Kontext der Rechtsextremismus- und Gewaltdebatte ist der gesellschaftliche Stellenwert von Jugend- und Sozialarbeit als Bearbeitungsinstanz von gesellschaftlichen Konflikten gestiegen. Insbesondere haben sich die Gewichte im Verhältnis von Jugendhilfe und Justiz verschoben. Gerade das Gewalt- und Rechtsextremismus-Problem hat deutlich werden lassen, dass allein mit Mitteln wie Parteiverboten, Ausbau der Polizei 184 und Strafverschärfungen wenig auszurichten ist. Kriminalisierung, Etikettierung und Stigmatisierung jugendlicher Akteure politisch konturierter Gewalt zeitigen vielfach kontraproduktive Folgen und kappen bestenfalls die organisatorisch und ideologisch verhärteten Spitzen des Problem-Eisbergs, lassen aber ursachenbezogene Strategien, Breitenwirkungen, Resozialisierungsgedanken und Präventionsgesichtspunkte außer acht. Diese Einsicht erscheint z.Zt. unumkehrbar, auch wenn immer wieder neu aufflammende Repressionsrhetorik (z.B. anlässlich des NPD-Verbots-Verfahrens oder einzelner Vorkommnisse rechtsextremer Gewaltsamkeit) das Gegenteil zu belegen scheint, Rotstiftpolitk in der Regelversorgung Erreichtes bedroht und die unzureichende Evaluation pädagogischer und Sozialer Arbeit Delegitimationsgefahren heraufbeschwört. 2. Die Breite der oben skizzierten Konzeptvarianten im pädagogischen und sozialarbeiterischen Umgang mit dem Gewalt- und Rechtsextremismus-Problem hat einerseits einer intraund interdisziplinären Akzeptanzausweitung von Methodenpluralismus Bahn gebrochen; andererseits beinhaltet sie markante Akzentsetzungen in Richtung auf mehr Prozessorientierung, Ganzheitlichkeit, Alltagsnähe, Erfahrungsbezug, Handlungsorientierung und Aktionsbezug des Lernens. Darin eingeschlossen deutet sich ein verstärktes Ansetzen an kulturell-ästhetischen und symbolischen Praxen an. Es spiegelt die fortschreitenden konsum- und jugendkulturellen Ausdifferenzierungen wider, die auch vor der Sphäre der Politik nicht haltgemacht haben. Demgegenüber muss das Paradigma der Wissensvermittlung deutliche Einbußen hinnehmen. Pädagogische Aufklärungsattitüden werden zunehmend abgelegt und rein informatorische Veranstaltungen werden seltener. Kognitiv-argumentativ verkürzte Überzeugungsversuche verspüren konzeptionellen Gegenwind. Moralische Urteilsfähigkeit kann weiter als unverzichtbar gelten, von oben herab moralisierend vermittelt, wird sie jedoch zunehmend als aussichtslose Zeigefinger-Pädagogik betrachtet. Besonders eindrücklich sind diesbezüglich die Diskussionen um und die Schlussfolgerungen für eine historisch adäquate Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Formate der Unterrichtung werden zwar, vor allem in der Schule (innerhalb des regulären Unterrichts) und in der Erwachsenenbildung (im Design von Vorträgen, Podiumsveranstaltungen etc.) durchaus noch bemüht, sie werden aber zunehmend durch konzeptionelle Favorisierungen solcher des Trainings (z.B. in personalen und sozialen Kompetenzen oder von StreitschlichterInnen), der Begegnung, der Recherche oder anderer stärker selbstgesteuerter Formate ergänzt und zumindest im Bereich der außerschulischen Jugendbildung auch verdrängt. 3. Die Debatte über die Ursachen von Rechtsextremismus, Ausgrenzungshaltungen und Gewalt hat deutlich werden lassen, dass zwar infrastrukturelle Tätigkeit verstärkt werden muss, dies aber keinesfalls dazu führen darf, die Arbeit mit dem Individuum zu vernachlässigen. Theoretisch und empirisch ist kaum zu übersehen, dass die Anfälligkeit für Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus im Einzelfall mit unzureichend entwickelten personalen und sozialen Kompetenzen zusammenhängt. Deshalb erscheint es folgerichtig, den Hebel hier anzusetzen. Allerdings handelt es sich bei den auf dem Markt befindlichen Konzepten im Regelfall um kurzzeitpädagogische Trainingsformate. Bei ihnen erscheint zum einen die Nachhaltigkeit von erwünschten Effekten zweifelhaft und zum anderen zu wenig bedacht, durch welche zusätzlichen Maßnahmen ein Alltagstransfer bzw. überhaupt eine kompetenzentwicklungsfreundliche Sozialisation sichergestellt werden kann. 4. Rechtsextremismus- und Gewalt-Projekte haben den i.w.S. lebensweltorientierten Konzepten, die schon der Achte Jugendbericht favorisiert, nachhaltige Schubkraft 185 verliehen. Die Aufwertung von aufsuchenden Ansätzen wie z.B. der Mobilen Jugendarbeit hat den Integrations- gegenüber dem Ausgrenzungsgedanken gestärkt, Bedürfnisorientierung krude Problemzentrierungen und -entsorgungsillusionen ablösen lassen und eine Lanze für alltagsnahe und sozialraumorientierte Cliquen- statt klassischer pädagogischer Gruppenorientierung gebrochen (vgl. Krafeld 1992). Selbst wenn in jüngerer Zeit die (sozial)pädagogische Arbeit in rechten Szenen, vornehmlich in Ostdeutschland, in Verruf geraten ist, so bleibt die Förderung von Integrationspotenzialen auch in der Arbeit mit politisch Desintegrierten der zentrale Bezugspunkt. So gesehen ist es als sehr problematisch zu bewerten, wenn der durchaus sinnvoll erscheinende Ansatz des Aufbaus politisch-sozialer Integrationsformen bzw. der Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen demokratischen Interessenausgleichs als Konterpart unmittelbarer Arbeit mit 'rechten' Jugendlichen statt als deren notwendige Ergänzung betrachtet wird. Insofern ist es auch folgerichtig, wenn Gemeinwesenarbeit bloßer Therapeutisierung entgegengesetzt, langfristig angelegte Konzepte – jedenfalls theoretisch, nicht unbedingt praktisch - im Vergleich zu bloßer Anlass-Pädagogik priorisiert und die Bedeutungen von Präventionsanstrengungen sowie von Kinder- und Jugend-Partizipation gesteigert werden. Das Gestaltungsparadigma sieht sich gegenüber einem bloß einzelfallbezogen altruistisch motivierten Hilfeparadigma im Aufwind, wie etwa auch gerade die konzeptionelle Anlage jenes Konzepts zeigt, das auf den ersten Blick noch am ehesten vom Gedanken erster Hilfe getragen wird: die Opferberatung. Sie hat die Einzelfallhilfe um Öffentlichkeits- und Gemeinwesenarbeit erweitert. 5. Insoweit die Geschlechterdifferenzen der Anfälligkeit für Rechtsextremismus ebenso wie für Gewalt erheblich sind, kann nicht verwundern, dass einschlägige Maßnahmen und Projekte nahezu zwangsläufig auf die Relevanz geschlechtsreflektierender Arbeit stoßen. Nachdem lange Zeit die Debatten um Rechtsextremismus und Gewalt sowie die um geschlechtsbezogene Pädagogik getrennt voneinander verliefen, werden zunehmend seit etwa 1991 Verbindungen hergestellt. Auch wenn sich die Praxis der RechtsextremismusProjekte in Bezug auf geschlechtsspezifische Arbeit insgesamt noch defizitär darstellt, so wird doch deren Bedeutsamkeit nachdrücklich unterstrichen. Dies gilt in erster Linie für Jungenarbeit. Die Einschätzung folgt offensichtlich vor allem der Einsicht in die Notwendigkeit einer Pädagogik der funktionalen Äquivalente. So wie sie auch im Rahmen einer noch geschlechtsundifferenziert verfahrenden aufsuchenden Arbeit in rechten Szenen und Cliquen 'hinter' das problematische Verhalten der Adressaten zu blicken sucht, so nimmt sie Gewalt und extremistische Inszenierung auch als ungelenken Umgang mit verspürtem geschlechtsspezifischen Anforderungsdruck wahr und versucht insbesondere für juvenil-maskuline Identitätsbildungsprozesse über Violenz Alternativen für Selbstwert-, Zugehörigkeits-, Teilhabe- und Anerkennungsgewinn zu entwickeln (vgl. auch Möller 2002c). Freilich müssen politisch Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die eher noch abstrakten Relevanzzuschreibungen an geschlechtsreflektierendes Arbeiten in konkrete Maßnahmen zu transformieren gestatten. 6. Der Einsicht folgend, dass Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit nicht auf monokausale Ursachen zurückzuführen sind, werden arbeitsfeldbezogene Abschottungen zwischen den Sozialisationsinstanzen und -institutionen immer fraglicher und erhalten Bestrebungen der Vernetzung sozialer Hilfsangebote und Kontrollformen Auftrieb. Dies gilt um so mehr, als die milieugebundenen Unterstützungs-Netzwerke des marginalisierten Klientels im Zuge von Individualisierungsfolgen vielfach zerstört sind bzw. werden und auf Ersatz drängen. Daher ist der Praxis-Zusammenhang der Rechtsextremismus- und Gewalt-Projekte nicht zufällig auch Hintergrund für das Konzept "milieubildender Jugendarbeit" (vgl. AGAG-Informationsdienst 2/1993, 69 ff.; Böhnisch 186 1994, 1997) und kann in Korrespondenz mit der auch in anderen Themenfeldern anstehenden Verstärkung zivilgesellschaftlichen Engagements stehen. Wohl nirgendwo sonst werden Formate der Strukturverbesserung von Lebensbedingungen konsequenter innerhalb pädagogischer und sozialarbeiterischer Kontexte verfolgt. Entsprechend können sie sich hier in Richtung auf politisches Handeln öffnen. 7. Insofern für die Fachperspektive auf die Problematik offenliegt, dass rechtsextrem Orientierte nur SymptomträgerInnen von Problemlagen sind, die viel breiter in der Gesellschaft streuen, ist die Konfrontation mit den Grenzen pädagogisierender Bearbeitungsformen unausweichlich. Rechtsextremismus- und Gewalt-Projekte entwickeln daher einen Druck auf die (Re-)Politisierung der Jugend- und Sozialarbeit bzw. der Pädagogik. Da sie Rechtsorientierung auch auf fehlende politische Partizipation zurückführen müssen, führen sie die Notwendigkeit der Erweiterung von Beteiligungsrechten Jugendlicher, der Verfolgung von politischen EinmischungsStrategien und der Mitentwicklung einer "integrierten Kommunalinfrastrukturpolitik" (Bundesministerium 1990, 16) vor Augen. 8. Nach einer Phase der Personalisierung von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, wurde gerade von den in einschlägigen pädagogischen Projekten tätigen Mitarbeitern dieser Mechanismus als Verleugnungs- und Ablenkungsmanöver von zumeist subtil vorhandenen oder rechtlich verankerten Formen struktureller bzw. systemischer Gewalt in der Gesamt-Gesellschaft erkannt. Konsequenz ist eine Sensibilisierung für eine über die Jugendarbeit weit hinausreichende Kultur der Gewaltlosigkeit. Sie betrifft, da der moderne Rechtsextremismus seinen Kristallisationspunkt aus i.w.S. Fremdenfeindlichkeit bezieht, naheliegenderweise insbesondere die Regelung des multiethnischen und multikulturellen Konfliktpotenzials. Konzepte interkulturellen Lernens und der Antidiskriminierungsarbeit stellen sich gerade dieser Aufgabenstellung, wobei gerade letztere auch sehr klar strukturelle Verbesserungen über politische Einmischungen anzielt. "Was wirkt denn nun wirklich?" – Wer diese Frage stellt, sieht sich in seiner Hoffnung auf Klärung durch Evaluationsstudien enttäuscht. Nicht einmal vorsichtiger formulierte Ansprüche, wie z.B. Grade der Zielerreichung festzustellen, werden in einem auch nur halbwegs hinreichendem Maße wissenschaftlich valide in ihrer Realisierung und Realisierbarkeit überprüft. Dies gilt für Einzelmaßnahmen wie für Programme, für letztere allerdings noch verschärft. Evaluationsstudien zu Anti-Gewalt-Programmen gehören nach wie vor zu den knappsten Gütern der gesamten Gewaltforschung. Lösel u.a. (1990, hier: 24) sowie Remschmidt u.a. (1990, hier: 273ff.) kritisieren schon vor über 10 Jahren im Hinblick auf die Wirkungsevaluation von gewaltbezogenen Präventions- und Interventionsmodellen in Deutschland, dass sie nur äußerst selten durchgeführt wird und es an systematischer, methodisch kontrollierter Evaluationsforschung einen "deutlichen Mangel" gibt. Im Hinblick auf den pädagogischen Umgang mit aggressiven Jugendlichen existieren bis zum Beginn der 90er Jahre in Deutschland allenfalls Erfahrungsberichte (vgl. vor allem Kraußlach 1981), nicht jedoch Wirkungsanalysen, die auf der Basis einer unabhängigen Begleitforschung in einem quantitativ- oder qualitativ-empirischen Sinne erstellt sind. Auch heute noch herrschen auf diesem Marktsegment Erfahrungsberichte vorwiegend aus pädagogischen Bereichen, die mit entsprechendem Klientel besonders intensiv befasst sind, also Streetwork und Mobiler Jugendarbeit, teilweise auch Jugendhausarbeit, vor (vgl. zusammenfassend bzw. auszugsweise dazu: Becker/Simon 1995; Koch/Behn 1997; Stickelmann 1996; LAG Mobile Jugendarbeit 1997; Deinet/Sturzenhecker 1998). Naturgemäß sind sie meist unsystematisch 187 und methodisch wenig anspruchsvoll. Darüber hinausgehende evaluative Arbeiten sind – wie oben im einzelnen mit Bezug auf verschiedene Konzepte markiert – äußerst dünn gesät. Methodisch betrachtet stehen auch sie selten auf festen Füßen. Bisweilen ist eher Dokumentation drin, wo Evaluation draufsteht. Hinzu kommt, dass generell die Nachhaltigkeit von Effekten so gut wie gar nicht untersucht wurde. Speziell in Hinsicht auf politische Gewalt von rechts sieht die Forschungslage noch düsterer aus. Man kommt wohl fast nicht umhin, der aktuell von Wagner u.a. (2001) gemachten Feststellung beizupflichten "Evaluierte Maßnahmen zur Prävention fremdenfeindlicher/antisemi-tischer Gewalt gibt es nicht" (ebd., 323) und diese Aussage auch auf andere Formen rechtsextremer Gewaltsamkeit ausdehnen zu müssen. In Bezug auf Forschung über die Wirkung von pädagogischen Anstrengungen bei der Bearbeitung von rechtsextremen Orientierungen, also auch in Bezug auf Einstellungen und geistige Haltungen unterhalb gewaltförmigen Handelns, gilt zusammenfassend auch heute noch wenigstens die vorsichtig formulierte Erkenntnis: "Rechtsextremismusforscher haben es bisher versäumt, auszuloten, mit welcher Wahrscheinlichkeit konkrete Maßnahmen Wirkung zeigen". Forschung ist "bisher kaum darauf gerichtet, effiziente Gegenstrategien zu entwickeln" (Winkler/Jaschke/Falter 1996, 19). Offensichtlich liegt dies daran, dass sie weit mehr ursachenanalytisch interessiert ist. Darin allerdings zeigt sich eine Gewichtung, die sich angesichts des konkreten Problem- und Handlungsdrucks nicht länger aufrecht erhalten lässt. Evaluationsforschung tut not. 4. Zum Stellenwert des Forschungsverbundes "Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft" und zu Forschungsdesiderata aus der Perspektive der Analyse pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxis 4.1 Zum Rahmenkonzept Der Forschungsverbund verbindet die Analyse von sozialen Destruktionsphänomenen wie Gewalt, interethnischen bzw. interreligiösen Feindseligkeiten, Fremdenfeindlichkeit und anderen Diskriminierungsformen, Entsolidarisierung sowie Rechtsextremismus mit der Identifizierung von sozialen Integrations- und Desintegrationsfaktoren. Er nimmt seinen theoretischen Ausgangspunkt mehrperspektivisch, methodenplural und multidisziplinär bei der Integrations-/Desintegrationsdynamik und den durch sie geprägten Krisenphänomenen. Damit setzt er bei Problematiken an, die zum einen aus theoretischer und empirischer Sicht der einschlägigen Forschung erfolgversprechend für die Eruierung von Anfälligkeits- und Distanz(ierungs)faktoren sind und die zum anderen aus der Sicht von Pädagogik und Sozialer Arbeit Kernaufgaben ihrer professionellen und institutionellen Orientierungen betreffen. So lässt sich Soziale Arbeit nach ihrem modernen professionellen Selbstverständnis nicht mehr hinreichend durch Problemgruppenzentrierung, Benachteiligtenorientierung und Defizitansatz definieren (vgl. Möller 2002a). Sie ist vielmehr substanziell als grundlegende "Arbeit am Sozialen" zu verstehen. Insofern soziale Probleme sich tendenziell entmarginalisieren und nicht mehr oder minder allein bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen, vornehmlich eben Randgruppen, betreffen, ist sie zunehmend auch auf die sog. "Mitte der Gesellschaft" bezogen. Sie weitet deshalb auch ihre Präventionsfunktionen aus und kommt nicht erst dann zum Einsatz, wenn Probleme sozialer Desintegration vehement auf den Plan treten und gänzlich unübersehbar auf ihre Lösung drängen. Selbst ungeachtet dessen intendiert sie auch bei offensichtlich problembelastetem Klientel die Vermittlung funktionaler Äquivalente für solche Befriedigungsformen von Integrations- und Anerkennungsbedürfnissen, die individuell 188 und sozial schädigend sind. Aufgrund dessen ist sie verstärkt auf der Suche nach sozialen Integrationspotenzialen und auf Forschungsleistungen angewiesen, die eben diese zu identifizieren gestatten. Die Anlage des Forschungsverbunds verspricht dieses Desideratum einzulösen, indem das Augenmerk auf Dimensionen der individuell-funktionalen System- und der gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Sozialintegration und die in diesem Kontext stehenden Anerkennungsprobleme gelegt wird (vgl. Heitmeyer 2001, bes. 17 ff.). Der dabei eingestellte Fokus auf Zugänge, Teilnahmechancen, Zugehörigkeiten und entsprechende Anerkennungen erscheint aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher deshalb gut justiert, weil in der Vermittlung und Qualifizierung darauf bezogener Ressourcen und Möglichkeiten wichtige problemprotektive und –reduzierende Chancen ausgemacht werden. Der Mehr-Ebenen-Ansatz reflektiert, dass Pädagogik und Soziale Arbeit sich nicht in der face-to-face-Auseinandersetzung mit dem 'Klientel' im Mikrobereich gesellschaftlichen Lebens erschöpft, sondern sich gezwungen sieht, auch infrastrukturell gestaltend auf der Meso- und Makro-Ebene Einfluss zu nehmen. Zwar liegt die Makro-Ebene im allgemeinen außerhalb der unmittelbaren Reichweite pädagogischer und Sozialer Alltagsarbeit, arbeitet sie sich aber andererseits notgedrungen an langfristigen und aktuell wirksam werdenden Strukturproblemen ab, so dass der allenthalben verbreitete Anspruch auf ursachenbezogenes Handeln nicht ohne Kenntnisse über die von ihnen bewirkten Prozesse und nicht ohne Überlegungen zu politischen Einmischungen eingelöst werden kann. Die in Sektor I des Forschungsverbundes zu betreibende Aufhellung struktureller Hintergrundprozesse kann deshalb der ursachenadäquaten Auslegung (sozial)pädagogischer Programme und Maßnahmen dienlich sein. Aus der theoretischen und empirischen Perspektive ursachenbezogener Forschung (vgl. dazu ausführlicher: Möller 2000, 2001; Boehnke/Baier 2001; Minkenberg 2002) geht hervor, dass institutionelle und sozialräumliche Gelegenheitsstrukturen (Sektor IIb des Forschungsverbundes), kollektive Mobilisierungspotenziale in der Bevölkerung (Sektor IIc) und das Verhalten von Deutungs-, Kontroll- und Mobilisierungsakteuren (Sektor IIa) individuelle Lernprozesse sowie kollektive Orientierungs- und Verhaltensweisen (Sektor III) entscheidend prägen. Daher erscheint es sinnvoll, wie der Forschungsverbund dies tut, Projekte mit entsprechenden Fragestellungen einzubinden, nicht zuletzt um die auch aus pädagogischer und sozialarbeiterischer Erfahrung heraus als relevant einzustufenden "verdeckten Varianten" der Unterminierung von Kernnormen freizulegen (vgl. Heitmeyer 2001, 21) und die Einzelprojekte auf den 3 Ebenen miteinander weitmöglichst kooperativ zu verzahnen. Er öffnet damit in gewisser Weise die Einzelprojekte durch die Möglichkeit zu Bezugnahmen aufeinander, initiiert Konvergenzanstrengungen und 'zwingt' die einzelnen Studien in die Gesamtverantwortung. Die avisierten Themen-, Konstrukt-, Methoden-, Instrumenten-, Daten- und Interpretationskooperationen sowie die regionalen und sozialräumlichen Feldkontakte untereinander ermöglichen Komplementaritäten, die außerhalb eines Verbundes unerreichbar blieben. Aus der Sicht pädagogischer Praxis lässt sich damit die Erwartung einlösen, nicht nur fragmentarisch neue Erkenntnisse über Teilphänomene, sondern auch Antworten auf Anschlussfragen, die aus bestimmten Forschungsergebnissen resultieren können, erhalten zu können. Die Themenauswahl in den einzelnen Sektoren des Verbundes erscheint zwar in gewisser Weise willkürlich und den jeweiligen Interessen der beteiligten Forscher und Forscherinnen zu folgen. Nichtsdestoweniger akzentuieren die Themen Problembereiche, die aus der Sicht pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxis hohe Relevanz beanspruchen können. Sie fokussieren auf Prozesse, Institutionen und Personengruppierungen, deren Studium entweder wichtige Hintergrundprozesse klären helfen oder die – dies ist die Mehrzahl – die unmittelbare Arbeit an der 'pädagogischen Front' betreffen (z.B. Schule, Angstzonen, Skinheads, Opfer). 189 Vor dem Hintergrund der zu konstatierenden Defizite in der Theorie-Praxis-Kooperation ist es erfreulich, dass der Forschungsverbund Wert auf Anwendungsrelevanz legt und einzelnen PraxisvertreterInnen wie Praxisinstitutionen "eine aktive Rolle" (Heitmeyer 2001, 38) zugesteht. Die vorgesehenen ExpertInnen-Interviews in manchen Projekten und Wissenschafts-Praxis-Workshops (vgl. ebd., 41) bieten allerdings nicht mehr als Ansätze dafür. Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Perspektive, vor allem aber aus der Sicht von Praktikern und Praktikerinnen der pädagogischen und Sozialen Arbeit wäre es wünschenswert, wenn auch die Einzelprojekte des Verbundes breiter und verstärkt Kooperationen eröffnen würden, wie dies in einigen Fällen bereits geschieht. Dabei erscheint es wichtig, PraktikerInnen bereits in der Phase der Felderschließung und der Konzeptualisierung der Erhebungen zu beteiligen, sie im weiteren Verlauf kontinuierlich zu Konsultationen einzuladen und nicht allein anschließend für sie (ggf. Zwischen)Ergebnispräsentationen anzubieten. So wäre zu gewährleisten, die Forschungsanlage durch Praxisanregungen 'aufladen' und Praxiskooperation auch als eventuelles Korrektiv innerhalb der Forschungsprozesses fruchtbar werden lassen zu können. Die in den voranstehenden Kapiteln geleistete Aufarbeitung des Forschungsstandes zu pädagogischen und sozialarbeiterischen Programmen und Konzepten zur Bearbeitung von Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sah sich gezwungen, deutschlandweit das fast gänzliche Fehlen sowie nicht unerhebliche Schwächen der wenigen und zudem z.T. nur im Ausland vorhandenen Evaluationsstudien zu diagnostizieren. Aus diesem Grund lässt sich die ursachenanalytische Ausrichtung des Forschungsverbundes und seine Aussparung von Evaluationsforschung bedauern. Andererseits bietet die strikt kooperative und konvergenzfokussierende Anlage des Forschungsverbundes gute Chancen dafür, den Ertrag der der Komplexität des Untersuchungsgegenstands schwer gerecht werdenden Einzelforschungen deutlich zu übertreffen. Außerdem bietet er Themen, die in z.T. weit aufklaffende Forschungslücken und Leerstellen stoßen (z.B. Angstzonen, Skinhead-Studie, Eliten, Sport, Gefängnisse) und gleichzeitig Praxisbereiche berühren, in denen MitarbeiterInnen unter hohem Handlungsdruck stehen. Insofern macht es wenig Sinn, ihre Ersetzung durch evaluativ ansetzende Forschungen zu fordern. Allerdings stellt sich auf der anderen Seite die Situation von Evaluationsforschung geradezu desaströs dar. Im Sinne rationaler politischer Steuerung erscheint es kaum noch verantwortbar, Gelder in mehrstelligem Millionenumfang in Programme und Maßnahmen zu leiten, deren Effektivitätsnachweise, sofern überhaupt abgefordert und vorgelegt, mehr auf dem Level von Alltagsplausibilisierungen geführt als wissenschaftlich basiert werden. Öffentlichkeit und Eltern haben ein naheliegendes Interesse daran, erfolgversprechende Umgangsweisen von eher nutzlosen oder sogar kontraproduktiven Strategien trennen zu können. Und auch für die Praxis ist es wenig befriedigend, Jahr für Jahr entweder mehr oder minder 'more of the same' zu produzieren oder innovative Wege zu gehen, die vielleicht MitarbeiterInnen und AdressatInnen unspezifischen "Spaß" machen, aber nicht bzw. kaum zu erkennen geben, wohin sie tatsächlich führen. Deshalb ist zu überlegen, ob nicht die Öffnungsklausel (vgl. Rahmenkonzept) dafür genutzt werden sollte, auch solche Studien ein- bzw. anzuschließen, die sich auf Evaluation von Praxis beziehen. Wie eine derartige Einbeziehung bzw. ein 'Andocken' aussehen könnte, sollte dann spätestens bis zum 'ersten Meilenstein' geklärt werden. 4.2 Zu den einzelnen Projekten17 17 Vgl. zum folgenden eingehender bei Bedarf: Interdisziplinärer Forschungsverbund "Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft". Antrag zur Förderung des Forschungsverbundes durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bielefeld 2001 190 Projekt 1 (Thome) zeichnet die Entwicklung der Gewaltkriminalität auf dem Hintergrund des sozialen Wandels und politischer Konfliktkonstellationen international vergleichend zwischen Deutschland, England und Schweden zwischen 1950 und dem Jahr 2000 nach. Es zielt darauf ab, Indikatoren zusammenzustellen und neu zu konstruieren, die es erlauben, "normale" und "pathologische" Integrationsformen zu identifizieren. Die im einzelnen verfolgte Indikatorenliste beinhaltet trotz der makrotheoretischen Anlage der Studie Aspekte, deren Praxisrelevanz hervortritt. Dazu gehören bspw. Vertrauen in politische Institutionen, Partizipationsbereitschaft, Wertorientierungen und Erziehungsziele, Freizeit- und Konsumverhalten, Lebensstile, Mitgliedschaft in freiwilligen Vereinigungen, soziale Einsamkeit, Zeit für Gespräche mit Eltern und Freunden, Umsätze bei bestimmten Computerspielen und Hinweise auf die Entstrukturierung der Jugendphase. Es handelt sich dabei um Faktoren, die innerhalb der Reichweite pädagogischer Beeinflussung liegen bzw. z.T. gezielt von Konzepten der Gewaltbekämpfung angegangen werden (etwa im Rahmen von Projekten der Partizipationsförderung die Steigerung von Partizipationsbereitschaft). Wenn Makro-Mikro-Verbindungen darin vermutet werden, dass ein durch bestimmte strukturelle Entwicklungen beförderter Mangel an Selbstkontrolle bzw. an Handlungskompetenz die Kriminalitätsbelastung einer Gesellschaft ansteigen lassen, deutet sich ein vielversprechender Ertrag für die pädagogische und sozialarbeiterische Praxis an, zumal bestimmte der in Kap. 3.1 diskutierten Konzepte speziell auch auf die Qualifizierung von individueller Selbstkontrolle abheben (besonders deutlich etwa Anti-Aggressivitätstrainings und Konzepte der Schulung von personalen Kompetenzen und des allgemeinen sozialen Lernens). Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Perspektive und im Interesse an Anwendungsrelevanz erscheint aber besonders interessant, dass erwartet wird, auch Vorschläge für die Sozialberichterstattung gewinnen zu können. Gleichwohl bleibt auch nach Projektabschluss zu prüfen, inwieweit makrotheoretisch herausgearbeitete Zusammenhänge auch im Mikrobereich zutreffen bzw. ob und ggf. wie sie sich auf Gruppen- und individueller Ebene umsetzen. Dabei sind dann auch die Einflüsse des Mesobereichs zu berücksichtigen. Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher wie – praktischer Sicht sind in diesem Rahmen gerade solche institutionellen Strukturbildungen, Programme und Maßnahmen interessant, die in ihrem professionellen Zuständigkeitsbereich liegen. Projekt 2 (Dörre) setzt ebenfalls makrotheoretisch an. Zentraler Gegenstand ist hier aber der Arbeitsmarkt. Untersucht wird, inwieweit prekäre Beschäftigungsverhältnisse als Ursachen von sozialer Desintegration und Rechtsextremismus in Frage kommen. Dementsprechend fahndet die Studie nach Verunsicherungen, Bindungsverlusten, Ohnmachtgefühlen und Erfahrungen sozialer Missachtung und stellt dabei Zonen der Prekarität solchen der Integration und der Entkoppelung gegenüber. Sie sucht jedoch darüber hinaus auch nach Formen der Selbsttätigkeit, Selbstorganisation und solidarischen Bewältigung, die Hinweise auf Ansatzpunkte für eine Revitalisierung der sozialen Bindungskraft von Erwerbsarbeit liefern könnten. Fünf Dimensionen werden dabei vorzugsweise berücksichtigt: Einkommen, Sinnstiftungsfunktion von Arbeit, die Qualität von Sozialbeziehungen am Arbeitsplatz, die Lang- bzw. Kurzfristigkeit von Lebensplanung, die Konsistenz bzw. Inkonsistenz von Status und die Grade an Vertrags(un)sicherheit. Das Vorhaben erschließt damit ein Themenfeld, das bspw. im Kontext des Xenos-Programms von zentraler Bedeutung ist. Es lässt Ergebnisse erwarten, die ohne sonderlich schwierige Transferierungsarbeiten in die (sozial)pädagogische Begleitung der darin vorgesehenen Maßnahmen einfließen können. Dies auch deshalb, weil forschungsmethodisch ein qualitatives Verfahren gewählt wird, das den subjektiven Umgang mit Prekaritäts-, Entkoppelungs- und Integrationserfahrungen einzufangen vermag. 191 Befruchtend dürften Projektergebnisse auch auf die betriebliche Sozial- und Antidiskriminierungsarbeit und die gewerkschaftliche Bildungsarbeit zur Thematik wirken. Um solche Transferleistungen verstärken zu können, wäre zu überlegen, ob nicht auch ExpertInnen-Interviews mit Professionellen aus diesen Bereichen bereichernd wären. Das Vorhaben bietet eine Reihe von Anschlussstellen zu Projekten, die sich nicht zentral auf Fragen der Arbeitsmarktintegration beziehen, andererseits aber von Kooperationen mit dem Projekt und von seinen Ergebnissen bei der Interpretation der eigenen Daten profitieren dürften. Projekt 3 (Rucht/Imbusch) untersucht das Verhalten von Wirtschaftseliten in Bezug auf eine Übernahme von Verantwortung für die Verhinderung und Beseitigung zerstörerischer Folgen sozialer Desintegrationsprozesse. Es nimmt damit auf der Meso-Ebene eine Gruppierung in den Blick, die vor allem unter Deutungs-, Kontroll- und Mobilisierungsaspekten von Belang ist, allerdings bislang fast gar nicht in den Fokus der Rechtsextremismus-, Fremdenfeindlichkeits- und Gewaltforschung gerückt wurde. Auch wenn die Unterstellung eines diskursprägenden Einflusses aufgrund des registrierbaren Glaubwürdigkeitsrückgangs von Eliten im allgemeinen durchaus strittig ist, kann ihnen eine bedeutsame Multiplikatorenfunktion zugesprochen werden. Damit erscheint die Frage spannend, inwieweit sie in der Lage und willens sind, das Klima für Integration und Desintegration über öffentliche Äußerungen und im Rahmen berufsständischer Organisationen insgesamt, in erster Linie aber auch gerade innerhalb ihrer Betriebe, zu bestimmen. Anzunehmen ist, dass auf ihrer Seite Strukturgestaltungskompetenzen vorhanden sind, die etwa die interethnischen Beziehungen von Beschäftigten am Arbeitsplatz entscheidend formen können. Geklärt wird, inwieweit sie wahrgenommen und genutzt werden, welche Motive hinter entsprechenden Initiativen und Aktivitäten stehen, welche Muster sich zeigen, unter welchen Bedingungen sowohl ein auf Integration zielendes Engagement als auch ein Desintegration duldendes oder gar verschärfendes Handeln zu Stande kommt und welche Erfahrungen sowohl mit dem einen wie dem anderen bisher gemacht wurden. Das Projekt zielt damit auf Forschungsergebnisse, die auch von außerwissenschaftlichem Interesse sind, etwa in der Debatte um die Zuwanderung. Sie berühren die Arbeitsbereiche von Pädagogik und Sozialarbeit vor allem dort, wo sie unmittelbar in betrieblichen Zusammenhängen (z.B. betriebliche Sozialarbeit) oder in beruflicher Aus- und Weiterbildung angesiedelt sind. Indem das Projekt in seiner Konzentration auf unternehmerische Figuren als Komplementärstudie zu der auf Arbeitnehmer bezogenen Studie von Dörre aufzufassen ist, ergeben sich nicht nur interessante Anschlussstellen der Projekte untereinander, sondern weist Projekt 3 in ähnlicher Weise wie Projekt 2 Erkenntnispotenziale auf, die vor allem für (sozial)pädagogische Arbeit im Rahmen von Xenos- und anderen arbeitsmarktbezogenen oder auch berufsschulbezogenen Maßnahmen interessant sind. Anregungen sind darüber hinaus aber auch – ähnlich wie bei Projekt 2 – für die betriebliche Antidiskriminierungsarbeit, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und eine auf ArbeitnehmerInnen bezogene Erwachsenenbildung erwartbar. Projekt 4 (Neckel) widmet sich der Untersuchung negativer Klassifikationen. Darunter sind stigmatisierende Elemente der symbolischen Ordnung einer Gesellschaft zu verstehen, die in zwei Typen existieren können: als graduelle Unterscheidungen oder als kategoriale Klassifikationen. Letztere erheben in Gestalt von Ungleichwertigkeitsvorstellungen den Anspruch auf Exklusivität von Zugängen, Teilnahmechancen und Teilhaberechten. Sie verteilen darüber auch Anrechte auf soziale Wertschätzung. Das Projekt untersucht in sozialräumlichem Zuschnitt in drei Stadtteilen mit unterschiedlicher Ressourcenausstattung und unterschiedlichen Integrationsgraden ("abgehängt", "durchmischt", "gehobene Lage") das Zustandekommen solcher Klassifikationen unter den fünf Dimensionen ihres materialen Inhalts (1), ihrer formalen Struktur (2), den Kontextbedingungen der Adressierung (3), den 192 Prozessverläufen praktischer Aushandlungen (4) und ihren sozialen Folgen (5). Es spitzt damit anerkennungstheoretische Fragen auf soziologisch beobachtbare Felder zu. Methodisch sind ethnographische Feldforschung sowie Einzel- und Gruppeninterviews mit Angehörigen verschiedener innerhalb der Stadtteile wohnhafter Sozialgruppen (z.B. Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Ausländer, aufwärts und abwärts sozial mobile Personen) vorgesehen. Aus erziehungsund sozialarbeitswissenschaftlicher wie aus pädagogischer und sozialarbeitspraktischer Sicht erscheint gerade die integrierte Sozialraumperspektive ertragversprechend. Insbesondere sozialräumliche Ansätze, Strategien infrastruktureller Arbeit und politischer Einmischung sowie Ansätze von Netzwerkarbeit benötigen Hinweise darauf, an welchen Stellen Einflussnahmen nötig und aussichtsreich sind. Der Ertrag des Projekts ist jedoch auch davon abhängig, dass es gelingt, genau jene Faktoren zu eruieren, die graduelle von absolut verfahrenden Klassifizierungsprozessen unterscheiden. Projekt 5 (Eckert u.a.) thematisiert Gruppenauseinandersetzungen von Jugendlichen in lokalen Kontexten. In sozialräumlich-kontrastierendendem Zuschnitt auf "abgehängte" Viertel einerseits und "privilegierte" Stadtteile andererseits werden die Konflikte, Desintegrationserfahrungen, Integrationspotenziale und Interaktionsmuster innerhalb und außerhalb von Jugendcliquen in Gegenüberstellung von gewaltarmen und gewaltaffinen Gruppierungen herausgearbeitet. Es bearbeitet damit ein Untersuchungsfeld, das mit dem praktischen Arbeitsfeld von Offener und Mobiler Jugendarbeit bzw. Streetwork große Kongruenzflächen aufweist. Gleichzeitig handelt es sich um eine u.a. durch die Gruppe um Eckert selbst bereits vergleichsweise gut ausgeleuchtete Problematik. Neue Erkenntnisse von unmittelbarer Praxisrelevanz sind vor allem dann zu erwarten, wenn mindestens drei Zusammenhänge eingehender untersucht werden: zum ersten die gender-Perspektive (vor allem die Frage qualitativ unterschiedlicher Betroffenheiten von sozialer Desintegration und unterschiedlicher Nähen zu Gewalt, Selbstkontrollmechanismen, gewaltfreien Konfliktregelungskompetenzen und Integrationspotenzialen zwischen Jungen und Mädchen; hierbei erscheint auch die Frage von Bedeutung, inwieweit für Kämpfe um maskuline Hegemonie, die Cliquenhändel häufig stark prägen, echte "Konflikte" vorausgesetzt werden müssen oder den Streitigkeiten nicht vielmehr die Konfliktsuche zu Grunde liegt); zum zweiten die ethnisch-kulturelle Formierung (hier vor allem auch die Auswirkungen ethnischkulturell bestimmter Männlichkeitsdefinitionen und Ehrbegriffe, u.a. mit Bezug auf Differenzen von Verwurzelungen im christlich-europäischen und islamischen Kulturkreis); zum dritten die Einflussbedingungen intermediärer Instanzen im Sozialraum, hier insbesondere auch von Schule und Jugendarbeit, auf Konfliktlösungsmuster. Während sich Erkenntnisse über den ersten und zweiten Gesichtspunkt für die breiten Leerstellen geschlechtsreflektierenden Arbeitens und interkultureller Jugendarbeit fruchtbar machen ließen, wäre die Erhellung von Bedingungsmomenten, die im Einflussbereich intermediärer, vor allem pädagogischer Instanzen liegen, für Antworten auf ungelöste Fragen sowohl der jeweils adäquaten Problemzuwendung der Institutionen als aber auch der Intensität, Inhalte und Formen anzustrebender inter-institutioneller Vernetzungen hilfreich. Das Projekt könnte sich damit ein Stück weit in Richtung auf Evaluationsfragestellungen bewegen. Projekt 6 (Minkenberg) versucht, Repressionswirkungen auf rechtsextreme Gruppen zu identifizieren. Es weist damit stärker als andere Projekte des Verbundes evaluative Momente auf, ist aber nicht auf Interventionen von Pädagogik und Sozialarbeit bezogen. Vielmehr wird untersucht, wie staatliche Repression (Parteien-, Versammlungs- und Vereinsverbote, Polizeieinsätze etc.) und soziale Ächtung (Gegenmobilisierungen durch zivilgesellschaftliche Zusammenschlüsse, Elitenverhalten, Positionierungen (innerhalb) der öffentlichen Meinung) auf Gewaltniveau und Gewaltbereitschaft, auf die Intensitäten der Verfolgung rechtsextremer Ideologie sowie auf Ausstiegsprozesse einwirken. Gleichwohl die Studie keine unmittelbar 193 pädagogischen und/oder sozialarbeiterischen Fragestellungen verfolgt, kann ihr eine hohe Bedeutung auch für sie zugesprochen werden. Diese Einschätzung stützt sich auch darauf, dass methodisch neben Auswertungen von Literatur und statistischem Material zentral auf eine qualitative Längsschnittanalyse abgestellt wird, die Angehörige von rechtsextremen Parteien sowie des rechtsextremen Bewegungsspektrums einbezieht. Die Studie bietet damit zum einen Anschluss an die Untersuchung von rechtsextrem orientierten Gruppierungen, die sich eher im unorganisierten und vergleichsweise weniger ideologisch motivierten Bereich finden (wie den Skinheads oder informellen Cliquen; vgl. Projekt 17 und 5) und die mit den Mitteln von aufsuchender Sozialarbeit und Pädagogik nicht unerreichbar zu sein scheinen (vgl. Kap. 3.1.7). Dass der Fokus dabei (wie bei Projekt 17) auch auf Ausstiegsprozesse eingestellt wird, stellt gewinnbringende Komplementaritäten der Projekte in Aussicht. Das Vorhaben vermag zum anderen (und auch gerade wegen des letztgenannten Aspekts) voraussichtlich wichtige Informationen für die Anlage bzw. Optimierung von Aussteigerprogrammen zu liefern und damit zu versprechen, konzeptionelle Unsicherheiten aufzufangen, die gegenwärtig unübersehbar sind (s. Kap. 3.1.15). Für Bestrebungen zivilgesellschaftlicher Vernetzungen (vgl. dazu Kap. 3.1.14) und eines Ausbaus der Demokratieerziehung (vgl. Kap. 3.1.2 und 3.1.5), für medienpädagogische Ansätze (vgl. Kap. 3.1.9), öffentliche Kampagnen, Wettbewerbe und Aktionen (vgl. Kap. 3.1.13), aber auch für die infrastrukturelle Seite der Opfer- und Antidiskriminierungsarbeit (vgl. Kap. 3.1.16 und 3.1.17) ist es wünschenswert, möglichst differenziert auch neue Erkenntnisse über verschiedene Formen und die Funktionen sozialer Ächtung zu erhalten. Projekt 7 (Häußermann) untersucht, inwieweit die Fragmentierung von Städten die Problemdefinitionen und Politikvorstellungen ihrer EinwohnerInnen bestimmt und wie die soziale Unterschiedlichkeit von Quartieren in den Wahrnehmungen und Entscheidungsprozessen von PolitikerInnen repräsentiert ist. Dazu werden telefonische Befragung von BewohnerInnen in "abgehängten" und privilegierten Stadtteilen in vier Vergleichsstädten sowie Leitfaden-Interviews mit PolitikerInnen und Quartiers-ExpertInnen durchgeführt. Über die beiden im Projektantrag genannten, eher auf politisches Handeln bezogenen praxisorientierten Lösungsvorschläge hinaus – die Prüfung, inwieweit eine Politik des sozialen Ausgleichs überhaupt noch erwartet werden kann und wie die mit Repräsentationslücken verbundenen Ausgrenzungs- und Diskriminierungsmechanismen behoben werden können – können auch wichtige Hinweise für eine sozialräumliche und auf Gemeinwesenentwicklung hin angelegte Pädagogik bzw. Sozialarbeit erwartet werden. Aus pädagogischer und sozialarbeiterischer Sicht wäre ein Einbezug von Professionellen in sozialen und pädagogischen Einrichtungen in die Befragungen interessant, um mögliche Übereinstimmungen oder Differenzen zwischen ihren Perspektiven zu PolitikerInnen- und BewohnerInnen-Sichtweisen einzufangen und ggf. auch gemeinwesen- bzw. quartiersbezogene Konzepte zu eruieren. Weiterführend erscheint auch vor allem für marginalisierte Stadtgebiete durch eine kontrastierende Auswahl von Vierteln mit besonders hoher und besonders niedriger Rechtsextremismusproblematik herauszuarbeiten, wo demokratieförderliche, gewaltverhindernde und extremismusreduzierende Steuerungspotenziale liegen und dabei gezielt auch die Rolle pädagogischer und sozialer Einrichtungen in den Blick zu nehmen. Projekt 8 (Bergmann) beschäftigt sich mit so genannten "Angstzonen", also mit Sozialräumen, in denen Rechtsextreme politisch-kulturelle Hegemonie erobert haben. Analysiert werden sie unter drei Dimensionen: Sozialräumlich wird zum ersten der Entstehungsprozess und die Funktionsweise solcher Zonen durch Interviews mit lokalen Akteuren und Auswertungen von lokalen Medien und thematisch einschlägigen anderen Dokumenten untersucht; zum zweiten werden die politisch-strategischen Überlegungen in der 194 rechtsextremen Publizistik herausgearbeitet; zum dritten wird die massenmediale Diskussion des Phänomens nachgezeichnet und auf ihre Einflüsse sowohl auf die rechtsextreme Szene als auch auf die Sphäre der demokratischen Politik und der Öffentlichkeitsarbeit untersucht. Das Projekt greift ein bislang erst in allerersten Ansätzen wissenschaftlich angegangenes Thema auf, das gleichwohl für mehrere pädagogische und sozialarbeiterische Konzepte von hoher Bedeutung ist: in erster Linie für aufsuchende Arbeit, Opferberatung, zivilgesellschaftliche Stabilisierungen von Gegenstrukturen, Maßnahmen zur Deeskalation und Förderung der Zivilcourage, Aussteigerprogramme (vgl. hierzu im einzelnen die entsprechenden Unterkapitel von Kap. 3.1), aber auch generell für eine sozialraum- und gemeinwesenorientierte Perspektive sozialer und pädagogischer Arbeit. Auch hier empfiehlt es sich, die gender-Perspektive bzw. speziell jungen- und männerforscherische Interpretamente aufzugreifen, weil der enorme maskuline Überhang in der Gruppierung der Produzenten von Angstzonen unübersehbar ist und geschlechtsreflektierende Konzepte davon sicherlich profitieren könnten. Wünschenswert erscheint auch hier, mittels Interviews die Deutungen von VertreterInnen pädagogischer und sozialarbeiterischer Einrichtungen einzuholen, nach den spezifischen professionellen Interventions- und Präventionspotenzialen sowie den Erfahrungen mit ihrer Aktivierung und ggf. auch nach registrierten Wirkungen zu fragen und die Befunde mit den Deutungen der anderen Befragten abzugleichen. Projekt 9 (Helsper/Krüger) spannt sein Untersuchungsfeld unmittelbar in einem pädagogischen Arbeitsgebiet, der Schule nämlich, auf. Es verfolgt in einem mehrfach abgestuften quantitativen und qualitativen Erhebungs-Design im Kern die hier ablaufenden Anerkennungsprozesse und studiert sie in ihrer Beziehung zu Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt bei Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren. Entsprechend sind Befunde zu erwarten, die schulbezogene Konzepte, insbesondere die meist noch eher in Entwicklung befindlichen schulumfassenden Programme, aber auch die Kooperationsbeziehungen von Schule mit Sozialer Arbeit, in erster Linie mit kommunaler Jugendarbeit, betreffen. Sie können mit dieser thematischen Ausrichtung versprechen, Erkenntnisse zu produzieren, die die in diesem Kernbereich der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen bestehenden, nicht unerheblichen Unsicherheiten im adäquaten Umgang mit den genannten Problemen zu reduzieren helfen. Empfehlenswert ist es, durch eine intensive Nutzung der im Antrag angedeuteten Kontrastierungen, die Perspektive weit auch für Integrations- und Anerkennungspotenziale einer "guten Schulkultur" zu öffnen, die sich in der Lage zeigen, Schutzwirkungen gegenüber Gewalt, Ausgrenzungsverhalten und extremistischen Orientierungen zu entfalten. Denn pädagogische Praxis vermag mehr von Verweisen auf positive Mechanismen und Strukturen als von ausschließlich defizitorientierter Forschung zu profitieren. Projekt 10 (Kühnel) analysiert Phänomene von Fremdenfeindlichkeit und ethnische Konflikte im Strafvollzug. Auch dies ist trotz damit zusammenhängender sich deutlich zuspitzender Problematiken im Strafvollzug ein nahezu unbeackertes Forschungsfeld. Entsprechend wird ein qualitatives Anforschungsverfahren gewählt, das problemzentrierte Interviews mit Insassen und Bediensteten vorsieht. Aus sozialarbeitspraktischer Sicht verspricht das Vorhaben vor allem, hilfreiche Erkenntnisse über Ursachen von Fremdenfeindlichkeit und ethnischen Konflikten im Strafvollzug und Ansatzpunkte für Gegensteuerungen zu eruieren. Es kann damit wichtige Grundlagen für die Straffälligenhilfe bieten. Zudem kann es zur Qualifizierung der noch kaum spezifisch auf interethnische Konflikte, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ausgerichteten AntiAggressivitäts-Trainings (vgl. Kap. 3.1.11) dienlich sein und Überlegungen zur Anlage von sport- und erlebnispädagogischen Ansätzen (vgl. Kap. 3.1.8) mit Straftätern zugute kommen. 195 Indem es mit kulturvergleichendem Anspruch Angehörige unterschiedlicher Ethnien einbezieht und Interaktionsdynamiken im Hintergrund der Entstehung bzw. Stabilisierung von Ausgrenzungshaltungen studiert, wird das Vorhaben nicht nur minderheitenfeindliche Orientierungen deutscher Staatsangehöriger, sondern auch Ausgrenzungsverhalten von NichtDeutschen erheben und damit auch Hinweise für den sozialarbeiterischen Umgang mit 'problematischen' Ausländern geben können. Projekt 11 (Soeffner) beschäftigt sich mit den Deutungsmustern und Handlungspraktiken bei interkulturellen Konflikten im Fußballbereich. Es zielt auf die Ermittlung des Spektrums vorhandener Integrations- und Assimilationsformen. Das Projekt bezieht sich konkret auf fünf Milieus des Fußballsports: die Ideologie und Praxis der Integrationspolitik des DFB, ethnisch gemischte Vereine des Profifußballs, eben solche des Amateurfußballs, Vereine in ethnischer Selbstorganisation und Fußballangebote im Rahmen des Schulsports. Dazu werden textliche und audio-visuelle Dokumente, selbst durchgeführte Interviews in Vereinen und im Schulsport sowie ethnographische Beobachtungen ausgewertet. Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Sicht wie aus der Perspektive entsprechender Praxisansätze füllt das Projekt eine breite Lücke im Kenntnisstand über faktische und denkbare Integrationsfunktionen des Sports auf. Wie im Kap. über sportpädagogische Ansätze (vgl. Kap. 3.1.8) näher dargelegt, fehlt es an Wissen darüber, unter welchen Konstellationen Sport tatsächlich, solche ihm vielfach zugeschriebenen positiven Funktionen erfüllen kann. Die zu erwartenden Befunde vermögen deshalb höchstwahrscheinlich Sportverbänden und der Sportpädagogik im allgemeinen, insbesondere aber wohl der Arbeit von Fußballfan-Projekten wichtige Anregungen zu liefern. Bedeutsam erscheint in diesem Zusammenhang auch gerade der Einbezug des Schulsports, so dass durch die Präsenz des Projekts in einem pädagogischen Arbeitsfeld demgemäss praxisnahe Verwertungen der produzierten Erkenntnisse vorgenommen werden können. Projekt 12 (Rippl/Boehnke) untersucht, ob und ggf. inwieweit die Osterweiterung der Europäischen Gemeinschaft als Mobilisierungsschub für Intoleranz, rechte Einstellungen und Diskriminierungstendenzen wirksam werden kann. Angenommen wird, dass die mit der Erweiterung in Teilen der Bevölkerung verbundenen Verunsicherungen und Ängste ein entsprechendes Mobilisierungspotenzial beinhalten. Vermutet wird aber auch, dass positive Einschätzungen vorhanden sind und deshalb auch sie eingeholt werden sollten. Angezielt ist eine international vergleichende, repräsentative Studie mit Deutschland, Tschechien und Polen. Das Vorhaben fokussiert auf eine Thematik und ein Untersuchungsfeld, das auf den ersten Blick eher wenig pädagogisch bzw. sozialarbeiterisch relevante Erkenntnisse erwarten lässt. Dafür scheint es stärker Befunde erheben zu können, die für Fragen der politischen Steuerung von Bedeutung sind. Andererseits liegen deutliche Hinweise aus der pädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis darauf vor, dass Ressentiments und Ausgrenzungsverhalten zunehmend gegenüber Neo-ImmigrantInnen spürbar wird, während bereits lang in Deutschland lebende und 'angepasste' AusländerInnen durchschnittlich eher akzeptiert werden. Vorbehalte betreffen insbesondere Menschen aus Osteuropa. Ausmaß und Zusammenhänge von Bedrohungsgefühlen und Ausgrenzungsbestrebungen näher bestimmen zu können, liegt deshalb im Interesse einer auch auf diese Gruppierungen ausgerichteten interkulturellen Arbeit. Auch die soziale Arbeit mit AussiedlerInnen kann davon profitieren. Projekt 13 (Dollase) thematisiert Islambilder in der multikulturellen Gesellschaft Deutschlands, wählt aber einen Ansatz, der die bei Nicht-Muslimen vorhandenen Bilder vom Islam in einem multilateral bestimmten Netzwerk wechselseitiger Wahrnehmungen im Kontext auch von Bildern des Christentums bei Muslimen verortet und somit auch letztere 196 untersucht. Beabsichtigt ist eine quantitative Studie mit großer Probandenzahl (N = 5000). An der gesellschaftspolitischen, aber auch speziell integrationspolitischen Relevanz des Themas der Studie kann spätestens nach dem 11. September 2001 kein Zweifel bestehen. Aus der Perspektive dieser Expertise ist zu begrüßen, dass es sich um eine Mehrstichprobenuntersuchung handeln wird, die nach Praxisinstitutionen stratifiziert ist. D. h. dass Stichproben gezielt u.a. ErzieherInnen in Tageseinrichtungen für Kinder, Lehrkräfte in Schulen, SchülerInnen, Studierende und Lehrende in Hochschulen sowie SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen einbeziehen. Sie sollen sowohl ihre eigenen religiösen Bilder abgeben, als auch als ExpertInnen für Beobachtungen in ihren jeweiligen Praxisfeldern zu Rate gezogen werden. Damit werden unmittelbar steuerungsrelevante Settings von Pädagogik und Sozialer Arbeit zum Gegenstand gemacht. Zur Erhöhung der Anwendungsrelevanz werden des weiteren bereits bekannte Integrationspotenziale einerseits und Mobilisierungspotenziale für rechtsextremistische Tendenzen andererseits näher zu konkretisieren gesucht. Deshalb wird gezielt nach dem Wissensstand über den Islam bzw. das Christentum, die Ursachen und das Ausmaß der Symbolakzeptanz bzw. Toleranz, Kontaktart und –ausmaß zwischen den Angehörigen der unterschiedlichen Religionen, Gemeinsamkeiten in der Wertestruktur, Faktoren der Salienzminderung und Anerkennungsressourcen gefragt. Diese praxisorientierte Anlage lässt erwarten, mit den erhobenen Daten nicht nur defizitorientiert Fehlentwicklungen benennen, sondern darüber hinaus Ansatzpunkte für positive Weichenstellungen für wechselseitige Anerkennungen bzw. für interreligiösen Toleranzaufbau identifizieren zu können. Neben Empfehlungen für die Gestaltung der Strukturen pädagogischer bzw. sozialarbeiterischer Einrichtungen und Projekte ist zu erwarten, aus den Forschungsresultaten auch weiterführende Anregungen für konkrete pädagogische Konzepte, insbesondere solche des interkulturellen Lernens und der Antidiskriminierungsarbeit (vgl. Kap. 3.1.17) sowie der Toleranzerziehung (vgl. Kap. 3.1.2) beziehen zu können. Projekt 14 (Heitmeyer/Willems) zielt auf eine prototypische Weiterentwicklung der Dunkelfeldstudien zum Bereich der fremdenfeindlichen und interethnischen Gewalt. Sie wird darin gesehen, die bislang quantitativ verfahrende Dunkelfeldforschung methodisch durch eine Kombination von quantitativen und qualitativen Untersuchungsanteilen zu optimieren. Damit wird nicht nur ein innerwissenschaftliches Interesse verfolgt, sondern auch ausdrücklich darauf hingearbeitet, der Dunkelfeldforschung stärkere Anwendungsrelevanz zu verleihen. Das Vorhaben konzentriert sich dafür auf eine Analyse solcher städtischer Sozialräume, in denen die Bevölkerung ethnisch-kulturell heterogen zusammengesetzt ist, weil auf der Grundlage vorliegender Untersuchungsergebnisse davon ausgegangen wird, dass sich gerade in multiethnischen städtischen Problemgebieten Desintegrationserfahrungen häufen, positive gesellschaftliche Anerkennungen ausbleiben und deshalb interethnische Konfliktlagen anwachsen. Im Fokus steht die Altersgruppe der 14- bis 16jährigen. Ergänzt werden Erhebungen bei dieser Probandengruppierung von Gruppendiskussionen mit relevanten Sozialgruppen der ausgewählten Stadtteile, kollektiven Akteuren und potenziellen Opfergruppen sowie von ExpertInnen-Interviews. Das erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftliche wie –praktische Interesse an dieser Studie liegt zum einen in der Erhöhung der Anwendungsrelevanz der bisherigen Dunkelfeldforschung, die in der Tat durch einen Einbezug qualitativer Verfahren erwartet werden kann. Zum anderen ist erfreulich, dass u.a. Lehrkräfte und SozialarbeiterInnen bzw. SozialpädagInnen als StadtteilexpertInnen befragt werden sollen. Wünschenswert wäre es, weitmöglichst nicht nur ihre Beobachtungen und Deutungen zur jeweiligen Konflikt- und Viktimisierungslage bzw. Opfersituation einzuholen, sondern darüber hinaus auch nach Ansätzen, die in den entsprechenden pädagogischen Handlungsbereichen bereits unternommen wurden und nach den Erfahrungen in ihrer Verfolgung zu forschen; dies um die 197 hier liegenden Integrations- und Konfliktbearbeitungspotenziale detaillierter ausloten zu können, ein Anspruch, der einlösbar erscheint, weil mit ihm noch nicht die für die Anlage des Projektes überzogene Erwartungshaltung echter Evaluationsleistungen verbunden ist. Die Projektbeschreibung gibt zu erkennen, dass Untersuchungsergebnisse für sozialräumlich orientierte Pädagogik und Soziale Arbeit, hier insbesondere für die Jugendarbeit, von hoher Relevanz sind. Substanzielle Bereicherungen stehen aber vor allem für pädagogische Konzepte der Opferberatung (vgl. Kap. 3.1.16) sowie des Aufbaus und der Stabilisierung zivilgesellschaftlicher Strukturen im Gemeinwesen (vgl. Kap. 3.1.14) in Aussicht. Projekt 15 (Böttger) stellt eine qualitative Längsschnittstudie mit zwei Erhebungsschnitten (N = 30 1. Welle, N = 20 2. Welle) zur Untersuchung der Erfahrungen von Opfern rechtsextremistischer Gewalt dar. Es geht dabei um die Prozesse des Opferwerdens und der Bewältigung der Viktimisierungserfahrung. Gezielt wird nach verschiedenen CopingStrategien gesucht. Das Projekt nimmt sich eines in Deutschland nahezu gänzlich unerforschten Themenbereichs an, indem spezifisch auf Opfer rechtsextremer Gewalt geblendet wird. Gleichzeitig werden – vor allem angeschoben durch das Civitas-Programm – Stellen für die Beratung solcher Opfer eingerichtet, die dringend weiterer konzeptioneller Fundierung bedürfen (vgl. Kap. 3.1.16). Der Studie ist deswegen schon aufgrund ihrer thematischen Ausrichtung hohe Praxisrelevanz zuzusprechen. Die angestrebte Längsschnittqualität der Daten ermöglicht, der Prozesshaftigkeit der Bewältigungsversuche gerecht zu werden und auch in dieser Hinsicht die Unterstützungsprozesse, die von MitarbeiterInnen solcher Einrichtungen abverlangt werden können, mit hilfreichen Erkenntnissen über Verläufe der individuellen Bearbeitung von rechtsextrem motivierten Straftaten durch die Opfer auszustatten. Die qualitative Methodik birgt gut nutzbare Chancen auf eine praxisnahe Verwendung der erzielten Ergebnisse. Um die Spezifik der Bewältigung rechtsextremer Viktimisierung herauszuarbeiten, wäre allerdings ein Vergleichsdesign ratsam, in das auch die Untersuchung der Bearbeitungsverläufe von Opfern anderer Gewaltstraftaten einbezogen wird. Projekt 16 (Nunner-Winkler) will zur Lösung der Frage beitragen, unter welchen Bedingungen die Anerkennung moralischer Normen vor sich geht. Unterschieden wird zwischen moralischen Wissensbeständen und Anwendungskompetenzen, die durch Inhaltslernen erworben werden als kognitiver Dimension und moralischer Motivation, die durch biographisches Erfahrungslernen aufgebaut wird, als motivationaler Dimension. Untersucht werden die Ausprägungsformen beider Dimensionen, vor allem aber auch die Art und Weisen ihres Zusammenspiels bezogen auf ca. 200 16jährige Jugendliche unterschiedlicher Schulformen mittels eines qualitativen, in erster Linie auf leitfadengestützte Interviews beruhenden Erhebungs- und Auswertungsverfahrens. Forschungsleitende Hypothese ist, dass demokratieabträgliche Orientierungen und Verhaltensweisen nicht hinreichend auf defizitär entwickelte Persönlichkeitsstrukturen zurückzuführen sind. Sie werden vielmehr auch als Ausfluss abweichender normativer Überzeugungen, also auch moralischer Vorstellungen und ihrer Realisierung interpretiert. Der erziehungswissenschaftliche und (sozial)pädagogische Ertrag des Vorhabens deutet sich schon in den erwähnten Vorannahmen an: Näher untersucht werden soll, wie weit jeweils Wissensvermittlung und Erfahrungslernen reichen, d.h. welche demokratieförderlichen und extremismusvermeidenden bzw. –reduzierenden Funktionen ihnen zugesprochen werden kann. Das Projekt bewegt sich damit im Zentrum der erziehungswissenschaftlichen Paradigmendiskussion (s.o.). Das Aufgreifen der Moral-Fragestellung koppelt inhaltlich nicht nur an die vor allem auch außerhalb von Fachkreisen geführte öffentliche Debatte über einen angeblichen Werte- und Moralverlust an, sondern legt auch eine Thematik frei, die in zahlreichen pädagogischen und sozialarbeiterischen Praxiskonzepten – meist verdeckt – 198 präsent ist, etwa in Konzepten der historischen Bildung, der Demokratie- und Toleranzerziehung, der Entfaltung personaler und sozialer Kompetenzen, der Förderung von Zivilcourage, oder der Gestaltung des öffentlichen Klimas, bspw. in Schule und Gemeinwesen. Vor diesem Praxishintergrund kommt der Studie ein besonders hoher Stellenwert zu. Projekt 17 (Möller) analysiert Ein- und Ausstiegsprozesse von Skinheads. Angelegt als qualitativer Längsschnitt über zwei Erhebungszeitpunkte hinweg untersucht es schwerpunktmäßig Einstiegsprozesse in einer Gruppierung von jüngeren, etwa 13- bis 16jährigen Jugendlichen und Ausstiegsprozesse bei Skins im Alter zwischen ca. 20 und 24 Jahren. Ziel ist es, herauszufinden, welche Funktionen Elemente der Skinheadkultur für einen Affinitätsaufbau zu rechtsextremen Orientierungen erfüllen und zu prüfen, unter welchen Bedingungen einschlägige jugendkulturelle Abwendungen erfolgen, Distanzierungen von rechtsextremen Orientierungen vorgenommen und beide Typen von Ablösungsprozessen miteinander in Verbindung gebracht werden. Das Projekt greift mit der Konzentration auf rechtsgerichtete Skinheads inhaltlich eine Thematik auf, die im öffentlichen Bewusstsein immer wieder mit Phänomenen von Rechtsextremismus verbunden wird, ja die sie geradezu metapherartig abzubilden scheint. In krassem Gegensatz zu der Menge der medial verbreiteten Bilder von Skins steht hingegen das Wissen um die Szene. Nahezu ausschließlich ist man auf Einschätzungen der Sicherheitsbehörden, vor allem des Verfassungsschutzes angewiesen. Sie können indes wissenschaftlichen Standards keinesfalls genügen. Fundierte Erkenntnisse sind aber um so notwendiger als aus Sicht der pädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis eine Strategie des 'Rechtsliegenlassens' von Skinjugendlichen nicht angezeigt ist. Statt Ignoranz und Ausgrenzung solcher Jugendlichen aus den Sphäre von Pädagogik und Sozialarbeit sind aufsuchende Strategien zu empfehlen, jedenfalls soweit es sich nicht um organisierte Kader handelt (vgl. dazu Kap. 3.1.7). Zudem ist zu klären, wie in Schule und Jugendhilfe generell mit diesem Klientel adäquat umzugehen ist, welche Potenziale möglicherweise in sport- und erlebnispädagogischen Ansätzen stecken (vgl. Kap. 3.1.8) oder auch verschiedene andere Konzepte, etwa Anti-Aggressivitäts-Trainings (vgl. Kap. 3.1.11) bieten können. Insofern die Prävention von antidemokratischen Gefährdungen von großem Gewicht ist, macht es uneingeschränkt Sinn, im Interesse rechtzeitigen Eingreifens die Einstiegsprozesse der Jüngeren detailliert kennen zu lernen. Die Fokussierung auf Ausstiegsprozesse wird zu erkennen geben, wie positive Weichenstellungen auch durch Pädagogik und Soziale Arbeit mit Skins unmittelbar und in ihrem Umfeld, etwa auch durch Aktivierung zivilgesellschaftlicher Gegenstrukturen (vgl. Kap. 3.1.14), bewirkt werden können. Ferner dürfte sie wichtige Hinweise für die Arbeit mit straffällig gewordenen rechtsextremen und für die Anlage von Aussteigerprogrammen (vgl. 3.1.15) samt ihrer konkreten Durchführung erbringen. 4.3 Fazit Eine resümierende Einschätzung der Anlage des Forschungsverbunds aus einer praxisorientierten Perspektive von Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft ergibt: Der projektierte Forschungsverbund stellt einen in seinem Zuschnitt und seiner absehbaren Durchführung vielversprechenden Versuch zur konzentrierten Bündelung von Erkenntnisfortschritten zum Themenbereich interethnische Konflikte, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt dar. Das Rahmenkonzept entwickelt ein tragfähiges Konzept. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, die zentralen Untersuchungsgegenstände konsequent auf Fragen der politisch-sozialen 199 Desintegration bzw. Integration sowie der Anerkennung resp. ihres Zerfalls zu beziehen. Damit sind gemeinsame Grundfragestellungen markiert, auf die die in den einzelnen Projekten produzierten Ergebnisse aus ihrer jeweiligen Teilthematik heraus antworten können. Mit der zentralen Rolle der Desintegrations-/Integrationsdynamik als inhaltlicher Brücke, ja als gemeinsamem Band zwischen den Projekten wird ein Referenzpunkt in den Mittelpunkt gerückt, der nicht nur nach dem bisherigen empirischen und theoretischen Forschungsstand beanspruchen kann, die wesentlichen Verursachungsmomente der zu untersuchenden Problematiken zu markieren. Er liegt vor allem auch im Zentrum erziehungsbzw. sozialarbeitswissenschaftlichen Interesses und pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxis. Anerkennungserwerb und Problemlagen der Sozialintegration bilden geradezu die Kernsubstanz ihrer Arbeit, zumal im Kontext der Bearbeitung von Rechtsextremismus, Minderheitenfeindlichkeit und Gewalt. Das Konzept bindet Makro-, Meso- und Mikroanalysen zusammen. Es löst damit ein Desiderat der Praxis pädagogischer und Sozialer Arbeit ein, das darin besteht, die eher in gesellschaftlichen Mikro- und Mesobereichen verorteten eigenen Zuständigkeiten nicht isoliert von gesamtgesellschaftlichen Prozessen zu betrachten und sich nicht mit der Erwartung konfrontiert sehen zu wollen, unmittelbar, kurzfristig, punktuell, ortsgebunden und in Feuerwehrfunktion 'Lösungen' für Probleme bewerkstelligen zu sollen, deren Ursachen größtenteils außerhalb des alltäglichen professionellen Handlungsbereichs zu suchen sind. Pädagogische und Soziale Arbeit sind auf politische Rahmenbedingungen angewiesen, die ein ursachenbezogenes und effektives Arbeiten ermöglichen müssen. Insofern ist gerade die integrierende Verbindung von mikro-, meso- und makrotheoretischen Sichtweisen von hohem Interesse. Dies gilt auch gerade für die hier in Rede stehenden Problem- und Konfliktlagen. Pädagogik und Soziale Arbeit können wichtige, ja entscheidende Beiträge zu ihrer Beseitigung bzw. Reduktion leisten. Dennoch: Ihre Arme sind zu kurz, um sozialstrukturelle Weichenstellungen vornehmen zu können, ohne die die eigenen Anstrengungen Symptomkur bleiben. Deshalb erweist sich auch ratsam, neben langfristigen Strukturproblemen institutionelle und sozialräumliche Gelegenheitsstrukturen sowie Mobilisierungspotenziale, sowohl innerhalb der Bevölkerung insgesamt, als auch hinsichtlich ausgewählter Deutungs-, Kontroll- und Mobilisierungsakteure, anzuzielen, wie dies das Konzept vorsieht. Beispielsweise stellt die außerschulische Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen immer wieder fest, dass sie nur vernetzt mit Aktivitäten Sinn macht, die auch andere AdressatInnen (z. B. Erwachsene) einbezieht bzw. von anderen Institutionen (z.B. von Schule und in Kooperation mit ihr) betrieben wird: Solange sich in Schule, im Elternhaus und im Sozialraum insgesamt keine Änderungen einstellen und von Jugendlichen medial wie im unmittelbaren Nahraum ein politisches Klima wahrgenommen werden kann, das Gewalt und Ausgrenzungsverhalten begünstigt oder ihm wenigstens nicht oder kaum entgegentritt, fehlt Jugendarbeit die Unterstützung. Daher ist es wichtig, dass Möglichkeiten ausgelotet werden, wie eine Kultur der Gewaltfreiheit und des demokratischen Interessenausgleichs in den Institutionen und über zivilgesellschaftliche Initiativen generell aufgebaut und stabilisiert werden kann. Ansätze zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen, wie sie seit kurzem verstärkt verfolgt werden, und anderweitige Konzepte, die auf die 'Mitte der Gesellschaft' zielen, benötigen entsprechende Hinweise aus der Forschung. Das Rahmenkonzept legt auf den Ausweis von Anwendungsrelevanz Wert. Erziehungs- und Sozialarbeitswissenschaft sind stark anwendungsorientierte Disziplinen. Aus ihrem Blickwinkel ist deshalb dieses Bemühen erfreulich. Es erhält zusätzliche Bekräftigung durch den oben dargestellten Stand der politischen Programme und der (sozial)pädagogischen/arbeiterischen Konzeptentwicklung, bei denen fehlende Anbindungen an den wissenschaftlichen Diskurs offensichtlich sind. Die Theorie-Praxis-Kommunikation zu verbessern, ist deswegen ein dringliches Desiderat. Die vorgesehenen PraktikerInnen200 Workshops sind deshalb zu begrüßen. Allerdings ist zu bedenken, ob sie ausreichen. Empfehlenswert erscheint die Einrichtung eines Theorie-Praxis-Zirkels, der die Anwendungsrelevanz des Projektverbundes durch seine kontinuierliche kritische Begleitung sicherstellen könnte. Er sollte sich aus Mitgliedern des Verbundes und interessierten PraktikerInnen zusammensetzen, wobei die Überlegung zu verfolgen wäre, ob nicht für die Zusammenarbeit von Verbundforschung und pädagogischer bzw. sozialarbeiterischer Praxis ein eigener Kreis von Interessierten etabliert werden sollte. Dabei sind jedoch auch die begrenzten Zeitkapazitäten der im Verbund tätigen WissenschaftlerInnen zu berücksichtigen. Die einzelnen Projekte thematisieren Untersuchungsgegenstände, die deutlich entweder Leerstellen des Wissensbestandes zu verringern bzw. zu verkleinern gestatten (unverkennbar z. B. Ein- und Ausstiegsprozesse von Skinheads oder ethnische Konflikte im Strafvollzug) oder sind auf Themen bezogen, die absehbar neue Konfliktlagen in den Blick nehmen (etwa EU-Osterweiterung, Islambilder). Sie produzieren Wissen, das gerade auch die vom Programm "Jugend für Demokratie und Toleranz" vorgenommen Akzentsetzungen mit bedeutsamen Hintergrundinformationen ausstattet. Die methodischen Anlagen lassen Ergebnisse von praxisorientiertem Gehalt erwarten. In keinem Projekt dominiert ein innerwissenschaftliches Interesse. Der direkte oder indirekte Bezug auf Praxisfelder, in den PädagogInnen und SozialarbeiterInnen tätig sind, gewährleistet die Produktion von solchen Erkenntnissen, die in einer Weise praxisverwertbar sind, die keine sonderlich großen zusätzlichen Transferleistungen erforderlich macht. Dazu tragen auch die vielfältigen Komplementaritäten bei, die bei den Projekten untereinander bestehen und die unbedingt genutzt werden sollten. Die Anlage des Verbunds ist auch in dieser Hinsicht anspruchsvoll. Sie stellt u.a. wechselseitige Deutungsanschlüsse in Aussicht, die ansonsten nicht möglich wären, verlangt aber den MitarbeiterInnen auch Leistungen ab, die bei Einzelförderungen nicht anfallen und die Arbeitskapazitäten nicht unerheblich strapazieren. Gleichwohl könnten manche Projekte durch eine Erweiterung von Fragestellungen an Praxisorientierung gewinnen (s.o.). Von den zu diesem Zeitpunkt konzipierten Projekten des Verbundes oder zumindest einem Teil von ihnen Evaluationsforschung zu verlangen, hieße, das Gesamtkonzept misszuverstehen, die einzelnen Projekte zu überfrachten oder bis zur Unkenntlichkeit zu modifizieren und damit das ganze Vorhaben aus den Angeln zu heben. Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Sicht kann daran keinerlei Interesse bestehen, weil die Studien – wie erwähnt – auf klar erkennbare Forschungslücken fokussieren, in ihrem kooperativen Kontext wichtige wissenschaftliche Fortschritte bringen werden und/oder neuartige Konfliktlagen untersuchen. Dennoch ist der Stand der wissenschaftlichen Evaluation von pädagogisch und sozialarbeiterisch akzentuierten Programmen und Konzepten der Verhinderung und Reduktion von Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit so stark unterentwickelt18, dass sich eine Ergänzung der Untersuchungsperspektive des Verbundes geradezu aufdrängt. Zu entscheiden gilt, ob sie durch eine Erweiterung des Konzepts im Rahmen des Verbundes oder in engem Anschluss, etwa in Form eines zeitversetzt parallel arbeitenden Evaluationsforschungsverbunds erfolgen soll und kann. In jedem Fall erscheint es sinnvoll, in enger Anbindung an oder Einbindung in den Forschungsverbund die mit dieser Expertise begonnene Bilanzierung von Programmentwicklung, Konzepten und ihrem jeweiligen Evaluationsstand in geeigneter Weise fortzuschreiben, um zum einen eine kontinuierliche Übersicht zu gewährleisten und 18 Aufgrund von Einzelhinweisen stark zu vermuten, wenn auch hier nicht im strengen Sinne zu belegen, ist, dass der Stand der Evaluation anderweitiger, hier nicht eingehend untersuchter Maßnahmen der Gewalt- und Extremismusbekämpfung (etwa der von Polizei und Verfassungsschutz verantworteten) nicht weiter entwickelt ist, so dass hier ähnliche Kenntnislücken aufzufüllen sind. 201 zum anderen auch - noch stärker als es im Rahmen dieser Arbeit möglich war - systematisch internationale Evaluationserfahrungen mit einzubeziehen. 5. Zusammenfassung Ziehen wir eine auf zehn Punkte begrenzte Gesamtbilanz der im Voranstehenden angestellten Analysen, so ist resümierend zunächst für die Anlage von politischen Programmen mit pädagogischer und sozialarbeiterischer Ausrichtung (vgl. im folgenden die Punkte 1. – 5.), dann für die in verschiedenen Handlungsfeldern verfolgten pädagogischen und sozialarbeiterischen Konzepte samt ihrer fachdiskursiven Grundlegungen und Anstöße (vgl. die folgenden Punkte 6.-8.) sowie schließlich für die Bedeutung des Forschungsverbundes vor dem damit skizzierten Hintergrund, aber auch an Schlussfolgerungen (Punkte Nummer 9.-10.) festzuhalten: 1. Die in Deutschland politisch Verantwortlichen zeigen sich bis auf einige Ausnahmen insgesamt betrachtet weder gleichgültig noch untätig im Hinblick auf die Problematiken von Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt sowie hinsichtlich der in ihrem Hintergrund stehenden Integrations-/Desintegrationsdynamiken, insbesondere in Gestalt von ethnisch-kulturellen Konfliktlagen. Die Ein- und Ansicht, dass es sich hierbei nicht um gesellschaftlich marginale Probleme handelt, ist zwar unter ihnen nicht uneingeschränkt und bruchlos verbreitet, jedoch nimmt offenbar das Wissen um die Notwendigkeit und Unausweichlichkeit der Konzipierung von mehr als punktuellen Gegenmaßnahmen zu. Dies gilt mindestens soweit, wie entsprechende öffentliche Erklärungen als Belege dafür interpretiert werden und die Kritik an dem Umstand zurückgestellt wird, dass diese Bekundungen in vielen Fällen erst durch medial verbreitete Gewaltvorkommnisse, sonstige Anlässe und Skandalisierungen hervorgerufen werden. 2. Auch jenseits von Verlautbarungspolitik, moralischen Appellen und Resolutionsrhetorik zeigt sich eine in den 90er Jahren gewachsene Bereitschaft, politische Steuerungen vorzunehmen, die Gewaltförmigkeiten und antidemokratische Umtriebe zu unterbinden beabsichtigen. Dabei gewinnt die Überzeugung an Boden, nicht allein auf repressive Maßnahmen vertrauen zu können, sondern auch weiter ausgreifend sowohl Erziehung und Bildung zu intensivieren als auch noch genereller für die Gestaltung einer gewaltfreien und demokratische Formen des Interessenausgleichs pflegenden Sozialität einzutreten. Die in den 90er Jahren aufgelegten Bundesprogramme stehen für diese Sichtweise; dies auch dann, wenn – besonders deutlich für AgAG - die Vermutung nicht von der Hand zu weisen ist, mit ihnen teilweise zusätzlich auch das eher themenunspezifische Interesse am Aufbau von Sozialarbeitsstrukturen in den neuen Ländern verfolgen zu wollen. Die Existenz von Landesprogrammen bzw. –aktivitäten dokumentiert, dass keine Verleugnungsstrategie verfolgt wird. 3. Das schlichte Vorhandensein von Ansätzen der politischen Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt beweist freilich noch nicht, dass die politische 'Hilflosigkeit des Antifaschismus' überwunden oder die Fassungs- und Ratlosigkeit angesichts bestimmter Gewaltexzesse verschwunden wäre. Und auch die Höhe der Mittel, die unter entsprechenden Haushaltstiteln verausgabt werden, sagt wenig über die Rationalität der damit vorgenommenen oder zumindest intendierten politischen Steuerungen aus. Unterstellungen, bei entsprechenden Aktionen und Programmen handele es sich um nicht mehr als Geschäftigkeit vorschützenden Aktionismus und symbolische Politik, sind von Seiten politischer VertreterInnen solange kaum mit gegenteiligen 202 Beteuerungen bei Seite zu drängen, wie nicht ausweisbar ist, dass die politischen Konzepte, für die man sich entschieden hat, wohl begründet sind und – besser noch – mit hoher Erfolgsaussicht auch greifen werden. 4. Eine kritische Analyse des aktuellen Bundesprogramms und der in den einzelnen Ländern verfolgten politischen Handlungskonzepte kann einerseits eine erfreuliche Anzahl und Breite von Aktivitäten registrieren. Sie lässt hervortreten, dass die Problematiken von Gewalt und Extremismus und Aspekte ihrer Gefährdungslagen durchaus ernst genommen werden, wenn auch eine Ankoppelung einschlägiger politischer Initiativen und Fördermaßnahmen an die Konjunkturen der medialen Debatte unübersehbar und damit die erforderliche Gründlichkeit der politischen Auseinandersetzung wieder in Frage gestellt ist. Andererseits fallen die Reaktionen in ihrer Quantität und Intensität bei unterschiedlichen Regierungskoalitionen und von Land zu Land recht unterschiedlich aus, so dass weder der Stellenwert der zu Grunde liegenden gesellschaftlichen Konflikte noch die Dringlichkeit und Tiefe ihrer Bearbeitungsformen einheitlich eingeschätzt werden. Die Differenzen können nicht nur auf unterschiedliche weltanschauliche Orientierungen und politische Grundauffassungen der jeweiligen (Regierungs-)Verantwortlichen zurückgeführt werden. Sie sind auch das Resultat eines ungeklärten Stellenwerts wissenschaftlicher Beratung von Politik. 5. Die bei aller demonstrativen Absetzung von (rechts)extremistischen Politikformen und Organisationen in der etablierten Politik verbreiteten unterschiedlichen Einschätzungen und Bekämpfungsweisen resultieren offenbar nicht zuletzt auch aus einer noch unzureichenden Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Herangehensweisen bei der politischen Analyse und Planung von Gegenmaßnahmen. Die vorliegenden politischen Programme und Förderkonzepte bedienen zwar durchaus relevante Handlungsfelder und vermögen theoretisch erfolgversprechende Konzepte zu stützen, blenden aber a) wichtige Handlungsfelder weitgehend aus und bleiben b) bislang in ihrer Bezugnahme auf Evaluation höchst defizitär. So geraten etwa durch die Akzentuierung des Xenos-Progamms auf Felder von Arbeit und Berufsausbildung Arbeitsfelder wie Kindertageseinrichtungen, Schulen oder auch die Eltern – und allgemeine Erwachsenenbildung aus dem Blick, ein Umstand, der den empirisch festzustellenden Gefährdungslagen im Sozialisationsprozess nicht gerecht wird. Wo – wie in Teil 2 des Bundesprogramms "Jugend für Toleranz und Demokratie" - auf Jugendarbeit bezug genommen wird, werden Unterstützungen für das Aufsuchen 'rechter' und gewaltorientierter Problemträger vermisst. Das Civitas-Programm bleibt bisher auf die ostdeutschen Länder beschränkt, obwohl ähnliche Bedarfe (z. B. Beratung kommunaler Akteure) wie hier auch in den Ländern der alten Bundesrepublik vorhanden sind. (Weiter-)Qualifizierungen von Programm-MitarbeiterInnen wie darüber hinaus für MultiplikatorInnen (z.B. in Sportclubs und sonstigen Vereinen) bleiben unterentwickelt. Neben solchen Lücken ist auf zwei weitere kritische Punkte hinzuweisen: Fast nirgendwo können durch die geförderten Angebote die tatsächlichen Bedarfslagen gedeckt werden (Beispiel: Streitschlichterprogramme in Schulen). Und: Es droht eine Verprojektierung pädagogischer und Sozialer Arbeit - besonders gravierend im Bereich von Jugendarbeit, aber auch darüber hinaus -, die die Relevanz der Regelförderung für die langfristige und auf Kontinuität und vorausschauende Prävention hin angelegte Stabilisierung der Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen und des Sozialen überhaupt zu verkennen droht. Aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlicher Perspektive sind solche Tendenzen eindeutig kontraproduktiv. Evaluationswissen erfährt auf zweierlei Weise zu wenig Berücksichtigung: Zum ersten können sich – mangels vorliegender wissenschaftlicher Erkenntnisse - die inhaltlichen 203 Förderkriterien kaum an Evaluationsbefunden ausrichten. Zum zweiten sind zwar wenigstens bei den Bundes(teil)programmen – Evaluationen der Gesamtprogramme vorgesehen, kämpfen sie aber mit erheblichen Startschwierigkeiten, die dazu führen werden, dass ihre Reichweite erheblich eingeschränkt werden wird, weil sie nicht mehr den gesamten Zeitraum der Laufzeit abdecken können. Außerdem sehen die Antragsrichtlinien die Evaluation von Einzelmaßnahmen nicht als deutliche Empfehlung oder gar als Regel vor, so dass nur ein geringer Anteil von Maßnahmen evaluiert wird. Ein wesentliches Manko, das diese Kritik hervorrufen kann, ist in der Unterschätzung und mangelhaften Förderung von Evaluationsforschung insgesamt zu sehen. 6. Das Spektrum pädagogischer und sozialarbeiterischer Praxiskonzepte lässt hinsichtlich seiner Breite wenig zu wünschen übrig. Es enthält neben eher traditionellen Anknüpfungen eine Fülle von teilweise recht phantasievollen und experimentellen Innovationen. Sie impliziert eine kaum noch zu überblickende Vielfalt von einzelnen Maßnahmen und Projekten. Vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, hier allerdings mit deutlicher Gewichtung auf Jugendarbeit, haben sich – zumeist ausgehend von schon vorhandenen institutionellen und professionellen Vorkenntnissen im Umgang mit bestimmten Zielgruppen, didaktischen Herangehensweisen, Methoden, Instrumentarien und Medien – Ansätze entwickelt, die offensichtlich fast alle gut angenommen werden. Hier zeigen sich nicht nur paradigmatische Verschiebungen von der Wissensvermittlung in Richtung auf Erfahrungslernen und Aneignung sowie vom Hilfe-Ethos in Richtung auf den Gestaltungsdiskurs, sondern auch strategische Umorientierungen weg von kognitivistisch verengten Konzepten zu Gunsten von ganzheitlichen Settings, Qualifizierungen personaler und sozialer Kompetenzen, Vermittlungen funktionaler Äquivalente, infrastruktureller Arbeit, politischer Einmischung, Sozialraumorientierung, Milieubildung, Netzwerkarbeit und Partizipationsförderung. Lebenswelt-, Teilnehmer-, Ressourcen- und Handlungsorientierung gewinnen an Bedeutung. Inzwischen obsolet gewordene Zentrierungen auf klassische Formate pädagogischer und Sozialer Arbeit werden durch Formatierungen abgelöst, die weitgehend ein selbstgesteuertes Lernen ermöglichen, Aktionsorientierung beinhalten und u.a. Elemente von Recherche, Produktion und Strukturverbesserung beinhalten. Ihnen folgen Designs, die Muster der Informationsvermittlung etwa durch projekt- und workshopförmige Angebote ablösen. Mehr noch: Es scheint, als habe in den vergangenen Jahren gerade der pädagogische und sozialarbeiterische Umgang mit dem Gewalt- und Extremismusproblem solche paradigmatischen, strategischen und operativen Umsteuerungen nicht bloß reflektiert, sondern selbst nicht unwesentlich mitbewirkt. Auf der anderen Seite verbleiben zahlreiche Initiativen, Maßnahmen, Projekte und Aktionen punktuell. Dies betrifft in erster Linie auch ihre zeitliche Dimensionierung. Kontinuierliche und langfristig angelegte thematische Zuwendungen und Abarbeitungen oder gar strukturell-institutionelle Justierungen auf die Bearbeitung von Gewalt und die Entwicklung von Integrations- und Demokratiepotenzialen sind keineswegs gang und gäbe. Sie wiederum sind unverzichtbar, weil politisch-soziale Desintegration, Gewaltorientierungen und politische Haltungen bekanntlich nicht 'von heut auf morgen' entstehen, sondern auf strukturellen Gegebenheiten im Zusammenspiel mit in bestimmter Weise aufgeschichteten Sozialisationserfahrungen beruhen. Folgerichtig lassen sich nachhaltige Effekte nicht von Einmal- bzw. Kurzfrist-Aktionen erwarten. Ebenso wenig sind sie realistischerweise von isoliert bleibenden Aktivitäten einzelner Träger oder einzelner Handlungsfelder zu erhoffen, so dass ihre Effektivität auch entscheidend von ihrer gegenseitigen Öffnung füreinander und ihrer Vernetzung abhängt. 204 7. Trotz der genannten Innovationen haben sich die von ihnen implizierten Tendenzen längst nicht in allen pädagogischen und sozialarbeiterischen Feldern mit gleicher Kraft durchgesetzt. Kindertageseinrichtungen werden noch wenig in pädagogische Konzepte der Demokratieschulung und der Anerkennungspädagogik einbezogen, Schulisches Lernen folgt alles in allem noch stark überkommenen Mustern. Weiterhin dominiert das Unterricht(ung)sprinzip, der 45-Minuten-Takt wird allenfalls einmal anlässlich von Projektwochen und ähnlichen Sonderveranstaltungen aufgelöst, Kooperationen mit anderen Trägern und fachlichen Kompetenzen (z.B. denen von Sozialarbeit) und Öffnungen zum Gemeinwesen gehören noch längst nicht zum Standard der Alltagsarbeit. Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Extremismus und interethnische Konflikte kommen zumeist allenfalls als Unterricht(ungs)thema vor, ihre lebensweltlichen Dimensionen bleiben in dem Maße außen vor, wie auch insgesamt Schule und Lebenswelt von Schülern und Schülerinnen – nicht nur in deren Einschätzungen - voneinander abgeschottete Bereiche bleiben. Ansätze wie Mediation und Streitschlichtung, Schulsozialarbeit, Qualifizierung personaler und sozialer Kompetenzen und Schulentwicklungsprogramme gehören noch längst nicht zur Regelpädagogik. In der Eltern-, Familien- und allgemeinen Erwachsenenbildung hat sich insgesamt wenig getan, obwohl zum Teil und längst nicht überall vor allem Trainings- und Begegnungsformate neben solche der Unterrichtung getreten sind. Die zentrale Bedeutung, die diesen Feldern in Hinsicht auf die familiale Sozialisation, aber auch in Hinsicht auf Deutungs- und Mobilisierungspotenziale in der Bevölkerung und von MultiplikatorInnen zukommt, dokumentiert sich in ihnen viel zu schwach. Aufsuchende, gemeinwesenorientierte und mobile Strategien werden schmerzlich vermisst. In allen Handlungsfeldern wird zwar die Relevanz geschlechtsreflektierenden Arbeitens inzwischen mehr oder minder durchgängig bekundet, konkrete Konsequenzen werden aber gerade für das in Hinsicht auf Gewaltphänomene und extremistische Bestrebungen besonders belastete männliche Klientel in verschwindend geringem Ausmaß gezogen. An dieser Stelle zeigen sich 'blinde Flecken', die der empirisch deutlich hervortretenden Gefährdungslage von Jungen und Männern nicht im geringsten entsprechen. 8. Die in Kap. 3.1. im einzelnen dargelegten Praxiskonzepte werden von den sie tragenden MitarbeiterInnen und Institutionen durchweg als erfolgreich bzw. erfolgversprechend eingeschätzt. Eine genauere Analyse erweist zwar nicht gegenteilige Wirkungen, entlarvt die Kriterien solcher Bewertungen aber als extrem 'weich' bzw. oberflächlich – ählich im übrigen wie die Grundlagen bisheriger "best-" und "good-practice"-Einstufungen. Validität könnte ihnen zugesprochen werden, wenn die Konzepte a) ihren Anschluss an wissenschaftlich-theoretische Einsichten nachweisen könnten, b) in adäquater Reaktion auf empirische Befunde entwickelt würden und c) wissenschaftlichen Standards genügende Evaluationen vorweisen könnten. Allerdings sind derartige Bezugnahmen selten, erfolgen – wenn überhaupt – meist implizit, punktuell und zu Zwecken nachträglicher Legitimation, wirken wenig stringent und sind vor allem von einem eklatanten Defizit an Evaluationserkenntnissen gekennzeichnet. Das letztgenannte betrifft sowohl den Rekurs auf Ergebnisse, die der eigenen Konzeptionsentwicklung vorgängig sind, als auch wissenschaftlich tragfähige Auswertungen der jeweiligen Konzeptionen selbst. Das Manko ist auch eine Folge vernachlässigter Qualitätsentwicklungsprozesse in den Projekten und Einrichtungen. Diese Schwachstelle wiederum ist nicht allein auf ein in dieser Hinsicht unterentwickeltes Professionsverständnis oder unzureichende Kompetenzen der Selbstevaluation zurückzuführen, sondern stellt auch eine Konsequenz von unzureichender Ressourcenausstattung und fehlenden förderungspolitischen Empfehlungen bzw. Vorgaben dar. 205 9. Der Forschungsverbund "Integrationspotenziale" ist nicht geeignet, die angemahnten Evaluationsdefizite zu beseitigen. Dies ist weder sein Anspruch noch kann ein derartiges Unterfangen bei seiner Anlage erwartet werden. Der Verbund verspricht aber, die ursachenanalytische Basierung von praktischen Handlungskonzepten zu verbessern. Er stößt in deutliche Wissenslücken vor, die abzubauen für zahlreiche Praxisfelder (z.B. Arbeit mit Opfern, Strafgefangenen, Skinheads, arbeitsmarktbezogene Projekte) von großer Wichtigkeit ist, um empirisch fundierte, rationale Gegenstrategien zu planen und Konzepte theoriegestützt auszulegen. Schließlich kann er auch als Beitrag dazu verstanden werden, die zumal aus erziehungs- und sozialarbeitswissenschaftlichem Blickwinkel zu postulierenden Theorie-Praxis-Transfers anzugehen. Praxisanregungen werden von ihm um so mehr ausgehen, wie die einzelnen Studien des Projektes ihre Fragestellungen auch in Hinsicht auf Anwendungsrelevanz schärfen und das Rahmenkonzept die Intention umsetzt, über Theorie-Praxis-Kooperationen wechselseitige Anstöße zu bewirken. 10. Um die pädagogische und sozialarbeiterische Praxis des Umgangs mit Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und ethnisch-kulturellen Konflikten weiter zu qualifizieren und auch den Forschungsverbund in den Kontext solcher Qualifizierungen einzubinden, ist zu empfehlen, Praxis, Forschungsverbund und Evaluationsforschung eng miteinander zu verknüpfen. Damit konkrete Ansätze pädagogischer und Sozialer Arbeit stärker auf theoretische und empirische Erkenntnisse - sowohl ursachenanalytischer als auch evaluativer Provenienz - Bezug nehmen können und umgekehrt wissenschaftliche Untersuchungen mehr von Hinweisen aus der Praxis profitieren können, bietet sich in einem ersten Schritt an, innerhalb des Verbundes oder eng an ihn angelagert eine Art von 'Beobachtungsstelle' einzurichten (in gewisser Weise ähnlicher den nationalen Beobachtungsstellen für Rassismus). Ihr kämen im wesentlichen drei Aufgaben zu: den mit dieser Expertise begonnenen Überblick über pädagogische und sozialarbeiterische Praxiskonzepte fortzuschreiben, weiter zu systematisieren und stärker auch auf internationale Erfahrungen hin auszudehnen, den ebenfalls mit dieser Expertise gelieferten ersten Überblick über den Stand von Evaluation kontinuierlich auf dem laufenden zu halten und auch hier verstärkt internationale Ansätze (z.B. aus den USA, aber auch anderen europäischen Ländern) zu sichten sowie Ansätze für Evaluationsforschung zum Themenbereich zu entwickeln bzw. vorhandene Überlegungen und erste Erfahrungen systematisch aufzugreifen und dabei auch insbesondere die methodische Diskussion voranzutreiben, die in Deutschland gerade in den letzten Monaten – nicht zuletzt über Evaluationsvorhaben im Rahmen von Xenos, Civitas und anderen Kontexten – verstärkt in Gang gekommen ist; dies vorrangig auf der Ebene der Evaluation von politischen Programme, auf der Ebene der Evaluation von Einzelprojekten, ggf. auch Institutionen, und auf der Ebene von Einzelmaßnahmen. Eine solche Stelle könnte auch über ihren Bezug zum Forschungsverbund hinaus Scharnierfunktion innerhalb des themenspezifischen Theorie-Praxis-Verhältnisses einnehmen, insoweit sie in die Lage versetzt würde, Aufgaben im Bereich der Organisation von Kooperation, Vernetzung und Austausch (Theorie-Praxis-Workshops etc.) sowie der Fortbildung (z.B. (Selbst-)Evaluations-Workshops für PraktikerInnen) zu übernehmen. Sie wäre u.U. auch in ein noch zu entwickelndes Fortbildungskonzept für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Projekten des Bundes (vor allem Xenos, Entimon, Civitas) einbeziehbar. 206 Summa summarum: Pädagogik und Soziale Arbeit stehen im Umgang mit Problemen wie Diskriminierung, Gewalt, Ausgrenzungsorientierungen, Extremismus und Erfahrungen von sozialer und politischer Desintegration sowie Anerkennungszerfall keineswegs auf verlorenem Posten. Sie können keine Patentrezepte bieten, beinhalten aber exklusive Chancen für Zugriffe auf Potenziale, die individuell und sozial destruktiven Folgen solcher Problemlagen und Prozesse entgegenarbeiten können. Die zukünftige Sicherung einer humanen Republik ist fundamental darauf angewiesen, diese Potenziale zu identifizieren und zu stärken. Dafür ist eine Absicherung und Qualifizierung pädagogischer und Sozialer Arbeit vonnöten. Dies wiederum setzt eine praxisorientierte und anwendungsbezogene Forschung voraus, durch die zum einen bestehende Leerstellen im vorhandenen Wissen um Ursachen von Affinitätsaufbau zu wie von Distanzierung von Gewalt und extremistischen Orientierungen geschlossen werden und zum anderen erheblich zu steigernde Anstrengungen unternommen werden müssen, die Qualität, Leistung und Wirksamkeit pädagogischer und Sozialer Arbeit wissenschaftlich einzuholen und zu optimieren. 6. Literatur ABAD (Anlaufstelle für Betroffene von rechtsextremen und rassistischen Angriffen und Diskriminierungen) Thüringen e.V.: Konzept. o.O. o.J. (Gera und Erfurt 2001) Abell, P.: Die Evaluation von Anti-Diskriminierungs-Trainingsmaßnahmen in den Niederlanden. In: Landeszentrum für Zuwanderung NRW (Hg.): Interkulturelle und antirassistische Trainings – aber wie? Konzepte, Qualitätskriterien und Evaluationsmöglichkeiten. Solingen 2001, 35-40 Abgeordnetenhaus von Berlin Drucksache 14/700 Abgeordnetenhaus von Berlin Drucksache 14/1457 Aboud, F.E./Fenwick, V.: Exploring and evaluating school based interventions to reduce prejudice. In: Journal of Social Issues 55, 1999, 767-786 Adorno, T.W. u.a.: Der autoritäre Charakter. Studien über Autorität und Vorurteil. Amsterdam 1968 Adorno, T.W. u.a.: The Authoritan Personality. Studies in Prejudice. New York 1969 (Orig. 1950) Adorno, T.W.: Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt/M. 1973 AEA – American Evaluation Association, Task Force on Guiding Principles for Evaluators: Guiding principles for evaluators. In: Shadish, W.W. e.a. (Eds.): Guiding Principles for Evaluators. San Francisco 1995 Aertsen, I.: Mediation bei schweren Straftaten – auf dem Weg zu einer neuen Rechtskultur. In: Pelikan, Chr. (Hg.): Mediationsverfahren. Horizonte, Grenzen, Einsichten. Baden-Baden 1999 (Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie), 115-138 AGAG-Informationsdienst 2/1993 Ahlheim, K./Heger, B.: Der unbequeme Fremde. Fremdenfeindlichkeit in Deutschland – empirische Befunde. Schwalbach/Ts. 2000 Ahlheim, K./Heger, B.: Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit. Handreichungen für die politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1999 Ahlheim, K./Heger, B./Kuchinke, Th.: Argumente gegen den Hass. 2 Bde. Bonn (Bundeszentrale für politische Bildung) 1993 Akin, T.: Selbstvertrauen und soziale Kompetenz: Übungen, Aktivitäten und Spiele für Kids ab 10. Mühheim 2000 Aktionshandbuch gegen Rassismus. Für eine BürgerInnen- und Menschenrechtsbewegung in Deutschland. Köln 1993 Allport, G. W.: The nature of prejudice. Reading 1954 207 Altemeyer, B.: Reducing prejudice in right-wing authoritarians. In: Zanna, M.P./Olson, J.M. (Eds.): The psychology of prejudice: The Ontario symposium, Vol. 7. Hillsdale NJ. 1994, 131-148 Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen u.a. (Hg.): Gewalt löst keine Probleme. Villigster Trainingshandbuch zur Deeskalation von Gewalt und Rassismus. Schwerte 2000 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 180: Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 303: Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.(Hg.): Präventive Projekte und Initiativen gegen Rechts. Bonn 2001 Arbeitsgruppe für empirische Bildungsforschung e.V./Museumsverband Baden-Württemberg e.V.: Museumspädagogischer Modellversuch an 22 Museen in Baden-Württemberg (www.people.freenet.de/afeb/fremd.html) Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.: Halt! Keine Gewalt. Wiesbaden o.J. Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.: basta. Nein zur Gewalt. Heft 94/95 (mit pädagogischer Handreichung). Wiesbaden 1994 Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.: basta. Nein zur Gewalt. Heft 98/99. Wiesbaden o.J. Arnold, R.: Natur als Vorbild. Frankfurt 1993 Arnold, R.: Vom "autodidactic turn" zum "facilitative turn" – Weiterbildung auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. In: Arnold, R./Giesecke, W. (Hg.): Die Weiterbildungsgesellschaft. Bd. 1: Bildungstheoretische Grundlagen und Analysen. Neuwied/Kriftel 1999, 3-10 Arnold, R./Siebert, H.: Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Hohengehren 1995 Arlt, B.: Von der Bedeutung politischer Bildungsangebote für die nachfolgenden Generationen. In: punktum. 20 Jahre Alternative Stadtrundfahrten. Hamburg o.J. (1998), 8/9 Aßauer, M./Hanewinkel, R.: Lebenskompetenztraining für Erst- und Zweitklässler: Ergebnisse einer Interventionsstudie. In: Kindheit und Entwicklung, 9, 2000, 253-263 Attia, I.: Antirassistisch oder interkulturell? Sozialwissenschaftliche Handlungskonzepte im Kontext von Migration, Kultur und Rassismus. In: IDA (Hg.): Trainings. Interkulturelle Methoden. Antirassistische Ansätze. Konfliktlösungsstrategien. Düsseldorf 2000, 5-8 Auernheimer, G.: Grundmotive und Arbeitsfelder interkultureller Bildung und Erziehung. In: Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfe für die politische Bildung. Bonn 2000, 18-28 AUS: Aktion Humane Schule: Baustein-Info-Blätter – Wir bauen eine humane Schule, Baustein Nr. 12: Stichwort: Zivilcourage. Sept. 1995 Außerschulische Bildung Heft 2/1993: Politische Bildung gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Deutschland, 216-245 Bach, T./Clayton, D./Tunc, M.: Die Beratungspraxis in sozialen Einrichtungen bei Diskriminierungstatbeständen. Ergebnisse einer Befragung von Einrichtungen und Verbänden der Sozialberatung. Solingen 2000 (Landeszentrum für Zuwanderung) Bäumer, G.: Die historischen und sozialen Voraussetzungen der Sozialpädagogik und ihrer Theorie. In: Nohl, H./Pallat, L. (Hg.): Handbuch der Pädagogik. Bd. 5. Langensalza 1929, 317 Balser, H./d'Amour, B.: Mit neuem Selbstwert gegen die Gewalt - gemeinsam statt einsam. In: Arbinger, R./Jäger, R.S. (Hg.): Zukunftsperspektiven empirisch-pädagogischer Forschung. Empirische Pädagogik. Beiheft 4. Landau 1995, 15-27 208 Bandura, A.: Social foundation of thought and actions: A social cognitive theory. Englewood Cliffs 1986 Bango, J.: Sozialarbeitswissenschaft heute. Wissen, Bezugswissenschaften und Grundbegriffe. Stuttgart 2001 Bartel, W. J.: A focus group investigation of a wilderness adventure program. Master Thesis. University of British Columbia, Vancouver, Canada 1996 Bauer, H. G.: Erlebnis- und Abenteuerpädagogik. Eine Literaturstudie., München 1985 Bauriedl, Th.: Verstehen – und trotzdem nicht einverstanden sein. In: Psychologie heute 2/1993, 30-37 Beck, D./Müller, B./Painke, U.: Man kann ja doch was tun! Gewaltfreie Nachbarschaftshilfe. Kreatives Eingreifen in Gewaltsituationen und gemeinschaftliche Prävention fremdenfeindlicher Übergriffe. Minden 1994 (Bund für soziale Verteidigung) Beck, U./Bonß, W. (Hg.): Weder Sozialtechnologie noch Aufklärung? Analysen zur Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens. Frankfurt a. M. 1989 Becker, G./Simon, T. (Hg.): Handbuch Aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit. Weinheim und München 1995 Becker, P.: Die Lust am Abenteuer und die Pädagogik. In: Sozialmagazin 2/1993, 27 - 32 Behn, S.,/Böhm, G./Heitmann, H./Steger, P. (Hg.): Glatzen, Cliquen und ein Club. Interviews und Gespräche aus einem Film über die Arbeit mit rechten Jugendlichen. Berlin 1995 Behn, S./Heitmann, H. (Hg.): Spannung, Abenteuer, Action - Erlebnis- und Abenteuerpädagogik in der Jugendarbeit. Berlin o.J. (1994) Behn, S./Heitmann, H./Voß, St. (Hg.): Jungen, Mädchen und Gewalt. Ein Thema für die geschlechtsspezifische Jugendarbeit? Berlin 1995 Behrens, H./Reichling, N.: Ohne antifaschistisches Pathos? Neue Arbeitsformen und Zugänge zum Lernfeld "Nationalsozialismus". (www.hu-bildungswerk.de/onlinearchiv_buchenwald. htlm) Benz, W.: Argumente gegen rechtsextreme Vorurteile. Informationen zur politischen Bildung aktuell 2001 Bergmann, W.: Antisemitismus in Deutschland. In: Schubarth, W./Stöss, R. (Hg.): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Opladen 2001, 131-154 Berlin, S.B./Marsh, J.C.: Informing Interpersonal Practice Decisions. New York 1993 Bertelsmann Stiftung/Bertelsmann Forschungsgruppe Politik (Hg.): Eine Welt der Vielfalt. Gütersloh 1998 Bertram, M./Helsper, W./Idel, T.-S.: Entwicklung schulischer Anerkennungsverhältnisse. Eine Reflexionshilfe zum Thema Schule und Gewalt. Mainz 2000 (hrsgg. v. Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Weiterbildung) Besemer, Chr.: Mediation in der Praxis. Erfahrungen aus den USA. Stuttgart 1996 Besemer, Chr.: Mediation – Vermittlung in Konflikten. Königsfeld 1999 (6. Aufl.) Bildung und Wissenschaft 1/2001 Beutel, W./Fauser, P. (Hg.): Erfahrene Demokratie. Wie Politik praktisch gelernt werden kann. Pädagogische Analysen. Berichte und Anstöße aus dem Förderprogramm Demokratisch Handeln. Opladen 2001 Beutel, W./Schnurre, St./Senge, K./Thöne, A./Fauser, P.: Demokratie lernen in Schule und Gemeinde – Demokratiepolitische und gewaltpräventive Potenziale in Schule und Jugendhilfe. Expertise für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bonn 2001 Beywl, W./Schepp-Winter, E.: Zielgeführte Evaluation von Programmen – ein Leitfaden -. QS Nr. 29. Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. Berlin 2000 (hrsgg. v. BMFSFJ) Bjorgo, T.: Exit Neo-Nazism: Reducing Recruitment and Promoting Disengagement from Racist Groups (unpubl. Paper) 2001 (Nachdruck auf deutsch: Rassistische Gruppen. Die 209 Anwerbung reduzieren und den Ausstieg fördern. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 1/2002, 5-31) Bloomquist, M. L.: Skillstrainings for children with behavior disorders. A parent and therapist guidebook. New York 1996 Blum, H./Beck, D.: Wege aus der Gewalt. Trainingshandbuch für ehrenamtliche MitarbeiterInnen und MultiplikatorInnen in der Jugendarbeit. Bonn 2000 Blum, H. /Knittel, G.: Training zum gewaltfreien Eingreifen gegen Rassismus und rechtsextreme Gewalt. Kölner Trainingskollektiv für gewaltfreie Aktion und kreative Konfliktlösung. Köln 1994 Böhm, R.: Neugierig und offen für andere. Interkulturelle Pädagogik in KiTas. In: kiga heute 6/2001, 6-14 Böhner, Th.: Spiele, die Beziehung knüpfen: Für kreative Spiel- und Theatergruppen. München 2000 Böhnisch, L.: Gespaltene Normalität. Lebensbewältigung und Sozialpädagogik an den Grenzen der Wohlfahrtsgesellschaft. Weinheim und München 1994 Böhnisch, L.: Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung. Weinheim und München 1997 Böhnisch, L.: Grundbegriffe einer Jugendarbeit als "Lebensort". In: Böhnisch, L./Rudolph, M./Wolf, B. (Hg.): Jugendarbeit als Lebensort. Weinheim und München 1998 Böhnisch, L./Frankfurth, M./Fritz, K./Seifert, Th.: Endbericht der wissenschaftlichen Begleitung des AgAG-Programms. Dresden 1996 (TU Dresden Institut für Sozialpädagogik und Sozialarbeit) Boehnke, K./Baier, D.: Expertise zum Forschungsstand im Themenbereich Fremdenfeindlichkeit – Rechtsextremismus – Gewalt aus Sicht der Psychologie. Bremen und Chemnitz 2001 Böllert, K.: Prävention. In: Kreft, D./Mielenz, I. (Hg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. 4. Aufl. 1996, 439-441 Böttger, A.: "Hervorlocken" oder Aushandeln? Zur Methodologie und Methode des "rekonstruktiven Interviews" in der Sozialforschung. In: Strobl, R./Böttger, A. (Hg.): Wahre Geschichten? Zur Theorie und Praxis qualitativer Interviews. Baden-Baden 1996, 131 - 158 Bogumil; J./Immerfall, St.: Wahrnehmungsweisen empirischer Sozialforschung. Zum Selbstverständnis des sozialwissenschaftlichen Forschungsprozesses. Frankfurt/M. 1985 Bohnsack, R.: Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in Methodologie und Praxis qualitativer Forschung. Opladen 1999 (3. Aufl.) Bohnsack, R./Loos,P./Schäffer, B./Städtler, K./Wild, B.: Die Suche nach Gemeinsamkeit und die Gewalt der Gruppe. Hooligans, Musikgruppen und andere Jugendcliquen. Opladen 1995 Borries, von, B.: Das Geschichtsbewußtsein Jugendlicher. Eine repräsentative Untersuchung über Vergangenheitsdeutungen, Gegenwartswahrnehmungen und Zukunftserwartungen von Schülerinnen und Schülern in Ost- und Westdeutschland. Weinheim und München 1995 Borries, von, B.: Forschungen über die Einstellungen Jugendlicher zum Holocaust. Empirische Befunde und sozialpsychologische Bedingungen. In: Kammerer, B/PrölßKammerer, A. (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung. Nürnberg 2002, 14-36 Boudette, R. D.: The therapeutic effects of Outward Bound with juvenile offenders. In: Dissertations Abstracts International 1989,50/II B, 5306 Brand, M./Saasmann, M.: Anti-Gewalt-Training für Gewalttäter. In: DVJJ-Journal 4/1999, 419-425 Braun-Badie-Massud, I./Gerstner, J./Mehring-Fuchs, M.: Das Theaterprojekt "Sehnsucht" in Freiburg - "rechte", "linke", "politisch-neutrale" und ausländische Jugendliche gemeinsam auf 210 der Bühne. In: Möller, K./Schiele, S. (Hg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für soziale Arbeit und politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1996, 147-164 Breckheimer, S. E./Nelson, R. O.: Group methods for reducing racial prejudice and discrimination. In: Psychological Reports 39, 1976, 1259-1268 Bremen, B.: Projekte gegen Ausländerfeindlichkeit und Gewalt – eine kritische Bilanz. In: deutsche jugend 11/1995, 475-482 Brettschneider, W.-D./Kleine, T.: Forschungsprojekt "Jugendarbeit in Sportvereinen". Jugendarbeit in Sportvereinen: Anspruch und Wirklichkeit. Abschlussbericht. Paderborn 2001 Brewer, M. B./Miller, N.: Beyond the contact hypothesis; theoretical perspectives on desegregation. In: Miller, N./Brewer, M. B. (Eds.): Groups in contact: The psychology of desegregation. New York 1984, 281-302 Brinkhoff, K.-P./Sack, H.-G.: Überblick über das Sportengagement von Kindern und Jugendlichen in der Freizeit. In: Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Kindheit, Jugend und Sport in Nordrhein-Westfalen. Der Sportverein und seine Leistungen – eine repräsentative Befragung der nordrheinwestfälischen Jugend – Abschlussbericht. Düsseldorf 1996, 29-74 Brinkmann, A.: Lernen aus der Geschichte. Projekte zu Nationalsozialismus und Holocaust in Schule und Jugendarbeit – Ein wissenschaftliches CD-ROM-Projekt mit Website (deutschenglisch). Bonn 2000 Brislin, R. W./Pedersen, P.: Cross-cultural orientation programs. New York 1976 Brislin, R. W./Yoshida, T.: Intercultural communication training: An introduction. Thousand Oaks 1994 Bröskamp, B./Alkemeyer, T. (Hg.): Fremdheit und Rassismus im Sport. Sankt Augustin 1996 Bromba, M./Edelstein, W.: Das anti-demokratische und rechtsextreme Potenzial unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Bonn 2001 (Reihe: BMBF Publik hrsgg, v. Bundesministerium für Bildung und Forschung) Brosius, H.-B./Scheufele, B.: Zwischen Eskalation und Verantwortung: Die Berichterstattung der Massenmedien und fremdenfeindliche Gewalt- und Straftaten. In. Zeitschrift für Politische Psychologie 9/2001, 99-112 Brown, C.R./Mazza, G.: Peer Training Strategies for Welcoming Diversity. In: IDA (Hg.): Trainings. Interkulturelle Methoden. Antirassistische Ansätze. Konfliktlösungsstrategien. Düsseldorf 2000, 14-18 Brüggemann, B./Riehl, R.: Alltägliche Fremdenfeindlichkeit im Betrieb und gewerkschaftliche Politik. Berlin/Freiburg 2000 (INFIS) Bruhns, K./Wittmann, S.: "Wir sind doch keine Schwacheier" – Mädchen in gewaltbereiten Gruppen. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 2/2001, 45-63 Bruhns, K./Wittmann, S.: "Ich meine, mit Gewalt kannst du dir Respekt verschaffen". Mädchen und junge Frauen in gewaltbereiten Jugendgruppen. Opladen 2002 Bruner, C. F./Winklhofer, U./Zinser, C.: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune. Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung. (BMFSJ) 1999 Bruner, C. F./Winklhofer, U./Zinser, C.: Partizipation – ein Kinderspiel? Beteiligungsmodelle in Kindertagesstätten, Schulen, Kommunen und Verbänden. München 2001 Buford, Bill: Geil auf Gewalt, München 1992 Bund gegen ethnische Diskriminierung in Deutschland e.V. (BDB e.V.): Polizei für interkulturelle Verständigung in Brandenburg – PiViB - . Formulierung der Lernziele im gehobenen Dienst. Berlin 2002 Bundesinstitut für Berufsbildung: Handlungsfähig statt handgreiflich. Konflikte lösen – Gewalt vermeiden. Strategien für die Berufsausbildung. Bielefeld 1998 Bundeskriminalamt (Hg.): Kriminalprävention. Rechtsextremismus – Antisemitismus – Fremdenfeindlichkeit. Neuwied, Kriftel 2000 211 Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hg.): Achter Jugendbericht. Bonn 1990 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Neunter Jugendbericht. Bonn 1994 Büttner, M. (Hg.): Braune Saat in jungen Köpfen. 2 Bde. Hohengehren 1999 Byrnes, D. A./Kiger, G.: Social factors and responses to racial discrimination. In: Journal of Psychology 126, 1992, 631-638 Chouhan, K. u.a.: Anti-Rassismus / Black Empowerment in Großbritannien. In: AluffiPentini, A. u.a. (Hg.): Antirassistische Pädagogik in Europa. Theorie und Praxis. Klagenfurt 1999 Clayton, D./Wehrhöfer, B.: Antidiskriminierungsarbeit in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse der Evaluation der mit Landesmitteln geförderten Antidiskriminierungsprojekte. Solingen 2001 (Landeszentrum für Zuwanderung NRW) Clemenz, M.: Aspekte einer Theorie des aktuellen Rechtsradikalismus in Deutschland. Eine sozialpsychologische Kritik. In: König, H.-D. (Hg.): Sozialpsychologie des Rechtsextremismus. Frankfurt/M. 1998, 126 - 176 Colla, H./Scholz, C./Weidner, J. (Hg.): Konfrontative Pädagogik – Das Glen Mills Experiment. Bad Godesberg 2001 Connell, R.W.: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Opladen 1999 Corsini, R.J.: Handbuch der Psychotherapie. Bd. 2. Weinheim 1994 Crick, N.R./Dodge, K.A.: A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. In: Psychological Bulletin, 115, 1994, 74-101 Cronbach, L.J./Suppes, P.: Research for tomorrow's schools: Disciplines Inquiry for education. New York 1969 Curth, A./Kelm, A./Mathern, S.: Schwierige Kinder und Jugendliche im Sportverein? In: Sozialmagazin 12/1996, 44-48 Cushner, K./Brislin, R.W.: Intercultural interactions: a practical guide. Thousand Oaks 1996 Csikszentmihalyi, M.: Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: im Tun aufgehen. Stuttgart 1985 Dammer, I./Stein v., C.: Blinde Flecken beim Gedenken. Zur Notwendigkeit von Wirkungsforschung. In: Ehmann, A./Kaiser, W./Lutz, Th./Rathenow, H.-F./Stein v., C./ Weber, N.H. (Hg.): Praxis der Gedenkstättenpädagogik. Erfahrungen und Perspektiven. Opladen 1995, 323-334 Dann, H.D.: Aggressionsprävention im sozialen Kontext der Schule. In: Holtappels, H.G./Heitmeyer, W./Melzer, W./Tillmann, K.-J. (Hg.): Forschung über Gewalt an Schulen. Weinheim und München 1997, 351 – 366 Das Projekt "Caritas – Offner Umgang mit Fremden, Gleichstellung und Partizipation in der Arbeitswelt". o.O. o.J. (unv. Papier) Davis-Berman, J./Berman D. S./Capone, L.: Therapeutic wilderness programs: A national survey. In: Journal of Experiential Education 2/1994, 49-53 Day, H. R.: Race relations training in the U.S. military. In: Landis, D./Brislin, R.W. (Eds.): Handbook of intercultural training. Vol. 2. Elmsford, NY. 1983, 241-289 Deinet, U.: Sozialräumliche Jugendarbeit. Eine praxisbezogene Anleitung zur Konzeptentwicklung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Opladen 1999 Deinet, U./Sturzenhecker, B. (Hg.): Konzepte entwickeln. Praxishilfen für die Jugendarbeit. Weinheim 1996 212 Deinet, U./Sturzenhecker, B. (Hg.): Handbuch Offene Jugendarbeit. Münster 1998 Dembowski, G.: Jugendpolitische Einmischungen gegen Rassismus. In: Schneider, Th./Gabriel, M./Schrapl, G. (Hg.): Kontrollierte Offensive. Texte zum Selbstverständnis der Fan-Projekte. Frankfurt 1998 (Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der dsj) Dembowski, G.: Zum Fußball als Männersache. In: deutsche jugend 6/2000, 251-255 Der Ausländerbeauftragte der Landesregierung Sachsen-Anhalt: Zuwanderung und Integration in den neuen Bundesländern. Jahresbericht 1999-2001. Magdeburg o.J. (2001) Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Hg.): Maßnahmen der Länder gegen Rechtsextremismus (Red.: Brieger, S./Klehr, B.). Speyer 2001 Deutsche Sportjugend: Vollversammlung 1998. Berichte, Vorlagen zur Tagesordnung. Münster 1998 Deutscher Bundesjugendring (Hg.): Jung und (un)beteiligt. Trends - Positionen - Forderungen (Red. Kreft, Gudrun/Peschel, Wolfgang). Bonn 1995 Deutscher Gewerkschaftsbund. Bundesvorstand: Schussbericht der Kommission Rechtsextremismus. Berlin 2000 Deutscher Caritasverband. Abteilung Soziales und Gesundheit. Lenkungsgruppe der AG Zuwanderung II: Projektskizze Umgang mit Fremden – "Blick nach innen" o.O. o.J. (unv. Papier) Deutscher Gewerkschaftsbund. Bundesvorstand (Hg.): Migrationspolitische Handreichungen. Diskriminierung am Arbeitsplatz – aktiv werden für Gleichbehandlung. Düsseldorf 1998 (Loseblattsammlung) Deutscher Gewerkschaftsbund. Bundesvorstand: Bericht für den DGB Bundesvorstand. Umsetzung des Berichts der Kommission Rechtsextremismus. Berlin 2001 Dewe, B./Wohlfahrt, N. (Hg.): Netzwerkförderung und soziale Arbeit. Bielefeld 1991 Die Ausländerbeauftragte des Senats (Hg.): NAPAP. Nongovernmental Organizations and Police against Prejudices. Multikulturalität - Herausforderung und Chance. Migrantenorganisationen, Berliner Polizei. Ein gemeinsames Projekt. Berlin 2000 Diewald, M.: Soziale Beziehungen: Verlust oder Liberalisierung? Soziale Unterstützung in informellen Netzwerken. Berlin 1990 Diskriminierung von Menschen ausländischer Herkunft und von Angehörigen ethnischer Minderheiten. Ein Konzept zur Struktur der Antidiskriminierungsarbeit in NordrheinWestfalen aufgrund von präventiver Arbeit, Falldokumentationen und Handlungsmöglichkeiten der Antidiskriminierungsprojekte. Verfasst und vorgelegt vom Antidiskriminierungsbüro Siegen unter Mitarbeit der landesgeförderten Antidiskriminierungsprojekte, des Anti-Rassismus Informationscentrums NRW (ARIC) und des Fachbereichs "Soziale Rehabilitation, Migration" im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Siegen 2000 (Juni) (unv. Papier) Dodge, K.A.: Social-cognitive mechanisms in the development of conduct disorder and depression. In: Annual Review of Psychology, 44, 1993, 559-584 Dollase, R.: Die multikulturelle Schulklasse – oder: Wann ist der Ausländeranteil zu hoch?. In: Zeitschrift für Politische Psychologie 9, 2001, 113-126 Donabadian, A.: An Exploration of Structure, Process and Outcome as Approaches to Quality Assessment. In: Selbmann, H.-K./Überla, K.K. (Eds.): Quality Assessment of Medical Care. Gerlingen 1982, 69-92 Dritter Bericht des Senats über Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Lande Bremen. Bremen 2000 Dritter Bericht der Sachverständigenkommission für Kriminalprävention der Hessischen Landesregierung (Präventionsrat). o.O. (Wiesbaden) 1998 Dubiel, H.: Kritische Theorie der Gesellschaft. Weinheim und München 1988 Durgin, C.H./McEwen, D.: Troubled young people after the adventure program: A case study. In: Journal of Experimental Education 1/1991, 31-35 213 Duss-von Werdt, J. u.a. (Hg.): Mediation – Die andere Scheidung. Stuttgart 1995 Eckert, R./Reis, Chr./Wetzstein, Th. A.: „Ich will halt anders sein wie die andern!“. Abgrenzung, Gewalt und Kreativität bei Gruppen Jugendlicher. Opladen 1999 Eckert, R./Steinmetz, L./Wetzstein, Th. A.: Lust an der Gewalt. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 1/2001, 28-43 Eckert, R./Willems, H.: Fremdenfeindliche Gewalt – Eine historische Emergenz? In: Edelstein, W./Sturzbecher, D. (Hg.): Jugend in der Krise. Ohnmacht der Institutionen. Potsdam 1996, 95-130 Edelstein, W./Fauser, P.: Demokratie lernen und leben. Gutachten für ein Modellversuchsprogramm der BLK. Bonn 2001 (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) Ehmann, A.: Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust in der historischpolitischen Bildung. Wo stehen wir – was bleibt – was ändert sich? In: Fechler, B./Kößler, G./Liebertz-Groß, T. (Hg.): "Erziehung nach Auschwitz" in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen. Weinheim und München 2000, 175-192 Ehmann, A./Kaiser, W./Lutz, Th./Rathenow, H.-F./Stein v., C./ Weber, N.H. (Hg.): Praxis der Gedenkstättenpädagogik. Erfahrungen und Perspektiven. Opladen 1995 Eisenberg, U.: Kriminologie. München 2000 Eisfeld, M./Ott, M.: Gesellschaftstherapie zur Überwindung des Rassismus. In: IDA (Hg.): Trainings. Interkulturelle Methoden. Antirassistische Ansätze. Konfliktlösungsstrategien. Düsseldorf 2000, 30f. Eismann, R./Gref, K./Mayer, B./Menzke, D.: Politische Bildung in der Offenen Jugendarbeit. Nürnberger Beispiele. In: deutsche jugend 11/1997, 485-493 Endlich, St./Goldenbogen, N./Herlemann, B./Kahl, M./Scheer, R.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation. Bd. II. Bonn 1999 Engel, M./Flösser, G./Gensink, G: Qualitätsentwicklung in der Dienstleistungsgesellschaft – Perspektiven für die Soziale Arbeit. In: Heiner, M. (Hg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau 1996, 48-67 Engel, M./Menke, B. (Hg.): Weibliche Lebenswelten - gewaltlos? Münster 1995 Engelke, E.: Theorien der Sozialen Arbeit. Eine Einführung. Freiburg 1999 Eser Davolino, M.: Prävention und Bekämpfung fremdenfeindlicher, rassistischer und gewaltaffiner Einstellungen: Evaluationsstudie eines einstellungsverändernden Projekts mit BerufsschülerInnen. Bern 1999 Eser Davolino, M.: Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt: Festgefahrenes durch Projektunterricht bewegen. Berlin u.a. 2000 EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia): Vielfalt und Gleichheit für Europa. Jahresbericht 2000. Wien 2001 Faller, K.: Mediation in der pädagogischen Arbeit. Ein Handbuch für Kindergarten, Schule und Jugendarbeit. Mülheim 1998 Faller, K./Kerntke, W./Wackmann, M.: Konflikte selber lösen. Mediation für Schule und Jugendarbeit. Mülheim 1996 Farrely, F./Brandsma, J.M.: Provokative Therapie. Berlin 1994 Fechler, B.: Zwischen Tradierung und Konfliktvermittlung. Über den Umgang mit "problematischen" Aneignungsformen der NS-Geschichte in multikulturellen Schulklassen. Ein Praxisbericht. In: Fechler, B./Kößler, G./Liebertz-Groß, T. (Hg.): "Erziehung nach Auschwitz" in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen. Weinheim und München 2000, 207-227 Fend, H.: Ausländerfeindlich-nationalistische Weltbilder und Aggressionsbereitschaft bei Jugendlichen in Deutschland und der Schweiz - kontextuelle und personale 214 Antecedensbedingung. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie 2/1994 Ferrainola, C.D.: Zur Notwendigkeit einer effektiven Veränderung stationärer Behandlungsmodelle delinquenter Jugendlicher. In: DVJJ 3/1999, 321-324 Fileccia, M.: Medienkompetente Auseinandersetzung gegen Rechtsorientierung am praktischen Beispiel. Das Schulprojekt www.stirnbieten.de am Bert-Brecht-Gymnasium in Dortmund. In: Wiedemann, D. (Hg.): Die rechtsextreme Herausforderung. Jugendarbeit und Öffentlichkeit zwischen Konjunkturen und Konzepten. Bielefeld 2002, 264-272 Fischer, C./Anton, H.: Auswirkungen der Besuche von Gedenkstätten auf Schülerinnen und Schüler. Wiesbaden und Erfurt 1992 Fischer, D./Klawe, W./Theissen, H.-J. (Hg.): (Er-)leben statt reden. Erlebnispädagogik in der offenen Jugendarbeit. Weinheim und München 1985 Fisher, R./Ury, W./Patton, B.: Das Harvard-Modell. Sachgerecht verhandeln, erfolgreich verhandeln. Frankfurt a.M. 1993 Flaig, B. u.a.: Alltagsästhetik und politische Kultur. Zur ästhetischen Dimension politischer Bildung und politischer Kommunikation. Bonn 1993 Flechsig, K.-H.: Methoden interkulturellen Trainings – ein neues Verständnis von "Kultur" und "interkulturell". In: IDA (Hg.): Trainings. Interkulturelle Methoden. Antirassistische Ansätze. Konfliktlösungsstrategien. Düsseldorf 2000, 11-14 Flick, U.: Methodenangemessene Gütekriterien in der qualitativ-interpretativen Forschung. In: Bergold, J./Flick, U. (Hg.): Ein-Sichten. Zugänge zur Sicht des Subjekts mittels qualitativer Forschung. Tübingen 1987, 247 – 262 Fluter Nr. 2, Heft April 2002 (Bundeszentrale für politische Bildung) Forschungsgruppe Schulevaluation: Gewalt als soziales Problem in Schulen. Opladen 1998 Förster, G.: Rezension von: Colla, H,/Scholz, Chr./Weidner, J. (hg.): Konfrontative Pädagogik – Das Glen Mills Experiment. Bad Godesberg 2001. In: DVJJ-Journal 4/2001, 413-415 Forum gegen Rassismus/Nationaler Runder Tisch, Arbeitsgruppe Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung: Umsetzung von Art. 13 des EG-Vertrages "Amsterdamer Vertrag". Berlin 2001 (August) Forum Kinder- und Jugendpolitik freier Träger in Baden-Württemberg: Jugend - Arbeit Zukunft? Konsequenzen der Enquetekommission für Jugendhilfe und Jugendpolitik in BadenWürttemberg. Stuttgart 1999 Freeman, H.E./Solomon, M.A.: Das nächste Jahrzehnt in der Evaluierungsforschung. In: Hellstern, G.-M./Wollmann, H. (Hg.): Handbuch zur Evaluierungsforschung. Bd. 1. Opladen 1984, 134-150 Frey, H.-P./Haußer, K. (Hg.): Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Stuttgart 1987 Friedman, G.J.: Die Scheidungsmediation. Reinbek 1996 Friedrich, B./ Herrmann, Th./Knauer, R./Liebler, B.: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune – vom Beteiligungsprojekt zum demokratischen Gemeinwesen. Kiel 2002 (a) Friedrich, B./ Herrmann, Th./Knauer, R./Liebler, B.: Vom Beteiligungsprojekt zum demokratischen Gemeinwesen – Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune. Münster 2002 (b) (vorauss. Herbst) Frindte, W./Neumann, J./Hieber, K./Knote, A./Müller, C.: Rechtsextremismus = "Ideologie plus Gewalt" – Wie ideologisiert sind rechtsextreme Gewalttäter? In: Zeitschrift für Politische Psychologie 9, 2001, 81-98 Frindte, W./Jacob, S./ Neumann, J.: Wie das Internet benutzt wird. Rechtsextreme Orientierung von Schuljugendlichen und ihr Umgang mit neuen Medien. In: Wiedemann, D. 215 (Hg.): Die rechtsextreme Herausforderung. Jugendarbeit und Öffentlichkeit zwischen Konjunkturen und Konzepten. Bielefeld 2002, 93-105 Fröhlich, W./Zebisch, J.: Besucherbefragung zur Neukonzeption der KZ-Gedenkstätte Dachau. Ergebnisbericht. München 2000 (Sozialwissenschaftliches Institut München) Führing, G.: Das Konzept der Anti-Bias-Trainings. In: IDA (Hg.): Trainings. Interkulturelle Methoden. Antirassistische Ansätze. Konfliktlösungsstrategien. Düsseldorf 2000, 19f. Gabriel, G. u.a.: Präventive Projekte gegen Jugendkriminalität. In: DJI-Bulletin 2/1999 Gabriel, M./Schneider, Th.: Fan-Projekte 2000. Zum Stand der sozialen Arbeit mit FußballFans. Frankfurt 1999 (Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der dsj) Gängler, H.: Hilfe. In: Krüger, H.-H./Helsper, W. (Hg.): Einführung in die Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Opladen 1995, 131-138 Gall, R.: "Verstehen, aber nicht einverstanden sein". Coolness-Training für Schulen. In: Weidner, J./Kilb, R./Kreft, D. (Hg.): Gewalt im Griff. Neue Formen des Anti-AggressivitätsTrainings. Weinheim und Basel 1997, 150-171 Gangway e.V.: Arbeitsmaterialien zur Qualitätsentwicklung. Die gelbe Reihe Nr. 1. Berlin 2001 Gegen Vergessen Nr. 30/2001 Geißler, H.: Grundlagen des Organisationslernens. Weinheim 2. Aufl. 1995 Geißler, K.A./Hege, M.: Konzepte sozialpädagogischen Handelns. Weinheim/Basel 1978 Geretshauser, M./Lenfert, Th.: Der Umgang mit rechtsorientierten Straftätern im Jugendvollzug. In: Sozialmagazin 7-8/1993, 62-66 Geretshauser, M./Lenfert, Th./Weidner, J.: Konfrontiert rechtsorientierte Gewalttäter mit den Opferfolgen! In: Otto, H.-U./Merten, R. (Hg.): Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland. Jugend im gesellschaftlichen Umbruch. Bonn 1993, 374-381 Gesicht zeigen! Handbuch für Zivilcourage (Red.: St. Frohloff). Bonn 2001 (Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung; Orig. Frankfurt a.M. 2001) Giesecke, H.: Offensive Sozialpädagogik. Göttingen 1973 Gilmore, D.: Mythos Mann. Rollen, Rituale, Leitbilder. München 1991 Glaser, B.G./Strauss, A.L.: The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago 1967 Glasl, F.: Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. Bern/Stuttgart 1997 Glasl, F.: Selbsthilfe in sozialen Konflikten. Konzepte – Übungen – Praktische Methoden. Bern 2000 (2. Aufl.) Glöckler, U.: Antirassistische Bildungsarbeit: Videoclip gegen Ausländerfeindlichkeit und rechte Gewalt. In: Kammerer, B/Prölß-Kammerer, A. (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung. Nürnberg 2002, 184-192 Gordon, T.: Lehrer-Schüler-Konferenz: Wie man Konflikte in der Schule löst. München 1990 (a) Gordon, T.: Familienkonferenz. Wie mit Kindern Konflikte gelöst werden. München 1990 (b) Gotsbachner, E.: Ausländerbilder als symbolische Ressource in Tatausgleichsverhandlungen. In: Pelikan, Chr. (Hg.): Mediationsverfahren. Horizonte, Grenzen, Einsichten. Baden-Baden 1999 (Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie), 189-239 Graf, A. M.: Mündigkeit und Anerkennung. Gesellschafts- und bildungstheoretische Begründungen sozialpädagogischen Handelns. Weinheim und München 1996 Grenz, W./Sielert, U.: "Sport alleine bringt 's nicht" Evaluation des Projektes "Sport gegen Gewalt, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit" in Schleswig-Holstein. In: Pro Jugend 4/1996, 10-14 216 Grosch, H./Gross, A./Leenen, W.R.: Methoden interkulturellen Lehrens und Lernens. Saarbrücken 2000 Grüner, Th./Hilt, F.: Prävention durch Schulentwicklung. Grundlagen für die Entwicklung schulischer Präventionskonzepte am Beispiel des Anti-Gewalt-Programms "Konflikt-Kultur". In: Jugend und GESELLSCHAFT 3/1998, 12-16 Grupe, O.: Vom Sinn des Sports. Kulturelle, pädagogische und ethische Aspekte. Schorndorf 2000 Gugel, G.: Wir werden nicht weichen. Erfahrungen mit Gewaltfreiheit. Eine praxisorientierte Einführung. Tübingen 1996 Guder, P.: Glen Mills – Amerikanischer Mythos oder reale Chance? In: DVJJ-Journal 3/1999, 324-334 Hafeneger, B.: Wider die (Sozial-)Pädagogisierung von Gewalt und Rechtsextremismus. In: deutsche jugend 3/1993, 120-126 Hafeneger, B.: Jugendarbeit im Dilemma zwischen Politik und Pädagogik. In: Neue Praxis 5/1995, 495-506 Hafeneger, B./Jansen M.M./Niebling, T./Claus, J./Wolf, T.: Rechte Jugendcliquen in Hessen. Szene, Aktivitäten, Folgerungen. Schwalbach/Ts. 2002 Hafeneger, B./Klose, Chr./Niebling, T.: Aktionsprogramm "Partizipation im Rahmen des hessischen Jugendbildungsförderungsgesetzes" – Zwischenbericht der Wissenschaftlichen Begleitung. Wiesbaden 2001 (unv. Bericht hgg. v. Hessischen Sozialministerium) Hamburger Sportjugend: Streetgames in der Großstadt – Offene Jugendarbeit Hamburger Sportvereine. Beschlussvorlage für den Vorstand der Hamburger Sportjugend (beschlossen: Hamburg 12.01.1998) Handbuch Schule ohne Rassismus. Bonn 1996 Hanewinkel, R./Petermann, U./Burow, F./Dunkel, A./Ferstl, R.: Förderung der Lebenskompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Kampagne "Rauchfreie Schule". In: Kindheit und Entwicklung, 3, 1994, 112-116 Hanewinkel, R./Knaack, R.: Prävention von Aggression und Gewalt an Schulen: Ergebnisse einer Interventionsstudie. In: Holtappels, H. G. u.a. (Hg.): Forschung über Gewalt an Schulen: Erscheinungsformen und Ursachen, Konzepte und Prävention. Weinheim und München 1997, 45-62 Harrison, R./Hopkins, R.: The Design of cross-cultural training. An Alternative to the university model. In Journal of Applied Behavioral Sciences 3, 4, 1967, 431-461 Hauk-Thorn, D.: Streitschlichtung in Schule und Jugendarbeit. 2001 Haumersen, P./Liebe, F.: Multikulti: Konflikte konstruktiv. Trainingshandbuch Mediation in der interkulturellen Arbeit. Mülheim 1999 Heidötting-Shah, E./Kather, B.: "Vom Widerstand zur Demokratie". Projekt der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Zusammenarbeit mit Berliner Gymnasien. In: Informationen für den Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer 63/2002, 39-51 Heigl, W.: Arbeitsbuch gegen Ausländerfeindlichkeit. Unterrichtsvorschläge für Schule und Jugendarbeit. Weinheim und Basel 1996 Heinemann, K.-H./Schubarth, W. (Hg.): Der antifaschistische Staat entlässt seine Kinder. Jugend und Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Köln 1992 Heiner, M.: Evaluation zwischen Qualifizierung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. In: Heiner, M. (Hg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau 1996 (a), 20-47 Heiner, M. (Hg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg im Breisgau 1996 (b) Heiner, M. (Hg.): Experimentierende Evaluation. Ansätze zur Entwicklung lernender Organisationen. Weinheim und München 1998 217 Heinisch, M./Thiel, H.: Arbeit mit "schwierigen und gefährdeten" Jugendlichen in BerlinLichtenberg. In: Möller, K./Schiele, S. (Hg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für Soziale Arbeit und Politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1996, 179-191 Heitmann, H.: Netzwerk- und Jugendarbeit gegen "Rechts" – ein stetiger "Stein des Anstoßes". In: Wiedemann, D. (Hg.): Die rechtsextreme Herausforderung. Jugendarbeit und Öffentlichkeit zwischen Konjunkturen und Konzepten. Bielefeld 2002, 146-159 Heitmeyer, W.: Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. Weinheim und München 1987 Heitmeyer, W.: Rahmenkonzept für den Forschungsverbund "Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft. In: Interdisziplinärer Forschungsverbund Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft (Analysen zu zerstörerischen Folgen von Desintegrationsprozessen und Erfolgsfaktoren von Integration). Antrag zur Förderung des Forschungsverbundes durch das Ministerium für Bildung und Forschung. Bielefeld 2001, 11-46 Heitmeyer, W./Buhse, H./Liebe-Freund, J./Möller, K./Müller, J,/Ritz, H./Siller, G./Vossen, J.: Die Bielefelder Rechtsextremismus-Studie. Erste Langzeituntersuchung zur politischen Sozialisation männlicher Jugendlicher. Weinheim und München 1992 Heitmeyer, W. u.a.: Gewalt. Schattenseiten der Individualisierung bei Jugendlichen aus unterschiedlichen Milieus. Weinheim und München 1995 Hellstern, G.-M./Wollmann, H.: Evaluierung und Evaluierungsforschung – ein Entwicklungsbericht. In: Hellstern, G.-M./Wollmann, H. (Hg.): Handbuch zur Evaluierungsforschung. Bd. 1. Opladen 1984 Hensel, R.: Lebenswelt Schule. In: Praxis Schule 5/1995 Herdegen, P.: Fremdenfeindlichkeit: politische und pädagogische Reaktionsmöglichkeiten. In: Gegenwartskunde 4/1992, 479-490 Hermann, M.C.: Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg. Eine interdisziplinäre Evaluation. Pfaffenweiler 1996 Hermann, M.C.: Sechs Qualitätskriterien für Beteiligungsmodelle. Ein Überblick über Erkenntnisse politischer Psychologie, politischer Pädagogik und der Politikwissenschaft. In: Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V./Akademie der Jugendarbeit Baden-Württemberg e.V. (Hg.): Partizipation Jugendlicher - Nur eine Formsache? Stuttgart 1997, 41-47 Hermann, M.C.: Institutionalisierte Jugendparlamente: Über die Beteiligungsmotivation kommunaler Akteure - Formen, Chancen, Risiken. In: Pallentien, Chr./Hurrelmann, K. (Hg.): Jugend und Politik. Ein Handbuch für Forschung, Lehre und Praxis. Neuwied/Kriftel/Berlin 1998, 315-334 Hermes, C.: Rechts rum? Das Onlinespiel des aktuellen forum NRW e.V. Gelsenkirchen 2002 (aktuelles forum) Hermes, C./Wisser, U.: "Rechts rum?". Politische Bildung im Internet als Innovationsprojekt des Landes NRW. In: Wiedemann, D. (Hg.): Die rechtsextreme Herausforderung. Jugendarbeit und Öffentlichkeit zwischen Konjunkturen und Konzepten. Bielefeld 2002, 273280 Herrmann, A.: Ursachen von Ethnozentrismus in Deutschland. Zwischen Gesellschaft und Individuum. Opladen 2001 Hinsch, R./Pfingsten, U.: Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK). Grundlagen, Durchführung, Materialien. Weinheim 1998 Hitzler, R./Honer, A. (Hg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. Opladen 1997 Hören, A. von: Modellkonzepte aktiver Jugendvideoarbeit (nicht nur) zur Prävention von Gewalt - Freie Artikulation jugendlicher Inhalte und Ästhetik. In: Möller, K./Schiele, S. (Hg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für soziale Arbeit und politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1996, 128-146 218 Hollstein, W.: Hilfe und Kapital. Zur Funktionsbestimmung der Sozialarbeit. In: Hollstein, W./Meinhold, M. (Hg.): Sozialarbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen. Frankfurt/M. 1973, 167-204 Hopf, Chr./Rieker, P./Sanden-Marcus, M./Schmidt, Chr.: Familie und Rechtsextremismus. Familiale Sozialisation und rechtsextreme Orientierungen junger Männer. Weinheim und München 1995 Hron, R./Klemm, M.: Projektschultage "Für Demokratie Courage zeigen". In: Gewerkschaftliche Bildungspolitik 9/10 2000, 6-7 Hufer, K.-P.: Argumentationstraining gegen Stammtischparolen. Schwalbach/Ts. 2000 Husbands, Chr. T.: Combating the Extreme Right with the Instruments of the Constitutional State: Lessons from Experiences in Western Europe. In: Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 1/2002, 52-73 Illi, U./Breithecker, D./Mundigler, S. (Hg.): Bewegte Schule – Gesunde Schule. Zürich/Wiesbaden/Graz 1998 Informations- und Dokumentationsstelle gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit in NRW (IDA-NRW) (Hg.): Vielfalt statt Einfalt. Antirassistische und interkulturelle Projekte in Schule und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf 2000 Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA): Was tun wenn...? Zivilcourage gegen rechts. Reader für MultiplikatorInnen in der Jugend- und Bildungsarbeit. Düsseldorf 2000 Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen – Pressereferat -: Behrens: Weniger junge Männer bei Hooligans – Erfolg von Fanprojekten. Düsseldorf 18.01.2000 Interdisziplinärer Forschungsverbund "Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft". Antrag zur Förderung des Forschungsverbundes durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bielefeld 2001 Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfen für die politische Bildung. Bonn 2000 (Bundeszentrale für politische Bildung) International Network Education for Democracy, Human Rights and Tolerance/Wenzel, F.M./Seberich, M. (Eds.): The Power of Language. An Activity Guide for Facilitators. Gütersloh 2001 Jäger, U.: Betrogene Sehnsucht. Informationen zum Rechtsextremismus - (nicht nur) für Jugendliche. Tübingen 1992 Jäger, U.: Rechtsextremismus und Gewalt. Materialien, Methoden, Arbeitshilfen. Tübingen 1993 Jagenlauf, M.: Wirkungsanalyse Outward Bound. Kurzbericht. In: Outward Bound – Deutsche Gesellschaft für Europäische Erziehung e.V. (Hg.): Erlebnispädagogik. Berichte und Materialien 8/1990 Jagenlauf, M.: Wirkungsanalyse Outward Bound – ein empirischer Beitrag zur Wirklichkeit und Wirksamkeit der erlebnispädagogischen Kursangebote von Outward Bound Deutschland. In: Bedacht, A./Dewald, W./Heckmair, B./Michl, W./Weis, K. (Hg.): Erlebnispädagogik: Mode, Methode oder mehr? München 1992, 72-95 Jefferys-Duden, K.: Das Streitschlichter-Programm. Mediatoren-Ausbildung für Schüler und Schülerinnen der Klassen 3 bis 6. Weinheim 1999. Jefferys-Duden, K.: Konfliktlösung und Streitschlichtung. Das Sekundarstufen-Programm. Weinheim 2000 Jefferys-Duden, K.: Konflikte spielend lösen. Eine Spielesammlung für Grund- und weiterführende Schulen. Weinheim 2001 (a) Jefferys-Duden, K.: Streitschlichtung in Schule und Jugendarbeit. 2001 (b) Jefferys-Duden, K./Noack, U.: Streiten, Vermitteln, Lösen: das Schüler-StreitschlichterProgramm. Lichtenau 2000 219 JCS – Joint Committee an Standards for Educational Evaluation: The program evaluation standards: how to assess evaluations of educational programs. Thousand Oaks 1994 Jende, S.: Das Gruppendynamische Aggressionsschwellentraining. Eine Methode zur Erhöhung der Hemmschwelle bei jugendlichen Gewaltstraftätern. In: DVJJ-Journal 4/2001, 387-396 Jonas, K.: Die Kontakthypothese: Abbau von Vorurteilen durch Kontakt mit Fremden? In: Oswald, M.E./Steinforth, U. (Hg.): Die offene Gesellschaft und ihre Fremden. Bern u.a. 1998, 129-154 Jugert, G./Rehder, A./Notz, P./Petermann, F.: Fit for life. Module und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim und München 2001a Jugert, G./Rehder, A./Notz, P./Petermann, F.: Soziale Kompetenz für Jugendliche. Grundlagen, Training und Fortbildung. Weinheim und München 2001b Kade, J.: Erwachsenenbildung und Identität. Eine empirische Studie zur Aneignung von Bildungsangeboten. Weinheim 1989 Kaase, M.: Vergleichende politische Sozialisationsforschung. In: Berg-Schlosser, D./ MüllerRamme (Hg.): Vergleichende Politikwissenschaft. Ein einführendes Studienbuch. Opladen 1992 Kade, J.: "Aneignung", "Vermittlung" und "Selbsttätigkeit" – Neubewertung erwachsenendidaktischer Prinzipien. In: Arnold, R./Giesecke, W. (Hg.): Die Weiterbildungsgesellschaft. Bd. 1: Bildungstheoretische Grundlagen und Analysen. Neuwied/Kriftel 1999, 32-45 Kandzora, G.: Pädagogik nach Auschwitz. Gedanken zu einem politisch-pädagogischen Paradigma im Erfahrungskontext einer Schülerprojektreise. In: Pädagogik und Schullalltag 2/1995, 204-216 Katz, J.: White awareness: Handbook for anti-racism training. Norman 1978 (Univ. of Oklahoma) Kelly, F./Baer, D.: Outward Bound schools as an alternative to institutionalization for adolescent delinquent boys. Boston 1968 Keppler, W./Leitmann, G./Ripplinger, J.: Das Soziale lernen. Ergebnisse eines landesweiten Modellprojekts. Stuttgart 1999 Kerner, H.-J./Weitekamp, E./Huber, Chr./Reich, K.: Wenn aus Spaß Ernst wird. Untersuchung zum Freizeitverhalten und den sozialen Beziehungen jugendlicher Spätaussiedler. In: DVJJ-Journal 4/2001, 370-379 Ketterle, G.: Evaluation of Education for Democracy and Tolerance. In: Podium International Tolerance Network 2/2001, 4 Keupp, H.: Zivilgesellschaftliches Engagement – Das Rezept gegen Extremismus? In: Kind – Jugend – Gesellschaft 1/2001, 3-12 Kiefl, W.: Evaluation einer Kampagne gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. In: Soziale Arbeit 9/1999, 296-301 KGSt: Bericht 6/1995 Kilb, W./Weidner, J.: "So hat noch nie einer mit mir gesprochen..." Eine erste Auswertung zu Möglichkeiten und Grenzen des Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainings. In: DVJJJournal 4/2000, 379-384 Kinast, E.-U.: Evaluation interkultureller Trainings. Lengerich 1998 Klawe, W.: Erlebnispädagogik in den Hilfen zur Erziehung. Ergebnisse einer Evaluationsstudie. In: Jugendwohl 10/1998, 477-489 Klein, M.-l./Kothy, J. (Hg.): Ethnisch-kulturelle Konflikte im Sport. Hamburg 1998 Klose, Chr./Rademacher, H./Hafeneger, B./Jansen, M.M.: Gewalt und Fremdenfeindlichkeit – jugendpädagogische Auswege. Opladen 2000 220 Klosinski, G.: Aggressives Verhalten als Endstrecke eines bio-psycho-sozialen Prozesses. In: Der Bürger im Staat, 43, 2/1993, 96-100 Klumker, Ch. J.: Fürsorgewesen. Einführung in das Verständnis von Armut und Armenpflege. Leipzig 1918 Klupsch-Sahlmann, R. (Hg.): Mehr Bewegung in der Grundschule. Berlin 1999 Knaack, R./Hanewinkel, R.: Das Anti-Mobbing-Programm nach Olweus. In: Pädagogik 1/1999, 13-16 Koch, R./Behn, S.: Gewaltbereite Jugendkulturen. Theorie und Praxis sozialpädagogischer Gewaltarbeit. Weinheim und Basel 1997 Koch, S.: Dumm, aufsässig und Faul? Blauäugig! Unterricht gegen Rassismus: In einem Workshop erfahren Schüler am eigenen Leib, wie grausam sich Diskriminierung anfühlt. In: Sozialmagazin 3/2001, 36-39 König, H.-D.: Arbeitslosigkeit, Adoleszenzkrise und Rechtsextremismus. Eine Kritik der Heitmeyerschen Sozialisationstheorie aufgrund einer tiefenhermeneutischen Sekundäranalyse. In: König, H.-D. (Hg.): Sozialpsychologie des Rechtsextremismus. Frankfurt/M. 1998, 279319 Kößler, G.: Perspektivenwechsel. Vorschläge für die Unterrichtspraxis zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. In: Fechler, B./Kößler, G./Liebertz-Groß, T. (Hg.): "Erziehung nach Auschwitz" in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und soziologische Annäherungen. Weinheim und München 2000, 193-205 Kohls, R. L.: Training as a Twentieth Century Discipline. In: Kohls, R. L.: Training knowhow for cross-cultural Trainers. Washington 1985 Kohlstruck, M.: Attraktivität ohne Gegenkraft? Problematische Rahmenbedingungen der Jugendarbeit. In: Wiedemann, D. (Hg.): Die rechtsextreme Herausforderung. Jugendarbeit und Öffentlichkeit zwischen Konjunkturen und Konzepten. Bielefeld 2002, 135-145 Kolland, D./Bach, U.: Widerstand gegen die NS-Herrschaft. Eine neue Form der Annäherung. In: Informationen für den Geschichts- und Gemeinschaftskundelehrer 62/2001, 64-69 Koppold, M.: Mit Phantasie und Kreativität gegen Gewalt: In: Möller, K./Schiele, S. (Hg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für Soziale Arbeit und Politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1996, 244-256 Korczak, J.: Wie man ein Kind lieben soll. Göttingen 1967 Korn, J./Mücke, Th.: Gewalt im Griff. Bd. 2: Deeskalations- und Mediationstraining. Weinheim 2000 Korn, J./Mücke, Th.: Von der Deeskalation zur Mediation. In: Sozialmagazin 1/2002, 34-38 Korte, J.: Sozialverhalten ändern! Aber wie? Ideen und Vorschläge zur Förderung sozialen Verhaltens. Weinheim und Basel 1996 Kottmann, L./Küpper, D./Pack, R.-P.: Bewegungsfreudige Schule. Bd. 1. Grundlagen. Münster 1997 Krafeld, F.J. (Hg.): Akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen. Bremen 1992 (a) Krafeld, F.J.: Cliquenorientierte Jugendarbeit. Grundlagen und Handlungsansätze. Weinheim und München 1992 (b) Krafeld, F.J. (Hg.): Die Praxis Akzeptierender Jugendarbeit. Konzepte, Erfahrungen, Analysen aus der Arbeit mit rechten Jugendcliquen. Opladen 1996 Krafeld F.J.: Von der akzeptierenden zur gerechtigkeitsorientierten Jugendarbeit. In: deutsche jugend 6/2000, 266-268 Krafeld, F.J.: Zur Praxis der pädagogischen Arbeit mit rechtsorientierten Jugendlichen. In: Schubarth, W./Stöss, R. (Hg.): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Opladen 2001, 271-291 (a) Krafeld F.J.: Gerechtigkeitsorientierung als Alternative zur Attraktivität rechtsextremistischer Orientierungsmuster. In: deutsche jugend 7-8/2001, 322-332 (b) 221 Krafeld, F.J.: Für die Zivilgesellschaft begeistern statt nur gegen den Rechtsextremismus ankämpfen. Berlin 2001 (c) (Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V.) Krafeld, F.J./Möller, K./Müller, A.: Jugendarbeit in rechten Szenen. Ansätze - Erfahrungen Perspektiven. Bremen 1993 Kraus, R.: Rechtsextremismus in den Reihen der Gewerkschaften? Ein Bericht über gewerkschaftliche Positionen. o. O. 2000 (unv. Mscr.) Kraußlach, J.: Aggression im Jugendhaus. Wuppertal 1981 Kretschmer, K.: EU-Projekt NAPAP. Evaluation des zweiten Projektjahres (1998/1999). Abschlussbericht. o.O. (Berlin) o.J. Kromrey, H.: Empirische Sozialforschung. Opladen 1994 Kühnel, W.: Soziale Beziehungen und delinquentes Verhalten beim Statusübergang von der Schule in die Ausbildung. Newsletter 2/1998, 42-56 Kuhn, Hubert: Kampfkunst in der Jugendarbeit. In: deutsche jugend 11/1994, S. 488 - 497 Kultusminister NRW (Hg.): Unterrichtsmaterial "Wir diskutieren - Rechtsextremismus". Düsseldorf 1990 Lamnek, S.: Qualitative Sozialforschung. Weinheim 1995 Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg e.V., LAG (Hg.): Praxishandbuch Mobile Jugendarbeit. Neuwied, Kriftel, Berlin 1997 Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V.: Standards. Stuttgart 2001 (unv. Papier v. 17.10.2001) Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-Württemberg e.V.: (Ohne Titel). Stuttgart 2002 Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Berlin e.V.: Tanz und Musik in der Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu Europäern. Berlin o.J. (2001) (Flugblatt) Landesgruppe Baden-Württemberg in der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (DVJJ): Deeskalation – Über den angemessenen Umgang mit Jugenddelinquenz. Heidelberg 1998 Landeshauptstadt Stuttgart GRDrs 816/2001 Landesjugendring Baden-Württemberg e.V. (Hg.): Leitfaden Partizipation. Viele Wege – ein Ziel. Stuttgart 1997 Landesjugendring Niedersachsen (Hg.): Spuren suchen, Spuren sichern. Hannover 1997 Landeswohlfahrtsverband Baden, Landesjugendamt: Beteiligung von Jugendlichen an Entscheidungsprozessen in der Kommune. Voraussetzungen - Verfahren - Materialien. Eine Orientierungshilfe. Karlsruhe 1998 Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.): Nein. Arbeitshilfen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit, Mainz 1992, 4. Aufl. 2000 Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz: Bericht über die Aktivitäten der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Thema Rechtsextremismus. Mainz 2000 (unv. Papier) Landeszentrum für Zuwanderung NRW (Hg.): Interkulturelle und antirassistische Trainings – aber wie? Konzepte, Qualitätskriterien und Evaluationsmöglichkeiten. Solingen 2001 Lang, S./Leiprecht, R.: Sinnvolles und Problematisches in der antirassistischen Bildungsarbeit – Eine kritische Betrachtung des Blue Eyed/Brown Eyed-Trainings (Jane Elliot). In: Neue Praxis 5/2000, 449-471 Lanig, J.: 100 Projekte gegen Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und Gewalt. Lichtenau und Göttingen 1996 Lanig, J.: "Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!" Mülheim 2001 LaPiere, R.T.: Attitudes versus actions. In: Social Forces 1943, 13, 230-237 222 Leif, Th.: Das Anti-Gewalt-Programm oder die Hilflosigkeit der Politik. In: deutsche jugend 10/1992, 476-479 Leenen, W.R.: Interkulturelles Training – Anmerkungen zur Entstehung, Typologie und Methodik. In: Landeszentrum für Zuwanderung NRW (Hg.): Interkulturelle und antirassistische Trainings – aber wie? Leenen, W. R./Grosch, H.: Bausteine zur Grundlegung interkulturellen Lernens. In: Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfe für die politische Bildung. Bonn 2000, 29-47 Lennep v., H.-G.: Auswertung Fragebogen "Rechte und Pflichten der Bürger". Arbeitsdokument. (hrgg. v. Europarat). Straßburg 1998 (unv. Mscr.) Lerchenmüller, H.: Evaluation eines Lernprogramms in der Schule mit delinquenzpräventiver Zielsetzung. Köln 1986 Lerchenmüller, H.: Soziales Lernen in der Schule: zur Prävention sozial-auffälligen Verhaltens. Ein Unterrichtsprogramm für die Sekundarstufe I. Bochum 1987 Lerchenmüller-Hilse, H.: Möglichkeiten der Delinquenzprävention im Schulbereich. Überlegungen und Erfahrungen aus der Praxis. In: Trenczek, T./Pfeifer, H. (Hg.): Kommunale Kriminalprävention. Paradigmenwechsel und Wiederentdeckung alter Weisheiten. Bonn 1996, 278-294 Liegel, W.: Erlebnispädagogik in der Sozialarbeit, in: Behn, S./Heitmann, H. (Hg.): Spannung, Abenteuer, Action - Erlebnis- und Abenteuerpädagogik in der Jugendarbeit. Berlin o.J. (1994), 15-42 Lindhal, K.: The Swedish EXIT-Project. Paper präsentiert auf dem EUMC-Workshop Decreasing Racial Violence. Wien (2.-3.Juli 2001) Lindhal, K./Mattson, J.: Exit. Ein Neonazi steigt aus. DTV 2001 Lindner, W./Freund, Th.: Der Prävention vorbeugen? Thesen zur Logik der Prävention und ihrer Umsetzung in der Kinder- und Jugendarbeit. In: deutsche jugend 5/2001, 212-220 Linke, K.: Erziehung zur Zivilcourage – Projekte in der Grundschule gegen Gewalt. Wissenschaftliche Hausarbeit. Heidelberg 1999 (dokumentiert unter: www.phheidelberg.de/org/phb/Zivil.html) Lösel, F.: Möglichkeiten und Probleme psychologischer Prävention. Kury, H. (Hg.): Prävention abweichenden Verhaltens – Maßnahmen der Vorbeugung und Nachbetreuung. Köln, Berlin, Bonn, München 1982, 55-91 Lösel, F./Selg, H./Schneider, U.: Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt aus psychologischer Sicht. In: Schwind, H.-D./Baumann, J. u.a. (Hg.): Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt. Analysen und Vorschläge der Unabhängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission). Bd. II. Berlin 1990, 1156 Lösel, F./Bliesener, Th./Fischer, Th././Pabst, M.A.: Hooliganismus in Deutschland: Ursachen, Entwicklung, Prävention und Intervention. Abschlußbericht eines Forschungsprojektes für das Bundesministerium des Innern. Berlin 2001 Lünse, D./Rohwedder, J./Baisch, V.: Zivilcourage. Anleitung zum kreativen Umgang mit Konflikten und Gewalt. Münster 1998 Lukas, H. u.a.: Gewaltfreiheit. Pädagogische Konzepte und Praxiserfahrungen in Schule und Jugendhilfe. AgAG. Berichte und Materialien 3/1993 Lutz, I.M.: Weibliches Aggressionsverhalten zwischen sozialer Durchsetzung und sozialer Erwünschtheit. Frankfurt/M. 2000 Lutzebäck, E./Schaar, G./Storm, C./Krafeld, F.J.: Mädchen in rechten Szenen. Erfahrungen aus der Praxis akzeptierender Jugendarbeit. In: deutsche jugend, 12/1995, 545-553 Maier, M.: Erziehung nach Auschwitz. Gedenkstättenarbeit mit Jugendlichen. Esslingen 1998 (CD-ROM) 223 Mansel, J./Hurrelmann, K.: Aggressives und delinquentes Verhalten Jugendlicher im Zeitvergleich. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1/1998, 78 - 109 McGregor, J.: Effectiveness of role-playing and antiracist teaching in reducing student prejudice. In: Journal of Educational Research 86, 1993, 215-226 Mecheril, P./Miandashti, S./Plößer, M./Raithel, J.: Aspekte einer dominanzempfindlichen und differenzkritischen Arbeit mit Migranten und Migrantinnen. In: Neue Praxis 3/2001, 296-311 Mecklenburg, J.: Was tun gegen rechts? Berlin 1999 Mehrwert: Magazin 2002. Stuttgart 2002 Meseth, W./Proske, M.: Vermittlung und Aneignung von Wissen über den Holocaust und Nationalsozialismus in der Schule. In: Kammerer, B/Prölß-Kammerer, A. (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung. Nürnberg 2002, 37-53 Messmer, H.: Täter-Opfer-Mediation. In: Dieter, A./Montada, L, Schulze, A. (Hg.): Gerechtigkeit im Konfliktmanagement und in der Mediation. Frankfurt a.M./New York 2000, 93-118 Metzger, R.: Pädagogische und politische Initiativen gegen Rechtsextremismus. In: Fliege, Th/Möller, K. (Hg.): Rechtsextremismus in Baden-Württemberg. Verborgene Strukturen der Rechten. Freiburg 2001, 149-177 Meyer, G./Hermann, A.: Zivilcourage im Alltag. Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 7-8/2000, 3-13 MFJFG NRW: Fußball-Fan-Projekte als erfolgreicher Beitrag zur Gewaltprävention. Düsseldorf 04.10.2000 Mielenz, I.: Die Strategie der Einmischung. Soziale Arbeit zwischen Selbsthilfe und kommunaler Politik. In: Mundt, J. (Hg.), Grundlagen lokaler Sozialpolitik. Weinheim 1983, 223-237 Migrationsarbeit der Caritas im Erzbistum Köln: Diözesanes Projekt "Antidiskriminierungsarbeit in den Migrationsdiensten" Auswertung Phase 1. Arbeitshilfe Phase 2. Köln 2001 (unv. Papier) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hg.): Tolerantes Brandenburg. Handlungskonzept der Landesregierung gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Potsdam 1998; 4. Aufl. 2000 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hg.): Tolerantes Brandenburg. 1. Zwischenbericht der Landesregierung zur Umsetzung des Handlungskonzeptes. Potsdam 1999 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hg.): Tolerantes Brandenburg. 2. Zwischenbericht der Landesregierung zur Umsetzung des Handlungskonzepts "Tolerantes Brandenburg". Potsdam 2001 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Koordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg (Hg.): Bürger für Toleranz und Weltoffenheit. Potsdam o. J. (2001a) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Koordinierungsstelle Tolerantes Brandenburg (Hg.): Beratungssystem Schule. Handeln für eine tolerante weltoffene Schule. Potsdam o.J. (2001b) Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hg.): Regionalkonferenzen der Koordinatoren und Koordinatorinnen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. 24. Februar/ 17. März 2001 Cottbus / Ruppin. Potsdam o.J. (2001c) Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Sozialverhalten lernen: Für die erzieherische Arbeit in Schulen und Jugendarbeit. Eine praktische Hilfe. Stuttgart 1999 Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Weiterbildung (Hg.): Dokumentation der Aktion "Sport und Spiel statt Gewalt auf dem Schulhof". Mainz 2000 Minkenberg, M.: Expertise "Politikwissenschaftlicher Forschungsstand zu Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt". Frankfurt/Oder o.J. (2002) 224 Mitbrodt, St./Ahnemann, H.: Schulhofgestaltung Grund- und Hauptschule Roter Hahn. Ein gewaltpräventives Beteiligungsprojekt. 1997 – 2000. o.O. o.J. (Lübeck 2001) (unv. Mscr.) Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta. Gütersloh 1997 Miteinander e.V. – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt/Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin (Hg.): Verfolgung, Terror und Widerstand in Sachsen-Anhalt 1933-45. Ein Wegweiser für Gedenkstätten-Besuche. Berlin 2001 Möller, K.: Zwei Dutzend Gründe für die aktuelle Hilflosigkeit des politischen und pädagogischen Antifaschismus - Provokationen - Polemiken - Perspektiven. In: Neue Praxis 6/1989, 480-496 Möller, K.: Zusammenhänge der Modernisierung des Rechtsextremismus mit der Modernisierung der Gesellschaft. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 46-47/1993, 3-10 Möller, K.: Jugendarbeit als Lösungsinstanz gesellschaftlicher Gewaltverhältnisse: Eine magische Inszenierung. In: Heitmeyer, W. (Hg.): Das Gewalt-Dilemma. Frankfurt a. M. 1994, 242-272 Möller, K.: Jugend(lichkeits)kulturen und (Erlebnis-)Politik. Terminologische Verständigungen. In: Ferchhoff, W./Sander, U./Vollbrecht, R. (Hg.): Jugendkulturen Faszination und Ambivalenz. Weinheim und München 1995, 172-185 (a) Möller, K.: "Fremdenfeindlichkeit" - Übereinstimmungen und Unterschiede bei Jungen und Mädchen. In: Engel, M./Menke, B. (Hg.): Weibliche Lebenswelten - gewaltlos? Münster 1995, 64-86 (b) Möller, K.: Pädagogische Strategien im Umgang mit rechtsextremen Orientierungen Jugendlicher. In: Brenner, G./Hafeneger, B. (Hg.): Pädagogik mit Jugendlichen. Weinheim und München 1996, 159-171 Möller, K. (Hg.): Nur Macher und Macho? Geschlechtsreflektierende Jungen- und Männerarbeit. Weinheim und München 1997 Möller, K.: Verläufe von Gewaltakzeptanz und rechtsextremen Orientierungen bei Jungen und Mädchen. Theoretische Erklärungen und Befunde einer Längsschnitt-Studie zum Einfluß geschlechtsspezifischer Sozialisation im Jugendalter. Bielefeld 1999 (a)(Habil.) Möller, K.: Die Stuttgarter Jugendräte-Studie. Möglichkeiten zur politischen Beteiligung Jugendlicher an gesamtstädtischen Belangen in einer Großstadt. Esslingen 1999 (b) Möller, K.: Rechte Kids. Eine Langzeitstudie über Auf- und Abbau rechtsextremistischer Orientierungen bei 13- bis 15jährigen. Weinheim und München 2000 (a) Möller, K.: Kommunalpolitische Partizipation von Jugendlichen – Entwicklungsstand und Qualitätskriterien. In: Neue Praxis 4/2000, 379-396 (b) Möller, K.: Zur Grundlegung geschlechtsreflektierender Ansätze sozialer und pädagogischer Arbeit zur Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen. In: Deutsches Jugendinstitut (Hg.): Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit – Aufgaben und Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe. Leipzig 2000, 59-76 (c) Möller, K.: Coole Hauer und brave Engelein. Gewaltakzeptanz und Gewaltdistanzierung im Verlauf des frühen Jugendalters. Opladen 2001 (a) Möller, K.: Extremismus. In: Schäfers, B./Zapf, W. (Hg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen 2001 (2. überarb. Aufl.) (b) Möller, K.: Bürger(gesell)schaftliches Engagement als Herausforderung für Soziale Arbeit. In: Möller, K. (Hg.): Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft? Soziale Arbeit als Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements. Opladen 2002, 29-50 (a) Möller, K.: Gewalt und Rechtsextremismus als Phänomen von Jugendcliquen. Empirische Erkenntnisse, theoretische Zusammenhänge und pädagogische Konsequenzen. In: Andresen, S./Bock, K./Brumlik, M./Otto, H.-U./Schmidt, M./Sturzbecher, D. (Hg.): Vereintes Deutschland - geteilte Jugend. Ein politisches Handbuch. Opladen 2002 (im Druck) (b) 225 Möller, K.: Anerkennungsorientierung als Antwort auf den Konnex von Männlichkeit und Gewalt - Grundlegende Skizzen. In: P. Henkenborg/B. Hafeneger/A. Scherr (Hg.): Die Idee der Anerkennung in der Pädagogik. Schwalbach/Ts. 2002 (im Druck) (c) Möller, K./Schiele, S. (Hg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für soziale Arbeit und politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1996 Morsch, G.: Authentic Places of KZ-Crimes. Chances and Risks from the View of Visitor Research. In: Beiträge zur historischen Sozialkunde. Sondernummer/Special Issue 2001: Teaching the Holocaust and National Socialism. Approaches and Suggestions. Müller, S.: Erziehen- Helfen – Strafen. Das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle in der Sozialen Arbeit. Weinheim und München 2001 Müller, S.: Besucher/innenforschung in Gedenkstätten – Ein Pilotprojekt in der Gedenkstätte Sachsenhausen. In: Gedenkstätten-Rundbrief 74, 1996, 3-9 Mutzeck, W./Faasch, Chr.: Stadtteil und Schule. Lübeck-Moisling. Abschlussbericht eines Modellprojektes zur Gewaltprävention. Lübeck 1998 Natorp, P.: Sozialpädagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft. Stuttgart 4. Aufl. 1920; Orig. 1899 (a) Natorp, P.: Sozialpädagogik. In. Rein, W. (Hg.): Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik. Bd. 6. Langensalza 1. Auflage 1908, 701-101; Orig. 1899 (b) NCCP – National Council for Crime Prevention (BRA): Exit: A Follow-Up and Evaluation oft the Organisation for People Wishing to Leave Racist and Nazi Groups. Stockholm 2001 Netz gegen Rassismus, für gleiche Rechte: "Vorschlag für einen Aktionsplan gegen Rassismus für die Bundesrepublik Deutschland". Berlin 2000 (28. März) Netz gegen Rassismus, für gleiche Rechte: Bewertung der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zur Verwirklichung des Art. 13 des Amsterdamer Vertrages und deren Umsetzung in nationales Recht. Berlin 2001 (22. Mai) Neue Westfälische 01./02.11.2001 Neugebauer, G.: Extremismus – Rechtsextremismus – Linksextremismus: Einige Anmerkungen zu Begriffen, Forschungskonzepten, Forschungsfragen und Forschungsergebnissen. In: Schubarth, W./Stöss, R. (Hg.): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Opladen 2001, 13-37 Nickolai, W. u.a.: Erlebnispädagogik mit Randgruppen. Freiburg 1991 Nickolai, W.: Gedenkstättenpädagogik mit sozial benachteiligten Jugendlichen. Freiburg 1996 (a) Nickolai, W.: Marko und die Folgen: Ein Skinhead in Auschwitz. In: Neue Praxis 2/1996, 160-168 (b) Niedersächsisches Kultusministerium (Hg.): Sichtwechsel – Weg zur interkulturellen Schule. Hannover 2000 Niemeyer, Chr.: Hilfe. In: Lenzen, D. (Hg.): Erziehungswissenschaft. Reinbek 1994, 159-182 Niemeyer, Chr.: Theorie und Praxis der Sozialpädagogik. Münster 1999 Niemeyer, Chr./Schröer, W./Böhnisch, L. (Hg.): Grundlinien Historischer Pädagogik. Weinheim und München 1997 Noack, U.: Mediation – das Streitschlichter-Modell in der Bewährung zur Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur in der Schule. In: Wissenschaft und Frieden 1998 Noack, P: Fremdenfeindliche Einstellungen vor dem Hintergrund familialer und schulischer Sozialisation. In: Zeitschrift für Politische Psychologie 9, 2001, 67-80 Nolting, H.-P./Knopf, H.: Gewaltverminderung in der Schule: Viele Vorschläge – wenig Studien. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht 45/1998, 249-260 Norddeutsche Antifagruppen (Hg.): "Rosen auf den Weg gestreut..." Eine Kritik an der akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen. Hamburg 2000 (4. Aufl.) (Bezugsadresse: c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Hamburg) 226 Nowitzki, W. (Hg.): AntiDiskriminierungsCodes. Arbeitshilfe für Schulen und Kommunen. Berlin 2000 Nunner-Winkler, G.: Anerkennung moralischer Nomen. Projekt 16 im Rahmen des Forschungsverbundes "Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft". In: Interdisziplinärer Forschungsverbund Stärkung von Integrationspotenzialen einer modernen Gesellschaft (Analysen zu zerstörerischen Folgen von Desintegrationsprozessen und Erfolgsfaktoren von Integration). Antrag zur Förderung des Forschungsverbundes durch das Ministerium für Bildung und Forschung. Bielefeld 2001, 408-425 Oesterreich, D.: Autoritäre Persönlichkeit und Gesellschaftsordnung. Weinheim und München 1993 Oesterreich, D.: Flucht in die Sicherheit. Zur Theorie des Autoritarismus und der autoritären Reaktion. Leverkusen 1996 Oesterreich, D.: Krise und autoritäre Reaktion. Drei empirische Untersuchungen zur Entwicklung rechtsextremistischer Orientierungen bei Jugendlichen in Ost und West von 1991 bis 1995. In: Gruppendynamik 3/1997, 259 - 272 Oesterreich, D.: Massenflucht in die Sicherheit? Zum politischen Verhalten autoritärer Persönlichkeiten. Theoretische Überlegungen und Ergebnisse von vier empirischen Untersuchungen. In: Newsletter 2/1998, 4 – 21 Offe, C.: Reproduktionsbedingungen des Sozialvermögens. In: Enquete-Kommission "Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements" Deutscher Bundestag (Hg.): Bürgergesellschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. Opladen 2002, 273-282 Ohlemacher, T./Sögding, D./Höynck, Th./Ethé, N./Welte, G.: Anti-Aggressivitätstraining und Legalbewährung: Versuch einer Evaluation. In: Bereswill, M./Grewe, W. (Hg.): Forschungsthema Strafvollzug. Interdisziplinäre Beiträge zur kriminologischen Forschung. Bd. 21. Baden-Baden 2001, 345-86 Olweus, D.: Familial and temperamental determinants of aggressive behavior in adolescent boys: A causal analysis. In: Development Psychology, 16, 1980, 644-660 Olweus, D.: Bully-victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a schoolbased Intervention program. In: Pepler, D.J./Rubin, K.H. (Eds.): The development and treatment of childhood aggression. Hilsday, N.J. 1991, 411-448 Olweus, D.: Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können. Bern u.a. 1996 (2. Aufl.) Olweus, D.: Täter-Opfer-Probleme in der Schule: Erkenntnisstand und Interventionsprogramm. In: Holtappels, H.G./Heitmeyer, W./Melzer, W./Tillmann, K.-J. (Hg.): Forschung über Gewalt an Schulen. Weinheim und München 1997, 281-298 Osborg, E.: Konzept einer subversiven Verunsicherungs- und Konfrontationspädagogik für die Präventionsarbeit mit rechtsradikalen Jugendlichen. Hamburg (FH Hamburg) o.J. (2001) Osei, S.: Empowermentansatz und –trainings von phoenix e.V. In: Landeszentrum für Zuwanderung NRW (Hg.): Interkulturelle und antirassistische Trainings – aber wie? Konzepte, Qualitätskriterien und Evaluationsmöglichkeiten. Solingen 2001, 59-64 Ostermann, Ä.: Zivilcourage – eine demokratische Tugend: Test für die Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft. In: Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V. (IDA): Was tun wenn...? Zivilcourage gegen rechts. Reader für MultiplikatorInnen in der Jugend- und Bildungsarbeit. Düsseldorf 2000, 4-10 Otto, U., 2000: Engagementförderung als multiple Netzwerkintervention. In: Otto, U./Müller, S./Besenfelder, Chr. (Hg.): Bürgerschaftliches Engagement. Eine Herausforderung für Fachkräfte und Verbände. Opladen, 11-50 Ottomeyer, K.: Psychoanalytische Erklärungsansätze zum Rassismus. Möglichkeiten und Grenzen. In: Mecheril, P./Teo, Th. (Hg.): Psychologie und Rassismus. Reinbek 1997, 111131 227 Paatsch, U.: Arbeitsfelder interkultureller Museumsarbeit. Auszug aus dem Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung (www.people.freenet.de/afeb/fremd.html) Paatsch, U.: Museen und Fremdenfeindlichkeit. Stellungnahmen von Museumsmitarbeiter/innen, Besuchern/innen, Eltern und Mitgliedern von Arbeitskreisen. Auszug aus dem Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung (Paatsch, U.: Arbeitsfelder interkultureller Museumsarbeit. Auszug aus dem Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung (www.people.freenet.de/afeb/fremd.html) Paatsch, U.: Museumspädagogischer Modellversuch Begegnung mit dem Fremden. Dokumentation der Projekte. Heidelberg 2001 (www.people.freenet.de/afeb/fremd.html) Pädagogisches Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz (Hg.): Schulische Gewalt- und Suchtprävention im Team (PIT). Ein Evaluationsbericht. Bad Kreuznach 2000 Pallentien, Chr./Hurrelmann, K. (Hg.): Jugend und Politik. Ein Handbuch für Forschung, Lehre und Praxis. Neuwied/Kriftel/Berlin 1998 Paul, G.: Zur Sozialpsychologie des jugendlichen Rechtsextremismus. Überlegungen zu psychischen Strukturen von Jugendlichen, die rechtsextremistische Dispositionen fördern. In: Ders./Schoßig, B. (Hg.): Jugend und Neofaschismus. Frankfurt/M. 1979, 138 - 169 Paul, G. (Hg.): Hitlers Schatten verblaßt. Die Normalisierung des Rechtsextremismus. Bonn 1989 Pelikan, Chr. (Hg.): Mediationsverfahren. Horizonte, Grenzen, Einsichten. Baden-Baden 1999 (Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie) Petermann, F./Jugert, G./Verbeek, D./Tänzer, U.: Verhaltenstraining mit Kindern. In: Holtappels, H.G./Heitmeyer, W./Melzer, W./Tillmann, K.-J. (Hg.): Forschung über Gewalt an Schulen. Weinheim und München 1997, 315-330 Petermann, F./Jugert, G./Rehder, A./Tänzer, U./Verbeek, D.: Sozialtraining in der Schule. Weinheim 1999 (2. überarb. Aufl.) Petermann, F./Petermann, U.: Training mit sozial unsicheren Kindern. Weinheim 2000a (7., völlig veränd. Aufl.) Petermann, F./Petermann, U.: Training mit Jugendlichen. Göttingen 2000b (6. veränd. Aufl.) Petermann, F./Petermann, U.: Training mit aggressiven Kindern. Weinheim 2000c, (9. überarb. Aufl.) Pettigrew, Th. F.: The Intergroup Contact Hypothesis Reconsidered. In: Hewstone/Brown (Eds.): Contact and Conflict in intergroup Encounters. Oxford and Cambridge 1986, 169-195 Pettigrew, Th. F.: Generalised intergroup contact effects on prejudice. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 1997, 173-185 Pettigrew, Th. F.: Intergroup contact theory. In: Annual Review of Psychology, 49, 1998, 6585 Pfingsten, U./Hingst, R.: Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK). Weinheim 1998 (3. Aufl.) Piaszczynski, U.: Mobile Jugendarbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen in BadenWürttemberg. Ein sozialpädagogischer Ansatz zur Konfliktbearbeitung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 46-47/93 vom 12.11.1993, 2431 Pielmaier, H. (Hg.): Training sozialer Verhaltensweisen. Ein Programm für die Arbeit mit dissozialen Jugendlichen. München 1980 Pilz, G.A.: Fairness und ihr Verständnis im sportlichen Wettkampf; oder: Die Moral des fairen Fouls. In: Mokrosch, R./Regenbogen, A. (Hg.): Was heißt Gerechtigkeit? Ethische Perspektiven zu Erziehung, Politik und Religion. Donauwörth, 215-227 Pilz, G.A.: Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen körper- und bewegungsbezogener Sozialer Arbeit am Beispiel der Gewalt und Gewaltprävention im, um und durch den Sport. In: Arbeitsgemeinschaft körper- und bewegungsbezogene Soziale Arbeit der Evangelischen 228 Fachhochschule Hannover (Hg.): Sport und Soziale Arbeit: Wahrnehmen – Bewegen – Verändern. Beiträge zur Theorie und Praxis körper- und bewegungsbezogener Sozialer Arbeit. Hannover 2002 (a) (im Druck) Pilz, G.A.: Mitternachtssport: Medienwirksames Spektakel oder Beitrag zur Gewaltprävention? In: Arbeitsgemeinschaft körper- und bewegungsbezogene Soziale Arbeit der Evangelischen Fachhochschule Hannover (Hg.): Sport und Soziale Arbeit: Wahrnehmen – Bewegen – Verändern. Beiträge zur Theorie und Praxis körper- und bewegungsbezogener Sozialer Arbeit. Hannover 2002 (b) (im Druck) Pilz, G.A./Schick, H./Yilmaz, H.: Fußball und Gewalt – Vernetzung gewaltpräventiver Vereinsjugendarbeit und aufsuchender Jugendsozialarbeit. Zwischenbericht. Hannover 2000 Pölert-Klassen, A.: Wir lernen uns kennen: Soziales Lernen. Arbeitsheft 1. Berlin 1997 Pölert-Klassen, A.: Starke Kinder: Soziales Lernen. Arbeitsheft 2. Berlin 1998 Polligkeit, W./Scherpner, H./Webler, H. (Hg.): Fürsorge als persönliche Hilfe. Festgabe für Prof. Dr. Christian Jasper Klumker zum 60. Geburtstag. Berlin 1929 Pollit, Chr./Bouckaert, G.: Defining Quality. In: Pollit, Chr./Bouckaert, G. (Eds.): Quality Improvement in European Public Services. Concepts, Cases and Commentary. London, Thousand Oaks, New Delhi 1995 Portmann, R.: Spiele, die stark machen. München 1998 Posselt, R.-E./Schumacher, K. (Hg.): Projekthandbuch: Gewalt und Rassismus, Mülheim 1993 (Neuauflage 2001) Pro Jugend, Heft 4/1996: "E lebe der..." Sport "...ist Mord" Proksch, R.: Mediation – Vermittlung in familiären Konflikten. Einführung von Mediation in die Kinder- und Jugendhilfe. Nürnberg o.J. (1998) Pruegger, V. J./Rogers, T. B.: Cross-cultural sensivity training. Methods and assessment. In: International Journal of Intercultural Relations 18, 1994, 369-387 Puhl, R.: Sozialarbeitswissenschaft. Weinheim und München 1996 Putnam, R. D.: Bowling alone: America's Declining Social Capital. In: Journal of Democracy 6, 65-78 Putnam, R.: Soziales Kapital in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA. In: Enquete-Kommission "Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements" Deutscher Bundestag (Hg.): Bürgergesellschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft. Opladen 2002, 257-271 Puvogel, U./Stankowski, M.: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation. Bd. I. Bonn 1995 Redl, F./Wineman, D.: Kinder, die hassen. München 1979 Redl, F.: Erziehung schwieriger Kinder. München 1987 Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule Berlin (Hg.): Kongress der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung vom 3. bis 5. Mai 2001 in Berlin. Für Demokratie – Gegen Gewalt. Eine Initiative gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus. Dokumentation. Berlin 2001 Rehm, M.: Evaluationen erlebnispädagogischer Programme im englischsprachigen Raum. In: Paffrath, F.H./Salzmann, A./Scholz, M. (Hg.): Wissenschaftliche Forschung in der Erlebnispädagogik. Augsburg 1998, 153-172 Reif, V.: Das Internet als Medium für die politische Beteiligung Jugendlicher. Esslingen 1999 (unv. Diplomarbeit) Reiners, A.: Praktische Erlebnispädagogik: Neue Sammlung motivierender Interaktionsspiele. Augsburg 2000 (5. Aufl.) Remschmidt, H./Hacker, F./Müller-Luckmann, E./Schmidt, M.H./ Strunk, P.: Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt aus psychiatrischer Sicht. In: Schwind, H.-D./Baumann, J. u.a. (Hg.): Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt. Analysen und Vorschläge der 229 Unabhängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission). Bd. II. Berlin 1990, 157-292 Ridley, Ch. R./Mendoza, D. W./Kanitz, B. E.: Multicultural training: Reexamination, operationalization, integration. In: The Counseling Psychologist 2/1994, 227-289 Rieker, P.: Ethnozentrismus bei jungen Männern. Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus und die Bedingungen ihrer Sozialisation. Weinheim und München 1997 Roberts, T.: Evaluation of the victim offender mediation project. Langley B.C. Final report for Solicitor General Canada. Victoria 1995 Röhrle, B.: Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung. Weinheim 1994 Römhild, R.: Wenn die Heimat global wird. In: Die Zeit 14.03.2002, 11 Rokeach, M.: The Open and the Closed Mind. New York 1960 Rokeach, M.: Long-range experimental modification of values, attitudes, and behavior. In: American Psychologist 26, 1971, 453-459 Rommelspacher, B./Polat, Ü./Wilpert, C.: Die Evaluation des CIVITAS-Programms. Die Aufbauphase (Juni – Dezember 2001). Berlin o.J. (2002) (Alice Salomon Fachhochschule Berlin) Rosenbladt, B. v.: Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse der Repräsentativerhebung 1999 zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement: Band 1: Gesamtbericht. Stuttgart 2000 Rossi, P.H.: Professionalisierung der Evaluierungsforschung? Beobachtungen zu Entwicklungstrends in den USA. In: Hellstern, G.-M./Wollmann, H. (Hg.): Handbuch zur Evaluierungsforschung. Bd. 1. Opladen 1984, 654-673 Sachbericht zum Projekt KJ.006.01 "Rechtsextremismus – was heißt das eigentlich heute?" Projekttage für Jugendliche. Frankfurt 2001 (unv. Papier) Sales, A.: The Effectiveness of NBCI Workshop Models. New York 1984 Sanders, J. R./Beywl, W.: Handbuch der Evaluationsstandards: die Standards des "Joint Committee on Standards for Educational Evaluation". Opladen 1999 Sausjord, I.: Service Learning for a Diverse Society: Research on Children, Youth and Prejudice. In: Social Studies Review 2/1997, 45-47 Schäffter, O.: Bildung als kognitiv strukturierende Umweltaneignung. In: DerichsKunstmann, D./Faulstich, P./Tippelt, R. (Hg.): Theorien und forschungsleitende Konzepte der Erwachsenenbildung. Beiheft zum Report 1995, 55-62 Scherpner, H.: Theorie der Fürsorge. Göttingen 1962 Scherr, A.: Möglichkeiten und Grenzen der Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen. In. deutsche jugend 3/1993, 127-135 Schilling, J.: Soziale Arbeit. Entwicklungslinien der Sozialpädagogik/Sozialarbeit. Neuwied, Kriftel, Berlin 1997 Schlicher, J./Günther, R./Schütze, D./Thiele, K.: "Ganz schön blauäugig..." – Ein Reader zum Einsatz der Braunäugig/Blauäugig-Übung in antirassistischer Bildungsarbeit. Marburg 1998 Schmälzle, U.: Mit Gewalt leben: Arbeit am Aggressionsverhalten in Familie, Kindergarten und Schule. Frankfurt am Main 1993 Schmauch, U.: "Mit reden statt Kloppen erfolgreicher durchs Leben" Mediation und mediative Elemente in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (I). In: deutsche jugend 5/2001, 221-228 (a) Schmauch, U.: "Mit reden statt Kloppen erfolgreicher durchs Leben" Mediation und mediative Elemente in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (II). In: deutsche jugend 6/2001, 266-273 (b) Schmidtchen, G.: Wie weit ist der Weg nach Deutschland? Sozialpsychologie der Jugend in der postsozialistischen Welt. Opladen 1997 (2. durchges. Aufl.) 230 Schnack, D./Neutzling, R.: Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach Männlichkeit. Reinbek 1991 Scholl, Cr./Korell, R.: Die Bombe entschärfen... Gewaltprävention in der Kindergruppe. Düsseldorf 2001 (hrsgg. vom deutschen Jugendrotkreuz, Landesverband Nordrhein) Schrödter, M.: Programm-Evaluation statt Output-Messung. Zum Nutzen der Evaluationsforschung für die Praxis am Beispiel des Antirassismus-Trainings 'Blue-eyed'. Überarbeitete Version des Vortrags für die Tagung "Interkulturelle und antirassistische Trainings auf dem Prüfstand. Evaluationskonzepte und Ergebnisse. Bielefeld 2002 (unveröff. Papier) Schubarth, W.: Zu Wirkungen eines Gedenkstättenbesuchs bei Jugendlichen. Leipzig 1990 (unv. Mscr.) Schubarth, W.: Analyse und Prävention von Gewalt. Der Beitrag interdisziplinärer Forschung zur Gewaltprävention in Schule und Jugendhilfe. Dresden 1998 (Habil.) Schubarth, W./Kolbe, F.-U./Willems, H. (Hg.): Gewalt an Schulen. Ausmaß, Bedingungen und Prävention. Opladen 1996 Schubarth, W.: Jugendprobleme in den Medien. Zur öffentlichen Thematisierung von Jugend am Beispiel des Diskurses zur "Jugendgewalt". In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 31/1998, 29-36 Schubarth, W.: Gewaltprävention in Schule und Jugendhilfe. Theoretische Grundlagen – Empirische Ergebnisse – Praxismodelle. Neuwied, Kriftel 2000 Schubarth, W.: Pädagogische Strategien gegen Rechtsextremismus und fremdenfeindliche Gewalt – Möglichkeiten und Grenzen schulischer und außerschulischer Prävention. In: Schubarth, W./Stöss, R. (Hg.): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz. Opladen 2001, 249-270 Schubarth, W./Ackermann, Ch.: 45 Fragen und Projekte zur Gewaltprävention. Eine Handreichung für Lehrer, Sozialpädagogen und Eltern. Dresden 1997 Schule ohne Rassismus. Ideen, Projekte und Erfahrungen aus der Praxis von Schule ohne Rassismus. Bonn 1996 Schwabe, M.: Eskalation und De-Eskalation in Einrichtungen der Jugendhilfe. Konstruktiver Umgang mit Aggression und Gewalt in Arbeitsfeldern der Jugendhilfe. Frankfurt/M. 1996 Schwind, H.-D./Baumann, J. u.a. (Hg.): Ursachen, Prävention und Kontrolle von Gewalt. Analysen und Vorschläge der Unabhängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission). 4 Bde. Berlin 1990 Scriven, M.: The Logic of evaluation. California: Edgepress 1980 Seehausen, B.: Integration statt Gewalt. Über das Projekt "Sport gegen Gewalt, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit" des Landessportverbands Schleswig-Holstein. In: Olympische Jugend 10/1995, 10 Seifert, Th.: "Verläßlichkeit", "Gebrauchtwerden" und "Bindung" in der Jugendarbeit. In: Böhnisch, L./Rudolph, M./Wolf, B. (Hg.): Jugendarbeit als Lebensort. Weinheim und München 1998, 207-224 Sherman, L. W.: Communities and crime prevention. In: Sherman, L. W. e.a. (Eds.): Preventing crime: what works, what doesn't, what's promising (Chapter 3). University of Maryland: Departement of Criminology and Criminal Justice 1993 Senatsverwaltung für Schule, Berufsbildung und Sport: "Jugend mit Zukunft" Sonderprogramm gegen Gewalt. Teilprogramm "Lebenswelt Schule". Handreichung. Berlin 1995 Siebert, H.: Bildungsarbeit – konstruktivistisch betrachtet. Frankfurt/M. 1996 Siebert, H.: Pädagogischer Konstruktivismus. Eine Bilanz der Konstruktivismusdiskussion für die Bildungspraxis. Neuwied/Kriftel 1999 231 Sims, S. J./Sims, R. R.: Diversity and difference training in the United States. In: Sims, R. R./Dennehy, R. F. (Eds.): Diversity and difference in organizations. An agenda for answers and questions. Westport, CT. 1993, 73-92 Simsa, Chr.: Mediation in Schulen. Schulrechtliche und pädagogische Aspekte. Neuwied, Kriftel 2001 Simsa, Chr.:/Schubarth, W. (Hg.): Konfliktmanagement an Schulen – Möglichkeiten und Grenzen der Schulmediation. Frankfurt a.M. 2001 SINUS: 5 Millionen Deutsche: "Wir sollten wieder einen Führer haben ...". Eine SINUSStudie über rechtsextremistische Einstellungen bei den Deutschen. Reinbek 1981 Slavin, R. A./Cooper, R.: Improving intergroup relations: Lessons learned from cooperative learning programs. In: Journal of Social Issues, 55, 1999, 647-663 Smith, P.K./Sharp, S.: School bullying: Insights and perspectives. Routledge 1994 Spahn, A.G.: Täter-Opfer-Ausgleich aus der Sicht des Jugendrichters. In: DVJJ-Journal 4/2001, 396-398 Specht, W. (Hg.): Sozialraum Hoyerswerda. Stuttgart 1992 Spergel, I.A.: Street Gang Work. Theory and Practice. Reading Mass. 1966 Spergel, I.A./Curry, G.D.: Strategies and Perceived Agency Effectiveness in Dealing with the Youth Gang Problem. In: Huff, C.R. (Ed.): Gangs in America. Newbury Park e.a. 1990 SPI Clearingstelle Jugendhilfe/Polizei: Infoblatt Nr. 17. Berlin 2001 Spiegel, H. v.: Aus Erfahrung lernen. Qualifizierung durch Selbstevaluation. Münster 1993 Spiele, Impulse und Übungen zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit. Schwerte 1996 (AG SOS-Rassismus NRW) Sportjugend Niedersachsen: go Sports-Tour 2002 – Planungsordner: Anlage zu 3.8 – Positionspapier der Sportjugend Niedersachsen Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.): Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus. Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe. Düsseldorf 2000 Staatskanzlei Sachsen-Anhalt (Hg.): Handlungskonzept der Landesregierung: Für ein demokratisches und weltoffenes Sachsen-Anhalt. Magdeburg 1999 Staatskanzlei Sachsen-Anhalt (Hg.): Demokratie braucht viele Stimmen. Dokumentation ausgewählter Redebeiträge der Regionalen Runden Tische für Weltoffenheit und Demokratie. Handlungskonzept der Landesregierung für ein demokratisches, weltoffenes Sachsen-Anhalt – Bilanz des ersten Jahres. Magdeburg 2000 Stahlberg, H.: Schlichtung – Moderation – Mediation. In: Pädagogisches Handeln 1998, 1721 Stange, W./Wiebusch, R.: Pro- und Contra-Diskussion von Kinder- und Jugendgremien. In: Pallentien, Chr./Hurrelmann, K. (Hg.): Jugend und Politik. Ein Handbuch für Forschung, Lehre und Praxis. Neuwied/Kriftel/Berlin 1998, 364-396 Steil, A./Panke, M. (Hg.): Betriebsnahe Bildungsarbeit und moralisches Lernen. Angebote für Lehrende und Lernende in Berufsschulen und Betrieben. Berlin/Flecken Zechlin 2001 Stephan, W.G./Stephan, C.W.: The role of ignorance in intergroup relations. In: Miller, N./Brewer, M.B. (Eds.): Groups in contact. Orlando 1984, 229-278 Stephan, W.G./Stephan, C.W.: Improving intergroup relations. Thousand Oaks 2001 (a) Stephan, W.G./Stephan, C.W.: Intergroup Relations Programs: How Effective Are They? In: Podium International Tolerance Network 2/2001, 1-4 (b) Stickelmann, B. (Hg.): Zuschlagen oder Zuhören. Jugendarbeit mit gewaltorientierten Jugendlichen. Weinheim und München 1996 Stöss, R.: Rechtsextremismus und Wahlen in der Bundesrepublik. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. B11/93 vom 12.03.1993, 50 - 61 Stöss, R./Niedermayer, O.: Rechtsextremismus, politische Unzufriedenheit und das Wählerpotenzial rechtsextremer Parteien in der Bundesrepublik im Frühsommer 1998. Berlin 1998 (Mscr.) 232 Stöss, R.: Rechtsextremismus im vereinten Deutschland. Bonn 2000 (Friedrich-EbertStiftung) Stolz, J.: Soziologie der Fremdenfeindlichkeit. Theoretische und empirische Analysen. Frankfurt a. M. 2000 Stotland, E./Katz, D./Patchen, M.: The reduction of prejudice through the arousal of selfinsight. In: Journal of Personality 27, 1959, 507-531 Streeck-Fischer, A.: Geil auf Gewalt. Psychoanalytische Bemerkungen zu Adoleszenz und Rechtsextremismus. In: Psyche, 46, 1992, 745 – 768 Sturzbecher, D.: Jugend in Ostdeutschland: Lebenssituation und Delinquenz. Opladen 2001 Suchman, E.A.: Evaluative research: Principles and practice in public service and social action Programs. New York 1967 Sue, D. W.: A model for cultural diversity training. In: Journal of Counseling and development 70, 1991, 99-105 Sutterlüty, F.: Gewalterfahrungen und Gewaltkarrieren. Elemente einer empirischen fundierten Theorie der Jugendgewalt. Berlin 2000 (Diss.) Tennstädt, K.-Ch.: Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM). Bd.2.: Theoretische Grundlagen, Beschreibung der Trainingsinhalte und erste empirische Überprüfung. Bern 1991 Tennstädt, K.-Ch./Dann, H.-D.: Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM). Bd. 3: Evaluation des Trainingserfolgs im empirischen Vergleich. Bern 1992 Terwey, M.: Ethnozentrismus in Deutschland: Seine weltanschaulichen Konnotationen im sozialen Kontext. In: Alba, R./Schmidt, P./Wasmer, M. (Hg.): Deutsche und Ausländer. Freunde Fremde oder Feinde? Empirische Befunde und theoretische Erklärungen. Opladen 2000, 295-332 Thiersch, H.: Abenteuer - ein Weg zur Jugend? In: Runtsch, B. (Red.): Abenteuer - ein Weg zur Jugend. Tagungsdokumentation. Frankfurt 1993, 35-53 Thomas, A.: Können interkulturelle Begegnungen Vorurteile verstärken? In: Thomas, A. (Hg.): Psychologie und multikulturelle Gesellschaft. Problemanalysen und Problemlösungen. Göttingen 1994, 227-238 Thornberry, T.P.: Empirical Support for Interactional Theory: A Review of the Literature. In: Hawkins, J.D. (Ed.): Delinquency and Crime. Current Theories. Cambridge 1996, 198-235 Thüringer Landtag 3. Wahlperiode. Protokoll der 25. Sitzung, 14. September 2000 Tiedemann, M.: "In Auschwitz wurde niemand vergast". 60 rechtsradikale Lügen und wie man sie widerlegt. Mülheim 1996 Tiemann, D.: Die Demokratiekampagne in Schleswig-Holstein. In: Dokumentation des zweiteiligen Hearings "Alltagsdemokratie statt Partizipationsspielwiese". Frankfurt 1998 (hrgg. v. Jugendbildungswerk der Stadt Frankfurt am Main und dem Frankfurter Jugendring), 11-24 Tillmann, K.-J./Holler-Nowitzki, B./Holtappels, H.G./Meier, U./Popp, U.: Schülergewalt als Schulproblem. Verursachende Bedingungen, Erscheinungsformen und pädagogische Handlungsperspektiven. Weinheim und München 1999 Ulbrich-Herrmann, M.: Lebensstile Jugendlicher und Gewalt. Die Verknüpfung alltagsweltlicher Verhaltensweisen und ihre Bedeutung für die Erklärung von Jugendgewalt. In: Newsletter 1/1998, 12-33 Ulrich, S.: Achtung (+) Toleranz. Weg demokratischer Konfliktregelung. Praxishandbuch für die politische Bildung. Gütersloh 2000 Vahsen, F. u. Mitarb.: Jugendarbeit zwischen Gewalt und Rechtsextremismus. Darstellung und Analyse aktueller Handlungsansätze. Hildesheim 1994 233 Van Dijk, L./Metzalar, M.: "Das sind wir". Interkulturelles Lernprojekt aus dem Amsterdamer Anne Frank Haus. In: Pädagogik und Schulalltag 2/1995, 228-234 Ver.di (Hg.): Ausgrenzung und Rassismus im Alltag. Dokumentation einer Fachtagung der ÖTV-Jugend Berlin und des ÖTV-Bundesjugendsekretariates am 2. April 2001 im Wannseeforum Berlin. o. J. 2001 Ver.di publik 01/2002 Verfassungsschutzberichte 1991 – 2000. Bonn 1992 – 2001 VIA e.V.: Vernetzung von regionalen Beobachtungsstellen gegen Diskriminierung und Austausch von Standards. o.O. o.J. (2002) Vierter Bericht der Sachverständigenkommission für Kriminalprävention der Hessischen Landesregierung (Landespräventionsrat). o.O. (Wiesbaden) 2000 Villigster Deeskalationsteam Gewalt und Rassismus. Verzeichnis der Trainer/innen und Referent/innen. Schwerte 1999 Voß, St.: Überlegungen zum Begriff der akzeptierenden Jugendarbeit. In: Jugendarbeit mit Skinheads. Dokumentation eines Seminars. Berlin 1993, 93-112 Wacker, A.: Zur Aktualität und Relevanz klassischer psychologischer Faschismustheorien Ein Diskussionsbeitrag. In: Paul, G./Schoßig, B. (Hg.): Jugend und Neofaschismus. Provokation oder Identifikation? Frankfurt/M. 1979, 105 – 137 Wagner, B.: Rechtsextremismus und kulturelle Subversion in den neuen Ländern. In: Bulletin 1/1998. Schriftenreihe des Zentrum Demokratische Kultur. Sonderausgabe. Berlin 1998 Wagner, B.: Keine Akzeptanz von Intoleranz. Grenzen der akzeptierenden Jugendsozialarbeit mit rechtsextremen Jugendlichen. In: Bulletin 1/1999. Schriftenreihe des Zentrum Demokratische Kultur. Berlin 1999 (a) Wagner, B. Zu Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit mit rechtsextrem orientierten jungen Leuten. In: Kalb, P.E./Sitte, K./Petry, Chr. (Hg.): Rechtsextremistische Jugendliche – Was tun? 5. Weinheimer Gespräch. Weinheim und Basel 1999, 122-128 (b) Wagner, B./Richter, R.: Die Geschichtswerkstatt der Jugend des Berlin-Brandenburger Bildungswerkes e.V. - Erste Erfahrungen, Beobachtungen, Überlegungen. In: Möller, K./Schiele, S. (Hg.): Gewalt und Rechtsextremismus. Ideen und Projekte für Soziale Arbeit und Politische Bildung. Schwalbach/Ts. 1996 Wagner, U./Avci, M.: Möglichkeiten der Reduktion von ethnischen Vorurteilen und ausländerfeindlichem Verhalten. In: Thomas, A. (Hg.): Psychologie und multikulturelle Gesellschaft. Göttingen 1994, 106-109 Wagner, U./van Dick, R./Christ, O.: "Möglichkeiten der präventiven Einwirkung auf Fremdenfeindlichkeit/Antisemitismus und fremdenfeindliche/antisemitische Gewalt". Teil III des Gesamtgutachtens "Leitlinien wirkungsorientierter Kriminalprävention". Marburg 2001 (unv. Mscr.) Wahl, K./Tramitz, Chr./Blumtritt, J.: Fremdenfeindlichkeit. Auf den Spuren extremer Emotionen. Opladen 2001 Walker, J.: Gewaltfreie Konfliktlösung im Klassenzimmer. Eine Einführung. Berlin 1991 (Pädagogisches Zentrum) Walker, J.: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Grundschule. Spiele und Übungen. Frankfurt a.M. 1995 Walker, J.: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I. Spiele und Übungen. Frankfurt a.M. 1995 Wandrey, M.: "Was ist drin, wenn TOA draufsteht?" Zu den Auswirkungen unterschiedlicher Rahmenbedingungen, Zielvorstellungen und Vorgehensweisen auf die Qualität des TäterOpfer-Ausgleichs. In: DVJJ-Journal 3/1999, 274-289 Weber, H./Ziegenspeck, J.: Die deutschen Kurzschulen. Weinheim 1983 234 Weidner, J.: Anti-Aggressivitäts-Training für Gewalttäter. Bonn 1990 Weidner, J.: Jungen - Männer - Aggression. Über geschlechtsreflektierende GewaltIntervention mit dem Anti-Aggressivitäts-Training. In: Möller, K. (Hg.): Nur Macher und Macho? Geschlechtsreflektierende Jungen- und Männerarbeit. Weinheim und München 1997, 257-272 Weidner, J./Kilb, R./Kreft, D. (Hg.): Gewalt im Griff. Neue Formen des Anti-AggressivitätsTrainings. Weinheim und Basel 1997 Weiß, N.: NGOs and Police Against Prejudice – NAPAP. Ausbildungsmaßnahme im Rahmen der Ausbildung von Anwärtern für den Mittleren Polizeivollzugsdienst. Evaluationsbericht vom 17.09.1999. Potsdam 1999 (unveröff. Papier) Weiß, N.: Polizei für interkulturelle Verständigung in Brandenburg PiViB. Maßnahme im Rahmen der Ausbildung von Studenten der FHpolBRB für den Gehobenen Polizeivollzugsdienst und von Anwärtern für den Mittleren Polizeivollzugsdienst. Evaluationsbericht für das Jahr 2000. Potsdam 2001 (a) (unveröff. Papier) Weiß, N.: Polizei für interkulturelle Verständigung in Brandenburg PiViB. Maßnahme im Rahmen der Ausbildung von Studenten der FHpolBRB für den Gehobenen Polizeivollzugsdienst. Evaluationsbericht für das Jahr 2001. Potsdam 2001 (b) (unveröff. Papier) Welzer, H.: "Bei uns waren sie immer dagegen". Wie im Familiengespräch aus Zuschauern und Tätern Helden des alltäglichen Widerstands werden. In: Frankfurter Rundschau 06.01.2001 Wendt, W. R.: Geschichte der sozialen Arbeit. Stuttgart 1995 (4. erw. u. überarb. Auflage) Wicker, A.W.: Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. In: Journal of Social Issues, 1969, 25, 41-78 Wilpert, C.: Eine Welt der Vielfalt e.V. – Diversity- und Anti-Diskriminierungs-Trainings. In: Landeszentrum für Zuwanderung NRW (Hg.): Interkulturelle und antirassistische Trainings – aber wie? Konzepte, Qualitätskriterien und Evaluationsmöglichkeiten. Solingen 2001, 65-78 Wink, St./Feuerhelm, W./Frühauf, H.-P.: Rechtsextremismus und lokale Gegenstrategien. Der Lokale Aktionsplan Jugend für Toleranz und Demokratie der Stadt Mainz – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Mainz 2002 (Stadt Mainz) Winkler, J.R./Jaschke, H.-G./Falter, J.W.: Einleitung: Stand und Perspektiven der Forschung. In: Politische Vierteljahreszeitschrift. Sonderheft 27/1996: Rechtsextremismus. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung, 9-21 Wippermann, C.: Die kulturellen Quellen und Motive rechtsradikaler Gewalt – Aktuelle Ergebnisse des sozialwissenschaftlichen Instituts Sinus Sociovision. In: jugend & GESELLSCHAFT 1/2001, 4-7 Wittig, M. A./Molina, L.: Moderators and mediators of prejudice reduction in multicultural education. In: Oskamp, S. (Ed.): Reducing prejudice and discrimination. Mahwah, N.J. 2000, 295-318 Wittmeier, M.: Internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz. Zur Pädagogik der Erinnerung in der politischen Bildung. Frankfurt a.M. 1997 Wochenschau-Verlag: Jugend und Gewalt. (Heft für die Sek. I) Schwalbach/Ts. 1993 Wochenschau-Verlag: Deutschland von rechts. (Heft für die Sek. II). Schwalbach/Ts. 1994 Wochenschau-Verlag: Jugend und Gewalt. (Heft für die Sek. I) Schwalbach/Ts. 1997 Wochenschau-Verlag: Rassismus – Antisemitismus. (Heft für die Sek. II) Schwalbach/Ts. 1999 Wolters, J.-M.: Kampfkunst als Therapie. Die sozialpädagogische Relevanz asiatischer Kampfsportarten, aufgezeigt am Beispiel des sporttherapeutischen Shorinji-Ryu-Karatedo zum Abbau der Gewaltbereitschaft und Aggressivität bei inhaftierten Jugendlichen. Frankfurt/Bern/New York/Paris 1992 235 Wolters, J.-M.: Erlebnisorientierter Sport mit gewalttätigen Jugendlichen. In: Zeitschrift für Erlebnispädagogik 9/1994, 46-57 Wottawa, H./Thierau, H.: Lehrbuch Evaluation. Bern, Stuttgart, Toronto 1990 Xenos - Leben und Arbeiten in Vielfalt. Bonn 2001 (Broschüre; hrsgg. von der Nationalen Koordinierungsstelle XENOS efp – Europabüro für Projektbegleitung GmbH) Ziegenspeck, J.: Segeln auf der "Johannes Georgi". Erziehung durch die See. Sozialpädagogische Konzeption und erste Erfahrungen. Lüneburg 1983 Zwaka, P.: Gewalt und Ausgrenzung in der Geschichte – Eine Projektreihe gegenwartsorientierter Geschichtsprojekte im Jugendmuseum Schöneberg. In: Kammerer, B/Prölß-Kammerer, A. (Hg.): recht extrem.de. Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Rechtsextremismus – Konzepte und Projekte der politischen und historischen Bildung. Nürnberg 2002, 236-247 Zweiwochendienst Bildung/Wissenschaft/Kulturpolitik Heft 13-14 u. 15/2000 Zwischenbericht Modellprojekt "Team Z". Stuttgart 2001 (Red. S. Frech) (unv. Papier) Zwischenbericht CIVITAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern. Amadeu-Antonio-Stiftung/Stiftung Demokratische Jugend. November 2001 (unv. Papier) 7. Internetadressen: www.act2001.de www.aktioncourage.org www.annefrank.de www.auswaertiges-amt.de/infoservice/download/pdf/mr/bercerd.pdf www.basta-net.de/aktionen/aktionen3.html www.bayern.de www.bkj.de/mutproben www.bmfsfj.de/dokumente/Struktur/ix_28765.htm www.bnr.de www.bra.se/web/material www.b.shuttle.de/b/frbayer-os/proj-ued.htm www.buendnis-fuer-kinder.de www.buendnis-toleranz.de www.buendnis-toleranz.de/Aufgaben-und-Ziele-.571.8206/.htm www.christen-und-juden.de www.d-a-s-h.org/Dossier/Dossier3/3_05.shtml www.djb-ev.de/noteingang www.dji.de www.eyetoeye.org www.fassmichnichtan.de www.gegen-vergessen.de www.gemeinsam-gegen-gewalt.de www.geocities.com/Vienna/Choir/5849/dgn/ProBesch.html www.gesichtzeigen.de www.howru.de www.hu-bildungswerk.de/onlinearchiv_buchenwald.htlm www.ich-mache-politik.de 236 www.integrationswettbewerb.de www.it-unternehmen-gegen-r...e www.jugendnetz-berlin.de/respect/index2.htm www.jugendwettbewerbe.com www.kamalatta.de/opferperspektive/Opferperspektive.html www.kino-gegen-Gewalt.bjfev.de www.kommunen-gegen-gewalt.de/DSTGB.asp www.kriminalpraevention.de www.kriminalpraevention-mv.de www.kultus-mv.de www.lernen-aus-der-geschichte.de www.leu.bw.schule.de/allg/gewalt/projekte.html www.linksruck.de/litera/agr www.mainzer-appell.de www.musikschulen.de www.mv-regierung.de/im/pages/demokratie.htm www.naiin.de www.nefkom.net/loester/fakten1.htm www.nrwgegendiskriminierung.de www.NRWGegenRechts.de www.nrw.de/zivilcourage www.niedersachsen.de/MI_Integration.htm www.niedersachsen.de/pdf/zusammenstellungPraevention.pdf www.oekumene-ack.de www.opferperspektive.de www.paritaet.org/via/kjp-sind.htm www.people.freenet.de/afeb/fremd.html www.ph-heidelberg.de/org/phb/Zivil.html www.phoenix-ev.org www.prof-jens-weidner.de/konfron/konfron.html www.renovabis.de www.sachsen.de/de/bf/verwaltung/verfassungsschutz/aktuelles/index.html www.saufengegenrechts.de www.sensjs.berlin.de www.skinheads.de www.sonnensegel.de www.spurensuche-online.de/projekte www.step21.de www.stmi.bayern.de/infothek/rechtsextrem/massnahmen/htm www.Tik-iaf-berlin.de www.verantwortung.de www.verfassungsschutz.de www.wcc-coe.org www.werwenn.de www.xenos-d.de 8. Anhang 237