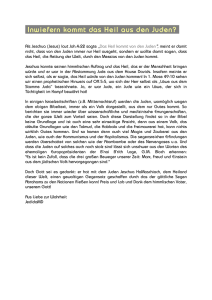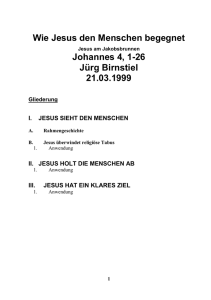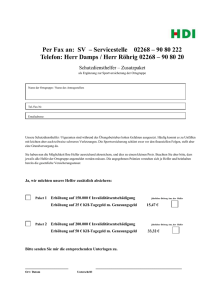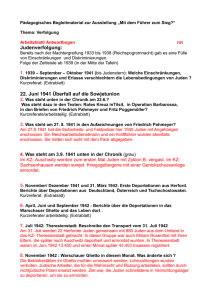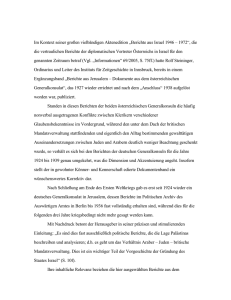Helfer III
Werbung
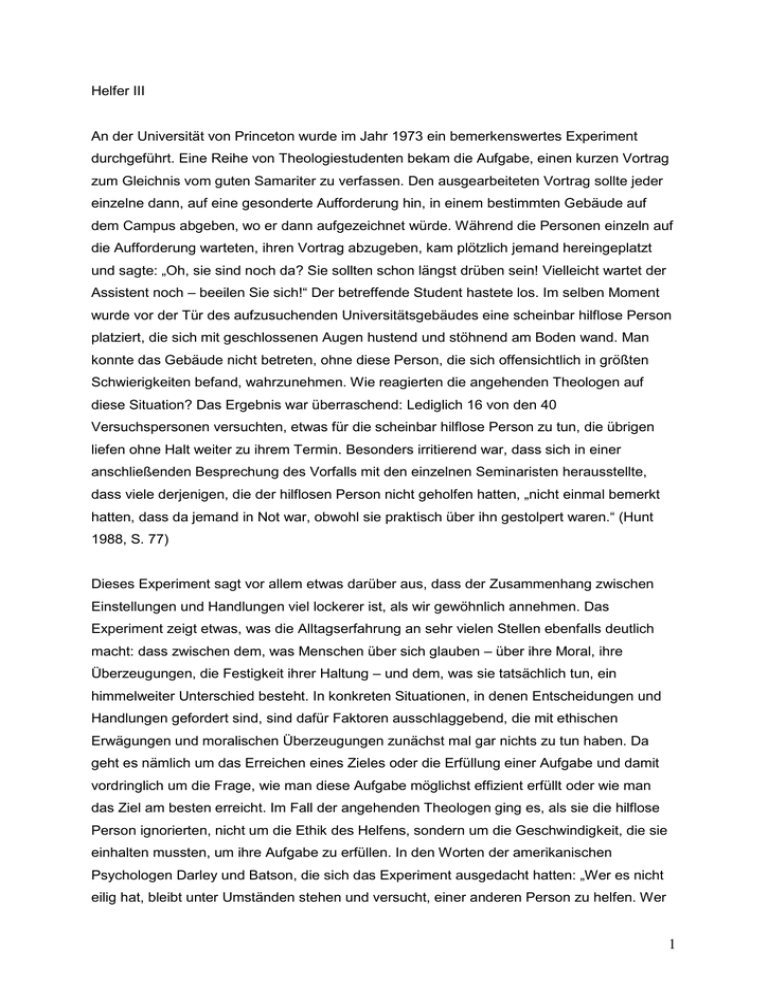
Helfer III An der Universität von Princeton wurde im Jahr 1973 ein bemerkenswertes Experiment durchgeführt. Eine Reihe von Theologiestudenten bekam die Aufgabe, einen kurzen Vortrag zum Gleichnis vom guten Samariter zu verfassen. Den ausgearbeiteten Vortrag sollte jeder einzelne dann, auf eine gesonderte Aufforderung hin, in einem bestimmten Gebäude auf dem Campus abgeben, wo er dann aufgezeichnet würde. Während die Personen einzeln auf die Aufforderung warteten, ihren Vortrag abzugeben, kam plötzlich jemand hereingeplatzt und sagte: „Oh, sie sind noch da? Sie sollten schon längst drüben sein! Vielleicht wartet der Assistent noch – beeilen Sie sich!“ Der betreffende Student hastete los. Im selben Moment wurde vor der Tür des aufzusuchenden Universitätsgebäudes eine scheinbar hilflose Person platziert, die sich mit geschlossenen Augen hustend und stöhnend am Boden wand. Man konnte das Gebäude nicht betreten, ohne diese Person, die sich offensichtlich in größten Schwierigkeiten befand, wahrzunehmen. Wie reagierten die angehenden Theologen auf diese Situation? Das Ergebnis war überraschend: Lediglich 16 von den 40 Versuchspersonen versuchten, etwas für die scheinbar hilflose Person zu tun, die übrigen liefen ohne Halt weiter zu ihrem Termin. Besonders irritierend war, dass sich in einer anschließenden Besprechung des Vorfalls mit den einzelnen Seminaristen herausstellte, dass viele derjenigen, die der hilflosen Person nicht geholfen hatten, „nicht einmal bemerkt hatten, dass da jemand in Not war, obwohl sie praktisch über ihn gestolpert waren.“ (Hunt 1988, S. 77) Dieses Experiment sagt vor allem etwas darüber aus, dass der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Handlungen viel lockerer ist, als wir gewöhnlich annehmen. Das Experiment zeigt etwas, was die Alltagserfahrung an sehr vielen Stellen ebenfalls deutlich macht: dass zwischen dem, was Menschen über sich glauben – über ihre Moral, ihre Überzeugungen, die Festigkeit ihrer Haltung – und dem, was sie tatsächlich tun, ein himmelweiter Unterschied besteht. In konkreten Situationen, in denen Entscheidungen und Handlungen gefordert sind, sind dafür Faktoren ausschlaggebend, die mit ethischen Erwägungen und moralischen Überzeugungen zunächst mal gar nichts zu tun haben. Da geht es nämlich um das Erreichen eines Zieles oder die Erfüllung einer Aufgabe und damit vordringlich um die Frage, wie man diese Aufgabe möglichst effizient erfüllt oder wie man das Ziel am besten erreicht. Im Fall der angehenden Theologen ging es, als sie die hilflose Person ignorierten, nicht um die Ethik des Helfens, sondern um die Geschwindigkeit, die sie einhalten mussten, um ihre Aufgabe zu erfüllen. In den Worten der amerikanischen Psychologen Darley und Batson, die sich das Experiment ausgedacht hatten: „Wer es nicht eilig hat, bleibt unter Umständen stehen und versucht, einer anderen Person zu helfen. Wer 1 es eilig hat, wird eher weitereilen, selbst wenn er sich eilt, um über das Gleichnis vom guten Samariter zu sprechen.“ (zit. nach Hunt 1988, S. 77) Was sagen solche Befunde über die Frage aus, warum manche Menschen in ausgrenzenden und totalitären Gesellschaften zu Tätern, viele zu Mitläufern und Profiteuren und nur sehr wenige zu Helfern, Rettern oder Widerständlern werden? Zunächst einmal, dass es selten eine Frage der Moral ist, für welche Verhaltensweise eine Person sich entscheidet. Die Funktion von Moral ist nämlich vor allem die, Gemeinschaft zu stiften und zu sichern: zu uns gehört, wer unsere moralischen Normen teilt. Diese soziale Funktion der Moral ist aber etwas völlig anderes als die Funktion, die gewöhnlich von ihr erwartet wird: nämlich handlungsleitend zu wirken, was sie aller Erfahrung nach eben nur höchst selten leistet. Viel eher als nach der Moral fällen Menschen ihre Entscheidungen danach, welche Verhaltensweise ihnen in der jeweiligen Situation als die Sinnvollste erscheint, und was sinnvoll ist, definiert sich nach ihren Interessen, Bedürfnissen und Möglichkeiten. Dabei muß man bedenken, dass Menschen ihre Verhaltensweisen und das, was sie für normal und angemessen halten, mit sich verändernden Verhältnissen ebenfalls verändern. Das kann man vielleicht am deutlichsten am Beispiel des Nationalsozialismus sehen, wo innerhalb weniger Monate soziale Umgangsformen etabliert und für normal gehalten wurden, die kurz zuvor als völlig inakzeptabel, unwürdig und unmenschlich gegolten hätten. Im März 1933 etwa hätten es die meisten Deutschen wohl für verwunderlich, wenn nicht für undenkbar gehalten, wenn man Juden verwehrt hätte, öffentliche Parks zu betreten oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und wenn an jedem Ortsschild gestanden hätte: „Juden sind hier unerwünscht!“ Nur wenige Jahre später war das alles Teil einer ganz selbstverständlichen Wirklichkeit, über die sich keiner der Nicht-Betroffenen sonderlich aufregte. So war es eben. Und weiter: Wenn solche gegenmenschlichen Umgangsformen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit geworden sind, wird es nur noch wenig Aufmerksamkeit erregen, wenn Menschen aus den für sie bereits eingerichteten „Judenhäusern“ geholt und an zentralen Stellen gesammelt werden, um sie dann gen Osten zu deportieren. So etwas wäre Anfang 1933 noch ganz und gar unvorstellbar gewesen, und gewiß hätten die meisten Deutschen so etwas 1936 auch nicht mit der Gleichgültigkeit hingenommen, wie sie es 1941 taten. Da war es bereits nicht mehr als ein unangenehmer, aber doch nicht ungewöhnlicher Bestandteil ihres ganz normalen Lebens. 2 Wenn man Motive für Täterverhalten auf der einen Seite und Helfer- und Retterverhalten auf der anderen Seite sucht, verfällt man allzu leicht in den Irrtum, diese Motive in der Biographie und in der Persönlichkeitsstruktur der Betreffenden zu suchen – so, als gäbe es eben Menschen, die vor dem Absturz in die Gegenmenschlichkeit gefeit sind, und andere, die dafür prädestiniert sind. Sicherlich gibt es bessere und schlechtere Menschen, aber ausschließlich gute sind ebenso pathologische Grenzfälle wie ausschließlich böse Menschen: beide sind nämlich nicht in der Lage, reflexiv und flexibel mit unterschiedlichen Situationen und Anforderungen umzugehen. Die übergroße Mehrheit der Menschen dagegen verhält sich im Leben höchst widersprüchlich, und das aus gutem Grund. Denn Menschen bewegen sich in modernen Gesellschaften in völlig verschiedenen sozialen Situationen mit wechselvollen Ansprüchen und Anforderungen an ihre Person – und man erwartet von ihnen, dass sie sich gegenüber einem Baby anders verhalten als gegenüber einem Zwölfjährigen und wiederum anders gegenüber einem Erwachsenen, dass sie mit der Partnerin oder dem Partner anders umgehen als mit Freunden und wieder anders als mit Kollegen und noch einmal anders mit den Vorgesetzten. Sie zeigen völlig unterschiedliches Verhalten auf dem Sportplatz, auf der Zuschauertribüne, im Wartezimmer eines Arztes oder auf dem Behandlungsstuhl eines Zahnarztes. Menschen bewegen sich jeden Tag durch viele soziale Räume, und in jedem existiert ein anderer Rahmen für das Verhalten, das jeweils als angemessen betrachtet wird. Jemand, der sich immer gleich verhielte, würde sofort für verrückt erklärt werden. Wir sind also in erstaunlichem Maße in der Lage, je nach Situation jeweils unterschiedliches Verhalten zu zeigen und dabei auch durchaus bestimmte Eigenschaften zu betonen und andere zu vernachlässigen. Die bisherige, übrigens erstaunlich spärliche Forschung zu den Helfern und Rettern im Holocaust ist trotz dieser normalen Widersprüchlichkeit von Menschen lange Zeit von der Vorstellung ausgegangen, dass es so etwas wie den geborenen Retter geben müsste, der über eine besondere Persönlichkeitsstruktur und besondere Eigenschaften verfügt. Anders sei nicht erklärlich, wieso diese wenigen Menschen sich im „Dritten Reich“ dem gegenmenschlichen Zug der Mehrheit entgegenstellen und sich anders verhalten konnten. Die umfangreichste Studie zur „Altruistischen Persönlichkeit“ haben Samuel und Pearl Oliner 1988 vorgelegt. Für ihre Untersuchung interviewten sie 700 Retter, Überlebende und Personen, die weder das eine noch das andere waren, um herauszufinden, welche Merkmale eine Retterpersönlichkeit von anderen unterscheiden. Das Problem dieser an sich verdienstvollen Studie ist, dass die interviewten Retter jene Kriterien erfüllen mussten, die auch in Yad Vashem angelegt werden, um jemanden als „Gerechten unter den Völkern“ auszuzeichnen – das heißt, diese Personen mussten aus freien Stücken, unter hohem persönlichen Risiko und unentgeltlich 3 geholfen haben. Diese Kriterien lassen zum einen die höchst unterschiedlichen Bedingungen unberücksichtigt, unter denen jemand zum Helfer oder Retter wird oder überhaupt werden kann, zum anderen führen sie in einen methodischen Zirkelschluß: denn wenn als Retter nur altruistische Persönlichkeiten interviewt werden, ist der Schluß nicht überraschend, dass eine altruistische Persönlichkeitsstruktur die Voraussetzung für Hilfeverhalten ist. Die soziale Wirklichkeit sieht freilich anders aus, wie die Historiker Wolfgang Benz und Juliane Wetzel schreiben: „manche Helfer taten es aus Nächstenliebe, aus religiöser Überzeugung, andere wegen ihrer antifaschistischen Orientierung aus Opposition gegen das NS-Regime, wieder andere wollten Freunde nicht im Stich lassen und viele andere kannten ihre Schützlinge gar nicht, kamen aus reinem Zufall in die Situation, plötzlich jemanden zu verstecken, ohne über die drohende Einweisung in ein KZ oder gar die Todesstrafe nachzudenken. Es gab auch solche Helfer, die sich persönliche Vorteile verschafften, sei es durch Geld- oder Sachleistungen“. (Benz & Wetzel 1996, S. 15) Dass sich Helferverhalten nicht damit erklären lässt, dass gute Menschen helfen und schlechte nicht, wird besonders deutlich, wenn man sich eines der bizarrsten und traurigsten Kapitel aus dem Alltag der Verfolgung anschaut: Ab 1943 hatte die Gestapo in Berlin eine Reihe sogenannter Greifer im Einsatz, die untergetauchte Juden aufspüren und ausliefern sollten. Die „Greifer“ waren jüdische Frauen und Männer, die ihrerseits hofften, mit ihren Diensten für die Gestapo der eigenen Deportation und damit dem sicheren Tod zu entgehen, was freilich eine trügerische Hoffnung war. Die berüchtigste unter ihnen war Stella Goldschlag, eine höchst attraktive junge Frau, auf deren Konto allein eine zweistellige Zahl verratener Juden ging. Insgesamt fielen den „Greifern“ einige Hundert untergetauchte Juden zum Opfer. Welches Persönlichkeitsmuster würde man den „Greifern“ zuordnen? Würden sie richtig beschrieben sein, wenn man sie als „verräterische“ oder „Spitzelpersönlichkeiten“ bezeichnete? Hier sieht man, dass Menschen ihre Verhaltensweisen nach ihren Handlungsmöglichkeiten ausrichten müssen, weshalb sich aus dem, was sie tun, nicht kausal auf ihre Persönlichkeitsstruktur rückschließen lässt. Die Sache wird nicht einfacher, wenn man weiß, dass sowohl Stella Goldschlag als auch andere „Greifer“ ihre Beziehungen zur Gestapo auch dafür nutzten, Personen, die ihnen nahestanden, vor Durchsuchungen zu warnen oder ihnen anderweitig halfen. Welche Persönlichkeitseigenschaften schreibt man ihnen vor diesem Hintergrund zu? Und welche Persönlichkeitsstruktur offenbart ein Mann, der eine jüdische Frau bei sich aus zunächst ganz altruistischen Motiven versteckt, später aber die Situation ausnutzt, um mit ihr zu schlafen? Welche zeigt die antisemitische Pfarrersfrau, die trotz ihrer Überzeugung Juden 4 versteckt, welche der „meschuggene SS-Mann“, der Michael Degen und seiner Mutter hilft? Welche das NSDAP-Mitglied Robert Holtz, der eine ganze Familie versteckt (alle Beispiel bei Borgstedt 2004, S. 309)? Was fängt man an mit einer Person wie Wilhelm Kube, Generalkommissar von Weißruthenien und seiner Biographie und Funktion nach ein absolut überzeugter Nationalsozialist, Antisemit und Vernichtungstäter in großem Maßstab, der andererseits aber intensiv um das Leben einiger deutscher Juden kämpfte, dafür zahlreiche Konflikte in Kauf nahm und in einem Fall auch erfolgreich war? Und was sagt es aus, dass Hilfe vielfach in sozial randständigen Milieus geleistet wurde – von Prostituierten, Kleinkriminellen, Schiebern usw.? Sicher wenig über die Bedeutung altruistischer Persönlichkeitsstrukturen, dafür gewiß einiges darüber, dass soziale Außenseiterstellungen auch eine größere Bereitschaft zu abweichendem Verhalten mit sich bringen und insofern auch ein Reservoir für Hilfeverhalten darstellen können. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der es kaum sinnvoll erscheinen lässt, Gründe für Helferverhalten in altruistischen Persönlichkeitsstrukturen zu suchen: Wenn man als Däne oder Belgier Juden gerettet hat, befand man sich in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Dänen oder Belgier, wenn man das als Deutscher oder Pole oder Ukrainer machte, tat man das in krasser Abweichung von dem, was die Mehrheit der Deutschen, Polen oder Ukrainer dachte und befürwortete. Insofern riskierten Helfer und Retter in Deutschland oder Polen nicht nur mehr, wenn sie jemandem halfen, sie hatten auch viel weniger sozialen Rückhalt bei dem, was sie taten. Und logischerweise war es für sie auch viel schwieriger, ihrerseits Unterstützung und Hilfe für ihre Aktionen zu bekommen. Oder anders gesagt: Was in einem Land als erwünschtes und normales Verhalten gilt, ist in einem anderen abweichend und unnormal. Es ist also ausgesprochen schwierig, dem schillernden Phänomen des Helfer- und Retterverhaltens auf die Spur zu kommen – und so betrachtet, ist es kein Wunder, dass wir bis heute so wenig darüber wissen, warum sich manche Menschen in extremen Situationen altruistisch verhalten, während die meisten anderen das nicht tun. Vermutlich kommt man dem Rätsel etwas besser auf die Spur, wenn man von zwei sehr einfachen Annahmen ausgeht: Erstens kann man, wie das Beispiel der Greifer gezeigt hat, nicht vom Ergebnis des Handelns einer Person auf ihre Persönlichkeit rückschliessen. Menschen gehen nicht im Ergebnis von Handlungen auf, die aufgrund sehr vielfältiger Faktoren zustande kommen, von denen nur wenige der freien Wahl der Handelnden unterliegen. Das bedeutet zugleich, dass sich Verhalten nicht als etwas Statisches 5 beschreiben lässt, sondern nur als Prozeß, und in diesen Prozeß gehen neben objektiven situativen Faktoren eine Reihe von sozialen Bedingungen ein: man richtet nämlich sein Handeln in viel stärkerem Maße an dem aus, was die anderen tun oder tun werden, als man das normalerweise wahrhaben möchte. Man kann sich das einfach an der eigenen Erfahrung klarmachen, dass es einem höchst peinlich ist, wenn man sich aus Unkenntnis, Ungeschicklichkeit oder Gedankenlosigkeit anders als die Anderen verhalten hat – und wir alle wissen, dass die Abweichung von dem, was von einem erwartet wird, zu den unangenehmsten Gefühlen führt, die man sich vorstellen kann. Grundsätzlich ist unser Handeln viel weniger individualistisch, als wir selbst glauben, und viel mehr orientiert an den Normen der Wir-Gruppe, zu der wir gehören oder gehören möchten. Deshalb bedarf es meist einer konkreten oder wenigstens einer gefühlten Übereinstimmung mit einer anderen Person oder Gruppe, um zum Helfer oder Retter werden zu können. Die zweite Annahme ist, dass wir nur auf der Grundlage dessen handeln können, was wir wahrnehmen. Denn erst, was wahrgenommen wird, kann gedeutet werden. Und Deutungen sind wiederum erst die Grundlage für Entscheidungen, aus denen dann Handlungen folgen. Das heißt zunächst einmal, dass man überhaupt etwas als Problem wahrnehmen muß, um sich zu einer Handlung veranlasst zu fühlen. Die meisten der Theologiestudenten im GuterSamariter-Experiment hatten ja deshalb nicht geholfen, weil sie die hilflose Person gar nicht erst wahrgenommen hatten. Konkret heißt das, dass die zunehmende Ausgrenzung und Verfolgung der Juden in Deutschland überhaupt als Problem wahrgenommen werden musste, bevor jemand in die Verlegenheit kam, sich zu überlegen, ob hier seine Hilfe gefragt sei. Dabei scheiden zunächst mal alle diejenigen aus dem Kreis der potentiellen Helfer aus, die die Behandlung der Juden begrüßen oder ihr gleichgültig gegenüberstehen. Und diejenigen, die vielleicht anderer Auffassung sind, aber keine direkten Beziehungen mit jüdischen Deutschen haben, haben oft keine realistische Einschätzung ihrer Situation. Victor Klemperer, der als Jude in Dresden überlebte, zeigt sich jedenfalls in seinen Tagebüchern oft verwundert darüber, wie wenig die nichtjüdischen Deutschen darüber wissen, welchen Einschränkungen die Juden ausgesetzt sind und dass ihre Situation buchstäblich von Tag zu Tag beengter und bedrohter wird. In der Sozialpsychologie ist viel über den bedrückenden Umstand geforscht worden, dass es immer wieder vorkommt, dass eine große Zahl von Menschen eine Gewalttat oder einen Unfall beobachtet, aber niemand einschreitet oder hilft. Dieser sogenannte Zuschauereffekt beruht darauf, dass die Passivität aller Herumstehenden jeden einzelnen in seiner 6 Unschlüssigkeit darüber bestärkt, ob hier seine Hilfe gefordert ist oder nicht – weshalb er sich dann in der Regel ebenfalls dafür entscheidet, passiv zu bleiben. Zugleich haben diese Experimente zum Hilfeverhalten gezeigt, dass die Entscheidung zur Hilfe sehr stark davon abhängig ist, wer Unterstützung benötigt: attraktiven Menschen wird eher geholfen als unattraktiven; Menschen, die ihren äußeren Merkmalen nach der Wir-Gruppe entsprechen, zu der man sich selber zählt, hilft man eher als solchen, die man fremden Gruppen zuordnet. Personen, die – wie zum Beispiel Betrunkene – ihre Notlage selbst verursacht zu haben scheinen, wird seltener geholfen, als Menschen, die ohne eigenes Zutun in eine üble Lage geraten sind (Hunt 1988, S. 158). Man kann sich vor dem Hintergrund solcher Befunde überlegen, was es für die Hilfebereitschaft der Deutschen bedeutete, wenn Menschen in Not waren, die antisemitischen Vorurteilen und rassistischer Propaganda zufolge alle negativen Eigenschaften auf sich zu vereinigen schienen, zunehmend in eine Situation der Verelendung und Verwahrlosung gebracht worden waren und zudem eindeutig nicht der WirGruppe zugehörig schienen. Und selbst wenn eine Person in einem solchen Klima die Not der Anderen wahrnahm und sich zum Helfen veranlasst sah, war das immer noch nicht gleichbedeutend damit, tatsächlich auch einen Handlungsspielraum für das Helfen zu sehen und sich selbst zuzutrauen, erfolgreich Unterstützung leisten zu können. Die Demütigung, Ausgrenzung und Beraubung der Juden gehörte so essentiell zur Wirklichkeit des „Dritten Reiches“, dass sie einfach normal schien – also nicht als etwas, was für Nicht-Betroffene eine besondere Aufforderung darstellt, aktiv zu werden. Noch heute erzählen die meisten Zeitzeugen des Nationalsozialismus, dass man ja nicht mitbekommen habe, was mit den Juden geschah – und aus meiner Sicht handelt es sich dabei nicht einfach um eine Lüge, sondern um die Wiedergabe einer historischen Wahrnehmungsweise. Wie man aus der Gedächtnisforschung weiß, wird das, was selbstverständlicher Bestandteil von Wirklichkeit war, später kein besonderes oder herausgehobenes Element von Erinnerung. Das Gedächtnis bewahrt nicht das Alltägliche, Routinehafte und Gewöhnliche auf, sondern das Außergewöhnliche, das also, was besonders schön oder besonders schlimm war. Hierzu zwei Beispiele, die andeuten, wie sehr die Verfolgung zum selbstverständlichen Alltag der Volksgemeinschaft zählte. Im ersten erzählte eine ältere Dame aus Bremen darüber, wie sie als Kind Kontakt mir russischen Kriegsgefangenen hatte: „Auf dem Gelände stand damals ein rohes, halbfertiges Gebäude; in dem waren Russen untergebracht. Junge Burschen, kahlgeschoren, in zerlumpten, alten Kleidern. – Barfuss, auch, wenn es kalt war. – 7 Saßen draußen und haben irgendwas geschnitzt. Und wenn wir Kinder in ihre Nähe kamen, dann sind sie aufgestanden, haben eine Hand durch den Zaun gesteckt, um gleichzeitig mit der anderen Hand so Bewegungen zum Mund hin zu machen. Wir Kinder konnten damit nicht viel anfangen und haben gelacht. Weil die so komisch aussahen, so ausgemergelte Gesichter mit so großen Augen […] Ich hatte keine Angst vor ihnen, bis die Mutter uns sagte, wir sollten da nicht so nahe herangehen.“ (Betscher 2005, S. 68) Eine andere alte Dame berichtet über die vorbeimarschierenden Häftlingskolonnen: „Diese Männer waren natürlich auch in Lumpen gekleidet und sahen für uns Kinder recht lustig aus. Und unsere Oma, die sagte dann immer zu uns: Wir müssen aufpassen, die Trula-Männer kommen ja gleich! Wir liefen dann zum Fenster und haben uns gefreut, wenn die da rumgewühlt haben“ (Betscher 2005, S. 69). Diese Zitate sind einer Studie über den Alltag der Verfolgung entnommen, die die junge Historikerin Silke Betscher kürzlich verfasst hat. In ihrer Untersuchung kommen auch Familien vor, die die morgendliche Uhrzeit mit der Frage ermittelt haben, ob die Häftlingskolonne schon durch sei oder nicht. In einer solchen gegenmenschlichen Atmosphäre sind Normen des Mitleids und der Nächstenliebe genauso verschoben wie die Kriterien dafür, welches Verhalten als sozial erwünscht und welches als abweichend betrachtet wird. Während die Ausgrenzung und Verfolgung einen immer selbstverständlicheren Teil der nationalsozialistischen Normalität bildete, wurden andere Wirklichkeitsdeutungen immer seltener, aber es gab sie doch. Sie konnten zum Beispiel darauf basieren, dass man am Schicksal jüdischer Bekannte oder Freunde teilhatte oder darauf, dass man selbst Unterstützung und Solidarität in einer heiklen Situation erlebt hatte. Oder auch darauf, dass man Beispiele eigenständigen Denkens und Handelns vor Augen hatte, wie es etwa Otl Aicher, der dem Widerstand um die Geschwister Scholl nahestand, über einen seiner Lehrer berichtet: „Nur wer in einer finsteren Zeit gelebt hat, weiß, was es bedeutet, vielleicht nur für einen persönlich bedeutet, wenn ein Biologielehrer vor der Klasse steht und Einführungen in Grundlagen der Naturwissenschaft gibt und dann folgendes sagt: Die biologische Substanz ist als Materie wertlos. Wenn man in der einen Hand einen Nationalsozialisten hätte, in der anderen einen Haufen Dreck, so wäre das – rein biologisch gesehen – ein- und dasselbe.“ (Aicher 1985, S. 35) Kommen wir damit zum Ausgangspunkt zurück: Den Motiven für Helfer- und Retterverhalten kommt man deshalb so schwer auf die Spur, weil es immer nur eine verschwindend kleine Minderheit ist, die sich abweichend verhält, sich die Angehörigen dieser Minderheit aber nicht durch besondere soziale und persönliche Merkmale vom Rest der Gesellschaft unterscheiden. Wenn man Helfer- und Retterverhalten verstehen will, muß man die Gründe 8 dafür wahrscheinlich woanders suchen als in den Biographien oder in den persönlichen Motiven der Helfer und Retter. Vielleicht liegen die Gründe dafür, weshalb jemand zum Helfer oder Retter wird, viel eher auf sozialer als auf persönlicher Ebene – dort nämlich, wo jemand direkt um Hilfe bittet, dort, wo man zu einem Netzwerk von Personen gehört, das bereits hilft und nun weitere Unterstützung braucht, oder dort, wo jemand ein Verhalten zeigt, dem man nacheifern möchte. Kurz gesagt: der Grund dafür, dass sich unter denselben äußeren Bedingungen gigantische Mehrheiten einer Bevölkerung konform verhalten, auch dann, wenn diese Konformität gleichbedeutend mit Gleichgültigkeit, Ausgrenzung, Verfolgung und Beraubung ist, und nur verschwindende Minderheiten sich gegen die Unmenschlichkeit entscheiden, ist nicht in abstrakten Gründen und Motiven, sondern in der konkreten Praxis zu suchen. Zufall, soziale Nähe, gefühlte Erwartungen an die eigene Person, Hilfemöglichkeiten und die Wahrnehmung von Handlungsspielräumen und – möglichkeiten – solche konkreten Dinge spielen vermutlich eine viel größere Rolle für die Entscheidung, ob man das persönliche Risiko des Helfens und Rettens auf sich nimmt, als abstrakte Einstellungen und Überzeugungen. Für die Forschung bedeutet das, dass man sich in Zukunft viel genauer die Situationen anschauen muß, in denen Menschen geholfen haben, und nicht bloß die Menschen, die geholfen haben. Und damit würde auch die Pädagogik eine neue Perspektive gewinnen: Denn die reinen guten altruistischen Retter, die stillen Helden, wie sie neuerdings genannt werden, sind als Menschen genauso fern, unerreichbar und abstrakt wie die absolut Bösen vom Schlage Joseph Goebbles, Rudolf Höss oder Amon Göths. Der Holocaust ist von psychisch ganz normalen Menschen ins Werk gesetzt und durchgeführt worden; und auch die Helfer und Retter waren ganz normale Menschen. Wenn man aus dem Holocaust, dem nationalsozialistischen Vernichtungskrieg oder anderen Völker- und Massenmorden tatsächlich etwas lernen könnte, dann doch wohl nicht, dass manche Menschen gut und die meisten anderen böse sind. Sondern man könnte lernen, dass es an jeder Stelle, an der man sich im Leben befindet, darum geht, Entscheidungen zu treffen, und dass jede einzelne Entscheidung wiederum Konsequenzen dafür hat, wie man sich bei der nächsten Frage entscheiden kann und wird. Und man könnte lernen, dass man Handlungsspielräume für Menschlichkeit auch dort sehen und finden kann, wo die meisten anderen sich längst für die Unmenschlichkeit entschieden haben. 9 10