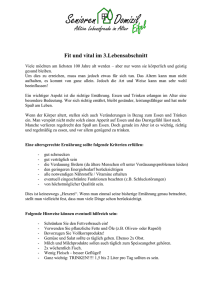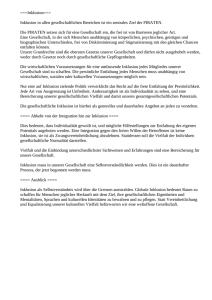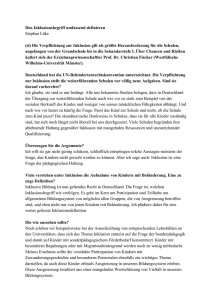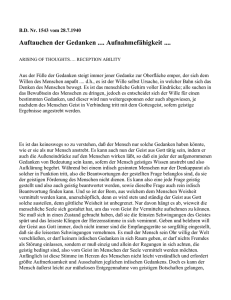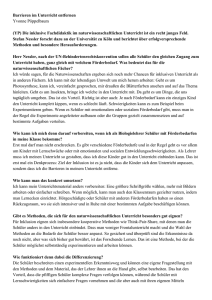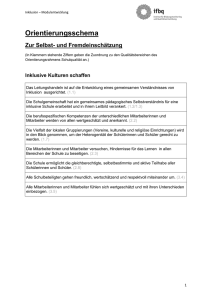INKLUSION
Werbung

AUSSENANSICHT Schlicht überfördert Es ist richtig behinderte Menschen zu integrieren. Es ist aber falsch, sie zwangsweise in klassische Schulen zu stecken. Von Udo Reiter Auch die Sozialpolitik unterliegt Moden. In den ersten Jahrzehnten der deutschen Bundesrepublik begann man, nach den gröbsten Aufräumungsarbeiten sich auch um die Schattenseiten der neu entstehenden Gesellschaft zu kümmern. Eine Grundidee war damals, dass man den körperlich und geistig Benachteiligten besonders unter die Arme greifen müsste. Behindertenhilfswerke entstanden und unterschiedliche Förderschulen für die, die mit dem Tempo und den Ansprüchen der normalen Ausbildungseinrichtungen nicht mithalten konnten. Das galt als fortschrittlich und human. Und in der Tat: Viele, die sonst unter die Räder des aufstrebenden Wirtschaftswunders gekommen wären, bekamen so Hilfe und eine Nische, in der sie auch unter ihren eingeschränkten Möglichkeiten einen Platz in der Gesellschaft finden und ein passables Leben führen konnten. Wer sich damals gegen diese Förderkultur gewandt hätte, wäre von den sozial Gutwilligen mit Sicherheit als herzloser Reaktionär gebrandmarkt worden. Heute sieht es anders aus. Unterstützt von einer UN-Resolution aus dem Jahr 2006 wird die spezielle Behandlung von Benachteiligten, auch wenn sie eigentlich als Förderung gedacht ist, zunehmend als Ausgrenzung, als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und als gesellschaftliche Diffamierung verurteilt. Die Behinderten gehören zu uns, heißt es, sie sollen mitten unter uns sein und am Leben aller gleichberechtigt teilnehmen können. Für technische oder intellektuelle Probleme gebe es Abhilfe, die Kinder müssten in der Schule dann eben speziell geschulte Lehrer an die Seite gestellt bekommen und bei Bedarf auch einen Assistenten, und für Rollstuhlfahrer müsse man halt Aufzüge und Behindertentoiletten bauen. Diesen Aufwand müsse uns eine humane Gesellschaft wert sein. Im Gegenzug würde die Hereinnahme der geistig und körperlich Behinderten auch der inneren Wertorientierung unserer eigenen extrem leistungsorientierten Alltagswelt nicht schaden und vielleicht etwas mehr Mitmenschlichkeit in unser Leben bringen. Inklusion heißt das Zauberwort für diesen Zustand. Es beherrscht zunehmend die Debatte, und wer dagegen Bedenken äußert, wird leicht zum herzlosen Reaktionär unserer Tage abgestempelt. Dabei gerät, wie häufig bei emotional gesteuerten Debatten, einiges durcheinander. Natürlich ist das Engagement der UN für die Menschenrechte Behinderter zu begrüßen. Natürlich soll man körperlich und geistig Benachteiligte nicht wegsperren. Natürlich soll man ihnen alle Chancen für ein Leben mitten in der Gesellschaft einräumen. Ich bin selbst schwerbehindert (querschnittgelähmt, Rollstuhl seit 48 Jahren) und weiß, wovon ich spreche. Nur: die moralische Schönheit solcher Überlegungen sollte nicht dazu führen, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Und in dieser Wirklichkeit gibt es leider Behinderungen, die den gleichberechtigten Wettbewerb mit Nicht-Behinderten einfach nicht zulassen. Wenn man ihn trotzdem um jeden Preis durchsetzen will, wenn man die Benachteiligten aus ideologischer Gleichheitsbegeisterung in die direkte Konkurrenz mit den anderen zwingt, dann tut man ihnen nicht nur keinen Gefallen, sondern man schadet ihnen, weil man sie überfordert. Man opfert sie, wie kürzlich ein Anrufer in einer Sendung von Günther Jauch formulierte, auf dem Altar der Inklusion. Wenn eine ehrgeizige Mutter ihr geistig behindertes Kind mit juristischer Gewalt ins Gymnasium boxen will, wem tut sie mit dieser Form der Gleichheit einen Gefallen, wirklich dem Kind oder vielleicht doch nur sich selbst? Es gibt mit Verlaub Ungleichheiten, die sich auch durch guten Willen und UN-Resolutionen nicht aus der Welt schaffen lassen. 1 Ich will das einmal polemisch zuspitzen: Ich möchte Fußballer werden! Es ist schließlich schlicht nicht einzusehen, warum ich wegen meiner Behinderung von dieser gesellschaftlichen Möglichkeit ausgeschlossen werden soll. Ich bräuchte lediglich einen Assistenten, der mich im Rollstuhl übers Feld schiebt und einen zweiten, der den Ball vor mir her treibt. Im Gegenzug könnte ich der Mannschaft einiges aus dem menschlichen Bereich bieten: dass Toreschießen nicht alles ist im Leben, dass man auch über Unterschiede hinweg zusammengehören kann und dass wir letztlich doch alle Brüder und Schwestern sind. Jeder wird einsehen, dass das nicht ernst gemeint sein kann. Aber sind die Ideen der radikalen Inklusionsanhänger so weit davon entfernt? Wird von ihnen nicht eine Idee, die in einigen Fällen ja gut sein mag, zu einem totalitären Modell aufgeblasen, das nie und nimmer funktionieren kann? Wenn man im Stern unter der Überschrift „Die Schulwende“ zu lesen bekommt, dass die Inklusion „das Leben aller Schüler, Eltern und Lehrer grundlegend verändern“ wird, dass sie „die größte Bildungsreform seit Einführung der Schulpflicht“ sei, dann stellt sich schon die Frage, ob hier nicht die Proportionen verrutscht sind. Zur Problematik der neuen Regelung gehört auch die Art ihrer Einführung. Die UNResolution wurde in New York von der Bundestagsabgeordneten Karin Evers-Meyer für Deutschland unterzeichnet. „Das hat damals niemand zur Kenntnis genommen“, sagte sie dem Stern-Autor, „aber ich wusste genau, was für eine Bombe ich mit nach Hause brachte. Um die Bombe zu zünden, musste das entsprechende Gesetz freilich noch durch den Deutschen Bundestag. An dieser Stelle wäre eine breite Diskussion, ein vernünftiges Abwägen von Pro und Contra notwendig gewesen. Genau das haben die Inklusionsbefürworter listig vermieden. Das Gesetz wurde am 4. Dezember 2008 nach 22 Uhr vor einem fast leeren Haus ohne Debatte durchgewunken. Jetzt zeigen sich langsam die Folgen - die gesellschaftlichen und die finanziellen. Noch einmal: Nichts, aber auch gar nichts gegen eine Öffnung unserer Gesellschaft für Behinderte. Aber dass die zwangsweise und flächendeckende Einführung der schulischen Inklusion auf Kosten der klassischen Fördereinrichtungen dafür der Königsweg sein soll, das stellen inzwischen nicht nur Lehrer, sondern auch betroffene Eltern infrage. Sie tun es nur vorsichtig, weil sie Angst haben, wie ein Vater im Focus schreibt, „in die Ecke der Inklusionsverweigerer gestellt zu werden“. Dort weht einem der Zeitgeist scharf ins Gesicht. Aber gerade deshalb kann es nichts schaden, auf den groben Klotz der Inklusionsbegeisterung auch einmal den groben Keil einer zugespitzten Antwort zu setzen. Udo Reiter, 70, war 20 Jahre lang Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks. Seit einem Autounfall 1966 ist er querschnittsgelähmt. FOTO: DPA Süddeutsche Zeitung, Samstag/Sonntag, 14./15. Juni 2014 2