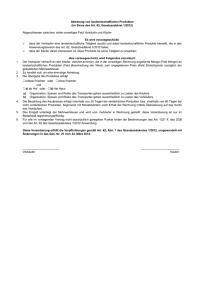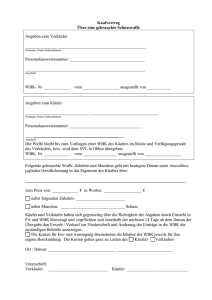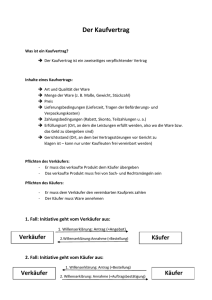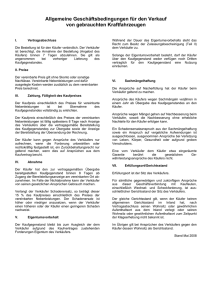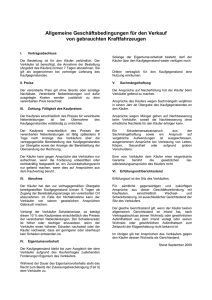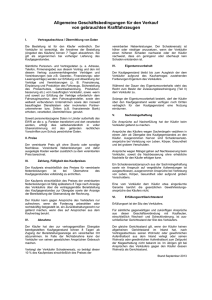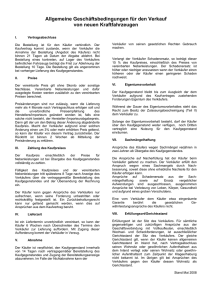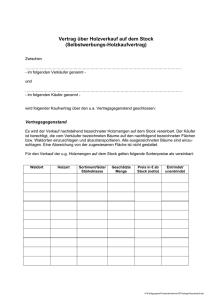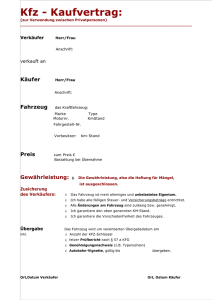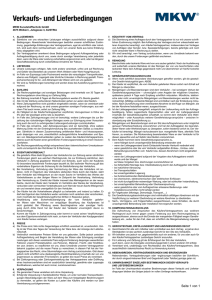Verletzung der Verkaufspflichten aus § 433 I 2 (Haftung für Sach
Werbung

Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Verletzung der Verkaufspflichten aus § 433 I 2 (Haftung für Sach- und Rechtsmängel des Kaufgegenstands) Zusammenfassung Der Verkäufer ist nach § 433 I 2 verpflichtet, dem Käufer den Kaufgegenstand frei von Sachund Rechtsmängeln zu verschaffen. Diese Pflicht gehört zu den Hauptleistungspflichten des Verkäufers. Wann ein Sach- bzw. ein Rechtsmangel vorliegt, ergibt sich aus § 434 bzw. § 435 (A). Die Rechtsfolgen einer mangelhaften Lieferung ergeben sich – von der Einrede des nicht erfüllten Vertrags abgesehen (§ 320) – aus §§ 437 ff (B). A) Mangel der Kaufsache I) Sachmangel (§ 434) Sachmangel ist eine ungünstige Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit der Kaufsache (Istbeschaffenheit) von der Sollbeschaffenheit. Der Begriff der „Beschaffenheit“ ist in § 434 nicht definiert. Unter „Beschaffenheit“ der Kaufsache versteht man: alle tatsächlichen rechtlichen, wirtschaftlichen Umstände, die nach der Verkehrsauffassung den Wert und die Brauchbarkeit der Sache beeinflussen. Umstritten ist allerdings, ob diese Umstände der Kaufsache unmittelbar innewohnen oder ihr unmittelbar anhaften müssen. Die bislang (zum früheren Recht) h.M. verlangte dies (BGH NJW 1984, 2289; NJW 1985, 2472; NJW 1986, 2824). Im Schrifttum zum neuen Recht mehren sich dagegen die Stimmen, die alle für die Wertschätzung oder Brauchbarkeit bedeutsamen tatsächlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Umstände der Kaufsache als Beschaffenheit ansehen, unabhängig davon, ob sie der Sache unmittelbar innewohnen oder anhaften (Huber, ExRep. Bes. SchuldR, Rn. 47 m.w.N.). Argument: Das neue Recht kenn die Unterscheidung des alten Rechts zwischen Beschaffenheitsvereinbarung und Eigenschaftszusicherung nicht mehr und spricht nur noch von Beschaffenheit, so dass im neuen Recht der Beschaffenheitsbegriff dem weiten Eigenschaftsbegriff angelehnt werden kann (Huber a.a.O.). Ob der BGH dem folgt, bleibt abzuwarten. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Der Streit wird nur relevant bei sogen. Umstandsmängeln, d.h. Mängel, die sich aus den Beziehungen der Kaufsache zur Umwelt ergeben. Nach der bislang h.M. müssen diese Beziehungen in der Beschaffenheit der Kaufsache selbst ihren Grund haben, ihr unmittelbar anhaften oder innewohnen (Beispiel: Lage eines Grundstücks am See; anders: Ertragsfähigkeit eines Unternehmens); Nach der Gegenauffassung ist dies nicht erforderlich. Sogenannte Qualitätsmängel beruhen demgegenüber stets auf der physischen Beschaffenheit der Kaufsache selbst (verdorbene Lebensmittel; Baufälligkeit eines Gebäudes), so dass der o.a. Streit hier keine Rolle spielt. 1) Vereinbarte Beschaffenheit (§ 434 I S. 1) Das Gesetz geht von einem subjektiven Mangelbegriff aus, indem es in erster Linie darauf abstellt, ob die Sache die vereinbarte Beschaffenheit hat. Die Beschaffenheitsvereinbarung kann ausdrücklich oder stillschweigend bzw. konkludent getroffen werden. 2) Eignung zur vertraglich vorausgesetzten Verwendung (§ 434 I S. 2 Nr. 1). Liegt keine Beschaffenheitsvereinbarung vor, ist nach § 434 I S. 2 Nr. 1 ein weiteres subjektives Kriterium maßgeblich. Erfasst sind durch die Norm Fälle, in denen die Parteien nicht bestimmte Merkmale der Sache, sondern einen bestimmten Verwendungszweck im Blick haben. Erforderlich ist eine übereinstimmende Vorstellung der Parteien bei Vertragsschluss über die Eignung zu einer bestimmten Verwendung. Eine bestimmte Vorstellung nur auf Seiten es Käufers reicht nicht; sie muss dem Verkäufer bei Vertragsschluss bekannt sein. Eine konkludente Übereinstimmung der Parteien reicht. Achtung: Wird die Eignung zu einer bestimmten Verwendung vereinbart, liegt § 434 I S. 1 vor! 3) Übliche Beschaffenheit und Eignung zur gewöhnlichen Verwendung (§ 434 I S. 2). § 434 I S. 2 stellt auf ein objektives Kriterium ab: die Sache muss zur gewöhnlichen Verwendung geeignet und die übliche Beschaffenheit vergleichbarer Sachen aufweisen. Ob dies der Fall ist, entscheidet sich danach, welche Eigenschaften ein vernünftiger Durchschnittskäufer bei „Sachen der gleichen Art“ wie der Kaufsache Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 „nach der Art der Sache“ erwarten kann (Beispiel Gebrauchtwagenkauf: Beschaffenheit eines Kfz gleichen Typs, gleichen Alters und gleicher Laufleistung). Achtung: Zur Beschaffenheit gem. § 434 I S. 2 Nr. 2 gehören gem. § 434 I S. 3 auch Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers , des Herstellers (§ 4 I, II ProdHaftG) oder seines Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über eine bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann. Es ist nicht erforderlich, dass der Verkäufer auf die öffentlichen Äußerungen bei den Vertragsverhandlungen Bezug genommen hat (dann ggf. „vereinbarte Beschaffenheit“ i.S. d. § 434 I S. 1). Voraussetzung ist allerdings, dass in den „öffentlichen Äußerungen“ Aussagen über „bestimmte Eigenschaften“ gemacht werden und es sich um Eigenschaften handelt, die der Käufer (objektiv) „erwarten kann“. Reißerische bzw. nicht nachprüfbare Aussagen über Eigenschaften der Sache sind damit in der Regel nicht erfasst. § 434 I S. 3 sieht allerdings drei Ausschussgründe vor (diese hat der Verkäufer zu beweisen): Der Verkäufer haftet nicht, - für Äußerungen, die er nicht kannte und nicht kennen musste. (Die Unkenntnis darf also nicht auf Fahrlässigkeit beruhen). - wenn die Äußerungen zur Zeit des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt war. (Die Berichtigung muss auf gleichermaßen effiziente, öffentlich wirksame Weise wie die ursprüngliche Äußerung erfolgen) - wenn die Äußerung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte. (Dies ist etwa der Fall, wenn der Käufer die Äußerung nachweislich nicht kannte oder zur Kenntnis nehmen konnte oder wenn es ihm auf die Aussagen bei seiner Kaufentscheidung nicht ankam). 4) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beschaffenheitsabweichung gem. § 434 I. Die Beschaffenheitsabweichung (nach § 434 I S. 1, S. 2 Nr. 1, Nr. 2 und S. 3) muss im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorliegen (§ 434 I). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Die Gefahr (Preisgefahr) geht über: - gem. § 446 S. 1 mit Übergabe der Kaufsache an den Käufer - gem. § 446 S. 3 mit Eintritt des Annahmeverzugs auf Käuferseite (§§ 293 ff). - gem. § 447 beim Versendungskauf mit Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson. Achtung: § 447 gilt nicht beim Verbrauchsgüterkauf, § 474 II. Beim Verbrauchsgüterkauf also Gefahrübergang stets nur bei Übergabe der Kaufsache an den Käufer oder bei Eintritt des Annahmeverzugs auf Seiten des Käufers, § 446 S. 1, S. 3. 5) Weitere Sachmängel a) Montagefehler und mangelhafte Montageleitung (§ 434 II). aa) Montagefehler (§ 434 II) Ein Sachmangel liegt gem. § 434 II S. 1 auch vor, wenn der Verkäufer oder sein Erfüllungsgehilfe (vgl. § 278 S. 1) eine vereinbarte Montage der Kaufsache unsachgemäß durchgeführt hat. Montage meint das Zusammen-/Aufbauen, Befestigen der Kaufsache Anbringen, und sonstige handwerkliche Leistungen, durch die die Sache für den Käufer verwendbar gemacht wird. Die Montage muss - vom Verkäufer geschuldet sein (ggf. ist eine Abgrenzung zum Werkvertrag erforderlich; siehe aber § 651) und - unsachgemäß durchgeführt sein. Damit sind zwei Fälle gemeint: zum einen der Fall, dass die Montage selbst fehlerhaft ist, ohne dass die Sache mangelhaft ist (schiefes Anbringen des Wandregals); zum anderen der Fall, dass durch die unsachgemäße Montage eine Beeinträchtigung der Sache herbeigeführt wird (beim Anschließen wird die Waschmaschine zerkratzt). bb) Mangelhafte Montageanleitung (§ 434 II S. 2) Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Bei einer zur Montage bestimmten Sache stellt gem. § 434 II S. 2 auch eine mangelhafte Montageanleitung einen Sachmangel dar. Voraussetzungen: - zur Montage bestimmte Sache (insbesondere Möbel: „Ikea-Klausel“) - mangelhafte Montageanleitung. Dabei kommt es darauf an, ob die Anleitung den ganz überwiegenden Teil der voraussichtlichen Kunden in die Lage versetzt, die Montage auf Anhieb fehlerfrei zu montieren, vgl. § 434 I S. 2 Nr. 2; (fehlerhafte Anleitung etwa, wenn in fremder Sprache abgefasst, nicht nachvollziehbar; zu klein gedruckt). Achtung: Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen sind nicht erfasst (umstritten: vgl. Brox Schuld BT, § 4, Ran. 25; Huber, ExRep. Schuld BT, Rn. 58 m.w.N.) - gem. § 434 II S. 2, letzter HS liegt kein Sachmangel vor, wenn trotz der mangelhaften Anleitung die Sache fehlerfrei montiert worden ist. Diesen Ausnahmefall hat der Verkäufer zu beweisen. Achtung: Ist eine Sache einmal fehlerhaftfrei montiert, dann etwa wegen eines Umzugs wieder abgebaut worden und kann nun die erneute Montage wegen der mangelhaften Anleitung nicht mehr fehlerfrei vorgenommen werden, liegt nach h.M. in der Lit. kein Mangel vor (Huber, ExRep. Bes. SchuldR, Rn. 57 m.w.N.). b) Falsch- (Aliud-) und Zuwenig-Lieferung (§ 434 III) aa) Falschlieferung (Lieferung einer anderen als der geschuldeten Sache, auch Aliud-Lieferung). Umstritten ist, ob § 434 III nur für den Gattungskauf oder auch für den Stückkauf gilt (Identitätsaliud). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Nach einer Ansicht ist § 434 III nicht auf den Stückkauf anwendbar (Schulze NJW 2003, 1022; Thier, AcP 2003, 403 ff.). Konsequenz: Der Nacherfüllungsanspruch, Käufer sondern hat den keinen primären Erfüllungsanspruch, der nach §§ 195, 199 verjährt. Die irrtümlich gelieferte Sache muss der Käufer nach § 812 I 1, 1. Fall zurückgeben. Nach der Gegenansicht (Brox, Schuld BT § 4 Ran. 26; Lorenz Jus 2003, 36, 38 f; Musielak NJW 2003, 89; Huber ExRep. SchuldR BT, Rn. 60) gilt § 434 III auch beim Stückkauf. Konsequenz: Der Käufer hat einen Nacherfüllungsanspruch, der nach § 438 verjährt (bzw. die sonstigen Rechtsbehelfe des § 437). Die irrtümlich gelieferte Sache ist bei Nacherfüllung gem. § 439 IV i.a. §§ 346-348 zurückzugeben. Für diese Lösung spricht, dass das Gesetz in § 434 III nicht zwischen Stück- und Gattungskauf unterscheidet und der Gesetzgeber die Abgrenzung zwischen Schlecht- und Falschlieferung entbehrlich machen wollte. Achtung: Die Behandlung der Falschlieferung als Sachmangel setzt voraus, dass die vom Verkäufer erbrachte Leistung (die Falschlieferung) für den Käufer erkennbar „als Erfüllung“ des Kaufvertrags erbracht wurde. Problem: Liefert der Verkäufer eine wertvollere als die geschuldete Sache und macht der Käufer seinen Nacherfüllungsanspruch nicht geltend , steht in Frage, ob und nach welcher Norm der Verkäufer die Falschlieferung (das wertvollere Aliud) zurückverlangen kann. § 439 IV gilt unmittelbar nicht; dies setzt das Geltendmachen des Nacherfüllungsanspruchs durch den Käufer voraus. Teilweise wird angenommen, der Verkäufer könne die Sache nach § 812 I 1. 1. Fall zurückverlangen (Lorenz JuS 2003, 36, 39) Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Andere sehen im Kaufvertrag auch den Rechtsgrund für die Leistung der wertvolleren Sache, weil § 434 III diesen Fall dem Sachmangel gleichstellt (Musielak NJW 2003, 89, 90). Lösung des Problems über § 242 i.V. m. § 162: Der Käufer, der treuwidrig nicht Nacherfüllung verlangt, muss sich nach dem Rechtsgedanken des § 162 (spezielle Ausprägung des § 242) so behandeln lassen, als lägen die Voraussetzungen des § 439 IV vor. Folge: Rückgabe der geleisteten (wertvolleren) Sache Zug um Zug gegen Lieferung der richtigen Sache (vgl. Brox, SchuldR BT, § 4 Rn. 26). bb) Zuweniglieferung Eine Zuweniglieferung im Sinne des § 434 III liegt nur vor, wenn der Verkäufer für den Käufer erkennbar mit der Mindermenge seine ganze Verbindlichkeit erfüllen will, sogen. versteckte Zuweniglieferung. Will der Verkäufer demgegenüber offen nur einen Teil der Leistung erbringen, kann der Käufer diese Teilleistung zurückweisen (§ 266), so dass die gesamte Verbindlichkeit nicht erfüllt ist. Nimmt der Käufer eine offene Teilleistung als solche an, ist § 434 III ebenfalls nicht gegeben (Der gelieferte und akzeptierte Teil wird nicht mangelhaft dadurch, dass der Rest nicht geliefert wird; Fall der Teillieferung). Nicht von § 434 III erfasst ist ferner die Zuviellieferung. Eine solche kann vom Verkäufer nach § 812 I 1., 1. Fall zurückverlangt werden. Umgekehrt braucht der Käufer das Zuvielgeleistete nicht zu bezahlen. II) Rechtsmangel (§ 435) Gem. § 435 S. 1 liegt ein Rechtsmangel vor, wenn ein Dritter bezüglich der Kaufsache gegenüber dem Käufer Rechte geltend machen kann, die in der Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer nicht berücksichtigt wurden, Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 wenn also die Sache mit Rechten Dritter belastet ist, die im Kaufvertrag nicht berücksichtigt sind. Dies können sein: - dingliche Rechte Dritter (Pfandrecht, Grundpfandrecht wie Hypothek oder Grundschuld, Dienstbarkeit, Nießbrauch) - schuldrechtliche Rechte Dritter (Mietrecht, Pachtrecht, vgl. §§ 566 I, 581 II, u.ä.) - das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Dritten (vgl. BGHZ 110, 196) Rechtsmängel stellen auch nicht bestehende, aber im Grundbuch eingetragene Rechte Dritter dar § 435 S. 2, (wegen der dann bestehenden Gefahr, dass ein Dritter das nicht existierende, aber eingetragene Recht gem. § 892 gutgläubig erwirbt). Kein Rechtsmangel ist die Belastung des Grundstücks mit öffentlichrechtlichen Abgaben und Lasten, § 436 II (Grundsteuern, Anliegerbeiträge). Ebenfalls kein Rechtsmangel liegt vor, wenn der Verkäufer dem Käufer nicht das Eigentum verschaffen kann. Dies ist vielmehr ein Verstoß gegen die Pflicht aus § 433 I S. 1, die nach dem allgemeinen Leistungsstörungsrecht zu behandeln ist. Fraglich ist allerdings, ob diese Ansprüche nicht nach § 438 I Nr. 1 analog (statt nach §§ 195, 199) verjähren. Dadurch wird verhindert, dass der Anspruch des Käufers, dem gar kein Eigentum verschafft wird, früher verjährt, als der Anspruch des Käufers, dem zwar das Eigentum, aber belastetes Eigentum verschafft wird; vgl. Huber, ExRep. SchuldR BT, Rn. 67 m.w.N. Der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen des Rechtsmangels ist der des Eigentümerübergangs. B) Rechtsfolgen mangelhafter Lieferung I) Einrede aus § 320 Mit der Lieferung einer mangelhaften Sache (§ 434) oder einer mit einem Rechtsmangel behafteten Sache (§ 435) verstößt der Verkäufer gegen eine seiner Hauptpflichten (§ 433 I S. 2). Es liegt im einen wie im anderen Fall keine ordnungsgemäße Lieferung/Erfüllung vor. Der Käufer, der den Mangel bei Lieferung erkennt, kann deshalb die Annahme verweigern, ohne in Annahmeverzug (§§ 293 ff) zu geraten; ferner kann er die Einrede des nicht Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 erfüllten Vertrags (§ 320) erheben und die Kaufpreiszahlung bis zur Lieferung einer mangelfreien Sache verweigern. II) Rechtsbehelfe der §§ 437 ff. Ist die Sache geliefert worden und hat sie bei Gefahrübergang einen Mangel (oben A) stehen dem Käufer die Rechte aus §§ 437 ff. zu. Danach hat der Käufer in erster Linie das Recht auf Nacherfüllung (wahlweise Nachlieferung oder Nachbesserung; Wahlrecht des Käufers), §§ 437 Nr. 1, 439. Scheitert die Nacherfüllung in der dem Verkäufer gesetzten angemessenen Frist, kann der Käufer entweder vom Vertrag zurücktreten (§§ 437 Nr. 2, 1. Fall, 440, 323, 326 V) oder den Kaufpreis mindern (§§ 437 Nr. 2, 2. Fall, 441). Der Käufer muss sich also entscheiden, ob er Rücktritt oder Minderung wählt; beides nebeneinander ist ausgeschlossen (entweder/oder). Neben Rücktritt oder Minderung kann der Käufer entweder gem. §§ 437 Nr. 3, 440, 280, 281, 283, 311a Schadensersatz oder gem. § 437 Nr. 3, 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzanspruch stehen also auch im Alternativverhältnis zueinander (entweder/oder). Der eine oder der andere Anspruch kann aber entweder mit dem Rücktritt oder mit der Minderung kombiniert, d.h. daneben geltend gemacht werden. Achtung: Der Schadensersatz- bzw. Aufwendungsersatzanspruch setzt Vertretenmüssen des Verkäufers voraus, § 280; Nacherfüllung, Rücktritt und Minderung dagegen nicht. III) Anwendungsbereich der §§ 437 ff 1) In sachlicher Hinsicht Die §§ 437 ff gelten unmittelbar für den Sachkauf, d.h. sowohl für den Stück-(Spezies-) als auch für den Gattungskauf. Beim Gattungskauf ist allerdings fraglich, ob bzw. wann bei Lieferung einer mit einem Sachmangel (§ 434) behafteten Sache die Konkretisierung (§ 243 II) eintritt, da eine mangelhafte Gattungssache nicht mittlerer Art und Güte ist (§ 243 I, II). Die Frage ist allerdings für die Geltung der §§ 437 ff. von geringer Bedeutung, da die Vorschriften regelmäßig nicht den Eintritt der Konkretisierung voraussetzen. In der Lit. wird hinsichtlich der Konkretisierung auf die Reaktion des Käufers abgestellt: Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse - Verlangt er Nacherfüllung, Januar 2009 Minderung oder keinen Schadensersatz, bringt er zum Ausdruck, dass er die gelieferte Sache behalten will, so dass nunmehr Konkretisierung eintritt. - Macht der Käufer den Nachlieferungsanspruch geltend, kann hierin der ursprüngliche Erfüllungsanspruch in modifizierter Form gesehen werden. Konkretisierung tritt danach hinsichtlich der ursprünglich gelieferten Sache nicht, sondern erst ein, wenn der Verkäufer eine mangelfreie Sache liefert. - Tritt der Käufer zurück oder verlangt er großen Schadensersatz, muss er die gelieferte Sache zurückgeben (§ 346 bzw. § 281 IV). Das Vertragsverhältnis wird zurück abgewickelt. Teilweise wird angenommen, dass vor der Rückabwicklung Konkretisierung eingetreten ist; andere gehen davon aus, dass die Rückabwicklung ohne Eintritt der Konkretisierung stattfindet. (Vgl. zur gesamten Problematik Huber, ExRep. SchuldBT, Rn. 77-80 m.w.N.). Die §§ 437 ff. gelten gem. § 453 I auch für den Kauf von Rechten und sonstigen Gegenständen, ferner gem. § 480 für Tauschverträge und gem. § 651 S. 1 für Verträge, die die Lieferung neu herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand haben. 2) In zeitlicher Hinsicht § 437 setzt voraus, dass die Sache mangelhaft ist. Mit Blick auf § 434, der als maßgeblichen Zeitpunkt den Gefahrübergang nennt, geht die überwiegende Ansicht davon aus, dass die §§ 437 ff. einen Sachmangel im Zeitpunkt des Gefahrübergangs voraussetzen. Die Gegenauffassung will die §§ 437 ff. dagegen erst und nur dann anwenden, wenn der Käufer die gelieferte (mangelhafte) Sache als Erfüllung angenommen hat. Zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen die beiden Ansichten beim Versendungskauf (§ 447). Nach der überwiegenden Ansicht gelten die §§ 437 ff. ab Gefahrübergang, d.h. beim Versendungskauf gem. § 447 bereits ab Übergabe der Sache an Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 die Transportperson. Nach der Gegenauffassung kommen die §§ 437 ff. dagegen nicht zur Anwendung, wenn der Käufer die bei ihm angelangte Sache als nicht unterschiedlichen erfüllungsgemäß Ergebnissen zurückweist. kommen die Ebenfalls Ansichten zu beim Annahmeverzug des Käufers (§§ 293 ff.). Nach der ersten Auffassung gelten die §§ 437 ff. mit Eintritt des Annahmeverzugs, weil gem. § 446 S. 3 dann die Gefahr übergeht. Nach der Gegenauffassung gelten die §§ 437 ff. dagegen nicht, weil es an der Annahme der Kaufsache fehlt. (Vgl. zum Ganzen Huber, ExRep. SchuldR BT, Rn. 74 ff. m.w.N.). IV) Gemeinsame Voraussetzung aller Mängelrechte kein Ausschluss, keine Einschränkung der Mangelhaftung 1) Gesetzliche Ausschlussgründe a) Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Käufers vom Mängel, § 442 aa) Kenntnis Kennt der Käufer den Mangel bei Vertragsschluss, sind die Mangelrechte ausgeschlossen, § 442 I S. 1. Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschweigt (mangelnde Kausalität der Täuschung). Eine Ausnahme vom Haftungsausschluss bei Kenntnis des Käufers macht § 442 II; danach hat der Verkäufer ein im Grundbuch eingetragenes Recht zu beseitigen, auch wenn der Käufer es kennt. Entscheidender Zeitpunkt für die Kenntnis des Käufers ist der Vertragsschluss. Spätere Kenntnis vom Mangel schließt deshalb auch bei vorbehaltloser Annahme der Sache durch den Käufer die Haftung des Verkäufers grundsätzlich nicht aus. In der vorbehaltlosen Annahme kann aber eine konkludente Vertragsänderung hinsichtlich der Beschaffenheit oder ein Verzicht auf die Mangelrechte liegen (Auslegungsfrage). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse bb) Januar 2009 Grobfahrlässige Unkenntnis Grobfahrlässige Unkenntnis des Käufers vom Mangel schließt die Mangelhaftung des Verkäufers gleichfalls grundsätzlich aus. Dies ist aber nicht der Fall, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen bzw. das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft arglistig vorgespiegelt oder wenn er eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat, § 442 I S. 2. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Käufer die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt und einen Mangel übersieht, der ihn bei Vertragsschluss ohne weiteres erkennbar war. Arglist liegt vor, wenn der Verkäufer den Mangel kennt oder ihn für möglich hält und damit rechnet, dass der Käufer den Vertrag bei Kenntnis das Geschäft nicht oder mit anderem Inhalt abschließen würde. Verschweigen ist das Schweigen trotz bestehender Aufklärungspflicht (s.o. das Vorspielen nicht vorhandener Beschaffenheiten steht gleich). Eine Beschaffenheitsgarantie gem. § 442 I s. 2 ist die vertraglich bindende Zusicherung des Verkäufers, die Kaufsache habe eine bestimmte Eigenschaft, verbunden mit der Erklärung, für die Folgen des Fehlens der Eigenschaft verschuldungsunabhängig einstehen zu wollen. Die Garantie kann ausdrücklich oder konkludent übernommen werden (Auslegungsfrage). b) Öffentliche Versteigerung Beim Pfandverkauf in öffentlicher Versteigerung (§§ 1235 I, 1236 ff) unter Bezeichnung als Pfand ist die Mangelhaftung im Interesse des Pfandgläubigers grundsätzlich ausgeschlossen. Auch hier gilt der Haftungsausschluss nicht, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig Beschaffenheitsgarantie verschwiegen übernommen Einzelheiten s.o.). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers hat, oder § 445 eine (zu Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Achtung: § 445 gilt nicht beim Verbrauchsgüterkauf, § 474 II; darunter fällt gem. § 474 I die Versteigerung neuer Sachen, nicht die gebrauchter Sachen, § 474 I S. 2 (außerdem Verkäufer muss Unternehmer, Käufer und Verbraucher sein, § 474 I S. 1). c) Verletzung der Rügepflicht gem. § 377 HGB § 377 HGB sieht eine besondere Rügepflicht vor, wenn der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft ist (vgl. 343 HGB). In diesem Fall muss der Käufer die gelieferte Ware unverzüglich untersuchen und dabei gefundene Mängel unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern, § 121 I) dem Verkäufer anzeigen, § 377 I HGB. Kommt der Käufer dem nicht nach, verliert er seine Mängelrechte, es sei denn, es liegt ein unerkennbarer Mangel vor, § 377 II HGB. 2) Vertraglicher Ausschluss der Mängelrechte Die Regeln der §§ 437 ff. sind grundsätzlich dispositives Recht und damit abdingbar. Dies setzt eine ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung voraus (häufig bei Grundstücksverkäufen). Die Reichweite des Ausschlusses ist ggf. durch Auslegung zu ermitteln (§§ 133, 157). Auf einen vereinbarten Haftungsausschluss bzw. eine vereinbarte Haftungsbeschränkung kann sich der Verkäufer allerdings nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat (zu den Einzelheiten s.o.). Durch das Wort „soweit“ wird zweierlei klargestellt: - zum einen, dass inhaltliche Beschränkungen einer Garantie (z.B. hins. der Summe oder des zeitlichen Rahmens) zulässig sind. - zum anderen, dass die Berufung auf den Haftungsausschluss oder die Haftungsbeschränkung nur in dem Umfang ausgeschlossen ist, in dem die Garantie übernommen wurde. Für außerhalb der Garantie liegende Mängel gilt der Haftungsausschluss also, wenn auch hinsichtlich ihrer ein Haftungsausschluss vereinbart wurde. Das entsprechende gilt bei arglistigem Verschweigen. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Durch die Formulierung „kann sich nicht berufen“ wird klargestellt, dass die Unwirksamkeit der Vereinbarung über den Haftungsausschluss bzw. deren Beschränkung entgegen § 139 nicht zur Unwirksamkeit des ganzen Kaufvertrags führt. Achtung: Beim Verbrauchsgüterkauf kann sich der Unternehmer/Verkäufer auf eine vor Mitteilung des Mangels angetroffene Vereinbarungen nicht berufen, die zum Nachteil des Verbrauchers von den §§ 433-435, 437, 439-443 abweicht, § 475 I. Damit ist u.a. auch ein bei Vertragsabschluss vereinbarter Haftungsausschluss bzw. eine Haftungsbeschränkung grundsätzlich unwirksam. Eine Vereinbarung nach Mitteilung des Mangels an den Unternehmer ist nicht ausgeschlossen. Die Regel des § 475 I gelten nicht für den Ausschluss oder die Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz, § 475 III; der bei Vertragsschluss getroffene Ausschluss des Schadensersatzanspruchs wegen Mangels ist also wirksam und kann vom Unternehmer geltend gemacht werden. Achtung: Ein Haftungsausschluss wegen vorsätzlichen Verhaltens im voraus ist nicht möglich, § 276. Sofern der Ausschluss in AGB enthalten ist, sind allerdings §§ 307-309 zu beachten (bei Verstoß gegen §§ 307-309 ist der Ausschluss bzw. Beschränkung des Schadensersatzanspruchs ebenfalls unwirksam; auch bei anderen Haftungsausschlüssen in AGB sind §§ 307-309 zu beachten). V) Die einzelnen Rechtsbehelfe der §§ 433 ff. 1) Nacherfüllung (§§ 437 Nr. 1, 439) Achtung: Vorrangiger Rechtsbehelf gegenüber Rücktritt, Minderung und Schadens- bzw. Aufwendungsersatz. Diese setzten prinzipiell den erfolglosen Ablauf einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung voraus; Schadensersatz und Aufwendungsersatzanspruch Vertretenmüssen des Verkäufers voraus. a) Wahlrecht des Käufers Der Käufer kann wählen zwischen Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers setzen zudem Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse (aa) Januar 2009 Nachlieferung, d.h. Lieferung einer neuen mangelfreien Sache. Der Anspruch auf Nachlieferung ist bei Gattungsschulden unproblematisch. Fraglich ist, ob der Käufer auch bei einem Stück-(Spezies)kauf Nachlieferung, also Lieferung einer neuen Sache verlangen kann. Die h.M. (Palandt/Putuzo, § 439, Rn. 15 m.w.N., vgl. auch die Gesetzesmaterialien BT-Drucks. 14/6040, S. 231) bejaht dies, wenn es sich bei der Kaufsache um eine vertretbare Sache gem. § 91 bzw. um eine ersetzbare, wirtschaftlich vergleichbare Sache handelt (Massen- und sonstige Artikel, bei denen der Verkäufer unproblematisch Ersatz liefern kann; anders etwa beim Gebrauchtwagenkauf). Die Gegenansicht verweist darauf, dass bei der Stückschuld nach dem Parteiwillen stets nur die konkret bezeichnete Sache geschuldet und deshalb eine Ersatzlieferung nicht möglich ist (§ 275 I). Die h.M. nähert die Stückschuld der Gattungsschuld an und belastet den gattungsschuldähnlichen Verkäufer mit Beschaffenheitsrisiko einem (vgl. hierzu auch Huber, ExRep. SchuldR BT, Rn. 105-112 m.w.N. und Lösung eines Fallbeispiels). (bb) Nachbesserung, d.h. Beseitigung des Mangels. (z.B. Reparatur; Beseitigung des Rechts des Dritten). b) Kosten der Nacherfüllung Die für die Nacherfüllung erforderlichen Kosten hat der Verkäufer zu tragen, § 439 II. Achtung: § 439 II regelt nach h.M. nur die Frage der Kostentragung i.R. der Nacherfüllung, die der Verkäufer zu erbringen hat, ist aber keine eigene Anspruchsgrundlage. Nicht geregelt ist, an welchem Ort die Nacherfüllung vom Verkäufer zu erbringen ist: am ursprünglichen Erfüllungsort Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 (Wohn- Geschäftssitz des Schuldners/Verkäufers, § 269) oder am Ort der Belegenheit der Sache (also beim Käufer). Die Entstehungsgeschichte der Norm (§ 439 II) spricht für letzteres: also Nacherfüllung am Ort der Belegenheit; Konsequenz: Nacherfüllung = Bringschuld; vgl. Huber, ExRep. SchuldR BT, Rn. 89 m.w.N.; Bamberger/Roth/Faust, § 439 Rn. 13; AG Menden NJW 2004, 2171. Problem: Kosten des Aus- und Wiedereinbaus einer mangelhaften Sache (z.B. eingebaute Fliesen erweisen sich nach Einbau als mangelhaft). - Ansicht OLG Karlsruhe ZGS 2004, 432, 433: Der Verkäufer hat die volle Kostenlast, also sowohl die Kosten des Ausbaus der fehlerhaften als auch die des Wiedereinbaus der neu gelieferten fehlerfreien Sache zu tragen. Argument: Die Nacherfüllung soll den Käufer in die Lage versetzen, mit der Sache zu verfahren, als sei sie mangelfrei gewesen, d.h. in die Lage, in der er bei mangelfreier Lieferung stünde. - Gegenposition (vgl. Tiedtke/Schmidt DStR, 2004, 2060 f.) Verkäufer braucht weder die Ausbau- noch die Wiedereinbaukosten zu tragen. Argument: Der Verkäufer ist von vornherein nur verpflichtet, die Sache zu liefern, nicht jedoch sie einzubauen; hieran ändert sich auch im Rahmen der Nacherfüllung nichts. Die Lösung des OLG Karlsruhe Schadensersatzanspruch; ein entspricht einem Schadensersatzanspruch setzt aber Vertretenmüssen des Verkäufers voraus: Wertungswiderspruch, wenn über die Auslegung des (verschuldensunabhängigen) Nacherfüllungsanspruchs das Ergebnis eines (an sich verschuldungsabhängigen) Schadensersatzanspruchs erreicht würde. - Vermittelnde Meinung (Lorenz ZGS 2004, 408 f.). Verkäufer schuldet die Ausbaukosten, die Kosten des Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Wiedereinbaus dagegen nicht. Argumentation: Gegen die Tragung der Wiedereinbaukosten sprechen die o.a. Gründe (Wertungswiderspruch). Hinsichtlich der Ausbaukosten gilt gem. § 439 IV das Rücktrittsrecht. Die Rückgabe bzw. Rücknahme der Sache hat am Ort zu erfolgen, an dem die Sache konkret belegt ist, sich konkret befindet (Fliesen an der Wand, Ziegeln auf dem Dach); Konsequenz: Verkäufer zum Ausbau bzw. zur Zahlung der Ausbaukosten Wertungswiderspruch besteht verpflichtet. insoweit nicht, Ein da Rücktritt und Ersatzlieferung kein Vertretenmüssen des Verkäufers voraussetzen. Vertreten wird allerdings auch die Ansicht, dass der Käufer die Sache am Ort der Belegenheit zu übergeben und der Verkäufer sie nur entgegenzunehmen habe, sie also nicht ausbauen müsse, so Wieling/Finkenauer. (vgl. zum Ganzen auch: Wieling/Finkenauer, Fälle zum Bes. SchuldR, 6. Aufl. 2007, Fall 2; Huber ExRep. SchuldR BT, Rn. 113-126). Achtung: Bei der Nachbesserung eingebauter fehlerhafter Sachen stellt sich die Problematik ebenfalls, wenn die Nachbesserung dementsprechend den den Ausbau Wiedereinbau und der nachzubessernden bzw. nachgebesserten Sache erfordert. Hier liefert § 439 II ein zusätzliches Argument für die vermittelnde Lösung: Gem. § 439 II sind die zur Nachbesserung erforderlichen Kosten vom Verkäufer zu tragen. Dies spricht für die Pflicht des Verkäufers die Ausbaukosten zu tragen, wenn die Nachbesserung nur bei Ausbau der Sache möglich ist und die Ausbaukosten insofern erforderliche Aufwendungen darstellen (s. hierzu Huber a.a.O.). c) Ausschluss/Einschränkung des Nacherfüllungsanspruchs Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse aa) Januar 2009 Unmöglichkeit (§ 275 I) Unmöglichkeit der Nacherfüllung liegt nur vor, wenn beide Arten der Nacherfüllung (also Nachlieferung und Nachbesserung) unmöglich sind. Dem Käufer stehen dann die anderen Rechtsbehelfe des § 437 zu, ohne dass eine Fristsetzung erforderlich wäre. Diese ist bei Unmöglichkeit der Nacherfüllung sinnlos. Ist nur eine der beiden Arten unmöglich, beschränkt sich der Anspruch des Käufers auf die noch mögliche Art der Nacherfüllung, also entweder auf Nachbesserung (bei Unmöglichkeit der Nachlieferung) oder auf Nachlieferung (bei Unmöglichkeit der Nachbesserung), vgl. § 275 I „soweit“. Der Käufer muss dann diese Form der Nacherfüllung geltend machen. Die übrigen Rechtsbehelfe des § 437 stehen ihm nur nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachlieferungsfrist- bzw. Nachbesserungsfrist zu. (Zum Problem Nachlieferung beim Stück-/Spezieskauf s.o.). bb) Grobes Missverhältnis zw. Aufwand und Leistungsinteresse (§ 275 II). Nach § 275 II kann der Verkäufer die Nacherfüllung verweigern, wenn der Aufwand der Nacherfüllung zum Leistungsinteresse des Käufers unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis steht. Auch hier ist zu beachten, dass der Verkäufer die Nacherfüllung im Ganzen nur verweigern kann, wenn die Voraussetzungen hinsichtlich beider Arten der Nacherfüllung vorliegen. Ansonsten hat der Käufer Anspruch auf die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Nachlieferung), für die die Voraussetzungen des § 275 II nicht vorliegen. Der Verkäufer muss sich auf § 275 II berufen. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Achtung: Die Vorschrift des § 275 II hat im Kaufrecht kaum praktische Bedeutung, da § 439 III (s.u.) dem Verkäufer bereits ein Verweigerungsrecht hinsichtlich der Nacherfüllung unverhältnismäßigen gibt, Kosten wenn verbunden diese ist. mit Die Voraussetzungen des § 439 III sind weniger streng als die des § 275 II. Diese Vorschrift bleibt zwar nach § 439 III S. 1 („unbeschadet“), anwendbar, kommt aber wegen der schärferen Voraussetzungen praktisch nicht in Betracht, sondern allenfalls bei sonstigem unzumutbarem Aufwand (BGH ZO 163, 234, 245 ff.). cc) Unverhältnismäßige Kosten § 439 III S. 1 Der Verkäufer kann gem. § 439 III S. 1 die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist (Ausprägung des § 242). Bei der Frage, ob die Kosten unverhältnismäßig sind, ist gem. § 439 III S. 2 auf den Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, sowie die Bedeutung des Mangels und darauf abzustellen, ob auf die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden kann. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich jeweils auf die andere Art der Nacherfüllung, es sei denn, dass beide Arten unverhältnismäßige Kosten nach sich ziehen würden, § 439 III S. 3. Nur im letzten Fall kann der Verkäufer also die Nacherfüllung im Ganzen verweigern. Beispiele: Bei billiger Massenware - etwa Uhr für 30,EUR - ggf. statt Reparatur, Lieferung einer neuen Sache; bei wertvollen Sachen mit geringfügigem Mangel eher Reparatur statt Nachlieferung). Ab wann die Grenze der Unverhältnismäßigkeit überschritten ist (110%, 150% etc.) ist umstritten, vgl. die Kommentarliteratur. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Achtung: § 439 III Januar 2009 gibt dem Verkäufer ein Verweigerungsrecht. Er kann, muss es aber nicht ausüben. Deshalb kann der Käufer nicht mit Hinweis auf die unverhältnismäßigen Kosten der Nacherfüllung sofort (ohne Fristsetzung) mindern (BGH NJW 2006, 1195) oder sonst sofort die übrigen Rechte aus § 437 geltend machen. dd) § 275 III, Unzumutbarkeit der Leistung (hier Nacherfüllung) § 275 III hat im Kaufrecht keine praktische Bedeutung; wie die Erfüllungs- ist auch die Nacherfüllungspflicht keine höchstpersönliche Leistungspflicht i.S. des § 275 III. d) Rechtsfolgen der Nacherfüllung Mit der erfolgreichen Nacherfüllung erlischt die Leistungspflicht des Verkäufers. Dies gilt auch bei verspäteter Nacherfüllung, sofern der Käufer nicht schon andere Rechtsbehelfe gem. §§ 437 ff. geltend gemacht hat. Bei Nachlieferung hat der Verkäufer gem. § 439 IV einen Anspruch auf Rückgewähr der ursprünglich gelieferten mangelhaften Sache nach den Regeln der §§ 346 und 348. Danach kann der Verkäufer vom Käufer auch die gezogenen Nutzungen (Gebrauchsvorteile) heraus- bzw. Wertersatz dafür sowie für nicht gezogene Nutzungen verlangen, die nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft hätten gezogen werden müssen verlangen, §§ 346 I, 347 I. Gem. § 347 II kann der Käufer Verwendungsersatz verlangen. Achtung: Die Regelungen der §§ 346, 347 über die Nutzungsherausgabe bzw. den Wertersatz für gezogene bzw. pflichtwidrig nicht gezogene Nutzungen gelten gem. dem jüngst geänderten § 474 II nicht für den Verbrauchsgüterkauf! § 474 II lautet nunmehr: Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 „Auf die in diesem Untertitel geregelten Kaufverträge ist § 439 Abs. 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass Nutzungen nicht herauszugeben oder durch ihrenWert zu ersetzen sind. Die §§ 445 und 447 sind nicht anzuwenden“. (vgl. Bundesgesetzblatt 2008, 1. Teil, Nr. 57; S. 2399); Gesetz v. 10.12.2008, in Kraft seit 16.12.2009). Hintergrund der Regelung ist der Umstand, dass der EuGH die Zulassung der Nutzungsherausgabe- bzw. Wertersatzanspruchs beim Verbrauchsgüterkauf als unvereinbar mit der Verbrauchsgüter-Richtlinie angesehen hat, vgl. EuGH, NJW 2008, 1433; siehe ferner BGH, Urteil v. 26.11.2008 - Az: VIII ZR 200/05 das Urteil (ergangen vor der Gesetzesänderung) gelangt zum selben Ergebnis durch teleologische Reduktion im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung; lesen! e) Prüfungsfolge des Anspruchs auf Nacherfüllung Anspruch auf Nachbesserung/Nachlieferung, §§ 437 Nr. 1, 439 (I) Wirksamer Kaufvertrag (II) Mangel der Kaufsache 1) Sachmangel gem. § 435 im Zeitpunkt des Gefahrübergangs (siehe hierzu o.A.) oder 2) Rechtsmangel gem. § 435 im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. (III) Kein Ausschluss der Mangelhaftung überhaupt (§§ 442, 445 BGB, § 377 HGB, s.o.). (IV) Kein Ausschluss der Nacherfüllung gem. § 275 I bzw. kein Verweigerungsrecht nach § 275 II. 2) (V) Kein Verweigerungsrecht nach § 439 III. (VI) Keine Verjährung (§ 438), s. unten. Rücktritt Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Das in § 437 Nr. 2, 1. Fall angesprochene Rücktrittsrecht des Käufers zielt auf die Rückabwicklung des Vertrags durch Rückgewähr der empfangenen Leistungen gem. §§ 346 ff. Hinsichtlich der Voraussetzungen verweist § 437 Nr. 2, 1. Fall auf die allgemeinen Regeln des § 323 und des § 326 V. Hinsichtlich des Erfordernisses der Fristsetzung sieht § 440 zusätzliche Bestimmungen vor a) Voraussetzungen des Rücktritts aa) Erfolglose Fristsetzung zur Nacherfüllung Der Rücktritt des Käufers wegen Mangels der Kaufsache kann erst erfolgen, wenn der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat und diese erfolglos abgelaufen ist. Hierdurch wird der Vorrang der Nacherfüllung sichergestellt. Zudem erhält der Verkäufer durch die Fristsetzung die Chance zur zweiten Andienung. Die Angemessenheit der Frist bestimmt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung der beiderseitigen Parteiinteressen. Eine zu knapp bemessene Frist ist nicht wirkungslos, vielmehr wird dann durch die Fristsetzung eine angemessene Frist in Gang gesetzt. bb) Entbehrlichkeit der Frist (1) nach §§ 440 S. 1, 323 II Eine Fristsetzung ist entbehrlich, - nach § 323 II Nr. 1, wenn der Verkäufer die Nachlieferung ernsthaft und endgültig verweigert. Erforderlich ist, dass der Verkäufer eindeutig zum Ausdruck bringt, seinen Vertragspflichten nachkommen zu wollen. nicht mehr Das bloße Bestreiten eines Mangels reicht nicht. - nach § 323 II Nr. 2, wenn der Verkäufer nicht zu einem bestimmten Termin innerhalb einer bestimmten Frist eine mangelfreie Sache geliefert hat und der Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Käufer im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteressens an die Rechtzeitigkeit der Leistung geknüpft hat (relatives Fixgeschäft). - nach § 323 II Nr. 3, wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen einen sofortigen Rücktritt rechtfertigen (z.B. Beschädigung der Vertrauensgrundlage durch Täuschung; Nachlieferung von Saisonware kann erst nach Ablauf der Saison vollendet werden). (2) Weitere Entbehrlichkeitsgründe nach § 440 S. 1 Neben § 323 II nennt § 440 S. 1 weitere Fälle, in denen eine Nachfristsetzung entbehrlich ist: - § 440 S. 1, 1. Fall: wenn der Verkäufer nach § 439 Nacherfüllung III beide Arten (Nachlieferung der und Nachbesserung) verweigern kann, also beide Arten mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sind. Wichtig: Der Verkäufer muss wegen § 439 III die Nacherfüllung verweigern, tut er dies nicht, ist Fristsetzung erforderlich. - § 440 S. 1, 2. Fall, wenn die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung fehlgeschlagenen ist. Dies ist etwa der Fall, wenn der Verkäufer trotz Aufforderung durch den Käufer die Nacherfüllung nicht in einer angemessenen Frist erbringt, auch wenn ihm keine ausdrückliche Frist gesetzt Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 worden ist. Nach § 440 S. 2 gilt die Nachbesserung nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, sofern sich aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen nichts anderes ergibt. - § 440 S. 1, 3. Fall, wenn die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung für ihn (d.h. den Käufer) unzumutbar ist (etwa dann, wenn die Nacherfüllung mit erheblichen Unannehmlichkeiten für den Käufer verknüpft ist). (3) Entbehrlichkeit nach §§ 437 Nr. 2, 1. Fall 326 IV Danach ist eine Fristsetzung entbehrlich, wenn der Verkäufer gem. § 275 nicht zu leisten, d.h. nicht nach zu erfüllen braucht. Dies ist der Fall: - nach § 275 I bei Unmöglichkeit der Nacherfüllung (also beider Arten). - nach § 275 II bei grobem Missverhältnis zwischen dem Aufwand für die Nacherfüllung (beide Arten!) und dem Leistungsinteresse des Käufers. - (§ 275 III hat im Kaufrecht keine praktische Bedeutung, s.o.). b) Rücktrittserklärung Das Rücktrittsrecht ist ein Gestaltungsrecht und muss vom Käufer durch einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden. c) Ausschluss des Rücktrittsrechts aa) Unerheblichkeit des Mangels Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Gem. §§ 437 Nr. 2, 1. Fall, 323 V, S. 2 ist der Rücktritt ausgeschlossen, wenn der Sachmangel („die Pflichtverletzung“) unerheblich ist. Dasselbe gilt in Fällen, in denen der Verkäufer gem. § 275 nicht nachzuerfüllen braucht, §§ 437 Nr. 2, 1. Fall, 326 V. Ob ein Sachmangel unerheblich ist, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Verwendungszwecks und der Verkehrsanschauung zu beurteilen (leichte Behebbarkeit; Verschwinden des Mangels nach bestimmter Zeit). Bei arglistiger Täuschung wird keine unerhebliche Pflichtverletzung anzunehmen sein, da der arglistige Verkäufer keinen Schutz verdient. Der Rücktrittsausschluss wegen unerheblicher Pflichtverletzung gem. §§ 437 Nr. 2, 1. Fall, 323 V S. 2 gilt auch bei der unerheblichen Zuweniglieferung; vgl. etwa Brox, SchuldR BT § 4, Rn. 64 f. bb) Verantwortlichkeit des Käufers für Mangel Gem. §§ 437 Nr. 2, 1. Fall, 323 VI, 1. Fall ist der Rücktritt ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel allein oder überwiegend zu verantworten hat. cc) Eintritt des Mangels während des Annahmeverzugs des Käufers Der Rücktritt ist gem. § 437 Nr. 2, 1. Fall, 323 VI, 2. Fall ferner ausgeschlossen, wenn der vom Verkäufer nicht zu vertretende Mangel zu einer Zeit auftritt, zu der sich der Käufer im Annahmeverzug (§§ 293 ff.) befindet. dd) In seltenen Ausnahmefällen kann ein Rücktritt auch nach § 242 ausgeschlossen sein (etwa wenn der Verkäufer wegen besonderer Umstände trotz Nachfristsetzung nicht mit einem Rücktritt rechnen musste). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse d) Januar 2009 Folgen des Rücktritts Durch Erklärung des Rücktritts wandelt sich der Vertrag in ein Rückabwicklungsverhältnis: Der Käufer muss die Kaufsache zurückgeben, der Verkäufer den Kaufpreis - soweit gezahlt - zurückzahlen (§ 346), Leistung Zug um Zug (§ 348). Ferner sind die jeweils gezogenen Nutzungen von beiden Seiten herauszugeben (d.h. z.B. Kaufpreis und Zinsen). Soweit Nutzungen nicht gezogen wurden, dies aber möglich gewesen wäre, muss Wertersatz geleistet werden (§ 347 I 1) (Die Regelungen über Nutzungsherausgabe bzw. Wertersatz gelten bei Rücktritt auch beim Verbrauchsgüterkauf! § 474 II hat nur den Nacherfüllungsanspruch im Blick). Ersatz für Verwendungen nach § 347 II. Achtung: Hat der Käufer wirksam Rücktritt erklärt, kann er nicht mehr mindern (entweder Rücktritt oder Minderung), da mit dem Rücktritt die beiderseitigen Leistungspflichten entfallen (s.o. Entstehen eines Rückabwicklungsverhältnisses). Deshalb ist nach Rücktritt auch der Nacherfüllungsanspruch erloschen. Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche kann der Käufer dagegen grundsätzlich neben dem Rücktritt geltend machen. Eine Einschränkung besteht aber beim kleinen Schadensersatz; will der Käufer nach Rücktrittsrecht die Sache zurückgeben, kann er nicht gleichzeitig den aus dem Mangel resultierenden Minderwert oder die Kosten für die Nachbesserung ersetzt verlangen (Brox, SchuldBT, § 4 Rn. 60). e) Prüfungsfolge Rücktritt aa) Mögliche Ansprüche: - Verkäufer: Anspruch auf Rückgewähr der Kaufsache; Nutzungsherausgabe bzw. Wertersatz (§§ 437 I, Nr. 2, 2.Fall, 440, 346, 347). - Käufer: Anspruch Kaufpreises; auf Rückzahlung Nutzungsherausgabe Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers des bzw. Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Wertersatz, Verwendungsersatz (§§ 437 I, Nr. 2. 2. Fall, 440, 346, 347). bb) Soweit der Kaufpreis noch nicht gezahlt ist, braucht der Käufer nicht mehr zu zahlen. cc) Voraussetzungen (I) Wirksamer Kaufvertrag. (II) Mangel, §§ 434, 435. (III) Kein Haftungsausschluss (s. o.). (IV) Fristsetzung zur Nacherfüllung und erfolgloser Ablauf der Frist oder der Entbehrlichkeit der Frist nach § 323 II oder § 440 S. 1. (V) Rücktrittserklärung. (VI) Kein Ausschluss des Rücktrittsrechts, § 323 VI. (VII) Keine Verjährung, § 438 (s. unten) 3. Minderung Statt vom Kauf zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis mindern (§ 437 Nr. 2, 2. Fall, 441), d.h. Herabsetzung des Kaufpreises verlangen (§ 441 III S. 1). Rücktritt und Minderung stehen im Alternativverhältnis zueinander (entweder/oder). a) Voraussetzungen Neben den Voraussetzungen wirksamer Kaufvertrag, Mangel, kein Haftungsausschluss müssen die Rücktrittsvoraussetzungen gem. § 323 vorliegen („statt zurückzutreten“). Eine Ausnahme besteht insofern, als eine Minderung auch dann möglich ist, wenn der Mangel unerheblich ist, § 441 I S. 2 (anders beim Rücktritt s.o.). Die Minderung setzt also ebenfalls eine Nachfristsetzung voraus, soweit diese nicht nach § 323 II bzw. § 440 entbehrlich ist (zu Einzelheiten s.o.). Ferner dürfen keine Gründe vorliegen, die den Rücktritt ausschließen würden; ausgenommen ist der Ausschluss wegen Unerheblichkeit des Mangels (s.o.), § 441 I S. 2). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse b) Januar 2009 Rechtsfolgen aa) Erklärung Minderung ist wie Rücktritt ein Gestaltungsrecht, muss also vom Käufer gegenüber dem Verkäufer erklärt werden (einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung). bb) Berechnung der Minderung Die Herabsetzung des Kaufpreises erfolgt durch die relative Berechnungsmethode, § 441 III 1: X (Geminderter Kaufpreis) = Vereinbarter Preis Wert mit Mangel Wert ohne Mangel X = Vereinbarter Preis x Wert mit Mangel Wert ohne Mangel Beispiel 1: Wert der Sache ohne Mangel: 800; vereinbarter Kaufpreis: 1000; Wert mit Mangel: 600. X = 600 1000; X = 1000 x 600; 800 X = 750 800 Beispiel 2: Wert ohne Mangel: 1000; vereinbarter Preis: 800; Wert mit Mangel: 800. .X.. 800 = 800 ; X = 800 x 800; 1000 1000 X = 640 Ansonsten ist, soweit erforderlich, die Minderung durch Schätzung zu ermitteln (häufig orientiert sich die Schätzung an den Reparaturkosten). cc) Minderungseinrede Hat der Käufer den Kaufpreis noch nicht oder noch nicht vollständig gezahlt, steht ihm die Minderungseinrede zu, d.h. er kann die Zahlung in Höhe des Minderungsbetrags verweigern (im Beispiel 1: i.H.v. 250,-). dd) Erstattungsanspruch Ist der Kaufpreis bereits vollständig gezahlt, kann der Käufer den zuviel gezahlten Betrag vom Verkäufer Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 zurückverlangen, § 441 IV S. 1; dabei kommen §§ 346 I und 347 I zur Anwendung. ee) Folgen für andere Mängelrechte Durch Ausübung des Minderungsrechts (Erklärung) erlischt der Nacherfüllungsanspruch. Gleichfalls ausgeschlossen ist nun ein Rücktritt (s.o.: entweder Minderung oder Rücktritt). Schadensersatz oder Aufwendungsersatzansprüche sind dagegen neben der Minderung möglich. Allerdings ist neben der Minderung der große Schadensersatzanspruch ausgeschlossen, da der Käufer sich entschlossen hat, die Sache zu behalten. 4) Schadensersatzanspruch a) Schadensersatz statt der Leistung aa) Wegen behebbaren Mangels Bei einem behebbaren Mangel kommt ein Anspruch aus §§ 437 Nr. 3, 440, 280 I, III, 281 in Betracht (Anspruch aus § 283 bzw. § 311a nur, wenn die Nacherfüllung nicht möglich, der Mangel also nicht behebbar ist, § 275). (1) Voraussetzungen Neben den Voraussetzungen wirksamer Kaufvertrag, Mangel, kein Haftungsausschluss erfordert § 281 i.V.m. § 440. - Pflichtverletzung: Lieferung mangelhafter Sache - Fristsetzung: § 281 I S. 1 (zu Einzelheiten s.o. zum Rücktritt); es sei denn die Fristsetzung ist entbehrlich entweder gem. § 281 II: ernsthafte, endgültige Verweigerung der Nacherfüllung; Entbehrlichkeit wegen besonderer Umstände (s. auch o. zum Rücktrittsrecht) oder gem. § 440 S. 1: Verweigerung beider Arten der Nacherfüllung gem. § 439 III; Fehlschlagen Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 der Nacherfüllung; Unzumutbarkeit der dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung für den Käufer (s. auch o. zum Rücktritt). - Vertretenmüssen des Verkäufers Vorsatz, Fahrlässigkeit gem. § 276 I, II. Ohne Verschulden (Vorsatz, Fahrlässigkeit) hat der Verkäufer den Mangel zu vertreten, wenn er vertraglich eine Garantie übernommen hat, § 276 I S. 1. Eine solche liegt vor, wenn der Verkäufer ausdrücklich oder stillschweigend das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft oder das Fehlen bestimmter Mängel garantiert, d.h. sich für das oder andere so stark macht, dass er in jedem Fall (ohne Verschulden) dafür einstehen will. Dies ist durch Auslegung zu ermitteln (früher: selbständigen Zusicherung). Beschaffenheits- (Zur oder Haltbarkeitsgarantie s.u.). Gegebenenfalls Vertretenmüssen nach §278 (Erfüllungsgehilfe Das Vertretenmüssen wird vermutet (§ 280 I S. 2). Der Verkäufer trägt also die Beweislast, wenn er sein Vertretenmüssen bestreitet. (2) Rechtsfolgen Mit der Geltendmachung Schadensersatzanspruchs erlischt des der Nacherfüllungsanspruch (§ 437 Nr. 3, 281 IV); stattdessen erhält der Käufer Schadensersatz statt der Leistung. Ersetzt wird der Mangelschaden: - kleiner Schadensersatz: Grundsätzlich kann der Käufer nur den kleinen Schadensersatz verlangen. Er behält die Kaufsache und wird ansonsten so gestellt, wie er bei ordnungsgemäßer Erfüllung Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse stünde: in erster Januar 2009 Linie erhält er die mangelbedingte Wertdifferenz ersetzt, daneben sonstige Vermögenseinbußen die aus der mangelhaften Lieferung resultieren: entgangener Gewinn; Schadensersatzpflicht gegenüber eigenem Käufer bei Weiterverkauf. - großer Schadensersatz: Diesen kann der Käufer nur verlangen, wenn der Mangel erheblich ist („Schadensersatz statt der ganzen Leistung“). Der Käufer gibt die Sache zurück und erhält den Ersatz des Schadens, der ihm wegen der Nichterfüllung des ganzen Vertrags entstanden ist: Er erhält den bereits gezahlten Kaufpreis zurück und kann ferner entgangenen Gewinn, Kosten einer Ersatzbeschaffung, Freistellung von Haftung gegenüber eigenem Käufer verlangen. Beim großen Schadensersatz kann der Verkäufer die bereits gelieferte Sache zurückverlangen §§ 281 V, i.V.m. §§ 346 ff. b) Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht behebbaren Mangels Ist die Beseitigung des Mangels nicht möglich, wird der Verkäufer von seiner Leistungs-/Nacherfüllungspflicht frei, § 275 I. Das gleiche gilt wenn der Aufwand unzumutbar ist und der Verkäufer sich darauf beruft, § 275 II. Der Käufer kann dann sofort – eine Nachfristsetzung wäre sinnlos – Schadensersatz statt der Leistung verlangen. (1) Anfänglich unbehebbarer Mangel Lag der unbehebbare Mangel bereits bei Vertragsabschluss vor, ist die Anspruchsgrundlage §§ 437 Nr. 3, 311a. Voraussetzungen: Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse - Neben den Januar 2009 Voraussetzungen wirksamer Kaufvertrag, Mangel, kein Haftungsausschluss muss der Verkäufer gem. § 275 von der Pflicht zur Nacherfüllung befreit sein. - Der unbehebbare Mangel muss zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits vorhanden gewesen sein, § 311a I. - Der Verkäufer hat dies gewusst oder hätte dies wissen müssen (also Unkenntnis infolge Fahrlässigkeit); ggf. Haftung aus Garantie (§ 276 I S. 1). (Das Verschulden wird vermutet, § 311a I; der Verkäufer trägt also die Beweislast, wenn er sein Vertretenmüssen bestreitet.) Rechtsfolge: Schadensersatz statt der Leistung (kleiner oder großer Schadensersatz, s.o.). (2) Nachträglich unbehebbarer Mangel Tritt der Mangel erst nach Vertragsschluss (aber vor Gefahrübergang!) ein, folgt der Schadensersatzanspruch aus §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 283. Voraussetzungen: - Neben den Voraussetzungen wirksamer Kaufvertrag, Mangel, kein Haftungsausschluss muss der Verkäufer gem. § 275 von seiner Nacherfüllungspflicht befreit sein. - Der unbehebbare Mangel muss nach Vertragsschluss aufgetreten sein. - Pflichtverletzung: Mangelhafter Lieferung, bzw. Herbeiführung der Unbehebbarkeit,- § 283 S. 1, 280 I S. 1. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse - Januar 2009 Vertretenmüssen des Verkäufers hinsichtlich des Mangels bzw. der Unbehebbarkeit, § 283 S. 1, 280 I S. 2. Verschulden, § 276 I; Garantie, § 276 I. Das Verschulden wird gem. § 280 I S. 2 vermutet. Der Verkäufer trägt die Beweislast für sein Nicht-Vertretenmüssen. Rechtsfolge: Schadensersatz statt der Leistung (Kleiner oder großer Schadensersatz, s.o.). c) Schadensersatz wegen Verzögerung mangelfreier Leistung aa) Verzugsschaden Verzögert sich die Nacherfüllung und entsteht dem Käufer deswegen ein Schaden, kann dieser unter den Voraussetzungen der §§ 280 I, II, 286 ersetzt verlangt werden. Erforderlich ist danach grundsätzlich eine Mahnung. Diese kann regelmäßig in der Setzung der Frist zur Nacherfüllung gesehen werden. Weiteres Erfordernis: Vertretenmüssen des Verkäufers hinsichtlich Verzögerung, § 280 I (wird vermutet, Beweislast trägt Verkäufer). bb) Schäden vor Verzugseintritt/Betriebsausfallschäden Verzögerungsschäden können allerdings bereits allein durch die mangelhafte Lieferung entstehen; Beispiel: Wegen Lieferung einer mangelhaften Maschine kann der Betrieb des Käufers nicht fortgesetzt werden, dies ist erst nach Reparatur bzw. Nachlieferung möglich → Betriebsausfallschaden. Der Gesetzgeber (BT-Drucks. 14/6040, S. 225) will derartige Schäden direkt aus § 280 I ersetzt wissen, d.h. wenn der Verkäufer den Mangel zu vertreten hat (§ 280 I). Die Gegenansicht will auch diese Schäden nur ersetzen, wenn die Voraussetzungen der §§ 280 I, II, 286 Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 vorliegen. Sie verweist auf den Wortlaut des § 280 II und darauf, dass der Verkäufer der schlecht, aber immerhin liefere, nicht schlechter stehen dürfe, als der Verkäufer der überhaupt nicht liefere (vgl. Brox § 4 Rn. 106 m.w.N.). d) Ersatz von Mangelfolgeschäden Achtung: Die oben unter a genannten Schadensersatzansprüche statt der Leistung haben nur die Schäden im Blick, die daraus entstehen, dass der Verkäufer seine Leistungspflicht nicht erfüllt, weil die Sache einen Mangel hat (Mangelschäden). Nicht erfasst sind davon solche Schäden, die wegen des Mangels an sonstigen Rechtsgütern des Käufers entstehen, sogen. Mangelfolgeschäden (Beispiel wegen Mangels am Kfz kommt es zu einem Unfall, bei dem der Käufer verletzt wird). Anspruchsgrundlage für Mangelfolgeschäden sind §§ 437 Nr. 3, 1. Fall, § 280 I. Voraussetzungen: Neben den Voraussetzungen wirksamer Kaufvertrag, Mangel, kein Haftungsausschluss: aa) Pflichtverletzung: Lieferung einer mangelhaften Sache. bb) Vertretenmüssen: Verschulden des Verkäufers (§ 276 I, II; Vorsatz bzw. Fahrlässigkeit hinsichtlich des Mangels); ggf. Haftung aus Garantie (§ 276 I, S. 1 a.E.), d.h. ohne Verschulden, wenn sich aus der Garantie ergibt (Auslegung), dass der Verkäufer sich auch dafür stark macht, dass es wegen der Mangelfreiheit auch nicht zu Mangelfolgeschäden kommt. e) Rechtsfolge: Ersatz des Mangelfolgeschadens; des Schadens der aus der Verletzung des Rechtsguts resultiert. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn 5) Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Aufwendungsersatz Statt des Schadensersatzes kann der Käufer (neben Rücktritt oder Minderung) Aufwendungsersatz nach §§ 437 Nr. 2, 284 verlangen. Schadensersatz und Aufwendungsersatz stehen im Alternativverhältnis (entweder Schadens- oder Aufwendungsersatz). Es müssen die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 2, 280 I, II, 281, 283 oder 311a vorliegen (insbesondere Vertretenmüssen), s. soeben 4) a). Ersetzt werden die Aufwendungen, die der Käufer im Vertrauen auf Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte (§ 284). Der Anspruch scheidet aus, wenn der Aufwendungszweck auch ohne Pflichtverletzung nicht erreicht worden wäre (§ 284). 6) Haftung aus „selbständiger“ Garantie (§ 443) § 443 meint Garantieansprüche, die der Verkäufer oder ein Dritter (z.B. Hersteller, Importeur) über die gesetzlichen Mängelrechte hinaus einräumt. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben davon unberührt (§ 443: „unbeschadet“), sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. Liegt der Mangel bei Gefahrübergang vor, bestehen die Ansprüche aus der Garantie und aus §§ 437 ff. nebeneinander. Wenn ein Dritter die Garantie abgegeben hat, haften er und der Verkäufer ggf. nebeneinander (Gesamtschuldner; § 421 ff.). Die Garantie i.S. des § 276 I (s.o. „unselbständige“ Garantie) und die „selbständige“ Garantie i.S. des § 443 unterscheiden sich dadurch, dass die „unselbständige“ Garantie lediglich die Haftung des Verkäufers auch auf eine Haftung ohne Verschulden erweitert (§ 276 I, s.o.), während die selbständige Garantie eine Erweiterung der Rechte des Käufers über die im Kaufrecht vorgesehenen Rechte hinaus erweitert. Was vorliegt und welchen Inhalt die Garantie hat, muss durch Auslegung (§§ 133, 157) ermittelt werden. § 443 nennt zwei Typen: a) Beschaffenheitsgarantie Sie garantiert eine bestimmte Beschaffenheit der Sache und kann für den Fall des Fehlens zudem zusätzliche Rechte für den Käufer eröffnen (z.B. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Umtauschrecht). Die Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Beschaffenheitsgarantie ist insbesondere bedeutsam, wenn ein Dritter sie abgibt, da der Verkäufer ohnehin nach §§ 437 ff. für Mängel der Kaufsache einzustehen hat; die Haftung aus der vom Verkäufer abgegebenen Garantie tritt allerdings - ggf. erweiternd - neben die gesetzlich vorgesehenen Rechte (s.o.); die Haftung des Dritten aus der Garantie neben die des Verkäufers (Gesamtschuld, s.o.). b) Haltbarkeitsgarantie Mit ihr garantiert der Verkäufer bzw. Dritte, dass die Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält (vgl. § 443 I S. 1). Sie schützt den Käufer unabhängig davon, ob der Mangel schon bei Gefahrübergang vorlag (...“eine bestimmte Dauer behält“). Gem. § 443 II wird vermutet, dass ein während der garantierten Dauer auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet. Der Käufer hat nur zu beweisen, dass der Mangel in den Anwendungsbereich der Garantie fällt und während deren Geltungsdauer aufgetreten ist; nicht dagegen, dass der Mangel Folge eines anfänglichen Zustands der Sache ist. Der Verkäufer (bzw. Dritte) kann die Vermutung nicht dadurch entkräften, dass er beweist, die Sache sei einwandfrei hergestellt worden, sondern nur dadurch, dass er beweist, dass der Mangel aus einer unsachgemäßen Behandlung oder eine Beschädigung der Sache durch den Käufer oder einen Dritten resultiert. c) Inhalt der Garantie Er ergibt sich aus der privatautonomen Bestimmung des Verkäufers oder Dritten, der Garantieerklärung. Die Garantie kann sich auf die ganze Sache oder auf bestimmte Teile oder auch auf bestimmte Eigenschaften beziehen. Aus der Bestimmung des Garantiegebers folgen weiterhin ggf. die Dauer oder die eingeräumten Rechte. § 443 I S. 2 verweist insoweit auf die Garantieerklärung und auf die in der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen. Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse d) Januar 2009 Verbrauchsgüterkauf Achtung: Beim Verbrauchsgüterkauf i.S. des § 474 I ist die Garantieerklärung an bestimmte Formerfordernisse gebunden, § 477: Sie muss einfach und verständlich sein und folgende Punkte enthalten. - den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Käufers (Verbrauchers) und darauf enthalten, dass diese durch die Garantie nicht eingeschränkt werden, § 477 I Nr. 1; - den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind (Dauer und räumlicher Geltungsbereich des Garantieanspruchs, Name und Anschrift des Garantiegebers). Der Verstoß gegen diese Erfordernisse führt nicht zur Unwirksamkeit der Garantie, § 477 III; kann aber zu Schadensersatzansprüchen führen gem. § 280 I, 241 II, 311 II (c.i.c.). VI) Verjährung der Mängelansprüche § 438 1) Anspruch auf Nacherfüllung, Schadens- oder Aufwendungsersatz (vgl. § 438 I) a) Dauer der Verjährungsfrist aa) 30 Jahre, § 438 I Nr. 1, wenn der Mangel, - in einem Recht eines Dritten besteht, aufgrund dessen der Dritte Herausgabe der Sache verlangen kann, § 438 I Nr. 1 a) oder - in einem sonstigen im Grundbuch eingetragenen Recht besteht. Durch die Regelung soll die Verjährung der Haftung für die angeführten Rechtsmängel mit der Verjährung der dinglichen Herausgabeansprüche des jeweiligen Dritten gleichgeschaltet werden. Ansonsten wäre der Käufer ggf. 30 Jahre dem Herausgabeanspruch des Dritten ausgesetzt, Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 ohne Ersatz für diesen Rechtsmangel vom Verkäufer verlangen zu können. bb) 5 Jahre, § 438 I Nr. 2: bei - Bauwerken § 438 I Nr. 2 und - Sachen, die ihrer üblichen Verwendungsweise entsprechend für ein Bauwerk verwendet worden sind und die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht haben, § 438 I Nr. 2 b). Hierdurch soll ein Gleichlauf mit den Ansprüchen des Bauherrn gegen den Bauhandwerker geschaffen werden, die ebenfalls in fünf Jahren verjähren, § 634 a I Nr. 2. Der vom Bauherrn in Anspruch genommene Bauherr soll sich gleichfalls fünf Jahre an den Verkäufer halten können, von dem er das - den Mangel des Bauwerks verursachende - Baumaterial bezogen hat. Achtung: Im Wege der teleologischen Reduktion ist allerdings anzunehmen, dass die Baumaterialien innerhalb von 2 Jahren nach Ablieferung des Materials beim Bauunternehmer eingebaut worden sein müssen; ansonsten würden Ansprüche die gem. § 438 I Nr. 3 (s.u.) verjährt sind, wieder aufleben (vgl. Mansel NJW 2002, 94). cc) 2 Jahre, in allen übrigen Fällen, § 438 I Nr. 3; dies ist abgesehen der zuvor genannten Fällen - die Regel. dd) Die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren (§ 195) gilt, statt der 5- bzw. 2-jährigen Frist des § 438 I Nr. 2 und 3, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Bei Baumängeln bzw. mangelhaftem Baumaterial (§ 438 I Nr. 2), tritt die Verjährung jedoch nicht nach Ablauf der 5 Jahre ein, § 438 III, S. 2. (Zum Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Fristbeginn bei arglistiger Täuschung des Verkäufers s.u.). b) Fristbeginn Nach dem allgemeinen Verjährungsrecht (§§ 195 ff.) beginnt die Verjährungsfrist mit Schluss des Jahres, in dem der Gläubiger des Anspruchs Kenntnis von den Anspruchsbegründenden Tatsachen erlangt oder hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hatte erlangen müssen, § 199. Bei den Mängelansprüchen wird der Beginn der Verjährung dagegen rein objektiv bestimmt. Der Anspruch kann also schon verjährt sein, bevor der Käufer überhaupt erkennt, dass ein Mangel vorliegt. Gem. § 438 II beginnt die Frist bei Grundstücken (Bauwerken) mit der Übergabe, ansonsten mit der Ablieferung. Beides setzt tatsächliche Besitzverschaffung voraus, weil der Käufer die Möglichkeit der Untersuchung haben soll. Deshalb beginnt die Verjährung im Fall des Versendungskaufs (§ 447) nicht mit der Übergabe der Sache an die Transportperson sondern erst mit Ablieferung beim Käufer. Achtung: Eine Ausnahmeregelung gilt, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. In diesem Fall gilt nicht nur die regelmäßige Verjährungsfrist. Diese beginnt vielmehr erst mit Schluss des Jahres zu laufen, in dem der Käufer den Mangel erkennt, § 438 III i.V.m. § 199 I Nr. 2. c) Vertragliche Vereinbarungen über die Verjährung Beginn und Dauer der Verjährung können abweichend von § 438 durch Vertrag geregelt werden. Eine vertragliche Verkürzung der Frist ist jedoch hinsichtlich der Haftung des Verkäufers für Vorsatz ausgeschlossen. Beim Verbrauchsgüterkauf kann die Verjährung gem. § 475 II bei neuen Sachen nicht auf unter zwei Jahren, bei gebrauchten Sachen nicht auf unter ein Jahr verkürzt werden. Eine vertragliche Verlängerung der Verjährungsfrist ist nach § 202 II nur bis zur Höchstdauer von 30 Jahren möglich; sie Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 kommt also nur bei § 438 I Nr. 2 (5-Jahresfrist) und Nr. 3 (2Jahresfrist) in Betracht. 2) Verjährungsfolgen für das Rücktritts- und das Minderungsrecht Der Verjährung unterliegen nur Ansprüche (§ 195). Das Rücktritts- und das Minderungsrecht sind keine Ansprüche, sondern Gestattungsrechte. Gleichwohl hat der Ablauf der Verjährungsfrist gem. § 438 auch für diese Rechte Folgen. a) Ausschluss von Rücktritt und Minderung Gem. § 438 IV S. 1 i.V.m. § 218 I ist der Rücktritt unwirksam, wenn der Anspruch auf Leistung oder Nacherfüllung gem. § 438 I-III verjährt ist und der Verkäufer sich darauf beruft, also die Verjährungseinrede erhebt. Gem. § 438 V gilt dasselbe entsprechend für die Minderung. Für die Rechtzeitigkeit kommt es auf die Zeit der Rechtsausübung an. b) Mängeleinrede Auch wenn der Rücktritt nach Verjährung des Leistungs- bzw. Nacherfüllungsanspruchs unwirksam ist, kann der Käufer aber gem. § 438 IV S. 2 die Zahlung des Kaufpreises verweigern, soweit er dazu aufgrund des Rücktritts berechtigt sein würde. Dies nutzt dem Käufer allerdings nur, wenn und soweit er den Kaufpreis noch nicht gezahlt hat. Macht der Käufer von dem Verweigerungsrecht Gebrauch, steht dem Verkäufer ein Rücktrittsrecht zu, § 438 IV S. 3. Tritt der Verkäufer zurück, wird der gesamte Kaufvertrag rückabgewickelt, §§ 346 ff. (Rückgewähr der Kaufsache etc., Rückzahlung der Kaufpreises etc.). Für die Minderung gilt gem. § 439 V das entsprechende. Danach kann der Käufer, soweit er noch nicht gezahlt hat, die Zahlung soweit verweigern, als er aufgrund der Minderung dazu berechtigt sein würde: Leistungsverweigerungsrecht also in Höhe des Minderungsbetrages Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers (vereinbarter Preis 100; Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 geminderter Preis 75; Zahlungsverweigerung also in Höhe von 25). Achtung: Beruft sich der Käufer auf die Minderung, kann der Verkäufer nicht zurücktreten; § 438 V verweist nur auf § 438 IV S. 2 nicht auf S. 3! VII) Konkurrenzen 1) Allgemeines Leistungsstörungsrecht Die kaufrechtlichen Sonderregelungen gelten ab Gefahrübergang beim Sachmangel und ab der Übertragung des Rechts/Übereignung beim Rechtsmangel. Das allgemeine Leistungsstörungsrecht ist in die kaufrechtlichen Sonderregeln einbezogen (s. die Verweisungen in §§ 437 ff.). Vor Gefahrübergang bzw. Rechtsübergang (bei Rechtsmangel) ist das allgemeine Leistungsstörungsrecht unmittelbar anwendbar: vor diesem Zeitpunkt muss also nicht auf §§ 437, sondern kann direkt auf die Vorschriften über Unmöglichkeit (§§ 275, 280 I, II, 283, 285, 311a), Verzug (§§ 280 I, II, 286) Schadensersatz (§§ 280-284) und gegenseitige Verträge (§§ 320-326) zurückgegriffen werden. Dies gilt auch dann, wenn der Käufer die Annahme wegen des Mangels verweigert hat und es deshalb nicht zum Gefahrübergang (bzw. Rechtsübergang) gekommen ist. 2) Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§ 320) Vor Gefahrübergang kann sich der Käufer auf § 320 berufen, d.h. die Lieferung der mangelbehafteten Sache zurückweisen und die Zahlung mit der Einrede des nicht erfüllten Vertrags verweigern (bis zur Lieferung einer mangelfreien Sache). Umstritten ist, ob der Käufer sich auch nach Gefahrübergang (bzw. Rechtsübergang) noch auf § 320 berufen kann, solange er den Anspruch auf Nacherfüllung hat. Dies wird z.T. bejaht (vgl. Jauernig/Berger, § 437 Rn. 29); z.T. verneint (vgl. HK-BGB/Saenger, § 437 Rn. 23). Argument: Vorrang der kaufrechtlichen Sonderregelung; § 437 enthält Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 keinen Verweis auf § 320; Argument der Gegenseite: Solange der Nacherfüllungsanspruch besteht, ist von Seiten des Verkäufers noch nicht ordnungsgemäß erfüllt, so dass die Voraussetzungen des § 320 vorliegen. Dass § 437 nicht auf § 320, bedeutet nicht, dass die Vorschrift völlig unanwendbar ist. 3) Schadensersatz wegen schuldhafter Pflichtverletzung Führt der Mangel dazu, dass weitere Rechtsgüter oder Rechte des Käufers verletzt werden (Mangelfolgeschäden), so kann gem. §§ 437, 280 I Schadensersatz wegen der Rechtsverletzung verlangt werden (s.o., Voraussetzung: Vertretenmüssen des Verkäufers hins. des Mangels). Dieser Anspruch tritt neben den ggf. gegebenen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung (Ersatz des Mangelschadens, s.o.). Sofern unabhängig vom Mangel durch eine Pflichtverletzung des Verkäufers ein sonstiges Rechtsgut oder Recht des Käufers verletzt wird (z.B. Beschädigung der Wohnungseinrichtung bei Anlieferung der Sache), greift unmittelbar § 280 I i.V.m. § 241 II (positive Vertragsverletzung; Voraussetzung: Vertretenmüssen des Verkäufers hins. der Rechtsgutverletzung). Auch dieser Anspruch tritt ggf. neben einenSchadensersatzanspruch statt der Leistung; (vgl. auch § 282!). 4) Verschulden bei Vertragsschluss (culpa in contrahendo), §§ 311, 280 I Ob bei einer schuldhaften Falsch- oder Nichtinformation hins. der Beschaffenheit der Kaufsache, ein Anspruch aus §§ 311 II, 280 I nach Gefahrübergang durch §§ 437 ff. ausgeschlossen ist oder neben den Mängelrechten des Käufers besteht, ist umstritten. Nach der h.M. (Palandt/Weidenkaff, § 437, Rn. 51 a; HK-BGB/Schulze § 311, Rn. 14; Jauernig/Berger, § 437, Rn. 34), haben die §§ 437 gegenüber dem Anspruch aus § 311 II, 280 I Sperrwirkung (ab Gefahrübergang/Rechtsübergang, s.o.). Argument: Durch einen aus §§ 311 II, 280 I resultierenden Anspruch auf Vertragsaufhebung (Schadensersatz im Wege der Naturalrestitution) würden der Vorrang der Nacherfüllung und des Nacherfüllungsrechts des Verkäufers unterlaufen. Bei Vorsatz ist der Verkäufer an sich nicht schutzwürdig, Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 im Interesse der Rechtsklarheit sind aber auch für diesen Fall die §§ 437 ff. gegenüber den §§ 280 I, 311 II als abschließend anzusehen (Palandt/Grüneberg, § 311, Rn. 15). Gegenansicht (z.B. MüKo/Emmerich, § 311 Rn. 135 ff m.w.N.): Zwischen §§ 437 ff. und §§ 311 II, 280 I besteht Anspruchskonkurrenz. Argument: Es ist kein Grund ersichtlich, warum der Verkäufer bei einer vorvertraglichen Pflichtverletzung (Informationspflichtverletzung hins. der Beschaffenheit der Kaufsache bzw. Rechter Dritter) durch eine ausschließliche Anwendung der §§ 437 privilegiert werden sollte (insbesondere hins. der Verjährung, s.u.). Der BGH geht davon aus, dass die Haftung aus c.i.c. nicht durch die Rechtsmangelhaftung des Verkäufers verdrängt wird, wenn der Verkäufer bei Vertragsschluss auf einen Rechtsmangel, von dem er wusste, nicht hingewiesen hat (BGH NJW 2004, 354 f.). Die umstrittene Konkurrenzfrage ist vor allem für die Verjährung der aus dem Mangel resultierenden Ansprüche relevant. Die Mängelansprüche verjähren in der Regel in 2 Jahren nach Ablieferung der Sache (§ 438 I Nr. 3, s.o.). Der Anspruch aus §§ 311 II, 280 I dagegen nach 3 Jahren (§ 195), wobei die Verjährungsfrist zudem erst mit Schluss des Jahres beginnt, in dem der Käufer von den anspruchsbegründeten Umständen Kenntnis erlangt hat bzw. ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 5) Anfechtung Hier ist hinsichtlich der Anfechtungsgründe zu unterscheiden: a) Eigenschaftsirrtum gem. § 119 II Eine Anfechtung wegen Eigenschaftsirrtums gem. § 119 II ist ausgeschlossen, wenn das Mängelrecht der §§ 437 ff. eingreift, d.h. wenn der Irrtum eine verkehrswesentliche Eigenschaft betrifft, die einen Mangel i.S. der §§ 434, 435 darstellt. Umstritten ist allerdings, ab wann der Ausschluss der Anfechtung greift. Nach der Rechtsprechung zum alten Recht soll der Zeitpunkt des Gefahrübergangs (bzw. Rechtsübergangs) entscheiden. Argument: Solange die Mängelrechte noch nicht Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 entstanden sind, besteht kein Anlass, die Anfechtung nach § 119 II auszuschließen (BGHZ 34, 32). Nach der Gegenansicht soll eine Anfechtung gem. § 119 II schon ab Vertragsschluss ausgeschlossen sein, wenn der Irrtum einen Mangel der Kaufsache betrifft (vgl. Medicus AT, Rn 775). In den Gesetzesmaterialien zum neuen Schuldrecht wird es angesichts der Veränderung der Rechtsbehelfe des Käufers als „naheliegend“ bezeichnet, die Anfechtung gem. § 119 II als von vornherein ausgeschlossen anzusehen; (BT-Drucks. 14/6040, S. 210). Der Ausschluss gilt sowohl für einen Irrtum des Käufers als auch für einen Irrtum des Verkäufers i.S. des § 119 II. Grund für den Ausschluss: Durch eine Anfechtung des Käufers würde das Nacherfüllungsrecht des Verkäufers unterlaufen; ferner würde die Verjährungsregelung des § 438 bedeutungslos, weil der Irrende gem. § 121 nach Kenntniserlangung - also ggf. erst nach Ablauf der Fristen des § 438 - (unverzüglich) zur Anfechtung berechtigt ist. Schließlich würde § 442 I 2 unterlaufen, wonach der Käufer keine Mängelrechte hat, wenn er vom Mangel wegen grober Fahrlässigkeit nichts wusste; eine Anfechtung gem. § 119 II ist dagegen auch bei grober Fahrlässigkeit des Irrenden möglich. Durch eine Anfechtung des Verkäufers, würde dieser sich der Mängelhaftung entziehen. Der Ausschluss der Anfechtung gem. § 119 II gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Mängelhaftung vertraglich ausgeschlossen oder die Mängelrechte verjährt sind; das eine wie das andere würde ansonsten unterlaufen. Achtung: Betrifft der Irrtum eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Sache, die keinen Mangel gem. §§ 434, 435 darstellt, ist eine Anfechtung des Irrenden (des Käufers oder des Verkäufers) möglich. b) Inhalts- und Erklärungsirrtum, § 119 I Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 Eine Anfechtung gem. § 119 I wegen Inhalts- oder Erklärungsirrtum ist durch §§ 437 ff. nicht ausgeschlossen. c) Arglistige Täuschung/Drohung Eine Anfechtung gem. § 123 wegen Drohung ist durch §§ 437 ff. nicht ausgeschlossen. Dasselbe gilt von Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, auch wenn diese den Mangel der Sache betrifft. Grund: der arglistig Täuschende verdient keinen Schutz. 6) Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313) §§ 437 ff. gehen als Sonderregelung dem § 313 vor. Das gilt auch beieinem Haftungsausschluss. 7) Unerlaubte Handlung Die Ansprüche aus Delikt (§ 823 I, § 823 II, § 826) werden durch die §§ 437 ff. nicht ausgeschlossen, da sie andere Voraussetzungen haben und weitreichender sind (§§ 844 ff.). Deliktische Ansprüche verjähren gem. § 195 in drei Jahren; die Frist beginnt gem. § 199 mit Schluss des Jahres, in dem der Geschädigte von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat bzw. ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Achtung: Die Lieferung einer mangelbehafteten Sache (§§ 434, 435) ist keine Eigentumsverletzung (§ 823 I), da der Käufer nie Eigentümer einer mangelfreien Sache war bzw. (beim Rechtsmangel) nie unbelastetes Eigentum erworben hat. Der Mangelschaden als solcher, der Minderwert der Sache kann also nicht nach § 823 I geltend gemacht werden (anders ggf. bei arglistiger Täuschung bzgl. des Mangels, dann Anspruch aus §§ 823 II, 263 StGB oder auch aus § 826). Nach § 823 I können allerdings Schäden liquidiert werden, die durch den Mangel an anderen Rechtsgütern des Käufers verursacht werden. Dasselbe gilt nach der Rechtsprechung auch dann, wenn der Mangel der gelieferten Sache zu einer Beschädigung eines anderen bislang mangelfreien Teils der Kaufsache oder auch dieser selbst führt („Weiterfresserschaden“); erforderlich ist, dass sich der Mangel Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Prof. Dr. Franz Dorn Vertragliche Schuldverhältnisse Januar 2009 ursprünglich auf einen abgegrenzten Teil beschränkt und später auf andere Teile bzw. die Sache im Ganzen schädigend wirkt (vgl. zu Einzelheiten etwa Brox, SchuldR BT, § 41 Rn. 6 m.w.N., sowie die Kommentarlit. zu § 823). VIII) Sonderproblem: Selbstvornahme der Nachbesserung durch den Käufer Nimmt der Käufer die Beseitigung des Mangels selbst vor, ohne dem Verkäufer den Mangel anzuzeigen und ihm eine Nachfrist zur Nachbesserung zu stellen, steht in Frage, ob der Käufer die Kosten der Selbstvornahme vom Verkäufer ersetzt verlangen kann. Die Frage ist höchst streitig. Der BGH lehnt jeden Anspruch ab, weil ansonsten dem Käufer ein Selbstvornahmerecht eingeräumt würde, das das Kaufrecht im Gegensatz zum Werkvertragsrecht (§ 637) nicht kennt. Das Recht zur Selbstvornahme im Werkvertragsrecht und der daraus resultierende Aufwendungsersatzanspruch, setzt zudem grundsätzlich den erfolglosen Ablauf einer angemessenen Nacherfüllungsfrist voraus, § 637 I. Dies gilt insbesondere für einen Anspruch aus §§ 326 II S. 2, IV, 346 (direkt oder analog), aber auch für Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag. (§§ 683, 677, 670 oder §§ 684 S. 1, 818) und für Ansprüche aus § 812 I S. 1, 2. Fall (Bereicherung in sonstiger Weise, Ersparnis der Aufwendungen auf Verkäuferseite).In der Literatur wird insbesondere ein Anspruch aus §§ 326 II S. 2, IV, 346 (direkt oder analog) bejaht. Zu Einzelheiten s. Huber, Rep. SchuldR BT, Rn. 294 ff. m.w.N.; eine eingehende Falllösung bietet Joh. W. Flume, JURA 2006, 86 ff. m.w.N. s. ferner BGH, NJW 2005, 1348; BGH NJW 2005, 3212; BGH ZGS 2006, 113; Lorenz ZGS 2003, 398; ders. ZGS 2003, 1417; jüngst Lerach, JuS 2008, 953 ff., (Verwendungsersatz). Glw-dorn-lehrstuhldorn-ws09-10-Zusammenfassung-II-Haftung-Mängelrechte-des-Verkäufers Lösung über Rücktritt