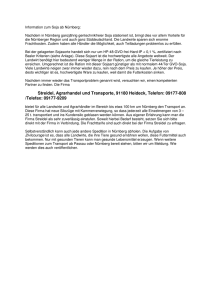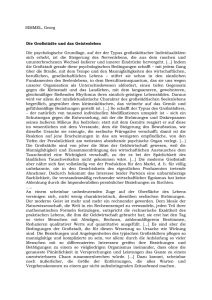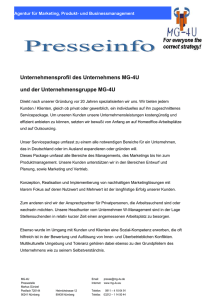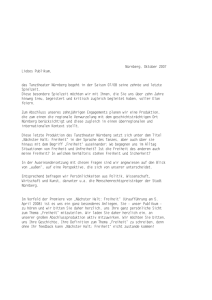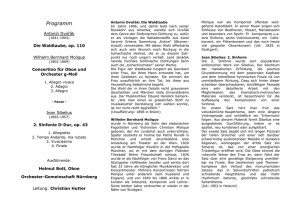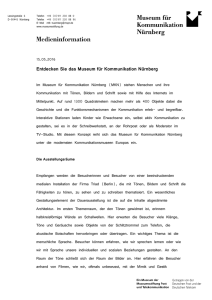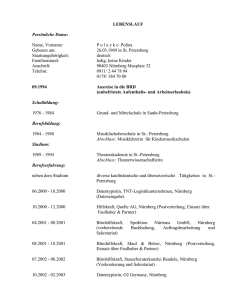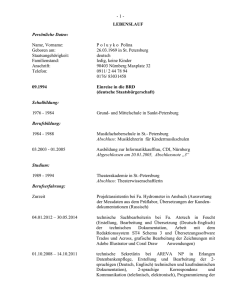Freikirche und Großstadt – Charakteristika und Herausforderungen
Werbung

Freikirche und Großstadt – Charakteristika und Herausforderungen Ich möchte in meinem Referat in folgenden Schritten vorgehen: Zuerst ein Rückblick wie in der Vergangenheit mit der Herausforderung Großstadt in unseer Kirche in England umgegangen wurde. Dann ein Blick auf das, was eine Großstadt ausmacht. Wenn ich konkrete Beispiele heranziehe, dann welche aus Nürnberg. Drittens schaue ich auf Stadtbewohner/innen. Und schließlich nehme ich landeskirchliche und freikirchliche Strategien und Herausforderungen in den Blick. Das alles natürlich mit der Brille eines Pastors, der in einer Großstadt arbeitet, ein wenig Literatur eingesehen hat und manchmal die Augen offen hat und sich so seine Gedanken macht. Davor eine kurze Vorbemerkung. Die Großstädte entstanden im Zuge der Industrialisierung, in Europa seit dem 18. Jahrhundert, dann besonders ab dem 19. Jahrhundert. Auf der Suche nach Arbeit strömten Massen von Menschen vom Land in die Städte. Ihr explosionsartiges Wachstum, das heute immer noch an Städten in der Welt beobachtet werden kann, überforderte alles Planen und Lenken. Die gravierende Armut in den Städten bewegten die Kirchen zunächst nicht. Es war entweder das Versagen der Betroffenen oder deren Situation wurde einfach ignoriert. Die Kirchen waren den Menschen nicht gefolgt. So kommt der Theologe Johannes Ch. Hoekendijk zu dem Urteil: „Bei der Grundsteinlegung zum Bau der modernen Großstadt war die Kirche nicht da.“1 Viel eher entstand mit dem Aufkommen der Großstädte die negative Konnotation „Sündenbabel“ o.ä. (etwa seit Wichern 1848) 1. Mission und Diakonie im Herzen der Stadt2 – Modellprojekte des Methodismus im 19. Jahrhundert in England In England entstanden die Großstädte, da auch die Industrialisierung früher begann, vor den kontinentalen Großstädten. Die Vorgänge glichen sich. Weit über 50% der Stadtbevölkerung waren Arbeitsmigranten. Um die alten Stadtkerne legten sich Industrieansiedelungen und damit verbunden große Arbeiterviertel. Die Mittel- und Oberschicht zog bald in „Sub-urbs“, mehr oder weniger geschlossene Wohnviertel. Die Innenstädte wurden entvölkert. Nach zogen arme Bevölkerungsteile. Schlechte Wohnbedingungen, die Bedrohung durch Krankheiten, die Gefahr der Arbeitslosigkeit, Krankheit und des Alters waren allgegenwärtig. Eine Sozialgesetzgebung existierte nicht. Deutlich wird die soziale Situation am durchschnittlichen Sterbealter. Es lag bei den „Gentlemen“ und ihren Angehörigen bei 45 Jahren, unter den „Tradesmen“ bei 26 und unter den Arbeitern bei nur 16 Jahren.3 Die Kirchen trafen besonders in den Arbeitervierteln auf Menschen, die zum größten Teil schon keine religiöse Sozialisation mehr erlebt hatte. Der Gottesdienstbesuch in Greater London lag bei einer Zählung bei ungefähr 18,6% (bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 4,5 1 Zitiert nach Otto Kehr: Stadtmission. Die kleine und arme Gestalt der Kirche in der großen Stadt. In: Gemeinde in diakonischer und missionarischer Verantwortung. Auftrag – Anspruch – Wirklichkeit. Hg. Von T. Schober/H.Thimme. HZDK 2, Stuttgart 1979, S.335 2 Stefan Deutschmann: Mission und Diakonie im Herzen der Stadt. Von den Anfängen der Stadtmissionsarbeit und ihrer Entwicklung im britischen Methodismus. Beiträge zur Diakoniewissenschaft NF 40, Heidelberg 1995 3 Deutschmann, aaO, 11 Mio Einwohnern). In Berlin lag der Kirchenbesuch, traditionsgemäß, muss man beinahe sagen, schon 1870 wesentlich schlechter, nämlich bei 1,88%.4 In dieser Situation begannen nicht Methodisten, die gehörten inzwischen durchweg zur Mittelschicht (so wurden etwa die meisten Mittel für den Bau von neuen Kirchen in den neuen Vororten verwendet), sondern Privatvereine mit einer neuen christlichen Arbeit in den Herzen der Städte. Der erste war 1826 in Glasgow entstanden, allerdings auf durchaus methodistischem Hintergrund. Es sollte bis in die 1880er Jahre dauern, bis die Methodisten als Kirche unter maßgeblicher Beteiligung von Hugh Price Hughes mit ihrem Konzept der Stadtmissionen auf diese Situation reagierten. Ein Ansatzpunkt war, die dann entstehenden Central Halls nicht als kirchliche Gebäude zu entwerfen, sondern als Vielzweckräumlichkeiten. Ein zweiter Punkt war, das Bezirkssystem aufzugeben, da es wichtiger schien, dass ein vor Ort vorhandener Geistlicher das Vertrauen der dortigen Bevölkerung erwerben konnte. Die Central Halls wurden in Anlehnung an die populären Musikhallen und Theater erbaut. Ihr Ziel war dreierlei: - volksnahe Missionsgottesdienste mit leicht verständlichen, eindringlichen Predigten - eine Palette verschiedener Freizeit- und Unterhaltungsangebote - Sozialarbeit Die Verbindung von Mission und Sozialarbeit erwies sich als außerordentlich erfolgreich, mindestens bis zur Zeit des 1. Weltkrieges. Es lagerten sich an die Missionen neue Berufe an, so etwa die „Sisters of the people“, nicht ohne weiteres Diakonissen vergleichbar. Inzwischen haben sich die Stadtzentren gewandelt, die Innenstädte wurden aufpoliert (wenn auch im angloamerikanischen Bereich lang nicht so wie auf dem Kontinent. In England und USA sind durchweg die Innenstädte die Problemzonen geblieben.), staatliche Sozialleistungen (Wohlfahrtsstaat) machten viele der sozialen Angebote und Hilfestellungen überflüssig. Die großen Gebäude wurden zur Last. Aktuell strukturieren die englischen Methodisten dieses einst angemessene und erfolgreiche Konzept um. Es zeigt: Konzepte haben ihre Zeit. Einfach deshalb, weil insbesondere Großstädte in einem stetigen Wandel begriffen sind. Kirchen haben große Mühe dem zu folgen und auf ihn zu reagieren. Das zeigt sich auch an den Standorten der methodistischen Kirchen in deutschen Großstädten. Als Beispiel die Paulusgemeinde. Die erste Kirche in der Innenstadt wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Ein Wiederaufbau an selber Stelle erwies sich als unmöglich. Neu gebaut wurde 1953/54 in einem anderen Stadtteil, an einer Stelle, an der vorher eine kleine Kapelle stand. Ausschlaggebender Grund war, dass die Mehrzahl der Gemeindemitglieder in diesem Arbeiterviertel wohnte. Inzwischen wohnt von der Gemeinde fast niemand mehr im Viertel. Es hatte sich gewandelt. Aus Arbeitervierteln der großen Industriebetriebe in Nürnberg, die es heute nicht mehr gibt, wurden sozial schwierige Wohnviertel. Noch gravierender sieht die Situation bei den großen Kirchen aus. Kirchengebäude, die vor 100 oder 70 oder 50 Jahren konzipiert und gebaut wurden, ausgelegt für 500 oder 1000 Menschen, sind nicht mehr angemessen für wesentlich kleinere Gemeinden und noch kleinere Gottesdienstgemeinden. Nochmals zeigt sich: eine Großstadt ist in ständigem Wandel begriffen. Darauf will ich jetzt schauen. 4 Stephan Reimers: Gott in der Stadt. Zur Zukunft des Christlichen in der säkularen Stadt in: Heinz Schmitt/Renate Zitt (Hg.): Diakonie in der Stadt. Reflexionen – Modelle – Konkretionen, Diakoniewissenschaft Bd. 8, Stuttgart 2003, S. 160 2. Städte und ihr Wandel „Von dem rapiden Wachsthum der Stadt hatte Niemand eine Ahnung.“5 Die Großstädte in Deutschland entstanden im 19. Jahrhundert. Ähnlich wie in England führte die Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum zu einem explosionsartigen Anstieg der Stadtbevölkerung. Verdeutlichen möchte ich das anhand von Nürnberg: 450000 400000 350000 300000 250000 Fläche in ha 200000 150000 Einwohner 100000 50000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1806-1930 Innerhalb von 125 Jahren verzwanzigfachte sich die Bevölkerung Nürnberg.6 Verbunden waren damit riesige Wanderungsbewegungen.6 50000 45000 40000 35000 30000 Zugewanderte 25000 Abgewanderte 20000 Wanderungsvolumen 15000 10000 5000 1894 1892 1890 1888 1886 1884 1882 1880 1878 1876 0 Rein rechnerisch setzt sich der Bevölkerungszuwachs Nürnbergs von 1849 bis 1895 wie folgt zusammen (Bevölkerungszahl 162386): 50828 Bevölkerungsstand 1849 1769 Bevölkerungszuwachs durch Eingemeindungen 32268 Geburtenüberschuss 5 Gottlieb von Merkel, Gutachten über die Verlegung des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Nürnberg, Nürnberg 1889 zitiert nach: Charlotte Bühl-Gramer: Nürnberg 1850-1892. Stadtentwicklung, Kommunalpolitik und Stadtverwaltung im Zeichen von Industrialisierung und Urbanisierung, Schriftenreihe de Stadtarchivs Nürnberg Bd 62, Nürnberg 2003, Deckblatt 6 nach Nürnbergs Wachstum im 19.&20. Jahrhundert, Ausstellung des Stadtarchivs Nürnberg 1972 6 nach Bühl-Cramer, aaO, S. 111 77421 Wanderungsgewinn So rasant wandeln sich unsere großen Städte heute nicht mehr. Aber was nach wie vor gilt: Großstädte sind im steten Wandel. Und dieser Wandel lässt sich nur bedingt steuern.7 Wo Menschen wohnen, wie sie sich bewegen, wo sie Arbeit finden lässt sich zwar beschreiben, aber nur mit großen Unsicherheitsfaktoren vorhersagen. Denn „Städte sind ‚lebende Systeme, gemacht, verändert und erfahren durch Menschen’ (Manuel Castells).“8 Kirchen, auch unsere Kirche, reagieren auf den stetigen Wandeln, wenn überhaupt, mit großer Verzögerung. Das Festhalten an überkommenen Strukturen, die Festlegung durch Gebäude und Standorte überwiegen. Zu dem kommt noch hinzu, dass aller Wandel in den Städten einhergeht mit Konstanz und Sesshaftigkeit. In vielen sich verändernden Stadtteilen wohnen auch noch viele Menschen, die schon lange dort wohnten. In unseren Gemeinden sind, zum Glück, ja auch Menschen, die hier geboren wurden und bleiben. Entstanden sind allerdings die EmK-Gemeinden wie vielleicht alle oder mindestens viele freikirchliche Gemeinden durch die Migrationsbewegungen in den Großstädten. Die Paulusgemeinde hatte einmal das Image vor gut 100 Jahren einer Hausmädchengemeinde. Das waren die jungen Frauen, die z.B. aus der Oberpfalz in die Stadt „in Stellung gingen“. Auch heute ist Migration noch mindestens für freikirchliche Gemeinden bezeichnend. Die Baptisten in Nürnberg etwa sprechen entweder ein Deutsch mit slawischem Akzent oder Hochdeutsch. Erwachsene Methodisten sind oft nicht in Nürnberg geboren. Und noch deutlicher wird dies Bild, wenn viele neue Gemeinden, die bestimmte Ethnien gebildet haben, in den Blick genommen werden. Es leuchtet mir auch ein, dass gerade Freikirchen und Migration viel miteinander zu tun haben. Menschen kommen in eine fremde Umgebung, in eine andere Kultur. Sie lassen ihre Orientierungssysteme, auch ihre Kirche zurück. In dieser neuen Situation suchen sie nach neuer Orientierung. Sie sind anders offen auch für eine Kirche und den christlichen Glauben als Menschen, die schon jahrelang vor Ort sind und sich orientiert haben. Migration kann geradezu als ein Kennzeichen der Stadt benannt werden. „Städte leben von der Migration. Seit Jahrhunderten wandern Menschen vom Land in die Städte. Seit dem Mittelalter haben die Städte meist eine negative demographische Bilanz gehabt.“9 Heute sind es in Nürnberg nicht mehr die Menschen aus der Oberpfalz, sondern aus Osteuropa, aus EUStaaten, aus der Türkei, aus Afrika, Ländern also, die oftmals einen demographischen Überschuss haben, die in die Großstadt kommen. Noch ein weiterer Blick auf Veränderungen: Stadtteile haben ein Image, das zu einem guten Teil auf Fakten, zu einem anderen Teil auf Einschätzungen beruht. Das jeweilige Image verstärkt sich von selber. Ist es schlecht (zu laut, zu viele Ausländer, zu unsicher) erhöht sich die Bevölkerungsfluktuation wie von selber. Im Nürnberger Süden liegt sie etwa bei 16%. D.h. ein hoher Teil der Bevölkerung ist auf der „Durchreise“.10 Es bilden sich in Stadtteilen Ghettos heraus. Sie sind bestimmt durch einen hohen Bevölkerungsanteil gleicher Herkunftssprache. Mit damit ist verbunden, dass andere Bevölkerungsteile vermehrt wegziehen, da Kindergärten und Schulen zunehmend dieselben 7 Fred Krüger: Lässt sich Stadt überhaupt planen? Zur Steuerungsfähigkeit urbaner Gesellschaften in: Werner K.Blessing (Hg): Die Zukunftsfähigkeit der Stadt in Vergangenheit und Gegenwart, Erlangen 2004, S.265-294 8 Stephan Lanz/Jochen Becker: Metropolen, Hamburg 2001, S.66 9 Dietrich Thränhardt: Globalisierung und städtische Gesellschaft in: Werner K.Blessing (Hg): Die Zukunftsfähigkeit der Stadt in Vergangenheit und Gegenwart, Erlangen 2004, S. 208 10 Vgl etwa Leben in Galgenhof/Steinbühl – Wo liegt die Zukunft des Stadtteils?, Deutsche Institut für Urbanistik 2001 Problemsituationen aufweisen und vermehrt eine bestimmte kulturelle und sprachliche Herkunft dominiert. Andere Tendenzen sind, dass sich Altersgruppen in einer Stadt gut lokalisieren lassen. Das hängt durchaus direkt mit der jeweiligen ethnischen Herkunft zusammen. (aus: F. Krüger, aaO, S. 270) Die Politik einer Stadt reagiert oft sehr spät wenn überhaupt auf solche Entwicklungen. Steuern lassen sie sich insgesamt kaum. Dazu kommt noch, dass die finanziellen Möglichkeiten eng geworden sind. Und dass unterschiedliche Fragen (Bildung, Arbeit etc) entweder Angelegenheiten der Stadt, des Bundes oder des Landes oder der freien Wirtschaft sind. Ein wirklich koordiniertes Vorgehen fehlt oft, vielleicht von manchen Projektgebieten abgesehen. Die Klage darüber, dass Integration nicht klappt ist allgegenwärtig.11 Eine typische Problemstellung für eine EmK-Gemeinde lautet dann: Unser Stadtteil hat sich wie oben verändert. Der Anteil von Menschen aus anderen Herkunftsländern und mit einer anderen Muttersprache ist gestiegen. Zu unseren Kinderangeboten müssen unsere Gemeindeglieder die Kinder herfahren. Die Kindern, die zu Fuß kommen können, sprechen oft nicht Deutsch als Muttersprache, gehören zu einer anderen sozialen Schicht, haben andere Verhaltensweisen etc. Die eigenen Gemeindeglieder machen den Aufwand nicht mit, ihre Kinder dieser Situation auszusetzen usw. Und noch ein weiteres Kennzeichen des Wandels. Heute wachsen nicht mehr die Vorstädte, geschweige denn die Cities. Inzwischen wird großflächig der Raum zersiedelt. „Würden Charlottenburg und Wilmersdorf, die vor hundert Jahren die größten Baugebiete der 11 Thränhardt, aaO, S.208 Reichshauptstadt waren, heute neu geplant, dann entstünde auf der Grundlage aktueller Abstands-, Dichte-, Belichtungs- und auch Parkplatzvorschriften eine aufgelockerte und durchgrünte Zone, so dass die gleiche Anzahl von Wohnungen nur auf einer Fläche untergebracht werden könnte, die größer wäre als das gesamte Stadtgebiet Berlins.“12 Bauliche Verdichtung und funktionale Reintegration wird heute beinahe verunmöglicht durch Bauvorschriften und eine langfristige Nachwirkung der Naziideologie, die stadtfeindlich war und Kleinbausiedlungen bevorzugte (auch wegen des Schutzes gegen Luftangriffe; zudem waren es dieselben Architekten, die die deutschen Städte nach dem Krieg wieder aufbauten). 3. Leben als Stadtbewohnerin und –stadtbewohner Aus der Sicht von StadtbewohnerInnen ergibt sich nochmals ein anderes Bild von Großstadt. Dies wird strukturiert durch die Orte, die ich jeweils selber aufsuche und durch meinen Grad an Mobilität. Das alles hat dann Folgen für unterschiedliche Altersgruppen und soziale Schichten. Und es hat zur Folge, dass jeweils unterschiedliche Stadtbilder entstehen. Verdeutlichen möchte ich das an der sogenannten „Inseltheorie“.13 Einkauf Kirche Kiga Wohninsel Freunde Schule Kurse Die einzelnen Insel der Lebenswelt Stadt haben miteinander höchstens zufällig etwas zu tun. Die einzig gemeinsame Mitte finden sie in einer Person. Was in einem inzwischen auch idealen Dorf von allen geteilt würde (dieselbe Schule, dieselbe Kirche, dieselben Einkaufsmöglichkeiten etc), differenziert sich in einer Stadt sehr schnell. Man kann sich das klar machen, wenn man die einzelnen Inseln mal für sich selber ausfüllt. Oder sich überlegt, wie sie für verschiedene Personen aussehen könnten. 12 Michael Mönninger: Einleitung: Tendenzen der Stadtentwicklung im Spiegel aktueller Theorien in: M.Mönninger (Hg.): Stadtgesellschaft, Frankfurt 1999, S.12 13 H.Zeiher/J.Zeiher: Orte und Zeiten der Kinder: Soziales Leben im Alltag von Großstadtkindern, Weinheim/München 1994, S.26ff Einkauf Kirche Sport Wohninsel Freunde Beruf Kultur Mit zunehmender Mobilität ist die Entfernung der einzelnen Inseln voneinander auch ohne Belang. Klar wird auch, dass Nachbarschaft in der Großstadt etwas völlig anderes ist als in einem kleinräumigeren Siedlungsgebiet. Und deutlich wird auch, dass die Bindung an eine Kirche ähnlich im Lebensmuster vorkommt. Eine örtliche Nähe muss nicht gegeben sein. Wenn ich mir eh mein Leben aus den verschiedenen Inseln zusammenstelle, dann auch mein kirchliches Leben. Individualisierung nennt sich das, übertragen auf ein Verhaltens- und Raummuster. Großstädte bieten die Voraussetzungen schlechthin, um Individualität zu leben. Und man redet von einer „Enträumlichung sozialer Beziehungen“.14 Und weiter: „Die Nutzung des Raums vollziehe sich nur noch als vorübergehendes Aufsuchen von Rauminseln; folglich lasse die Identifikation mit Räumen immer mehr nach.“15 Dieses Lebens- und Verhaltensmuster hat viel mit Mobilität zu tun. Alte Menschen, die nicht mehr können, sind wesentlich stärker darauf angewiesen, möglichst wenig Inseln in ihrem Lebensfeld zu haben. Ebenso sind Kinder, mindestens diejenigen, deren Eltern nicht für Mobilität sorgen können, darauf angewiesen, ihr Leben kleinräumig gestalten zu können. 4. Kirchliche Strategien Die großen Kirchen haben in der Vergangenheit, so weit ich das beobachten kann, folgende Struktur in Großstädten ausgebildet: - flächendeckende Parochialgemeinden, die immer noch bestehen, auch wenn sich die Personengruppen in der Parochie deutlich verändert haben. Sie versuchen ein Komplettangebot zu bieten. - zentrale Veranstaltungskirchen, in Nürnberg etwa St. Lorenz. Zum Teil mit inhaltlichen Schwerpunkten wie z.B. Kirchenmusik. Diese Kirchen haben zwar noch eine Gemeinde, der größere Teil aber nicht mehr aus der Parochie. - Zentrale Dienste und eigenständige Einrichtungen im sozialen, kulturellen Bereich, im Jugendbereich und für verschiedene Zielgruppen 14 Regina Bittner: Die Stadt als Event in: dies. (Hg): Die Stadt als Event. Zur Konstruktion urbaner Erlebnisräume, 2002, S. 17 15 dies., S. 22 Die engeren finanziellen Spielräume bedeuten zur Zeit das „aus“ für diese Modelle. Gemeinden werden zusammengelegt, das Ende von Parochien ist absehbar. Zentrale Dienste werden eingestellt oder gekürzt. Die Rede geht von der Besinnung auf die Kernaufgaben einer Kirche. Wie auch immer das sich dann konkret darstellen soll. Gemeindeneugründungen aus dem evangelikal-charismatischen Bereich arbeiten meist mit einer sehr klaren und engen Zielgruppenorientierung (vgl dazu das Modell der Suddelback Community Church von Rick Warren). Meist sind mittelständische, deutsche junge Familien im Blick. Der Ort der jeweiligen Gemeinde ist eigentlich ohne Belang. Die Verkehrssituation entscheidender. Als kleine Kirche hatten wir nie ein solches Modell wie die Großkirchen. Auch die Ausbildung von Central Halls wie in der Vergangenheit in England fand in Deutschland nie statt. Eine Orientierung auf eine ganz bestimmte soziale Zielgruppe hin geschieht in nur wenigen Gemeinden. Was uns mit den großen Kirchen verbindet ist der Versuch, am jeweiligen Standort ein möglichst umfassendes Angebot zu machen. Da auch unser finanzieller Spielraum enger wird und sich zudem das Umfeld der Standorte stark verändert hat, ist auch in unserer Kirche eine neue Orientierung angesagt. Dazu einige Gedankensplitter: - Überzeugend finde ich den Gedanken einer Verbindung von Mission und Sozialarbeit. Das eine sollte nicht an die Spezialisten verwiesen werden, das andere nicht als evangelikale Eigenart bezeichnet werden. Allerdings weis ich von keinen überzeugenden Modellen. Vielmehr gilt es hier welche zu finden. Ich kenne nur globale Modellbeschreibungen wie etwa einen Dreischritt von „Erinnern“ (Glaubensdienst), „Sorgen“ (Nächstendienst) und „Danken“ (Gottesdienst). Oder ein anderes Beispiel: „Die Arbeit am Gewissen der Stadtöffentlichkeit“, „Die Sorge für das Gedächtnis der Stadt und ihrer Bewohner“ und „Die Inszenierung der Hoffnung am jeweiligen Ort“.16 - Eine Voraussetzung dazu ist, dass eine Gemeinde ihren Ort als Herausforderung begreift. Ein Traum von mir wäre, dass Menschen bereit sind, ihren Wohnort dorthin (wieder) zu verlegen. - Die Tendenz, unterschiedliche Menschen mit einem verschiedenen Hintergrund integrieren zu wollen, scheint mir eine Fiktion zu sein. Die Milieus sind zu verschieden. Die Sprache trennt. Die sozialen Schranken sind hoch. Die Lebenswelten sehr verschieden. - Wenn Integration nicht das Ziel sein kann, was dann? Eine Möglichkeit ist der verstärkte Aufbau von Gemeinden gleicher Herkunftssprache, wie es z.B. in der NJK mit den ghanaischen Gemeinden passiert. Dazu benötigt auch die EmK Menschen, die das Evangelium in der entsprechenden Muttersprache weitergeben können. Ich träume davon, auch außerhalb unserer Gehaltsordnung Menschen mit schmalerer Ausbildung anstellen zu können, die diesen Anforderungen gerecht werden. Eine andere Möglichkeit sind stärker milieugerechte Angebote innerhalb bestehender Gemeinden. Man muss sich dabei allerdings von dem Wunsch verabschieden, dass die damit erreichten Menschen in absehbarer Zeit im Gottesdienst auftauchen. Insbesondere von Angeboten für Kinder und alte Menschen (beide durch eine nicht hohe Mobilität gekennzeichnet und eher an den Wohnort gebunden) erhoffe ich mir einiges. - Es braucht den Mut, Immobilien verlassen zu können und neu danach zu fragen, wer wir als Gemeinde für wen sind. Wolfgang Grünberg: Die Kirche und die Seele der Stadt – Was ist Stadtkirchenarbeit heute? In: Diakonie in der Stadt (s.0.), S. 185f 16 - In einer Situation, in der fast alle Kirchen kürzen müssen, erwachsen auch neue ökumenische Chancen. Weshalb sollen denn Kirchen ihre Angebote alle zurückfahren, Häuser und Gemeinden aufgeben oder zusammenlegen, um dann doch wieder in kleinerem Maßstab ein Rundumangebot zu gestalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ökumene in Zukunft auch heißen kann, stadtteilbezogen Aufgaben zu teilen oder/und gemeinsam anzugehen.