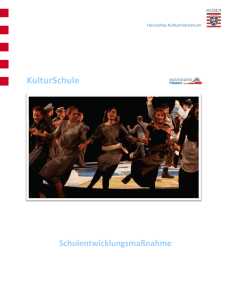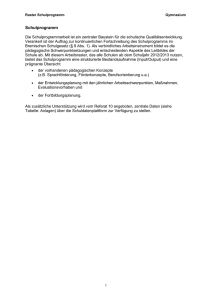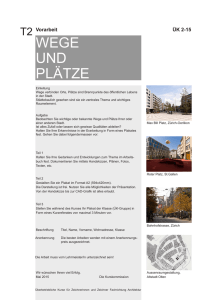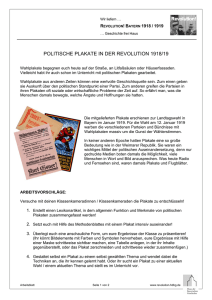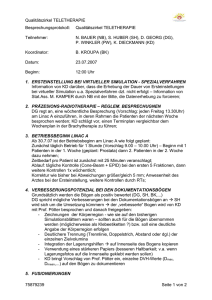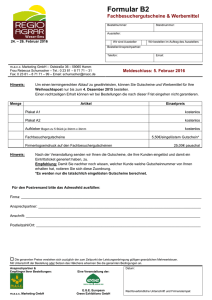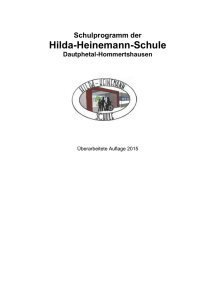Moderation von Schulentwicklungsprozessen
Werbung
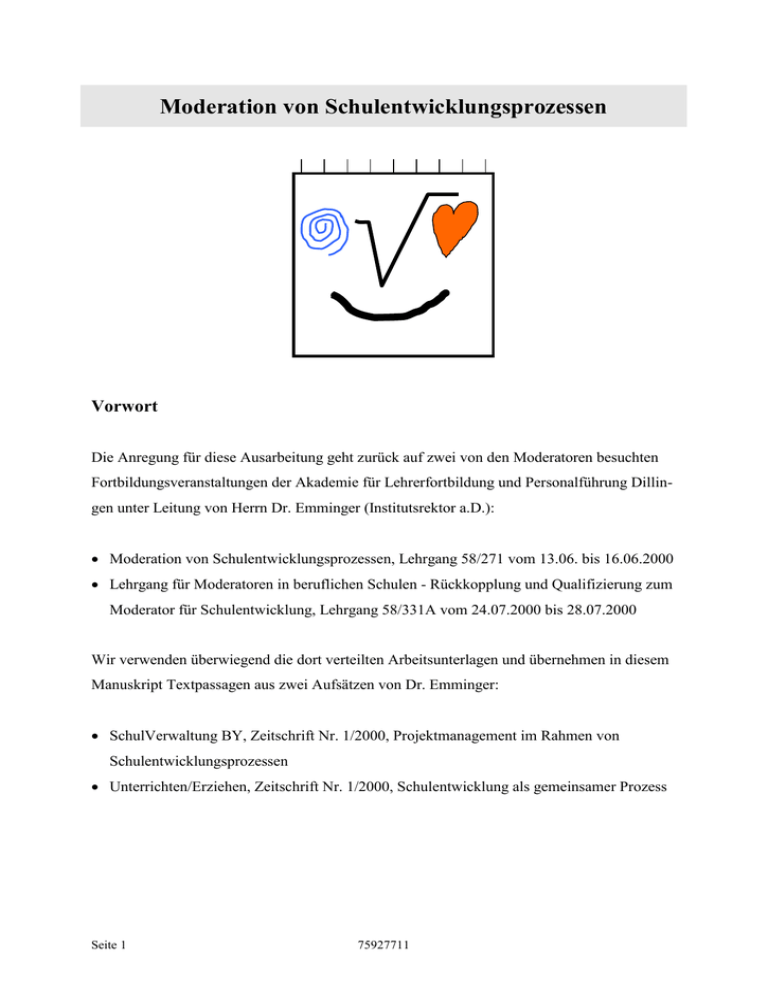
Moderation von Schulentwicklungsprozessen Vorwort Die Anregung für diese Ausarbeitung geht zurück auf zwei von den Moderatoren besuchten Fortbildungsveranstaltungen der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen unter Leitung von Herrn Dr. Emminger (Institutsrektor a.D.): Moderation von Schulentwicklungsprozessen, Lehrgang 58/271 vom 13.06. bis 16.06.2000 Lehrgang für Moderatoren in beruflichen Schulen - Rückkopplung und Qualifizierung zum Moderator für Schulentwicklung, Lehrgang 58/331A vom 24.07.2000 bis 28.07.2000 Wir verwenden überwiegend die dort verteilten Arbeitsunterlagen und übernehmen in diesem Manuskript Textpassagen aus zwei Aufsätzen von Dr. Emminger: SchulVerwaltung BY, Zeitschrift Nr. 1/2000, Projektmanagement im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen Unterrichten/Erziehen, Zeitschrift Nr. 1/2000, Schulentwicklung als gemeinsamer Prozess Seite 1 75927711 Inhalt 1 Was geht voraus? 1.1 Information des Schulleiters und des Kollegiums 1.2 Kollegiumsbeschluss 2 Informationsveranstaltung (1. Sitzung): Fachbetreuer und Lehrerkonferenz 2.1 Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms 2.2 Reflexion über die Schulentwicklung 2.3 Referat 2.3.1 Warum Schulentwicklung? 2.3.1.1 Schulentwicklung ist nichts Neues 2.3.1.2 Schulentwicklung muss neu definiert werden 2.3.2 Unser Weg der Schulentwicklung 2.3.2 1 Der Versuch einer Definition 2.3.2.2 Übersicht über die organisatorischen Strukturen 2.3.2.3 Betreuungsvereinbarung und die Rolle des Moderators 2.3.3 Die Schritte des Schulentwicklungsprozesses 2.3.3.1 Information des Schulleiters und des Kollegiums (Schritt 1) 2.3.3.2 Kollegiumsbeschluss (Schritt 2) 2.3.3.3 Informationsveranstaltung (Schritt 3) 2.3.3.4 Betreuungsvereinbarung (Schritt 4) 2.3.3.5 Bildung einer Steuergruppe (Schritt 5) 2.3.3.6 Entwicklung gemeinsamer Zielvorstellungen (Schritt 6) 2.3.3.7 Prioritätensetzung: Schulprogramm (Schritt 7) 2.3.3.8 Projektmanagement (Schritt 8) 2.3.3.9 Beschlussfassung der Lehrerkonferenz und Umsetzung(Schritt 9) 2.3.3.10 Interne und externe Evaluation (Schritt 10) 2.3.3.11 Neue Prioritätensetzung (Schritt 10) 2.4 Zusammenfassung / Diskussion 2.5 Reflexion/Abstimmung 2.5.1 Reflexion 2.5.2 Abstimmung Seite 2 75927711 2.6 Wahl der Steuergruppe 2.7 Schluss der Veranstaltung 2.8 Anhang 2.8.1 Folien 2.8.2 Betreuungsvereinbarung 2.8.3 Sammlung wichtiger Kernaussagen 2.8.4 Zitatenschatz 3 Praktische Umsetzung 3.1 Erarbeitung eines Leitbildes (2. Sitzung) 3.1.1 Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms 3.1.2 Treffen von Arbeitsvereinbarungen 3.1.3 Von „irgendeiner guten Schule zur „Schul-Charta“ 3.2 Vom Leitbild zum Projektmanagement (3. Sitzung) 3.2.1 Begrüßung, Vorstellung des Tagungsprogramms, Reflexion 3.2.2 Prioritätensetzung: Schulprogramm 3.2.3 Projektmanagement 3.2.4 Anhang 3.2.5 Vorstellung der Umsetzungskonzepte 3.2.6 Wie geht es weiter? 3.2..1 Interne und externe Evaluation 3.2.6.2 Neue Prioritätensetzung 3.2.7 Zusammenfassung 3.2.8 Reflexion über die Umsetzungschancen 3.2.9 Blitzlicht zum Tagesverlauf und Abschluss der Veranstaltung Seite 3 75927711 1 Was geht voraus? 1.1 Information des Schulleiters und des Kollegiums Vorab müssen die Schulleiter über das Angebot der Multiplikatoren, den von Dr. Emminger konzipierten Schulentwicklungsprozess zu moderieren, informiert werden. Dies kann/ist geschehen durch a) ein Informationsschreiben der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalplanung, das an alle beruflichen Schulen versandt wird/wurde; b) ein Informationsschreiben der Regierung an alle beruflichen Schulen; c) ein/eine Referat/Informationsveranstaltung während einer Schulleiterkonferenz; d) einen Hinweis auf unsere Homepageseite; e) direkte Kontaktaufnahme der Moderatoren mit den Schulen. Den Anstoß zur Einleitung eines Schulentwicklungsprozesses gibt der Schulleiter, indem er bei den Moderatoren sein Interesse für einen solchen Prozess bekundet. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, dass die Moderatoren vorab ihr Konzept dem Schulleiter, den Führungsträgern der Schule und dem Personalrat im Rahmen einer Fachbetreuerkonferenz persönlich vortragen (Anmerkung: Diese Vorgehensweise, zuerst mit den Meinungsträgern der Schule ins Gespräch zu kommen, hat sich bewährt.) Im Rahmen einer Gesamtkonferenz informiert der Schulleiter das Kollegium über die Möglichkeit, einen Schulentwicklungsprozess einzuleiten. Er verteilt ggf. verschiedene Artikel (z.B. die auf der ersten Seite erwähnten Aufsätze) zum Thema „Schulqualität/Schulentwicklung“ und animiert das Kollegium, der Einladung eines externen (EM) Moderators zur nächsten Konferenz zuzustimmen. 1.2 Kollegiumsbeschluss Wenn das Kollegium beschließt den EM zwecks näherer Informationsbeschaffung einzuladen, dann stimmen sich Schulleiter und Moderatoren über den nächsten Veranstaltungstermin ab. Die Einladung geht an das gesamte Kollegium der Schule. Anmerkung: Folgendes soll beim Schulleiter erfragt werden: - Wie groß ist sein Interesse an einem Schulentwicklungsprozess? - Wie groß ist das Interesse des Kollegiums? Schulentwicklung ist ohne Schulleitung nicht möglich. Aber: Viele Schulleiter denken „Ich bin die Schule. Das ist meine Schule.“ Der Schulleitung muss klar sein, dass sie zur Disposition steht. Man sollte sich als Moderator nicht verführen lassen, einen SE-Prozess einzuleiten, ohne dass die Schule (Schulleitung, Kollegium) es will. Man sollte nicht an der eigenen Schule einen Schulentwicklungsprozess moderieren. Die Schule, die einen Schulentwickler anfordert, bräuchte gar nicht entwickelt werden, weil sie den ersten Schritt bereits getan hat. Seite 4 75927711 2 Informationsveranstaltung (1. Sitzung) Informationsveranstaltung im Rahmen einer Lehrerkonferenz zum Thema „Vorstellung unseres Konzeptes zur inneren Schulentwicklung“ Vorgesehenes Tagesprogramm (ca. 2,5 – 3 Std.) 1. Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms 2. Reflexion über die „Schulentwicklung“ 3. Referat 3.1 Warum Schulentwicklung? 3.2 Unser Weg der Schulentwicklung 3.3 Die Schritte eines Schulentwicklungsprozesses 4. Zusammenfassung / Diskussion 5. Reflexion / Abstimmung Seite 5 75927711 Vorbereitung Folien und Arbeitsblätter Kopien Vertragsmuster Aufsatz Dr. Emminger Aushang im Konferenzzimmer Plakat 1 Schulqualität durch Schulentwicklung Steigerung der Qualität schulischer Bildung durch interne Schulentwicklungsprozesse (mit externer Begleitung) Plakat 2 Unser Weg von innerer Schulentwicklung ist ein systemischer und systematischer Schulentwicklungsprozess auf der Grundlage eines Organisationsentwicklungsprozesses. Plakat: Zitatenschatz Evtl. Plakat vor der Eingangstür zum Konferenzzimmer Plakat 3 Schulentwicklung ist für mich ... kein Thema ein Blatt mit sieben Siegeln wichtig (weiß nicht) Jeder kommende Teilnehmer bekommt einen Klebepunkt, mit dem er einen von den drei Aspekten bepunktet. Kurz vor Veranstaltungsbeginn wird die Tafel (Pinwand) in das Konferenzzimmer gefahren. Seite 6 75927711 Plakat 4 Killerphrasen? „Das machen wir doch alle schon längst!“ „Ich will weiter nichts als in Ruhe in meinen Unterricht gehen!“ „Erst mal müssen die Klassen kleiner werden!“ „Wir haben sowieso schon so viel am Hals, und dann sollen wir auch noch Schulentwicklung machen!“ „Soll das KM uns doch vormachen, wie Schulentwicklung geht!“ Plakat 5 Zitatenschatz „Es muss nichts geschehen, weil, wenn nichts geschieht, passiert etwas.“(unbekannt) „Konflikte sind Chancen für Neues.“ (unbekannt) „Schulentwicklung braucht große Gedanken, kleine Schritte und einen langen Atem.“ (Hartmut von Henting) „..., ich habe verschiedene alte Gebäude kennen gelernt, in welchen gut unterrichtet wurde, es komme nur hauptsächlich auf die Lehrer an.“ (Goethe) „Gemeinsam statt einsam“ (unbekannt) „Am Anfang jeder Tat steht der Traum, die Vision oder das Ziel.“ (Nikolaus B. Enkelmann) „Fehler sind Freunde. Sie helfen mir, den Fehler nicht mehr zu machen.“ (unbekannt) „Schule ist ein Haus des Lernens.“ (unbekannt) „Schulentwicklung dient den Menschen oder es ist ein überflüssiges vorhaben.“ (unbekannt) „Die neue Lernkultur wird es nicht geben, wenn wir nicht die Lernenden sein wollen.“ (unbekannt) Das beste Mittel gegen Traurigkeit ist lernen.“ (unbekannt) Seite 7 75927711 2.1 Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms (15 min) Vorbereitung: (1) Folie 1: Tagungsprogramm (2) Im Vorfeld klären, wie das Abstimmungsverfahren erfolgen soll. (3) evtl. Vorstellungsplakat a) bei einer Gesamtkonferenz Sehr geehrter Herr ..., sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Helm und ich begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Informationsveranstaltung zur inneren Schulentwicklung. Vorgestellt haben wir unser Schulentwicklungskonzept bereits in einer Konferenz der Schulleitung, (der Steuergruppe,) dem Personalrat und den Fachbetreuern. Vielleicht gelingt es uns heute, auch Sie für unsere Sache zu gewinnen. Sie müssen nämlich entscheiden, ob Sie in einen Schulentwicklungsprozess mit unserer Begleitung an Ihrer Schule eintreten wollen. Evtl. Vorstellung (mit Vorstellungsplakat) Reiner stellt sich vor. Ich unterrichte ... Zur inneren Schulentwicklung sind mittlerweile unzählige Bücher und Aufsätze veröffentlicht worden. Die Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen bietet ein umfangreiches Netz an Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema an. Somit versteht es sich von selbst, dass wir am heutigen Nachmittag mit dem uns zur Verfügung stehenden knappen Zeitkontingent nur auf die wichtigsten Aspekte der Schulentwicklung eingehen können. Folgendes Tagungsprogramm haben wir vorgesehen. Folie 1: Tagungsprogramm (2) Zunächst sollen Sie selbst Gelegenheit haben, zum Thema Schulentwicklung etwas zu sagen. (3.1) Dann informieren wir Sie kurz darüber, warum Schulentwicklung in der heutigen Zeit wichtig ist. (3.2) Wir erklären Ihnen, was wir unter Schulentwicklung verstehen. (3.3) Dann stellen wir Ihnen unseren Weg der Schulentwicklung vor. Wir zeigen Ihnen gegen Ende des Vortrages in ganz konkreten Schritten, wie ein solcher Prozess an Ihrer Schule ablaufen Seite 8 75927711 könnte. (4) (5) Nachdem ausführlich diskutiert wurde stimmen Sie ab, ob Sie mit uns diesen Weg gehen wollen. Uns ist durchaus bewusst, dass trotz der Kürzungen, die wir vorgenommen haben, auf sie sehr viele Informationen hereinströmen werden. Dennoch hoffen wir, dass Ihre geschätzte Aufmerksamkeit nicht allzu sehr darunter leidet. Gibt es zum Verlauf der Veranstaltung Fragen? Seite 9 75927711 b) vor Fachbetreuern Sehr geehrter Herr _______________, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Helm und ich begrüßen Sie sehr herzlich. Wir freuen uns, Ihnen heute Nachmittag unser Schulentwicklungskonzept zur inneren Schulentwicklung vorstellen zu dürfen. Für die Einladung bedanken wir uns bei Ihnen Herr _________________ sehr herzlich. (Was bewegt nun Herrn Helm und mich, unser Konzept von Schulentwicklung zunächst nur im kleinen Kreis - bestehend aus Schulleitung, Fachbetreuern und Fachbereichsleitern, Personalrat und der Steuergruppe - vorzustellen? Zunächst einmal haben Herr Helm und ich ein großes Interesse daran, dass sich in der Sache Schulentwicklung an den Schulen mehr als bisher bewegt. Einen wichtigen Beitrag können hierbei die Funktionsträger übernehmen. Sie sind der Transmissionsriemen zum Kollegium. Ihre Aufgabe ist es, das Kollegium in Sachen Schulentwicklung zu informieren und zu motivieren. Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch in der Annahme, dass Funktionsträger im Kollegium eine Vorbildfunktion zu erfüllen haben. Deshalb sollten Sie ständig – wenn es einmal soweit ist - in der Projektgruppe „Schulentwicklung“ vertreten sein und in die Steuergruppe eingebunden werden. Wer dann auch noch in den Arbeitskreisen mitarbeitet, kann ziemlich sicher sein, dass seine Ideen aufgegriffen werden.) Evtl. Vorstellung (mit Vorstellungsplakat) Nachdem jetzt unsere Ziele bei dieser Veranstaltung klar beschrieben sind, stellen wir uns Ihnen vor. Reiner! Reiner stellt sich vor. Ich unterrichte ... Folgendes Tagungsprogramm haben wir vorgesehen: Folie 1: Tagungsprogramm (2) Zunächst sollen Sie erst einmal selbst Gelegenheit haben, zum Thema Schulentwicklung etwas zu sagen. (3.1) Dann informieren wir Sie kurz darüber, warum Schulentwicklung in der heutigen Zeit wichtig ist. (3.2) Wir erklären Ihnen, was wir unter SchulSeite 10 75927711 entwicklung verstehen. (3.3) Dann stellen wir Ihnen unseren Weg der Schulentwicklung vor. Wir zeigen Ihnen in ganz konkreten Schritten, wie ein solcher Prozess an Ihrer Schule ablaufen könnte. Nach jedem Abschnitt haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit uns über die Ausführungen zu diskutieren. (Später einmal müssen Sie mit Ihrem Kollegium entscheiden, ob Sie mit uns in einen Schulentwicklungsprozess mit allen positiven, aber auch negativen Auswirkungen eintreten wollen.) Gibt es bis hierher Fragen? Wir steigen anfangs sehr allgemein in das Thema Schulentwicklung ein und werden dann Schritt für Schritt konkreter. Seite 11 75927711 Vorgesehenes Tagesprogramm (2,5 –3 Std.) 1. Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms 2. Reflexion über die „Schulentwicklung“ 1. Referat 3.1 Warum Schulentwicklung? 3.3 Unser Weg der Schulentwicklung 3.3 Die Schritte des Schulentwicklungsprozesses 4. Zusammenfassung / Diskussion 5. Reflexion / (Abstimmung) Folie 1 Seite 12 75927711 2.2 Reflexion (20min) 2.2.1 Fall 1 Anmerkung: Besonders geeignet auf der Gesamtkonferenz Vorbereitung: (1) Umfragezettel (2) evtl. Flipchart (3) Frage mit alternativer Fragestellung Der Moderator kommentiert die bepunkteten Aussagen (Plakat 3) auf der Tafel (Pinwand). Die Umfrage zeigt, dass ein (großer) Teil des Kollegiums eigentlich erst einmal mehr über Schulentwicklung erfahren möchte. Viele finden Schulentwicklung als wichtig und nur für einem geringen Teil von Ihnen ist Schulentwicklung kein Thema. Persönliche Stellungnahme zu dem Umfrageergebnis Möglichkeit 1 Die Konferenzteilnehmer äußern sich zu den drei Aspekten. „Möchten Sie Ihre Stellungnahme auf der Pinwand begründen? Teilnehmer melden sich. Anmerkung: Die Diskussion beizeiten abrechen! Sie bekommen noch weiter Gelegenheit Ihre Gedanken zur Schulentwicklung einzubringen. Möglichkeit 2 Sie sollen nun Ihre bepunktete Aussage kurz und knapp auf einem Zettel begründen. Notieren Sie auf dem Zettel ein Hauptargumente, warum Sie die Frage „Schulentwicklung ist für mich ...“ so und nicht anders bewertet haben. Die Zettel werden verteilt und die Teilnehmer notieren sich die Antwort. Anschließend werden die Zettel eingesammelt, vom Moderator werden die Antworten vorgelesen und auf das Plakat 3 (vom Co-Moderator) geheftet. Eine anschließende Diskussion ist nicht vorgesehen. Seite 13 75927711 2.2.2 Fall 2 Anmerkung: Besonders geeignet auf der Konferenz mit Fachbetreuern Bevor wir Ihnen nun unseren Beitrag zur Schulentwicklung vorstellen, würden wir von Ihnen gerne Folgendes erfahren (Folie): „Was ist bisher in Sachen Schulentwicklung an Ihrer Schule gelaufen?“ und / oder „Was erhoffen Sie sich von einem Schulentwicklungsprozess an Ihrer Schule?“ Die Teilnehmer äußern sich. Seite 14 75927711 Begründen Sie kurz Ihre Einstellung zur Schulentwicklung! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Begründen Sie kurz Ihre Einstellung zur Schulentwicklung! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Begründen Sie kurz Ihre Einstellung zur Schulentwicklung! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Seite 15 75927711 „Was ist bisher in Sachen Schulentwicklung an Ihrer Schule gelaufen?“ und / oder Was erhoffen Sie sich von einem „ Schulentwicklungsprozess an Ihrer Schule?“ Alternative Fragestellung „Mit was sind Sie beim bisherigen Schulentwicklungsprozess unzufrieden?“ und / oder „Welche Hoffnungen verknüpfen Sie mit dieser Veranstaltung?“ Seite 16 75927711 2.3 Referat (45 min) Vorbereitung: - Folie 2: Unser Weg der Schulentwicklung - Folie 3a: Definition eines systemischen und systematischen Schulentwicklungspro zesses - Folie 3b/Fragebogen: Nennen Sie kurz und bündig einen Zustand an ... - Folie 4: Beteiligte Personen und Gruppen - Folie 5: Deckblatt Betreuungsvertrag - Folie 6: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses - Folie 7: Leitbild der Pestalozzi-Schule - Folie 8: Richtungsaspekte des KM’s - Folie 9: Was ist ein Schulprogramm? - Plakat 2: Unser Weg der Schulentwicklung - Protokollblatt - evtl. Vertragsmuster - evtl. Fragebogenmuster - evtl. Arbeitsblatt: Nennen Sie kurz und ... Bei Fachbetreuern: Protokollblatt austeilen! 2.3.1 Warum Schulentwicklung? 2.3.1.1 Schulentwicklung ist nichts Neues Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Tatsache ist, es gibt viele Probleme an den Schulen, Tatsache ist auch, dass sich zu allen Zeiten Lehrer und Schulbehörden bemüht haben, diese Probleme zu lösen und die Qualität der schulischen Bildung zu steigern. Insofern ist Schulentwicklung nicht etwas grundsätzlich Neues. Zur Schulentwicklung gehört das zufällige Pausengespräch über ein gemeinsames Unterrichtsproblem genau so wie das teamorientierte Gespräch im größeren Kollegenkreis. Auch die gezielt angesetzte kollegiumsinterne Fortbildungsveranstaltung zu einer bewusst gewählten Thematik und der formelle Informationsaustausch im Rahmen einer Konferenz gehört zu jener Art von Schulentwicklung, die wir Lehrkräfte schon immer gemacht haben. Da Schulentwicklung immer und zu jeder Zeit stattfindet, liegt oft der vordergründig der Gedanke nahe, doch lieber alles beim Alten zu lassen und fortzufahren wie bisher. Kritisiert werden muss aber bei den bisherigen Schulentwicklungsprozessen, dass Seite 17 75927711 oftmals kein geplantes und zielgerichtetes Vorgehen stattfindet. Es wird einmal dieses oder jenes ohne Konzept durchgeführt; das die Funktion des Kollegiums gesehen wird als auszuführendes Organ, das die Ideen und Pläne irgendwelcher Eliten an der Schule umzusetzen hat. die konsequente Umsetzung der getroffenen Maßnahmen nach anfänglichen Bemühungen oft wieder vernachlässigt wird; für eine gemeinsame Evaluation oft die Zeit, die Bereitschaft und die nötigen Instrumente fehlen; viele Aktionen mehr oder weniger gelungene Einzelaktionen engagierter Lehrkräfte oder Abteilungen an der Schule sind, die im Allgemeinen keine Verbindlichkeit für das Gesamtkollegium besitzen. Ich frage mich manchmal: „Woher kommt die Unzufriedenheit in vielen Kollegien?“ Eine Ursache findet sich im traditionellem Schulentwicklungsprozess. 2.3.1.2 Schulentwicklung muss neu definiert werden Die Schulentwicklungsoffensive des bayerischen Kultusministeriums muss somit nicht als „Bedrohung“ aufgefasst werden, sondern als eine Chance, die alten eingefahrenen Wege zu verlassen, um die Schulqualität nachhaltig zu steigern. Zitat: „Schulentwicklung muss ein gewollter Prozess der gesamten Schule mit klaren Zielvereinbarungen sein, der die unterschiedlichen Aktivitäten bündelt und Kontinuität in die gemeinsamen Unternehmungen bringt.“ Nach Auskunft des KM’s sind bereits etwa 1/3 aller bayerischen Schulen in einen solchen (systematischen) Schulentwicklungsprozess eingetreten (Vortrag von Ministerialrätin Regina Pötke bei der IHK Nbg. am 03.05.01). Die Bedingungen für einen solchen Prozess sind immer dann an einer Schule günstig, wenn der Schulleiter, der Personalrat, die Fachbetreuer und die Mehrheit des Kollegiums der Schulentwicklung positiv gegenüber stehen. Wichtig ist dabei die Bereitschaft, sich als lernende Organisation zu begreifen; das heißt, sich darüber im klaren zu sein, dass dieser Weg eine lange Strecke darstellt, auf der kontinuierlich an der Umsetzung einer offenen Zielsetzung gearbeitet werden muss. Seite 18 75927711 Dazu benötigen die Schulen einen größeren Freiraum. Dieser wird ihnen auch politisch zugestanden. Dazu ein Zitat von Kultusministerin Monika Hohlmeier (Eröffnung des Kongresses Schulinnovation 2000 am 11. April 2000): „Schulentwicklung erhält ihre Dynamik aus den Schulen selbst. Sie kann nicht vom Staat per Dekret angeordnet werden nach dem Motto: „So, jetzt entwickelt euch!“ Eigeninitiative an den Schulen ist gefragt.“ Es liegt jetzt also an den Lehrkräften, ob und wie Sie den angebotenen Freiraum bei der Schulentwicklung nutzen wollen. Stellen Sie nun Ihre Fragen an uns, denn „das Fragen ist“ nach Thomas von Aquin „die Frömmigkeit des Denkens“.) Bei Fachbetreuern: Diskussion nach den Aufzeichnungen auf dem Protokollblatt Seite 19 75927711 2.3.2 Unser Weg der Schulentwicklung 2.3.2.1 Der Versuch einer Definition Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, es gibt in der Literatur viele Wege, wie man Schulentwicklung betreiben kann. Egal nun, welchen Weg man bei der Schulentwicklung einschlägt, wichtig ist, dass man ein schlüssiges Konzept vorweisen kann – und ein solches fehlt den meisten Schulen.(Ich meine nach meinem Informationsstand auch Ihrer Schule.) Plakat 2 (evtl. Folie 2) lesen und Schlüsselworte anschließend erklären. Unser Weg von innerer Schulentwicklung ist ein systemischer und systematischer Schulentwicklungsprozess auf der Grundlage eines Organisationsentwicklungsprozesses. Unter innerer Schulentwicklung versteht man all das, was wir Lehrkräfte aus eigenem Antrieb heraus an der Schule verändern können, was also nicht uns durch Gesetze oder Verordnungen zwingend vorgegeben ist. Der Leitspruch bei der Organisationsentwicklung heißt: „Wer besseren Unterricht will, darf nicht nur Unterricht besser machen.“ D.h. guter Unterricht alleine macht noch keine gute Schule aus. Auch sein Umfeld muss bedacht werden. Die Organisationsentwicklung ist also mehr als Unterrichtsentwicklung. Das wesentlich Neue bei der vom KM anvisierten inneren Schulentwicklung, ist der systemische und systematische Schulentwicklungsprozess. Was ist darunter zu verstehen? Systemisch heißt, dass sich die Folgen eines Schulentwicklungsprozesses immer auf die ganze Institution Schule auswirken: auf die Schulleitung, auf alle Abteilungen, auf alle Schüler und Lehrkräfte, selbst auf diejenigen, die sich nicht selbst aktiv an diesem Prozess beteiligen. Folie 3a: Definition einer systemischen und systematischen Schulentwicklung Eine systemische und systematische Schulentwicklung kann allgemein definiert werden als ... Seite 20 75927711 a) Zuerst linke Spalte lesen. Die Komplexität dieses Satzes hat Sie jetzt möglicherweise erschlagen. Diese Definition erklärt aber in aller Kürze vieles, um was es bei der Schulentwicklung Kern geht. b) Dann nähere Erklärungen zur rechten Spalte geben (schrittweises Aufdecken). a) ein Prozess Ein systematischer Prozess verläuft wie auch der Unterricht mit unseren Schülern zielorientiert. Er ist gegliedert und verläuft planmäßig. Es ist ein längerfristiger Prozess, denn Qualität braucht Zeit zum Entstehen und braucht Zeit, um gepflegt zu werden. Es ist ein transparenter Prozess: Er ist durchschaubar, vor allem für die, die sich nicht daran aktiv beteiligen. (Deshalb sollen alle Protokolle, Ergebnisse und Planungen zum Prozess auf einer Pinwand und/oder durch Infoschreiben für alle veröffentlicht werden. Diese Transparenz fördert letztlich auch die Akzeptanz der Ergebnisse bei denen, die Abseits stehen und ermöglicht ihnen jederzeit einen Seiteneinstieg.) Läuft der Prozess nicht transparent, dann bedeutet dies oftmals den frühen Tod des Projektes. Er ist offen für Änderungsvorschläge der Beteiligten. Wenn sich z.B. plötzlich herausstellen sollte, dass ein anderer „Weg“ oder gar ein „Umweg“ gegangen werden muss, dann kann er gegangen werden. Im Prinzip ist ein guter Schulentwicklungsprozess wie ein guter Unterricht. Wenn man ein Konzept hat, kann man Umwege gehen und findet dann wieder leicht zum Hauptweg zurück. b) bei dem die Beteiligten D.h. nicht nur Lehrkräfte können sich an dem Schulentwicklungsprozess beteiligen, sondern auch Schüler und die Außenpartner der Schule. c) der lernenden Institution Schule Der Motor der Schulentwicklung kann immer nur die Einzelschule sein. Der Prozess läuft immer dann an den Schulen gut, wenn die Lehrkräfte sagen: „Ich muss Lernender sein.“ Eine solche Lernkultur haben aber bekanntlich nicht alle Lehrkräfte an einer Schule, denn Sie verlangt von jedem Einzelnen die Bereitschaft zum Zuhören und die Fähigkeit neue Ideen offen und vorurteilsfrei aufzugreifen. Seite 21 75927711 Ein Schulentwicklungsprozess ist kein Prozess der Moderatoren oder der Schulleitung oder der Steuergruppe, sondern ein Prozess der gesamten Schule. Wir, die externen Moderatoren, unterstützten nur diesen Prozess nach dem Motto: „Wir helfen dir dahinter zu kommen, wie du es gut machst.“ d) auf der Basis gemeinsam erarbeiteter Visionen „Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es kein Motiv, sich anzustrengen“, so Erich Fromm. Leitbilder sind z.B. solche Visionen. Sie stellen einen gemeinsam erarbeiteten und gemeinsam formulierten pädagogischen Minimalkonsens einer Schule dar auf der Grundlage der Vorstellungen jedes einzelnen Mitgliedes unter Beachtung des vorgegebenen Rahmens. Dabei ist zu beachten, dass der Begriff Leitbild an der Schule oftmals einen negativen Beigeschmack hat. Er kann, ersetzt werden durch andere Begriffe, wie Schulprofil, Leitsätze, Zielvereinbarungen u.ä. e) bestimmte Strukturen/Handlungsfelder ihrer Schule Gegenstand der Untersuchung sind Handlungsstrukturen, wie Unterricht und Erziehung, schulische Teamarbeit und Kommunikation, usw. Nichts ist heilig, alle Schulfaktoren / Problemfaktoren können auf den Prüfstand kommen. Alternative Dazu starten wir jetzt eine kleine Umfrage: Fragestellung auf der Folie 3b vorlesen. Beschränken Sie die Fragestellung auf Zustände, die hausintern sind, die folglich auch nur von der Schule selbst gelöst werden können. Fragezettel austeilen und nach Beantwortung der Frage wieder einsammeln. Der Moderator liest (einige Fragen) die Frage vor und heftet sie geclustert an die Pinwand. Evtl. werden Oberbegriffe gefunden zu den Antworten gefunden. Der Moderator fasst die Ergebnisse der Umfrage zusammen. f) diagnostizieren, reflektieren und ggf. verändern Die Strukturen der Schule, also die Handlungsfelder, sollen reflektiert und ggf. verändert werden. Seite 22 75927711 Dabei darf man darf nicht – wie so oft - bei der Analyse hängen bleiben. „Die Deutschen sind Weltmeister in der Analyse und Kreismeister in der Umsetzung.“ (Zitat von einem Vorsitzenden der Deutschen Bank) Stellt man Defizite an der Schule fest, dann soll nicht nur kritisiert werden, sondern auch ernsthaft der Versuch unternommen werden, diese zu ändern. Kritisieren ändert gar nichts an der Schule, nur das „Jammern“ wird über die Jahre kuliviert. g) um die Effektivität von Unterricht und Erziehung Die Veränderungen haben zum Ziel, die Effektivität, aber auch die Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit zu steigern. (Evtl. Versuch einer Definition: Qualität ist die Gesamtheit der Eigenschaften eines Objektes, die den Betrachter davon überzeugen, dass es herausragend ist.) h) und damit auch die Lebensqualität der Mitglieder in dieser Institution zu steigern. Auch die Berufzufriedenheit aller soll erhöht werden, weil hier ein Mangel bei vielen Lehrkräften festzustellen ist. i) nachweisbar zu steigern Die anvisierte Qualitätssteigerung soll quantitativ bzw. qualitativ nachweisbar sein. Ein Schulentwicklungsprozess, der sich nicht evaluieren lässt, ist kein Schulentwicklungsprozess. Schulentwicklung muss auch extern evaluierbar sein. Auch ein Neutraler muss feststellen können, dass es jetzt besser geht. Seite 23 75927711 2.3.2.2 Übersicht über organisatorische Strukturen Voraussetzung für die Durchführung eines systemischen und systematischen Schulentwicklungsprozesses ist die Schaffung organisatorischer Strukturen. Folie 4: Beteiligte Personen und Gruppen Installiert werden muss an der Schule, eine Steuergruppe, eine temporäre Projektgruppe und je nach Bedarf einer oder mehrere temporäre Qualitätszirkel. Die Projektgruppe ist eine Untergruppe des gesamten Kollegiums. Jeder, der freiwillig an einer Schulentwicklungskonferenz teilnimmt, ist momentanes Mitglied in der Projektgruppe „Schulentwicklung“. Die Größe und Zusammensetzung der Projektgruppe kann sich im Laufe des Prozesses durch Aus- und Einsteiger immer wieder ändern. (Eine Steuergruppe ist bereits an Ihrer Schule installiert.) Die Steuergruppe setzt sich aus den Mitgliedern der Projektgruppe zusammen. Sie ist als Leitung der Projektgruppe zu verstehen und soll die Zusammensetzung des Kollegiums repräsentieren. In ihr sollten alle Fachbereiche vertreten sein. Schulleiter und der Koordinator müssen Mitglied der Steuergruppe sein. Wünschenswert wäre es, wenn auch der Personalrat in der Steuergruppe vertreten wäre. (Da die Steuergruppe das Vertauen der Projektgruppe besitzen muss, soll sie gewählt werden. Gewählt werden können Mitglieder, die ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der Steuergruppe erklären oder von anderen Mitgliedern der Projektgruppe vorgeschlagen werden. In die Steuergruppe gewählt sind Kandidaten, die die absolute Mehrheit erhalten haben.) Zu den Aufgaben der Steuergruppe gehört u.a.: - Die Koordinierung des Projekts vor Ort. Hier laufen alle Fäden zusammen. - Die Kontakte zu den externen Begleitern. - Die Vorbereitung der Plenumssitzungen und - nach einiger Zeit die Übernahme der Moderation der Sitzungen. Der Begriff Qualitätszirkel kommt aus der Wirtschaft. Qualitätszirkel sind temporäre Arbeitsgruppen, die sich nach getaner Arbeit wieder auflösen. Sie sollte aus max. 8 Personen bestehen. Seite 24 75927711 2.3.2.3 Betreuungsvereinbarung und die Rolle des Moderators Für die Zusammenarbeit der Moderatoren mit den an der Schule installierten Gruppen bedarf es klarer Vereinbarungen. Die erste Aufgabe der Projektgruppe ist, der von den externen Beratern vorgeschlagenen Betreuungsvereinbarung zuzustimmen. Hier sind in 8 Abschnitten die Rechte und Pflichten zwischen der Projektgruppe „Schulentwicklung“ und den externen Beratern aufgeführt. Folie 5: Deckblatt Betreuungsvertrag, evtl. Vertragsmuster austeilen Von uns werden alle Änderungen akzeptiert, die nicht zum voraussehbaren Scheitern des Projektes führen. Dies wären nach unserer Meinung z.B. die folgenden Punkte: Die Aktivitäten sind vor allem in der unterrichtsfreien Zeit durchzuführen (3.1). Eine Schulentwicklung zwischen Tür und Angel zu betreiben geht nicht, man muss sich schon ganz einbringen. Der Schulleiter muss sich in das Projekt mit einbringen (3.10). Eine Schulentwicklung ohne Schulleiter geht nicht. Ein mehrheitliches Abstimmungsergebnis in der Gesamtkonferenz ist für alle Lehrkräfte bindend (5.3), sonst findet kein systemischer Prozess statt. (Abgesichert ist dieser Vertragspunkt durch Art. 58 EUG.) Auch Punkt 1 kann nicht gestrichen werden: „Der Berater hat das Ziel, das Kollegium schnellstmöglich von der Begleitung unabhängig zu machen und in die Lage zu versetzen, den Schulentwicklungsprozess selbst zu steuern.“ Das heißt, wir, die externe Berater, ziehen sich nach einiger Zeit zurück. Die Moderation im weitern Schulentwicklungsprozess übernimmt dann die Steuergruppe. Der Schulkoordinator, der Mitglied der Steuergruppe ist, könnte dann die weiterführenden Moderationsdienste übernehmen. Dazu bedarf es Moderationstechniken, die er sich an der ALP in Dillingen aneignen kann. Wir stehen aber weiterhin für Beratungsdienste zur Verfügung. Zu unserer Rolle als Berater und Moderator ist noch zu sagen: Seite 25 75927711 Wir geben keine Daten an Außenstehende weiter. Wir garantieren die Datensicherheit an der Schule. Wir sind uns bewusst „Schulentwickler können nicht alles, sie können aber viel kaputt machen.“ An diesen Leitspruch halten wir uns. Bei Fachbetreuern: Diskussion nach den Aufzeichnungen auf dem Protokollblatt Seite 26 75927711 2.3.3 Die Schritte des Schulentwicklungsprozesses Folie 6: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses in 10 Schritten Der von uns vorgeschlagene Schulentwicklungsprozess besteht aus 10 Schritten. Schon laufende Projekte und Bemühungen zur Steigerung der Schulqualität kollidieren nicht mit diesem Prozess. 2.3.3.1 Information des Schulleiters und des Kollegiums (Schritt 1) Schritt 1 und 2.3.3.2 Kollegiumsbeschluss (Schritt 2) Schritt 2 ist Ihre Schule bereits gegangen / müsste Ihre Schule noch gehen. 2.3.3.3 Informationsveranstaltung (Schritt 3) Eben befinden wir uns bei Schritt 3, der Informationsphase (der Fachbetreuer und der Steuerungsgruppe / des Kollegiums). 2.3.3.4 Betreuungsvereinbarung (Schritt 4) Der Schulleiter, die Steuergruppe oder die Projektgruppe hat nach Schritt 4 die Aufgabe mit uns den Betreuungsvertrag zu schließen. Es kommt zu keiner Vereinbarung, wenn den Kernpunkten des Vertrages nicht zugestimmt wird. 2.3.3.5 Bildung einer Steuergruppe (Schritt 5) Nach Schritt 4 folgt Schritt 5: Die Installation der Steuergruppe. (Dieser Schritt ist hier nicht mehr notwendig, weil bereits eine Steuergruppe besteht.) Seite 27 75927711 2.3.3.6 Entwicklung gemeinsamer Zielvorstellungen (Schritt 6) Unser Prozess verläuft – wie bereits gesagt - zielorientiert und baut auf einem Leitbild auf. Evtl. Zusatz Grundsätzlich bieten sich zwei Wege zur Zielfindung an: 1. Über eine Fragebogenaktion wird der IST-Zustand einzelner Handlungsfelder an der Schule, wie z.B. Unterricht und Erziehung oder Regeln und Normen, erfasst. Die negativen Bewertungen aus der Umfrage werden in positive Ziele umformuliert, die dann zum Schulprogramm erhoben werden. 2. Das Schulprogramm leitet sich aus einer Vision, also von einem Traum des Kollegiums „über ihre gute Schule“ ab. Beide Wege können verfolgt werden. Nachteilig für den ersten Weg, dem unmittelbaren Befragungsweg, erscheint uns: Probleme im Zusammenhang mit der Erstellung und Auswertung von Fragebögen. In der Erstellung oder der Übernahme vorgefertigter der Fragebögen stecken bereits Ziele, an deren Aufstellung das Kollegium nicht beteiligt ist. (Wir lehnen auch einen umfangreichen Fragebogen zu einer Rundum- Organisationsdiagnose ab. Dieser schreckt oftmals viele der Befragten ab (Evtl. umfangreiches Fragebogenmuster zeigen.). Wenn dann die Rücklaufquote überhaupt aussagekräftig ist, so bringt die Diagnose so viele Daten mit, dass sich die mit der Aus- und Bewertung vertrauten Lehrkräfte in aller Regel überfordert fühlen. Ich frage Sie: Wer von denen, die auswerten ist schon spezialisiert auf die empirische Pädagogik? Wer von den Auswertern kann Daten professionell aufarbeiten? Wer liest sich schon die umfangreiche Problematik ein? Was ist, wenn man bei der Rundum-Umfrage auf vielleicht 12 Probleme stößt? Die in der Literatur zu Prozessbeginn empfohlenen Stärken- und Schwächenanalysen ergeben nicht selten ein entmutigendes Bild, das auf den Nenner gebracht - „Erst müssen mal bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann sind auch wir Lehrkräfte bereit ...“ - schon das Ende eines Schulentwicklungsprozesses herbeiführen kann.) Seite 28 75927711 Hinter den vorgefundenen negativen Ergebnissen steckt oft ein erhebliches Konfliktpotential, weil manche Umfrageergebnisse von Einzelnen in Frage gestellt werden. Nach der Auswertung der Umfrageergebnisse wissen viele Schulen nicht, wie es weitergehen soll. Deshalb baut unser Konzept auf den zweiten Weg, dem Leitbild auf. Dies ist Schritt 6 im Schulentwicklungsprozess. Ein Schulleitbild kann dabei definiert werden als die schriftlich fixierte Vision von einer „qualitativ guten Schule“. Ein Leitbild darf, wenn es vom Kollegium angenommen und umgesetzt werden soll, keinesfalls von der Schulleitung vorgegeben werden. Das Leitbild, die Schul-Charta, erstellt die Projektgruppe – also alle diejenigen, die sich freiwillig melden - während einer Wochenendveranstaltung an der Schule selbst oder noch besser an einem außerschulischen Ort. Dabei bleibt es der Projektgruppe freigestellt, ob sie Eltern, Schüler, Betriebe oder den Berufsschulbeirat bei diesem Prozess beteiligen möchte. Wir, die externen Berater, führen die Teilnehmer durch die Veranstaltung und moderieren den Prozess. (Wir verlangen vom Kollegium, dass es sachlich miteinander zu kommunizieren kann. Es muss keine Fähigkeit zur Teamarbeit vorweisen, aber die Bereitschaft zu dieser muss vorhanden sein. Kurzum: Man muss sich nicht lieben, aber man muss professionell zusammenarbeiten können. Um die Kommunikation und die Teamarbeit auf eine solide Basis zu stellen, können zu Beginn der Veranstaltung gemeinsame Normen für die Gruppenarbeit getroffen werden.) In einem mehrstufigen Arbeitsprozess erstellt die Projektgruppe das Leitbild der Schule. Dabei nehmen wir Moderatoren keinen Einfluss auf die vom Kollegium als wichtig erachteten Leitbildziele. Wir weisen das Kollegium bei Bedarf aber darauf hin, dass ein Leitbild nicht gegen die gesetzlichen Bestimmungen (EUG, BSO, LDO etc.) verstoßen darf und dass die unumstößlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden sollen. Nur dann besteht eine reelle Chance zur Umsetzung der Leitbildziele. Folie 7: Leitbild der Pestalozzi-Schule (evtl. Hinweis auf Aufsatz Dr. Emminger) Seite 29 75927711 Dieses Leitbild zeigt die Vision der Pestalozzi-Schule (Teile davon vorlesen). Es hat einen Gültigkeitsdauer von vielleicht 5-6 Jahren. Danach haben sich gewöhnlich die Rahmenbedingungen an der Schule soweit verändert, dass in aller Regel ein neues Leitbild aufgestellt werden muss. (Wenn die Schule es will, können Fachbereiche auch eigene Leitbilder erstellen. Aber: Man sollte die Schule schon besser als Ganzes sehen. Eine partielle Schulentwicklung sollte es nicht geben.) Seite 30 75927711 2.3.3.7 Prioritätensetzung: Schulprogramm (Schritt 7) Folie 6: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Es gilt nun aus dem gemeinsam erarbeiteten Leitbild ein Schulprogramm, Schritt 7, abzuleiten. Dazu wird in der Projektgruppe mehrheitlich entschieden, welches Ziel als erstes in die Praxis umgesetzt werden soll. Möglichst sollte auch nur an der Umsetzung eines Zieles gearbeitet werden. Schon Konfuzius sagte: „Wer zwei Hasen fangen will, fängt keinen.“ Die Entscheidung ob dann evtl. doch mehr als ein Ziel umgesetzt werden soll, trifft die Projektgruppe. Jedes Schuljahr wird dann ein anderes Leitbildziel zum Programm erhoben (s. auch Beispiel Wasserburg). 2.3.3.8 Projektmanagement (Schritt 8) Anschließend erstellt die Projektgruppe auf dieser zentralen Veranstaltung in mehrere Qualitätszirkel ein konkretes Handlungskonzept zur Umsetzung des ausgewählten Leitbildzieles. Dabei bedienen sich die Gruppen der Methode des Projektmanagements, Schritt 8. (Beim Projektmanagement wird eine komplexe Aufgabenstellung in besser planbare Einzelaufgaben gegliedert.) Folgende Schritte gehören zum Projektmanagement: 1. Der QZ erfasst durch Befragung, wie das ausgewählte Leitziel vom Kollegium derzeit eingeschätzt wird (IST-Zustand). Ebenso wichtig ist es, das Kollegium nach dem gewünschten SOLL-Zustand und nach möglichen Umsetzungskonzepten zu befragen. Mit einer solchen Umfrage bekommt der QZ wichtige Daten für seine weitere Arbeit. 2. In einem mehrschrittigen Verfahren erarbeitet er ein konkretes Konzept zur schulinternen Umsetzung des Leitzieles. Die Teilschritte sind u.a.: - Die Festlegung operationalisierbarer Arbeitsziele (Feinziele) - Das Sammeln positiver Folgen für die Schule - Das Sammeln möglichst vieler Umsetzungsmöglichkeiten über kreative Moderationsme thoden. - Die Festlegung auf ein Umsetzungskonzept. Dieses enthält Antworten auf die Fragen „wie?“, „wo?“ und „wann?“ läuft das Programm ab. Welche Kosten entstehen, welche Referenten laden wir ein? usw. Seite 31 75927711 Nun wird ein neuer Qualitätszirkel gebildet, der sich aus Mitgliedern der einzelnen Arbeitsgruppen zusammensetzt. Er fasst in den nächsten Wochen die Gruppenergebnisse zu einem feingliedrigen Schulprogramm zusammen. (Alternative: Fachgruppen erstellen zusätzlich ein Umsetzungskonzept bezogen auf ihre Fachgruppe). 2.3.3.9 Beschlussfassung der Lehrerkonferenz und Umsetzung (Schritt 9) Nun folgt Schritt 9: Beschlussfassung der Lehrerkonferenz und Umsetzung Das vom Qualitätszirkel erstellte Umsetzungskonzept des Schulprogramms wird nun an alle Lehrkräfte der Schule verteilt. Sie haben jetzt die Möglichkeit schriftlich innerhalb von 14 Tagen Änderungs- und Verbesserungsvorschläge vorzubringen, die dann der Qualitätszirkel nach wohlwollender Prüfung noch mit in sein Konzept aufnehmen kann. In einer Gesamtkonferenz stellt der Qualitätszirkel nochmals kurz sein erarbeitetes bzw. überarbeitetes Konzept vor. Insbesondere stellt er dabei überzeugend die Vorteile für jeden Einzelnen und für die Schule heraus. Dann wird über die Annahme oder Ablehnung des Umsetzungsprogramms ohne Aussprache abgestimmt. Ohne Aussprache deshalb, weil die Diskussion - wo sich jeder hätte einbringen können - um den besten Weg schon vorher stattgefunden hat. (Nach Dr. Emminger ist es bisher noch nicht vorgekommen, dass ein Leitbild vom Gesamtkollegium abgelehnt wurde. Falls dieser Fall doch einmal eintreten sollte, muss der Prozess nochmals durchgeführt werden.) Eine Anmerkungen, die von erfahrenen Schulentwicklern stammt, erscheint mir an dieser Stelle wichtig: „Qualität steckt an!“ Auch der eine oder andere anfängliche Kritiker und Verweigerer wird dann doch noch zum aktiven Gestalter bei der Schulentwicklung. Sollte es den Schulen nicht gelingen, einen Schulentwicklungsprozess auf freiwilliger Basis durchzuführen, dann könnte die Gefahr bestehen, dass dieser dann vom KM bzw. von den Regierungen angeordnet wird. Seite 32 75927711 Die Rahmenbedingungen für einen Schulentwicklungsprozess liegen bereits vor. Den Schulen werden folgende Richtungsaspekte vorgegeben: Folie 8: Richtungsaspekte des KM’s Sie müssen eine Steuergruppe installieren. Sie haben Zielvereinbarungen zu treffen. Sie müssen eine Stärken- und Schwächenanalyse durchführen. Sie haben den Prozess zu evaluieren. 2.3.3.10 Interne und externe Evaluation (Schritt 10) Folie 6: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Nun kommen wir zu Schritt 10. Ein Schulprogramm macht keinen Sinn, wenn es nicht evaluiert, also überprüft wird. Dabei kann man sich nicht von subjektiven Eindrücken leiten lassen. Sowohl für die Beteiligten, aber auch für Außenstehende muss quantitativ nachweisbar sein, welche Folgen die Umsetzung des Konzeptes hat. Dazu bietet sich an, das zum Beispiel im Schritt „Erfassung des IST-Zustandes“ verwendete Befragungsinstrument nach einem bestimmten Zeitraum erneut - evtl. sogar unverändert - einzusetzen. Der Vergleich der Ergebnisse des zweiten Durchlaufs mit denen der Erstbefragung am Beginn des Projektmanagements kann Veränderungen aufdecken und Entscheidungen bezüglich der Fortführung des Gesamtprojekts positiv beeinflussen. Wenn bei der Evaluation nachweisbar etwas Schlechtes herauskommt, muss man einen neuen Weg suchen. Schulentwicklung muss auch extern evaluierbar sein. Auch Neutrale bzw. Außenstehende müssen später feststellen können, dass es jetzt besser geht. Die externe Evaluation der Schule kann zum Beispiel erfolgen durch ... die Regierung. Sie führt z.B. eine Metaevaluation durch, um zu erfahren, ob die Schule ein System hat. Kollegen anderer Schulen andere Qualitätszirkel Elternvertreter Seite 33 75927711 Betriebe Schüler Mit wem und wie das Verfahren letztlich durchgeführt wird bleibt der Entscheidung der Projektgruppe überlassen. 2.3.3.11 Neue Prioritätensetzung Nun wird - ein Schuljahr ist seit Beginn des SE-Prozesses vergangen - ein neues Schulprogramm für den folgenden Zeitraum vereinbart. Ein neues Thema motiviert nun vielleicht auch andere Kollegen, in den neuen Umsetzungsprozess mit einzusteigen. Das Projektmanagement beginnt von vorne. Das Gesamtkonzept ist dabei so angelegt, dass man zuerst ein Problem löst bevor man das nächste in Angriff nimmt. Die Steuergruppe sollte nach einem Jahr in der Lage sein, den Schulentwicklungsprozess selbst zu steuern und zu moderieren. Die Qualität der Schule zeigt sich, wenn sich die externen Betreuer, also wir, möglichst schnell überflüssig machen. Ich sagte bereits: Qualität lässt sich nicht konservieren, sie muss immer wieder neu definiert werden. Deshalb wird nach 5-6 Jahren, wenn sich die Rahmenbedingungen an der Schule geändert haben, ein neues Leitbild erstellt. Schulentwicklung hört somit niemals auf. Folie 9: Was ist ein Schulprogramm Durch die Umsetzung der zeitlich gestaffelten Schulprogramme entwickelt sich langsam ein individuelles Schulprofil an der Schule heraus. Das Schulprofil ist das, was die Schulmitglieder und Außenstehende als das „Eigentliche“ der Schule wahrnehmen. Dies ist z.B. das Schulklima oder die Schulkultur. Evtl. an dieser Stelle bereits die Zusammenfassung (nächster Gliederungspunkt) Bei Fachbetreuern: Diskussion nach den Aufzeichnungen auf dem Protokollblatt Seite 34 75927711 Unser Weg von innerer Schulentwicklung ist ein systemischer und systematischer Schulentwicklungsprozess auf der Grundlage eines Organisationsentwicklungsprozesses. Folie 2 Seite 35 75927711 Systemische u. systematische Schulentwicklung kann definiert werden als ein Prozess zielorientiert längerfristig transparent geplant und offen zugleich möglichst viele/alle Schüler/innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter, Außenpartner etc. Einzelschule als Motor der Schulentwicklung bei dem die Beteiligten der lernenden Institution Schule auf der Basis gemeinsam Schulprofil, Leitbild, Leitsätze, pädagogischer Minimalkonsens etc. und Schulprogramm erarbeiteter Visionen bestimmte Strukturen/ Unterricht, Erziehung, Normen, Beratung, Beurteilung, Schulleben, Arbeitsklima, Kollegium, Leitung, Außenbeziehungen etc. Handlungsfelder ihrer Schule diagnostizieren, reflektieren und ggf. verändern, um die Effektivität von Unterricht und Erziehung und damit auch die Lebensqualität der Mitglieder (in) dieser Umfragen, Erhebungen, gemeinsame Auswertung, Projektmanagement, Arbeitskreise, Qualitätszirkel Wirksamkeit, Prozessqualität, Ergebnisqualität Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, Freude am Beruf, Motivation, Commitment Corporate Identity etc. Institution nachweisbar steigern. interne und externe Evaluation Folie 3 Seite 36 75927711 Schulentwicklungsprozesse Beteiligte Personen und Gruppen gesamte Kollegium Projektgruppe „Schulentwicklung Qualitätszirkel Qualitätszirkel Steuergruppe QZ SLtg. Folie 4 Seite 37 75927711 Vereinbarung zwischen dem Kollegium der Staatlichen Berufsschule .... und Reiner Helm, Staatliche Berufsschule Lauf Paul Weeger Staatliche Berufsschule I Ansbach über die Begleitung im Projekt „Schulqualität durch Schulentwicklung“ 1. Zweck Herr Helm und Herr Weeger unterstützen als beratende Begleiter das Kollegium der o.g. Schule im Projekt „Schulqualität durch Schulentwicklung“. Ziel des Projekts ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Schulqualität. Schwerpunkte der Beratung sind: Einführung des Gesamtkollegiums in den Schulentwicklungsprozess, Begleitung und Betreuung der Projektgruppe „Schulqualität durch Schulentwicklung“, Beratung der Steuergruppe und Anleitung zur Arbeit in Kleingruppen (Qualitätszirkel). Die Berater haben das Ziel, das Kollegium schnellstmöglich von der Begleitung unabhängig zu machen und in die Lage zu versetzen, den Schulentwicklungsprozess selbst zu steuern. Folie 5 Seite 38 75927711 Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Schritte Wer? Wo? 1. Information des Kollegiums: Da gibt es ... 2. Kollegiumsbeschluss Wir wollen mehr Informationen ... 3. Informationsveranstaltung SL, LK... Schule Kollegium Schule Kollegium Ext. Begl. Ext. Begl. Projektgr. Kollegium Ext. Begl. Projektgr./ Reakt.gr. Ext. Begl. Projektgr. Schule 4. Betreuungsvereinbarung 5. Bildung einer Steuergruppe 6. Zielerklärung: SOLL-Zustand Leitbild 7. Prioritätensetzung Schulprogramm 8. Projektmanagement: Diagnose im/in den Handlungsfeld/ern des Schulprogramms Zielaufstellung Möglichkeiten Konzept als Antrag an die 9. Beschlussfassung/Umsetzung 10. Evaluation: intern u. extern Zeit 1. Sitzung 2 Std. Schule Schule nicht an der Schule Schule 2. Sitzg. Pädagog. Wochenende 3. Sitzg. Schule Qualitätszirkel (evtl. ext. Begl. LKonferen z Kollegium Schule QZ Schule e 7. neue Prioritätensetzung: Schulprogramm alle 5 - 6 Jahre: 6. Leitbild-Evaluation Projektgr. Schule Projektgr. s.o. s.o. Folie 6 Seite 39 75927711 Leitbild der Pestalozzi-Schule in X Die folgenden Visionen stellen das vom gesamten Kollegium entwickelte Leitbild der Pestalozzi-Schule in X dar. Es bildest für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Schulleitung und weitere Mitarbeiter/innen einen verpflichtenden Orientierungsrahmen der kommenden Jahre, aus dem gemeinsam die Zielpunkte des jährlichen Schulprogramms abgeleitet werden. 1. Im Zentrum unserer Erziehungsarbeit stehen die folgenden Schlüsselwerte, die an die Schüler/innen zu vermitteln sind: Rücksicht auf andere, vor allem Schwächere Toleranz gegenüber Andersdenkenden Zuverlässigkeit beim einhalten von Vereinbarungen Positive Nutzung des Energiepotentials der Schüler/innen 2. Wir wollen Unterricht ohne vermeidbare Störungen. 3. Wir organisieren Unterricht am optimalen Lernort. 4. Wir Lehrkräfte sind temporäre Lebensbegleiter/innen der Schüler/innen: Schüleranliegen treffen immer auf offene Lehrerohren, 5. Die Verhaltens- und Umgangsregeln an der Schule sowie die Formen ihrer Überwachung und Sanktionierung bei Nichtbeachtung werden von Schüler/inne/n und Lehrkräften gemeinsam erarbeitet. 6. Wir Lehrkräfte sind immer auch Lernende: Schulinterne Fortbildung zu aktuellen Themen und gegenseitige Unterrichtshospitation erachten wir als unverzichtbar; beides wird organisatorisch ermöglicht. 7. Wir pflegen in der Schule eine Streitkultur mit dem Ziel kooperativer Regelung aller Konflikte. 8. Unsere Schule und das Schulgelände sind rauchfreie Zone. 9. Der Schule zur Verfügung stehende zusätzliche Gelder werden in den jährlich zu beschließenden Schwerpunkt (Schulprogramm) investiert. 10. Ohne den Partner „Eltern“ geht nichts. Wir halten intensiven Kontakt, gekennzeichnet von Geben und Fordern. Folie 7 Seite 40 75927711 Schulentwicklung braucht nach Vorgabe des Kultusministeriums die folgenden Richtungsaspekte Beginn Steuer-/ Lenkungsgruppe Zielvereinbarungen Prozess Stärken- und Schwächenanalyse Ergebniss Evaluation Folie 8 Seite 41 75927711 Was ist ein Schulprogramm? Beispiel 10. Begrifflich- Gültigkeit Ziele keiten Ohne den Partner Leitbild ca. 5 - 7 gemeinsame Erarbei- „Eltern“ geht nichts. Leitlinien/ Jahre tung eines päd. Mini- wir halten intensiven Leitsätze/ malkonsenses im zeichnet von Geben Päd. Grund- Kollegium und Fordern. sätze/ ... Kontakt, gekenn- daraus wird abgeleitet Intensivierung der Schul- Elternarbeit programm Jahre ca. 1 - 2 Prioritätensetzung: gemeinsame Ableitung Konkretisierung Umsetzung eines Leitsatzes durch seine Umsetzung entwickelt sich im Laufe der Zeit das Schulprofil unbegrenzt, Schulklima/ jedoch nur die nach innen und außen erkennbare Schulethos/ solange, wie Individualität der Ein- Schulkultur/ es gepflegt zelschule (im ... wird Rahmen der Vorgaben des „Veranstalters“) Folie 9 Seite 42 75927711 Protokollblatt Teil 1: Warum Schulentwicklung/ Der Schulentwicklungsprozess Notizen: Welche Fragen haben Sie? Teil 2: Unser Weg der Schulentwicklung Notizen: Welche Fragen haben Sie? Teil 3: Mögliche Schritte eines Schulentwicklungsprozesses Notizen: Welche Fragen haben Sie? Seite 43 75927711 Nennen Sie kurz und bündig einen Zustand an Ihrer Schule mit dem Sie unzufrieden sind und / oder der verbesserungswürdig ist und / oder der bei Ihnen einen Leidensdruck erzeugt! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Nennen Sie kurz und bündig einen Zustand an Ihrer Schule mit dem Sie unzufrieden sind und / oder der verbesserungswürdig ist und / oder der bei Ihnen einen Leidensdruck erzeugt! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Nennen Sie kurz und bündig einen Zustand an Ihrer Schule mit dem Sie unzufrieden sind und / oder der verbesserungswürdig ist und / oder der bei Ihnen einen Leidensdruck erzeugt! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Seite 44 75927711 Vereinbarung zwischen dem Kollegium der Staatlichen Berufsschule III Ottostr. 22 90762 Fürth und Reiner Helm, Staatliche Berufsschule Lauf Paul Weeger Staatliche Berufsschule I Ansbach über die Begleitung im Projekt „Schulqualität durch Schulentwicklung“ 1. Zweck Herr Helm und Herr Weeger unterstützen als beratende Begleiter das Kollegium der o.g. Schule im Projekt „Schulqualität durch Schulentwicklung“. Ziel des Projekts ist die Sicherung und Weiterentwicklung der Schulqualität. Schwerpunkte der Beratung sind: Einführung des Gesamtkollegiums in den Schulentwicklungsprozess, Begleitung und Betreuung der Projektgruppe „Schulqualität durch Schulentwicklung“, Beratung der Steuergruppe und Anleitung zur Arbeit in Kleingruppen (Qualitätszirkel). Die Berater haben das Ziel, das Kollegium schnellstmöglich von der Begleitung unabhängig zu machen und in die Lage zu versetzen, den Schulentwicklungsprozess selbst zu steuern. Seite 45 75927711 2. Leistungen der Berater (1) Sie stellen der Projektgruppe und der Steuergruppe ihr Fachwissen und ihre mit bisherigen Schulentwicklungsprozessen gemachten Praxiserfahrungen zur Verfügung. (2) Sie moderieren den während der Anfangsphase des Projekts auf Wunsch Sitzungen der verschiedenen Gruppen. (3) Sie leiten die Steuergruppe dazu an, schnellstmöglich die Moderation der eigenen Arbeit und der Sitzungen der Projektgruppe zu übernehmen. (4) Sie weisen die Qualitätszirkel in ihre Arbeit ein. (5) Sie geben den Gruppen Rückmeldung zu Prozesswahrnehmungen, macht sie auf Schwierigkeiten und Störungen aufmerksam und zeigen ggf. Lösungen auf. (6) Sie machen aus eigener Initiative Vorschläge zum Prozessverlauf. (7) Sie sind offen gegenüber Vorschlägen und Änderungen der Vereinbarung im Laufe des Projektes. (8) Sie stellen sich vor Beginn des eigentlichen Prozesses zu einem Gespräch mit den Kolleg/innen/en zur Verfügung, die weder in der Projekt-, noch in der Steuergruppe noch in den Qualitätszirkeln mitarbeiten. 3. Leistungen der Projektgruppe (1) Sie ist bereit, das Projekt „Schulqualität durch Schulentwicklung“ mit externer Begleitung auch und vor allem in der unterrichtsfreien Zeit durchzuführen. (2) Sie erklärt sich bereit, die vereinbarten Sitzungen zu besuchen und sich daran aktiv am Geschehen zu beteiligen. (3) Sie formuliert ihre Ansprüche gegenüber den Beratern und hält diese über alle für das Projekt relevanten Vorgänge auf dem laufenden. (4) Sie ist bereit, zunehmend die Selbststeuerung des Prozesses zu übernehmen und somit den externen Begleiter „überflüssig“ zu machen. (5) Sie übernimmt die Protokollierung der Sitzungen. (6) Sie beteiligt sich gemeinschaftlich und kooperativ an den Lösungen evtl. auftretender Probleme. (7) Sie öffnet sich für alle am Projekt interessierten Lehrkräfte des Kollegiums, die erst später in den Prozess einsteigen. (8) Sie beschließt über die Zusammensetzung der Steuergruppe. (9) Sie bildet, wenn im Verlauf des Projekts nötig, Qualitätszirkel. (10) Die Schulleitung ist in der Projektgruppe vertreten. 4. Leistungen der Steuergruppe (1) (2) (3) (4) Für sie gelten die Leistungen der Projektgruppe. Darüber hinaus hält sie engen Kontakt zum externen Berater. Sie übernimmt im Laufe des Projekts zunehmend die Leitung des Projekts. Sie pflegt die für das Projekt an geeigneter Stelle angebrachte Informationstafel, d.h. sie sorgt für Transparenz des Prozesses durch Aushang der Sitzungsprotokolle und der geplanten Sitzungszeiten und -themen. Seite 46 75927711 5. Leistungen der Qualitätszirkel (1) Für sie gelten die Leistungen der Projektgruppe. (2) Sie regeln die Arbeitsweise ihrer Sitzungen selbstverantwortlich. (3) Sie bringen alle Vorschläge zur Weiterentwicklung der Schulqualität in der Gesamtkonferenz ein, deren Entscheidung für das gesamte Kollegium bindend sind. 6. Dauer des Projektes Die Vereinbarung dauert bis zum Ende des Schuljahres 2001/2002. Sie kann von beiden Seiten nach Aussprache mit dem Vereinbarungspartner jederzeit geändert oder gekündigt werden. 7. Kosten Die Berater stellen die Fahrt-, Honorar- und Materialkosten in Rechnung. Diese Kosten werden von der Schule übernommen. 8. Sonstiges (1) Änderungen von Teilen der Vereinbarung sind nach Aussprache und in gegenseitigem Einverständnis jederzeit möglich. (2) Sämtliche im Projekt verwendeten Informationen werden vertraulich behandelt. (3) Die in Art 57 (EUG) aufgeführten Pflichten und Rechte der Schulleitung sind vom Schulentwicklungsprozess nicht berührt. (4) Neu an die Schule versetzten Lehrkräfte wird ein „Seiteneinstieg“ in den Prozess ermöglicht. (5) Die für die Schule zuständige Aufsichtsbehörde begleitet den Schulentwicklungsprozess, wird über den Fortgang des Prozesses kontinuierlich informiert und erhält eine Ausführung dieser Vereinbarung. Unterschriften Ort und Datum Ort und Datum Vertreter der Steuergruppe Reiner Helm, StD Paul Weeger, StD Seite 47 75927711 2.4 Zusammenfassung / Diskussion (20 min) Vorbereitung: - Folie 1: Tagungsprogramm - Folie 10: Missverständlicher Text - Plakat 5 - Flipchart: Schulentwicklung evtl. Zusatz Folie 10: Missverständlicher Text Beurteilen Sie nun einmal das folgende Gespräch: „Ich habe gestern für meinen Mann ein wunderbares Feuerzeug bekommen!“ Antwort: „Da haben Sie aber einen guten Tausch gemacht.“ Reaktion abwarten! Wir hoffen, dass wir mit unserem Beitrag zur Schulentwicklung Missverständnisse ausräumen konnten und wir Ihnen unser Konzept von Schulentwicklung verständlich dargestellt haben. Zusammenfassung Folie 1: Tagungsprogramm Ich habe Ihnen .... Dieses Schulentwicklungskonzept hat den Vorteil, dass sich der organisatorische Überbau bezogen auf die gewaltige Aufgabenstellung in Grenzen hält; der zeitliche Aufwand bezogen auf die Vorteile, die sich ergeben, in Grenzen hält; sehr schnell konkrete Ergebnisse vorliegen; alle Handlungen von den Lehrkräften selbst bestimmt werden; man miteinander spricht und Ziele gemeinsam festgelegt werden; alles „Handeln“ demokratisch legitimiert ist. die Schule durch die externen Moderatoren Unterstützung erhält; Seite 48 75927711 alle Aktivitäten in ein Gesamtkonzept eingebunden werden. Dieses deckt sich mit den Vorgaben des KM’s. Von der Ministerialrätin Regina Pötke vom KM stammt folgende Aussage: Plakat 4 zeigen und an die Pinwand hängen. „Ich kann jene nicht verstehen, die sich vor neuen Ideen fürchten. Es sind die alten Ideen, die mir Angst machen.“ (hier bezogen auf einen systemischen und systematischen Schulentwicklungsprozess) Sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, an was denken Sie, wenn Ihnen jetzt das Wort „Schulentwicklung an Ihrer Schule“ in den Sinn kommt? Flipchart S C H U L E N T W ... chwachsinn hance ... Seite 49 Der Moderator deckt das vorbereitete Flipchartpapier auf und notiert die spontan gegebenen Zurufantworten zu den vorgegebenen Anfangsbuchstaben. 75927711 „Ich habe gestern für meinen Mann ein wunderbares Feuerzeug bekommen!“ Antwort: „Da haben Sie aber einen guten Tausch gemacht.“ Folie 10 Seite 50 75927711 2.5 Reflexion / Abstimmung (15 min) Anmerkung: Entfällt, wenn Zwischenschleife (Punkt 3) erforderlich ist Vorbereitung: (1) Plakat 5: Träume (2) Folie: Welche Chancen ... (5) Plakat 6/7: Abstimmung 2.5.1 Reflexion (wenn Zeit) Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor Sie abstimmen, sollen Sie die Gelegenheit nutzen, für ca. 10 min im kleinen Kreis über die Vor- und Nachteile des vorgestellte Schulentwicklungskonzeptes zu sprechen. Bilden Sie an Ihren Plätzen Diskussionsinseln und besprechen Sie die folgenden zwei Fragen: Welche Chancen bietet ein Schulentwicklungsprozess an unserer Schule? Welche Risiken sind damit verbunden? Nach der Gruppenarbeit kann folgende Frage ans Plenum gestellt werden: „Besteht bei jemanden der dringende Wunsch, zu der Fragestellung etwas zu sagen?“ Teilnehmer melden sich ggf. Jeder Einzelne von Ihnen muss nun zu einem Urteil kommen. Er muss entscheiden, ob die Risiken dominieren oder Chancen eines solchen Prozesses überwiegen. Meine Empfehlung an Sie: (Plakat 6): “Geben Sie Ihren Träumen eine Chance“ Seite 51 75927711 Welche Chancen bietet ein Schulentwicklungsprozess an unserer Schule? Welche Risiken sind damit verbunden? Folie Seite 52 75927711 2.5.2 Abstimmung (bei Gesamtkonferenz) Anmerkung: Entfällt, wenn Zwischenschleife (Punkt 3) erforderlich ist Vorbereitung: - Plakat 6/7: Abstimmung - Stimmzettel Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie nun ab, ob Sie sich einen Schulentwicklungsprozess an Ihrer Schule mit uns als externe Begleiter vorstellen können. Wir moderieren den Prozess, wenn sich die Mehrheit (50% und mehr) dafür entscheidet. Dabei muss Ihnen klar sein, dass Sie möglicher Weise etwas in Gang setzten, das zu erheblichen Konflikten an der Schule führen kann, aber auch große Chancen bietet, etwas an der Schule zu verändern. (Das Abstimmungsverfahren wird mit dem Schulleiter oder mit den Teilnehmern der Konferenz im Vorfeld geklärt.) Die Teilnehmer füllen den Stimmzettel aus. Alternative: offene Abstimmung Die Stimmzettel werden ausgewertet und das Ergebnis wird auf dem Plakat festgehalten. Plakat 7 Ich stimme ... einen Schulentwicklungsprozess an unserer Schule. für _________________ gegen: ______________ Seite 53 75927711 Alternative Die Teilnehmer schreiben Ihren Namen auf die vorbereitete Pinwand. Alle diejenigen, die sich für einen Schulentwicklungsprozess an der Schule aussprechen gehören der momentanen Projektgruppe an. Das Plakat 8 wird an die Infowand geheftet. Zu- und Abgänge werden darauf namentlich vermerkt. Ich bin für einen Schulentwicklungsprozess! Mitglieder Abgänge Zugänge Meier Müller ... Seite 54 75927711 Stimmzettel Ich stimme ...... einen Schulentwicklungsprozess an unserer Schule. O O für gegen Stimmzettel Ich stimme ...... einen Schulentwicklungsprozess an unserer Schule. O O Seite 55 für gegen 75927711 2.6 Wahl der Steuergruppe (20 min), evtl. bei Gesamtkonferenz Anmerkung: Entfällt, wenn Zwischenschleife (Punkt 3) erforderlich ist Auf Wunsch verlässt bei der Abstimmung der Moderator für ca. 20 Minuten das Konferenzzimmer. Die Wahl der Steuergruppe wird durchgeführt. Die Diskette mit dem Betreuungsvertrag wird – falls noch nicht geschehen - der Steuergruppe ausgehändigt. Der Vertrag wird ggf. abgeändert dem externen Berater zugesandt. Anmerkung Die Installation der Steuergruppe kann auch in einer weiteren Sitzung erfolgen. Geht man diesen Weg, dann werden bei dieser Veranstaltung ggf. auch die Arbeitsvereinbarungen getroffen. 2.7 Schluss der Veranstaltung (10 min) Folie 6: Hinweis auf den nächsten Schritt (Betreuungsvereinbarung, Erarbeitung der Zielvereinbarungen) Verabschiedung der Teilnehmer Seite 56 75927711 2.8 Anhang Zitatenschatz „Es muss nichts geschehen, weil, wenn nichts geschieht, passiert etwas.“ „Reformieren sollt Ihr, aber ändern darf sich nichts!“ „Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steige ab.“ „Lasst uns fünf tote Pferde zusammenspannen, dann kommen wir auch vorwärts.“ Ihr müsst dem Pferd mehr Futter geben, dann kommt es wieder in Schuss.“ „Die mächtige Fraktion der Aussitzer wird sagen: Auch das geht vorüber!“ „Die neue Lernkultur wird es nicht geben, wenn wir nicht die Lernenden sein sollten.“ „Das beste Mittel gegen Traurigkeit ist Lernen.“ „Lernen musst du, nichts anderes.“ „Schule ist ein Haus des Lernens“ „Wir haben ein wunderbares Leitbild, nur die Schüler passen nicht dazu.“ „Die Summe der Pädagogik ist: die Menschen stärken, die Sachen klären.“ „Schulentwicklung dient den Menschen oder es ist ein überflüssiges Vorhaben.“ „Schulentwicklung ist eine enorme Herausforderung.“ „Es muss erkennbar sein, was zu lieben ist und was zu verachten ist.“ „Konflikte sind Chancen für Neues.“ „In der Konfliktkultur zeigt sich die Schulkultur.“ „Im Mittelpunkt der Schule steht der Unterricht.“ „Lernen ist wichtiger als Unterricht.“ „Unterricht ist zum Lernen da.“ „Gemeinsam statt einsam.“ „Fehler sind Freunde. Sie helfen mir, den Fehler nicht mehr zu machen.“ „Schulentwicklung braucht große Gedanken, kleine Schritte und einem langen Atem.“ (Hartmut von Henting) „Am Anfang jeder Tat steht der Traum, die Vision oder das Ziel“ (Nikolaus B. Enkelmann) Seite 57 75927711 Das A - B - C der Guten Schule Eine Atmosphäre der Achtung, der Anerkennung und der Akzeptanz aufbauen Die Bedürfnisse aller Beteiligten in all ihrer Besonderheit berücksichtigen Jedem Charakter sein Charisma zuerkennen Zum Durchblick drängen Zu ernsthaften Einsichten einladen Sich fehlerfreundlich ferhalten Gelingende Gemeinsamkeit genießen Zum Helfen herausfordern Immer wieder Initiativen initiieren Ja-Sagern entgegentreten, Nein-Sagern Alternativen anbieten Zu einem Klima der Kooperation beitragen und Konfrontationen kooperativ kontern Auf die Lust am Leisten Wert legen und das Loben lieben Mitmenschlichkeit mehren Der Nähe zur Nachbarschaft nachspüren Auf Offenheit orientieren Perspektiven planen Sich mit der Qualität des Querdenkens quälen Räume für Ruhe schaffen Nach Sinn und auch nach Sinnes-Lust immer wieder suchen Den Tag leben und das Tagewerk prüfen Unterschiede unterstützen und über Unvollkommenkeiten nicht unzufrieden sein Verantwortung vorleben Wahrhaftigkeit wagen und Widersprüchen widersprechen Sich in XX und in XY einfühlen, die Verschiedenheiten gemeinsam genießen und sie miteinander versöhnen Zufriedenheit zeigen und Zuversicht immer wieder zutrauen und zumuten Seite 58 75927711 Sammlung wichtiger Kernaussagen Es gibt viele Definitionen von Schulqualität. Wir verstehen darunter einen Schulentwicklungsprozess, der systematisch, zielorientiert, schülerorientiert und überprüfbar ist. Nimmt der Moderator seine Aufgabe ernst, dann mischt er sich nicht in die Angelegenheiten Schule ein. Es muss klar sein, dass die Schulleitung primär für die Lehrer zuständig ist und die Lehrer für die Schüler. Die Schulleitung ist nur indirekt für die Schüler zuständig. Wo liegen die großen Klippen bei einem SE-Prozess? - Schritt 1: Schulleiter muss dahinter stehen. - Schritt 2: Wenn der Schulleiter ein schlechtes Verhältnis zum Kollegium hat. - Schritt 4: Wenn wichtige Punkte des Betreuungsvertrages gestrichen werden, so dass ein - SE nicht möglich ist. Schulentwickler können nicht alles, sie können aber viel kaputt machen. Evtl. bilden an der Berufsschule auch andere Abteilungen eine Steuergruppe. Im Lehrerzimmer werden Protokolle von Sitzungen ausgehängt (Transparenz). Die Steuergruppe soll Kollegium widerspiegeln. Der Begriff „Arbeitsgruppe“ ist negativ belegt, deshalb der Begriff Qualitätszirkel. Wenn die Schule es will, können auch Abteilungen eigene Leitbilder erstellen. Aber: Man sollte die Schule als Ganzes sehen. Ein Leitbild muss evaluiert werden. Ein Leitbild kann gut umgesetzt werden, wenn das Leitbild von den Lehrkräften kommt. Wenn sich die Beziehungsebene verbessert, dann verbessert sich auch die Sachebene. Es sollten keinesfalls mehr als zwei Leitbildziele in Angriff genommen werden. Die Schule wählt meistens das Lernfeldziel aus, das sich am schnellsten umsetzen lässt, nicht dasjenige, das für die Schule das größte Problem darstellt. Zu 60%-70% wird von den Kollegen das Handlungsfeld „Schulleitung“ genannt. Das Projektmanagement kann evtl. vorher am Beispiel Pestalozzischule geübt werden. Der Schulkoordinator hilft ggf. bei der späteren Umsetzung. Nach Dr. Emminger ist es bisher noch nicht vorgekommen, dass ein Leitbild vom Gesamtkollegium abgelehnt wurde. Falls doch einmal geschehen sollte, muss der Prozess nochmals durchgeführt werden. Der positive Beschluss der Konferenz ist für das Gesamtkollegium bindend, d.h. die Minderheit muss sich fügen. Deren Vertreter hätten ja jederzeit am Prozess teilnehmen können. Bei der praktischen Umsetzung können auch andere Lehrkräfte aus der Projektgruppe mitwirken. Im nächsten Schuljahr nimmt sich dann ein neuer Qualitätszirkel ein andere Leitziel vor. Wer Schulentwicklung nicht mitmacht, wird sie erleiden. Qualität steckt an! Evtl. verlässt bei der Abstimmung über die Zusammensetzung der Steuergruppe der Betreuer für ca. 20 Minuten das Konferenzzimmer. Die Diskette mit dem Betreuungsvertrag wird der Steuergruppe ausgehändigt. Der Vertrag wird - ggf. abgeändert - dem externen Berater zugesandt. Die Bildung der Projekt- und Steuergruppe kann auch in einer weiteren Sitzung erfolgen. Geht man diesen Weg, dann werden bei dieser Veranstaltung auch die Arbeitsvereinbarungen getroffen. Seite 59 75927711 Ein Schulentwicklungsprozess braucht unbedingt nach Vorgabe des KM’s: a) Steuer- und Lenkungsgruppe b) Zielvereinbarungen c) Stärken- und Schwächenanalyse d) Evaluation Seite 60 75927711 3 Zwischenschleife: Der Einstieg in die systemische und systematische Schulentwicklung – das Kollegium der Schule trifft eine Entscheidung Die Zwischenschleife wird durchgeführt, wenn das Kollegium einer Schule erst noch intensiv auf die Abstimmung vorbereitet werden muss. Vorbereitung Die Schulleitung führt Vorgespräche mit Interessenten, die der Steuergruppe betreten wollen, führen. Gruppenräume auf einer Ebene in Nähe des Plenumsraumes organisieren. Bezeichnungen der Fachgruppen vor den Gruppenräumen anbringen. Sitzordnung: Stuhlreihen Applikation 1 Der Einstieg in die systemische und systematische Schulentwicklung – das Kollegium der Schule trifft eine Entscheidung Applikation 2 Schulqualität durch Schulentwicklung Steigerung der Qualität schulischer Bildung durch interne Schulentwicklungsprozesse (mit externer Begleitung) Applikation 3 Unser Weg von innerer Schulentwicklung ist ein systemischer und systematischer Schulentwicklungsprozess auf der Grundlage eines Organisationsentwicklungsprozesses. Seite 61 75927711 3.1 Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms (10 min) Vorbereitung: (1) Folie 1: Tagungsprogramm (2) Applikation 1: Thema der Veranstaltung Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Helm und ich begrüßen Sie zum pädagogischen Tag. Für die freundliche Einladung bedanken wir uns bei ... Wir freuen uns, das Thema (Applikation 1) moderieren zu dürfen. Folgende Tagesordnungspunkte sind bis ca. ... Uhr vorgesehen: Folie 1 vorlesen. Der Veranstaltungsverlauf wurde Ihnen durch ein Schreiben der Schulleitung mitgeteilt. Gibt es zum vorgesehenen Verlauf der Veranstaltung Fragen? Teilnehmer melden sich ggf. Achtung: keine Methodendiskussion! Anfangsdiskussion kurz halten! Bringen sie Ihre Argumente in die Gruppenarbeit und in die spätere Präsentation ein Es geht nicht um die Abstimmung „Schulentwicklung ja/nein“, sondern um die Abstimmung, ob die Schule unseren Weg von innerer Schulentwicklung gehen will. Mögliche kritische Einwände der Teilnehmer: Einige Kollegen stören sich an den Begriffen systematisch und systemisch. Jedes Fachgebiet hat seine Fachsprache mit ihrer Fachterminologie. Das Fachgebiet Schulentwicklung kennt die Fachbegriffe „systemisch“ und „systematisch“. Wenn Sie sich an diesen Begriffen stören, ersetzten Sie sie einfach durch Wörter wie „zielgerichtet“ und „alle betreffend“. Aber: Ein Schulentwicklungsprozess, der nicht systemisch und systematisch verläuft ist nach einhelliger Meinung aller Schulentwicklungsexperten kein Schulentwicklungsprozess im Sinne der Definition. Viele Kollegen beschweren sich darüber, dass der Schulleiter Kollegen angesprochen hat, ob sie nicht in der Steuerungsgruppe mitarbeiten möchten. Seite 62 75927711 Der Schulleiter muss ein Interesse haben, dass eine Steuerungsgruppe zustande kommt. Der Schulleiter muss Gelegenheit haben, dass Kollegen seiner Wahl in der Steuerungsgruppe vertreten sind. Jeder kann in der Steuerungsgruppe mitarbeiten, niemand ist ausgeschlossen, auch wenn er nicht vom Schulleiter direkt angesprochen wurde. Seite 63 75927711 3.2 Rückblick (10 min) Vorbereitung: (1) Applikation 2: Schulqualität durch Schulentwicklung ... (2 Applikation 3: Unser Weg ... (3) Folie 2: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Bevor wir in die Arbeitsphasen einsteigen ein kurzer Rückblick: Im ... haben wir unser Schulentwicklungskonzept der Schulleitung, dem Personalrat und den Fachbetreuern der Schule vorgestellt. Im ... haben wir Ihnen unser Konzept im Rahmen einer Gesamtkonferenz vorgestellt. Jeder von Ihnen hat ein Skript sowie unsere Homepage-Adresse zum Nachlesen erhalten. Was kennzeichnet nochmals unseren Weg der Schulentwicklung? 1. Applikation 2: Schulqualität durch Schulentwicklung Innere Schulentwicklung ist nicht Aktionismus zum Selbstzweck, sondern dient der Steigerung der Qualität schulischer Bildung. Alle; die am Schulleben beteiligt sind, müssen erfahren, dass vieles durch den Schulentwicklungsprozess jetzt besser geht. Jedes Fachgebiet hat seine Fachsprache mit ihrer Fachterminologie. Wenn Sie sich an den Begriffen „systemisch und systematisch“ stören, dann verwenden Sie andere Worte. Aber: Ein Schulentwicklungsprozess, der nicht systemisch und systematisch verläuft ist nach einhelliger Meinung aller Schulentwicklungsexperten kein Schulentwicklungsprozess im Sinne der Definition 2. Applikation 3: Unser Weg ... Unser Weg von innerer Schulentwicklung ist ein systemischer und systematischer Schulentwicklungsprozess auf der Grundlage eines Organisationsentwicklungsprozesses. Systemisch heißt, dass sich die Folgen des Prozesses auf die gesamte Institution Schule auswirken. Systematisch heißt, dass der Prozess zielorientiert, gegliedert und planmäßig verläuft. 3. Wir zeigten Ihnen auf, wie ein solcher Schulentwicklungsprozess möglicherweise an der Schule verlaufen könnte. Seite 64 75927711 Folie 2: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses (erklären) Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben es heute in der Hand, wie es in Sachen Schulentwicklung an Ihrer Schule weitergehen soll. Bevor Sie darüber demokratisch abstimmen, bekommen Sie die Gelegenheit, sich einmal intensiv mit der Thematik auseinander setzten. Seite 65 75927711 Der Einstieg in die systemische und systematische Schulentwicklung – das Kollegium der Schule trifft eine Entscheidung Schule: ... Raum: ... Tag: ... Vorgesehenes Tagungsprogramm 09.00 –12.00 Uhr 1. Begrüßung und Vorstellung des Tagungsprogramms 2. Ein kurzer Rückblick 3. Stärken-Schwächen-Bilanz der Schule 3.1 Individuelles Brainstorming 3.2 Gruppenarbeit 3.3 Präsentation der Gruppenergebnisse 4. Pro- Contra- Analyse zu einem systemischen und systematischen SE-Prozess 4.1 individuelles Brainstorming 4.2 Gruppenarbeit 4.3 Pro- Contra- Diskussion 12.00 – 12.45 Uhr Mittagspause 12.45 – 13.30 Uhr 5. Abstimmung über den weiteren Weg der Schulentwicklung 6. Enrichtung der Steuerungsgruppe Ansbach, 26. Oktober 2002 gez. Paul Weeger / Reiner Helm Folie 1 Seite 66 75927711 Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Schritte Wer? Wo? 1. Information des Kollegiums: Da gibt es ... 2. Kollegiumsbeschluss Wir wollen mehr Informationen ... 3. Informationsveranstaltung SL, LK... Schule Kollegium Schule Kollegium Ext. Begl. Ext. Begl. Projektgr. Kollegium Ext. Begl. Projektgr./ Reakt.gr. Ext. Begl. Projektgr. Schule 4. Betreuungsvereinbarung 5. Bildung einer Steuergruppe 6. Zielerklärung: SOLL-Zustand Leitbild 7. Prioritätensetzung Schulprogramm 8. Projektmanagement: Diagnose im/in den Handlungsfeld/ern des Schulprogramms Zielaufstellung Möglichkeiten Konzept als Antrag an die 9. Beschlussfassung/Umsetzung 10. Evaluation: intern u. extern Zeit 1. Sitzung 2 Std. Schule Schule nicht an der Schule Schule 2. Sitzg. Pädagog. Wochenende 3. Sitzg. Schule Qualitätszirkel (evtl. ext. Begl. LKonferen z Kollegium Schule QZ Schule e 7. neue Prioritätensetzung: Schulprogramm alle 5 - 6 Jahre: 6. Leitbild-Evaluation Projektgr. Schule Projektgr. s.o. Folie 2 Seite 67 75927711 s.o. 3.3 Stärken- und Schwächenbilanz der Schule (100 min) Vorbereitung: (1) Applikation: Stärken-Schwächen-Analyse (2) Folie 1 / Arbeitsblatt 1: Stärken-Schwächen-Analyse (3) Folie 2: Gruppenräume (4) Im Vorfeld Stifte und Plakatpapier in den Gruppenräumen auslegen. Wir beginnen mit der Diagnose des IST- Zustandes an Ihrer Schule. Als Methode setzten wir die so genannte „Stärken-Schwächen-Analyse“ ein (Applikation). Gleichzeitig haben Sie die Gelegenheit Ihre Wünsche für die Zukunft mit einzubringen. Zunächst sollen Sie sich alleine mit der Problematik auseinandersetzen und dann in Gruppen darüber diskutieren. Anschließend stellen die Gruppen Ihre Ergebnisse dem Plenum vor. Nr. Verlauf / Methode Medien 1 10 min Beachte: Die Gruppenräume sind nach Fachgruppen gekennzeichnet. 1/2 Einzelarbeit Der Moderator teilt an jeden Teilnehmer Arbeitsblatt 1 aus. Arbeitsauftrag 1 (Einzelarbeit) über Folie 1 oben der erklären: „Erfassen Sie im linken Rechteck alle Stärken Ihrer Schule. - Wo sind Sie spitze? - Was läuft gut? - Worauf sind Sie stolz?“ „Notieren Sie in der rechten Fläche Schwächen Ihrer Schule. - Was läuft nicht? - Womit sind Sie unzufrieden? - Was ist mangelhaft?“ „Schreiben Sie ins untere Feld Ihre Ziele und Ihre Wünsche für die Zukunft.“ Seite 68 Teilnehmer erledigen den Arbeitsauftrag. 75927711 2 Arbeitsauftrag 2 (Gruppenarbeit) über Folie 1 unten erklären. 10 min Setzten Sie sich nun intensiv mit dem Thema in den Gruppen auseinander. Diskutieren Sie und versuchen Sie in der Gruppe einen Konsens herzustellen. Gruppenarbeit Gruppenbildung Es werden 6 Gruppen nach Fachbereichen gebildet (s. Folie 2). Die Gruppenräume befinden sich alle auf diesem Stockwerk. Vor den Räumen sind die Bezeichnungen der Fachgruppen angeschlagen. Tagen Sie bitte nur in dem Raum, der Ihrer Gruppe zugewiesen wurde. In den Gruppenräume finden Sie Stifte und das Plakatpapier. Sie haben 45 Minuten Zeit, um den Arbeitsauftrag zu erledigen. Wir sehen uns also wieder um ... Uhr hier.“ Begeben Sie sich jetzt bitte mit Ihren Blatt in die Gruppenräume und kommen Sie bitte pünktlich zurück in den Plenumsraum mit dem Präsentationsplakat. Anmerkung Die Moderatoren besuchen die Fachgruppen, machen sich über den Stand kundig und beantworten ggf. Fragen. Der Moderator stellt die Pinwände zu einem INFO-Markt auf. Kurz vor der Präsentation werden die Raumbezeichnungsapplikationen vor den Gruppenräumen abgenommen und durch Zahlen von 16 ergänzt (Vorbereitung der Gruppenräume für die Mixgruppen bei der Pro- Contra-Analyse) 3 Die Arbeitsgruppen erledigen den Arbeitsauftrag. Treffen im Konferenzraum Die Gruppen heften ihre Plakate an die Pinwände. Die Gruppen stellen sich der Reihe nach vor Ihren Plakaten auf und stellen ihre Ergebnisse dem Plenum vor. 50 min 4 30 min Präsen- Alternative (bei Platzmangel) tation Die Gruppensprecher heften der Reihe nach ihre Plakate an eine Pinwand und erklären die Einträge. Beachte Nach jeder Präsentation findet eine kurze Diskussion statt. Applikation Seite 69 Stärken-Schwächen-Analyse 75927711 2/3/4 Meine Schule, die Staatliche Berufsschule ... Stärken Schwächen - - Ziele / Wünsche - Arbeitsaufträge 1. Einzelarbeit Wo liegen die Stärken Ihrer Schule? Welche Schwachpunkte stellen Sie fest? Welches sind Ihre Wünsche für die Zukunft? 2. Gruppenarbeit Finden Sie einen Gruppensprecher, der die Sitzung leitet. Setzen Sie sich intensiv mit den Stärken und Schwächen Ihrer Schule auseinander. Formulieren Sie Ihre gemeinsamen Wünsche für die Zukunft. Halten Sie die Ergebnisse auf einem Plakat fest (z. B. nach obigem Muster). Ein Sprecher der Gruppe stellt dem Plenum die Arbeitsergebnisse vor. Folie 1 / Arbeitsblatt 1 Seite 70 75927711 Stärken- Schwächen- Analyse Gruppenraum Gruppe 305 FG Metalltechnik 304 FG Elektrotechnik 302 FG Bautechnik 301 320 FG Körperpflege / Friseure FG Nahrung FG Gesundheit, Handel 318 FG Wirtschaft und Verwaltung 317 Religionslehrer Folie 2 Seite 71 75927711 3.4 Pro- Contra- Analyse (65 min) Vorbereitung: (1) Plakat: Unsere Schule: Wie lassen sich ...? (2) Arbeitsblatt 1/ Folie 1 Unser Weg von Schulentwicklung kann definiert werden als ... (3) Arbeitsblatt 2 / Folie 2: Pro- Contra- Analyse (Rückseite mit Nummern) (4) Applikation: Pro- Kontra- Analyse (5) Folie 3: Gruppenraum = Gruppennummer Erfahrung: Obwohl den Teilnehmern das Schulentwicklungskonzept aus der Informationsveranstaltung her bekannt sein müsste und ihnen die wichtigsten Merkmale des Prozesses nochmals erklärt werden, kann es vorkommen, dass nicht wenige angeben, zu wenig über den systemischen und systematischen Schulentwicklungsprozess zu kennen. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass oft die emotionale Einstellung zur Schulentwicklung eine „intensive geistige Auseinandersetzung“ und das „Begreifen“ des Prozesses verhindern. Wenn an der Veranstaltung Störungen dieser Art auftreten, dann wird an Stelle der Pro-Contra-Analyse über das Konzept diskutiert und anschließend die Wahl durchgeführt. Nr. Verlauf / Methode Medien 1 Plakat „Wie lassen sich nun die Stärken der Schule weiter ausbauen?“ „Wie können die Schwächen abgebaut werden?“ „Wie lassen sich die Ziele und Wünsche erfüllen und umsetzten?“ 1/2/3/4 15 min Einzelarbeit Ein Weg, wie sich diese Fragen beantworten und lösen lassen, ist unser Weg von Schulentwicklung. Er unterscheidet sich von den bisher an der Schule gelaufenen Aktivitäten durch seinen systematischen Ansatz. Folie 1 (Unser Weg ... kann definiert werden als ...) (nicht erklären) Sie können die Definition unseres systematischen Ansatz jetzt nochmals in Ruhe durchlesen. Arbeitsblatt (1) austeilen Plakat Sie müssen sich jetzt im Klaren sein, bringt dieses Schulentwicklungskonzept etwas für die Schule, für Ihre Abteilung, für die Schüler und für Sie als Lehrkraft. Damit Sie keine voreiligen Schlüsse ziehen, sollen Sie zunächst einmal selbst Pro- und Contra-Argumente sammeln. (Applikation). Austeilen des Arbeitsblattes (2) an jeden Teilnehmer Seite 72 75927711 Folie 2 oben Arbeitsauftrag „Sie haben 10 Minuten Zeit, Ihre persönlichen „Pro- und Contra-Argumente zu notieren!“ Teilnehmer erledigen Arbeitsauftrag in Einzelarbeit. 2 30 min Gruppenarbeit Nun sollen Sie sich in Gruppen mit Ihren Argumenten auseinander- 3/5 setzen. Auf der Rückseite Blattes „Unser Weg von Schulentwicklung“ finden Sie Ihre Gruppennummer. Der Gruppenraum ist gleich Ihrer Gruppennummer (Folie 3). Während die erste Gruppenarbeit fachbereichsbezogen war, soll diese Gruppenarbeit fachbereichsübergreifend stattfinden. Wichtig ist uns dabei, dass der Informationsaustausch auch mit Ihnen weniger bekannten Kollegen stattfindet. Arbeitsauftrag Der Moderator erklärt über die Folie 2 unten den Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit. Sie haben 30 Minuten Zeit für die Erledigung des Arbeitsauftrages. Anschließend treffen Sie sich wieder hier pünktlich im Plenum. An die Gruppen wird jeweils ein Arbeitsblatt (2) verteilt. Die Teilnehmer treffen sich in den Gruppenräumen und erledigen den Arbeitsauftrag. In der Zwischenzeit baut der Moderator den Fish-Pool auf. Ein Stuhl für den Diskussionsleiter (ist Moderator) Sechs Stühle für die Gruppensprecher Zwei Stühle für Diskussionsteilnehmer aus dem Plenum 3 20 min FishPool Treffen im Plenum Die Gruppensprecher begeben sich mit Ihrem Wappenplakat in den Fish-Pool Die Regel des freien Stuhls im Fish-Pool wird erklärt. Der Diskussionsleiter eröffnet die Diskussion. Mögliche Fragestellungen: Geben Sie Ihr Statement ab! Diskutieren Sie diese Aussage! Wie ist der Gruppenprozess verlaufen? Zu welchem Resümee kommen Sie? Wie ist Ihr persönliche Meinung? Möchte jemand aus dem Plenum hierzu etwa sagen? Pro- Contra- Analyse Seite 73 75927711 Applikation Seite 74 75927711 Unsere Schule Wie lassen sich die Stärken weiter ausbauen? Wie können die Schwächen abgebaut werden? Wie lassen sich die Ziele und Wünsche erfüllen und umsetzen? Ein Weg systematischer und systemischer Ansatz für Schüler, Lehrer, Abteilungen, Schule, ... Plakat Seite 75 75927711 Unser Weg von Schulentwicklung kann definiert werden als ... ein Prozess zielorientiert längerfristig transparent geplant und offen zugleich möglichst viele/alle Schüler/innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter, Außenpartner etc. Einzelschule als Motor der Schulentwicklung bei dem die Beteiligten der lernenden Institution Schule auf der Basis gemeinsam Schulprofil, Leitbild, Leitsätze, pädagogischer Minimalkonsens etc. und Schulprogramm erarbeiteter Visionen bestimmte Strukturen/ Unterricht, Erziehung, Normen, Beratung, Beurteilung, Schulleben, Arbeitsklima, Kollegium, Leitung, Außenbeziehungen etc. Handlungsfelder ihrer Schule diagnostizieren, reflektieren und ggf. verändern, um die Effektivität von Unterricht und Erziehung und damit auch die Lebensqualität der Umfragen, Erhebungen, gemeinsame Auswertung, Projektmanagement, Arbeitskreise, Qualitätszirkel Wirksamkeit, Prozessqualität, Ergebnisqualität Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz, Freude am Beruf, Motivation, Corporate Identity etc. Mitglieder (in) dieser Institution nachweisbar steigern. interne und externe Evaluation Folie 1 / Arbeitsblatt 1 Seite 76 75927711 Pro- Contra- Analyse Arbeitsaufträge 1. Einzelarbeit Beantworten Sie in den nächsten 10 Minuten folgende Fragen und notieren Sie Ihre Antworten in das jeweilige Feld des Wappens. 1. Was spricht für einen systemischen und systematischen Schulentwicklungsprozess an Ihrer Schule? Welche Chancen bietet er? 2. Welche Argumente sprechen gegen einen systemischen und systematischen Schulentwicklungsprozess an ihrer Schule? Welche Risiken geht die Schule ein? 1. Pro 2. Contra 2. Gruppenarbeit Finden Sie einen Gruppensprecher, der die Sitzung leitet. Der Gruppensprecher sammelt die Pro- und Contra- Argumente. Sie werden in einer gemeinsamen Formulierung im Wappen festgehalten. Versuchen Sie die Pro- Argumente und die Contra- Argumente in eine Rangordnung zu bringen. Ein Sprecher der Gruppe stellt dem Plenum die Arbeitsergebnisse vor. Folie 2 / Arbeitsblatt 2 Seite 77 75927711 Pro- Contra- Analyse Gruppenraum Gruppe 305 305 304 304 302 302 301 301 320 320 318 318 Folie 3 Seite 78 75927711 3.5 Abstimmung über den weiteren Weg der Schulentwicklung (20 min) Vorbereitung: (1) Gefäß zum einsammeln der Stimmzettel (2) Blatt: Stimmzettel (3) Applikation: Abstimmung Nr. Verlauf / Methode 1 1/2/3 Haben Sie noch Fragen zu unserem Schulentwicklungskonzept? Teilnehmer melden sich. Schulentwicklung hat wie vieles im privaten Leben und im Beruf auch Vor- und Nachteile. Die Frage ist: „Wie gewichte ich die beiden Seiten einer Medaille? Sie sollen jetzt durch Ihr Abstimmungsverhalten klar bekunden, ob Sie mit unserer Begleitung in einen systemischen und systematischen Schulentwicklungsprozess einsteigen wollen. Dazu sind mindestens 50 Prozent der Stimmen nötig (Applikation). Austeilung der Stimmzettel (Blatt (2)) Geheime Abstimmung und einsammeln der Stimmzettel (2) Das Abstimmungsergebnis wird an der Tafel festgehalten. 15 min Applikation Seite 79 Medien Abstimmung 75927711 Stimmzettel Ich stimme ...... O O für gegen den anvisierten Schulentwicklungsprozess an unserer Schule. Stimmzettel Ich stimme ... O O für gegen Den anvisierten Schulentwicklungsprozess an unserer Schule. Seite 80 75927711 3.6 Wahl der Steuerungsgruppe (20 min) Vorbereitung: (1) Folie 1: Aufgaben der Steuerungsgruppe (2) Applikation: Installation Steuerungsgruppe Nr. Verlauf / Methode Medien 1 Bereits in dieser Sitzung sollten die organisatorischen Strukturen für den weiteren Prozess geschaffen werden. Ein wichtiger Schritt ist hierbei die Installation einer Steuerungsgruppe an Ihrer Schule (Applikation). 1/2 Folie 1 Die Aufgaben der ... Für die Arbeit von Steuerungsgruppen ... Was letztlich zu den Aufgaben und zur Arbeit der Steuerungsgruppe gehört kann diese selbst festlegen. Wer würde gerne in der Steuerungsgruppe mitarbeiten? Kandidaten, die im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt haben, melden sich zusammen mit weiteren Bewerbern. Sie kommen nach vorne und stellen sich neben den Moderatoren. Die Kandidaten werden namentlich auf einer Pinwand festgehalten. Anmerkung Die Moderation übernimmt ggf. ein Vertreter der Schulleitung (Die Steuerungsgruppe wird demokratisch per Hand vom Kollegium gewählt.) Applikation Seite 81 Installation der Steuerungsgruppe 75927711 Aufgabe der Steuerungsgruppe ist die Steuerung des Schulentwicklungsprozesses. Prozesssteuerung bedeutet im Einzelnen u.a.: Erfahrungsaustausch innerhalb und zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen, Unterstützung und Koordinierung im Schulentwicklungsprozesses, Vorbereitung und Durchführung von Diagnose und Feedbackkonferenzen, Koordinierung des Schulentwicklungsprozesses an der Schule, Kontakt zu den externen Beratern pflegen, Information des Kollegiums und allen am Schulentwicklungsprozess Beteiligten, Zusammen mit der Schulleitung Einleitung und Vorbereitung der schulinternen Evaluation, Begleitung der schulinternen Evaluation, ... Für die Arbeit von Steuerungsgruppen sollten u.a. folgende Voraussetzungen gelten: Freiwilligkeit der Mitarbeit, Repräsentanz der wichtigsten Gruppierungen, Übernahme von Verantwortung durch alle Beteiligten, ... Folie 1 Seite 82 75927711 3.7 Abschluss der Veranstaltung (15 min) Vorbereitung: Folie 1: Blitzlicht a) ggf. Abschlussblitzlicht Folie 1: „Wie habe ich die Veranstaltung erlebt?“ „Welche Wünsche habe ich für den weiteren Schulentwicklungsprozess?“ b) Verabschiedung der Teilnehmer Seite 83 75927711 Blitzlicht „Wie habe ich die Veranstaltung erlebt?“ „Welche Wünsche habe ich für den weiteren Schulentwicklungsprozess?“ Folie 1 Seite 84 75927711 4 Praktische Umsetzung Vorbereitung: - Sitzordnung: Tische in U-Form und Arbeitsinseln für die Gruppenarbeiten - Unterlagen zu 3.1.3 und 3.1.4 - Pinwand: „Zielvereinbarungen treffen“ - Flipchart: „ ... ist dann gut, wenn ...“ Pinwand Arbeitsprozess: Zielvereinbarungen treffen 1. Handlungsfelder „Irgendeiner guten Schule“ 2. Zielvereinbarung „Meine gute Schule“ 3. Zielvereinbarung „Unsere gute Schule“ Selektion I Selektion II Bild Selektion III 4. Zielvereinbarungen formulieren evtl. Flipchart Z I E … evtl. Plakat „Probleme sind Freunde“ 4.1 Erarbeitung eines Leitbildes (2. Sitzung) (310 min) Anmerkung: Beachte auch den IST-Verlauf der Veranstaltung an der Berufsschule Wasserburg. Die Durchführung dieses zentralen Schrittes erfolgt wenn möglich im Rahmen einer Kompaktveranstaltung an einem Wochenende in einem außerschulischen Konferenzzentrum. Die Terminabsprache trifft die Steuergruppe mit dem externen Moderator. Die Einladung geht an alle Mitglieder der Projektgruppe bzw. an das gesamte Lehrerkollegium sowie ggf. an die externen Teilnehmer. Seite 85 75927711 4.1.1 Begrüßung, Vorstellung des Tagungsprogramms (10 min) Anmerkung: Evtl. beginnt die Veranstaltung zur Einstimmung mit einem Stehkaffee. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Sie und heißen Sie herzlich willkommen auf dieser Veranstaltung. Es ist Ihre Veranstaltung, denn Sie haben es heute in der Hand, den SOLL-Zustand Ihrer Schule und damit die angestrebte Qualität zu definieren. Dies freut uns, und wir werden Sie dabei unterstützen. Der Arbeitsprozess für den heutigen Tag gliedert sich in zwei (drei) Teile: Wir steigen ein mit einer kurzen Reflexion und Problematisierung der Thematik. Dann treffen Sie Arbeitsvereinbarungen für Ihre spätere Arbeit (kann evtl. entfallen), Anschließend treten Sie mit uns in den Zielvereinbarungsprozess ein. In einer weiteren Sitzung wählen Sie dann ein Leitbildziel aus, das Sie dann im Rahmen eines Schulprogramms als erstes umsetzen werden. Auch hierbei werden wir Ihnen helfen. Gibt es hierzu Fragen? (Teilnehmer melden sich.) Seite 86 75927711 4.1.2 Reflexion und Problematisierung (15 min) Stellungnahme der Teilnehmer (1) Bevor wir aber mit Ihnen in den Arbeitsprozess einsteigen, interessiert uns schon die Frage Folie: „Was bewegt mich in der Projektgruppe mitzuarbeiten?“ Im Rahmen eines Blitzlichtes äußern sich die Teilnehmer zu der Fragestellung. Stellungnahme der Teilnehmer (2) Im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung steht also die Vereinbarung von Zielsetzungen, die wichtig sind für den weiteren systematischen Schulentwicklungsprozess. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, was fällt Ihnen ein, wenn Ihnen das Wort „Zielsetzung“ in Zusammenhang mit Schulentwicklung in den Sinn kommt? Flipchart (z.B.) Z I E L S E T Z U N G entrale Punkte nhalte suchen einsatz ösungen suchen chulleitung valuation erminsetzung ukunft gestalten mfangreiche Arbeit euanfang ewinn Der Moderator deckt das vorbereitete Flipchartpapier auf und notiert die spontan gegebenen Zurufantworten zu den vorgegebenen Anfangsbuchstaben. Ihre spontan gegebene Antworten sind sehr interessant. Auch wir möchten dazu unsere Gedanken einbringen. Seite 87 75927711 Stellungnahme des Moderators Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Begriff „innere Schulentwicklung“ steht für Veränderungsprozesse, die nicht nur auf Impulse und Herausforderungen reagieren, sondern bewusst geplant und gesteuert sind. Das heißt: Die Schulentwicklung muss zielorientiert verlaufen. Ohne Klarheit über die Veränderungsrichtung kann sich zwar auch etwas verändern, aber nicht unbedingt in die gewünschte Richtung. Die Zielfindung ist ein häufig vernachlässigter Schritt in der Veränderungsarbeit. Doch ohne Ziele kann auch das „Ergebnis“ nicht erkannt werden. Somit besteht das Risiko, sich zwar andauernd zu verändern, doch letzten Endes sich dabei im Kreise zu drehen. Solche Ziele können und sollen sogar visionär sein. Warum? Visionen und Träume sind die Motoren jeglicher Entwicklung. Ich frage Sie: Wäre das Flugzeug entwickelt worden, wenn nicht irgendwann Menschen vom fliegen geträumt hätten? Wäre die erste Mondlandung zustande gekommen, wenn nicht der Traum davon Pate gestanden wäre? Und wie war es mit Ihrem ersten Auto, Ihrem Haus oder Ihrer ersten größeren Reise? Wenn Lehrer Ihre Traumschule gar nicht mehr vorstellen können, besteht dann überhaupt noch eine Chance auf ein positive Entwicklung? Alle Lehrer haben bestimmte Vorstellungen von einer guten Schule, von interessantem Unterricht, von interessierten Schülern, von Eltern, von Kollegen, usw. Seite 88 75927711 Alle Lehrer haben auch ihre ganz persönlichen Gründe, warum Sie gerade diesen Beruf ergriffen haben bzw. ausüben. Alle Lehrer verspüren außerdem noch ganz individuelle Bedürfnisse, leben in einem spezifischen sozialen Umfeld. Betrachtet man dieses Konglomerat unterschiedlichster Bedürfnisse, Visionen und Ansprüche, so zeigen sich bei aller Verschiedenheit auch viele Gemeinsamkeiten, die in einem Leitbild zum Ausdruck gebracht werden können. Auf einem solchen Leitbild, also auf Zielvereinbarungen, baut unser Schulentwicklungskonzept auf. Es beinhaltet die Vision einer vom Kollegium getragenen „qualitativ guten Schule“. Darüber hinaus übernimmt es für die Schule verschiedene Funktionen: es bündelt die grundlegende pädagogische Haltung der Lehrkräfte; es vermittelt allen am Schulleben beteiligten Personengruppen den „Geist“ der Schule; es weist den Weg bei der Planung gemeinsamer Aktivitäten; es spart Zeit, weil sich ständige Grundsatzdiskussionen erübrigen und es wirbt für die Schule. Erfahrungen zeigen, dass beim Zielfindungsprozess über Visionen mehr die Sache im Mittelpunkt steht und störende Einflüsse über die Gefühls- und Beziehungsebene nicht so zum tragen kommen, als wenn der Einstieg über die Schwächen der Schule erfolgen würde. Wichtig ist, dass der Inhalt des Leitbildes nicht vorgegeben wird, sondern in einem gemeinsamen und intensiven Reflexionsprozess gewonnen wird. In einen solchen steigen wir jetzt mit Ihnen ein. Wenn Sie der Begriff „Leitbild“ wegen des negativen Beigeschmackes stört, können Sie ihn ohne weiteres ersetzen durch andere Begriffe, wie Schulprofil, Schulcharta, Leitsätze, Zielvereinbarungen, Zielkatalog u.ä. Seite 89 75927711 Alternative Liebe Kollegen und Kolleginnen, das primäre Ziel von Schulentwicklung, ist die Steigerung der Qualität schulischer Bildung. Im Mittelpunkt aller Bemühungen im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen stehen daher immer unsere Schüler. Bei diesen müssen sich letztendlich die gemeinsamen Anstrengungen, einschließlich der Optimierung der veränderbaren Rahmenbedingungen, niederschlagen, bei ihnen muss ankommen, was durch Schulentwicklungsprozesse in Bewegung gesetzt wird, ansonsten macht Schulentwicklung wenig Sinn. Dazu sind Zielsetzungen nötig, die vom Kollegium gemeinsam formuliert und getragen werden. Die Bedeutung von Zielen für diesen Prozess, möchte ich durch eine kleine Geschichte und ein Zitat verdeutlichen. Ein Vater wollte seinen Hof an denjenigen seiner drei Söhne vererben, der auf dem Feld mit dem Pflug die geradeste Furche ziehen konnte. Die Söhne verrichteten diese Arbeit auf recht unterschiedliche Weise (Gestik). Der erste Sohn pflügte und sah dabei auf den Pflug. Der zweite Sohn drehte sich um und pflügte. Der dritte Sohn sah auf den Hof und pflügte. Wen von den Dreien ist es wohl gelungen die geradeste Furche zu ziehen? Antwort: „Der dritte Sohn zog die geradeste Furche, weil er ein Ziel hatte.“ Mark Twain sagte einmal: „Als sie ihr Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten sie ihre Anstrengungen.“ Auf den Prozess der Schulentwicklung übertragen bedeutet das zweierlei: Schulentwicklung muss zielorientiert verlaufen. Solche Ziele können oder sollen sogar visionär sein. Konrad Adenauer, der viele seiner Reden mit selbstgemachten Lebensweisheiten würzte, formulierte es einmal so: „Ich habe immer gefunden, dass nichts befreiender ist als ein weiter Blick in die Ferne.“ Seite 90 75927711 Die Zielformulierung steht am Anfang einer systematischen Schulentwicklung. Wenn ich das Ziel weiß, kann ich mich auch auf dem Weg zu diesem Ziel machen. Solche Ziele gilt es nun im Folgenden für Ihre Schule zu finden. Seite 91 75927711 „Was bewegt mich in der Projektgruppe mitzuarbeiten?“ Folie Seite 92 75927711 4.1.3 Treffen von Arbeitsvereinbarungen (45 min) Anmerkung: Die Arbeitsvereinbarungen können bei Bedarf auch während des folgenden Arbeitsprozesses erarbeitet werden. Vorbereitung: - (1) Arbeitsblatt: „Übung: Arbeitsvereinbarung Kommunikation“ - (2) DIN-A3-Blätter - (3) zwei Applikationen - (4) großes Plakat „Unsere Arbeitsvereinbarungen“ Nr. Methode / Schritt 1 Einzelarbeit/ Gruppenarbeit (30 min) Verlauf Damit der spätere Arbeitsprozess in den Gruppen weitgehend reibungslos abläuft, sollen Sie sich zunächst auf Normen für die spätere Zusammenarbeit einigen. Der Moderator teilt das Arbeitsblatt (1) aus. Bildung von freiwilligen Gruppen Die auf dem Arbeitsblatt gestellten Aufgaben werden ausgeführt. - Gruppenarbeit I - Einzelarbeit - Gruppenarbeit II Zwischenzeitlich heftet der Moderator das große Plakat (4) mit den Applikationen (2) an die Pinwand und teilt an die Gruppen die DIN-A3-Blätter (2) aus. 2 Treffen im Plenum Der Gruppensprecher einer Gruppe heftet das DIN-A3 Plakat (2) auf das große Plakat (4) und erklärt die getroffenen Arbeitsvereinbarungen. Die weiteren Gruppensprecher bringen der Reihe nach ihr Plakat an die Pinwand an und geben ergänzende Erklärungen ab. Hinweis: Die Arbeitsvereinbarungen sollen im Lehrerzimmer (Infowand) und bei jedem Arbeitstreffen ausgehangen werden. Der Moderator klebt die DIN-A3 Plakate (2) auf das großes Plakat (4). Präsentation (Stationenarbeit) und Reflexion der Gruppenarbeit (15 min) Seite 93 75927711 Anlage 1/2/3/4 großes Plakat Unsere Arbeitsvereinbarungen (Appl. 1) Auf Verstöße gegen die vereinbarten Regeln dürfen Teammitglieder aufmerksam gemacht werden! (Appl. 2) Seite 94 75927711 DIN-A3 Übung: Arbeitsvereinbarung Kommunikation 11 Minusregeln: 1. Rede nie von dir und verwende immer die Man-Form. 2. Lass die anderen nie ausreden und rede selbst in jede Pause hinein. 3. Lasse immer nur die anderen machen und übernehme nie persönliche Verantwortung für den Arbeitsprozess. 4. Übergehe alle Konflikte. 5. Erzähle eine Anekdote nach der anderen. 6. Fühle dich immer persönlich angegriffen, zeige es aber nicht und gib entsprechend zurück. 7. Erteile ungefragt - aber möglichst heftig - Ratschläge. 8. Antworte immer mit einem möglichst umfassenden Referat. 9. Vermeide jeden Spaß beim Arbeiten. 10.Friss allen Ärger über das Thema, über die Aufgabe und über andere in dich hinein. 11.Vermeide Einigungen und versuche - wie auch immer - deine Auffassung den anderen überzustülpen. Akzeptiere nie Entscheidungen, die gegen deine Auffassung zustande gekommen sind. 12. ... Aufgabe Gruppenarbeit I: 1. Formulieren Sie gemeinsam die Minus-Regeln in Plus-Regeln um. 2. Sollten Sie gemeinsam noch eine für Sie alle wichtige Regel gefunden haben, die hier noch nicht thematisiert ist, können Sie diese als Nummer 12 formulieren. Einzelarbeit: Suchen Sie sich Ihre ganz persönlichen fünf Plus-Regeln heraus (also die, die Sie persönlich bei Ihrer Arbeit in der Gruppe einhalten möchten) und notieren Sie sich die Nummern. Gruppenarbeit II: 1. Vergleichen Sie in der Gruppe Ihre persönlichen Nummern und einigen Sie sich gemeinsam auf fünf Regeln, die Sie alle in den folgenden Arbeitssitzungen ohne jede Abstriche einzuhalten bereit sind 2. Schreiben Sie die Regeln auf ein DIN-A3-Plakat und unterschreiben Sie Ihre Vereinbarung. Das Plakat ist bei allen Gruppensitzungen an geeigneter Stelle anzubringen. Seite 95 75927711 Auf Verstöße gegen die vereinbarten Regeln dürfen die Teammitglieder aufmerksam gemacht werden. Seite 96 75927711 4.1.4 Von „irgendeiner guten Schule" zur „Schul-Charta“ (240 min) Vorbereitung: - Flipcharttafel und Flipchartpapier - (1) Evtl. Folie 1: „Handlungsfelder der Schule“ - (2) 10 Kärtchen (DIN-A7) für jeden Teilnehmer - (3) Folie 2/Infoblatt 1: Zielklärungsübung „Meine gute Schule“ mit „Formulierungsansätze“ (1) - (4) Folie 3/Infoblatt 2: Zielklärungsübung „Unsere gute Schule“ (1) - (5) Folie 4/Infoblatt 3: Zielklärungsübung „Unsere gute Schule“ (2) - (6) Folie 5/Infoblatt 4 Zielklärungsübung „Unsere gute Schule“ (3) - (7) Plakatpapier - (8) Farbklebepunkte - (9) Plakat: Redaktionsgruppe - (10) Folie 6: Reflexion - (11) Folie 7: Wie geht es weiter? - (12) Folie 8: Schritte eines Schulentwicklungsprozesses - (13) Folie 9: Infoblatt: Formulierungshilfen zum Erstellen eines Leitbildes - (14) Plakat: Stichpunkte zu „unseren Zielvereinbarungen“ Unter Beachtung der geschlossenen Arbeitsvereinbarungen wird nun in mehreren Schritten eine gemeinsame Vision Ihrer Schule erstellt. Auf der Pinwand „Arbeitsprozess – Zielvereinbarungen treffen“ wird die Vorgehensweise erklärt und schrittweise durch einen Pfeil markiert. Nr. Methode / Schritt 1 Zurufmethode (15 min) Wichtige Handlungsfelder (Subsysteme) „irgendeiner guten Schule“ finden. Verlauf Anlage Frage: Welche „Handlungsfelder“ gibt es an „ir- evtl. 1 gendeiner guten Schule“? (s. Pinwand) 1. Der Moderator notiert den Zuruf eines Teilnehmers auf dem Flipchartpapier, z.B. Erziehung (in einer Wolke). 2. Er schreibt darunter: ist dann gut, wenn ... Mehrere Spiegelstriche werden angebracht. Eine Antwort aus dem Plenum wird exemplarisch notiert, z.B. partnerschaftlich. 3. Das Flipchartpapier wird abgerissen und in die Kreismitte (oder je eines auf jeden Tisch) gelegt. 4. Wiederholung der Schritte 1-3 (Beispiele siehe nächste Seite) Anmerkung: Evtl. ein Handlungsfeld provozieren, wenn Seite 97 75927711 dieses nicht vom Kollegium kommt. Der Moderator besteht auf konkrete Formulierungen (=wichtig!) Es sollten so viele Handlungsfelder gefunden werden wie Partnergruppen vorhanden sind, mindestens aber ca. 12 Handlungsfelder. Alternative: 1. Der Moderator gibt 12 Handlungsfelder „irgendeiner guten Schule“ auf Folie 1 vor. 2. Jeder Teilnehmer notiert sich auf einem Blatt das Handlungsfeld, z.B. Erziehung und schreibt dahinter die Antworten zu „ist dann gut, wenn ...“ 3. Der Prozess wird so lange fortgesetzt, bis alle Handlungsfelder abgearbeitet sind. Seite 98 75927711 Erziehung ist dann gut, wenn ... - partnerschaftlich - Weitere Beispiele: Unterricht Teamarbeit Schulleitung Arbeitsklima Außenbeziehungen Kollegium getroffen Rahmenbedingungen Administration und Verwaltung Hausmeister Personalrat Unterbringung der Heimschüler Beratung der Schüler/innen Beurteilung der Schüler/innen Normen und Regeln Schulleben Schulinterne Fortbildung Seite 99 ist dann gut, wenn... gute Unterrichtsvorbereitung ist dann gut, wenn... guter Informationsaustausch ist dann gut, wenn... Aufgabenteilung geklärt ist dann gut, wenn... Materialaustausch stattfindet sind dann gut, wenn... Arbeitskreise gebildet werden ist dann gut, wenn... Entscheidungen gemeinsam werden. sind dann gut, wenn... viele Computer ist dann gut, wenn... ist dann gut, wenn... ist dann gut, wenn... Lehrer entlastet werden er hilfsbereit ist er dem Chef die Meinung sagt ist dann gut, wenn... kurze Schulwege 75927711 2 Brainstorming (20 min) Vorbereitung: Auf jedem Tisch wird ein Plakat mit zwei Stiften ausgelegt. Ergänzung der Plakate 1. Jede Zweiergruppe am Tisch ergänzt hinter den Spiegelstrichen die Antwort um weitere Argumente (kleine Abstände). 2. Nach ca. 2-3 Minuten ertönt ein Glockenton und die Plakate werden an die nächste Arbeitsinsel im Uhrzeigersinn weitergereicht (Die Stifte bleiben ortsfest). Alternativ hierzu können auch die Tischgruppen) im Uhrzeigersinn wandern. Anmerkung: Es sind keine Veränderungen und Kommentierungen der Vorgängerbemerkungen vorzunehmen. Methode entspricht der 6-3-5-Methode (Brainwriting) - 6 Teilnehmer - 3 Lösungen - 5 Minuten 3. Die Partnergruppen ergänzen die Eintragungen der Vorgruppe. 4. Nach ca. 4 Runden wird dieser Arbeitsprozess abgebrochen. Zur Alternative: Je eine Partnergruppe fasst die Einzelergebnisse zu einem oder zwei der 12 vorgegebenen Handlungsfelder auf einem Plakat zusammen. 3 Präsentation (10 min) stille Vernissage Seite 100 1. Die Partnergruppen erstellen eine Plakatgalerie an den Pinwänden oder an den Wände im Gang. 2. Die Teilnehmer nehmen die Arbeitsergebnisse in einem Rundgang in Augenschein. 3. Treffen im Plenum 75927711 4 Einzelarbeit (20 min) Zehn Merkmale „Meiner guten Schule“ finden. Die Plakate mit den Handlungsfeldern zeigen die 2/3 Kennzeichen „irgend einer guten Schule“. Damit haben Sie Anregungen für den nächsten Arbeitsauftrag. In dem geht es darum, dass Sie ein geistiges Bild mit dem Titel „Meine gute Schule“ erstellen. (s. Pinwand) 1. Über die Folie 2 wird die weitere Vorgehensweise erklärt. Anschließend wird das Infoblatt 1 ausgeteilt. 2. Arbeitsauftrag: Machen Sie sich jetzt also auf den Weg und „Notieren Sie auf jeder Karte ein Merkmal, das für „Ihre gute Schule“ zutreffen soll!“ 3. Jeder Teilnehmer holt sich beim Moderator 10 Kärtchen (DIN-A7) ab. (Evtl. nimmt sich jeder Teilnehmer den vorbereiteten Stoß auf einem Stuhl in der Kreismitte.) 4. Anschließend absolvieren die Teilnehmer einen Galerierundgang und notieren sich 10 Merkmale zu „Meiner guten Schule“. 5. Treffen im Plenum Anmerkung: Um den Kollegen genügend Zeit zum Nachdenken zu geben, wäre es sinnvoll, den Arbeitsprozess über die Pause laufen zu lassen. Die Teilnehmer können während des Rundganges auch neue Aspekte auf ihre Kärtchen notieren. 5 Selektion I (Gruppenarbeit) (20 min) Fünf Merkmale „Unsere gute Schule“ (1) finden. Der Moderator teilt das Infoblatt 2 aus. Erklärung der Vorgehensweise nach Folie 3. 1. Freiwillige Gruppenbildung mit 5 Teilnehmern Anmerkung Sinnvoll wäre es, die Gruppen nach Fachbereichen oder anderen spezifischen Merkmalen der Schule zusammenzustellen (Rücksprache mit Steuergruppe bzw. Teilnehmern) Ein Mitglied der Steuerungsgruppe oder eine Seite 101 75927711 4 Person, die vertraut ist mit den Moderationstechniken, sollte die Gruppenleitung übernehmen. 2. Jede Gruppe postiert sich kreisförmig um eine Arbeitsinsel. 3. Die 5 Karten mit den wichtigsten Merkmalen (Herzkarten) werden in die linke Hand genommen. Die 5 weniger wichtigen Karten hält die rechte Hand. 4. Nach dem Befehl „Hau-Ruck“ durch den Gruppenleiter werden die Karten der rechten Hand an den rechts sitzenden Partner weiter gegeben. 5. Dieser verschiebt dann ggf. Karten von rechts nach links bzw. von links nach rechts. Die Summe der Karten in jeder Hand bleibt immer fünf. 6. Nach einem Rundlauf ist der Selektionsvorgang beendet. 7. Die Gruppenmitglieder legen die restlichen Karten in der Mitte des Tisches ab. 8. Anschließend trifft man sich wieder im Plenum. Die 5 Herzkarten nimmt jeder mit. 5 Karten Die 5 weniger wichtigen Argumente 5 Herzkarten Die 5 wichtigsten Argumente 5 Karten Die 5 weniger wichtigen Argumente 5 Karten Die 5 weniger wichtigen Argumente Person A Person B Seite 102 Person C 75927711 6 Selektion II (Gruppenarbeit) (15 min) Der Moderator teilt das Infoblatt 3 aus. Erklärung der Vorgehensweise nach Folie 4. (s. Pinwand) „Unsere gute Schule“ (2) Vorbereitung Auf jedem Gruppentische wird ein farbiges DINA3-Blatt für die Ablage der 10 zentralen Argumente gelegt. Gemeinsame Auswahl der 10 wichtigsten Karten 15 periphere Argumente 10 zentrale Argumente 5/2 1. Die Gruppe breitet alle 25 Herzkarten auf dem Gruppentisch aus. 2. Der Moderator teilt an jeden Gruppentisch Ersatzkarten aus. 3. Die Gruppe einigt sich auf 10 Kriterien, die auf „ihre gute Schule“ zutreffen sollen. Karten mit ähnlichen Merkmale werden zu einem Stoß gebündelt. Die Randkriterien werden nach außen gelegt; sie bilden die peripheren und somit weniger wichtigen Kriterien. Die Gruppen führen den Arbeitsauftrag aus. Anschließend trifft man sich wieder im Plenum. Anmerkung: Falls noch nicht geschehen: Ggf. Zwischenschleife einlegen und Übung „Arbeitsvereinbarung Kommunikation“ durchführen. 7 Plakaterstellung (Gruppenarbeit) (45-60 min) „Unserer gute Schule“ (3) 8 Präsentation (20 min) Seite 103 Der Moderator teilt das Infoblatt 4 aus. Erklärung der Vorgehensweise nach Folie 5. Arbeitsauftrag: „Erstellen Sie ein Bild Ihrer gemeinsamen „Traum- Schule“! Ein Bild bringt auch die emotionale Dimension zum Vorschein. Finden Sie dazu ein aussagekräftiges Symbol über das Sie die 10 zentralen, absolut unverzichtbaren Merkmale Ihrer guten Schule sowie die restlichen, minder wichtigen, peripheren Merkmale darstellen können. Die Merkmale sollten für alle gut leserlich sein.“ 1. Gruppenarbeit 2. Die Plakate werden nebeneinander an Pinwände geheftet. 3. Treffen im Plenum Die Präsentation der jeweiligen „TraumSchule“ erfolgt durch einen freiwilligen Gruppensprecher. 75927711 6/7 Anmerkung: Es gibt keinen festen Zeitplan. Nachfragen möglich, z.B.: Wie kommt die Gruppe auf das Symbol? Wie war der Gruppenprozess? Seite 104 75927711 9 Selektion III (30 min) Merkmale „unserer guten Schule“ finden Plakat 14 Stichpunkte zu „unseren Zielvereinbarungen“ - Vorbereitung 7/8/14 Plakat 14 wird an Pinwand geheftet. Der Sprecher der Steuergruppe (Protokollführer)wird gebeten, später die gemeinsam gefundenen Zielvereinbarungen stichpunktartig zu notieren. Diese Stichpunkte bilden die Grundlage für die Feinformulierung der Ziele durch die Redaktionsgruppe. Beim Vergleich der Plakate aller Gruppen zeigen sich mehr oder weniger viele Übereinstimmungen in den zentralen und/oder peripheren Werten. (s. Pinwände) Die Gruppensprecher treten vor ihre Plakate. Die übrigen Teilnehmer stellen sich hinter ihnen auf. 1. Der erste Gruppensprecher (linkes Plakat) nennt einen zentralen Punkt der „TraumSchule“ und begründet diesen. 2. Die übrigen Gruppensprecher sehen nach, ob dieses Merkmal (direkt oder indirekt) in ähnlicher Form auch auf ihrem Plakat aufgeführt ist (Wechsel ist wichtig!). 3. Findet sich bei allen Gruppen eine Übereinstimmung, dann klebt der Moderator auf jedes Plakat einen bestimmten Farbpunkt an das jeweilige Merkmal. Der Protokollführer findet im Dialog mit dem Plenum eine stichpunktartige Grobformulierung des Zieles. 4. Dann nennt der 2. Gruppensprecher ein zentrales Merkmal auf seinem Plakat. Findet sich dann wieder eine Übereinstimmung, dann wird dieses Argument mit einer anderen Farbe markiert, usw. Anmerkung: Ist bei einer Gruppe keine Übereinstimmung vorhanden, dann überlegt die Gruppe, ob sie das Merkmal mittragen will, ansonsten besteht keine Konsens und es werden keine Punkte verteilt. Evtl. Hinweis: Nach Untersuchungen sind ca. 15 -20% aller Gruppen nicht konsensfähig. Seite 105 75927711 Es muss nicht unbedingt ein Konsens gefunden werden. Es gibt keine Begrenzung der Konsenspunkte. Der Moderator hat viele Farben in Reserve. 10 Redaktionsgruppe formu- Plenum 9/13 liert Leitziel Anmerkung: Die redaktionelle Feinformulierung des Mitglieder der Leitbildes erfolgt in aller Regel nicht während Redaktionsgruppe Veranstaltung. Grund: Die Redaktionsmitglieder brauchen Zeit zum Nachdenken. 1. Es formiert sich eine Redaktionsgruppe. Am besten wäre es, wenn im Redaktionsteam alle Gruppen vertreten wären. 2. Auf einem vorbereiteten Plakat werden die Mitarbeiter schriftlich erfasst. 3. Alle Statemants mit gleicher Farbe sollen in einer gemeinsamen Formulierung münden. 4. Die Formulierungshilfe zum Erstellen eines Leitbildes werden ausgeteilt. Die Erklärung erfolgt über Folie 9. Bedenken Sie, dass ein Leitbild nur dann wirksam ist, wenn es auf breitem Konsens der aller am Schulleben beteiligten Personengruppen beruht; Zukunftsperspektive vermittelt; begeistert; klar und verständlich formuliert ist; kurz gehalten ist; im Kopf jeden Betroffenen Platz hat: prägnant ist, damit es schnell vermittelt werden kann. Anmerkung bei Fortbildungsveranstaltung 1. Die Konsenspunkte werden evtl. vom Moderator schlagwortartig auf einem Plakatpapier festgehalten. 2. Je nach Anzahl der Konsenspunkte werden eben so viele DIN-A-3 Blätter an die Teilnehmer verteilt. 3. Die Zielformulierung erfolgt je nach Teilnehmerzahl in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit. Seite 106 75927711 4. Seite 107 Die Ziele werden an die Pinwand geheftet. 75927711 11 Abstimmung über das Leitbild der Schule (5 min) Der Moderator gibt folgende Hinweise an die Projekt- und Steuergruppe: 10/11 Folie 7 1. Das erarbeitete Leitbild wird veröffentlicht (Pinwand, Infobrief). 2. Einwände und Verbesserungsvorschläge des Kollegiums sind schriftlich innerhalb von 14 Tagen vorzutragen. 3. Die Abstimmung über das Leitbild der Schule kann über die Projektgruppe oder über das Gesamtkollegium in einer Konferenz erfolgen. 4. Das Leitbild der Schule wird dem Moderator zugesandt. 5. Die Fortsetzung des Prozesses wird anhand der Folie 8 erklärt. 12 Reflexion (30 min) Der Moderator stellt die Frage (Folie 6): „Wie haben Sie den Arbeitsprozess empfunden?“ Teilnehmer äußern sich Alternative (bei großer Teilnehmerzahl) Interne Diskussion der Gruppen über die Fragestellung 1. Nach einer gewissen Nachdenkzeit trifft sich je ein Gruppenmitglied im Fishpool. 2. Ein Stuhl bleibt frei für die externen Diskussionsteilnehmer. 3. Im Fishpool wird die Frage diskutiert, wie der Arbeitsprozess verlaufen ist. 4.1.5 Abschluss der Veranstaltung (20 min) Seite 108 75927711 10 4.1.6 Anhang Folie 1: Handlungsfelder der Schule Folie 2: Zielklärungsübung „Meine gute Schule“ Folie 3: Zielklärungsübung „Unsere gute Schule (1)“ Folie 4: Zielklärungsübung „Unsere gute Schule (2)“ Folie 5: Zielklärungsübung „Unsere gute Schule (3)“ Folie 6: Reflexion Folie 7: Wie geht es weiter? Seite 109 75927711 Handlungsfelder der Schule: 1) Unterricht 2) Erziehung 3) Beratung der Schüler/innen 4) Beurteilung der Schüler/innen 5) Normen und Regeln 6) Schulleben 7) Arbeitsklima 8) Kollegium 9) Schulleitung 10)Organisation und Verwaltung 11)Schulinterne Fortbildung 12)Außenbeziehungen Handlungsfelder des Unterrichts: 1) Planung des Unterrichts 2) Sachgemäßheit d.U. 3) Schülergemäßheit 4) Zielgemäßheit 5) Anschaulichkeit 6) Selbsttätigkeit 7) Motivation 8) Medieneinsatz 9) Erfolgssicherung 10) Erziehender Unterricht 11) Bildender Unterricht 12) Nachbearbeitung des Unterrichts Seite 110 75927711 Handlungsfelder einer umweltengagierten Schule: 1) Umweltorientiertes Lehren und Lernen 2) Müllvermeidung/Mülltrennung/Müllverwertung 3) Umgang mit Wasser 4) Reinigungsmittel 5) Unterricht- und Arbeitsmittel 6) Ernährung 7) Schulgelände/Schulbau 8) Energienutzung 9) Büroausstattung 10)Arbeitsklima Handlungsfelder der Schulleitung: 1) Motivationsformen 2) Mitarbeitergespräch 3) Informationsfluss 4) Auslastung des Personals 5) Kommunikationsverhalten 6) Konfliktverhalten 7) Menschlicher Umgang 8) Präsenz 9) Außenbeziehungen/Vertr. der Schule 10)Ablauforganisation Folie 1 Seite 111 75927711 Zielerklärungsübung: Meine gute Schule 1. Nehmen Sie sich etwa 10 leere Karten. Schreiben Sie bitte möglichst leserlich. Beschriften Sie bitte die Karten nur einseitig. Schreiben Sie auf jede Karte nur ein Statement. 2. Machen Sie sich auf den Weg zu Ihrer guten Schule. Studieren Sie alle Plakate. Notieren Sie auf jede Karte möglichst konkret je ein für Sie in diesem Moment wichtiges Merkmal Ihrer persönlichen guten Schule. Unverbindliche Formulierungsvorschläge: Wir pflegen einen intensiven Kontakt zu den Eltern. Wir Lehrer besuchen uns gegenseitig im Unterricht. Es finden regelmäßige, kurze pädagogische Konferenzen statt. Pünktlicher Unterrichtsbeginn ist für mich sehr wichtig. Folie 2 Seite 112 75927711 Zielerklärungsübung: Unsere gute Schule (1) 1. Bilden Sie nun Gruppen. Machen Sie es mit Ihrer Gruppe und Ihren Karten an einem Tisch bequem. Wählen Sie aus Ihrer Kartensammlung die fünf Karten aus, auf denen die für Sie jetzt die absolut unverzichtbaren Kennzeichen Ihrer guten Schule stehen. Diese fünf Karten sind Ihre Herz-Karten. Nehmen Sie sie in Ihre Herz-Hand. Geben Sie die anderen Karten nach rechts weiter. (Befehl: HauRuck!) 2. Sie erhalten somit von links 5 Karten. Lesen Sie diese Karten und überprüfen Sie, ob bei diesen Karten eine oder gar mehrere Karten dabei sind, die Sie mit einer Ihrer Herz-Karten (1:1) tauschen möchten. Tun Sie es gegebenenfalls! Achtung: Sie dürfen nach der Tauschaktion wiederum nur maxi- mal 5 Herz-Karten in Ihrer Herz-Hand halten! Geben Sie die anderen Karten wieder nach rechts weiter. Verfahren Sie so weiter, bis Sie einmal „durch sind“ - Sie dürfen dann am Ende maximal 5 Herz-Karten haben. 3. Legen Sie die restlichen Karten in die Mitte des Tisches „ab“. Behalten Sie Ihre 5 Herz-Karten. Folie 3 Seite 113 75927711 Zielerklärungsübung: Unsere gute Schule (2) 1. Legen Sie nun in Ihrer Gruppe alle Ihre Karten aus. Lesen Sie alle ausgelegten Karten. Fragen Sie nach, wenn Sie zum Verständnis der Karten Zusatzinformationen brauchen. 2. Suchen Sie Doppelkarten d.h. Karten, die den absolut gleichen Inhalt mit anderen Worten beschreiben. entscheiden Sie sich in Ihrer Gruppe für eine der Doppelkarten, legen Sie die andere/n unter diese Karte oder schreiben Sie eine neue Karte, die das gemeinsame Kennzeichen aller Doppelkarten am besten umschreibt. 3. Führen Sie nun in Ihrer Gruppe eine diskursive Entscheidung Entscheidung herbei über die 10 zentralen, für alle Gruppenmitglieder absolut unverzicht- baren Kennzeichen einer guten Schule; diese Karten legen Sie in der Mitte aus und die restlichen, für Sie im Moment eher peripheren - aber auch unverzichtbaren Kennzeichen einer guten Schule; legen Sie diese außen herum. Folie 4 Seite 114 75927711 Zielerklärungsübung: Unsere gute Schule (3) 1. Erstellen Sie nun gemeinsam ein „Bild von Ihrer guten Schule“. Suchen Sie ein Symbol für Ihre gute Schule. Machen Sie ein Plakat. Achten Sie darauf, dass Außenstehende Ihrem Plakat selbständig entnehmen können, welche Ihrer Kennzeichen zentral und welche peripher sind. Schmücken Sie Ihr Plakat aus - Material wird zur Verfügung gestellt. 2. Hängen Sie Ihr Plakat aus. Erläutern Sie kurz, wie Sie zu Ihrem Symbol gekommen sind; wie die Arbeit in Ihrer Gruppe verlaufen ist und wie Sie mit divergierenden Ansichten umgegangen sind. Folie 5 Seite 115 75927711 Wie haben Sie den Arbeitsprozess empfunden? Folie 6 Seite 116 75927711 Wie geht es weiter? Das erarbeitete Leitbild wird veröffentlicht (Pinwand, Infobrief)! Einwände und Verbesserungsvorschläge sind vom Kollegium schriftlich innerhalb von 14 Tagen vorzutragen! Die Abstimmung über das Leitbild der Schule kann über die Projektgruppe oder über das Gesamtkollegium in einer Konferenz erfolgen. Das Leitbild der Schule wird dem Moderator zugesandt. Folie 7 Seite 117 75927711 Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Schritte Wer? Wo? 1. Information des Kollegiums: Da gibt es ... 2. Kollegiumsbeschluss Wir wollen mehr Informationen ... 3. Informationsveranstaltung SL, LK... Schule Kollegium Schule Kollegium Ext. Begl. Ext. Begl. Projektgr. Kollegium Ext. Begl. Projektgr./ Reakt.gr. Ext. Begl. Projektgr. Schule 4. Betreuungsvereinbarung 5. Bildung einer Steuergruppe 6. Zielerklärung: SOLL-Zustand Leitbild 7. Prioritätensetzung Schulprogramm 8. Projektmanagement: Diagnose im/in den Handlungsfeld/ern des Schulprogramms Zielaufstellung Möglichkeiten Konzept als Antrag an die 9. Beschlussfassung/Umsetzung 10. Evaluation: intern u. extern Zeit 1. Sitzung 2 Std. Schule Schule nicht an der Schule Schule 2. Sitzg. Pädagog. Wochenende 3. Sitzg. Schule Qualitätszirkel (evtl. ext. Begl. LKonferen z Kollegium Schule QZ Schule e 7. neue Prioritätensetzung: Schulprogramm alle 5 - 6 Jahre: 6. Leitbild-Evaluation Projektgr. Schule Projektgr. s.o. Folie 8 Seite 118 75927711 s.o. 4.2 Vom Leitbild zum Projektmanagement (3.Sitzung) Die Steuergruppe vereinbart in Abstimmung mit dem Moderator einen Veranstaltungstermin an der Schule. Die Mitglieder der Projektgruppe werden eingeladen. Anmerkung: Der Punkt „Prioritätensetzung“ kann u.U. auch im Rahmen einer Gesamtkonferenz abgehalten werden. Alternative: siehe Veranstaltungsverlauf bei der Berufsschule Wasserburg. Vorbereitung: Plakat Schulqualität durch Schulentwicklung Steigerung der Qualität schulischer Bildung durch interne Schulentwicklungsprozesse (mit externer Begleitung) Pinwand 1 (Der Pfeil zeigt den Verlaufsfortschritt an.) Vom Leitbild zum Projektmanagement 1. Prioritätensetzung: Schulprogramm Auswahl des Leitbildziels Bildung der Qualitätszirkel 2. Projektmanagement 1. Runde: 2. Runde: 3. Runde: 4. Runde: - Arbeitsverarbeitungen treffen - Kommunikationsregeln festlegen - Ist-Analyse im ausgewählten Leitbild - Detaillierte Zielformulierung - Sammeln positiver Folgen - Viele Möglichkeiten der Umsetzung finden - Ein klares Konzept der Umsetzung erstellen Es ist darauf zu achten, dass nur das in den Gruppen bearbeitet wird, was als konkrete Aufgabenstellung ausgegeben wird! Gruppenräume mit Gruppennummern versehen. Seite 119 75927711 Pinwand 2 (Beispiel) Unser Leitbild Seite 120 Leitbild 1 Wir wollen eine ansprechende, lernfördernde Umgebung gestalten! Leitbild 2 Wir wollen an unserer Schule menschlichen Umgang pflegen! Leitbild 3 Wir wollen uns gegenseitig motivieren! Leitbild 4 Wir wollen dem Schüler Wissen und Fähigkeiten vermitteln, damit er den beruflichen und privaten Anforderungen gerecht werden kann! Leitbild 5 Wir wollen an der Schule die bestmögliche Ausbildung bieten! Leitbild 6 Wir wollen, dass sowohl Kollegen als auch Schüler stolz darauf sind, an der Berufsschule Wasserburg zu sein! 75927711 4.2.1 Begrüßung, Vorstellung des Tagungsprogramms, Reflexion (20 min) Vorbereitung: (1) Folie: Blitzlicht (2) Pinwand 2: Vom Leitbild zum Projektmanagement Anmerkung: Evtl. beginnt die Veranstaltung zur Einstimmung mit einem Stehkaffee. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Helm und ich begrüßen Sie zu Ihrem Schulentwicklungstag und heißen Sie hier herzlich willkommen. Der heutigen Veranstaltung gingen bereits mehrer Treffen voraus: Wir führten mit der Schulleitung, den Fachbetreuern und dem Personalrat eine erste Informationsveranstaltung durch. In der zweiten Informationsveranstaltung stellten wir Ihnen, den Lehrkräften der Schule, unser Schulentwicklungskonzept vor. Dann erstellten Sie mit uns das Leitbild Ihrer Schule. Und nun folgt der nächste Schritt (Sie haben das Veranstaltungsprogramm für den heutigen Tag bekommen?) Pinwand 1: Vom Leitbild zum Projektmanagement (Der Pfeil zeigt den Verlaufsfortschritt an.) Das Thema der heutigen Veranstaltung heißt: Vom Leitbild zum Projektmanagement. Es gliedert sich in die Bereiche „Prioritätensetzung - Schulprogramm“ und „Projektmanagement“. Bei der Prioritätensetzung geht es um die Auswahl eines Leitbildzieles, das Ihr Schulprogramm für die nächste Zeit sein wird. Zu diesem erstellen Sie dann in Gruppen Vorschläge zu einem konkreten Umsetzungskonzept. Dies erfolgt mittels Projektmanagements, d. h. die Lösung des Problems erfolgt in Teilschritten. In der Runde 1. findet ... (vorlesen) Die gewonnenen Arbeitsergebnisse muss dann noch ein zu bildender Arbeitskreis selektieren, bündeln und redaktionell aufarbeiten. Später entscheiden Sie in einer Gesamtkonferenz, ob dieses Umsetzungskonzept ihr Schulprogramm für die nächst Zeit sein wird. Seite 121 75927711 (Das uns zur Verfügung stehende Zeitfenster ist sehr knapp bemessen.) Wenn keine unvorgesehenen Probleme auftreten, gehen wir bei zügiger Arbeit davon aus, dass das vorgesehene Tagespensum zu leisten ist. Gibt es zum Veranstaltungsverlauf Fragen? Seite 122 75927711 Mittlerweile steht das Leitbild Ihrer Schule. Sie haben Zeit gehabt sich in Ruhe darüber Gedanken zu machen. Die Frage an Sie lautet: Folie: „Wie zufrieden bin ich mit dem Leitbild meiner Schule?“ Evtl. Murmelgruppen bilden Tauschen Sie sich über die Frage in 3er-Gruppen, also mit Ihren unmittelbaren Nachbarn aus. Sie haben dafür ca.10 Minuten Zeit. Diskussion Möchte jemand seine Überlegungen dem Plenum vortragen? (Teilnehmer melden sich, Diskussion kurz halten und nicht ausufern lassen) Seite 123 75927711 Wie zufrieden bin ich mit dem Leitbild meiner Schule? Seite 124 75927711 4.2.2 Prioritätensetzung: Schulprogramm (30 min) Es geht nun darum, aus dem gemeinsam erarbeiteten Leitbild das Schulprogramm abzuleiten. Beim einem Schulprogramm handelt es sich um eine klare schriftliche Ausformulierung eines Ziels aus dem Leitbild, das in etwa einem Schuljahr umgesetzt werden soll. Sie werden jetzt entscheiden, welches Leitbildziel als erstes in die Praxis umgesetzt werden soll. Vorbereitung: - (1) Gruppenräume bzw. – tische nummerieren - (2) Pinwand 2: DIN-A3-Blätter mit den Leitbildzielen (evtl. Simulation Pestalozzischule) - (3) Klebepunkte: 3er-Streifen - (4) Folie 1: Arbeitsauftrag - (5) Programmblatt bei Zufallsgruppen - (6) evtl. Pinwände 3 Anmerkungen: Es muss im Vorfeld geklärt werden, wie und wo die Arbeitsgruppen installiert werden sollen, z.B.: fachbereichsübergreifend oder fachbereichsspezifisch / mit oder ohne Mitarbeit der Steuerungsgruppe in den Qualitätszirkeln. Arbeitet ein Mitglied der Steuerungsgruppe in einem Qualitätszirkel mit, besteht u. U die Gefahr, dass die anderen Gruppenmitglieder zu wenig Verantwortung übernehmen. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe können sich temporär in die Gruppen einbringen. Bei Fortbildungsveranstaltungen wird u.U. bei einem Quereinstieg das Leitbild der Pestalozzischule simuliert. Veranstaltungsverlauf über einen Pfeil an Pinwand 1 anzeigen. Nr. Methode / Schritt 1 Auswahl eines Leitbildzieles / mehrer Leitbildziele Verlauf Die Leitbildziele an der Pinwand 2 werden vorgelesen. Evtl. Hinweis Empfehlenswert ist es am Anfang, diejenigen Ziele auszuwählen, die sich am schnellsten umsetzten lassen, nicht dasjenige, das für die Schule das größte Problem darstellt (Prinzip der kleinen Schritte). Natürlich können Sie, wenn Sie wollen, die Pfanne auch an der heißesten Stelle anfassen. An jedes Mitglied der Projektgruppe werden 3 Klebepunkte verteilt. Arbeitsauftrag (Folie 1): „Schreiben Sie auf die Klebepunkte die Nummern von den Leitbildzielen, von denen Sie sich persönlich den meisten Gewinn für Ihre Seite 125 75927711 Anlage 2/3/4 berufliche Tätigkeit als Unterrichtender und Erziehender versprechen! – Häufeln ist möglich.“ Evtl. Hinweis Die Nummerierung an dieser Stelle ist deshalb wichtig, damit später bei der Bepunktung wirklich die Sache im Mittelpunkt steht und man sich nicht vom Teilnehmerkreis beeinflussen lässt. Die Teilnehmer kleben die Punkte an die von ihnen ausgewählten Leitbildziele. Die Abstimmungsergebnisse werden auf den Applikationen notiert. Welches Leitbildziel soll nun für den nächsten Zeitraum (z.B. 1 Jahr) zum Schulprogramm erhoben werden? Konfuzius sagte: „Wer zwei Hasen fangen will, fängt keinen.“ Danach wäre es ratsam, die Energien auf ein Ziel zu konzentrieren und nicht an mehreren gleichzeitig zu arbeiten. Das hier am höchsten gepunktete Ziel ist das Leitbildziel Nr. ... Zweiter Sieger ist das Leitbildziel Nr. ... Stimmen Sie jetzt bitte per Hand ab, ob Sie ein Leitbildziel umsetzten wollen oder zwei! Abstimmung! Wer ist ...? Das Abstimmungsergebnis wird an der Pinwand 2 festgehalten. Anmerkung: Die Entscheidung, ob evtl. doch zwei oder mehrere Leitbildziele umgesetzt werden sollen, trifft die Projektgruppe. Liegt bei zwei Leitbildern die gleiche Punktezahl vor, dann wirbt je ein Vertreter einer Gruppe mit einem Kurzreferat für die Umsetzung seines Leitbildzieles. Anschließend wird über die beiden Leitbildziele nochmals abgestimmt. Kommt auch jetzt keine Einigung zustande, wird das Losverfahren vorgeschlagen. Seite 126 75927711 2 Bildung der Qualitätszirkels Anmerkung 5/6 In einem Vorgespräch muss geklärt werden, ob die Mitglieder der Steuerungsgruppe in den Qualitätszirkeln mitarbeiten wollen. Auch muss geklärt werden, wie sich die Gruppen zusammensetzten sollen. Die Projektgruppe formiert sich zu Qualitätszirkeln mit maximal 8 Teilnehmern. Nun müssen für die späteren Arbeit Arbeitskreise, also Qualitätszirkel installiert werden. Möglichkeit I (Regelfall): - 1 Leitbildziel ausgewählt - mehrere themengleiche (Unter-) Qualitätszirkel Möglichkeiten der Gruppenbildung: 1) Bildung von Zufallsgruppen Das Programmblatt wird an alle Teilnehmer verteilt. Die Rückseite hat der Moderator mit Gruppennummern versehen. Vorteil: Mixgruppen über die Fachbereiche hinweg haben den Vorteil, dass viele Ideen und Meinungen in den Gruppenprozess einfließen, Klüngelgruppen werden aufgebrochen. 2) Bildung von Fachbereichsgruppen Die Lehrkräfte der Fachbereiche werden aufgefordert Fachbereichsgruppen zu bilden. Die Gruppenstärke sollte 8 Teilnehmer nicht übersteigen. Vorteil: Teilnehmer kennen sich gut, die Belange der einzelnen Fachbereiche werden stärker bedacht, die Umsetzungschancen in den Fachbereichen steigen. 3) Bildung von freien Gruppen Die Lehrkräfte werden aufgefordert z.B. 5 Gruppen mit maximal je 8 Teilnehmern zu bilden. Vorteil: Seite 127 75927711 Die freie Wahl der Gruppenmitglieder kann den Arbeitsprozess positiv (aber auch negativ) beeinflussen. Möglichkeit 2 (Sonderfall): - mehrere Leitbildziele ausgewählt - mehrere themengetrennte Qualitätszirkel Möglichkeit der Gruppenbildung: Die Leitbildziele werden an verschieden Stellen im Raum angebracht. Je nach Interesse ordnen sich die Teilnehmer den Applikationen zu. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gruppenstärke 8 Personen nicht übersteigen sollte. Ggf. werden zu einem Leitbildziel mehrer Gruppen gebildet. Möglichkeit 3 (Sonderfall): - 1 Leitbildziel ausgewählt - nur 1 Qualitätszirkel Möglichkeit der Gruppenbildung: Jeder Anwesende der Projektgruppe bekommt vom Moderator einen kleinen Klebestreifen, auf dem er seinen Namen schreibt. Wer in dem Qualitätszirkel arbeiten möchte, bringt auf der Applikation sein Namenskärtchen an. Wer nicht in dem Qualitätszirkel arbeiten möchte, heftet sein Namenskärtchen neben die Applikation. Anmerkung: Anschließend wird die Projektgruppe entlassen und der Qualitätszirkel geht über zum nächsten Schritt, dem Projektmanagement. Es wäre sinnvoll, wenn ein Mitglied der Steuergruppe, z. B. der Schulkoordinator mit anwesend wäre, damit er den nachfolgenden Moderationsprozess verfolgen kann, um diesen dann ggf. einmal später selbst moderieren zu können. Möglichkeit 4 (Fortbildungsveranstaltung): (z.B. Simulation der Pestalozzischule) Seite 128 Jeder Anwesende der Projektgruppe be75927711 kommt vom Moderator einen kleinen Klebestreifen, auf dem er seinen Namen schreibt. Anschließend klebt er diesen Klebestreifen auf das Leitbildziel, das er gerne umgesetzt haben möchte. Um arbeitsfähige Gruppen zu erzielen müssen u. U. die großen Gruppen verkleinert und die kleinen Gruppen zahlenmäßig vergrößert werden. Bei wenigen Anheftungen, z.B. zwei, wirbt diese Gruppe über ein Kurzreferat um einen Gruppenwechsel. Die Ideen der einzelnen Qualitätszirkel soll später ein noch zu bildender Hauptqualitätszirkel redaktionell zusammenfassen. Dort sollte mindestens ein Vertreter der jetzt gebildeten Unterqualitätszirkel vertreten sein. Seite 129 75927711 Arbeitsauftrag Schreiben Sie auf die Klebepunkte die Nummern von Leitbildzielen, von denen Sie sich persönlich den meisten Gewinn für Ihre berufliche Tätigkeit als Unterrichtender und Erzieher versprechen! Häufeln ist möglich! Folie 1 Seite 130 75927711 Programm Vom Leitbild zum Projektmanagement 1. Prioritätensetzung: Schulprogramm Auswahl des Leitbildziels Bildung der Qualitätszirkel 2. Projektmanagement 1. Runde: 2. Runde: 3. Runde: 4. Runde: - Arbeitsverarbeitungen treffen - Kommunikationsregeln festlegen - Ist-Analyse im ausgewählten Leitbild - Detaillierte Zielformulierung - Sammeln positiver Folgen - Viele Möglichkeiten der Umsetzung finden - Ein klares Konzept der Umsetzung erstellen Es ist darauf zu achten, dass nur das in den Gruppen bearbeitet wird, was als konkrete Aufgabenstellung ausgegeben wird! Programm Vom Leitbild zum Projektmanagement 1. Prioritätensetzung: Schulprogramm Auswahl des Leitbildziels Bildung der Qualitätszirkel 2. Projektmanagement 1. Runde: 2. Runde: 3. Runde: 4. Runde: - Arbeitsverarbeitungen treffen - Kommunikationsregeln festlegen - Ist-Analyse im ausgewählten Leitbild - Detaillierte Zielformulierung - Sammeln positiver Folgen - Viele Möglichkeiten der Umsetzung finden - Ein klares Konzept der Umsetzung erstellen Es ist darauf zu achten, dass nur das in den Gruppen bearbeitet wird, was als konkrete Aufgabenstellung ausgegeben wird! Seite 131 75927711 Pinwände 3 Möglichkeit 1: - 1 Leitbildziel - mehrere Qualitätszirkel Schulprogramm Leitbild 2 Wir wollen an unserer Schule menschlichen Umgang pflegen! ----------------------------... Unterqualitätszirkel QZ 2/1 - QZ 2/2 - QZ 2/3 - Hauptqualitätszirkel QZ 2 - Möglichkeit 2: mehrer Leitbildziele / mehrere Qualitätszirkel Schulprogramm Leitbild 2 Wir wollen an unserer Schule menschlichen Umgang pflegen! ----------------------------... Leitbild 5 Wir wollen an der Schule die bestmögliche Ausbildung bieten! ---------------------------... Erarbeitung Unterqualitätszirkel QZ 2/1 - QZ 2/2 - Unterqualitätszirkel QZ 2/3 - QZ 5/1 - Hauptqualitätszirkel QZ 2 - Seite 132 QZ 5/2 - Hauptqualitätszirkel Umsetzung 75927711 QZ 5 - Möglichkeit 3: - 1 Leitbildziel - 1 Qualitätszirkel Schulprogramm Leitbild 2 Wir wollen an unserer Schule menschlichen Umgang pflegen! ----------------------------... Qualitätszirkel Seite 133 75927711 4.2.3 Projektmanagement (160 min) Vorbereitung: - (1) Kärtchen, Arbeitsblätter und die Sammelmappe zur Erledigung der Arbeitsaufgaben werden an den Gruppentischen verteilt. - (2) Arbeitsblatt „1. Runde“ = Folie 1a oder Folie 1aa - (3) Infoblatt „Hilfen für die Befragung“ = Folie 1b - (4) Arbeitsblatt: „2. Runde“ = Folie 1c - (5) Arbeitsblatt „3. Runde“ = Folie 1d - (6) Arbeitsblatt: 4. Runde“ = Folie 1e - (7) Methodenblatt zur 3. und 4. Runde = Folie 2 - (8) Folie 3a: theaterpädagogische. Übung, Folie 3b/ Arbeitsblatt: Einfache Übungen zur ... - (9) Folie 4/Applikation: Morgenstern, .. . - (10) Folie 5: Reflexion - (11) Folie 6: operationalisierbares Ziel - (12) Evtl. leere Folien Achtung: Für die Arbeitsrunden werden klare Zeiten vorgegeben. Es ist nicht weiter bedenklich, wenn eine der arbeitsgleichen Gruppen ihr Arbeitspensum nicht schafft, da der Hauptqualitätszirkel sowieso alle Arbeitsergebnisse zusammenfasst. Hinweis, dass immer eine Methode auf dem Methodenblatt eingesetzt werden soll. Der Qualitätszirkel /die Qualitätszirkel erstellt / erstellen nun über das Projektmanagement ein Handlungskonzept zur Umsetzung des gewählten Leitsatzes. Mit dem Begriff „Projektmanagement“ wird eine Vorgehensweise beschrieben, bei der eine komplexe Problemstellung entflochten und in besser planbare Teilaufgaben gegliedert wird. Nr. Methode / Schritt 1 Erklärung des Projektmanagements (15 min) Verlauf Bei unserem Projektmanagement sind vier Runden mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen zu durchlaufen. Mittels Folien 1a/b/c/d/e und der Pinwand 2 wird ein Überblick über die Vorgehensweise gegeben. Sollten Ihnen die Arbeitsaufträge einmal nicht klar sein, so bitte ich, dass der Gruppensprecher mit uns Rücksprache nimmt. Bewusst haben wir einige der Arbeitsauftrage „allgemein“ gefasst. Damit wollen wir erreichen, dass die Gruppe von uns nicht über Gebühr gegängelt wird. Wir erhoffen uns davon ein mehr an kreativen Lösungen. Erarbeiten sie in der Gruppe nicht mehr als der Arbeitsauftrag von Ihnen verlangt. Denken Sie immer an die folgenden Runden. Seite 134 75927711 Anlage 1 2/4/5/6 Evtl. Hinweis, wenn keine Kommunikationsregeln aufgestellt werden Es heißt „Schweigen ist Silber und miteinander Sprechen muss gelernt sein.“ Wir gehen davon aus, das Sie alle untereinander teamfähig sind. Sie müssen sich nicht lieben, aber Sie sollten schon die Fähigkeit besitzen fachlich miteinander zu kommunizieren. Deshalb verzichten wir jetzt auch darauf, mit Ihnen Normen für die Gruppenarbeit zu vereinbaren. Beachten Sie bei der Gruppenarbeit noch Folgendes: Schreiben Sie Ihre Arbeitsergebnisse gut leserlich nieder. Stecken Sie nach jeder Gruppenarbeit die Arbeitsergebnisse in die vorgesehene Sammelmappe (zeigen) Seite 135 75927711 2 Runde 1 Arbeitsvereinbarungen treffen IST-Analyse (mind. 45/60 min) Das Arbeitsblatt „Runde 1“ wird an den Qua- 2/3 litätszirkel ausgeteilt nochmals über die Folie 1a (oder Folie 1a/a) kurz erläutert. 1. Zunächst besprechen Sie in der Gruppe die Organisation Ihrer Arbeit.... 2. „Schweigen ist Silber, doch miteinander zu reden muss gelernt sein.“ Deshalb sollen Sie sich bei Punkt 2 die Zeit nehmen gemeinsam 5 Kommunikationsregeln aufzustellen, die Sie bei der Gruppenarbeit einzuhalten gedenken. (Folie) Schreiben Sie die Regeln auf dieses Blatt. (Folie) Hilfestellung erhalten Sie von uns über das Blatt 11 Minusregeln. (beide Blätter austeilen) Anmerkung Punkt 2 kann ggf. entfallen (dann Folie 1a) Wenn Arbeitsvereinbarungen bereits getroffen wurden: Die zu Beginn des Prozesses ausgehandelten Kommunikationsvereinbarungen besitzen Gültigkeit. Das Plakat über die Arbeitsvereinbarungen wird neben den Gruppentisch angebracht. 3. „Die Selbstbewertung ist der Motor für Verbesserungen des IST-Zustandes im ausgewählten Handlungsfeld.“ Deshalb sollen Sie sich in Punkt 2/3 Gedanken darüber machen, wie Sie im ausgewählten Handlungsfeld eine Diagnose durchführen können. Mit den Ergebnissen der Befragung, die Sie demnächst durchführen sollen, erhalten Sie weitere Anregungen zu Ihrer heutigen Arbeit. Seite 136 Sie als Teilgruppe des Kollegiums haben durch die Zielformulierung bereits festgelegt, dass im ausgewählten Handlungsfeld Handlungsbedarf besteht, sonst hätten Sie dieses Ziel nicht formuliert. Durch die Umfrage wollen Sie nun erfahren, wie nun die anderen an der Schule den IST - Zustand im ausgewählten Handlungsfeld einschätzen. Ihre These, dass hier etwas getan werden muss findet hier höchstwahrscheinlich die Bestätigung. 75927711 Des weitern bekommen Sie durch die Umfrage zusätzliche Informationen zu dem gewünschten SOLL - Zustand. Kurzum, Sie wollen erfahren, was getan werden soll, um den Ist-Zustand zu verbessern. Weiterhin bekommen Sie Vorschläge, wie dieser Soll-Zustand nach Meinung anderer erreicht werden könnte. Dieses Ideenpotential sollten Sie unbedingt nutzen. Sinn und Zweck der Befragung soll also sein, dass Sie weitere Anregungen für Ihre heutige Arbeit erhalten. Mit den Daten der Umfrage können Sie Ihre Arbeitsergebnisse noch sinnvoll ergänzen und optimieren. Es ist nicht notwendig erst dann weiterzuarbeiten, wenn die Umfrageergebnisse vorliegen. Sie haben nur einen Ergänzungscharakter zu Ihren Ideen und zu Ihren Vorschlägen. Als Hilfestellung erhalten Sie von uns das Infoblatt „Fragestellungen“ (austeilen und evtl. über Folie 1b erläutern) Halten Sie Ihren Fragekatalog kurz, denn es soll wissenschaftlich erwiesen sein, dass Fragebögen, die zum Ausfüllen mehr als 10 Minuten Zeit benötigen, nicht mehr objektiv von den Befragten ausgefüllt werden. Auch gibt eine Befragung nicht in jedem Fall Sinn. Wenn z.B. die Datenlage offensichtlich ist, braucht man keine Umfrage mehr. Gruppenarbeit 1. Schritt: Zunächst bespricht die Gruppe die Organisation ihrer Arbeit. 2. Schritt: Dann erstellt der Qualitätszirkel unter Zuhilfenahme des ausgeteilten Befragungsmusters einen Fragebogen zu dem gewählten Leitsatz. Plenum Die Fragebogenaktion soll in nächster Zeit an der Schule (vom noch zu bildenden Hauptqualitätszirkel) durchgeführt werden. Anschließend werSeite 137 75927711 den die Daten ausgewertet. Die negativen Bewertungen formulieren Sie später in positive Ziele um, die Sie dann bei der Umsetzung berücksichtigen sollen. Das Ergebnis der Umfrage soll allen Lehrkräften über eine Infotafel zugänglich gemacht werden. Anmerkung: Man macht häufig schlechte Erfahrungen mit der Übernahme von Fragebögen. Seite 138 75927711 3 Runde 2 Zielformulierung (30 min) Damit kommen wir zur Runde 2, der Zielformulierung. Dabei gilt: „Ein Ziel ist schon halb erreicht, wenn es klar formuliert ist.“ Das Arbeitsblatt „Runde 2“ wird ausgeteilt und nochmals besprochen (Folie1c). Zum 1. Schritt: Formulieren Sie zu dem ausgewählten Leitbildziel eines oder mehre operationalisierbare Ziele, die möglichst spezifisch, messbar, kontrollierbar, erreichbar, positiv formuliert, aktuell, zeitlich gegliedert, verlockend und akzeptierbar sind. Ein Beispiel wird vorgelesen (Folie 6). Anmerkung: In dieser Phase müssen die oft üblichen „Aktionsbremser“ zurückgewiesen werden, bekannt durch Formulierungen wie „Das geht doch eh nicht!“, „Das machen wir doch schon!“, „Das habe wir schon tausendmal erfolglos versucht!“ Zum 2. Schritt: Das Motto des zweiten Schrittes heißt: „Was nützt es uns, gerade dieses Projekt umgehend zu verwirklichen?“ Machen Sie sich hierüber Gedanken. Für diesen Arbeitsschritt bieten sich die folgenden Methoden an: Methodenblatt austeilen. Mittels Folie 2 werden die Methoden erklärt. Vorschläge: 1. Zettelumlaufmethode Jedes Gruppenmitglied notiert sich auf einem Kärtchen einen Gedanken, der ihm gerade einfällt. Mit dem Befehl Hau-Ruck wird das Kärtchen an den rechten Partner weitergegeben. Jeder schreibt nun ein weiteren Gedanken unter dem Ersten. Die Notizzettel werden so lange weitergereicht, bis er sich der Vorgang totläuft. 2. Zurufmethode Die Zurufe der Gruppenmitglieder werden no- Seite 139 75927711 4/7/11 tiert. 3.Mindmap Die Wahl der Kreativitätsmethode bleibt Ihnen überlassen. Die gesammelten positiven Folgen werden nun von der Gruppe ausgewertet. Dazu werden die Argumente gesammelt, verglichen, bewertet und vom Protokollführer niedergeschrieben. Anmerkung: Ziel der Methode ist es, aus den vorausgegangenen Argumenten Anregungen für neue kreative Lösungen zu finden. Wichtig ist, dass die Gruppen die Methoden auch einsetzen. Das schriftliche Ergebnis führt klar vor Augen, dass es sich lohnt, das Projekt anzugehen. Die Gruppenleitung sollte jemand übernehmen, der bereits Erfahrungen mit diesen Methoden gemacht hat. Gruppenarbeit Die Gruppen führen die beiden Arbeitsaufträge durch. Seite 140 75927711 4 Runde 3 Möglichkeiten der Umsetzung (30 min) Plenum Evtl. Übung1: Folie 4 Das nachfolgende Verfahren wird vorab erklärt, danach werden die Plakate der Reihe nach gezeigt. Sprechen Sie mir bitte lautiernd nach: Abendstern Morgenstern Fixstern (Zwerg)elstern Treffen Sie eine Schlussfolgerung! Antwort: Eingefahrene Gleise kann man nur schwer verlassen. Evtl. Übung 2: Folie 3a/3b Um den Kolleginnen und Kollegen von ihren „Scheren im Kopf“ zu befreien, bietet sich zur Vorbereitung der Sammelphase eine theaterpädagogische Übung zur Freisetzung kreativer und divergierender Denkprozesse an. Alternativ können auch die „Einfachen Übungen zur Förderung der Kreativität“ von den Teilnehmern (evtl. in der Pause) bearbeitet werden. Bei der Runde 3 steht die praktische Umsetzung des von Ihnen erstellten Zieles auf dem Programm. Denken Sie das „Unmögliche“ und sagen Sie nicht gleich, „Das geht an unserer Schule doch nicht.“ Ein weitere Schlagwort zu dieser Runde heißt „Quantität geht vor Qualität“. Arbeitsblatt „Runde 3“ wird ausgeteilt und nochmals besprochen (Folie 1d). Folie 2: Bei diesem Arbeitsauftrag können Sie die selben Methoden einsetzten wie schon bei der Runde 2. Gruppenarbeit Die Gruppe sammelt möglichst viele Möglichkeiten und Unmöglichkeiten zur Umsetzung des Zieles Die Ergebnisse werden ausgewertet und auf dem Arbeitsblatt erfasst. Anmerkung: Gerade in dieser Arbeitsphase schlagen die früher schon erwähnten „Denkhemmer“ oft gnadenlos zu! Sämtliche Einwände bezüglich der Seite 141 75927711 5/7/8/9 Umsetzbarkeit der Ideen werden in dieser Arbeitsphase zurückgewiesen. Seite 142 75927711 5 Runde 4 Konzepterstellung (45 min) Plenum 6/12 In der letzten Runde des Projektmanagement sollen Sie ein Konzept zur konkreten Umsetzung des von Ihnen formulierten Feinzieles erstellen. Das Motto lautet hier: „Ziele helfen. Pläne helfen Ziele zu verwirklichen“ Arbeitsblatt „Runde 4“ wird ausgeteilt und nochmals besprochen (Folie 1e). Erstellen Sie mit Hilfe der Ideensammlungsmethode ein kleinschrittiges Konzept zur Umsetzung des Ziels unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen. Das Konzept soll darüber Auskunft geben, was nun - der Reihe nach, - von wem (Personalschiene), - wie (Methodenschiene) und - bis wann (Zeitschiene) gemacht werden muss, um das definierte Ziel in der geplanten Zeit zu erfüllen. Dabei berücksichtigen Sie insbesondere auch die Kosten (Kostenschiene), die die Umsetzung erfordert. Gruppenarbeit Der Arbeitsauftrag wird von der Gruppe ausgeführt. Das Ergebnis wird auf Folie oder einem Plakat festgehalten. 6 Reflexion (15 min) Seite 143 Plenum Der Moderator stellt die Frage (Folie 5): „Wie haben Sie den Arbeitsprozess empfunden?“ Teilnehmer äußern sich im Rahmen eines Blitzlichtes. 75927711 10 4.2.4 Anhang Folie 1a: Runde 1 Folie 1a/a Runde 1 mit Arbeitsvereinbarungen Folie 1b: Hilfen für schriftliche Befragungen Folie 1c: Runde 2 Folie 1d: Runde 3 Folie 1e: Runde 4 Folie 2: Methodenblatt Folie 3a: Theaterpädagogische Übung Folie 3b: Einfache Übungen zur Förderung der Kreativität Folie 4: Morgenstern, ... Folie 5: Blitzlicht Folie 6: operationalisierbares Ziel Seite 144 75927711 1. Runde: Projektmanagement Vergessen Sie bitte nie: Im Zielpunkt Ihrer Überlegungen zur Umsetzung Ihres Schulprogramms muss immer der Schüler/die Schülerin stehen. Arbeitsaufträge für den Qualitätszirkel 1. Sprechen Sie in Ihrer Gruppe zuerst darüber, wie Sie miteinander arbeiten wollen: mit (fest, wechselnd) oder ohne Leitung Protokollführung (fest, wechselnd) Zeitstruktur ... 2. Diagnose im ausgewählten Handlungsfeld. Erarbeiten Sie eine Befragung zu dem gewählten Leitsatz: Entscheiden Sie gemeinsam wen Sie befragen wollen, wie Sie befragen wollen und welchen Umfang Ihre Befragung haben soll. Berücksichtigen Sie dazu die „Hilfestellungen“ und die „Befragungsmuster“ . Ziele Ihrer Befragung: Sie wollen herausbringen, wie die von Ihnen Befragten das Handlungsfeld (vertreten durch den gewählten Leitsatz) derzeit sehen/einschätzen/bewerten (IST-Zustand), wie dieses Handlungsfeld ihrer Meinung nach im Idealfall „aussehen“ sollte (SOLL-Zustand) und welche Vorschläge die befragten Personen zu dessen Weiterentwicklung (zu diesem SOLL-Zustand hin) haben. Folie 1a Seite 145 75927711 1. Runde: Projektmanagement Vergessen Sie bitte nie: Im Zielpunkt Ihrer Überlegungen zur Umsetzung Ihres Schulprogramms muss immer der Schüler/die Schülerin stehen. Arbeitsaufträge für den Qualitätszirkel 1. Sprechen Sie in Ihrer Gruppe zuerst darüber, wie Sie miteinander arbeiten wollen: mit (fest, wechselnd) oder ohne Leitung Protokollführung (fest, wechselnd) Zeitstruktur ... 2. Einigen Sie sich in der Gruppe auf 5 Plus-Regeln der Kommunikation, die Sie in den folgenden Arbeitssitzungen ohne jede Abstriche bereit sind einzuhalten. Die 11 Minus-Regeln geben Ihnen Hilfestellung. 3. Diagnose im ausgewählten Handlungsfeld. Erarbeiten Sie eine Befragung zu dem gewählten Leitsatz: Entscheiden Sie gemeinsam wen Sie befragen wollen, wie Sie befragen wollen und welchen Umfang Ihre Befragung haben soll. Berücksichtigen Sie dazu die „Hilfestellungen“ und die „Befragungsmuster“ . Ziele Ihrer Befragung: Sie wollen herausbringen, wie die von Ihnen Befragten das Handlungsfeld (vertreten durch den gewählten Leitsatz) derzeit sehen/einschätzen/bewerten (IST-Zustand), wie dieses Handlungsfeld ihrer Meinung nach im Idealfall „aussehen“ sollte (SOLL-Zustand) und welche Vorschläge die befragten Personen zu dessen Weiterentwicklung (zu diesem SOLL-Zustand hin) haben. Folie 1a/a Seite 146 75927711 Hilfen für schriftliche Befragungen zum Zwecke der IST-Analyse I. Überlegungen zum Entwurf: 1. Grundsätzlich: - Weniger ist oft mehr! - Heiße Fragen nicht umgehen! - Rückschlüsse von Frage zu Personen möglichst vermeiden! 2. Was will/muss ich unbedingt wissen - was geht mich nichts an? 3. Auf Eindimensionalität achten: Nur eine Frage! Die Frage so formulieren, dass ich auch auf sie (und nichts anderes) eine Antwort bekomme. 4. Welche Antworten wähle ich? (Beispiele siehe unten) Wenn unterschiedliche Formen gleichzeitig, an die Auswertung denken! 5. Wie streng formal soll/darf der Fragebogen sein, um die Befragten nicht zu „verschrecken“. Layout des Fragebogens beachten! 6. Hilfen für das Ausfüllen nötig? Hinweise zu Beginn Hinweise einstreuen II. Einige Beispiele für Antwortmöglichkeiten 1. Skalierte Fragen sind bevorzugt anzuwenden für Fragen zur Einstellung. TN beantworten die Frage durch ein Kreuz auf der Einschätzskala. B „Von der Schulleitung gehen regelmäßig Innovationen aus trifft nicht zu -2 -1 0 +1 +2 trifft zu Polaritätsprofil B „Die Schulleitung überträgt mir genug 1 2 3 4 5 6 Verantwortung“ 2. Entscheidungsfragen sind sinnvoll bei Fragen nach schlichten Fakten. TN kreuzt ja oder nein (oder weiß nicht) an. B „Sind Sie Mitglied in einem schulinternen Arbeitskreis?“ ja nein 3. Multiple-Choise-Fragen sind Faktfragen mit Inhaltsvorgabe: TN kreuzt an, Mehrfachmöglichkeiten berücksichtigen, evtl. Platz für Ergänzungen einbauen. B „Welches sind die von Ihnen in diesem Schuljahr unterrichteten Fächer?“ Deutsch/ Sozialkunde/ Fachrechnen/ ... 4. Offene Antworten Inhaltsanalytisches Verfahren, an die Auswertung denken, gezielte Fragen stellen. B „Schreiben Sie bitte auf, was Ihnen an der Maßnahme x gefallen bzw. nicht gefallen hat!“ Mir hat gefallen: .......................... Mir hat nicht gefallen: ......................... Folie 1b Seite 147 75927711 2. Runde: Projektmanagement Arbeitsaufträge für den Qualitätszirkel 1.Formulieren Sie gemeinsam und sehr detailliert Ihr Arbeitsziel - abgeleitet aus dem von Ihnen gewählten Leitsatz (Schulprogramm) Ihres Leitbildes. 2.Sammeln und notieren Sie die möglichen positiven Folgen für die Schule /verschiedenen Betroffenen für den Fall, dass Ihr Ziel umgesetzt worden ist. Motto: Was nützt es uns, das Projekt zu verwirklichen? Folie 1 c Seite 148 75927711 3. Runde: Projektmanagement Arbeitsauftrag für den Qualitätszirkel Sammeln Sie (möglichst) viele Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung des von Ihnen formulierten Zieles. Nehmen Sie Ihre „Schere aus dem Kopf“! Dabei gelten die Grundsätze: Quantität vor Qualität! Seien wir Realisten - denken wir das Unmögliche! Folie 1d Seite 149 75927711 4. Runde: Projektmanagement Arbeitsauftrag für den Qualitätszirkel Erstellen Sie ein detailliertes Konzept zur Umsetzung: Formulieren Sie dazu einen Antrag an die Gesamtkonferenz, der mindestens folgende Angaben enthält: Thema Ziel(e) Nutzen/positive Folgen Zeitlicher Verlauf Rahmenbedingungen: personell, finanziell etc. Evaluationsmöglichkeit(en) Beteiligte etc. Denken Sie daran: Pläne helfen, Projekte zu verwirklichen! Aktivitäten?, Kosten?, Was?, Wie?, Methodenschiene?, Widerstände?, Ziel?, Wann?, Womit?, Nr.?, Terminkoordination?, Wo?, Referent?, Team?, Bemerkung?, Wer?, Kosten?, Verantwortlicher?, Struktur des Planes?, Wie prüfen?, Datum?, Warum?, Wer mit Wem?, Konflikte?, Personalschiene?, Maßnahme?, negative Folgen?, ... Folie 1e Seite 150 75927711 Methodenblatt zur Runde 2, 3 und 4 Möglichkeiten für eine Ideensammlung 1. Zettelumlaufmethode (Brainwriting) Jedes Gruppenmitglied trägt auf einem Kärtchen je eine Idee zur Lösung des Problems ein. Mit dem Befehl „Hau-Ruck“ werden die Kärtchen an den rechten Partner weitergereicht. Jetzt wird ein weiterer Gedanke unter dem ersten angefügt. Die Kärtchen werden so lange weitergereicht, bis er sich der Vorgang totläuft. Anschließend werden alle Einfälle auf den Kärtchen gesichtet, geordnet, zusammengefasst und vom Protokollführer auf einem Blatt protokolliert. 2. Zurufmethode (Brainstorming) Ideen werden spontan, d. h. ohne Kommentar von den Gruppenmitgliedern geäußert. Der Protokollführer sammelt die Einfälle auf einem Blatt. 3. Mindmap (persönliches Brainstorming) Jeder erstellt zur Lösung des Problems ein Mindmap, wobei er seine Ideen frei und ungehindert fließen lässt. Die Einfälle werden anschließend gemeinsam gesammelt und vom Protokollführer notiert. Folie 2 Seite 151 75927711 Theaterpädagogische Übung „Einer bleibt drin!“ Die Teilnehmer des Qualitätszirkels stehen im Kreis. 1. A tritt in die Mitte und erklärt z.B. „Ich bin ein Baum.“ Dazu verkörpert er durch eine entsprechende Stellung und/oder Bewegung einen Baum. 2. Die beiden schnellsten (hier B und C) Teilnehmer/Teilnehmerinnen vervollständigen den Baum durch die sprachliche Ergänzung, B: „Und ich bin ein Ast!“ und die ganzkörperliche Darstellung der Ergänzung. So klammert sich zum Beispiel B an den Baum; C: „Und ich bin ein Apfel!“, C hängt sich an den Ast. 3. Nun entscheidet der „Baum“, wen er mit aus dem Kreis nimmt - A: „Ich nehme den Ast mit.“ A und B kehren in den Kreis zurück. C bildet den neuen Grundbegriff „Ich bin ein Apfel!“ Nun beginnt das Spiel von vorne - sprachlich und körperlich - zum Apfel gesellen sich die schnellsten („kreativsten“) Teilnehmer/Teilnehmerinnen, z.B. „Ich bin der Wurm!“ und „Ich bin der Stiel!“ Der Apfel nimmt wieder einen mit in den Kreis zurück etc. Nach anfänglichen, eher zögerlichen Runden geht es Schlag auf Schlag: die Denkbremse wird gelockert und schließlich ganz beseitigt. Folie 3a Seite 152 75927711 Einfache Übungen zur Förderung der Kreativität Übung 1: a) Das Neun-Punkte-Problem Verbinden Sie die neun Punkte mit drei geraden Linien, ohne jedoch den Stift abzusetzen! O O O O O O O O O b) Das Viereck-Problem Zeichnen Sie ein Viereck und teilen Sie es mit einer einzigen geraden Linie in 3 Teile! c) Die logische Reihe Setzen Sie bitte die folgende Reihe logisch fort! ___________________________________________________________________________ d) Die Rheinüberquerung Zwei Männer wollen nahe Koblenz den Rhein überqueren. Das Boot, das am Ufer lag, bot nur für einen Platz, denn es war so klein, dass es nur einen Menschen tragen konnte. Beide überquerten den Rhein in diesem Boot und setzten anschließend die Reise fort. Wie konnten sie das tun? Übung 2: Köpfchen, Köpfchen – Geistesblitze sind gefragt Beispiel: Wozu lässt sich ein Stuhl noch verwenden – außer zum Sitzen? Sie können sich auf Ihn stellen, Sie können daraus Brennholz machen, Sie können ... Was fällt Ihnen zu dem Begriff Autoreifen ein? Autoreifen _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Folie 3b Seite 153 75927711 Morgenstern Abendstern Fixstern Zwergelstern Folie 4 Seite 154 75927711 Wie haben Sie den Arbeitsprozess empfunden? Folie 5 Seite 155 75927711 Beispiel: operationalisierbares Ziel 1. Wir führen mindestens zwei SCHILF-Veranstaltungen in diesem Schuljahr durch (ganztägig an einem Freitag oder Samstag). Der SCHILF-Qualitätszirkel übernimmt die Organisation. 2. Wir streben an, dass jede Lehrkraft mindestens fünf Unterrichtsstunden pro Schuljahr in Absprache bei einer Kollegin / einem Kollegen hospitiert. 3. Leitbild, z.B. “Konflikte sollen umgehend und gemeinsam gelöst werden“ Ziel, z.B. “Im Laufe des kommenden Schuljahres erlernen wir eine beziehungsweise professionalisieren wir unsere gewöhnlich angewandte Form der Bearbeitung von Konflikten im Umgang miteinander und im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, der Schulleitung, den Eltern und dem Hauspersonal.“ Folie 6 Seite 156 75927711 4.2.5 Vorstellung der Umsetzungskonzepte (bei mehreren Qualitätszirkeln oder Unterqualitätszirkeln) (30 min) Treffen im Plenum Ein freiwilliger Gruppensprecher stellt der Projektgruppe das Umsetzungskonzept seiner Gruppe vor. Diskussion im Plenum Anmerkung, wenn mehrere Unterqualitätszirkel ein Leitbildziel bearbeitet haben Vorbereitung: (1) Plakat Arbeiten mit Unterqualitätszirkeln (2) Folie: Aufgabe des Hauptqualitätszirkels Hinweis auf Plakat (1) Nun geht es darum den Hauptqualitätszirkel mit max. 8 Gruppenteilnehmern zu installieren. Seine Aufgaben sind: (Folie) 1. Er muss die Arbeitsergebnisse der einzelnen Qualitätszirkel bündeln und redaktionell überarbeiten. 2. Er ist zuständig und verantwortlich bei der Durchführung des Schulprogramms. Dazu bitte ich, dass sich die Gruppen nochmals treffen. In jeder Gruppe sollten sich eine oder zwei Personen finden (je nach Zahl der UQZ), die im Hauptqualitätszirkel mitwirken wollen. Die Gruppen treffen ihre Entscheidung. Anschließend werden im Plenum die freiwilligen Mitglieder des Hauptqualitätszirkels namentlich auf einem Plakat festgehalten. Damit der Hauptqualitätszirkels seine Aufgaben planmäßig erfüllen kann, benötigt er einen Gruppenleiter. Er hat die Gruppe zu führen. Der Gruppenleiter wird ermittelt: 1. durch freiwillige Meldung oder 2. über einen Vorschlag und anschließender Wahl oder Seite 157 75927711 3. durch Zufallswahl. Anmerkung Die Installation eines Gruppenführers ist unabdingbare Voraussetzung für die Erledigung der Aufgaben des Hauptqualitätszirkels. Findet sich kein Führer, dann scheitert an dieser Stelle das Schulprogramm. Es wäre auch möglich das die Führung von Zeit zu Zeit wechselt. Der Gruppenleiter muss nicht der Steuergruppe angehören. Ich bitte den Hauptqualitätszirkel alle Aktivitäten und Ergebnisse für das Kollegium öffentlich zu machen. Plakat Mitglieder des Hauptqualitätszirkels sind: 1. ....................... 2. ....................... 3. ....................... ........................ Gruppenführer: ....................... Seite 158 75927711 Aufgaben des Hauptqualitätszirkels Die Arbeitsergebnisse der Unterqualitätszirkel bündeln und redaktionell überarbeiten. Er ist zuständig und verantwortlich für die Durchführung des Schulprogramms. Folie Seite 159 75927711 4.2.6 Wie geht es weiter? (15 min) Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Folie: Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Nun folgt Schritt 9: Beschlussfassung der Lehrerkonferenz und Umsetzung Das vom (Haupt)qualitätszirkel erstellte Umsetzungskonzept des Schulprogramms wird an alle Lehrkräfte der Schule verteilt. Das Kollegium hat jetzt die Möglichkeit schriftlich innerhalb von 14 Tagen Änderungs- und Verbesserungsvorschläge vorzubringen, die dann der (Haupt)qualitätszirkel nach wohlwollender Prüfung noch mit in sein Konzept aufnehmen kann. In einer Gesamtkonferenz stellt der (Haupt)qualitätszirkel nochmals kurz sein erarbeitetes bzw. überarbeitetes Konzept vor. Insbesondere stellt er dabei überzeugend die Vorteile für jeden Einzelnen und für die Schule heraus. Dann wird über die Annahme oder Ablehnung des Konzeptes ohne Aussprache abgestimmt. Ohne Aussprache deshalb, weil die Diskussion - wo sich jeder hätte einbringen können - um den besten Weg schon vorher stattgefunden hat. Anmerkungen: Nach Dr. Emminger ist es bisher noch nicht vorgekommen, dass ein Leitbild vom Gesamtkollegium abgelehnt wurde. Falls doch einmal geschehen sollte, muss der Prozess nochmals durchgeführt werden. Der positive Beschluss der Konferenz ist für das Gesamtkollegium bindend, d.h. die Minderheit muss sich fügen. Deren Vertreter hätten ja jederzeit am Prozess teilnehmen können. Bei der praktischen Umsetzung können auch andere Lehrkräfte aus der Projektgruppe mitwirken. Wer Schulentwicklung nicht mitmacht, wird sie erleiden. Qualität steckt an! 4.2.6.1 Interne und externe Evaluation Jetzt folgt Schritt 10. Ein Leitbild macht keinen Sinn, wenn es nicht evaluiert, also überprüft wird. Sowohl für die Beteiligten, aber auch für Außenstehende muss - möglichst quantitativ nachweisbar - über die subjektive Empfindung hinaus erfahrbar sein, dass die Bemühungen Früchte tragen. Dazu bieSeite 160 75927711 tet sich an, das zum Beispiel im Schritt „Erfassung des IST-Zustandes“ verwendete Befragungsinstrument nach einem bestimmten Zeitraum erneut - evtl. sogar unverändert - einzusetzen. Der Vergleich der Ergebnisse des zweiten Durchlaufs mit denen der Erstbefragung am Beginn des Projektmanagements kann Veränderungen aufdecken und Entscheidungen bezüglich der Fortführung des Gesamtprojekts positiv beeinflussen. Wenn bei der Evaluation nachweisbar etwas Schlechtes herauskommt, muss man einen neuen Weg suchen. Schulentwicklung muss auch extern evaluierbar sein. Auch Neutrale bzw. Außenstehende müssen feststellen können, dass es jetzt besser geht. Die externe Evaluation der Schule kann nach einiger Zeit zum Beispiel erfolgen durch ... Mitglieder der Regierung, Kollegen anderer Schulen, andere Qualitätszirkel, Elternvertreter, Betriebe und Schüler Mit wem und wie das Verfahren letztlich durchgeführt wird bleibt der Entscheidung der Projektgruppe überlassen. 4.2.6.2 Neue Prioritätensetzung Nun wird - ein Schuljahr ist seit Beginn des SE-Prozesses vergangen - ein neues Schulprogramm für den folgenden Zeitraum vereinbart. Ein neues Thema motiviert nun vielleicht auch andere Kollegen, in den neuen Umsetzungsprozess mit einzusteigen. Das Projektmanagement beginnt von vorne. Qualität lässt sich nicht konservieren, sie muss immer wieder neu definiert werden. Deshalb wird – wie schon gesagt - nach 5-6 Jahren, wenn sich die Rahmenbedingungen an der Schule geändert haben, ein neues Leitbild erstellt. Schulentwicklung hört somit niemals auf. Haben Sie Fragen zu diesen nach folgenden Schritten? Seite 161 75927711 Möglicher Ablauf eines Schulentwicklungsprozesses Schritte Wer? Wo? 1. Information des Kollegiums: Da gibt es ... 2. Kollegiumsbeschluss Wir wollen mehr Informationen ... 3. Informationsveranstaltung SL, LK... Schule Kollegium Schule Kollegium Ext. Begl. Ext. Begl. Projektgr. Kollegium Ext. Begl. Projektgr./ Reakt.gr. Ext. Begl. Projektgr. Schule 4. Betreuungsvereinbarung 5. Bildung einer Steuergruppe 6. Zielerklärung: SOLL-Zustand Leitbild 7. Prioritätensetzung Schulprogramm 8. Projektmanagement: Diagnose im/in den Handlungsfeld/ern des Schulprogramms Zielaufstellung Möglichkeiten Konzept als Antrag an die 9. Beschlussfassung/Umsetzung 10. Evaluation: intern u. extern Zeit 1. Sitzung 2 Std. Schule Schule nicht an der Schule Schule 2. Sitzg. Pädagog. Wochenende 3. Sitzg. Schule Qualitätszirkel (evtl. ext. Begl. LKonferen z Kollegium Schule QZ Schule e 7. neue Prioritätensetzung: Schulprogramm alle 5 - 6 Jahre: 6. Leitbild-Evaluation Projektgr. Schule Projektgr. s.o. s.o. Folie Seite 162 75927711 4.2.7 Zusammenfassung (5 min) Folie: Vorgesehenes Tagungsprogramm Ich habe Ihnen .... 4.2.8 Reflexion über die Umsetzungschancen (30 min) Als nächstes sollen Sie besprechen und beurteilen, wie Sie die Umsetzungschancen eines systematischen Umsetzungsprozesses an der Berufsschule im allgemeinen und besonders an Ihrer Berufsschule einschätzen. Erörtern Sie dazu die folgenden Fragen (Folie) Verlauf: Die Stammgruppen erledigen den Arbeitsauftrag. Ein freiwilliger Gruppensprecher wird bestimmt. Treffen im Plenum Diskussionsrunde vor dem Plenum im Fishpool a) Ein Stuhlkreis (Diskussionskreis) wird gebildet. b) Die Gruppensprecher nehmen Platz. c) Eine Person aus dem Plenum übernimmt auf einem weiteren Stuhl die Diskussionsleitung. d) Ein Stuhl bleibt frei. Auf diesem kann ein externer Diskussionsteilnehmer seine Argumente in die Runde einbringen. Der Leiter achtet darauf, dass dieser ein bevorzugtes Rederecht hat. Wird allerdings der freie Stuhl von einem Gruppensprecher nach außen gedreht, dann kann kein Außenstehender mehr an der Diskussion teilnehmen. Erst das nach Innenrücken des Stuhl hebt das Verbot auf. e) Der Außenkreis beobachtet und notiert sich den Diskussionsverlauf. f) Die Diskussion wird vom Moderator abgebrochen. g) Er gibt dem Plenum den Auftrag über den Diskussionsablauf zu berichten. Seite 163 75927711 Erörtern Sie die Fragen Was müsste an Schulentwicklungsprozessen geändert werden und was müsste sich an der Berufsschule ändern, um die Umsetzungschancen eines Schulentwicklungsprozesses zu erhöhen? Folie Seite 164 75927711 4.2.9 Blitzlicht zum Tagesverlauf und Abschluss der Veranstaltung (15 min) Rückblick und Bilanz des Tages erfolgt über die folgende Fragestellungen (Folie): Wie zufrieden bin ich mit dem heutigen Schulentwicklungstag? Was wünsche ich mir für die Schulentwicklung in der Zukunft? Sie haben zwei Minuten über die Fragen nachzudenken. Nach dieser kurzen Bedenkzeit wird das Blitzlicht wird gestartet. Die Teilnehmer werden verabschiedet. Flotte Musik wird über den Kassettenrecorder eingespielt. Im kleinen Kreis wird über die weitere Vorgehensweise gesprochen. Seite 165 75927711 Blitzlicht Wie zufrieden bin ich mit dem heutigen Schulentwicklungstag? Was wünsche ich mir für die Schulentwicklung in der Zukunft? Seite 166 75927711