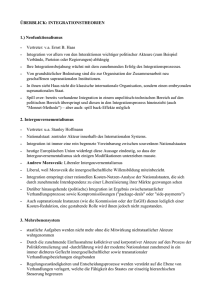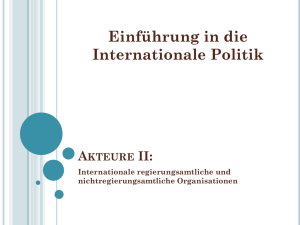vohs06fol01
Werbung
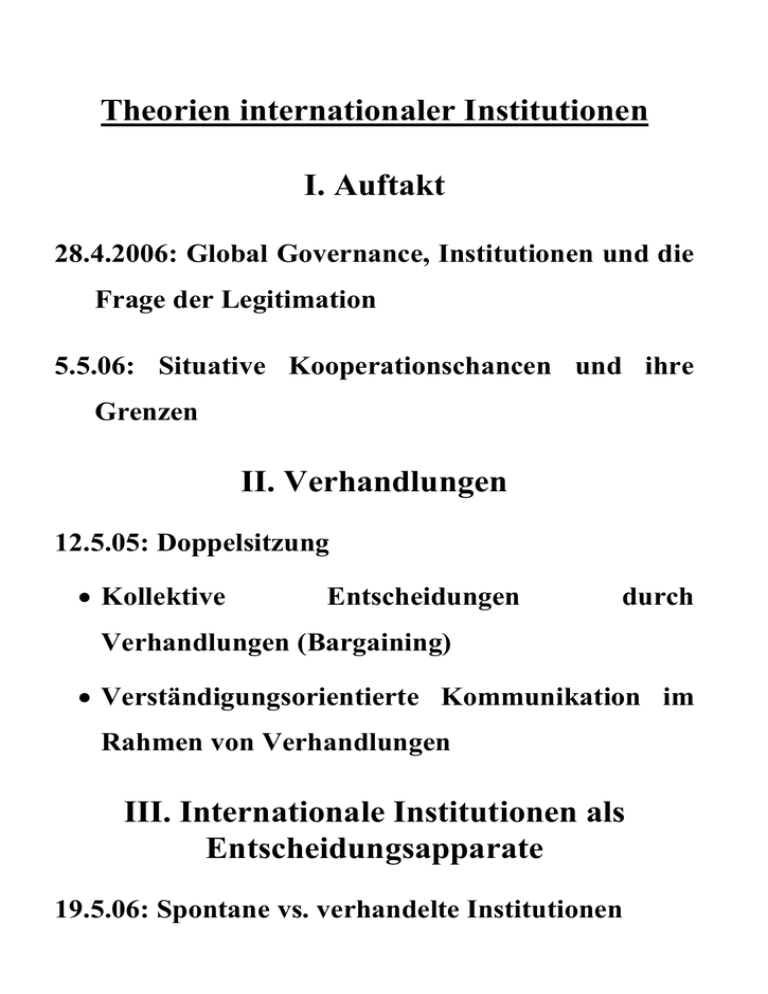
Theorien internationaler Institutionen
I. Auftakt
28.4.2006: Global Governance, Institutionen und die
Frage der Legitimation
5.5.06: Situative Kooperationschancen und ihre
Grenzen
II. Verhandlungen
12.5.05: Doppelsitzung
Kollektive
Entscheidungen
durch
Verhandlungen (Bargaining)
Verständigungsorientierte Kommunikation im
Rahmen von Verhandlungen
III. Internationale Institutionen als
Entscheidungsapparate
19.5.06: Spontane vs. verhandelte Institutionen
26.5.06: Fällt aus (Tag nach Himmelfahrt)
2.6.06: Die Strukturierung des Verhandlungsraums
und Festlegung von Entscheidungsregeln
9.6.06: Delegation, sekundäre Entscheidungen und
die
Ausdifferenzierung
von
Entscheidungsprozessen
16.6.06:
Pfadabhängigkeit
durch
internationale
Institutionen
IV. Die transnationale Komponente
23.6.06: Mehrebenensituationen
30.6.06: Nicht-staatliche Akteure in internationalen
Institutionen
V. Aktuelle Aspekte des Regierens durch
internationale Institutionen
7.7.06:
Verrechtlichung
der
internationalen
Beziehungen
14.7.06: Wechselwirkung zwischen internationalen
Institutionen
21.7.06: Private Governance
28.7.06: Klausur
I. Global Governance, Institutionen und die
Frage der Legitimität.
1. Global Governance
Suche nach dem Ort und den
Zusammenhängen „des Politischen“ jenseits
des Nationalstaates
empirische Beobachtung: das politische
System des Nationalstaates
o verliert Steuerungskapazität
o wird durch Steuerungsaktivitäten
jenseits des Nationalstaates beeinflußt
implizit zugrunde liegende Vorstellung von
Politik als
o Gegenstück zur Marktkoordination
o Gegenstück zur machtbasierten Koord.
o „zivilisierter“ Austrag von Konflikten
o organisiert, aber nicht zentralisiert
(keine Weltregierung)
zentrale Fragen
o Wer ist beteiligt (Staaten, substaatliche
Einheiten [z.B. Gerichte, Ämter,
Ministerien], NGOs, Firmen?)
o In welcher Rolle jeweils ?
o in welchem institutionellen Rahmen
(polity)
o Wie sehen die Machtverteilung und der
Prozeß aus (politics)
o welche Politikergebnisse entstehen ?
o Wie legitim sind diese ?
Übergreifende Beobachtungen
Ausdifferenzierung der Global GovernanceStrukturen (mehr Akteure, Prozesse,
Einflußbeziehungen)
Internationale Institutionen (und EU)
spielen eine zentrale Rolle
o aber nicht mehr auf Staaten beschränkt
Staaten und ihre nat. politischen Systeme
sind nach wie vor von zentraler Bedeutung
für die Politikgestaltung in der globalisierten
Welt
Legitimationskrise internationaler
Institutionen
Zahl der internat. Institutionen nimmt
dramatisch zu
Obwohl die Mitgliedstaaten die formalen
Adressaten sind, nehmen sie zunehmend
Einfluß auf gesellschaftliche Akteure
(Umwelt, Menschenrechte, Wirtschaft)
=> Bedarf für einen gewissen Grad an
Autonomie von den Staaten (durch
Supranationalisierung, Verrechtlichung) ??
Kampagnenfähigkeit internationaler
NGOs
Öffnung von Internat. Institutionen für
NGOs und Einrichtung von
Accountability-Arrangements
zunehmende Schwierigkeiten, internat.
Regulierung gegen Widerstand von NGOs
du gesellschaftlichen Kräften
durchzusetzen
wachsende Fähigkeit, eigene Anliegen
international kooperationsfähig zu machen
2. Einige konzeptuelle Ansätze zur Analyse
internationaler Institutionen
a. kooperationstheoretischer Mainstream
Ausgangsfrage: Unter welchen Bedingungen
kann Koop. gelingen ?
o Koop. = Anpassung individueller
Verhaltensweisen
kooperationstheoretisches
Analyseinstrumentarium (insbes.
Spieltheorie)
=> Struktur der jeweiligen Situation
bestimmt Kooperationsmöglichkeiten
=> Es gibt Situationen, in denen
institutionalisierte Kooperation möglich
und vorteilhaft ist
Annahmen:
o Staaten als zentrale Akteure
o kennen ihre Interessen
o handeln einheitlich und
nutzenmaximierend
Folgen:
o Kooperation in Pareto-suboptimalen
Situationen möglich
(einige [alle] Akteure können besser
gestellt werden, ohne einen einzigen
schlechter zu stellen)
o Implizit: Verteilung von
Kooperationsgewinnen spielt keine Rolle,
solange die Pareto-Bedingung
eingehalten wird
o Implizit: Problemfelder werden
unabhängig voneinander behandelt
=> funktionale Regimetheorie
b. Neo-realistischer Theorieansatz
Zentraler Ausgangspunkt: 'Anarchie des
internat. Systems bestimmt nicht nur das
Handeln der Staaten, sondern gefährdet
auch ihre Existenz
o Staaten können Verträge und Zusagen
brechen
o Interessen mit Gewalt durchsetzen
o keine durchsetzungsfähige Instanz, an
die Opfer sich wenden können
Annahmen des Neorealismus
o Staaten sind die zentralen Akteure
o besonders wichtig: die großen Staaten
o Staaten handeln
rational (an ihren Interessen im
internat. System orientiert)
einheitlich ('mit einer Stimme')
Folgen:
o Staaten orientieren ihr Handeln an der
Struktur des internat. Systems und ihrer
jeweiligen Position darin
o Staaten haben Interessenhierarchie:
Sicherheit zuerst
o sind bestrebt, ihre Macht relativ zu
anderen Staaten zu maximieren
Auswirkungen für die
Institutionenkonzeption:
o generelle Institutionenskepsis, aber:
o Theorie hegemonialer Stabilität
Regime bedürfen der Stützung durch
einen starken Akteur
(z.B. GATT, IWF, ursprüngliche
Seerechtsordnung)
aber: viele Regime (z.B. in Europa)
kommen ohne einen Hegemon aus
o Maximierung des relativen Nutzens
Akteure sind nicht mit absoluten
Kooperationsgewinnen zufrieden
Verluste der relativen Machtposition
werden stark berücksichtigt
Es wird um Verteilung gerungen
Nicht PD, sondern
Koordinationsspiel mit
Verteilungskonflikt
Institutionen sind relevant, wenn
und insoweit wie sie durch mächtige
Akteure gestützt werden
c. 'Kognitivistischer Theorieansatz
Zentraler Ausgangspunkt: Die Welt ist
komplex und tatsächlich existierende
Akteure können ihre Präferenzen gar nicht
vollständig kennen, z.B.
o Unsicherheit über die
Rahmenbedingungen des Handelns ("wie
ernst ist der Klimawandel"?)
o Unsicherheit über Lösungsansätze
("welche Auswirkungen haben
unterschiedliche Lösungsansätze und
welcher führt am besten ans Ziel"?)
Implizite Annahmen:
o Selbst wenn Akteure versuchen, ihren
Nutzen zu maximieren, stoßen sie dabei
auf Schwierigkeiten
Folgen:
o Präferenzen sind nicht stabil, sondern
durch Institutionen beeinflußt
o Bedeutung nicht-staatlicher Akteure
(z.B. 'epistemic communities') f. Koop.
o Bedeutung von Kommunikation und
'Ideen'
d. 'Gemäßigter' Konstruktivismus
Ausgangspunkt: Vermutung, daß
Institutionen und internationale
'Gesellschaft' die Identität von Staaten (nat.
Gesellschaften) verändern können
o z.B. Veränderung der 'Identität'
Deutschlands durch europ. Integration
o Veränderung des polit. Systems
Indonesiens unter dem Einfluß der
internat. Menschenrechtsordnung
=> Suche nach
Internalisierungsmechanismen
Akteure folgen einer ‚logic of
appropriateness’
Institutionen sind relevant, indem sie
Akteure orientieren und ihre
Präferenzen verändern