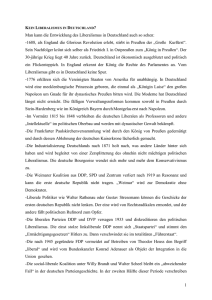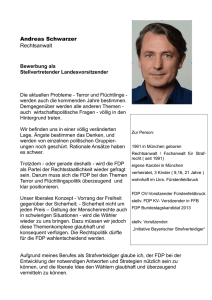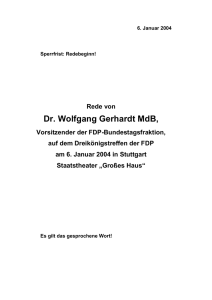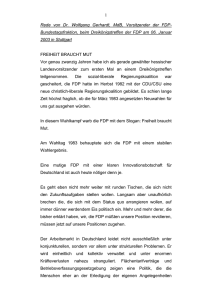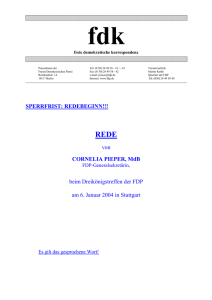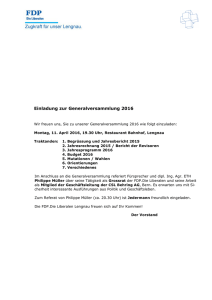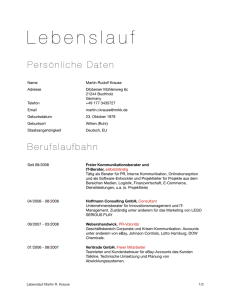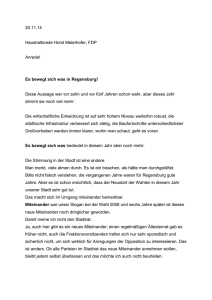Jürgen Dittberner - Universität Potsdam
Werbung

PERSPEKTIVEN DER GERECHTIGKEIT FÜR DIE ZUKUNFT LIBERALER POLITIK - ÜBERLEGUNGEN AM BEISPIEL DER FDP – Gerechtigkeit ist eines der Ziele des Liberalismus, ein anderes ist Wahrheit. 1 Gerecht sollen nach die Institutionen sein, die sich der Mensch schafft und in denen er lebt. Wahr sollen die Ideen sein, die den Menschen leiten. Gerechtigkeit hat eine institutionelle und eine inhaltliche Seite. Die Verfahren, nach denen die Menschen miteinander umgehen, bedürfen klarer Definition, Erkennbarkeit und allgemeiner Anwendbarkeit. Im Politischen erwächst daraus das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Dieses muss von den Bürgern her entworfen werden und nicht aus der Sicht des Staates und seiner Interessen. Inhaltlich bezieht sich Gerechtigkeit auf die Verteilung begehrter Ressourcen wie Geld, Güter, Bildung oder Sozialstatus. Eine Aufgabe liberaler Politik ist es, in jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Umständen jenes Maß der Verteilung zu definieren, das allgemeine Anerkennung findet. Gerechtigkeit, auch soziale Gerechtigkeit, ist nicht identisch mit sozialer Gleichheit. Soll ein aktueller Verteilungsstatus veränderbar sein, bedarf er einer gewissen Ungleichheit. Wie die Gerechtigkeit verlangt die Wahrheit nach ständiger Erneuerung. Wahrheit ist nicht Glaube, und der Feind der Wahrheit ist der Fundamentalismus. Dieser artikulierte sich im 20. Jahrhundert im Nazismus und Stalinismus politisch, im 21. Jahrhundert religiös. Wahrheitsfindung ist ein dialektischer Prozess: Jede Antithese ersetzt oder verfeinert jede aktuelle These. Gegenrede ist die Quelle der Fortentwicklung. Damit Wahrheit und Gerechtigkeit sich entfalten können, muss es Freiheit und permanenten Diskurs geben. Freiheit der Menschen sowie Offenheit der Strukturen und Prozesse sind Medien des Liberalismus, ohne dieser sich nicht entfalten kann. In der vom internationalen Kapitalismus beherrschten Welt hat dieser eigene Strukturen und Denkmuster entfaltet. Gerechtigkeit und Wahrheit haben keine zentrale Bedeutung, wenn sie den Interessen der Global Players im Wege stehen. Genommen und wird jener Arbeiter auf dem Globus, der die geringsten Kosten verursacht. Für seine Befindlichkeit gibt es eine globale Unterhaltungs- und Eventkultur, die Emotionen anspricht und das Rationale marginalisiert. Dem widersetzt sich ein religiös gespeister Fundamentalismus vor allem in der islamischen Welt, der den aktuellen Zustand der westlichen Welt falsch als Folge des „Liberalismus“ 1 ansieht. Dieser Fundamentalismus hat seine Basis in den armen und mittleren Schichten des „grünen Gürtels“ von Algerien bis nach Indonesien und ist entstanden aus dem Empfinden, ausgeschlossen zu sein aus der „westlichen“ Welt. Der Fundamentalismus in den USA dagegen ist anderer Art. Er ist die Popularisierung des klassischen Puritanismus, jenes kapitalistischen Geistes, den Max Weber beschrieben hat.2 Der moderne amerikanische Fundamentalismus ist religiös-nationalistisch, nicht persönlich durch harte Arbeit nach Gottwohlgefälligkeit strebend, sondern sich in der Sicherheit der Gottwohlgefälligkeit wähnend aufgrund der Überzeugung von der Güte und Überlegenheit des eigenen, „Gottes eigenen“, Landes: den USA. In China wiederum setzt sich ein staatlich gelenkter Kapitalismus ohne bürgerliche Freiheitsrechte durch. Wegen des aus Bevölkerungszahl und Nachholbedarf resultierenden extremen Wachstums ist China ein eigener Global Player und potenzieller Rivale der USA. Im übrigen hat sich in China die These nicht verifiziert, dass Marktwirtschaft gleichsam systemnotwendig bürgerliche Freiheiten als erforderlichenÜberbau entstehen ließe. Indien ist ein erwachsender Riese. Diese Land ist mit über einer Milliarde Bewohner vordergründig die „größte Demokratie der Welt“ mit einer westlich-parlamentarischen Fassade. Hinter dieser Fassade wirken religiöse, ethnische, soziale und Kastenkonflikte sehr stark und werden teilweise mit brutaler Gewalt ausgetragen werden – und das im Lande Mahmadma Ghandis! Nicht die Lehren der endemischen vielfältigen Kultur streben in die Globalisierung – sie wirken eher konservierend, sondern die große Armut der vom westlichen Wohlstand geblendeten Massen lockt Investoren an und löst einen Prozess aus, von dem niemand weiß, wohin der den Subkontinent – der bevölkerungsreicher als Afrika ist – führt. Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtigkeit werden wohl auf absehbare Zeit relevante Kriterien nur für eine Schicht sein von „Westlern“, die an der Spitze einer Pyramide leben, deren Basis die Kasten, der Hinduismus mit seinen auch extremen Varianten und der Islam bleiben werden. Schwarzafrika leidet unter dem Postkolonialismus. Die Kolonialherren haben alte Kulturen und deren Stolz zerstört, durch Krieg und Landnahme Ungerechtigkeiten geschaffen und schwache Staaten danach Bonapartismus, Rassismus und Misswirtschaft überlassen. Warlords unterdrücken unentwickelte Gebiete, schweben wie Fettaugen auf der Magersuppe. Die Länder Schwarzafrikas leben entweder mit der Ungerechtigkeit der einstigen Landnahme mehr schlecht als recht wie Namibia, oder sie versinken nach Enteignungen und Terror von oben im Chaos wie Simbabwe. Gerechtigkeit würde hier darin bestehen, möglichst viele 2 Menschen erst einmal zu bewahren vor Krieg, Mord und Hunger – nicht weniger, aber auch nicht mehr. Südamerika bewegt sich zwischen Autoritarismus und formaler Demokratie - ständig bemüht, sich von der äußeren Abhängigkeit von der westlichen Welt (besonders der USA) und der inneren Armut zugleich zu befreien. Im Existenzkampf dieser Staaten und ihrer Völker erscheinen die Ideen der sozialen Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit luxuriös und wenig aktuell. Russland geht einen Weg des gelenkten und kontrollierten Staatskapitalismus, getragen von Populismus, Nationalismus, Geheimdienstmethoden und Gewalt wie in Tschetschenien. Der Fall Cholodkowski zeigt: Eine offene Demokratie ist das nicht. Aber Russland ist ein nach wie vor militärisch starker Staat, der getragen wird von seinen natürlichen Ressourcen sowie der Leidensfähigkeit seines Volkes und daher einigermaßen stabil erscheint. Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtigkeit als Leitmotive bewegen nur eine kleine Schicht von Bürgerrechtlern. Aus den unterschiedlichen angedeuteten Gründen steht in China, in Indien, in der moslemischen Welt, in Afrika und eigentlich auch in Südamerika und in Russland das Thema Gerechtigkeit als Element liberaler Politik gar nicht auf der Agenda: Das ist ein Spezialpunkt der „westlichen Welt“. Die „westliche Welt“ – USA, Kanada, Europa, Australien, Neuseeland, Japan und vielleicht noch Südafrika – sind Demokratien, in denen Gerechtigkeit als Perspektive liberaler Politik durchgehend relevant sein könnte. Dabei stellen sich die Probleme in den religiösen USA anders als in Europa, und im Westen Europas wiederum anders dar als im postkommunistischen Osten des alten Kontinents. Insofern ist es angemessen, die Frage nach Recht und Gerechtigkeit auf Westeuropa zu beziehen und da auf Deutschland. Und obwohl alle deutschen Parteien Recht und Gerechtigkeit als Ziele nennen, ist es angezeigt, sich hier speziell auf die FDP zu fokussieren. Denn wenn nicht diese ausdrücklich am Liberalismus orientierte Partei, wer sonst würde sich bemühen zu definieren, wie Recht, Gerechtigkeit und zugleich Liberalität hinzubekommen sein können in einer vielfältigen und doch vernetzten Welt? Somit steht auch zur Diskussion, ob es überhaupt Inseln der Liberalität geben kann im Zeitalter der Globalisierung. 3 Die These ist, Deutschland könnte – trotz aller aktuellen Klagen - eine dieser Inseln liberaler politischer Kultur sein und in Deutschland selbst die dem Liberalismus verpflichtete Partei, die FDP. Da nun kommt man aber zu einem enttäuschenden Befund: Als langjährige Regierungspartei hat die FDP das Land stark geprägt. Als einige der kleinen Parteien seit 1949 hat sie jedem Bundestag angehört. Die FDP befindet sich beim Thema „soziale Gerechtigkeit“ ebenso wie bei der Rechtsstaatlichkeit in Konkurrenz zu den beiden anderen „Bonner“ Parteien, aber auch zu den Grünen und zur PDS/Linkspartei. Die anderen Parteien betonen zudem, dass es nötig sei, das soziale Netz weiter zu flechten. Sie garnieren angeblich notwendige „sozialpolitische Grausamkeiten“ mit Floskeln wie Frieden, Sicherheit oder eben soziale Gerechtigkeit. Die dem Liberalismus verschriebene Partei vertraut im Unterschied dazu der aufklärerischen Wirkung ihrer ordoliberalen Argumente von der Eigenverantwortung und hofft auf Selbsteinsicht der Bürger. Sie agiert als Kleinpartei und nimmt sich der Sorgen um negativ Betroffene nicht an. Als soziale Basis reichen ihr privilegierte Gruppen, so dass sie als Klientelpartei der Bessergestellten erscheint. Ein weiter gedachter Liberalismus müsste sich dem Klientel-Vorwurf nicht aussetzen, denn Freiheit und Wahrheit für möglichst viele setzt soziale Gerechtigkeit voraus – und eben danach gibt es in Deutschland ein Grundbedürfnis. Hier wird fehlende soziale Gerechtigkeit besonders im Osten des Landes beklagt. Die FDP als Partei des organisierten Liberalismus wird unter den politischen Parteien zuallerletzt als jene Organisation gesehen, die an dieser Stelle das Auseinanderdriften der deutschen Gesellschaft bekämpfen würde. Mit dem Stichwort von der „Partei der Besserverdienenden“ hat die Partei selber den Beleg für diesen Befund geliefert und damit ihre politische Absenz im deutschen Osten in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre begründet. Es ist der FDP nicht wiederfahren, dass sie die soziale Gerechtigkeit und zeitweilig sogar die Rechtstaatlichkeit aus den Augen verloren hat, sondern das wurde bewusst so entschieden. Der Parteivorsitzende Guido Westerwelle sieht es so: Der „Verteilungsstaat“ habe die soziale Gerechtigkeit zum obersten Prinzip erhoben und herausgekommen sei „Gleichmacherei“. Gemeint ist jener „Verteilungsstaat“, den die FDP selber mitgestaltet hat! An die Stelle der sozialen Gerechtigkeit wird seit Ende der neunziger Jahre der Begriff „fair“ aus der Theoriediskussion entliehen: „Fair ist, wenn Leistung sich lohnt und Fleiß sich auszahlt.“3 Das Problem ist, dass in der Öffentlichkeit der Begriff soziale Gerechtigkeit verstanden wird, der Begriff „fair“ dagegen weniger. 4 Die Rechtsstaatlichkeit büßte zur selben Zeit an Priorität ein mit der Begründung, der Bürger fürchte sich nicht mehr vor dem liberalen Staat, sondern vor ausufernden Bürokratien. So konnte es geschehen, dass die Partei des Liberalismus in der Ära Kohl aus Koalitionsräson dem Angriff auf das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung in Form des „großen Lauschangriffs“ zustimmte. Im Unterschied hierzu konnte die „alte FDP“ mit den Begriffen Gerechtigkeit und Rechtsstaat etwas anfangen. Es gab Sternstunden der Rechtsstaatlichkeit. Eine ereignete sich am 7. November 1962, als der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Wolfgang Döring, in der Debatte über die „Spiegel“-Affäre den inhaftierten Rudolf Augstein leidenschaftlich gegen Bundeskanzler Konrad Adenauer verteidigte und dabei ein Plädoyer für den Rechtsstaat hielt. In den Wiesbadener Grundsätzen von 1997 jedoch wurde unter dem gedanklichen und auch linguistischen Einfluss von Guido Westerwelle die Haltung der FDP zum Rechtsstaat verwischt: „Der Staat ist nicht Vormund der Bürger, sondern deren Instrument zur Sicherung der offenen Bürgergesellschaft. Deshalb gewährt nicht der Staat den Bürgern Freiheit, sondern die Bürger gewähren dem Staat Einschränkungen ihrer Freiheit zur Wahrung der gleichen Rechte aller."4 Zur sozialen Gerechtigkeit: Das als rechtslastig geltende „Deutsche Programm“ aus den frühen 50er Jahren stellte sich eine freie Marktwirtschaft vor, die Wirtschaftswachstum, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit garantieren könne. Ebenso gab es im Berliner Programm von 1957 diese Passage: „Soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und wachsenden Wohlstand gibt es nur in einer auf Freiheit der Persönlichkeit, dem Privateigentum und dem Leistungswettbewerb aufgebauten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.“5 Freilich ging es der an Wohlstand auch für die breiten Massen interessierten alten FDP um eine Wachstumswirtschaft, bei der Zuwächse zu verteilen waren. Nach dem Ende des Verteilens von Wachstum ist das Ziel der sozialen Gerechtigkeit jäh verschwunden. In den Freiburger Thesen noch hatte der Zusammenhang zwischen Liberalismus und sozialer Gerechtigkeit einen besonderen Dreh: „Der Kapitalismus hat, gestützt auf Wettbewerb und Leistungswillen des Einzelnen, zu großen wirtschaftlichen Erfolgen, aber auch zu gesellschaftlicher Ungerechtigkeit geführt.“6 Die FDP erreichte eine programmatische Tiefe und drang zum Wesen des Liberalismus, der in dieser Zeit mehr als Etikette war, vor. In der These 2 wurde von „Wahrheit und Gerechtigkeit“ gesprochen, die nicht als „fertige Antworten“ zu verstehen seien, sondern in der sich wandelnden und offenen Gesellschaft „als stets neu sich stellende Fragen“.7 5 Mit dem Ende der sozialliberalen Phase werden diese Erkenntnisse verschüttet, und in den 1997er Wiesbadener Grundsätzen war vage von einer „Bürgergesellschaft“ die Rede, die Globalisierung und Wohlstand verbinden könne. Soziale Gerechtigkeit wurde nun verstanden als Produkt der Leistungsgesellschaft, in der Ressourcen geschaffen würden, die auch zur Verteilung verwandt werden könnten. Soziale Gerechtigkeit war nicht mehr zentrales Ziel liberaler Politik, sondern eine Option, die dann Realität werden könnte, wenn „Leistungsträger“ freie Bahn bekämen: Das war der Sturz der sozialen Gerechtigkeit vom konstitutiven Ziel zum Abfallprodukt „liberaler“ Politik! Aber verhält es sich bei der FDP nicht ebenso wie bei den anderen Parteien? Die „Legende“ der FDP ist der Liberalismus. Verlieren die etablierten Parteien alle ihre Legenden und erklärt das die Tatsache, dass eine neue Linkspartei, die sich auf soziale Gerechtigkeit beruft, drauf und dran ist, das traditionelle deutsche Parteiensystem zu verändern? Als Gerhard Schröder noch die Doppelfunktion des Bundeskanzlers und SPD- Parteivorsitzenden ausübte, setzte er gesellschaftspolitische Veränderungen durch, die den Sozialstaat zurückdrängten und an das „sozialdemokratische Herzblut“ gingen. Bis dahin war das Wesen der sozialdemokratischen Legende ohne alle Umschweife soziale Gerechtigkeit. So resümiert Franz Walter: „Es gibt nicht mehr die umfassende sozialistische Erzählung, die über hundert Jahre das Sozialdemokratische ausgemacht hat, die Kitt und Treibstoff der Partei war, allerdings auch Belastung Barriere bedeutete. Die modernen Sozialdemokraten können oder müssen nun ohne all dies leben.“8 Es fällt – wie man sieht – ihnen schwer. Bei der CDU scheint das „C“ zur Monstranz ohne Inhalt zu werden. Die Partei muss sich auf die zunehmend säkularisierte Gesellschaft einstellen und – so stellt Frank Bösch fest: „Bei neuen Themen wie der Asylpolitik, der inneren Sicherheit oder der Gentechnik droht die christliche und wirtschafts-liberale Anhängerschaft der CDU zunehmend auseinander zu brechen.“9 Die Grünen haben sich meilenweit entfernt von den ökologisch-pazifistischen Überzeugungen ihrer Gründungszeit. Die „Anti-Parteien-Partei“ der Petra Kelly ist zur pragmatischen Staatspartei Joschka Fischers geworden. Die Grünen tragen Auslandseinsätze der Bundeswehr mit, und die gebremste Umweltpolitik Jürgen Trittins steht im Schatten der 6 Außenpolitik des (un)heimlichen Vorsitzenden. Fast sarkastisch klingt die Schlussfolgerung von Joachim Raschke: „Seit dem 27. September 1998 sind die Grünen Regierungspartei oder sie sind nichts. Sie sind Regierungspartei in den Ämtern oder – als Opposition – im Wartestand. Die Frage nach ihrer Regierungsfähigkeit lässt sie nicht mehr los.“10 Die PDS – solange sie reine Ostpartei war - hatte sich von Anfang an vor der eigenen Legende gefürchtet. Sie ist zwar die SED-Nachfolgerpartei, aber sie verurteilt die Politik der alten Staatspartei. Sie spricht zwar vom „demokratischen Sozialismus“, aber da wo sie kann – in Berlin und Mecklenburg-Pommern zum Beispiel – macht sie eine marktwirtschaftliche Politik. Sie war bisher die Regionalpartei des Ostens, träumte aber stets von einem dauerhaften Platz im gesamten deutschen Parteiensystem. So wurde die PDS zum Sammelbecken für Protestler und Ostalgiker, hatte als solche den Bundestag 2002 verlassen müssen und hofft nun durch die WASG-Auffrischung auf den Wiedereinzug. Wenn auch Eva Sturm zu dem Ergebnis kommt, dass die PDS nicht den Weg der Aufklärung ginge, denn sie wende sich an „Menschen, die emotionsgesteuert handeln, die ´fühlen´ und ´Eindrücke haben´ und nicht etwa die Realität erfassen, - Menschen also, die nicht den Mut oder die Entschlossenheit aufbringen, sich des eigenen Verstandes zu bedienen.“11 – so scheint sie doch 2005 gerade mit dieser Methode beim Aufnehmen des von den anderen Parteien vernachlässigten Zieles der sozialen Gerechtigkeit Wählerzulauf zu erhalten. Die CSU verfolgt scheinbar ihre alten Ziele der Entwicklung und Förderung Bayerns und wird – wie Alf Mintzel prophezeit – Hegemonialpartei in Bayern bleiben: „Das eine Ziel ist, bayerische Staatlichkeit, soziokulturelle Eigenprägung und politische Kultur sowie wirtschaftlichen Wohlstand im Wandel der Zeiten zu bewahren und zu fördern, und Bayerns Gewicht als historisch gewachsene vitale Kulturregion Deutschlands und Europas auch in neuen, übergreifenden und europaweiten Entwicklungen zu erhalten. Das andere Ziel ist, Bayerns historisch begründeten Mitspracheanspruch und Geltungsauftrag in der deutschen und europäischen Politik zur Geltung zu bringen.“12 Doch diese europa- und bundesweit operierende bayerische Regionalpartei könnte mehr und mehr ihre Sonderrolle verlieren, denn auch im Freistaat erfolgen Einschnitte ins soziale Netz, und Proteste dagegen werden immer häufiger. Wie steht es mit der FDP? Sie betont nach wie vor ihre Legende des Liberalismus. Dabei ist sie in einen Zwiespalt geraten: Den Wirtschaftsliberalismus, den sie vertritt, praktizieren die anderen Parteien in ihrer Politik ebenfalls. Und was sie sonst „liberal“ nennt, ist oft schlichte Organisationspolitik. 7 Ob sie sich als Korrektiv sieht oder als eigenständiges Medienereignis: Koalitionsaussagen oder „18%“-Strategien haben viel mit dem Wunsch nach Selbsterhaltung, aber wenig mit dem Liberalismus zu tun. Der Selbsterhaltungstrieb der Organisation mag die Ursache für das Weiterbestehen der FDP sein; die liberale Legende wurde mehr und mehr zur Kulisse, die `mal gezeigt, `mal nach hinten geschoben wurde. Siegt sich der Liberalismus zu Tode? Die nationale Frage ist gelöst. Den Rechtsstaat beschwören alle Parteien. Die parlamentarische Demokratie wird praktiziert. Die Kirchen beherrschen nicht mehr den Staat und die Politik. Die Marktwirtschaft hat sich durchgesetzt, und selbst ihre schärfsten Kritiker fordern noch nicht ihre Abschaffung. Der nicht mehr bezahlbare Sozialstaat wird zurückgebaut von anderen Kräften als jene, die sich „liberal“ nennen. Was nützt da der FDP der Bezug auf den Liberalismus? In allgemeiner, abstrakter Form weiß sie ihn zeitunabhängig zu definieren: als Streben nach Freiheit. Freiheit wird bezogen auf die Person, Eingrenzung der Freiheit wird diagnostiziert bei Institutionen und Organisationen. „Vorrang der Person vor der Institution“, lautet das Politschlagwort dieser Philosophie. Bei der FDP kommt man damit in jeder Debatte durch. Doch wer fordert schon „Vorrang der Institution vor der Person“? Keiner der Konkurrenten der FDP tut das. Dennoch schreitet die Bürokratisierung des Lebens voran und engt den Handlungsspielraum ein. Die liberale Philosophie will das verhindern, kann es aber nicht. Und so scheint es, als habe die Legende der FDP, der Liberalismus, seine inhaltliche Wirkungskraft verloren –sei nur noch aufgesetzte Fassade. Im Kampf gegen klerikale, feudale und dynastische Herrschaft war der Liberalismus die leitende Idee des aufsteigenden Bürgertums. Das Bürgertum erkämpfte seinen Platz in der Gesellschaft, etablierte seine eigene Macht und eroberte eigene Ressourcen. Der Liberalismus war erfolgreich, weil hinter ihm das Interesse einer neuen Klasse stand. Deren Wucht setzte die liberalen Ziele durch. Und als das geschehen war, wurde das ehemals liberale Bürgertum defensiv – verteidigte seine Stellung. Wo ist am Beginn des 21. Jahrhunderts das gesellschaftliche Interesse, das Liberalismus als Wunsch nach individueller Freiheit braucht? Die Global Players wollen diesen Liberalismus nicht. Durch Investitionsentscheidungen setzten sie Fakten und schießen die privilegierten Sozialsysteme des Westens sturmreif. Den Abriss überlässt man am besten Sozialisten, Sozialdemokraten oder Konservativen, weil es bei ihnen am unverdächtigsten oder glaubwürdigsten ist. Liberale sind dazu nicht nötig, höchstens als Stichwortgeber hilfreich. 8 Diese Stichworte hierbei heißen Eigenverantwortung, Leistung und Flexibilität – nicht Freiheit und Gerechtigkeit. Die Mehrzahl der Menschen in der Bundesrepublik sieht weniger die persönliche Freiheit als vielmehr die soziale Sicherheit bedroht. Einkommensschwund, sozialer Abstieg, Arbeitslosigkeit können jeden erreichen. Bedrohungen der persönlichen Freiheit durch die staatlichen Repressionssysteme wie Polizei oder Justiz werden weniger gefürchtet. Die Staaten, allen voran die Hegemonialmacht USA, beschwören zwar die Gefahr durch den Terrorismus, doch die Bürger haben andere Sorgen. Sie fühlen sich allenfalls belästigt durch Abwehrmaßnahmen dagegen wie Wartezeiten an den Flughäfen, Absperrungen oder Kontrollen in den Großstädten. Es ist keine relevante soziale Schicht zu sehen, die sich aus einem gewichtigen Interesse heraus den Abwehrmaßnahmen gegen den Terrorismus in den Weg stellte. Und so hatte es die FDP zwischen 1998 und 2002 gar nicht versucht, hier die Stimme zu heben. Sie stellte keinen „Anti-Beckstein“ und keinen „Anti-Schily“. Die Worte „Skymarshal“, „Rasterfahndung“ und „Genetischer Fingerabdruck“ lösten zunächst keine Protestrufe bei der FDP aus. Zwar heißt es immer wieder „Weniger Staat wäre mehr“, 13 aber bei der Terrorbekämpfung schien dieser Satz in FDP-Kreisen suspendiert. Die FDP wollte sich beim Thema Terror nicht in die Ecke der nicht „Wachsamen“ drängen lassen. Schließlich lag die Organisation dicht an der 5%-Sperrgrenze. Da wollte sie ihre Existenz nicht gefährden mit einem Beharren auf den Rechtsstaat. Seit 2002 gab es vorsichtige Versuche, diese Position des Opportunismus zu verlassen. In Erwartung einer schwarz-gelben Koalition bleibt abzuwarten, was Substanz und was Lippenbekenntnis ist. Freiheit erfordert Aufklärung. Die Freiheit der Medien jedoch hat Entertainment in den Mittelpunkt gerückt. Auch Politik wird durch Unterhaltung verkauft. Die unter anderem von der FDP einst freudig begrüßten Neuen Medien brachten die Quote als Maß aller Dinge. Liberalen sollte das zuwider sein. Aber die FDP – immer in ihrer organisatorischen Existenz bedroht – geht gegen die Macht der Medienbosse nicht an. Sie will nicht sauertöpfig wirken, und ihr Vorsitzender hatte sogar keine Probleme, in den Container der Selbstentblößung zu gehen. „Aufklärung durch die Medien“ – an diesem Thema war die FDP nicht dran – es schien ihr zu riskant. Die Freiheit der Wissenschaft hingegen hatte die FDP auf ihre Fahnen geschrieben. Bei der Gentechnologie und der Embryonenforschung war und ist sie auf der Seite der Wissenschaft, will die Grenzen des Zulässigen weit ziehen. Das ist ein Freiheitskampf auf einem sehr 9 schmalen Feld. Nicht immer ist erkennbar, dass die FDP den ethischen Argumenten der Gegner neuer Technologien gerecht wird. Hier von „Bedenkenträgerei“ zu reden, ist nicht angemessen – klingt mehr nach Lobbyismus als nach liberaler Weltsicht. Immer wieder ist aus FDP-Kreisen zu hören, „liberal“ zu sein, habe auch etwas mit Lebensgefühl und –stil zu tun. Beim Projekt 18% schien die Partei insofern den richtigen Ton getroffen zu haben: Harald Schmidt, das Guidomobil, der Fallschirm und die goldene 18 an den Schuhsohlen schienen einem Hedonismus zu entsprechen, der große Teile der jüngeren Generation erfasst hatte. Die Umfragen und Parteibeitritte Jüngerer bestätigten es: Die FDP schien vielen den richtigen Ton gefunden zu haben. Doch die bunte Seifenblase zerplatzte 2002. Eine Mode war vergangen – nichts, was sich mit dem Begriff Liberalismus deuten ließ. Es blieb die Realität: Aus der FDP selber heraus wurde geklagt, man habe die liberalen Themen aufgegeben. Die Partei habe sich bei der Terrorismusbekämpfung in einen Konsensus mit den anderen Parteien begeben und verlöre dabei die Verteidigung der Bürgerrechte aus den Augen verloren. Die Partei lasse jegliches Gefühl für soziale Verantwortung vermissen. Wer schamlos steigende Spitzengehälter einiger kritisiere und zunehmende Armut vieler beklage, dem werde von der FDP-Führung vorgeworfen, er schüre Neid. Die FDP sei nicht mehr die Partei der die Kultur tragenden Schichten. Diese neigten zur SPD oder zu den Grünen. Das Umweltthema habe die FDP schon 1982 im Verlaufe der Wende aufgegeben. Die FDP verspiele die Kompetenz in der Europapolitik wie sie von ihren Außenministern aufgebaut worden sei. In 16 Jahren Verschleiß während der Ära Kohl und zunehmend rasanter nach dem Verlust ihrer strategischen Position 1998 hatte die FDP in der Parteiführung ihre liberale Leidenschaft für die Freiheit verloren. Der Wunsch nach Selbsterhaltung der Organisation und Bewahrung der Pfründe herrschte vor. Mal probierte man es mit Show, dann mit Populismus. Mal war von gleicher Augenhöhe zu den Großparteien die Rede, dann wieder lieferte sich die FDP in der Bundesversammlung der Union als Hilfstruppe aus. Dem Publikum erschien das unseriös, und das Renommee einer verdienstvollen Partei schmolz dahin. Dennoch: Die FDP hat eine Perspektive, wenn sie verlorene Politikfelder wieder erobert. Sie ist im Innern nicht tot. Es gibt sie noch, die Liberalen, die zu den Kleinen halten wollen. Selbst ein Wirtschaftsliberaler wie Günter Rexrodt ließ die Kleinen wenigstens nicht 10 unerwähnt. Zwar hielt er zu den „Leistungsträgern“: Denen wollte er ermöglichen, Leistung zu zeigen, sich zu entfalten. Dann würde sich eine Volkswirtschaft entwickeln, „die Ressourcen besitzt, damit sie den wirklich Schwachen, denen, die leisten wollen, es aber nicht können, solidarisch zur Seite steht.“14 Wenn man zu den Leistungsträgern hält – so diese Philosophie, hilft man damit auch leistungswilligen Schwachen. Die „leistungsunwilligen Schwachen“ – die es ja geben muss – bleiben außerhalb dieser Betrachtung. Gilt für sie der Liberalismus nicht - jene „Geisteshaltung, die dem Menschen Freiheitsspielräume einräumt, die es ermöglichen, dass er nach seinen Vorstellungen ein freies und erfülltes Leben führt“(Rexrodt)? Wie weit sich die zu Beginn des 21. Jahrhunderts eindeutig wirtschaftsliberale FDP von ihrer Gründerzeit entfernt hat, wird deutlich, wenn man die Einstellung eines Politikers wie des verstorbenen Günter Rexrodt vergleicht mit einem Gründungsdokument von 1946: In den „Programmatischen Richtlinien“ der FDP der britischen Zone hieß es: „Wie der Staat nicht Selbstzweck ist, sondern dem Volke dient, so auch die Wirtschaft. Erstes Ziel der Wirtschaftspolitik ist deshalb entsprechend dem Bedürfnis der breiten Massen die Steigerung der Erzeugung auf allen Gebieten zur Befriedigung des Lebensbedarfs der vermehrten Bevölkerung im verengten Raum... Persönliche Initiative und freier Wettbewerb steigern die wirtschaftliche Leistung, und persönliches Eigentum ist eine wesentliche Grundlage gesunder Wirtschaft. Andererseits darf jedoch die Freiheit der Wirtschaft nicht unsozial missbraucht werden und nicht zur Übermacht von Überstarken führen. Das Recht und die Möglichkeit der Kleinen, sich neben den Großen zu behaupten, muss ebenso gesichert sein wie das Recht derer, die ihr Leben nicht in Selbständigkeit, sondern als Mitarbeiter in großen oder kleinen Betrieben verbringen.“15 Bei allen zeitbedingten Forderungen: Es ist die Haltung, die sich bei den Freien Demokraten geändert hat: Anfänglich standen die Bedürfnisse der „Massen“ – des Volkes – im Mittelpunkt des Denkens. 60 Jahre später sind die Interessen der Funktionseliten das Primäre für die FDP, und als sozialpolitische Absicherung wird behauptet, das diene wenigstens einem Teil der Schwachen. Wie Hohn klang da die Werbeformel von der „Partei des ganzen Volkes“! Was muss die FDP tun, um von den Wurzeln her den Liberalismus neu zu entfalten? Die FDP müsse wieder Themen besetzten, sagt Gerhart-Rudolf Baum: „Kulturpolitik, Bürger- und Menschenrechte, Bildungspolitik, Umweltpolitik...“ Und Wolfgang Lüder bringt es auf die Formel: „Liberalismus muss erklärt werden: was wollen wir sein.“ Die FDP müsse „Leuchtfeuer“ aufstellen: Datenschutz, Recht und Umwelt.“ Und er fordert ein „Nachdenken über das Verhältnis zu den Grünen.“ 11 Die FDP selber stellt seit den Wiesbadener Grundsätzen das Thema Gerechtigkeit als „Generationengerechtigkeit“ in den Mittelpunkt. Im „Deutschlandprogramm 2005“ heißt es: „Die Lasten einer überalterten Gesellschaft müssen gerecht auf die Schultern aller Generationen verteilt werden“. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine substanzielle Position liberaler Politik, sondern um Klientelpolitik - zugunsten von Wählern aus der jüngeren Generation. Die FDP könnte es schaffen, sich von unten zu reformieren und im deutschen Parteiensystem neu zu positionieren als Partei eines an Gerechtigkeit orientierten Liberalismus. Bei aller Bedeutung der Rechtsstaatsthemen und der Beziehungen zur Konkurrenz: Alles steht und fällt mit der sozialen Frage. Entgegen verbreiteten Vorurteilen hatte die FDP seit den 50er Jahren soziale Verantwortung gezeigt. Wahrer Liberalismus will die Emanzipation möglichst aller, muss Ungerechtigkeit und Armut mit Herz und Verstand bekämpfen. Die FDP jedoch war zwischen 1998 und 2002 zur Apologetin des globalen Kapitalismus geworden. Die Führung der FDP hatte spätestens ab 1998 das Augenmaß bei der Parteinahme für die Marktwirtschaft verloren. Sie übernahm keine Verantwortung beim Kampf gegen die ungleiche Verteilung von Ressourcen. Ihr fehlte die Leidenschaft beim Engagement für soziale Gerechtigkeit. Es waren gar nicht einmal die wohl formulierten Sozialprogramme, geschrieben im Politiker- und Bürokratenstil, an denen es mangelte. Das Publikum spürte, dass den Repräsentanten der FDP beim politischen Kampf um soziale Gerechtigkeit das Feuer fehlte. Aber das Spiel war noch nicht verloren. Immerhin sagten im Jahre 2004 29% der Deutschen in einer Umfrage: „Wir brauchen die FDP.“ Elisabeth Noelle schloss daraus: „Die FDP ist ein fester Bestandteil unserer politischen Landschaft.“16 Schließlich werde die FDP im Unterschied zu ihren Konkurrenten als Partei der Mitte gesehen. Dennoch sahen 44% der Befragten die FDP als „out“ an, und nur 9% fanden sie „in“. Das Dilemma der FDP: Generell ist sie erwünscht, weil ein Land wie Deutschland eine liberale Partei will. In ihrer konkreten Erscheinungsform zu Beginn des Jahrhunderts war sie weniger gefragt, weil die FDP nicht die erwünschte liberale Partei zu sein schien. In diesem Dilemma ruhte wieder einmal eine Chance, dass es im Innern der FDP-Organisation genügend Kräfte gäbe, die einen freiheitlichen Liberalismus für alle erkämpfen wollen. 12 Nach 2002 wurde nach außen deutlich, dass zumindest die Rechtsstaatlichkeit bei der FDP wieder in Mode kommen könnten. Bürgerrechtsthemen werden aufgegriffen. Soziale Gerechtigkeit wurde wenigstens verbal beschworen. Aber was wird daraus? Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann sich die FDP– entgegen geäußerter anderer Wünsche ihres führenden Personals – bald in der Rolle einer Funktionspartei der Mehrheitsbeschaffung für die Union wieder finden. Ihre Rolle kann quantitativ relevant werden ohne qualitativ brisant zu sein. Es sichert das Überleben und bringt Pfründe. Das Materielle siegt meistens über das Ideelle. Aber in der Politik kommt es manchmal anders als nach den Erfahrungen vermutet. Noch ist die FDP nicht an der Macht. Sollte der Sprung in die Regierung ausbleiben – sei es wegen einer absoluten Mehrheit der Union oder anderer Koalitionen als „schwarz-gelb“ - dann müsste sich die FDP inhaltlich und organisatorisch tatsächlich reorganisieren. Eine liberale Renaissance, bei der die FDP die Chancen für die Freiheit dem beginnenden 21. Jahrhunderts gemäß formuliert, wäre unter diesen Umständen möglich. Die Überlebensstrategie der FDP würde darin bestehen müssen, sich nicht mehr ausschließlich um die Platzierung ihres Produktes auf dem Politikmarkt zu kümmern, sondern zuerst zu sagen, was es heißt, im Zeitalter der Globalisierung und Mediatisierung liberal zu sein. Verkaufs- und Marktfragen würden nachrangig. Sie wären nach der programmatischen und politischen Neujustierung der FDP zu erörtern. Fast möchte man mithin hoffen, dass die FDP noch einmal den Zugang zur Macht verpasst, weil das die Voraussetzung für eine liberale Renaissance wäre und der Gerechtigkeit als Ziel liberaler Politik eine Perspektive eröffnen könnte. Denn eine andere Partei, die überhaupt eine Chance hätte, mit liberaler Politik zu Gerechtigkeit zu gelangen, existiert nicht in Deutschland. Jürgen Dittberner (Juli 2005) 1 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1975 sowie ders., Politischer Liberalismus, Frankfurt/M. 1998 2 Max Weber, Asketischer Protestantismus und kapitalistischer Geist; in: Max Weber, Soziologie. Weltgeschichtliche Analysen. Politik, Stuttgart 1964, S. 357 ff 3 Jürgen Dittberner, Die FDP. Geschichte, Personen, Organisation. Perspektiven. Eine Einführung, Wiesbaden 2005, S. 321 4 ebenda, S. 349 5 ebenda, S. 323 6 ebenda, S. 324 7 ebenda, S. 338 8 Franz Walter, Die SPD. Vom Proletariat zur Neuen Mitte, Berlin 2002, S. 267 9 Frank Bösch, Macht und Machtverlust. Die Geschichte der CDU, Stuttgart/München 2002, S. 274 10 Joachim Raschke, Die Zukunft der Grünen. „So kann man nicht regieren“, Frankfurt/M. 2001, S. 442 13 Eva Sturm, „Und der Zukunft zugewandt?“ Eine Untersuchung zur „Politikfähigkeit“ der PDS, Opladen 2000, S. 337 12 Alf Mintzel, Die CSU-Hegemonie in Bayern. Strategie und Erfolg. Gewinner und Verlierer, Passau 1998, S. 282 13 Guido Westerwelle, Neuland. Einstieg in einen Politikwechsel, München/Düsseldorf 1998, S. 142 14 Dieses Zitat von Günter Rexrodt wie die folgenden von Gerhart-Rudolf Baum und Wolfgang Lüder stammen aus Interviews, die Studenten der Universität Potsdam geführt haben. 15 Programmatische Richtlinien der Freien Demokratischen Partei der britischen Zone von 1946. Quelle: Eilert Tantzen, Verwahrer des Familienarchivs Tantzen 16 Elisabeth Noelle, Vor der Europa-Wahl. Ein Porträt der FDP – zwischen Avantgarde und Zünglein an der Waage; in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Mai 2004, S. 5 11 14