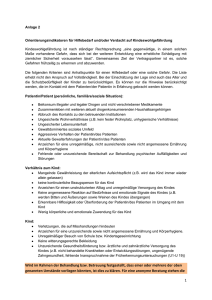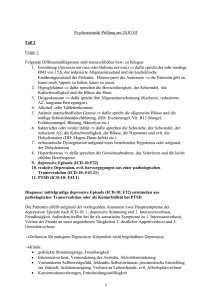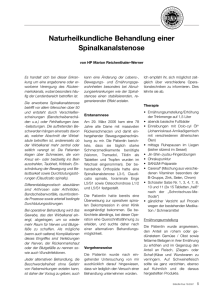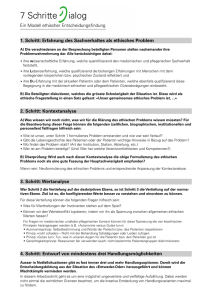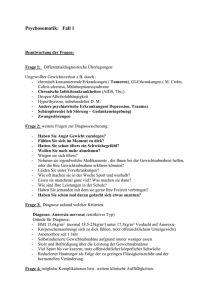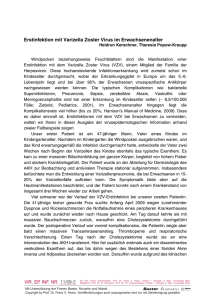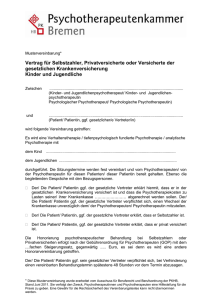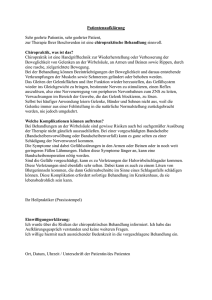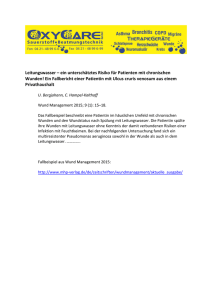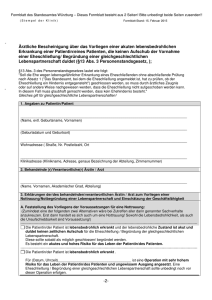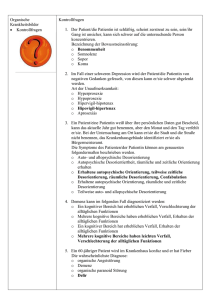Word - 77K
Werbung

The Heart and Soul of Change1 – Ein Modell zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich Jürgen Hargens, Bengta Hansen-Magnusson und Ernst Hansen-Magnusson Abstract Es wird ein Modell psychotherapeutisch-medizinischer Zusammenarbeit im Rahmen einer Landarztpraxis vorgestellt, das sich aus der praktischen Alltagsarbeit heraus entwickelt hat. Das Modell, eine Form der Konsultation, nutzt die Ressourcen der beteiligten Personen, arbeitet zielorientiert an den Anliegen und hat sich, wie die angeführten Beispiele und Zahlen der ersten Evaluationen belegen, als überaus wirksam erwiesen. Dieses Modell wird im Rahmen eines ärztlichen Praxisnetzes gefördert. Keywords Psychotherapeutisch-medizinisches Kooperationsmodell, systemische Praxis, Kompetenz- und Ressourcennutzung, Ziel- und Lösungsorientierung, fächerübergreifende Konsultation, Evaluationsdaten Ein kurzer theoriegeleiteter Einstieg Wir möchten hier ein Modell beschreiben, das wir – ein Arzt und eine Ärztin sowie ein Psychotherapeut – seit mehr als vier Jahren in einem ländlichen Bereich des nördlichen Schleswig-Holsteins praktizieren und das wir – in dem uns möglichen Rahmen – als Beitrag zu einer Optimierung der Gesundheitsversorgung verstehen. Eine der Grundlagen des Modells ist die Überzeugung, dass es sich bei Krankheiten immer um ein systemisches Zusammenspiel vieler Faktoren, körperlicher wie psychologischer und sozialer, handelt, das letztlich nicht auf ein einziges klares und eindeutiges Ursachenbündel zurückgeführt werden kann. Deshalb ging es uns bei unserem Projekt auch nie darum, einen „richtigen“ Zugang zu finden, sondern unsere Leitidee war, die Kompetenzen aller Beteiligten optimal zu nutzen, um dem Ziel – der Verbesserung der Situation des Leidenden – näher zu kommen. Diese Überlegungen finden wir in den Zusammenfassungen über empirische Befunde aus der Psychotherapieforschung bestätigt. So macht eine neuere Veröffentlichung (Hubble, Duncan u. Miller 2001) nicht nur darauf aufmerksam, dass im Bereich der Psychotherapie jede Therapie etwa gleich gut wirkt, sondern auch drauf, dass eine mögliche Erklärung darin besteht, dass es gemeinsame Faktoren gibt, die diese Wirksamkeit erklären können. Diese vier Faktoren werden benannt und in ihrer Bedeutsamkeit für das Therapieergebnis, wie in Tab. 1 erläutert, eingeschätzt (Asay u. Lambert 2001) Tab 1 Wirksame therapeutische Faktoren Wirkfaktor: KlientInnenvariablen u. extratherapeutische Faktoren Beziehungsfaktoren Erwartungs- u. Placeboeffekte Technik- u. Modellfaktoren 1 Varianz am Therapieergebnis: 40% 30% 15% 15% Wir nehmen mit dem englische Zitat Bezug auf den Titel des Buches von Hubble u. Mitarb. (2001) Dabei ist besonders darauf hinzuwiesen, dass es bei den Beziehungsfaktoren so zu sein scheint, dass „die von der KlientIn wahrgenommenen Beziehungsfaktoren – und nicht so sehr die von objektiven Bewertern wahrgenommene Beziehung – stets die positiveren Erfolge mit sich bringen. Außerdem bestehen die größeren Korrelationen in Bezug auf Ergebnisse oft zwischen den Einschätzungen des Fortschritts der KlientInnen und den Berichten der KlientInnen selbst über das Ergebnis „ (Asay u. Lambert 2001, S. 54) Anders gesagt – die Sichtweise der KlientIn scheint bedeutsamer als Einschätzungen der TherapeutIn oder erhobene Messwerte, zumindest wenn es darum geht, den wichtigsten Einzel-Prädiktor zu benennen. Auch diese Ergebnisse sind mehrfach bestätigt worden, z.B. von Grawe u. Braun (1994) oder Frank u. Fliegenbaum (1994). Grawe (1995, mündlich) nennt sogar konkrete Zahlen: „Die Einschätzungen der Patienten im Patientenstundenbogen hängen sehr hoch mit dem Therapieergebnis zusammen. Etwa 50% der Varianz im Therapieerfolg können durch die Einschätzungen der Patienten im Patientenstundenbogen aufgeklärt werden“, dieses Ergebnis sei zudem „breit abgestützt“. Dieses Wissen hat auf andere Weise vor Jahren Eingang in den Ansatz der lösungsorientierten Therapie gefunden: „Der Begriff „Problem“ setzt immer den Begriff „Lösung“ voraus (de Shazer 1992, S. 140). Die KlientIn kann nur dann ein Problem erleben, fühlen oder beschreiben, wenn sie die Idee hat, dass es einen Zustand gibt, der anders – also problemfrei oder gelöst – sein kann. Dies heißt nicht, dass die KlientIn diesen Zustand auch konkret benennen kann, doch sie hat zumindest eine Idee von der Möglichkeit (O´Hanlon u. Beadle 1998). Diese Überlegungen haben uns veranlasst, nicht länger von PatientInnen oder KlientInnen zu sprechen, sondern von KundInnen (Hargens 1993a). Damit meinen wir Menschen, die wissen, was oder wohin sie (etwa) wollen und wohin nicht: Sie sind in diesem Sinne kundig. Der Rahmen des Projekts Nachdem wir einige Zeit im eher üblichen Rahmen – Zuweisungen und Rückmeldungen – über die Arbeit (vgl. Hargens u. Albers 1996), Hausbesuche (Hargens 1993b) und Erfahrungsaustausch kooperiert hatten, begannen wir 1997 mit dem Projekt unter folgenden Bedingungen: Ärztin oder Arzt entscheiden, wem sie ein Gespräch mit dem Psychologen in der Arztpraxis anbieten möchten. Die PatientIn entscheidet, ob sie dieses Angebot wahrnehmen will oder nicht, und sie selber macht den Termin über die übliche Anmeldung in der Arztpraxis ab. Dazu wird dort ein Terminkalender geführt, sodass solche Termine sofort festgelegt werden können. Die Formalitäten werden am Ende des Erstgesprächs geklärt. Im dem Vorschlag der ÄrztIn zu einem Gespräch wird auch deutlich gemacht, dass es den PatientInnen überlassen bleibt, zu entscheiden, wer aus der Familie daran teilnehmen soll. Das Gespräch findet in einem Raum der Arztpraxis statt. Dieser Raum wird für diese Gespräche leicht umgebaut mit einem Stuhlkreis in der Mitte. Darüber hinaus trägt der Arzt bzw. die Ärztin bei diesen Gesprächen normale Kleidung und keinen weißen „Arztanzug“. Es nimmt von ärztlicher Seite immer der/die daran teil, der/die die PatientIn behandelt bzw. den Vorschlag für das Gespräch gemacht hat. Jedes Erstgespräch folgt einem standardisierten Beginn: Nach Begrüßung und Vorstellung fragt der Psychotherapeut zunächst danach, ob Erfahrungen mit Psychotherapeuten vorliegen, um dann die „Regeln“ für diese Gespräche zu erläutern: „Wir fragen viel, und es ist Ihr gutes Recht, nicht zu antworten. Sagen Sie einfach: „dazu möchte ich nichts sagen“. Wir fragen trotzdem weiter ... Und wenn Sie auf die nächste Frage auch nicht antworten mögen, dann sagen Sie das einfach wieder ... Das macht uns die Arbeit leichter, denn Sie sagen wirklich nur das, was Sie sagen wollen ... in Ordnung? .. Und was Sie auf jeden Fall wissen müssen – wir haben vorher nicht über Sie gesprochen. Ich kenne nur Ihren Namen, das ist alles. Nicht dass Sie sich wundern und denken: „Wieso weiß der das denn nicht?“ --- Das machen wir bewusst so. Denn wenn wir über Sie gesprochen hätten, dann wüsste ich sehr viel, was Herr/Frau Doktor über Sie denkt und das muss nicht unbedingt dasselbe sein, was Sie denken ... In Ordnung?“ Erst wenn dies ausdrücklich als „in Ordnung“ befunden worden ist, geht es weiter. Der PatientIn/KundIn soll durch dieses Vorgehen die Auffassung vermittelt werden, dass sie gleichberechtigt ist, dass ihre Meinung und ihr Wohlergehen wichtig sind und dass uns daran gelegen ist, unser Vorgehen transparent zu machen. Der Einstieg in die erste Sitzung geht dann immer über eine Klärung, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist: „Wessen Idee war es, sich hier in dieser Runde zu treffen?“ Meist äußert die PartientIn/KundIn2, dass es die Idee der ÄrztIn gewesen ist. „Dann würde mich zunächst die Idee der ÄrztIn interessieren. Ist es in Ordnung, wenn ich zuerst sie/ihn (der Psychotherapeut zeigt auf die ÄrztIn) befrage?“ Bisher ist es noch nie vorgekommen, dass die PatientIn/KundIn damit nicht einverstanden war. Uns ist dieses Vorgehen wichtig, weil es u.E. hilft, Erwartungen und Vorannahmen zu klären. Die Fragen an die ÄrztIn zielen darauf ab, was sie persönlich veranlasst hat, das Gespräch vorzuschlagen – in der Regel erfolgen Äußerungen sowohl zur Symptomatik als auch zur Besorgnis der ÄrtzIn - und was sie konkret von diesem heutigen Gespräch erwartet, was für sie ein gutes Ergebnis am Ende wäre. Erst dann wechselt der Fokus zur PatientIn/KundIn: „Sie haben gehört, was Herr/Frau Doktor gesagt hat ... was sagen Sie dazu?“ Dann geht es weiter, die Erwartungen und Ziele der PatientIn/KundIn, ehe wir fortfahren: „So etwa ist es, wenn wir hier in diesem Rahmen zusammenarbeiten, dann soll das, was wir hier tun, nutzen. Es geht dabei nicht um uns, sondern es geht um Ihren Nutzen. Und es gibt niemanden, der das besser beurteilen kann, als Sie selber. ... Deshalb sagen wir auch nicht, Sie müssen jetzt so und so oft wiederkommen. ... Wenn Sie danken, es mach Nutzen, dann machen Sie einfach einen Termin aus über die Arztpraxis. Sie rufen an und bekommen einen Termin. In Ordnung?“ Nach Zustimmung geht es weiter: „Wenn wir hier zusammenarbeiten, dann arbeiten wir immer mit denen, die da sind. Wir denken, Sie wissen am besten, wer dabei sein soll oder wer nicht dabei sein soll. Das ist Ihre Entscheidung. In Ordnung?“ Abschließend werden ein paar Informationen über den Projektrahmen gegeben: „Bei dieser Art von Arbeit sehen wir die Leute, als Daumenregel, einmal im Monat, alle vier Wochen. Änderungen brauchen Zeit. ... Und noch eine wichtige Information möchten wir Ihnen gern sagen: Wir bemühen uns, das, was wir hier tun, von der Arztpraxis zu trennen, auch wenn es in den Räumen der Arztpraxis stattfindet. Wenn Sie also das nächst Mal in die Arztpraxis kommen, wundern Sie sich bitte nicht, wenn Herr/Frau Doktor Sie nicht fragt. Er/sie hat dann den weißen Kittel an und fragt Sie nicht. Nicht dass Sie denken, es interessiert ihn/sie nicht. Wenn Sie es ansprechen, dann ist es völlig in Ordnung – nur von sich aus, wird er/sie es nicht ansprechen. ... In Ordnung?“ Dann stehen wir auf, reichen zum Abschied die Hand, und die PatientIn/KundIn geht. Nachdem anfangs die finanzielle Seite offen war, ist das Projekt inzwischen als Modell in das Praxisnetz Region Flensburg (P*R*F) – ein Zusammenschluss niedergelassener ÄrztInnen und einiger Krankenkassen zur Erprobung von Möglichkeiten der Verbesserung der 2 Wir benutzen beide Begriffe, weil wir in Gegenwart der PatientIn/KundIn bei unserem jeweilige Sprachgebrauch bleiben – die ÄrztInnen sprechen von PatientIn, der Psychotherapeut von KundIn. Sobald einer von uns den Eindruck hat, dass dies zu Verwirrung führt, erklären wir unsern unterschiedlichen Sprachgebrauch. Gesundheitsversorgung und zur Reduzierung von Kosten – eingegangen und wird aus Projektmitteln finanziert (Hansen-Maggnusson, Hansen-Magnusson u. Hargens 1999a u.b, Hargens, Hansen-Magnusson u. Hansen-Magnusson 1999) Praxisgeschichten – Geschichten aus der Praxis In der Struktur unseres Gesundheitswesens gibt es, was die Schulmedizin betrifft, therapeutische Hierarchien, in denen PatientInnen „Karrieren“ machen können und die in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zum gewünschten Behandlungserfolg führen. Tritt dieser Erfolg jedoch nicht ein, dann wendet sich die PatientIn gegebenenfalls so genannten Außenseitermethoden zu oder kehrt zur HausärztIn mit der Frage zurück: „Was nun?“ Diese sieht sich mit der Krankheissymptomatik und –problematik allein gelassen, greift manchmal zu kreativen Fantasiediagnosen und –therapien, „er-findet“ „etwas“, um die PatientIn „zu führen“ und ist häufig mit dem eigenen Tun nicht zufrieden, weiß sie doch, dass der Pragmatismus nicht den Vorstellungen der Medizin entspricht, meit denen sie ihren Beruf ausüben wollte. Eine „evidence based medicine“ oder irgendeine Art wissenschaftlich fundierten Handelns ist das sicher nicht! In diesen Fällen ist es hilfreich und aus unserer Sicht notwendig, die Lösung des Problems von einem anderen Blickwinkel aus zu versuchen, gegebenenfalls den gewohnten Weg von der Symptomatik über die Diagnose zur Therapie zu verlassen, den Behandlungsversuch aufzugeben und mit der PatientIn gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Hier tritt die fächerübergreifende Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten im Rahmen des Modells auf den Plan, den wir nach Rücksprache mit unseren PatientInnen um ein gemeinsames Gespräch in unserer Praxis oder – wie im nachfolgend geschilderten Fall – ans (häusliche) Krankenbett bitten. Die 35-jährige M.J. war mit dem Verdacht auf eine so genannte artifizielle Erkrankung aus der Klinik entlassen worden war. Die bisherige, die Behandlung bestimmende Diagnose (in diesem Fall Glukogenose Typ V) war durch eine Spezialklinik widerlegt worden, und das örtlich behandelnde Krankenhaus hatte die Patientin ohne weiteres prognostisches Therapieregime in unsere hausärztliche Betreuung zurückgestellt. Dies bedeutete für die Patientin, dass erstens die KollegInnen aus der Klinik ihr kein definiertes Krankheitsbild als Erklärung für die sehr schwerwiegenden beklagten Beschwerden anbieten konnten und zweitens in ihrem Entlassungskurzbrief der Unterstellung Ausdruck verliehen worden war, die Symptomatik sei artifizieller, d.h. von außen willentlich herbeigeführter Natur. Auf dieser Basis lässt sich, wie leicht zu verstehen ist, keine vertrauensvolle therapeutische Arbeit gründen. Die Behandlung und die Kommunikation mit der Patientin wurde weiter dadurch erschwert, dass sie inzwischen an einer Reihe von Krankheitssymptomen litt, die nicht unmittelbare Folge der primären Erkrankung, sondern Folgen bzw. Auswirkungen inzwischen erfolgter invasivtherapeutischer Eingriffe waren: 1. Retinaembolie rechts mit konsekutivem Visusverlust 2. Iatrogene Nebennierenrindeninsuffizienz 3. Rezidivierende Septikämien 4. Spondylodiscitis L5/S1 (als Folge der Septikämien) 5. Chronische Obstipation (als Folge einer hochdosierten Analgetikatherapie) Was war vorausgegangen? Die Patientin litt bereits seit ihrem 17. Lebensjahr immer wieder unter Abszessbildungen an unterschiedlichen Körperstellen, die zum Teil invasive Behandlungen erforderlich gemacht hatten. Zudem war es zu Eileiterentzündungen gekommen. Sie klagte über ein hohes Schlafbedürfnis, schlechte Konzentration, Trunkenheitsgefühle, Schmerzen in den Beinen (ähnlich Wadenkrämpfen), Zittern der Hände, Zittern der Beine sowie Kraftlosigkeit, Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich, Herzrasen, Schwitzen und vermehrtem Durst. Seit 1988 traten dann wiederkehrende Unterzuckerungen mit nachfolgenden Bewusstseinsverlusten auf. Das beschriebene Krankheitsbild wurde in verschiedenen Universitätskliniken untersucht und einer Klärung zuzuführen versucht. Schließlich kam es zu einer Pankreasschwanzresektion unter der Vorstellung, dass eine so genannte Nesidioblastose (das ist ein insulinproduzierender Tumor) die klinische Symptomatik ausgelöst habe. Das histologische Präparat zeigte jedoch einen Normalbefund, die Verdachtsdiagnose musste fallen gelassen werden. 1990 wurde die Patientin berentet, seit 1995 kam es zu Grand-mal-Anfällen. Wegen nicht beherrschbarer hypoglykämischer Stoffwechsellagen und unter der diagnostischen Vorstellung einer Glukoseverwertungsstörung (Glykogenose vom Typ V McArdle) wurde 1999 ein intravenöser Verweilkatheter eingesetzt, dessen Implantation letztendlich der Anlass für eine Kette von Komplikationen bis hin zur septischen Retinaembolie mit Erblindung gewesen war. Die Wende in der somatische Betrachtungsweise des Krankheitsbildes hat nach einer Untersuchung in einer auf das Krankheitsbild der Glykogenosen spezialisierten Klinik in einer anderen Stadt stattgefunden. Die Patientin wurde unter der Diagnose einer psychosomatischen Erkrankung an ihr Heimatkrankenhaus zurücküberstellt, dort wurde der Verdacht auf eine „artifizielle“ Krankheit artikuliert und die Patientin in die hausärztliche Weiterbetreuung entlassen – mit der Empfehlung eine weiter psychotherapeutische Behandlung einzuleiten. Die jahrelangen schulmedizinischen Versuche, die Leidenssymptomatik einer Klärung zuzuführen, waren gescheitert. Die umfangreichen invasiven Behandlungsmaßnahmen hatten lebensbedrohliche Komplikationen herbeigeführt, die die Patientin für den Rest des Lebens schwerwiegend beeinträchtigen könnten und würden. Wie sollte man der Patientin nun die medizinischen Irrwege erläutern, ihr zugleich im Rahmen der medizinischen Behandlung eine von Hoffnung getragene Perspektive für die Zukunft anbieten und einen Behandlungserfolg erzielen? In diese Situation war es für uns HausärtzInnen erleichternd, dass Patientin und Ehemann im Frühjahr 2001 dem Vorschlag eines gemeinsamen Hausbesuchs mit einem psychologischen Psychotherapeuten zustimmten. Hausarzt und Psychologe fuhren zur Wohnung der Patientin, wurden vom Ehemann begrüßt und ins Schlafzimmer geführt, wo die Patientin im Bett lag. Das Gespräch drehte sich sowohl um medizinisch-diagnostische Fragen wie um die aktuelle familiäre Situation. Dabei achteten die Fachleute sehr genau darauf, Ressourcen zu erkennen, hervorzuheben und in Beziehung zu dem zu setzen, was die Eheleute erreichen wollten. Die Anwesenheit aller Beteiligten half, nicht in Schuldzuweisungen zu verfallen, sondern Klagen, die in diese Richtung zielten, auch als Ausdruck der vorhandenen Kraft und des starken Willens zu sehen, die Situation zu „meistern“ und/oder zu verändern. Wenn der Volksmund sagt, dass vier Augen mehr als zwei sehen, so erleichtert genau dies – Arzt und Psychologe schauen mit vier Augen -, kleinste positive Änderungen zu erkennen und zu benennen und sich nicht in negativistischen Beschreibungen und Klagen der Vergangenheit zu verstricken. Arzt wie Psychotherapeut nutzten darüber hinaus die Möglichkeit, über das, was sie sahen, fühlten, dachten und spürten, vor den Eheleuten wertschätzend zu reflektieren – was immer medizinisch-diagnostische wie psychologischsoziale Aspekte einschloss. Auch wenn das erste Gespräch scheinbar ohne konkrete Absprachen, Aufgaben oder benennbare Möglichkeiten endete, so meldete sich das Paar, um einen zweiten Termin zu vereinbaren, der einen Monat später (im Frühjahr 2001) erneut im Schlafzimmer der Eheleute stattfand. Weitere als diese zwei Gespräche haben bisher nicht stattgefunden und aus hausärztlicher Sicht lässt sich sagen, dass heute (Herbst 2001) folgende Therapieziele erreicht werden konnten: 1. Reduktion der Analgetikadosis 2. Erziehlung eines Mobilitätsradius der Patientin 3. Erweiterung des Mobilitätsradius der Patientin 4. Vermeidung von Hypoglykämien durch Ernährungsmanagement 5. Verbesserung der innerfamiliären Kommunikation 6. Absetzen der Dauerantibiose Die stetige Besserung der Symptomatik schuf einen hoffnungsfroheren Ausblick auf die weitere Zukunft und dieser Optimismus trug wiederum zu einer Stärkung des familiären Zusammenhaltes bei. Die Patientin konnte artikulieren, dass es in Hinblick auf die Prognose für ihr Leben „besser sei“, keine Glykogenose zu haben, denn die Ungewissheit über den weiteren Krankheitsverlauf bietet der Hoffnung mehr Raum als das Wissen um den (tod-) sicheren Verlauf einer Glykogenose! Im Sommer des Jahres, in dem die beiden Gespräche stattgefunden haben – dies der Vollständigkeit halber -, fuhr die Familie mit einem Wohnmobil in Urlaub3. Indikation Da sich unser Modell aus der Praxis ergeben und in der Praxis entwickelt hat, sind wir nicht in der Lage, eine eindeutige Indikation zu beschreiben, die objektivierbaren Kriterien genügt. Bei jeder (nachträglichen) Reflexion unseres Tuns sind und bleiben wir auf unserer Wahrnehmungen, unsere Subjektivität angewiesen. So beschreiben die ÄrztInnen die Indikation – in einer Art zusammenfassender Erfahrung der letzten vier Jahre – stichwortartig folgendermaßen: Das schulmedizinische Konsiliarklavier gibt keine Lösung für die vom Patienten vorgestellte Leidensgeschichte; Mangel an geeigneten Therapieplätzen und Deklarierung der PatientIn als mit den vorhandenen Methoden nicht behandelbar; Vorausgegangene Behandlungen, insbesondere Psychotherapien wurden von der PatientIn als demütigend, respektlos und invasiv empfunden; Nur im Schutz einer ihnen vertrauten Umgebung fassen die PatientInnen den Mut zum Gespräch mit dem Psychologen (ich denke, dass wir ÄrztInnen oft nicht genug respektieren, wie hoch das Vertrauen in die HausärztIn ist); Wir unterstellen (oder haben die Einsicht gewonnen), dass nur noch die PatientIn Verfahren, Rhythmus und Fortschritt der Behandlung (kann man es dann noch so nennen?) bestimmen kann, wenn sich eine Änderung seines(ihres Zustandes zum „Besseren“ ergeben soll; Die HausärztIn möchte seine/ihre „Unterstellungen“ zum therapeutischen Prozess im Schutze der psychologischen Supervision mit der PatientIn erörtern; Die HausärztIn weiß irgendwie nicht weiter, obwohl er/sie schon alle symptombezogen arbeitenden KollegInnen gefragt hat; 3 Leider konnten wir aus ganz praktischen (Zeit-)Gründen in diesem Falle keine Modellrechnung der Kostenersparnis berechnen – wir haben dies in einem anderen Fall (Diagnose: chronischer Schmerz) einmal versucht (Hansen-Magnusson, Hansen-Magnusson u. Hargens 2000) und waren vom Ergebnis selbst überrascht. Im psychosomatischen Konsil wird dem Wesen und Charakter der PatientIn/KlientIn mehr Gewicht gegeben, als ein medizinisches oder auch rein psychotherapeutisches Verfahren kann, weil bei diesen immer ein pathologisch definierter Zustand Grundlage der Intervention sein muss. Evaluationen Ein Nachweis der Wirksamkeit unseres Modells, der über subjektive Eindrücke hinausgeht, ist notwendig, übersteigt aber unsere Alltagsmöglichkeiten. So haben wir anderenorts zwei subjektive Annäherungen vorgestellt (Hansen-Magnusson, Hansen-Magnusson u. Hargens 2000, S. 345fff), in die wir auch eine erste Schätzung der Kostenreduktion eingearbeitet haben. Wir haben 1997 und 1999 zwei Evaluationen durchgeführt, die explorativen Charakter haben und keinen strengen Kriterien genügen können, weil wir zugleich BehandlerInnen wie UntersucherInnen waren. Wir möchten im Folgenden einen kurzgefassten Überblick geben. Tab.2 gibt einen Überblick über die Anzahl der Sitzungen: Tab.2 Anzahl der Sitzungen 1997 N 1 24 2 4 3 2 4-5 1 6 1 davon fortlaufend 4 N=32 % 75,00 12,50 6,25 3,125 3,125 12,5 1999 N 8 6 2 1 1 1 N=18 % 44,4 33,3 11,1 5,5 5,5 5,5 Diese Statistik macht deutlich, dass in aller Regel nur sehr wenige Sitzungen durchgeführt werden – 1997 handelte es sich in 87,8% um ein bis zwei Sitzungen, und 1999 lag der Prozentsatz bei 77,7. Anhand der Krankengeschichte erarbeiteten wir dann zwei Vergleichswerte für eine Einschätzung des Erfolgs: zum einen die Häufigkeit der ÄrztInnenbesuche vor und nach dem Konsil, zum anderen die entsprechenden Veränderungen im Symptombild. Beides schätzten wir dann auf einer fünfstufigen Skala ein, die wir in Tab.3 wiedergegeben definiert war (vgl. Hansen-magnusson, Hansen-Magnusson u. Hargens 1999b, S. 18f). Tab.4 gibt einen Überblick über die eingeschätzten Ergebnisse. Tab.3 Einschätzung des Erfolgs ++ Maximaler Erfolg Weniger Arztbesuche und/oder Verschwinden der Symptomatik + Erfolg Weniger Arztbesuche und/oder Verbesserung der Symptomatik ? Nicht einzuschätzen, unklar Kein Erfolg Arztbesuche und/oder Symptomatik unverändert -Misserfolg Mehr Arztbesuche und/oder Symptomatik verschlechtert Tab.4 Ergebnisse ++ + ? 1997 N 14 13 4 % 43,750 40,625 12,500 1999 N 6 10 1 % 33,3 55,6 5,5 -- 0 1 0,000 3,125 1 0 5,5 0,0 Bei aller Vorsicht ist die Erfolgsrate (+ und ++) unseres Modellprojektes ausgesprochen ermutigend: 1997 bei ca. 84%, 1999 bei ca. 89%. Auch hier bemühten wir uns, das Bild abzurunden, indem wir nach dem Nutzen aus Sicht der ÄrztInnen fragten. Das ergab folgende Beschreibungen: Die Konsultationsfrequenz in der Sprechstunde sinkt. Die PatientIn braucht, falls es darum geht, eine helfende GesprächspartnerIn zu finden, keine somatische Symptomatik als „Eintrittskarte“. In der Langzeitbeobachtung und –betreuung der Familien erkennen wir die gewachsene Sicherheit im Umgang miteinander (Partnerkommunikation, Kindererziehung). Wir sind entlastet, wenn wir sehen, dass die PatientIn seine/ihre Somatisierung „vergisst“ und sich in Eigenkundigkeit der Lösung seiner/ihrer „Probleme“ zuwenden kann. Bei so genannten Langzeitkonsilien wird u.E. in kürzester Zeit durch die Neustrukturierung der Behandlungsbeziehung dem Leben Halt, Orientierung und Wende gegeben. „Aktionsfeld“ der HausärztInnen sind verschiedene Bereiche: Soma, Psyche, soziales Umfeld, Kommunikationsart, Verhalten der KundIn, PatientIn etc. Hier erleben sich Hausärzte oft von der Fülle der Erwartungen überfordert und erleben es als entlastend, die eigene Kompetenz durch das psychosomatische Konsil erweitern zu können. Auf den direkten ökonomischen Nutzen, der sich auch aus dem Honorarverteilungsmaßstab ergibt, waren wir in den ersten Veröffentlichungen schon eingegangen. Die dritte Seite der Medaille Damit die Stimmen der KlientInnen Gehör finden (Conran u. Love 1993), haben wir 1999 PatientInnen/KundInnen, die ein dreiviertel Jahr keinen Termin mehr vereinbart hatten, einen Fragebogen zugeschickt und möchten die erhaltenen Zahlen unkommentiert auflisten (Kasten 1). Auch wenn die Antworten auf die offenen Fragen noch nicht im Einzelnen ausgewertet sind, zeigen sich hier Tendenzen. Da ist zum einen die Wertschätzung, die den HausärztInnen entgegengebracht wird, die sich in Äußerungen ausdrückt, die betonen, wie wichtig es ist, in einer „vertrauten Umgebung“ zusammenzukommen. Die Anwesenheit der HausärztInnen wurde immer wieder hervorgehoben, denn darin spiegelte sich für die PatienInnen das Engagement und Interesse wider, was sehr positiv eingeschätzt wurde. Zum anderen betonten die Befragten, wie sehr sie sich respektiert und ernst genommen fühlten, was auch als eine Stärkung des Selbstbewusstseins erlebt wurde. Und zum Dritten erwähnten viele Befragte, dass sie es zu schätzen wussten, andere Perspektiven sehen zu können, sich gewissermaßen von dritter Seite aus (wertschätzend) infrage zu stellen. Eine PatientIn/KundIn fasste es folgendermaßen zusammen: „... (Sie, ÄrztIn und Psychotherapeut) haben mir in die Schuhe geholfen! Laufen muss ich selbst.“ Kasten 1 Ergebnisse des PatientInnenfragebogens Frage: Hat sich das Problem, das Anlass dieses Gesprächs war, gebessert, ist es gleich geblieben, oder hat es sich verschlechtert? Gebessert 17 Gleich geblieben 8 Verschlechtert 0 Summe 25 Zwei Antworten konnten nicht eingeordnet werden, da sie sich auf zwei Kategorien bezogen. Frage: Haben sich andere Probleme, die nicht Thema des Gesprächs waren, gebessert, verschlechtert oder sind sie gleich geblieben? Gebessert 10 Gleich geblieben 6 Verschlechtert 3 Es gibt keine anderen Probleme 6 Summe 25 Zwei Antworten konnten nicht eingeordnet werden, da sie sich auf zwei Kaategoreien bezogen. Frage: Sind in der Zwischenzeit neue Probleme aufgetreten? Ja 9 Nein 18 Summe 27 Frage: Das Gespräch bewerte ich als: Sehr hilfreich und nützlich Hilfreich und nützlich Weder ... noch Nicht hilfreich und nützlich Überhaupt nicht nützlich und hilfreich Summe 15 11 1 0 0 27 Und nun ... Das Modell, das wir hier beschrieben haben, setzt in unseren Augen einen (kleinen) Unterschied, der einen Unterschied macht – das gleichberechtigte Nebeneinander unterschiedlicher Kompetenzen, eingebunden in ein bekanntes Setting (die Arztpraxis) mit kurzen Wegen, raschen Terminen, Respektieren und Wertschätzen unterschiedlicher Perspektiven und Erfahrungen, orientiert an gemeinsam erarbeiteten Zielen. Es fallen uns zwei Aspekte ein, die uns wichtig sind. Der Name sei ... Da Sprache Wirklichkeiten konstruiert, macht der Name für uns einen Unterschied. Begriffe wie „medizinische Familientherapie“ oder „systemische Familienmedizin“ oder „Familientherapie in der Medizin“ (McDaniel, Hepworth u. Doherty 1997, Kröger, Hendrischke u. McDaniel 2000, Cierpka, Krebeck, u. Retzlaff 2001) behagen uns einfach deshalb nicht, weil in der Bezeichnung zwei Dimensionen verschwinden, die für eine kollaborative Praxis bedeutsam sind: die Expertise und Kompetenz der KundIn/PatientIn sowie das spezifische Wissen aus der Psychologie. Ausgangspunkt unseres Modells war und ist die medizinische Alltagspraxis, die sich am Leiden der PatientIn festmacht. Die Veränderung, die uns bedeutsam ist, findet an der Schnittstelle der unterschiedliche Kompetenzbereiche statt – an dem, was das medizinische Fortschritt zu bieten hat und an dem, was psychologische Kenntnis und psychotherapeutische Möglichkeiten einbringen. Würden wir der bisherigen Terminologie folgen, so würde das Modell nicht nur unter dem Dach der Medizin landen, sondern zugleich die beiden anderen Bereiche ausklammern, somit gewissermaßen sprachlos machen. In der Region des P*R*F heißt das Modell „psychosomatisches Konsil“ – ein Begriff, der uns auch nicht zufrieden stellt, der allerdings notwendig war, um das Modell im Rahmen und mit Mitteln des Praxisnetzes zu fördern. Anders gesagt – wir befinden uns auf der Suche nach einem passenden Begriff, der das gleichberechtigte Miteinander der drei beteiligten Kompetenzen auch ausdrückt. Anregungen sind erwünscht. High Utilizer Die Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitssystem ist durchaus nicht gleich verteilt, worauf viele Untersuchungen verweisen: „Mit Blick auf die ärztliche Alltagswirklichkeit erscheint bedeutsam, dass 10% der Patienten in Allgemeinpraxen als High Utilizer ein Drittel bis zur Hälfte der täglichen Sprechzeit eines Allgemeinarztes beanspruchen“ und dass „diese Patientengruppe ca. 70% der Gesundheitskosten verursacht ... Identifikationsmerkmal der High Utilizer ist ... das gleichzeitige Vorliegen einer somatischen und einer psychosozialen Diagnose“ (Hendrischke u. Kröger 1997). Wenn wir auf unsere Daten schauen, so denken wir, dass unser Modell durchaus auch dazu beitragen kann, auf diese Gruppe einzuwirken – ein Großteil der PatienInnen/KundInnen senkte die Anzahl der Arztbesuche. Dennoch bleiben Unklarkheiten bestehen, in welchem Umfang dies tatsächlich zutrifft. Das können unsere subjektiven Einschätzungen nicht bestimmen. So verwundert es nicht, wenn unser Wunsch ein doppelter ist: Zum einen wünschen wir uns NachahmerInnen, KollegInnen, die den Mut haben, Neues zu probieren, ihre KlientInnen/PatientInnen/KundInnen ebenso ernst zu nehmen wie ihre eigenen Ideen und Kompetenzen. Zum anderen wünschen wir uns Unterstützung für unser Modell, damit es nicht untergeht – Unterstützung auch in dem Sinne, das Interessierte uns kontaktieren, um das Material für eine umfassende Wirksamkeitsuntersuchung zu nutzen. Jürgen Hargens, geb. 1947, Psychologischer Psychotherapeut, eigene Praxis seit 1979, zunächst in Flensburg, sein 1981 in Meyn. Bengta Hansen-Magnusson, geb. 1955, praktische Ärztin, seit 1986 Landarztpraxis in Wanderup. Ernst Hansen-Magnusson, geb. 1952, Dr. med., Arzt für Allgeminmedizin, seit 1986 Landarztpraxis in Wanderup.