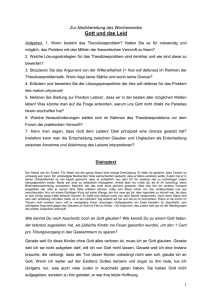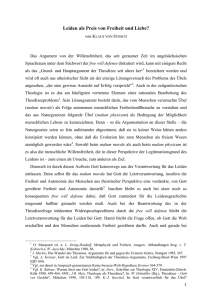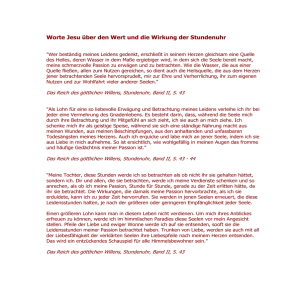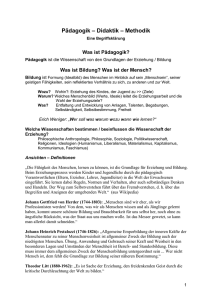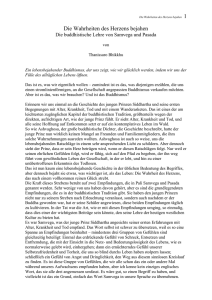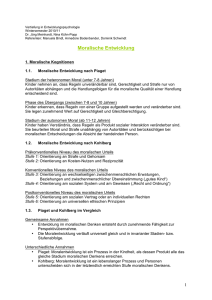Wandruszka - Das leidende Subjekt
Werbung

MÖGLICHKEIT UND GRENZE EINER WISSENSCHAFT VOM LEIDENDEN SUBJEKT - eine kurze Epistemologie von Psychiatrie und Psychotherapie, verstanden als dialogische Handlungswissenschaft - Boris Wandruszka, Stuttgart, 2013 Grußwort: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag über die Möglichkeiten und Grenzen einer Wissenschaft vom leidenden Subjekt und danke Herrn X für die freundlichen Einführungsworte. Was nun den Inhalt meines Referates betrifft, ist mir wohl bewusst, mit dieser explizit wissenschaftstheoretischen Fragestellung ein eher trockenes und abstraktes Thema gewählt zu haben. Gerade bei einem primär so subjektiven Gegenstand wie dem leidenden, ja wie dem auf gestörte, auf kranke Weise leidenden Subjekt schien mir jedoch der Versuch geboten, die Möglichkeit der wissenschaftlichen, d.h. methodisch begründeten und methodisch durchsichtigen Herangehensweise auszuloten. Darüber hinaus meine ich, dass gerade bei der Gründung einer wissenschaftlichen Gesellschaft, die im Rahmen dieses Kongresses stattfindet, die Besinnung auf ihre besondere Weise der Wissenschaftlichkeit nicht unterbleiben darf. Wie also ist diese beschaffen? 2 1. Einleitung: Leiden und Wissenschaft – ein Widerspruch? „Wissenschaft vom Leiden“, diese scheinbar so harmlos dastehende Wortfügung – birgt sie nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen eklatanten Selbstwiderspruch? Während wir nämlich im Leiden ein affektiv-ergreifendes, subjektiv-belastendes und zunächst und zumeist nur intuitiv verstandenes, ja allzu oft unverstandenes Geschehen sehen, impliziert die wissenschaftliche Tätigkeit – anscheinend völlig konträr dazu - eine Haltung, die in nüchtern-kühler, distanziert-rationaler, von allen allzu persönlichen Ambitionen absehender Weise allgemein gültige Erkenntnisse in argumentativdiskursiver Weise zu gewinnen sucht. Trifft diese Gegenüberstellung zu, dann dürfte wohl zu Recht gefragt werden, ob ein „Phänomen“ wie das Leiden nicht auf der Strecke bleibt, ja bleiben muss, wenn es auf distanziert-diskursive Weise in abstrakt-allgemeinen Begriffen formuliert wird? 1. Schaubild Leiderleben und Wissenschaft – eine Disjunktion? Subjektivität versus Objektivität? Konkretheit versus Abstraktion? Affektivität versus Rationalität? Intuition versus Diskursivität? Singularität versus Allgemeingültigkeit? Erleben versus Sprache? Entgegen diesen Bedenken hoffe ich im Folgenden zeigen zu können, dass - auch ein solch individuell-subjektives Phänomen wie das Leiden oder das leidende Subjekt über Strukturmomente verfügt, die echt allgemein sind und daher sprachlich und begrifflich fassbar sind; - dass Sprache und Wissenschaft, wenn auch in Grenzen, sehr wohl das Subjektive, Individuelle, Singuläre erfassen können, ja sogar, um überhaupt allgemein verbindliche Aussagen zu treffen, erfassen müssen. Denn, wie sich zeigen wird, ist das Singuläre die ontologische Basis des Allgemeinen. - Und schließlich möchte ich darlegen, dass das Wesen eines Phänomens, einer Sache, eines Sachverhaltes erst dann adäquat erfasst ist, wenn seine allgemeinen und seine individuellen Bestimmungsstücke berücksichtigt und zusammengeschaut werden. 2. Schaubild: der konjunktive Standpunkt a. Alles Individuelle impliziert allgemeine Strukturmomente. b. Wissenschaft kann und muss das Singuläre als Basis des Allgemeinen beachten. c. Das „volle“ Wesen eines Sachverhaltes umfasst individuelle und allgemeine Momente. 3 Wissenschaftstheoretisch stellt sich damit die Aufgabe, Methoden der Erkenntnisfindung und sicherung herauszuarbeiten, die in der Lage sind, sowohl das Singulär-Individuelle als auch das Allgemeine bzw. sowohl das Qualitativ-Existenzielle als auch die begrifflich-unsinnlich bestimmte Wesensstruktur oder Essenz in den Blick zu nehmen. 3. Schaubild: die Aufgabe Wissenschaft vom Leiden als Einheit von Individuell-Subjektivem und Allgemein-Intersubjektiven von Qualitativ-Existenziellem und Ideell-Essenziellem therapeutisch relevant: a. subjektiv-individuell: von leiblich-koenästhetisch-empathischem Verstehen, psychologischem Verstehen, interaktionell-szenischem Verstehen b. allgemein: und sprachlich-logisch-theoretischem Verstehen Daher werde ich im Folgenden in ständiger gegenseitiger Bezugnahme die spezielle Ontologie des leidenden Subjektes und die dafür geeignete Epistemologie und Methodologie, soweit das in diesem Rahmen möglich ist, darzustellen versuchen. 4. Schaubild: der Weg Spezielle Ontologie des Leidens („Was ist Leiden?“) in korrelativer Wechselbeziehung zu spezieller Epistemologie/Methodologie des Leidens („Wie lässt sich Wesen und Sinn des Leidens erkennen?“) „Grundsatz der Intentionalität“: Jedem Was („Gegenstand“) entspricht ein Wie („subjektiver Vollzug“) und umgekehrt. 4 2. Die drei Wissenschaften des Leidens Was nun die Wissenschaft vom Leiden selbst betrifft, so zeigt eine erste Besinnung, dass sie alles andere als monolithisch bzw. als homogen-einfach ist, sondern dass sie sich aus mehreren Wissenschaften zusammensetzt, die eine komplexe und kritische Einheit bilden. Die Basis dabei bildet die Phänomenologie bzw. phänomenologische Psychopathologie, die den Gegenstand – das Leiden bzw. das kranke Leiden – überhaupt erst erscheinen lässt. Ohne sie wären die beiden anderen Wissenschaften inhaltsleer. So schon die empirische Psychologie zusammen mit der Neurobiologie, denen es darum geht, die neuronalen, verhaltens- und kognitionspsychologischen Korrelate zu einem konkret-leidvollen Erleben zu bestimmen. Wüssten sie nicht, was Leiden überhaupt meint und seinem (phänomenologisch-eidetischen) Wesen nach ist, könnten sie auch die entsprechenden Korrelate nicht finden. Ich spreche daher im Falle der Neurobiopathologie auch von einer „Korrelationswissenschaft“. Auf diesen beiden Wissenschaften baut schließlich drittens jene Wissenschaft auf, die über alles Phänomenologische und Empirische hinausgeht und die psychodynamischen Hinter- oder Untergründe des Leidens, also seine un- und vorbewussten Motive bzw. Motivverarbeitungen, noch tiefer die Hemmung, Abwehr und Transformation konfliktuös besetzter Grundbedürfnisse erarbeitet und bewusst macht. Ihr Name ist bekannt: Es handelt sich um die Tiefenpsychologie bzw. die Psychoanalyse. 5. Schaubild: die drei Wissenschaften vom Leiden 3. Tiefenpsychologie 2. empirische Psychologie/Soziologie/Neurobiologie 1. Phänomenologie (wissenschaftstheoretische Basis) So verschieden alle drei Wissenschaften sein mögen, sie zentrieren sich um das Phänomen Leiden und suchen es, in Sprache umzusetzen. Sprache, verbale wie non-verbale Sprache, wird daher zum wesentlichen Medium der Leidenserfahrung, des Leidverstehens und der Leidaufarbeitung, also seiner Transformation. Geraten wir hier jedoch nicht in ein Dilemma, in eine Sackgasse? 5 3. Sprache und Leiden In der Tat, es scheint so. Denn da Sprache vereinfacht, abstrahiert und verallgemeinert - andernfalls wäre Verständigung unmöglich -, drängt sich die Frage auf, ob wir überhaupt sinnvoll vom Leiden, ja vom konkreten Leiden eines ganz bestimmten Individuums reden können. Diese Anfrage gewinnt im Rahmen psychopathologischer Phänomene dadurch eine Zuspitzung, dass der psychisch kranke Mensch oft nicht in der Lage ist, sein Leiden zu versprachlichen, sei es, weil es buchstäblich überwältigend und deswegen „unsäglich“ ist, sei es, weil das Sprach- und Denkvermögen selbst gehemmt, verwirrt oder beschädigt ist. Eine negative Antwort bedeutete allerdings dann nicht nur, kaum dass es begann, das Ende dieses Referates, sondern die Nutzlosigkeit aller sprachvermittelten Therapeutik. Glücklicherweise führt uns das Leben der Sprache selbst aus dieser drohenden Sackgasse hinaus. Halten wir nämlich nach jenen Sprach-Schauplätzen Ausschau, auf denen das persönlich-subjektive Erleben am besten zum Ausdruck kommt, dann ist es zweifellos die Dichtung, die uns hier am intimsten an die Sache heranführt. Da im Leiden, wie zu zeigen sein wird, eine eminent dramatische Dynamik am Werk ist, verwundert es nicht, dass nicht wenige Sprachkunstwerke gerade an ihren Anfang diese Thematik - gleichsam als Urmovens ihres weiten geistig-emotionalen Spannungsbogens - setzen: So schon die Ilias, die Gründungsurkunde des Abendlandes, wo es heißt: „Göttin, singe mir nun des Peleussohnes Achilleus unheilbringenden Zorn, der tausend Leid den Achäern schuf…“. und analog die Odyssee, das zweite große Epos des Homer, an dessen Anfang von ihrem Helden Odysseus gesagt wird: „Vieler Menschen Siedlungen sah er und lernte ihr Wesen kennen und litt auf dem Meer viel Schmerzen in seinem Gemüte.“ Denken wir an deutsche Dichter, so fallen uns gleich zwei epochale Dichtungen ein, an deren Anfang Seufzer und Klage, Schmerz und Verzweiflung stehen: „Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühn. Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor.“ Schon das kleine Wörtchen „ach“, das vom Faust-Dichter an rhythmisch genialer Stelle plaziert ist, bringt tiefen seelischen Schmerz zum Ausdruck. Und keine geringere Verzweiflung vernehmen wir, wenn Rilke in der ersten Duineser Elegie singt: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören.“ Wie diese wenigen Beispiel beweisen, kann Sprache sehr wohl Beides: das Singuläre, Einmalige, hier in Form persönlichsten Leidens, zur Darstellung bringen und doch auch das Überindividuelle, das Allgemeine, ja das Abgründige, Geheimnisvolle und Transzendente als umfassenden Horizont aufreißen. Ob Achill, Odysseus, Faust oder Rilke – sie alle ringen zwar als einzigartige Subjekte in 6 einmaliger Weise um ihre Existenz, manchmal sogar bis zum sprachlichen Verstummen, doch sowohl die Konflikte, in die sie verstrickt sind, als auch die Art und Weise, wie sie leiden, haben alle Kreaturen, die fühlen und denken, mit ihnen gemeinsam. Fragen wir doch nur einmal: Wer von uns hätte noch nicht wie Achill um die Anerkennung seiner Person und die Achtung seiner zu Unrecht verletzten Ansprüche gekämpft? Wer sich nicht wie Odysseus nach jenem Ort, wo er sich hingehörig, und jenen Menschen, wo er sich zugehörig fühlt, gesehnt? Wer von uns wäre nicht schon wie Faust an der Unfähigkeit verzweifelt, „zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält“? Und wer würde nicht wie Rilke vor der Hingabe an ein Größeres, Höheres, in dem wir unser kleines Ich loslassen müssen, angstvoll zurückschrecken? Zusammengefasst dürfen wir sagen, dass eine Wissenschaft vom Leiden sich nicht formalistisch oder rationalistisch einengen darf, sondern aus allen Quellen menschlicher Kreativität – aus Alltag, Kunst, Mythos, Philosophie, Politik, Religion und Spiritualität – schöpfen soll, um gerade so ihrem Gegenstand, dem „leidenden Subjekt“, gerecht zu werden. Große Psychotherapeuten wie Freud, Jung, Jaspers und Binswanger bieten für diesen umfassenden Ansatz überzeugende Beispiele. 7 4. Die Wesensfassung des Leidens durch den epistemologischen Dreischritt Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne würde ich Ihnen noch weitere Beispiele aus der Literatur beibringen und etwa aus den griechischen Tragikern, aus dem Woyzeck von Büchner oder aus den Dramen Samuel Becketts vorlesen, Werke, in denen das Leid kongenial in Szene gesetzt ist. Doch genügen die bisher vorgebrachten Beispiele aus Epos, Drama und Lyrik durchaus, um in einer ersten Besinnung das Phänomen Leiden, und zwar zunächst diesseits aller Psychopathologie, zu erhellen. Drei methodologisch-epistemologisch wichtige Stufen sind dabei zu erklimmen, eine intuitive, dann – darauf aufbauend – eine diskursive und danach erneut eine intuitive: 1. - Im ersten Schritt gilt es, sich mittels eines unmittelbar ganzheitlichen, perzeptiv-auffassenden und affektiv-resonierenden, darin allerdings noch weitgehend undifferenzierten Erspürungsaktes mit dem Phänomen Leiden überhaupt vertraut zu machen, mit ihm in koenästhetische Fühlung zu kommen, 2. - um dann aus diesem qualitativen Material der konkreten Fülle in einem zweiten Schritt diskursiv/diakritisch, d.h. betrachtend-rational und analytisch-differenzierend, aufzudecken, was Leiden – seiner allgemeinen Grund- und Wesensstruktur nach – ist. 3. - In einem dritten Schritt erfolgt schließlich wiederum eine intuitive, nun aber zugleich differenzierte Erkenntnisleistung, in der – im Unterschied zur ersten noch undifferenzierten Intuition – die beiden ersten Erkenntnisschritte ganzheitlich-direkt und differenziert zusammengeschaut werden. 6. Schaubild des epistemologisch-phänomenologischen Dreischrittes 1. Ganzheitlich-undifferenzierte Intuition (Anmutung, „koenästhetische Erspürung“) 2. differenzierend-diskursive Analyse („diakritisches Denken“) 3. ganzheitlich-differenzierte Intuition („versprachlichte Gesamt-Gestalt-Anschauung“) Nehmen wir etwa das Leid des Faust in seinem Eingangsmonolog, seine schmerzlich-unerträgliche Not, wissen zu wollen, aber nicht wissen zu können, dann gilt das erste Anliegen der Frage, was sich von der spezifischen Qualität, der unmittelbaren Seinseigenart und Seinsgefülltheit des Leidens auf der ersten epistemologischen Stufe, der unmittelbaren Intuition, fühlbar offenbare? Ich kann dreierlei Qualität darin festmachen: 8 1. - zum Ersten eine Art „inneres Weh“, einen subjektiv-seelischen Schmerz, ein inneres Zerren und Reißen, eine seelisch-geistige Wunde; 2. - zum Zweiten eine Art Druck, Last, Schwere, Hemmung, Beklemmung. 7. Schaubild: die qualitative Eigenart und Fülle des Leidens: 7.1. des gesunden Leidens: Leidensweh („innerer Schmerz“, „Weh“) – Leidensdruck („Last“) 3. - Kommt zu diesen beiden Momenten drittens noch das spezifische Moment der Ohnmacht hinzu, das dadurch charakterisiert ist, dass der Betroffene die Grenze seiner Bewältigungsmöglichkeit erreicht hat, dann haben wir das „Notleiden“ vor uns, das den Betroffenen droht, zu verletzen, zu beschädigen oder gar zu vernichten. 7.2. des Not- oder Grenzleidens: (Weh – Druck) – Ohnmacht (Nicht-mehr-Können) – existenzielle Grenzerfahrung – Beschädigungs-/Vernichtungsangst in der Not Dieses Notmoment ist der entscheidende existenziell-motivationale Grund, warum der Betroffene um Hilfe anersucht. Faust liefert sich dem „Therapeuten“ Mephisto aus. Alle drei Momente, Leidensweh, Leidensdruck und Beschädigungs- oder gar Vernichtungsangst, lassen sich logisch nicht herleiten, sondern müssen in ihrer besonderen Qualität erlebt, empfunden, gefühlt werden, und ich meine, dass jeder Leidende mindestens die qualitative Doppelerfahrung von Schmerz und Last, der Leidende in Not – und das sind unsere Patienten! - sogar die Dreifacherfahrung von Schmerz, Last und Vernichtungsnot macht. Im Falle neurotischen und psychotischen Leidens tritt schließlich ein viertes Moment hinzu: der Leidensvollzug selbst ist beschädigt oder wirkt beschädigend. Während z.B. das Leiden an einer organischen Krankheit meist völlig adäquat, angemessen, ja „gesund“ ist, ist das Leiden an einer Neurose oder Psychose immer selbst auch krank, krankhaft verändert und pathogen, also krankheitserzeugend: Pathonoesis. 7.3. des pathologischen Leidens: beschädigter und beschädigender Leidensvollzug, durch den ein biopsychosozialer Lebensriss erzeugt wird („Dehiszenz“, „Dissoziation“) (destruktiver Akt des Leidens, destruktive Selbstkonstitution, Pathonoesis) 9 Diese besondere Qualität, diese phänomenal-leidspezifische Seinsgefülltheit des Leidens ist nun aber keineswegs völlig diffus und strukturlos, sondern im Gegenteil lässt sich darin im zweiten epistemologischen Schritt ein ganz bestimmter Strukturzusammenhang, eine wesenhafte Ordnung, jetzt allerdings nicht mehr nur intuitiv, sondern diskursiv-analytisch aufdecken. Denn wer leidet, muss in einer ganz spezifischen Weise seine Existenz vollziehen, die keineswegs beliebig ist, sondern von einer besonderen Dynamik, Dialektik und Ambivalenz, sprich von einem dissonanten Aktgefüge geprägt ist; das sich folgendermaßen ausdifferenzieren lässt: 8. Schaubild: phänomeno-logische (nicht-pathogene) Leidensgrundstruktur Widerfahrnis – Grenzerfahrung: Passivität + Wahrnehmung und Wertung eines Widerfahrnisses als Übel: Perzeption und Wertsetzung + Vergebliche kognitiv-emotiv-volitive Negation: Reaktion + Ohnmacht und Zerrissenheit: apperzipierter Selbstzustand: „Leiden“ + Drang der Selbstüberwindung: Selbstranszendierungsimpuls des Leidenden = Dynamisch-dialektische Diskrepanz des Leidens Wer leidet, dem widerfährt etwas, das er wohl wahrnimmt, aber nicht sein will, ja nicht einmal (von sich her) wirklich sein kann, das er aber doch sein muss. In dieser existenziellen Selbstdissonanz erlebt sich der Betroffene einerseits passiv-getroffen, ausgeliefert, ohnmächtig, andererseits regt sich ein dynamischer Impuls in ihm, das Unerträgliche, Widerwärtige, das ihm auferlegt ist, abzuschütteln. Doch vergeblich: Solange er leidet, gelingt ihm die Befreiung nicht, und er muss in der hilflosen, frustranen Revolte verbleiben. Das aber bedeutet, dass er hinnehmen muss, was er nicht hinnehmen kann, dass er Ja sagen (besser noch: Ja sein!) muss, wo sein ganzes Wesen aufbegehrt und gleichsam ein Nein in die Welt hinausschreit. Ich spreche darum von der dynamisch-dialektischen Diskrepanz des Leidenden, von einer Leidensdialektik, die eine unfreiwillig-auferlegte Leidhinnahme („Leidensposition“) und eine versuchte, aber vergebliche Leidensnegation umfasst. Es ist klar, dass diese diskrepante Dialektik eine ganz bestimmte Zeitlichkeit, Räumlichkeit, Leiblichkeit und Intersubjektivität ausgestaltet. 10 Gesamtdarstellung des „normalen“ Leidensaktgefüges Der Grundakt des Leidens Wahrnehmung des Objekts (Reizes) Leidverurteilung (Leidposition) frustraner Handlungsimpuls (Leidnegation) Grenzerfahrung, Hinderung, Zwang Ohnmacht + fortbestehender Handlungsimpuls oder Sehnsucht nach Leidfreiheit Leidenszwietracht /Leidensdiskrepanz Doch welche Dialektik waltet im Leiden genau? Meine Antwort: Die Lebensbewegung im Leiden ist zugleich blockiert und hochdynamisch antreibend. Das leidende, vor allem aber das notleidende Subjekt, dem die Vernichtung droht, ist einerseits ohnmächtig gefangen in seinem Leid, will jedoch andererseits mit aller Macht über sein Leiden hinaus, und also steckt in allem Leiden ein aktiver Selbsttranszendierungsimpuls, der beweist, dass Leiden, obzwar ohnmächtig, keineswegs total passiv ist, sondern ein Aufbegehren, einen Widerstand, ein Nein, eine Negationsintentionalität, ja einen Machtkampf impliziert. Um mit Kierkegaard zu sprechen, ist der Leidende jemand, der verzweifelt – weil vergeblich – er selbst sein will; bzw. genauer: verzweifelt, aber vergeblich nicht so sein will, wie er gerade sein muss. Dass sich diese bis zum Zerreißen gespannte, gleichzeitig aber massiv gehemmte Lebensdynamik in Psyche, Leib und Mitwelt, in Empfindung, Zeit und Raum auswirkt, kann nicht verwundern, sondern lässt sich im Gegenteil als eine Hauptquelle aller psychischen, psychosomatischen und psychosozialen Störungen und Krankheiten erweisen. Und noch einmal: Sowohl die qualitativen Aspekte als auch die essenziell-logische Struktur des Leidens haben wir durch den epistemologischen Dreischritt gewonnen, der für alle Wissenschaft, erst recht aber für alle Therapeutik fundamental ist. Er setzt sich zusammen aus - der direkten, intuitiv-ganzheitlichen, allerdings noch undifferenzierten Gewahrung und Erspürung eines Phänomens, hier des Leidens, - mit der darauf aufbauenden, immer vermittelnden, diskursiv-differenzierenden Analyse, die im Falle des Leidens zur dynamisch-dialektischen Leidensstruktur führt - und schließlich mit seiner ganzheitlich-differenzierten Zusammenschau, in der wir das Leiden ganzheitlich-differenziert spüren, verstehen und versprachlichen. 11 9. Schaubild (Wiederholung): 1. Ganzheitlich-undifferenzierte Intuition (Anmutung und „koenästhetische Erspürung“) 2. differenzierend-diskursive Analyse („diakritisches Denken“) 3. ganzheitlich-differenzierte Intuition („versprachlichte Gesamt-Gestalt-Anschauung“) Ohne den ersten Akt würde uns das Leiden gar nicht bekannt bzw. bliebe ein leerer Begriff, eine leere Theorie; ohne den zweiten Akt wird es zwar erlebt und gefühlt, bliebe aber diffus und unverstanden, könnte nicht in Sprache umgesetzt und mitgeteilt werden. Und ohne den dritten Akt kämen wir zu keinem abgerundeten, zu keinem innerlich überzeugenden und beruhigenden Ergebnis. Das gesamte Wesen des Leidens setzt sich darum aus seinen singulären Qualitäten und seinen verallgemeinerbaren Essenzialstrukturen zusammen, und zwar so, dass die konkrete qualitative Seinsfülle selbst uns zur implizit mitgegebenen Struktur, zu Gestalt und Wesen des Leidens führt, das wir dann durch eine diskursive Analyse explizit machen und begrifflich-unanschaulich fassen, also definieren können. Gelingt uns schließlich noch eine anschauliche, evtl. sogar bildhaft-imaginative Versprachlichung, dann haben wir die dritte Stufe der differenziert-intuitiven Gesamtschau erklommen. Kann auf dieser Basis, so nochmals die Eingangsfrage, eine Wissenschaft, eben die Wissenschaft vom Leiden entwickelt werden? Ermöglicht die hier zunächst nur skizzierte pathische und strukturelle Grundfigur des Leidens das, was Wissenschaft leisten soll und zu leisten beansprucht? Nämlich rational-analytisch, argumentativ-diskursiv, methodisch nachvollziehbar, kritisch reflektiert und systematisch geordnet ihren Gegenstand zu erhellen? Lässt sich das leidende Subjekt so überhaupt erreichen, geschweige denn verstehen, aufklären oder sogar erklären und „herleiten“? Im Folgenden will ich zeigen, dass Wissenschaft so, wie sie sich traditionell versteht, nicht genügen kann, dass sie – und zwar fundamental – einer intuitiv-evidenten, phänomenologisch zu erringenden Basis bedarf, die keineswegs vor- oder gar unwissenschaftlich sein muss, sondern im Gegenteil durchaus aufweisbar ihre eigene Wissenschaftlichkeit besitzt. 12 5. Wissenschaft in ihrer traditionellen Form und ihre Ergänzungsbedürftigkeit Doch zunächst muss, um die Standpunkte klarer zu fassen, die in der abendländischen Geistesgeschichte wirksam gewordene Auffassung von Wissenschaft in Erinnerung gerufen werden. Schon nach Aristoteles, der hierfür bekanntlich maßgeblich wurde, sucht der bios theoretikos nicht das Singuläre, Einmalige, Zufällige, Zeitlich-Bedingte, Veränderliche, Vergängliche, sondern das Allgemeine, Überindividuelle, Notwendige, Essenzielle, Überzeitliche, das SubstanziellInkorrumpierbare, also die angeblich bleibende, „identische“ Natur einer Sache“ zu erfassen (eidos, idea, essentia, substantia, hypokeimenon) und gleichsam von oben souverän zu überblicken. 10. Schaubild Der traditionelle Bios theoretikos sucht das Allgemeine, Substanzielle, Unveränderliche, Wesenhafte (Antike: Wesensschau und Wesensanalyse) bzw. das Gesetzliche, Bleibende, Regelhafte, Objektive (Neuzeit: induktive Hypothese und deduktive Operation) Wo bleibt das Individuelle, Einmalige, Pathische, Zufällige bzw. in welchem Verhältnis stehen Individuelles und Allgemeines zueinander? Analog war die neuzeitliche Wissenschaft bestrebt, wenn auch nicht wie in der antiken Philosophie mittels logischen Wesensdefinitionen, dafür aber mittels mathematisch-allgemeinen Formeln (die induktiv und deduktiv aufgefunden wurden) die Gesetze von Natur, Leben und Geschichte, also wieder das Allgemeine, Überzeitliche, Unsinnliche, hier nun auch experimentell WiederholbarGesetzliche zu fassen, um es sich als umgrenztes Gegenstandswissen gegenüberzusetzen. Gewiss, die Methode hatte sich geändert, statt der platonischen Wesensschau bzw. der aristotelischen Urteils- und Satzanalytik übernahm nun die Mathematik mit ihren quantifizierenden – also messenden, rechnendkalkulatorischen und konstruierenden - Mitteln die Vorherrschaft, aber wieder ging es um das „Objektive“, das Überindividuelle, Nicht-Subjektive, das allgemein Festsetzbare, das Unveränderliche, ja – und hier liegt eine bedeutende Differenz zur Antike – es ging nun auch, ja nicht nur auch, sondern vor allem um das technisch Beherrsch- und Manipulierbare im Verhältnis des Menschen zur Welt. Nicht vita contemplativa, sondern vita manipulativa. Man lese dazu etwa Descartes, Galilei oder Francis Bacon. In beiden Epochen - in Antike wie Neuzeit – geriet aber weitgehend alles bloß Individuelle, Zufällige, Vergängliche, Sinnliche in den Hintergrund (ohne allerdings zu verschwinden!) oder blieb doch zumindest unterbelichtet, was nicht von ungefähr so kam, wenn wir bedenken, dass es gerade das Individuelle, Zufällige, Vergängliche, Sinnliche ist, mit dem unaufhebbar das Fragile, Prekäre, Verletzliche, Bedrohlich-Ängstigende unserer Existenz verbunden ist. Hinzu kam ein Zweites: Während alles Allgemeine, Gesetzliche, Wesenhafte nicht einfach auf der Hand liegt, sondern durch einen komplizierten Abstraktions-, Argumentations- und Reflexionsprozess, 13 also wesentlich auf diskursiv-analytischem Wege ins Helle des Bewusstseins gehoben werden muss, entzieht sich das Singuläre, Individuelle, so schon das Sinnliche dem Beweis, der Argumentation, dem Diskurs, sondern muss unmittelbar gespürt und geschaut, also intuitiv direkt und ganzheitlich in seinem Da- und Sosein ergriffen und angeschaut werden. Dieser Gesang einer Amsel, diese Trauer eines Verlassenen, dieser Schmerz einer Krebskranken müssen unmittelbar gehört, nachgefühlt und imaginiert werden, andernfalls sind sie einfach nicht da. Analyse, Induktion, Deduktion und Reduktion vermögen hier gar nichts, sondern allein die „Intuition“ in ihrer erkenntnistheoretischen und wahrheitsfundierenden Gestalt gibt hier, was zu nehmen ist. Genau sie, die Intuition, war es aber, die aus der Wissenschaft immer wieder verbannt oder epistemologisch unzureichend gewürdigt wurde. Zu Recht? Soviel jedenfalls steht fest: Wäre die bis jetzt skizzierte Wissenschaft die einzig mögliche, dann wäre eine adäquate Wissenschaft vom leidenden Subjekt weder nötig noch möglich, denn dieses ist – jedenfalls nach Kierkegaard, aber auch nach Nietzsche, Heidegger, Jaspers, Weizsäcker, Straus, Sartre und vielen anderen - zunächst und zuvörderst ein individuelles, sinnlich-leibliches, nicht allgemeines Sein, ist subjektiv und vollzieht sich in nicht verobjektivierbaren Akten, ist nicht zeitlos, sondern zeitverhaftet, ja zeitgestaltend, ist nicht harmonisch, sondern konfliktbeladen und fragil, ist nicht gesetzlich-berechenbar, sondern unbestimmt und im Entscheidenden – nämlich in seiner spezifischen Freiheit! - oft unbestimmbar, ist in vielem nicht einfach anschaulich gegeben, sondern entzieht sich, ist oft unverständlich, rätselhaft, geheimnisvoll und ganz und gar nicht rational, ist nicht inkorruptibel, sondern verletzbar und vergänglich, ist vor allem aber nicht notwendig da, sondern kontingent, könnte also auch anders oder überhaupt nicht sein, ist, wie Heidegger sagt, „vom Sein ins nichtende Seiende geworfen“. Stimmt dies, dann muss eine Wissenschaft vom leidenden Subjekt, wenn sie möglich sein soll, all dies berücksichtigen und sich selbst wesentlich anders konzipieren. 11. Schaubild Intuitiv-analytische Wissenschaft vom Singulären, Individuellen, Pathischen, Zeitlichen, Fragilen? Es wird überraschen, dass es genau in dieser Hinsicht wieder Aristoteles ist, der uns zum Wegweiser dient. Denn er betont nachdrücklich, dass jede Realität die ihr je eigene und nur dadurch erst angemessene Wissenschaft und Methodik besitzt, sodass es mindestens so viele Wissenschaften gibt wie Seinsarten. Das Verhältnis der Farben untereinander und zu anderen Qualitäten, etwa den Klängen, muss daher anders erforscht werden als das Verhältnis der Zahlen oder das Verhältnis von Energiequanten zueinander. Damit nicht genug, erkannte Aristoteles, dass jedes eidos, also jede allgemeine Wesenheit (deutera ousia) in einer konkreten, singulären Seiendheit (ousia prote) gründet und anders gar nicht wirklich, nicht real sein kann. 14 12. Schaubild Einzelding (prote Ousia, tode-ti) als ontologisches Fundament der „raumzeitlosen“ Wesenheit („Form“; „Essenz“, ti-en-einai) = deutera Ousia (Antike!) und der physikalischen, psychologischen, soziokulturellen Gesetzmäßigkeiten in Zeit und Raum (Neuzeit!) Dass er bei dieser Erkenntnis stehen blieb und nicht die Konsequenz zog, eine durchdringende Wissenschaft vom Konkreten, Singulären, vom Tode-Ti („Dieses-da“; „Totik“, vgl. Brandenstein 1965), z.B. eine ausdifferenzierte Wissenschaft der Sinnesqualitäten oder eine Wissenschaft der Affekte auf den Weg zu bringen, in der Singuläres erst für sich und dann zusammen mit dem Allgemeinen und Essenziellen vereint untersucht wird, mag man bedauern, auch zu Recht bedauern, wenn wir an die von Pascal bis Heidegger kritisierten Nebenwirkungen des abendländischen Intellektualismus denken, aber für uns heute ist es hilfreicher, diesen Prozess, der sicher kein bloßer Zufall war, in seiner inneren Sinnlogik zu verstehen zu versuchen, um ihn dann, wo möglich und wo nötig, zu korrigieren - übrigens ein Vorgehen, das typisch für alle gute Therapeutik ist: Erst verstehen, dann verändern – andernfalls läuft man Gefahr, dem Leben Gewalt anzutun. 15 6. Die Basis einer jeden Wissenschaft Glücklicherweise muss die Korrektur nicht an etwas völlig Neuem ansetzen, sondern sie kann und muss, wie so oft, nur bewusster aufgreifen, was immer schon da war, aber allzu rasch übergangen oder verkannt, verdrängt oder verleugnet wurde, wie alles Verdrängte aber im Untergrund fortgärte, um dann in unverständlicher und oft leidbringender Weise an anderen Orten durchzubrechen. Gerade Aristoteles ist es, der auf dem Ausgang des Denkens von der konkreten, singulären Erfahrung besteht, nur übersprang die abendländische Denkdynamik diese Basis allzu rasch und allzu oft, sodass Gegenbewegungen nötig wurden, die, wie der Nominalismus und die anhebenden Naturwissenschaften am Ende des Mittelalters, der Positivismus und Historismus im 19. Jahrhundert oder die Phänomenologie Edmund Husserls „den Rückgang zu den Sachen“ forderten. Denn in der Tat ist eine Erkenntnis vor aller Erfahrung, wie Kant sein Apriori manchmal umschreibt, sachlich völlig unmöglich. Nicht nur die Geisteswissenschaften, die Psychologie und die Philosophie, sondern auch die Physik, ja sogar die Mathematik müssen vom konkreten Erfahrungsmaterial - Husserl sagt: von der Lebenswelt (1930) - ausgehen, um nach einem ganzheitlich-direkten, meist wenig differenzierten Hinblick auf analytischem Wege sowohl die Binnenstruktur eines (immer zuerst intuitiv gewonnenen) Phänomens als auch seinen Zusammenhang mit allem Anderen herauszuarbeiten. Erst Intuition des Singulären also, dann Analytik des Allgemeinen. Erst ein Aposteriori, dann ein sozusagen sekundäres Apriori, erst Fühlungnahme, dann gedankliche Aufhellung. Die fühlungnehmende Ersterfahrung wiederum kann aus drei Quellen schöpfen, erstens aus der Sinneserfahrung, welche die lebensgeschichtlich erste und übliche ist, zweitens aus der Welt der kreativen Phantasiebildung und drittens aus der ungegenständlichen Selbstgewahrung, „Selbstaffektion“ – die Ersterfahrung ist also keineswegs, wie Sensualismus und Empirismus meinen, gleichsam an die Sinnenwelt gekettet, sondern kann und darf auch imaginative, imaginäre, ideale und reflexiv erfahrene Sachverhalte zum Ausgangspunkt nehmen. Wenn sich ein Patient im Verlaufe einer Therapie z.B. seiner Vorlieben, Erwartungen, Ideale, Normen, Empfindlichkeiten, seiner Verletzungen, Ängste, Prägungen, seiner spontanen Reaktions- und Verarbeitungsweisen usw. anschaulich bewusst wird, dann handelt es sich in diesen Fällen um Sachverhalte, die nicht aus der Sinnenwelt stammen und dennoch direkt und konkret, also intuitiv erfahrbar sind. Wenn eine Wissenschaftstheorie oder Epistemologie von einer solchen Basis ausgeht und nicht allzu rasch nach den erkenntnistheoretischen, transzendentallogischen oder gar metaphysischen Bedingungen der Möglichkeit eines Sachverhaltes fragt, dann wird sie Zweierlei feststellen: - 1. dass jeder Sachverhalt, den wir erfahren, in sich mannigfach strukturiert ist und nicht nur quantitative und logisch-essenzielle, sondern immer auch qualitative Züge umfasst und über alle diese drei Seinsaspekte mit der Welt mannigfach vernetzt ist. Was sich hier als Möglichkeit eröffnet, ist eine anschaulich-trinitarische Ontologie von Qualität, Wesensstruktur („Essenz“) und Quantität (Gestalt). 13. Schaubild: trinitarische Grundstruktur des Seins (gegenstandstheoretisch) Singulärer qualitativer Gehalt (tode-ti): Qualia des Leidens (Schmerz, Last, Angst, Riss) Allgemeine Wesensform („Idea“, „Forma“, „Essenz“, „Begriff“): Leidenszusammenhang Quantitative Gestalt (Vielheit-Zahl, Raum, Zeit, Gestalt): Leidensvollzug, Leidenskontext 16 Und - 2. dass jeder Sachverhalt, auch etwa ein Widerfahrnis, ein Trauma, nie nur einfach „gegeben“, nie nur einfach da ist, sondern vom erfahrenden, erleidenden, betrachtenden, untersuchenden Subjekt immer auch aktiv genommen und schon insofern aktiv mitgestaltet oder – um mit Husserl zu sprechen – „konstituiert“ wird. Hermeneutik, Psychoanalyse und Phänomenologie, so different sie sonst sein mögen, stimmen hierin weitgehend überein und könnten sich an dieser Stelle eine gemeinsame Basis erarbeiten. Alle Ontologie ist eine vom Subjekt eröffnete und vollzogene, insofern immer immanente, immer aktive, immer subjektiv-erlebte, immer vom Menschen, vom Ich und vom Wir, gestaltete Ontologie. 14. Schaubild: subjektive Ontologie (subjekttheoretisch) (Vor-) Gegebenes + Genommenes Widerfahrnis + subjektive Konstitution Passivität -+ Rezeptivität + Initiativik Entsprechend gilt es zunächst, das individuelle Selbsterleben und die Selbstbeschreibungen des Betroffenen, mögen sie noch so perspektivisch, subjektiv, ja verzerrt sein, ernst zu nehmen. Ja umgekehrt bedeutete es einen Mangel an Objektivität, an „Lebensgerechtigkeit“, diese Subjektivität zu überspringen, da es gerade die besonderen Betroffenheiten, der Perspektivismus, die Idiosynkrasien und die Verzerrungen dieses einmaligen Menschen sind, die uns am meisten über seine Lage und seine besondere Form der Selbst- und Lebensgestaltung Auskunft geben. Denn sie sagen uns nicht nur darüber etwas, was dem Leidenden widerfährt oder widerfahren ist, sondern auch darüber, wie er das, was ihm widerfuhr, aufgenommen, affektiv erlebt und bewertet, kognitiv gedeutet, emotional verarbeitet, vielleicht auch umgedeutet und umgearbeitet oder eben emotional, kognitiv und praktisch nicht verarbeitet hat. Was Husserl Konstitution, was Heidegger Entwurf nennt, was C.G. Jung Konstellierung nennt, was Freud meint, wenn er von „Agieren“ (heute positiver: Enactment), Widerstand, Abwehr und Übertragung spricht, läuft letztendlich auf die emotionale, kognitive und volitive Eigenaktivität, Eigenwertung und Eigenselektion des Betroffenen hinaus, die dieser allerdings, gerade weil er in seinem Leiden befangen ist, oft nicht als seine eigene bzw. nicht in rechter Weise als seine eigene erkennen kann, sei es, dass er zu sehr die äußeren Ursachen des Widerfahrnisses – den Arbeitsplatzverlust, den ungerechten Chef usw. - im Blick hat und dabei seinen Eigenanteil übersieht, sei es, dass er seine Eigenaktivität, etwa aus Angst-, Scham- und Schuldgefühl, aktiv verdrängt und unbewusst hält, sei es, dass die neurobiologischen Grundlagen seines Leidenkönnens - wie im Falle von Demenz, Melancholie und Schizophrenie - beschädigt sind. Wie dem auch immer im Einzelfall sei, eine Wissenschaft vom leidenden Subjekt als Hilfswissenschaft für die therapeutische Praxis muss für das Einmalige, Konkrete, Individuelle, Spezifisch-Pathische und Subjektiv-Selbsttätige offen sein und darf nicht zu früh das Selbsterleben, die Selbstdeutung und die oft unbewusste Selbstdarstellung des Betroffenen unterbrechen oder gar mit vorgefassten Theorien überfrachten, sondern muss mit dem dritten Ohr die feinsten Nuancen der therapeutischen Beziehungsinszenierung herauszuhören versuchen, die ganz von selbst zu überindividuellen und sogar wesenhaft-zeitlosen Strukturzusammenhängen hinführen. 17 7. Die Aufdeckung überindividueller Strukturzusammenhänge Wie aber und welche? Nun, es gilt, prinzipiell gesprochen, das Überindividuelle im Individuellen, das Essenzielle im Existenziellen aufzuspüren, das also, was einer Gruppe von Menschen oder gar allen Menschen gemeinsam ist, im konkreten anschaulichen Fall aufzudecken. Um dies zu leisten, kommen die klassischen wissenschaftlichen Operationen, letztlich irgendwelche Formen des Abstrahierens und Ideierens, die sich wiederum argumentativer Diskurse bedienen, ins Spiel – also die abstraktive Bildung von Begriffen, die Formulierung von Urteilen, die Durchführung von Klassifikationen, die Aufstellung von Idealtypen, die Formulierung von Regelhaftigkeiten und Gesetzmäßigkeiten, die Erkenntnis von Wesenszusammenhängen und die Rekonstruktion von bestimmten Genesen und Kausalitäten. Hierbei dominiert zweifellos nicht mehr die Intuition, die direkte, einfach-ganzheitlichundifferenzierte Anschauung, sondern die differenzielle, indirekt-diskursiv zu leistende Aufdeckung von in den Sachverhältnissen selbst, aber primär nicht offen am Tage liegenden, sondern nur impliziten Begründungszusammenhängen. Wir fragen: Was hängt wie und warum womit zusammen? Wie bedingt ein Moment ein anderes, ein Phänomen ein anderes, eine Tatsache eine andere? Wer oder was bringt was hervor? Wie gestaltet sich nach welchen Motiven, Regeln, Gesetzen, Wahrscheinlichkeiten ein Prozess, ein Vorgang, ein Geschehen? Wie formt sich eine Vielheit von Momenten und Ereignissen zu einem zusammenhängenden Lebensganzen, sei es räumlich, sei es zeitlich, sei es logisch oder psychologisch, sei es qualitativ oder quantitativ oder alles zusammen? Kurzum: Wir betreiben - auf dem Boden einer intuitiv gewonnenen Anschauung – eine „Implikatanalyse“, eine Explikation von etwas, das zwar da, aber verborgen ist. Und eben genau auf diesem Wege arbeiten wir Allgemeinstrukturen heraus, die in der Lage sind, jene Fragen nach dem Wie, Wodurch und Wozu zu beantworten. Dabei ist aber zu beachten, dass Allgemeinheit keineswegs gleich Allgemeinheit, Überindividualität nicht gleich Überindividualität ist, sondern dass etwa zwischen logischer, biologischer, anthropologischer, psychologischer, gesellschaftlicher und kultureller Allgemeinheit wohl unterschieden werden muss. Die erste Schicht des Überindividuellen, die hier erwähnt werden muss, betrifft die uns allen gemeinsame biologische Basis, die gerade in Medizin, Psychiatrie und Psychosomatik nicht unberücksichtigt bleiben darf. Im Rückblick dürfen wir heute wohl sagen, dass nicht nur die Psychoanalyse, sondern auch die Existenzphilosophie die organismische bzw. biologisch-leibliche Dimension des Menschseins zu sehr abgeblendet hatten und daher von einer neuen Leibphilosophie und Leibpsychologie ergänzt werden müssen. Die Behauptung, der Mensch sei das instinktbefreite Tier, war wohl eine Übertreibung und führte zu einer überspitzten Spiritualisierung des Menschen. Gerade die moderne Neurobiologie, natürlich im Verbund mit Verhaltensbiologie und Biopsychologie, beweist, dass das menschliche Wahrnehmen, Fühlen, Erinnern, Verarbeiten, Lernen, Planen und Handeln im hohen Grade biologisch vorgebahnt und getragen wird und dabei weitgehend unbewusst bleibt. Organismus und Leib haben ihre eigene – vormenschliche, allgemeinbiologische Intentionalität, ja ihre eigene Sinnhaftigkeit, in die die spezifisch humane Intentionalität des Cogito als des phänomenalen Bewusstseins im Sinne des Embodiement tief eingebettet ist, ohne doch dadurch in seiner Eigenaktivität und Eigengesetzlichkeit voll festgelegt zu sein. Gerade die psychiatrischen Krankheiten beweisen, wie sehr der „personale Geist“ einerseits von seinem intakten Leib abhängig ist und ohne ihn nicht zur Entfaltung kommt, wie er aber andererseits selbst in pathologischen Situationen Freiräume besitzt, seine Defizite zu gestalten, zu kompensieren, ja überzukompensieren. Man denke nur an manche schwere neurologische oder psychiatrische Erkrankungen und ihre schöpferische Bewältigung. Das ist die erste Schicht des Überindividuellen. Anders liegen die Verhältnisse, wenn wir die in allen konkret-individualen Leiden mitgegebenen überindividuell-gesellschaftlichen und kollektiv-kulturellen Beziehungsstrukturen, Muster, Denk- und Sprachgewohnheiten, Gebote und Verbote, Sitten und Rituale herausarbeiten. Auch davon bleibt kein Individuum verschont, schon allein deswegen, weil es sich von Geburt an in kollektiven 18 Zusammenhängen bewegt. Diese zweite überindividuelle Schicht baut auf der biologischen auf, ja durchdringt sie und formiert sich im Rahmen von Kollektiven und im Laufe der Geschichte. Von daher erlegt sich ganz natürlich die Forderung auf, dass in einer Psychotherapie nicht nur die intrapsychischen und zwischenmenschlichen Verarbeitungsweisen eines Menschen, sondern darüber hinaus seine individuelle Geschichte, seine sozioökonomische Einbettung und seine spezifische Kulturprägung Beachtung finden. Dies gilt umso mehr, seit wir wissen, dass viele krank machenden Erlebnisverarbeitungen über Generationen hinweg, weitgehend unbewusst, tradiert werden. Eine dritte überindividuelle Determinierung setzt an der Tatsache an, dass alle Krankheiten Prozesse sind, die gewisse Regelhaftigkeiten – z.B. Umweltbedingungen, Stadien, Episoden, Verläufe aufweisen und nicht völlig zufällig zustande kommen. Schon dem Praktiker fällt auf, dass die Menschen nicht nur verschieden sind, sondern in vielem ähnlich reagieren und ihr Kranksein in Leib, Zeit, Raum und Intersubjektivität gleich oder ähnlich gestalten. So weiß der erfahrene Therapeut, dass depressive Menschen, die einen Verlust ihrer inneren Eigenaktivität, Eigenspannung und vitalen Initiative aus welchen Gründen auch immer erlitten haben - die „Hauptursache“ kann hier physikalisch, biologisch, psychologisch, soziologisch, geistig sein! -, ihre Aktivität herunterregeln und in einen eher passiven Modus übergehen. Das aber hat gesetzmäßige Folgen, die das Leiberleben, das affektive Durchleben des Umraumes, die Zeitigung, die Arbeits- und die Beziehungsgestaltung mit Anderen charakteristisch modifizieren: So nehmen schon mit der geschwächten Körperaufrichtung des Depressiven die Empfindungen des Drückenden, Lastenden, Schweren, Zähen, Widerständigen, Langsamen zu; durch den Verlust der psychophysischen Vitalität verlangsamt sich die Selbstzeitigung, bei schweren Depressionen bis zum Stillstand, mit der Folge, dass den Depressiven der Eindruck quält, stets zurückzubleiben und nicht mehr hinterherzukommen; analog wird sein Umraum nicht mehr mimisch und gestisch ausdrucksvoll durchstrahlt; der Kontakt zur Welt und zu den Anderen reißt ab oder wird zurückgenommen; alle Anforderungen, nicht nur die von außen, sondern sogar vom eigenen Leibe, wie z.B. die Eigenpflege, werden als Zumutung, als Angriff erlebt, dem sich der Depressive nicht mehr erwehren kann, sodass er sich ohnmächtig, ausgeliefert, hilflos fühlt, was ihn zum Rückzug veranlasst. Spätestens hier wird ein übergreifender Strukturzusammenhang sichtbar, der den Depressiven etwa vom Zwangskranken in typischer Weise unterscheidet: Durch das innere Zuwenig an Kraft, Vitalität, Antrieb, Lust, Freude – dem beim Zwanghaften eher ein Zuviel an Wille und Kontrolle gegenübersteht - wird für den Depressiven notwendig alles, selbst das Geringste, zu einem Zuviel, wird aufdringlich, eindringend, übergriffig und bewirkt bei ihm Abwehr, Rückzug, Angst, Unruhe und Verweigerung. Es leuchtet ein, dass der therapeutische Erst- und Hauptansatz in diesem Fall darin bestehen muss, die leiblichen, seelischen, sozialen und geistigen Kraft- und Auftriebsquellen zu befreien, um sich wieder als selbstwirksam, initiativ, selbständig, also überhaupt als wiederaufgerichtetes Subjekt erleben zu können. Um Unterschied zum Schizophrenen, der eine „Spaltung“ seiner Person erfährt, erleidet der Depressive den Verlust oder doch die Schwächung der fundamentalsten Potenz des Menschseins, nämlich sich selbst aktiv und kraftvoll ergreifen und vollziehen zu können, also dessen, was man für gewöhnlich „Wille“ oder „Wollen“ nennt. Was hier mit „überindividuell“ gemeint ist, betrifft den modalen Prozess der Konstituierung des im Kranksein veränderten Selbstseins und Selbstwerdens. Allerdings muss hier vor einer Ontologisierung der Krankheit gewarnt werden. Krankheiten sind keine einfachen stabilen Einheiten, keine „Wesenheiten“, wie der Begriff der Krankheitseinheit nahezulegen scheint, vielmehr sind sie, wenn sie überhaupt Einheiten sind (was oft fragwürdig ist, wie etwa im Falle der Schizophrenie!), diskrepante und damit wesenhaft labile, prekäre Einheiten, in denen antagonistische Faktoren ineinander verschränkt sind und dabei eine Schädigung hervorrufen. Schon vornehmlich organische Krankheiten zeigen dies, erst recht aber psychische Störungen. Solange ein Organismus, ein Lebewesen, ein Mensch noch lebt, gibt es, wenn er krank ist, Kräfte, die zerstören, und Kräfte, die sich von den Störfaktoren und ihren Schadenswirkungen befreien, sie begrenzen, ausgleichen, überwinden wollen. Dieser Grunddissens in aller Krankheit ist es auch, der ihren Verlauf oft so unvorhersehbar sein lässt 19 und nicht selten mit einem Ausgang überrascht, den keiner erwartet hat. Und dennoch ist diese antagonistische Wechselwirkung in der Krankheit nicht völlig beliebig, sondern weist allgemein formulierbare Regelmäßigkeiten auf, die es erlauben, charakteristische Krankheitsdiagnosen, Verläufe, Krankheitsverarbeitungen und Therapiepläne zu erstellen. Schon hier wird ein fundamentaler Unterschied zwischen Leiden und Krankheit sichtbar: Leiden führt nicht notwendig zu einer Schädigung, Krankheit dagegen ist immer ein destruktiver Prozess. Oder anders: In beiden Phänomenen lässt sich zwar eine diskrepant-konfliktive Strukturdynamik herausarbeiten, doch pathologisch im Sinne von pathogen, von destruktiv ist nur die Krankheit, nicht das Leiden als solches. Es gibt durchaus „gesundes Leiden“, wie ich noch zeigen werde. Und schließlich sind allgemein-überindividuelle Strukturen zu erwähnen, die im Sinne von Leibniz, Kant, Fichte und Husserl die Grundstrukturen unserer Vernunft im weiten Sinne, also unseres Erlebens, Wahrnehmens, Fühlens, Wollens und Denkens betreffen und die durch das konkrete einzelne Individuum, wenn auch meist nur implizit, also nur randbewusst, konstituiert, aktiviert und realisiert werden. Sie explizit zu machen, ist Aufgabe vor allem der Philosophie, aber auch der Psychologie und aller Geisteswissenschaften. Denn nicht nur das Was und Wie unseres Denkens, Fühlens, Handelns ist oft dunkel und unbewusst, sondern auch das Warum und Wozu unserer emotional-motivationalen, kognitiven und volitiven Vollzüge bleiben uns in hohem Maße verhüllt. Doch genau diese Konstitutionsakte des Subjektes, seine initiativen, rezeptiven und passiven Selbstvollzüge sind es, die uns erlauben, eine fundamentale und dadurch echt allgemeine, ja zeitlose Wesensstruktur des Leidens bzw. des leidenden Subjektes aufzudecken, in der sich qualitative, logisch-formale und quantitative Aspekte, weiter initiative, rezeptive und passive, ja sogar konfliktive, diskrepante und pathogene Akte in charakteristischer Weise zu einer bestimmten und damit wesenhaft-stabilen Gestaltganzheit verknüpfen und vereinen. 15. Schaubild Dimensionen des Allgemeinen - pathologisch - - kulturell transzendental - biologisch 20 8. Zugänge, Mittel und Wege zur „Wissenschaft vom Leiden“ und ihre kritische Überprüfung Wenn Leiden als Phänomen tatsächlich, wie dargelegt, ein ontologisches Kompositum aus singulären und allgemeinen Wesenszügen ist, dann eröffnet sich die Möglichkeit einer Wissenschaft vom Leiden als eines Logos vom Pathos, sprich als eines geordneten und dadurch verstehbaren Zusammenhangs oder „Systems“ von allgemeinen, sich gegenseitig bedingenden Aussagen. Wie von einer jeden Wissenschaft müssen wir dann allerdings auch von dieser verlangen, dass sie erstens jene Zugänge, Mittel und Wege erarbeitet, mittels derer in intersubjektiv nachvollziehbarer Weise jene allgemeinen Aussagen gewonnen werden können, und dass sie zweitens bemüht ist, ihre Aussagen nicht nur dogmatisch zu behaupten, sondern durch reflektierte und kritische Begründung zu sichern oder – wie man heute sagt - zu „validieren“. Der umfassende Begriff für diese beiden Leistungen heißt traditionell „Methodologie“, die Lehre einerseits von den Mitteln und Wegen einer Erkenntnisgewinnung und andererseits von deren kritischer Überprüfung und womöglich Sicherung. 16. Schaubild: Epistemologie – Methodologie: Zugänge Verstehensformen Methoden Evidenzkriterien Möglichkeiten und Grenzen In aller gebotenen Kürze möchte ich diese Methodologie, durch die eine Wissenschaft erst Wissenschaft wird, darstellen. Ich gehe dabei von der speziellen Lebenswelt der „Leidenssituation“ aus, wie sie sich im Felde der Therapeutik konstelliert. Das hat den Vorteil, erstens die Spezifität dieser patho-logischen Methodologie aufzuzeigen und zweitens die Fülle dieser Methodologie zu wahren, die leicht durch eine falsche Vorentscheidung, etwa im naturalistisch-szientistischen Sinne, verloren ginge. Das Besondere des Leidens hebt schon mit dem Umstand an, dass es in seiner lebendigen Phänomenalität gar kein nur theoretisches, sondern ein eminent affektives und praktisches Phänomen ist. „Motor des psychoanalytischen Erkenntnisprozesses ist daher nicht das Interesse an Selbstreflexion, sondern sinnlich erfahrbares Leiden, das nach Aufhebung verlangt. […] Psychoanalyse als kritischhermeneutisches Verfahren bezieht ihren Impuls aus der unerträglichen realen Lage der Subjekte, sie lebt vom ‚Widerspruch‘ und zielt auch auf nichts anderes […] als darauf, blind erfahrene Widerspruchskonsequenzen in bewusste Erfahrung zu verwandeln.“ (Alfred Lorenzer: Über den Gegenstand der Psychoanalyse oder: Sprache und Interaktion, 1973). Wer leidet, will, dass dieser Zustand endige. Und wer damit subjektiv nicht mehr zurechtkommt und sich in diesem Grenz- und Notzustand an einen Helfer wendet, will nicht primär Erkenntnis, sondern Veränderung, ja genauer Aufhebung dieser seiner existenziellen Grenzsituation: Viktor von Weizsäcker spricht prägnant von der therapeutischen Grundfigur „Not und Hilfe“. Im Leiden, vor allem im Notleiden – das ich als Leiden an der Unerträglichkeitsgrenze definiere - liegt also ein 21 praktischer Appell bzw. ein praktischer Auftrag, der letztlich auf den Leidensdruck im Leidenden zurückgeht, der seinerseits einen Handlungsdruck erzeugt und daher nie wertfrei ist. Ohne die Wissenschaft einer Pragmatik des Leidens kann es somit keine adäquate Patho-Logie geben. Oder anders: Alle auf Hilfe bezogene Psychopathologie ist fundamental in eine dialogische Handlungswissenschaft eingebettet. „Not und Hilfe“ bilden so den fundamentalen Zugang zu Leiden und psychischer Störung. 22 17. Schaubild: erster Zugang: Not und Hilfe als fundamental pragmatische Sinndimension (entsprechende Wissenschaft: dialogische Handlungswissenschaft) leidvolles Widerfahrnis + Leidwahrnehmung und –bewertung + Leidensdruck – Not (Leidensgrenze/Unerträglichkeit/Verletzungsdrohung) + Appell – therapeutischer Auftrag + therapeutische Antwort: Zusage + Erkennen („Diagnostik“) und „Eingriff“ (Durcharbeiten und Verwandeln) Nun macht es jedoch die fast paradoxale Grundsituation des Arztes bzw. Therapeuten aus, dass er genau diesem Handlungs- und Veränderungsdruck nicht unreflektiert nachgeben darf – weil nämlich sonst ein „Agieren“, ein kopfloses Handeln droht -, sondern auf ein Inne- und damit Ansichhalten bestehen muss, ein Inne- und Ansichhalten, das den Raum für Erspürung, Betrachtung, Analyse, Verstehen und Erklären, also für „Diagnostik“ = „Durchschauung“ im weitesten Sinne überhaupt erst eröffnet. Das aber impliziert, dass der Therapeut sowohl dem Patienten als auch sich selbst Handlungsaufschub, Handlungsverzicht, Geduld und Leidensfähigkeit aufzuerlegen hat. Denn wer im Leiden helfen will, muss Leiden, um es verstehen zu lernen, erst gelten, ja sich entfalten, sich zeigen lassen. Kein Leidverstehen ohne Leiderduldung. Das sollte man seinen Patienten explizit mitteilen und erläutern, andernfalls würden sie dies als therapeutischen Sadismus missverstehen. 18. Schaubild: zweiter Zugang: pragmatische Sinndimension der Leidenserduldung Inne- und Ansichhalten + Handlungsaufschub, Geduld, Leidensfähigkeit + Raumeröffnung für das „Erscheinen des Leidens“ Was folgt? Nun, eine objektivistische Wissenschaft würde mit Feststellungen und Deskriptionen anheben. Nicht so in unserem Fall. Beschreiben lässt sich ein Leiden nämlich erst, wenn der Betroffene - und mittelbar der Therapeut durch Mitfühlung und Einfühlung - in einen spürenden Kontakt mit dem Leid gekommen ist. Was hier geschieht, umschreibt die Lebensphänomenologie eines Michel Henry als „Selbstaffektion“, was nichts anderes meint, als dass das Subjekt mit seiner ganz einmaligen Subjektivität bzw. subjektiven Lebendigkeit in Spürung, in Selbstresonanz, in 23 lebendigen Kontakt tritt. Wie bedeutsam und alles andere als selbstverständlich schon dies ist, erhellt, wenn wir bedenken, dass bei vielen psychischen Störungen genau diese Selbstaffektion, diese affektivemotionale Selbstbegegnung irritiert, verwirrt, beschädigt, verdrängt, verzerrt, verdunkelt ist. 19. Schaubild: dritter Zugang: spürsam-feinfühlige Wahrnehmung Leidwahrnehmung, Leiderspürung, Selbstresonanz seitens des Betroffenen + Mitfühlung, Einfühlung, „Herausfühlung“, Fremdresonanz seitens des Therapeuten („leibliche Koenästhesie“) + Psychologisches und szenisches Verstehen von beiden („interaktionelles Verstehen“) (Übertragung/Gegenübertragungs-Abbau und Aufbau echter Begegnungs-/Beziehungsfähigkeit) 20. Schaubild: Zusammenschau der drei Zugänge 1. Enactment (Handlungsdialog) von Not und Hilfe 2. Leidenserduldung („Containing“) 3. Leidenswahrnehmung („Spürung“), psychologisches und „szenisches“ Verstehen 24 9. Arten und Weisen, Mittel und Wege der analytischen Erfassung und Durchklärung des Leidens Hat der Betroffene diesen Selbstkontakt geleistet - und sei es nur in minimalster Weise -, kann er zu Feststellungen, Aussagen und Beschreibungen übergehen. In aller Regel geschieht dies spontan, unsystematisch, wenn auch nicht völlig regellos, und natürlich interessegeleitet. Zu diesen meist vorund unbewussten Interessen gehören z.B. die Wünsche und Erwartungen, ernst genommen zu werden, verstanden zu werden, wichtig zu sein, Hilfe zu erfahren, aber auch allerlei Ängste und Ambivalenzen, z.B. abgelehnt zu werden, zu dominieren usw. Auch wenn wir solche Deskriptionen vorwissenschaftlich nennen, haben sie nichtsdestotrotz einen hohen Erkenntniswert, da der Mensch, der sein Leid beschreibt, nicht über irgendetwas, sondern von sich redet und dabei wie selbstverständlich sich selbst mit seinen Sichtweisen, Perspektiven, Wertungen und seinem Daseinsstil inszeniert (Argelander, Lorenzer). Da er sich dabei außerdem in einer Beziehung bewegt, inszeniert er nicht nur sich, sondern auch seine spezifische Form der Beziehungsaufnahme und Beziehungsgestaltung. Oft lässt sich schon daraus eine ganze Psychopathologie herauslösen. Was die Deskription selbst angeht, so hat sie immer analytischen Charakter, denn sie stellt niemals nur Einzelphänomene, etwa Symptome sinnlos nebeneinander, sondern sucht schon von sich her, Verbindungen zu stiften und Zusammenhänge aufzudecken. Methoden – Wege der Leidenserkenntnis 1. vorwissenschaftlich-unsystematische Deskription (Betroffenenbeschreibung) Das ändert sich, wenn der Therapeut, etwa durch Nachfragen, Klären, Hinterfragen, Konfrontieren, Hypothesenbilden, Deuten oder etwa auch mittels Fragebögen und anderer Hilfsmittel die Deskription zu ordnen, zu strukturieren, ja zu systematisieren sucht. Wir können dann von einer 2. phänomenologisch-systematischen Deskription und Analyse (Expertenanalyse) sprechen. Sie lässt sich in zwei Richtungen weitertreiben, nämlich erstens dahingehend, ein Phänomen in seiner inneren, vor uns in der Anschauung „horizontal“ ausgebreiteten Aspektvielfalt zu beschreiben, zu analysieren und zu verstehen. Gelingt es hierbei, die gegenseitige Bedingungs- und Abhängigkeitsstruktur dieser Momente herauszuarbeiten, ja zu zeigen, dass und wie sie sogar notwendig miteinander zusammenhängen, dann haben wir es mit einer phänomenologischen Eidetik, einer anschaulichen Wesenslehre zu tun und ihrem Bestreben, sozusagen überzeitliche Wesensgestalten etwa der Depression, der Angststörung, der Schizophrenie voneinander zu unterscheiden. Gelingt der Aufweis der Strukturnotwendigkeit nicht, so ist es immerhin möglich, gewisse Idealtypen zu bestimmen, die es erlauben, das Erfahrungsmaterial – wenn auch nicht objektiv notwendig, so doch heuristisch – in Ganzheiten zu ordnen. Solche Idealtypologien liefern uns etwa der ICD-10- und der DSM-IV-Diagnosenschlüssel, aber auch die Neurosenlehre der Psychoanalyse. 2.1. phänomenologisch-horizontale Wesensanalytik bzw. Idealtypologie („statische Phänomenologie“) Diese gegenstandsimmanente Horizontalanalyse muss nun allerdings um eine horizontale Kontextanalytik erweitert werden. Hier geht es um den Versuch, ein Leid, eine Störung bzw. eine 25 Krankheit im Kontext der aktuellen Lebenssituation zu verstehen. Es gilt, solche Faktoren wie den Gesundheitszustand, die soziale Einbettung, die kulturelle Prägung, das Arbeitsverhältnis, die Freizeitgestaltung, den Freundeskreis, die Wohnungssituation, aktuelle Schicksalsschläge etc. einzubeziehen und in ihrer Wirkung auf die Störung zu verstehen. Umgekehrt muss aber auch der Einfluss der Krankheit auf den Lebenskontext untersucht und bestimmt werden. Gelingt es, diese Wechselbedingungen zu fassen und mit der ersten horizontalen Wesensanalytik zu vereinheitlichen, verknüpfen sich die Symptome zu Syndromen, also z.B. die vielfältigen Symptome der Depression zur Ganzheitsgestalt eben dieser Depression mit ihrem gesamten situativen Kontext. Die Achsensystematik der modernen Diagnoseschlüssel versucht, diese Dimensionen abzubilden. 2.2. phänomenologisch-horizontale Kontext- oder Situationsanalytik („situative Phänomenologie“) Was dabei entsteht, ist ein komplexer Situationskreis, der ungefähr folgende Struktur hat. 2.2.1. Allgemein-lebensweltlicher Situationskreis Vererbung ökologische Umwelt (psychophysische Konstitution/Disposition) Selbst Selektion = Entscheidung = Selektion Welt-Entwurf Sozialisation Gesellschaft Familie (Konstitution: ererbte oder phylogenetische Anpassung; Disposition: erworbene oder ontogenetische Anpassung) Ein Sonderfall dieser horizontal-deskriptiven Analytik ist übrigens die therapeutische Situation selbst, in der sich der Umgang des Patienten mit seinem Leiden abbilden kann. Daher rührt das hohe diagnostisch-szenische Potential der therapeutischen Situation (Begegnungsart, Beziehungsart und – gestaltung, Übertragung, Gegenübertragung, Widerstand, Verwirrung etc.), auf das die Psychoanalyse traditionell so großen Wert legt, sicherlich zu Recht. 2.2.2. therapeutischer Situationskreis – spezifische Wir-Gemeinschaft: Beziehungsarbeit - „Sprachzerstörung und Rekonstruktion“ 26 Doch dabei bleiben wir nicht stehen, vielmehr gilt es, die horizontale Analytik durch eine vertikale Analytik, die ihrerseits zwei Richtungen aufweist, zu ergänzen: Die Eine geht in die Tiefe der Lebensgeschichte, die Andere zielt in die Tiefe der Person selbst. Im ersten Fall arbeiten wir die lebensgeschichtliche „Genese“ eines Leidens heraus und stoßen erneut auf viele analytisch aufzudeckende Bedingungszusammenhänge, die natürlich nicht als simple Kausalitäten missverstanden werden dürfen. Denn die entscheidende Kausalität im Falle des Leidens ist nicht dieses oder jenes Lebensereignis, diese oder jene Beziehung (zur Mutter etc.), dieser oder jener Konflikt, vielmehr gilt, dass das betroffene Subjekt selbst und seine Art und Kapazität, Lebensbedingungen, Widerfahrnisse, Konflikte, Defizite und Beziehungserfahrungen zu verarbeiten, die entscheidende Causa effizienz darstellt. 2.3. vertikal-genetisch-deskriptive Analytik („psychohistorische Phänomenologie“) Damit berühren wir schon die zweite Vertikalität, die durch die 2.4. vertikal-transzendentale Konstitutionsanalytik, inklusive Widerstands-, Abwehr-, Coping- und Resilienzanalyse („dynamische Phänomenologie“) aufgearbeitet wird, wie sie von der an Husserls Phänomenologie orientierten Daseinsanalyse gepflegt wird. Hierbei geht es um die aktiv-dynamischen Konstitutionsleistungen eines Subjektes, einfacher gesagt darum zu erkennen, wie und in welchem Umfang der Betroffene an seinem Leiden selbst beteiligt ist. An dieser Stelle kommen unvermeidlich meist rand-, vor- und unbewusste Wert- und Sinngebungen ins Spiel, ohne die kein Leiden näher bestimmt und verstanden werden kann. Im Unterschied zur horizontalen Analytik verlangt die vertikale Analytik allerdings eine neue Methodik, die so genannte phänomenologisch-transzendentale Reduktion. Was meint dieses Wortungetüm? Nun, nichts anderes als ein Rückfragen und Rückarbeiten (oft gegen Widerstand!) von einem phänomenal gegebenen Tatbestand zu seinen oft verborgenen konstituierenden Voraussetzungen und Leistungen seitens des betroffenen Subjektes. Oder als Frage: Was tut das Subjekt, damit dieses Leiden mit diesen Symptomen, mit dieser Pathogenese und Gestalt überhaupt entstehen kann und dann auch noch aufrecht erhalten wird? Wir fragen also von der Symptom- und Syndromoberfläche zurück in die Tiefe; wir fragen nach der subjektiven Kausalität oder Ätiologie, die sich zwar in den Phänomenen andeutet und ausdrückt, oft aber verstellt, verdrängt, verschoben oder beschädigt sein kann, was die Notwendigkeit nach sich zieht, an Widerständen, Blockaden, Verwirrungen und Hindernissen zu arbeiten. So sagen, um ein Beispiel zu geben, nicht wenige Patienten, dass sie entsetzlich darunter leiden, gewisse selbstschädigende Handlungen tun zu müssen, deren Zustandekommen sie mit bestem Willen nicht verstehen können. Hier ist gefordert, in kleinen Schritten den Patienten zur Selbstaufklärung, zur Erweiterung seines Bewusstseinshorizontes zu führen und dem dunklen Meer des Unbewussten Land abzuringen, wie wir wissen, oft gegen den Widerstand des Patienten. In diesen Zusammenhang gehört übrigens auch die Frage nach der subjektiven Krankheitstheorie des Patienten, die für die Krankheit und deren Gestaltung selbst dann wichtig ist, wenn sie falsch ist. Hier angekommen könnte man meinen, das Ende der „Wissenschaft vom Leiden“ erreicht zu haben. Das ist aber nicht der Fall. Denn alle Wissenschaft impliziert eine Wissenschaftsgemeinde, und diese ist nur lebensfähig, wenn sie sich gewisse Regeln auferlegt, beginnend schon mit präzisen 27 Sprachkonventionen. Im Falle einer Therapeutik, die auf einer Psychopathologie basiert, bedarf es aber noch mehr. Denn um etwa die Kommunikation von einem zum anderen Arzt bzw. Therapeuten zu ermöglichen, braucht es Kriterien, die zu umgrenzen versuchen, was – im Rahmen unserer Kultur krankhaft, was gerade noch gesund, was nicht mehr gesund ist, braucht es Kriterien, die verschiedene Symptome, Syndrome, Krankheitseinheiten, Krankheitsklassen, Krankheitsverläufe, Krankheitsphasen, Pathogenesen und Ätiologien voneinander abgrenzen, braucht es Metatheorien, die die gesamte Pathologie in einen sinnvollen Bezug zur Psychologie überhaupt, ja zur philosophischen Anthropologie bringen. Um das zu erreichen, genügen rein deskriptiv-analytische Analysen nicht mehr, dann müssen induktive Analytiken zum Einsatz kommen, deren Funktion bekanntlich in der Aufstellung hypothetischer Allgemeinheiten besteht. Diese werden mittels empirischer Vergleiche ähnlicher Phänomene erreicht. Eine jede Diagnose- bzw. Krankheitseinheit ist ein solches induktives Gebilde, gleichgültig ob in diese Verallgemeinerung überindividuelle Symptomkonstellationen, überindividuelle Pathogenesen (Verlaufsformen) oder überindividuelle Ätiologien oder alles zusammen eingehen. 3. induktiv-hypothetische Verallgemeinerungsanalytik in einer Wissenschaftsgemeinde (Syndromkonstellation, Pathogenetik, Ätiologie, Klassifikationen) Wenn es die Induktion, die vom Besonderen zum Allgemeinen übergeht, gibt, fragt sich, ob es auch die Deduktion gibt, die von allgemeinsten Axiomen ausgeht und davon weniger allgemeine Aussagen ableitet, „deduziert“? Nun, schauen wir in die Geschichte der Philosophie und Wissenschaftstheorie müssen wir eine große Verwirrung bezüglich der Deduktion feststellen. So gibt es die am meisten bekannte mathematische Deduktion, die eine Form der quantitativ-funktiven Abgestaltung darstellt, mittels derer der Mathematiker von allgemeinen Axiomen ausgehend gewisse weniger allgemeine, aber stets abstrakte mathematische Folgen deduktiv herbeikonstruiert oder herbeikombiniert. Die Philosophen der Neuzeit – Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant – haben versucht, diese Methode in die Philosophie einzuführen, in der Hoffnung, damit ähnlich exakte und apodiktische Erkenntnisse gewinnen zu können. Das war ein großer Missgriff, der sich schwer gerächt hat. Sie haben aber auch oft, so Descartes schon, eine Erkenntnisform als Deduktion bezeichnet, die gar keine ist, sondern das pure Gegenteil. Das lässt sich schön an den „Primae Meditationes“ des Descartes oder in der „Kritik der reinen Vernunft“ Kants aufzeigen. Was dort „Deduktion“ heißt, ist in Wahrheit eine „Reduktion“, nämlich der rückfragende und rückarbeitende Rückgang von einem Bedingten zu seinem Bedingungsgrund, von einem Phänomenalen zu seiner oft nicht phänomenal gegebenen Voraussetzung. Gerade die transzendentale Deduktion Kants ist keine mathematische Ableitung, kein Übergang vom mathematischen Grund zur abgestalteten mathematischen Folge, sondern ein Rückschluss bzw. Rückgang von einer Phänomenalität auf die „transzendental-nichtphänomenale“ Bedingung ihrer Möglichkeit seitens der subjektiven Vernunft. Dabei schließt sie – ähnlich, wenn auch anders als die Induktion – vom Konkretem zum Allgemeineren, eben zum Grundlegenderen zurück, gewiss jedenfalls nicht – wie die echte, die mathematische Deduktion – vom Allgemein-Abstrakten zum weniger Allgemein-Abstrakten. Wohl handelt es sich bei der Kantschen Deduktion um eine diskursive Aktion, doch nicht um eine mathematisch-konstruktive Synthese, sondern um eine reduktive Analytik, deren Wesen immer darin besteht, zurückzufragen, nicht vorwärtszukonstruieren, wie das die mathematische Deduktion tut! Die Gleichsetzung von Diskursivität und Deduktion, die bis heute in den Wissenschaften herumgeistert (und übrigens schon bei Aristoteles begann!), ist also völlig unhaltbar. 28 Dennoch die Frage: Kann es in der Wissenschaft vom Leiden eine Deduktion im mathematischoperativen Sinne geben? Ich meine ja, aber nur sehr beschränkt. Ich selbst konnte z.B., was die möglichen Grundgestalten des Leidens angehen, einen Kalkül aufstellen, der, weil als Kreis in sich geschlossen, deduktiv vollständig abgestaltbar ist und deswegen apodiktisch gilt. Das ist aber ein seltener Ausnahmefall. 4. operative Deduktion und der Kreis der möglichen Leidensgestalten Doch selbst damit sind wir nicht am Ende, wie gerade die Psychoanalyse mit ihrer besonderen tiefenpsychologischen Analytik beweist. Denn bekanntlich geht sie über jede mögliche Empirie hinaus und erschließt mittels Deutungen solche Seins- und Wirkschichten des Menschen, die gar nicht anschaulich sind bzw. nicht auf Anhieb angeschaut werden können. Das dynamische Unbewusste lässt sich in seinem Kern nicht beobachten, sondern nur regressiv aus seinen erfahrbaren Wirkungen – Symptomen, Fehlleistungen, Träumen, Neurosen - erschließen – es ist also eine echt transzendente Größe, die durch ein rückwärtiges Rückschlussverfahren – natürlich immer nur hypothetisch – erhellt wird. Es grenzt schon ans Kuriose, wie sehr auch von den Psychoanalytikern verkannt wird, dass die psychoanalytische Metapsychologie auf einer Metaphysik aufruht, eben auf einer Metaphysik des Unbewussten, die ich allerdings für unumgänglich halte (Der Traum und sein Ursprung, Alber, 2008). Während bei allen bisherigen Methoden die Anschauung und damit die phänomenologische Analyse möglich sind, erreicht die Phänomenologie hier ihre definitive Grenze. Um über den Erfahrungshorizont hinauszukommen, bedarf es daher eines Rückschlussbzw. Rückarbeitungsverfahrens, das die Phänomenologie Husserls bekanntlich ablehnt. Unabhängig von der Frage, ob diese Ablehnung berechtigt ist, steht jedenfalls fest, dass sie angewandt wird, übrigens nicht nur in der Psychoanalyse, sondern in jeder Wissenschaft, die sich auf Gegenstände bezieht, die sich der direkten Anschauung entziehen. Niemand kann den Urknall anschauen, niemand ein Gluon sehen, niemand kann sich die Größe Wurzel aus 2 oder Pi real vergegenwärtigen, niemand direkt die Ermordung Cäsars betrachten, niemand um die erste lebende Zelle wissen – und doch bemühen sich viele Wissenschaften und nicht selten mit großem Erfolg um die Erkenntnis dieser Wirklichkeiten jenseits der Empirie. Ich meine, dass auch die Aussagen der Psychoanalyse über das dynamische Unbewusste, wenn leider auch nicht selten recht verstiegen, bei maßvoll-kritischer Anwendung und im Bewusstsein ihrer unaufhebbaren Hypothetik unverzichtbar sind. Ihr Name ist die 5. regressive transempirische Analytik („Transphänomenologie“/Tiefenpsychologie) Da sich die Psychoanalyse nicht ausschließlich auf die direkte Anschauung stützen kann, denn das Unbewusste ist ja gerade durch die Verdrängung vom Bewusstsein ausgeschaltet, besteht ihre größte Gefahr darin, irgendwelche willkürliche Zusammenhänge herbeizukonstruieren oder zu unterstellen und vom Patienten zu erwarten, dass er sich ohne echte eigene Nachprüfungsmöglichkeit ihren Deutungen unterwerfe. Wie kann dem begegnet werden? Nun, wohl nur dadurch, dass es dem Patienten ermöglicht wird, die erdeuteten Zusammenhänge in Bezug auf seine konkrete Lebenserfahrung nachzuvollziehen und in einen sinnhaften Bezug zu seinen Leiden zu bringen. Wenn er sowohl affektiv spüren als auch kognitiv besser verstehen kann, wie, wodurch, wozu seine Leiden entstehen und sich erhalten, wenn ihm zumindest plausibel wird, was mit ihm geschieht und wogegen er sich wehrt, so dass er sich neu sehen, besser verstehen, sich neu einstellen und mit seinen Leiden konstruktiver umgehen kann, wenn er schließlich mittels jener Deutungen sein Leiden überwinden und sein Leben kongruenter, authentischer, lebendiger und realitätsgerechter führen kann, dann machen auch hypothetische Deutungen, die zunächst an der Erfahrung nicht validiert werden können, Sinn. 29 Letztlich aber muss es das Ziel aller tiefenpsychologischen Verfahren sein, die Notwendigkeit der Abwehr so zu lockern, sprich vor allem Angst, Scham und Schuld abzubauen, dass das Verdrängte, Abgespaltene, Verbannte erscheinen darf und direkt angeschaut, erlebt, affektiv gefühlt und kognitiv integriert werden kann. Genau das wollen das „aufdeckende“ Gespräch und das analytische Verstehen leisten. Dann in der Tat ist, philosophisch gesprochen, das unerfahrene Transzendente in die erfahrbare Immanenz übergegangen mit der Möglichkeit, die Richtigkeit der Deutungen zu überprüfen und evtl. zu korrigieren. Das hatte Freud ja gemeint, wenn er sagte: Wo Es ist, soll Ich werden. 21. Schaubild: Methoden der Leidensanalytik 1. Vorwissenschaftlich-unsystematische Deskription und Analyse („Laiendeskription“) 2. Phänomenologisch-systematische Deskription („Expertendeskription“) 2.1. Phänomenologisch-horizontale Wesensanalytik bzw. Idealtypologie („statische Phänomenologie“) 2.2. Phänomenologisch-horizontale Kontext- oder Situationsanalytik von Syndromen, Idealtypen oder Wesensgestalten („situative Phänomenologie“) 2.2.1. Allgemein-lebensweltlicher Situationskreis 2.2.2. Therapeutischer Situationskreis – spezifische Wir-Gemeinschaft: Beziehungsarbeit, „Sprachzerstörung und Rekonstruktion“ 2.3. Vertikal-genetisch-deskriptive Analytik („genetische oder psychohistorische Phänomenologie“) 2.4. Vertikal-transzendentale Konstitutionsanalytik („dynamische Phänomenologie“) 3. Induktiv-hypothetische Verallgemeinerungsanalytik 4. operative Deduktion und der Kreis der möglichen Leidensgestalten 5. regressive transempirische Analytik („Transphänomenologie“/Tiefenpsychologie) 30 22. Schaubild: Verstehensformen in der Erhellung der leidenden Existenz 1. Einleibung, Mitgefühl und empathisches Verstehen (affektive Resonanz, „Einleben“, psychologisches „Nacherleben“) 2. logisches Verstehen („Satz-, Sprachverstehen“) 3. szenisches Verstehen („Handlungsdialog“, „interaktionelles Verstehen“) 4. motivational-erklärendes Verstehen („Bewusstmachung“ von Motiven, „Gründen“) 5. genetisch-erklärendes Verstehen bzw. psychohistorisches Verstehen: „Rekonstruktion“ der Leidensgeschichte (individuelle Biografik, transgenerationelle Biografik) 6. (meta-) theoretisches, konzeptuelles Verstehen 7. prognostisches Verstehen 8. neurobiologisches Verstehen (3./4./5./6. bilden zusammen das „hermeneutische Verstehen“) Erklären (entgegen Dilthey) = keine exklusiv naturwissenschaftliche Methodik, sondern: = Verstehen aus Gründen, einem physiologisch-biologischen, logischen, motivationalen, historischen Grund 31 10. Wahrheitskriterien und kritische Überprüfung in der Psychopathologie Damit kommen wir zum letzten Punkt, zur Frage nämlich, wie sich die Erkenntnisse, die mittels der hier vorstellten Methoden gewonnen werden, überprüfen, validieren und sichern lassen. Denn soviel ist klar: Eine Erkenntnisleistung darf sich erst dann wissenschaftlich nennen, wenn sie eine ausgewiesene Selbstkritik mit entsprechenden Überprüfungsmethoden besitzt. Vorher verbleibt sie in alltäglicher Dogmatik. Zum Zweiten ist aber auch klar, dass jede Wissenschaft – entsprechend ihrem einmaligen Erkenntnisgegenstand – über ihr je eigenes Überprüfungsinstrumentarium verfügt, das sich nicht einfach von anderen Wissenschaften ausleihen lässt. Die Mathematik hat da ganz andere Möglichkeiten als die Physik; die Physik ganz andere als die Biologie; die Biologie ganz andere als die Geschichtswissenschaft; die Geschichtswissenschaft andere als die Psychologie; die Psychologie andere als die Psychiatrie und Psychotherapie und die Philosophie wieder ganz andere als alle anderen zusammen. Grundsätzlich gilt dabei, dass das kritische Instrumentarium umso komplexer und unsicherer wird, je jünger und komplexer eine Wissenschaft ist. Da unsere Wissenschaft, die Wissenschaft vom Leiden und seiner adäquaten Behandlung, alle anderen Wissenschaften voraussetzt und also auf ihnen aufbaut, liegt die Komplexität ihrer kritischen Methodologie schon apriori auf der Hand. Die Erkenntnismethode einer Wissenschaft hängt aber nicht nur von der Komplexität des Gegenstandes ab, sondern vor allem von ihrem Kontext, ihrem Zweck und Ziel. Was aber sind Kontext und Ziel aller Therapeutik? Erkenntnis? Einsicht? Wahrheit? Die Psychoanalyse glaubte dies anfänglich, aber schon der Appell des Patienten widerlegt sie. Er will Überwindung seines Leidens, und eben dazu soll ihm die Einsicht in seine Wahrheit dienen! Dieses praktische Ziel aller Therapeutik – Veränderung von Wirklichkeit, vor allem der Wirklichkeit des eigenen (krankhaft leidenden) Selbstseins – wirkt sich nun aber zwangsläufig auf die Auswahl der Evidenzkriterien aus. Das lässt sich an einem Gedankenexperiment leicht zeigen: Nehmen wir zwei Therapeuten, von denen der eine ein genialer Diagnostiker ist, der die Verfassung eines Menschen präzise und umfassend erkennen kann, aber therapeutisch völlig inkompetent ist, und der andere ein genialer Praktiker, der zwar unfähig ist, eine Diagnose zu stellen, aber dem Patienten zu helfen weiß, sein Leid, seine Krankheit zu überwinden. Wen würde ein Patient vorziehen? Natürlich den zweiten. Das aber heißt, dass es letztlich nicht um Erkenntnis und Wahrheit geht, sondern dass Erkenntnis und Wahrheit im Dienst der Selbstveränderung, konkret im Dienst von Gesundung, Heilung, Nachreifung und Reifung stehen. Diese Aussage stimmt mit unserer früheren Einsicht überein, dass alle therapeutisch orientierte Wissenschaft von Leiden und Krankheit, also alle Psychopathologie, eine Hilfswissenschaft für das praktisch-therapeutische Leben, genauer eine dialogische Handlungs- und Veränderungswissenschaft auf dem Hintergrund einer Leidens- und Krankheitssituation ist. Stimmt das, dann hat dies erhebliche epistemologische Konsequenzen. Die Evidenz der Güte einer therapeutischen Diagnostik, Intervention, eines Verfahrens, einer Technik, ja sogar die Evidenz der Güte der therapeutischen Beziehung selbst bemisst sich dann primär nicht daran, dass sie Einblick in die eigene Wahrheit und Geschichte vermittelt, sondern dass die therapeutische Beziehung für den Patienten und seine Not tragfähig und vertrauenswürdig ist, dass der Therapeut sich verständnisvoll, mitfühlend, einfühlend, unterstützend, hilfreich zeigt und dass das Verfahren für den Patienten so maßgeschneidert ist, dass er sich zu mehr Selbstklärung, Selbstkongruenz und Authentizität, zu mehr Arbeits-, Genuss-, Liebes- und Leidensfähigkeit, kurz zu mehr Lebendigkeit entwickeln kann. Stimmt dies, dann fragt sich aber, wie und woran all dies soll erkannt werden können? Sicherlich nicht allein objektiv-szientistisch von außen und aufgrund ausschließlich allgemeiner Kriterien, sondern letztlich im Rahmen einer konkret-einmaligen Patient-Therapeut-Wir-Gemeinschaft, die mittels der ständigen Wechselanwendung von Intuition und Diskurs, von Anschauung und Begriffsarbeit, von Anspüren und Analyse, von Erkenntnis und Erprobung, von Phantasie und Realitätsprüfung herausfindet, wie die Not zu beheben, wie die lebensfeindlichen Muster aufzulösen und wie die Entwicklung zu mehr 32 Selbstkongruenz und Beziehungsfähigkeit zu erreichen ist. Ob sich der Patient in dieser therapeutischen Beziehung angenommen, gut aufgehoben, verstanden, ernst genommen fühlt, ob er sich über sich selbst klarer wird, sich annehmen und entwickeln kann, das kann allerdings letztlich nur er selbst bestimmen, und er wird sich dabei auf eine Mischung aus emotional-intuitiver Intelligenz, kognitiv-diskursiver Rationalität und praktischer Alltagserprobung stützen. Dagegen ist es die Sache beider, des Patienten und des Therapeuten, empathisch und dialogisch zu überprüfen, ob die gesteckten Ziele erreicht wurden, ob der Patient beziehungsfähiger, ausdrucksfähiger, kritikfähiger und freier geworden ist. Bevor ich aus der Fülle der Evidenz-, Wahrheits- und Wahrscheinlichkeitskriterien einige wenige detaillierter bespreche – denn alle lassen sich in diesem Rahmen nicht behandeln -, soll ein Überblick zeigen, was in der Psychopathologie und in der Therapeutik methodologisch überhaupt relevant sein kann: 33 23. Schaubild: Übersicht über Evidenz-, Wahrheits- und Wahrscheinlichkeitskriterien 1. unmittelbare positive Evidenz („Aha-Erlebnis“): a. aisthesiologisch-phänomenologische („kognitive“) Evidenz: „Das ist es!“, „So ist es!“ b. affektiv-emotionale Evidenz = Kongruenz (gefühlte Selbsteinheit, Selbststimmigkeit, Selbstresonanz): „So fühlt es sich stimmig an! So stimmt es.“ c. pragmatische Evidenz = Handlungskohärenz: „So klappt es, so funktioniert es! So will ich es.“ d. intersubjektive Evidenz = spontane intersubjektive Übereinstimmung („Sympathetik“) 2. negative Evidenz = Inkonsistenz-, Inkongruenz-, Inkohärenzerlebnis: „So stimmt es nicht, das fühlt sich nicht richtig an, das leuchtet mir nicht ein. Das kann ich nicht nachvollziehen.“ (philosophische Sonderform der negativen Evidenz = argumentatio ex contrario = Unmöglichkeit der Verneinung eines Phänomens, einer Tatsache, einer Einsicht, eines Gefühls, einer Handlungsnotwendigkeit = negativ-diskursive Evidenz) 3. empirische Evidenz = Übereinstimmung = Korrespondenz zwischen Vorstellung und „Realität“, zwischen Begriff und „Realität“ (inklusive Objektivität, Validität, Reliabilität) 4. psychogenetische Plausibilitätsevidenz (Selbstverstehen durch biografisch-kausale Erklärung, psychohistorische Kohärenz): „Biografiearbeit“ 5. Evidenz durch Aufklärung der Verarbeitungskausalität oder subjektiv-motivationalen Kausalität (Selbstverstehen durch motivational-kausale Erklärung; psychomotivationale Kohärenz, „psychologisches Verstehen“): „kognitive Psychotherapie“ 6. diskursiv-intersubjektive Evidenz = Konsensus, Erlebnis einer Gemeinschaftskohärenz (dialogisch vermittelt; „szenisch-interaktionelles Verstehen“): „Psychoanalyse“ 7. logische Konsistenz/Widerspruchsfreiheit bzw. sachliche Kohärenz einer bzw. mehrerer Aussagen („logisches Verstehen“, „logische Evidenz“): „Logotherapie“ 8. theoretisch-systematische Kohärenz zwischen Einzelaussagen („Hypothese“, Deutung), Kontext und Metatheorie („hermeneutisches Verstehen“, „hermeneutischer Zirkel“) 9. zukunftsbezogene Übereinstimmung = pragmatisch-wahrscheinliche bzw. später bestätigte richtige Prognose („prognostische Evidenz“) 10. psychophysische Übereinstimmung (neurobiologisch-psychologische Korrelation, analogische Heuristik, „neurobiologische Evidenz“) 34 An allem Anfange steht wissenschaftstheoretisch das fundamentale Wahrheitskriterium der so genannten „positiven Evidenz“, also schlicht die Tatsache, dass überhaupt etwas gegeben und direkt erlebbar, erfahrbar, anschaubar ist. Dass es sich hierbei um ein apodiktisch-fundamentales Kriterium handelt – den so genannten „Satz des Bewusstseins“ (K.L. Reinhold, 1789) bzw. den „Satz der Phänomenalität“ -, kann am klarsten durch die so genannte negative Evidenz bewiesen werden. Denn ihre kritische Funktion besteht darin zu überprüfen, ob die Verneinung einer Aussage möglich ist oder nicht. Leicht ersichtlich ist aber die Leugnung einer jeglichen positiven Evidenz unmöglich, denn der Satz: „Mir ist rein gar nichts gegeben.“ widerspricht sich direkt selbst. Gerade in der Psychotherapie muss es aus Gründen, die sogleich genannt werden, immer das Bestreben sein, alle noch so komplizierten Diskurse und Operationen letztlich auf positive Evidenzen, am besten natürlich auch noch solche, deren Leugnung unmöglich oder widersinnig ist, zurückzuführen. Gelingt dies nicht, bleibt eine Erkenntnis nur oberflächlich, unpersönlich, nicht subjektiv angeeignet, unverbindlich, nicht existenziell. Eine psychodynamische Deutung z.B., die der Patient zwar logisch verstehen, die er aber nicht mit sich selbst verbinden kann, wäre für sich genommen bedeutungslos und muss daher mindestens als Anregung, als Heuristik dafür dienen können, einem unbekannten Zusammenhang nachzuspüren und nachzugehen. Stellt sich dieser aber nicht irgendwann einmal als persönliche Evidenz ein, dann muss der Therapeut seine Deutung, die ja immer nur hypothetischen Charakter hat, zurückstellen, aufgeben oder modifizieren. Löst sie dagegen im Patienten ein Aha-Erlebnis aus, sodass ihm ein neuer Zusammenhang aufleuchtet, dann kann der Patient sie verinnerlichen und integrieren, dann ist aus der Vermutung eine subjektive Gewissheit geworden. Bei dieser Gewissheit, dieser subjektiven, mit dem Therapeuten geteilten Evidenz handelt es sich in der Regel um ein Gemisch aus kognitiven und affektiven Evidenzen, die der Patient dann noch praktisch erproben kann und soll. Gelingt ihm das nicht, dann muss überprüft werden, ob der Transfer in den Alltag problematisch ist oder ob jene Evidenz nur scheinbar eine war und korrigiert werden muss. Je länger eine Therapie dauert, desto mehr Evidenzerlebnisse machen Patient und Therapeut, und zwar gemeinsam, was zur Folge hat, dass ein regelrechtes Gewebe von Evidenzen entsteht, die sich gegenseitig beleuchten, stützen, aber auch hinterfragen, korrigieren und weitertreiben. In der Hauptsache kommen hier „innere“ Wahrheitskriterien wie die logische Evidenz, die affektive Evidenz, die szenische Evidenz, die psychodynamische, psychogenetische und psychosomatische Evidenz zur Geltung, aber natürlich auch prognostische und metatheoretische Evidenzen. „Äußere“ Wahrheitskriterien, die etwa von der Psychoanalyse (vgl. Lorenzer 1965) bewusst ausgeklammert werden, sollten dennoch nicht unterschätzt werden, da der Patient ja gezwungen ist, auch außerhalb der Therapiesituation zu leben und, wenn möglich, seine neuen Einsichten, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten im Alltag zu erproben. Die Rückmeldungen aus der „Welt“ sind darum oft sehr hilfreich und können gesteigert werden, wenn eine andere Person, z.B. der Partner oder die Mutter oder der Vater usw. im Rahmen eines Paargespräches, hinzugezogen wird. Aber auch die Erfahrungen, die ein Kuraufenthalt oder nur die Ferienzeit mit sich bringen, stellen außenempirische Prüfkriterien dar. In jedem Falle erhält man neue Perspektiven und kann das bisher Bekannte kritisch überprüfen. Modifikationen sind nach meiner Erfahrung dabei immer die Folge. Die extremste Form einer äußeren Überprüfung wäre ein psychologisches Experiment oder gar eine neurobiologische Untersuchung – beides ist durchaus nicht apriori unsinnig, sondern kann in bestimmten Situationen durchaus sehr hilfreich sein. Schon eine Schlaflaboruntersuchung, die zwischen einem organischen und einem psychischen Leiden unterscheidet, sollte in einer Psychotherapie nicht ausgeschlossen werden. 35 Spätestens an diesem Punkt erweist sich das Diltheysche Konzept der konträren Gegenüberstellung von geisteswissenschaftlichem Verstehen und naturwissenschaftlichem Erklären als zu undifferenziert und noch zu sehr am cartesischen Dualismus von sinnlos-mechanischer Natur und sinnhaft-geistiger Kultur orientiert. Doch, wie schon Heinrich Rickert (1921) zeigte, gibt es bereits innerhalb der Geisteswissenschaft viele Formen eines erklärenden Verstehens, ohne das keine Biografik und keine Werkanalyse möglich wären. Denn immer wenn wir für irgendetwas einen Grund angeben, bedienen wir uns eines erklärenden Verstehens, so im Falle der motivationalen, der psychogenetischen oder auch der – nie rein psychologischen - psychosomatischen Erklärung. Denn ein Motiv, z.B. eine Angst, eine Scham, ein Trauma, ein „Triebwunsch“ etc., ist ja ein „bewegender“, ein dynamischer Grund, also eine echte Wirkursache, nicht nur ein statisch-struktureller Sinnzusammenhang. Das haben Dilthey und Gadamer nicht beachtet. Gerade das Verstehen von Psychischem aus Psychischem ist ein Erklären, eben ein Verstehen aus einem seelisch-dynamischen, also wirksamen Grund-FolgeVerhältnis. Wie solch ein erklärendes Verstehen erkenntniskritisch gesichert werden kann, ist ein anderes Problem, aber dass wir uns ständig – sowohl im Alltag als auch in der Therapie – dessen bedienen, ist leicht überprüfbar. Denn wir wollen für alles, was geschieht, aber unverständlich ist, einen zureichenden Grund finden, und so auch für unsere unverständlichen Leiden. Werden sie durch einen psychodynamischen oder psychogenetischen Zusammenhang transparent, erhalten also eine innere Logik, die das aktuelle Leiden auf dem Hintergrund der Persönlichkeitsstruktur und ihrer Beziehungsund Konfliktgeschichte verständlich macht und die Perspektive eröffnet, sich damit konstruktiv auseinander zu setzen, vielleicht sogar, sich davon zu befreien, dann sind es hier die oben eingeführten kognitiven, emotionalen und praktischen, weiter logischen, empirischen und intersubjektiven Wahrheitskriterien, die die Richtigkeit einer therapeutischen Arbeit stützen. Für die Belange einer gelingenden Therapeutik reicht dies vollkommen, wir müssen und können hier den Maßstab der mathematischen Präzision und Sicherheit nicht anlegen, das wäre geradezu unwissenschaftlich, weil sach- bzw. seinsunangemessen. Das Leben, auch das leidende, ja das kranke, ist nie ohne Struktur und Ordnung, nie ohne Sinn und Bedeutung, nie ohne Zusammenhang, aber es ist eben nicht statisch, nicht zeitlos, nicht rein funktional, nicht rein quantitativ, sondern höchst dynamisch, wandelbar, qualitativ, widersprüchlich, konfliktreich, fragil und oft genug gebrochen und verletzt. Im Unterschied zu einer falschen mathematischen Gleichung kann sich das beschädigte Leben aber selbst heilen, kann regenerieren, kann schöpferisch-kreativ neue Wege der Selbstkonstitution finden. Gewiss, das mag alles ungenau und schwer fassbar sein, aber wer feinfühlig-achtsam mitgeht, erfährt eine andere Genauigkeit, eine lebendige, tiefe, reiche Genauigkeit, die in Hinsicht der Existenz des Menschen, seines Daseinsinnes und Daseinswillens sicher weitaus präziser ist als alle Mathematik oder Logik. 36 11. Möglichkeit und Grenze einer Wissenschaft vom leidenden Subjekt Auf dem Hintergrund der bisherigen Ergebnisse gibt es keinen vernünftigen Grund, an der Möglichkeit einer Wissenschaft vom leidenden Subjekt zu zweifeln. Diese Möglichkeit wurzelt zusammengefasst in den folgenden Tatsachen: 24. Schaubild: Ermöglichung und Grenze der Leidenserkenntnis 1. in der (begrenzten) Selbsterlebbarkeit des Leidens, also in der reflexiv erfahrbaren spezifisch pathischen Selbstaffektivität 2. in der Selbsterkennbarkeit der individuellen und universalen Struktur des Leidens 3. in der persönlichen Ausdrucksmöglichkeit des Leidens in Leib, Szene und Sprache 4. in der Mitteilbarkeit des Leidens 5. von Seiten des Therapeuten in Einleibung, Mitgefühl (affektiver Resonanz), Empathie, im imaginativen Sich-in-den-Anderen-Hineinversetzen, im Nacherleben des Leidens 6. in der gemeinsamen Sprache und im gemeinsamen Vorrat an Begriffen und Bildern, den die Sprache zum Phänomen Leiden vorhält 7. und in der allgemeinen, überindividuellen Grundstruktur a. des normalen Leidens, b. des Grenzleidens (Notleidens) und c. des pathologischen Leidens (Neurosen, Psychosen, Psychosomatosen, Perversionen, Beziehungsstörungen, kollektive Leiden und Störungen) Mit diesen Möglichkeiten sind nun aber auch die Grenzen und Unmöglichkeiten einer Wissenschaft vom Leiden gegeben. Hierzu ist zu sagen: 1. Die Quellen und (Ab)-gründe des Leidens sind dem Selbstbewusstsein oft nicht zugänglich, etwa weil die Leidenserfahrung zu intensiv, zu tief, zu total, zu verwirrend, zu diffus und zu komplex ist. 2. Das Leiden kann aber auch aktiv verstellt sein, etwa durch Verdrängung, Verleugnung, Abspaltung, Verzerrung, Verschiebung (Somatisierung) und Projektion seitens des Betroffenen. 3. Auch die begrenzte sprachliche Mitteilbarkeit kann eine Grenze für die Erkenntnis und Behandlung eines Leidens sein. 4. Wie im Falle von gewissen Wahnformen kann die intersubjektive Verständlichkeit eingeschränkt sein. 5. Oder es ist die Bereitschaft und Fähigkeit des Therapeuten nicht gegeben bzw. zu beschränkt, sich auf das Leid des Anderen mitfühlend, empathisch, verstehend, nachvollziehend einzulassen (intersubjektive Abwehr: Beschönigung etc.) 37 6. Im Falle, dass das Leiden partiell oder total vom Bewusstsein ausgeschlossen ist, kann die Lesbarkeit des Unbewussten in Spuren, Symptomen, Fehlleistungen, Symbolen etc. für den Therapeuten mehrdeutig oder unmöglich sein bzw. muss zusammen mit dem Betroffenen erst in einem mühsam-langen Prozess in Lesbarkeit überführt werden. In diesem Prozess gilt es nicht selten, gegen innere Widerstände der Leidenswahrnehmung, des Leiderduldens und des Leidverstehens – und zwar auf beiden Seiten! – anzuarbeiten. Dabei können vielfältige Mittel zum Einsatz kommen, wie das Hinund Nachspüren, die Klärung, die Deutung, die Konfrontation, die Imagination, die kreative Gestaltung und psychodramatische Inszenierung des Leidens. Immer jedoch sollte die therapeutische Beziehung als Mini-Inszenierung und Mini-Drama des Leidens und der spezifischen Leidverarbeitung (oder –nichtverarbeitung) eines Patienten aufgefasst und genutzt werden. 7. Im Letzten darf nie aus dem Blick geraten, dass der Mensch mit seinem Leid ein „individuum ineffabile“ ist: der innerste individuale Kern des Leidens ist nur fühlbar und bleibt dem wissenschaftlichen Begriff unzugänglich. So dürfen wir am Ende dieses Vortrages zusammenfassend feststellen, dass eine Wissenschaft vom leidenden Subjekt zwar durchaus möglich, also methodisch und kritisch durchführbar ist, dass sie aber aufgrund der besonderen Struktur und Dynamik des Leidens, seiner Labilität, Widerständigkeit und Dialektik, seiner Affektivität und Selbsttranszendierungstendenz, und aufgrund seiner schwierigen Versprachlichung und Mitteilbarkeit und schließlich seiner wesenhaften Gebundenheit an Subjektivität, Empathie und Sprache immer prekär bleibt und nur in einem letztlich unabschließbaren Prozess entwickelt und aufgebaut werden kann. Nichtsdestotrotz bleibt es möglich, echt allgemeine Strukturen und Gestalten des normalen Leidens, des Notleidens (an der Grenze der Erträglichkeit) und des kranken Leidens, weiter des individualen und kollektiven Leidens, der besonderen pathischen und pathologischen Beziehungsformen und der besonderen therapeutischen Beziehung, Situation und Intervention in den bekannten Grundformen von Prävention, Diagnostik, Prognostik, Therapeutik und Nachsorge auszuarbeiten. Darum sollte eine Wissenschaft vom leidenden Subjekt bzw. von leidenden Subjekten nie zum bloßen Selbstzweck werden, sondern sollte als Hilfswissenschaft für die therapeutische Praxis fungieren und damit Bestandteil einer umfassenden dialogisch-helfenden Handlungswissenschaft, also einer therapeutischen Pragmatik des Leidens, der Not, des Krankseins und der therapeutischen Hilfe sein. 38