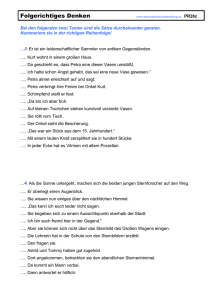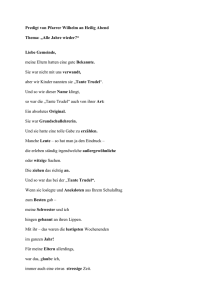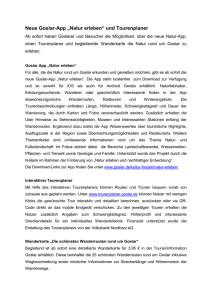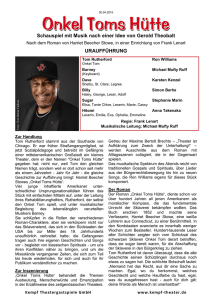Stellen Sie sich vor, liebe Goslärsche, liebe
Werbung
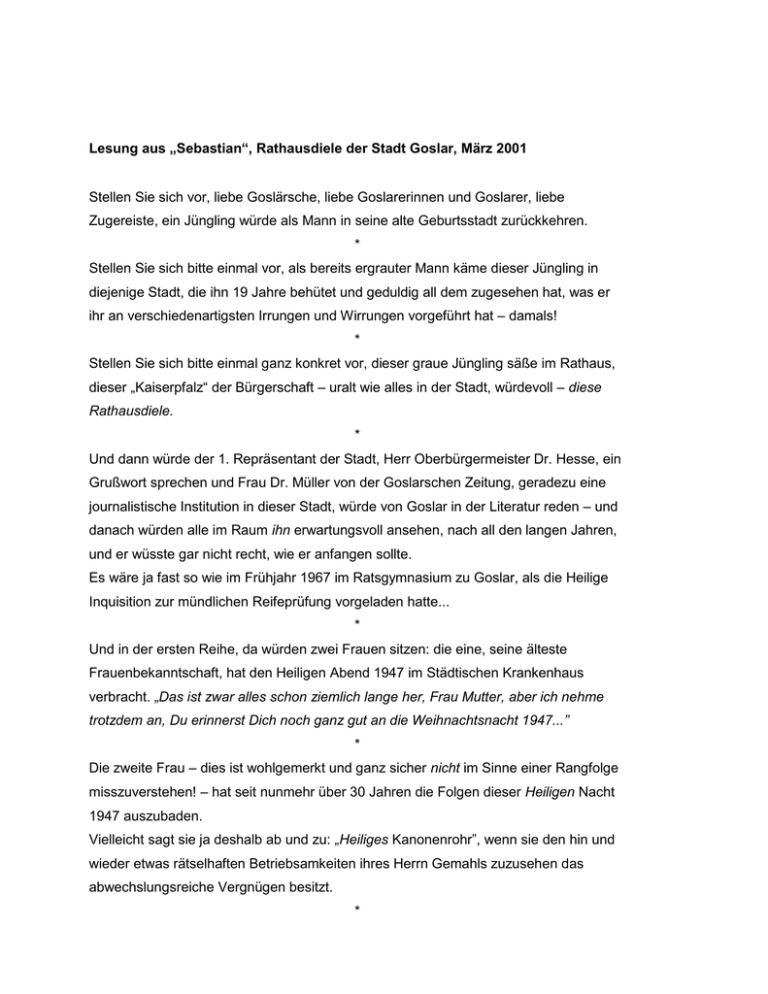
Lesung aus „Sebastian“, Rathausdiele der Stadt Goslar, März 2001 Stellen Sie sich vor, liebe Goslärsche, liebe Goslarerinnen und Goslarer, liebe Zugereiste, ein Jüngling würde als Mann in seine alte Geburtsstadt zurückkehren. * Stellen Sie sich bitte einmal vor, als bereits ergrauter Mann käme dieser Jüngling in diejenige Stadt, die ihn 19 Jahre behütet und geduldig all dem zugesehen hat, was er ihr an verschiedenartigsten Irrungen und Wirrungen vorgeführt hat – damals! * Stellen Sie sich bitte einmal ganz konkret vor, dieser graue Jüngling säße im Rathaus, dieser „Kaiserpfalz“ der Bürgerschaft – uralt wie alles in der Stadt, würdevoll – diese Rathausdiele. * Und dann würde der 1. Repräsentant der Stadt, Herr Oberbürgermeister Dr. Hesse, ein Grußwort sprechen und Frau Dr. Müller von der Goslarschen Zeitung, geradezu eine journalistische Institution in dieser Stadt, würde von Goslar in der Literatur reden – und danach würden alle im Raum ihn erwartungsvoll ansehen, nach all den langen Jahren, und er wüsste gar nicht recht, wie er anfangen sollte. Es wäre ja fast so wie im Frühjahr 1967 im Ratsgymnasium zu Goslar, als die Heilige Inquisition zur mündlichen Reifeprüfung vorgeladen hatte... * Und in der ersten Reihe, da würden zwei Frauen sitzen: die eine, seine älteste Frauenbekanntschaft, hat den Heiligen Abend 1947 im Städtischen Krankenhaus verbracht. „Das ist zwar alles schon ziemlich lange her, Frau Mutter, aber ich nehme trotzdem an, Du erinnerst Dich noch ganz gut an die Weihnachtsnacht 1947...” * Die zweite Frau – dies ist wohlgemerkt und ganz sicher nicht im Sinne einer Rangfolge misszuverstehen! – hat seit nunmehr über 30 Jahren die Folgen dieser Heiligen Nacht 1947 auszubaden. Vielleicht sagt sie ja deshalb ab und zu: „Heiliges Kanonenrohr”, wenn sie den hin und wieder etwas rätselhaften Betriebsamkeiten ihres Herrn Gemahls zuzusehen das abwechslungsreiche Vergnügen besitzt. * Es ist viel von Geschichte in den dicken Mauern dieser alten Stadt – und es gibt riesige Mengen kleiner Geschichten. Und die ganze Geschichte und der Berg von Geschichten, das alles summiert sich zu einem beachtlichen Gewicht, das sich soeben demjenigen, der hier vorn sitzt, auf die Schultern legt. * Dem Mann, den wir, um ihm eine literarische Dimension zu verleihen, beim Kunstnamen „Sebastian“ nennen wollen, geht gerade jetzt ein solches Gestrüpp von Erinnerungen und Gefühlen durch Kopf und Herz, dass er dem Himmel dankt, dass er sich heute Abend bei einem Herrn von Goethe anlehnen darf: „Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost ins Rathaus tragen“. Der verehrte Geheimrat möge mir verzeihen, dass ich ihn soeben etwas verbiegen musste, damit er in die Goslarer Rathausdiele passte... * Das Leben, von dem das Büchlein „Sebastian” in Episoden berichtet und aus dem ich etwas lesen will, fand statt im Goslar der Jahre 1947 bis 1967. Der Aufbau des Textes ist denkbar einfach: Der Mann Sebastian, „Der Graue”, der das Buch schreibt, beobachtet das Aufwachsen des blonden kleinen Sebastian, begleitet ihn und gibt ihm den einen oder anderen Hinweis, wie man noch mit dem Leben umgehen könnte – wohlweislich sagt er nicht: „sollte“ – weist dem Kleinen nur in etwas längerer Kenntnis des Lebens andere Möglichkeiten – mehr nicht. Mit Belehrungen ist er sparsam, da er wohl fühlt, dass im Erwachsenen sämtliche Stadien des Jünger-Seins heftig rumoren, manchmal sogar die Oberhand über das vermutlich anzustrebende Vernünftigsein gewinnen. * Nicht weit von diesem herrlichen historischen Raum mit der blauen Sternendecke und den wohl einmaligen mittelalterlichen Geweihleuchtern steht bekanntlich die Kaiserworth, über die der bewundernswert bösartige Heinrich Heine in seiner Harzreise von 1824 schrieb: „Ungefähr von der Erde und vom Dach gleich weit entfernt stehen da die Standbilder deutscher Kaiser, räucherig schwarz und zum Teil vergoldet, in der einen Hand das Szepter, in der anderen die Weltkugel; sehen aus wie gebratene Universitätspedelle... Einer dieser Kaiser hält ein Schwert, statt des Szepters. Ich konnte nicht erraten, was dieser Unterschied sagen soll; und es hat doch gewiss seine Bedeutung, da die Deutschen die merkwürdige Gewohnheit haben, dass sie bei allem was sie tun, sich auch etwas denken.“ * Dieser Heine war schon ein ziemlich infamer Kerl – und hat doch mit der Loreley eines der schönsten deutschen Gedichte überhaupt geschrieben. Der typisch Heinesche Zwiespalt: „Taubenherz und Geierschnabel” – ich mag Heine sehr. * Und wenn es „deutsch“ ist, dem Sinn des Lebens nachzuspüren, dann ist „Sebastian“ ein sehr deutsches Buch geworden! * Und 1967 ging Sebastian in die Welt hinaus: „Als Sebastian mit 19 Jahren unter die Fahnen zog, (...) da krächzte in seinem nunmehr verwaisten Kinder- und Jugendzimmer sein alter vorlauter hölzerner Rabe, Gefährte seiner Kindheit und Jugend zum Abschied: «Soldaten, Soldaten, schießen mit Tomaten!» Dann klappte er seinen innen rotlackierten Schnabel zu und war nur noch rabenschwarz. Sebastians Vater saß im Kontor über seiner Buchhaltung und dachte: ,Der schafft das schon, ist ja schließlich mein Junge’, während Sebastians Mutter ihren Sohn vor dem Haus zum Abschied umarmte, weinte, ihn ängstlich an sich drückte und zu ihm sagte: «Hoffentlich schaffst du das, mein Junge. Gib’ schön acht auf dich!»“ * Und viele, viele Jahre später: Von den bittersüßen, berauschend-ernüchternden Cocktails des Lebens probiert, elysisches Manna mit den Elixieren des Teufels achtlos hinuntergespült, mal sich mit Prometheus an gestohlenen Feuern gewärmt, mal mit Herrn Urian die knöchernen Würfel geworfen – und immer wieder von seiner Frau gerettet und aufgerichtet –, da stellte das Leben den Sebastian vor einen Spiegel, rückte ihm den Kopf zurecht und sprach zu ihm: „Wir sind jetzt schon ein wenig auf dieser komischen Welt herumgelaufen, oft geschäftig unterwegs gewesen, da scheint es mir an der Zeit, dass Du mir einmal sagst, wer Du eigentlich bist, mein Freund! Und dabei blickst Du mir gefälligst in die Augen, wenn ich bitten darf!“ Und Sebastian blickte in den Spiegel. Vor 34 Jahren hatte er sich gewünscht, James Dean sähe heraus, das hätte seiner damaligen Tanzstundendame, der kleinen Bärbel, sicher nicht schlecht gefallen – heraus sah hingegen Sebastian. Jetzt wünschte er sich, Sean Connery täte es – aber der hatte wohl Besseres zu tun. Und Sebastian blickte in den Spiegel. * Lange tat er das. * Und plötzlich wurde der Raum hinter dem Spiegel weit und Sebastians graue Haare wurden wieder dunkel. Dunkler und dunkler wurden sie – und plötzlich ganz blond, und hinter dem Spiegel hopste aufgeregt ein kleiner Junge und kreischte vor Lebensfreude. Und das Kind trug den Namen Sebastian. „Direkt außerhalb des Grundstücks, hinter dem Lager, verliefen auf einem Bahndamm Gleise, in denen hoch mit Eisenerz befrachtete Güterzüge asthmatisch schnaufende Dampflokomotiven bis zum letzten forderten. Die Maschinisten, welche die feuer-, dampf- und rauchspeienden Ungetüme souverän bedienten, wurden Sebastians erste Helden. Oft stand er im Garten, wartete mit großen Augen und heißen Händen auf die längsten dieser Züge, die zu Berge fuhren, und kannte bald alle Fahrpläne auswendig. Schon von weitem sah er die pechschwarzen Zugmaschinen die Wolken ihres heißen Atems gegen die des Himmels schleudern, spürte, wie der Boden unter ihm immer stärker zu vibrieren begann, und fühlte, dass sein kleines Herz wie wild versuchte, in den Rhythmus einzufallen, der stählern-unaufhaltsam auf ihn zugestampft kam. Das war ganz unübertrefflich aufregend und verlieh ihm für kurze Zeit die Kraft, die seinem schmächtigen Körper fehlte, weshalb er sich mitunter, ganz für sich, verschwiegen schämte. Beim Näherkommen der dreigeäugten Kesselwagen konnte Sebastian das rot-silbrig zischend-rasende Getümmel von Gestänge und Räderwerk unterscheiden, das die Brachialgewalt der Dampfmaschine den Schienen aufzwang und für Vortrieb sorgte. Sebastian vermochte es fast nicht zu begreifen, dass solcherlei Inferno von Menschen ausgedacht und kontrollierbar war; und doch, ersichtlich war es so: Zu Sebastians größter Genugtuung – denn von eines Menschseins Wert ruhte schon ungeweckte Erkenntnis in ihm, trotz seiner Jugend – fehlten niemals die beiden rußgeschwärzten Beherrscher der wutentbrannten Eisenkonstruktion. Lässig den rechten Ellbogen auf die Brüstung gelegt, den Blick nach vorn, in Richtung Fahrtziel gerichtet, den linken Arm im Dunkel des Steuerstandes, der Maschine über unsichtbare Armaturen die nötigen Befehle erteilend – so glitt, unerreichbar über dem staunenden Sebastian, der Lokomotivführer vorbei, den Sebastian zaghaft grüßte, gleichwohl er wusste, dass dieser viel zu Wichtiges vollbringen musste, als einen kleinen Jungen wie ihn zu beachten. Einmal erwiderte aber doch einer der Kommandeure dieser Höllenmaschinen seinen Gruß – indem er die Dampfpfeife einen schrillen Pfiff zu Sebastians Ehren ausstoßen ließ. Da hüpfte Sebastians Herz in seiner engen Brust wie ein außer Rand und Band geratener Gummiball.“ * Nun kennen wir immerhin schon Sebastians ersten Berufswunsch: Lokomotivführer! Mit dem Ersatz dieser prachtvollen Dampfmaschinen durch langweilige V 200 und ähnlich fade Dieselloks kam er dann davon wieder ab, wollte zunächst Zirkusdirektor und später Formel-1-Pilot werden. * Hätte selbst heutzutage, im so genannten ‚gesetzten’ Alter, nichts dagegen, das Brüllen und Fauchen eines 10-Zylinder-Rennmotors hinter sich zu hören! * Lehrer wollte Sebastian nie werden! Darum wurde er Lehrer. * Wem dies wider alles Erwarten wie ein krasser Widerspruch vorkommen sollte, der kennt erstens den Sebastian nicht und hat es vielleicht zweitens noch nie gewagt, einen Abstieg in die zerklüfteten Seelenlandschaften eines Menschen zu riskieren. Eine Art der dunklen, rätselhaften Labyrinthe des Minotaurus. Ich empfehle in solchen Fällen eine intensive Lektüre der gesammelten Werke eines analytisch sehr beschlagenen Professors namens Sigmund Freud aus der Wiener Berggasse. Diese Lektüre sticht einen Karl May mit Leichtigkeit aus! * „Durch milchglasartige, halbtransparente Traumvorhänge sah Sebastian sich selbst zu, wie er, die Brottasche verwegen über der Schulter, mit wehendem Blondschopf aus dem Haus zum Kindergarten lief. Die Straße hinauf, vorbei an der schieferverkleideten Häuserzeile, die den Kleinen schon gut kannte und sich grüßend vor ihm leicht verneigte, bis zur Tankstelle, an der einige Leukoplastbomber (,Wer den Tod nicht scheut – fährt Lloyd...’ summte Sebastian vor sich hin) langsam verschimmelten, dann über die Kreuzung in den Köppelsbleek hinein. Immer wenn er in das Wäldchen gelangte, begann er zu hüpfen, das hatte er sich so angewöhnt, um schneller vorwärts zu kommen. Als er auf die erste Weggabelung zugesprungen kam, hielt er abrupt inne: ,Wo war der Vogelgesang geblieben, der ihn sonst jeden Tag erfreute?’ Totenstill war es im Gehölz, keine der immer so emsig raschelnd Blätter wendenden Amseln war heute zu vernehmen, kein Gewusel der flinken, stecknadelkopfäugigen Haselmäuse drang an sein Ohr, auch die Finken, Meisen und das übrige Vogelvolk gaben keinen Mucks von sich. Nur das Bummern von Sebastians Herz dröhnte durch den Wald, immer lauter wurde es, und Sebastian entzifferte nach und nach drei Wörter, die es ihm in den Kopf hämmerte und die seine Lippen zaghaft nachzuflüstern begannen: «Der Schwarze Mann, der Schwarze Mann...» Mit Donnergetöse teilte sich der Wald vor ihm, und ein riesiger Fuß in einer Ledersandale stellte sich ihm in den Weg. «Hab’ ich dich endlich?!» brüllte der entsetzlich anzuschauende Waldmensch und riss eine ausgewachsene Buche mitsamt der Wurzel aus, die er drohend gegen den schlotternden Knaben mit einer solchen Wut schüttelte, dass Sebastian die Erdklumpen um die Ohren flogen. «Ich steck’ dich in den Sack, und dann musst du für mich in meinem Bergwerk arbeiten, tausend Fuß unter Tage; dreimal dreiunddreißig Jahre, bei Wasser und Brot!» Nach dieser Drohung versuchte der Gigant, das arme Kerlchen zu packen, indem er seine rot behaarte Riesentatze, in der Sebastian bequem Platz gehabt hätte, nach ihm ausstreckte; dabei bewegte er ruckartig seinen klobigen Schädel auf Sebastian zu, um ihn wie ein Geier zu verschlingen. Aus gewaltigen Nasentunneln grollte ein Sturm auf Sebastian zu, der ihn fast von den wackligen Beinchen blies, tückisch funkelnde Augen, groß wie Wagenräder, kamen näher und gefletschte gelbe Hauer machten sich bereit, den Knaben zu zermalmen. Laut kreischte da der Sebastian auf und stob derart angstgepeitscht davon, dass der Kies nur so spritzte. Der Koloss richtete sich zu seiner ganzen Größe auf, wohl an die sieben Meter hoch, und schleuderte den Baum hinter dem flüchtenden Jungen her, den er nur um Haaresbreite verfehlte, da Sebastian sich gerade noch rechtzeitig geduckt hatte. Es polterte heftig und die Erde erzitterte..., als Sebastian sich vor seinem Bett wieder fand, furchtgeschüttelt zwar und völlig außer sich, aber errettet aus höchster Todesgefahr, und schlecht wär’ er drangewesen, ganz ohne dringend nötige Tröstung geblieben, hätte er nicht sein treues Plüschbärchen gleich wieder gefunden und in seine Arme nehmen können, um seinem zotteligen Gefährten anzuvertrauen, was er gerade unglaublich Schlimmes auszustehen gehabt hatte. Ein dermaßen braves Bärchen, das war im Leben gar nicht hoch genug einzuschätzen, dachte sich der halbwegs beruhigte Sebastian und wünschte innig, dass die Welt doch nur aus gutmütigen Brummbären mit schwarzen Nasen bestünde, auf Schwarze Männer könnte man schon sehr gut verzichten. Und das Bärchen, dem noch schnell die weiche Schnauze und die runden Ohren gestreichelt worden waren, stimmte seinem kleinen Herrn wie immer vollkommen zu, schloss beruhigt seine klugen Glasaugen und gab weiterhin gut acht auf Sebastian, dem noch etwas beigestanden werden musste auf unserer Welt, was sich das Bärchen fest vornahm, denn es war ein ausgesprochen liebes Bärchen, von überdurchschnittlichem Verantwortungsbewusstsein und großer Weisheit, das ganz genau wusste, wie mit kleinen Jungen zu verfahren ist, damit sie nicht Schaden an ihrer verletzlichen Seele nähmen. «Leider, mein Junge, muss ich dir jetzt schon mitteilen, dass dies nicht der letzte ,Schwarze Mann’ in deiner Laufbahn gewesen sein wird», murmelte gedankenvoll der schreibende Sebastian, «und die aus deinen Träumen sind noch von der harmloseren Sorte, da sie dein Erwachen nur kurz überleben.» Noch lange sann der graue Sebastian im Schein seiner Schreibtischlampe darüber nach, ob es wohl richtig gewesen war, den Kleinen gleich so heftig mit einem Schrecken konfrontiert zu haben, entschied dann, dass Gefahr unvermeidlich zum Leben gehöre, der Kleine damit umzugehen frühzeitig lernen müsse, löschte das Licht und balancierte auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, um Klein-Sebastian auf keinen Fall zu wecken, der sich von den Aufregungen des ersten Kapitels seines Lebens erholen musste.“ * Sie sehen, es war damals alles andere als gefahrlos, ein Kind zu sein – lebensgefährlich war es geradezu – und ausnahmsweise weiß ich, wovon ich rede, denn schließlich war ich ja dabei. * Und dann war da mein Vater! Und was für ein Vater – Ecken und Kanten, so viele Sie nur wollen. Und ein Mensch wie aus dem Barock! Und voller Gefühl, das er perfekt zu tarnen wusste. Nur nicht vor Sebastian... * Vor der nächsten Passage, die sogleich hier im Rathaus zu Goslar sozusagen amtlich zur Verlesung gelangen wird, muss ich unbedingt vorausschicken, dass mein Vater der unumstößlichen Überzeugung war, dass ein Mensch ohne ein Auto nicht überlebensfähig sei! Der reinste Affe sei er ohne seinen geliebten fahrbaren Untersatz. Nicht für voll zu nehmen! Und damit der Junge diese Überzeugung beizeiten teile, dafür wurde einiges unternommen seitens des Herrn Erzeugers. * Davon möge Klein-Sebastians Durchbrechen der Schallmauer auf der Vienenburger Landstraße künden: „Das war ein Abenteuer für sich, diese Zerreißprobe für Mensch und Material im 170er Mercedes, dem mit den vorstehenden Kotflügeln und dem Reserverad auf dem Kofferraumdeckel, der es mit einem Motor auf 265000 km gebracht hatte: Otto, der Testpilot, der mitunter eigens in die unwirtliche Eifel fuhr, zum alten Nürburgring, um Legenden zuzusehen wie der Zuchtmeister Alfred Neubauer eine war, der die Mechaniker mit eiserner Hand ,auf Vordermann’ brachte, sie die Farbe von den schwäbischen Boliden kratzen ließ, damit sie ein paar wenige Kilo leichter würden, und Juan Manuel Fangio, der seinen röhrenden, sich in Kurven quer stellenden Silberpfeil in harter Arbeit über die 22 Kilometer lange Nordschleife drosch, durch Südkehre und Hatzenbach, hinauf zur Hohen Acht, durch Karussell und Brünnchen, vorbei am Schwedenkreuz zurück zu Start und Ziel, wo die Boxenwaben das Crescendo der entfesselt rasenden Mechanik in hämmerndes Stakkato zerlegten und wie aus Echokammern gegen die Haupttribüne schmetterten. Eines trüben Nachmittages, als Ottos Geschäfte planmäßig liefen, der Kontrolle weiter nicht bedurften, und er mit sich selbst nichts Rechtes anzufangen wusste, dachte er sich, eine kleine Spritztour könne nicht verkehrt sein, und in Gesellschaft fahre es sich doch allemal angenehmer. Außerdem schien es langsam an der Zeit, das Kind an die hohe Kunst des Autofahrens heranzuführen. «Sebastian, wollen wir mal eine Runde drehen?» – «Au ja, ich komme», schon saßen sie im Wagen. Damals sprangen Autos nicht einfach an, sie mussten noch gestartet werden – und jedes auf eine andere, individuelle Weise; aber alle «mit viel Gefühl», das der Fahrer erst im Laufe des Zusammenlebens entwickeln musste. Der wirklich gute Kraftfahrer – nicht die behandschuhten Herrenfahrer, die es gerade schafften, sonntags bei Sonnenschein ihre Familien zum Kaffeetrinken zu kutschieren, für die einer wie Otto, eben einer, der wusste, dass Autos eigentlich Lebewesen sind, nur Verachtung übrig hatte – ein Kraftfahrer der professionellen Kategorie, der erwies sich immer erst dann, wenn er die Kunst beherrschte, einen Motor auf Anhieb zum Laufen zu bringen, einen Motor, der über Nacht, bei 0° Außentemperatur und 100% Luftfeuchtigkeit, eigentlich beschlossen hatte, nicht anzuspringen – mit daniederliegender Batteriespannung und dicken Wassertropfen, die langsam an den Zündkabeln herunterliefen, bevor sie träge zu Boden fielen, ölige Regenbogen aufs Pflaster malend. Otto war jemand, der in Italiens furchterregenden Kriegsnächten gelernt hatte, dass Autos einfühlsam behandelt werden müssen, will man sich auf sie unter allen Umständen verlassen können. Um sie auf den Brachialakt des Anlassens schonend vorzubereiten, musste man mit solchen Wagen sprechen, auf sie einreden, wobei der Inhalt des Gespräches unwesentlich war, die Intonation machte es: «So, mein Alter, wären wir soweit?» – Die Antwort des 170er, der Sebastian an einen riesigen, tapsigen Hirschkäfer erinnerte, mit großen Scheinwerfern als Augen, konnte Sebastian noch nicht hören, dazu war er noch zu unverständig, sein Vater schon, denn er nickte, drehte den Zündschlüssel im Armaturenbrett und begann mit dem Vorglühen. Nach einigen Sekunden erschien ein dicker, roter Wurm hinter einer kleinen, mit Löchern versehenen Blechscheibe und leuchtete heller und heller. Jetzt war der alles entscheidende Moment gekommen, der nicht verpasst werden durfte: Starterhebel nach unten drücken und festhalten – aber nicht zu lange, sonst wirkt das Schwungrad als Drehbank, was das Anlasserritzel unwiederbringliches Metall kosten würde! Und der Motor kam, der Wagen schüttelte sich und dieselte lautstark eine erste schwarze Auspuffwolke in die Luft. Dass Sebastians Vater: «Maschine läuft», ihm zurief, konnte der aufgeregte Junge nur an seinen Lippen ablesen, die Worte selbst wurden vom Stampfen des Motors zugenagelt. Was für ein Mann sein Vater doch war, der diese unbändigen Kräfte beherrschte, wie er nur wollte! Krächzend bestätigte der 1. Gang, dass er bereit war, das Fahrzeug in Bewegung zu setzen, und sie fuhren davon, vom Hof hinunter, zur Hauptstraße und dann in Richtung Ausfallstraße, auf der sich Otto in Rudolf Caracciola verwandelte, der in seinem gewaltigen Ungetüm von einem Mercedes Sport Cabriolet, mit einer nicht endend wollenden Motorhaube, aus der sich silberne Kompressorschlangen wanden, unglaubliche Rekorde aufstellte. Jetzt lag die freie Strecke vor ihnen, Otto Caracciola brachte sich in Rennposition, nahm das Lenkrad in seinen Schraubstockgriff, legte energisch, keinen Widerspruch duldend, den größten Gang ein und trat das Gaspedal bis unten durch, so dass es fast eine Beule in das Bodenblech drückte. Nun ging es um alles: Rekordfahrt oder Tod – mit weniger würden sie sich nicht zufrieden geben! Der gutmütige Hirschkäfer tat, was er konnte, und zeigte durch sonores Brummen an, dass er auf vollem Schub lief; mit stampfenden Kolben brausten Sebastian und sein Vater an den Alleebäumen vorbei, immer schneller zischten die todesverachtenden Testfahrer in die Landschaft hinein, und Sebastian wurde es plötzlich sonnenklar, dass er, wenn jemals einer, für die Formel 1 geschaffen war. Wie Tazio Nuvolari wollte er werden, ein Gladiator des Maschinenzeitalters, dem man auf dem Nürburgring den Lorbeerkranz umhängen würde. Und fair würde er auch sein, niemals seine unterlegenen Gegner, die ohne Zahl sein würden, schmähen oder verhöhnen, denn er, Sebastian, war ein freundliches Kind, das Menschen gern hatte. Sebastian schielte vorsichtig zu seinem Vater, der alle Hände voll damit zu tun hatte, den leicht schlingernden Wagen, dem diese Geschwindigkeit bedenklich schien, auf der buckligen Straße zu halten. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, aber Otto Caracciola, einer der letzten Kapitäne der Landstraße, ging nicht einen Millimeter vom Gas – schließlich kämpften sie um ihre Ehre! Jeden Stoß, den die Straße dem Lenkrad versetzte, parierte er geschickt und hielt die entfesselte Rennmaschine erbarmungslos auf Rekordkurs. Und sie erreichten alles. Sebastians Vater schrie, mit seiner vibrierenden Nasenspitze auf die flatternde Tachonadel deutend: «Hundert, wir fahren hundert, wir haben es geschafft!» Sebastian kreischte vor Begeisterung: «Karacho, Tempo – mit atzig umde Kurve, mit hundert gegen Baum!» und klatschte in die Hände. Das war so ganz und gar nach seinem Herzen, dass er allein mit seinem Vater solche Husarenstücke vollbrachte. Zurück fuhren sie dann ganz sittsam wie die anderen, geradezu scheinheilig langsam, und kurz bevor sie wieder auf den Hof einbogen, machte Otto seinen Sohn zu seinem Vertrauten: «Aber erzähl’ bloß nicht deiner Mutter, dass wir wie die Verrückten gerast sind. Frauen verstehen so was nicht, das muss unter uns Männern bleiben.» Auf dem Hof, als der rasende Hirschkäfer leise knackend, knisternd und heimlich schnaufend langsam wieder zu Atem kam, ging Otto, von dem niemand außer Sebastian jemals geahnt hätte, dass er in Wirklichkeit Otto Caracciola war, zufrieden um den Wagen herum, tätschelte die heiße Motorhaube und sagte leise zu ihm: «Brav, mein Alter, ganz brav hast du das gemacht.» Sebastian glaubte, seinen noch immer leuchtenden Augen nicht zu trauen, als er sah, wie sein Vater eine große Mohrrübe aus seiner Tasche zog, vor den Kühler hielt, das Auto sich das Gemüse vorsichtig schnappte und zufrieden mit seinen Lamellen schrapend verspeiste – ganz so, wie es ,Lotte’, das Pferd, mit dem Sebastians Vater früher ,über Land’ gefahren war, abends im Stall immer getan hatte. Dies war eines der ganz großen Geheimnisse, die Sebastian mit seinem Vater teilte.“ * Und dann gab es da noch die Verwandtschaft – im Alt-Goslar, dort, wo es so richtig mittelalterlich wird: „Obwohl Sebastians Vater davon nicht viel positiven Aufhebens machte, pflegte er doch gewissenhaft die althergebrachte Tradition, die da gebietet, dass der Familienzusammenhalt durch regelmäßige gegenseitige Besuche zu fördern sei – ob mit oder ohne Begeisterung sei dahingestellt. Es gehörte sich einfach so, denn wenn man sich in der Familie schon nicht vertrüge, wohin sollte es dann mit der Welt kommen? Wie gesagt, ohne viel ,positiven’ Aufhebens davon zu machen, sogar vielmehr – schien er dies doch seiner Rolle als Geschäftsmann und Haushaltungsvorstand schuldig zu sein – unterließ er es nie, deutlich darauf hinzuweisen, dass die Gründe für diese Stippvisiten einzig und allein in seiner Fürsorgepflicht der einzigen Schwester gegenüber zu suchen seien, nicht etwa seinem Drang nach Vergnügungen entsprangen, wofür eine angemessene Dankbarkeit durchaus erwartet werden könne. Sebastians Tante, die den wenig aufregenden Namen ,Erna’ trug, somit für Sebastian Tante Erna war und mit Onkel Erich verheiratet war, wohnte in der Oberstadt, dem ältesten Teil der alten Stadt, in der ursprünglich die Bergleute angesiedelt waren – und als richtig ,alt’ galten in Sebastians Geburtsort Gebäude erst dann, wenn sie mindestens 300 Jahre und mehr auf ihren sie der Erde entgegenbiegenden Witwenbuckeln trugen. Bei Häusern, die mit Müh’ und Not und Ach und Krach das zarte Alter von 100 Jahre erreicht hatten, wartete man vorsichtshalber erst einmal ab, ob sie ihre Bewährungsprobe bestehen würden, bis dahin wurden sie eher ,neumodischem Kram’ zugerechnet, von dem hauptsächlich zu sagen war: ,Das soll auch wieder so was sein...’ Sebastian war der festen Überzeugung, die er aber wohlweislich für sich behielt, dass die Tante, die er ebenso wunderlich wie liebenswert fand, genauso alt wie ihr Haus sein müsste, mindestens, denn offensichtlich kannte sie die ganze Geschichte und alle Geschichten, die sich seit Menschengedenken in ihrer näheren Umgebung zugetragen hatten. Tante Ernas Fachwerkhaus befand sich in einer schmalen, dunklen Gasse, die nur für Fußgänger passierbar war. An einigen der schwarzen, von den Jahren rissig gewordenen Balken des Grundgerüstes, das den Häusern Standfestigkeit verlieh, hatten die Bewohner neben ihren Stubenfenstern kleine Spiegel befestigt, ähnlich Rückspiegeln von Autos, die es ihnen ermöglichten, unauffällig in die Gasse hinabzusehen, ohne den Kopf aus dem Fenster strecken zu müssen und sich auf diese Weise versichern zu können, ob sich dort unten lichtscheues Gesindel herumtrieb – nach wie vor dachte man bei dieser Sorte natürlich hauptsächlich an ‚den Braunschweiger’, dessen Lippenbekenntnisse, sein Interesse an Edelmetallen sei nicht mehr auf das Erzlager der alten Stadt fixiert, mit Vorsicht aufgenommen wurden. «Sebastian, hast du Lust zu einem Besuch im Mittelalter?» ließ sich Otto aus dem Kontor vernehmen, wenn er meinte, die Zeit sei wieder einmal herangerückt, der Schwester seine Aufwartung zu machen, was er stets in Begleitung des Jungen tat, der es ganz aufregend fand, die Tante in dem alten Fachwerkhaus zu beehren. (...) Da Kraftfahrer Otto es als für weit unter seinem Stand ansah, sich in entwürdigender Weise wie ein gemeiner Fußsoldat zu Fuß durch die Gegend zu quälen, musste Sebastian das Garagentor öffnen, der Wagen wurde herausgefahren, und ab ging’s ins ,Nachtjackenviertel’, eine weitere Bemerkung von Sebastians Vater in Richtung: ,Was nimmt man nicht alles für die Mischpoke auf sich, obwohl man doch eigentlich so viel Wichtiges zu Hause zu erledigen hätte?! Man bringt Opfer – für nichts und wieder nichts, und dankt’s einem einer?’ Sie fuhren durch das alte Stadttor, das Breite Tor, dessen massige Türme seit Jahrhunderten unermüdlich über das Wohl der Bürger wachen, die Breite Straße hinauf, die im Mittelalter, als sie nur Fuhrwerke aufzunehmen gehabt, das ihre Maße beschreibende Adjektiv noch zu Recht getragen hatte, dem in Sebastians Jugend sich rapide entfaltenden Autoverkehr jedoch sukzessive wie ein Nadelöhr erscheinen musste. Über das Kopfsteinpflaster, das jederzeit als Stoßdämpfer-Teststrecke hätte verwendet werden können, holperten sie zu dem Parkplatz, von dem sie knapp 100 Meter bis zum Haus gingen. In mancherlei Hinsicht erweckte Tante Ernas Behausung den Eindruck einer Trutzburg aus der Alten Zeit, an der die Jahrhunderte vorübergegangen waren, ohne sie beeindrucken zu können; nur die Zugbrücke fehlte. Das Gebäude hatte wahrscheinlich schon da gestanden, als das Pferd des sich nach langem Ritt kurz verschnaufenden Ritters Ramm oben im alten Gebirge, auf stürmischen Höhen, das Erzlager freigescharrt und den Wohlstand der Stadt einst begründet hatte, wie die Sage erzählt. Nach dem Klingeln tat sich hinter der dunkelroten Haustür zunächst einmal gar nichts; dann hörte man, vorausgesetzt man hatte ein so gutes Gehör wie Sebastian, schlurfende Geräusche, wie sie Filzpantoffeln auf alten Dielen hervorrufen, und mit leisem, vorsichtigem Knarren hob eine Hand den Metalldeckel des Briefeinwurfschlitzes, hinter dem, aus immerwährendem Halbdunkel des Hausflurs, ein Augenpaar argwöhnisch in die Außenwelt spähte, mit der unausgesprochenen, aber eindeutigen Frage: «Wer da? Gut Freund?» Der Geist der Vergangenheit wehte aus dem schießschartenartigen Spalt – unvermeidlich vermischt mit dem Geruch von Bohnerwachs, ATA-Scheuerpulver, Zwiebeln und Kohl. Sebastians Vater, der nichts lieber tat, als seiner Schwester einen Schrecken einzujagen, rief: «Aufmachen, Gerichtsvollzieher: amtliche Pfändung!» Die Klappe wurde blitzschnell zugeschlagen, und das Haus stellte sich mitsamt seinen Bewohnern tot wie eine Schildkröte, die alle Extremitäten in Sicherheit gebracht hatte, was sich allerdings sofort änderte, als Sebastian zu krähen begann: «Stimmt gar nicht, Tante Erna, wir sind’s!» Dies war das ,Sesam, öffne dich!’, denn Sebastian war ein gern gesehener Gast im ‚Mittelalter’, da er etwas Abwechslung in die Gleichförmigkeit des Lebens der Familie seiner Tante brachte. Solange sich Sebastian erinnern konnte, war sein Onkel Erich krank gewesen, denn er war, in Sebastians früher Kindheit, von einem Gehirnschlag heimgesucht worden, der ihn mental in die Infantilität zurückgeworfen hatte, was zu einer Vielzahl von kuriosen Situationen führte, denn der Tante wollte die Einsicht in die Art und Folgen der Beeinträchtigungen nicht so recht gelingen. (...) Lange betrachtete der graue Sebastian das patinatragende Hochzeitsphoto von Onkel und Tante: ,Welche Träume und Erwartungen sie wohl an diesem Tag hatten? Und warum sie einander geheiratet hatten? Eine Liebeshochzeit? Eine Vernunftehe? Was immer das sein mag.‘ Das Bild zeigte die beiden, wie sie der Photograph in Positur gesetzt und ,abgenommen’ hatte: Onkel Erich, der Lokomotivführer bei der Reichsbahn, mit militärischer Kurzfrisur, Tante Erna mit dem obligatorischen Brautschleier; unergründlich ihr Gesichtsausdruck, zu gestellt, um Menschen zu zeigen, beide so, als hätten sie Ladestöcke verschluckt. Sebastians Vater hatte ihm einiges von seinem Schwager Erich erzählt, der ein geradezu fanatischer Eisenbahner gewesen war und für sein Leben gern Bier getrunken hatte, wohlgemerkt in Maßen, wie alles in seinem überschaubaren, korrekten Leben. Der Graue neigte nicht mehr der Auffassung zu, dass diese Hochzeit aus Leidenschaft entstanden war, denn der ist jedes Maß zuwider. In den 30er-Jahren war irgendwann einmal der Entschluss gefasst worden, dass Bier per LKW zu transportieren sei, woraufhin Onkel Erich demonstrativ Mineralwasser zu trinken begonnen hatte. Er, der Lokomotivführer Erich F. war nicht bereit, diese skandalöse Beleidigung der Reichsbahnen ungesühnt hinzunehmen, sondern er würde die Brauherren in die Knie zwingen, so lange abstinent bleiben, bis die dickbäuchigen Bierfässer wieder auf seinen Zug gerollt würden! «Erich, da werden die aber ganz schön zusammenzucken», höhnte Otto, der so etwas einfach nicht lassen konnte, was Schwager Erich weder anfocht noch in seinem Boykottentschluss wankelmütig werden ließ, denn schließlich war er ein Mann von Prinzipien! Im Krieg war er bis auf die Krim gekommen und hatte von Ferne, im Führerstand seiner Lokomotive, das unheimliche Donnergrollen gehört, als die Wehrmacht Sewastopol mit gigantischen Eisenbahngeschützen sturmreif zu schießen versucht hatte, allerdings war ihm dann in seinem armen Geist alles durcheinander geraten, und einmal erzählte er Sebastian, wie er mit dem Führer und der ,Dicken Berta’ zusammen Braunschweig mit Bierfässern beschossen hätte. Sebastian konnte sich lebhaft vorstellen, wie es in der Welfenstadt Fassdauben, Eisenringe und Bierschaum gehagelt und geschäumt hatte – Freibier für alle mit Verpackung! Nur wunderte er sich etwas, warum Onkel Erich damals mit der ,Dicken Berta’ zusammengewesen war, wo er doch eigentlich mit der ,Dicken Erna’ verheiratet war. Es musste vermieden werden, dass Tante Erna jemals Lunte roch. Aber das verstand er sowieso alles nicht so richtig mit Ehe und Liebe und Kinderkriegen und dem ganzen Zeug, das er nur ab und zu mal aufschnappte, wenn sich die Erwachsenen unterhielten. Er würde das schon später irgendwie rauskriegen, im Moment war es ja viel aufregender, im alten Fachwerkhaus auf Entdeckungsreise zu gehen. «Otto, was soll denn immer dieser Quatsch?» Tante Erna öffnete die Tür, und an ihr vorbei lief Sebastian in den Flur. Im Erdgeschoß befanden sich die Küche und die ,Gute Stube’ sowie eine steile Holztreppe, die nach oben zu den Schlafzimmern führte. Da es sich selbst bei der nächsten Verwandtschaft ,nicht gehörte’, anderer Leute Schlafzimmer zu betreten, es sei denn, jemand lag auf dem Totenbett, wusste Sebastian nicht, wie diese Räume aussahen. (...) «Wenn du einen schönen Schmorbraten haben willst, musst du bei Paul K. kaufen, Schorse M. kann nur guten Aufschnitt machen», sprach Otto in der Küche zu seiner Schwester, die sich nicht schlüssig gewesen war, wo sie den nächsten Sonntagsbraten erstehen sollte. Otto saß an einem einfachen Holztisch in der Ecke des kleinen Raumes mit Blick auf den gegenüberliegenden Schuppen, in dem sich der ungeheizte ,Abtritt’ befand und an dessen Wand die teilweise abgeplatzte Schrift eines bunten Email-Schildes im Befehlston darauf hinwies, dass ausschließlich ,Treue-Briketts’ zu verwenden seien, wenn man Wert darauf legte, wirklich den gewünschten Heizerfolg zu erzielen. Ottos Gesicht war gerötet und bestätigte überzeugend diesen Werbespruch. Er fuhr seine Schwester an: «Wie du diesen Schwulm hier drin aushältst, Erna! Man kriegt ja regelrecht Beklemmungen in deiner Bude!», was nicht übertrieben war, denn in Ernas Küche herrschten in der eigentlich ,kälteren’ genannten Jahreszeit Temperaturen von annähernd dreißig Grad Celcius. Tante Erna, die recht korpulent war – andere Matronen dieses Formats bezeichnete Otto wenig respektvoll als ,Ballonsche’ – und deshalb übermäßigen Bewegungen abhold, hielt solche Temperaturen für angemessen und Wallungen rief die Hitze bei ihr nicht hervor. Das normale Leben spielte sich bei Sebastians Tante ganz überwiegend in der Küche, direkt neben dem Eisenherd ab. Die ,Gute Stube’, mit einem schwarzen Vertiko und einem dunklen Chaiselongue – eigentlich ein Sofa, aber ‚Chaiselongue’ zu sagen galt als gebildeter –, an der Wand ein Früchtestillleben, wurde ausschließlich an hohen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten benutzt. Die Küche, der Ort der Frauen und Mütter: warm, kuschelig und sicher wie ihr Schoß, aus dem alles Kreatürliche stammt, der Gegenpol zum Unberechenbaren draußen. Die Bewahrerin des Feuers und des Lebens, das war seine Tante Erna für Sebastian, das fühlte der Instinkt des Jungen ganz stark und dem folgte er gern und ohne zu fragen. (...) Tante Erna hatte im Überfluss von dem, was vortrefflich mit ,Intelligenz des Herzens’ zu beschreiben wäre; sie ruhte in sich und ihrer Welt, an ihrem Herd in ihrer Küche, kannte noch alle Volksweisheiten und lebte nach ihnen. Großen Respekt und tiefe Ehrfurcht hatte sie vor den Urgewalten der Natur, und wenn nachts ein Gewitter aufzog, der ,liebe Gott’ seinen Unmut über das sinn- und sittenlose Treiben zu seinen himmlischen Füßen mit Blitzstrahl und Donnerschlag unüberhörbar kundtat, dann stand Erna sofort auf: ,Den Beter lass beten, den Schläfer weck auf, den Fresser schlag tot’, jagte mit lautem Gezeter den Rest der Familie aus den Federn, schnappte sich ihre blecherne ,Gewitterkiste’, in der alle wichtigen Familiendokumente und Versicherungspolicen akkurat untergebracht waren, und die ganze Familie musste einträchtig auf der Treppe sitzend warten, bis der ,HERR’ sein elektromagnetisches Strafgericht abzuschließen geruhen würde. Onkel Erich, der eigentlich lieber im Bett geblieben wäre, glaubte dann manchmal, es wäre wieder Krieg, ,der Führer’ brauche ihn, und fragte regelmäßig, ob seine Lokomotive denn auch schon aufgeheizt worden sei, ob sie genug Dampf habe, damit er mit ihr bis nach Russland fahren könne. «Sie brauchen viel Granaten für die Artillerie. Hört ihr, die Front ist nicht mehr weit weg. Das Jaulen, das sind die Stalinorgeln, jetzt werden sie gleich mit der Infanterie angreifen.» «Der Krieg ist vorbei, Erich, und der Führer muss ohne dich zurechtkommen. Sei jetzt still.» Und ängstlich schmiegten sie sich auf den rissigen, stets frisch gebohnerten Stufen der alten Holztreppe aneinander und hofften, dass ihr kleines Fachwerkhaus, der einzige sichere Ort in der Welt, den sie hatten, von Blitzschlag und Feuersbrunst verschont bleiben möge – denn sie begingen nur sehr kleine Sünden, wie ab und zu mal heimlich ein Schnäpsen zu zwitschern, und das würde der Herrgott ihnen sicher nachsehen.“ * Sie sehen also, das waren auf ihre Weise gottesfürchtige, anständige Menschen, die versucht haben, aufrecht und untadelig durchs Leben zu kommen. Sozusagen „unspektakulär“. * „Die alte Stadt war eine sehr geeignete Stadt, um darin erwachsen zu werden, und die Berge mit ihren dunklen, von Harzgeruch durchwehten Wäldern, in denen man im Herbst so wunderbar Pilze sammeln konnte, auf federnden Nadelböden, sich zwischendurch zum Ausruhen auf Moospolster bettend, um den emsig-unermüdlichen Käfern zuzusehen, wie sie unter äußerster Kraftanstrengung riesige Lasten durch das Kraut zerrten, während das Summen und Brummen der flugtauglichen Insektenwelt in allen möglichen Tonarten die klare Luft vibrieren ließ, diese Berge bildeten einen perfekten Kontrast zu dem sanft wogenden, helleren Vorgebirgsland, mit seinen inmitten der vielen Zuckerrübenfelder verstreut liegenden Fachwerkgehöften. Mit hinaus in die unruhige Welt nahm Sebastian diese friedliche Seele Niedersachsens, und sie nährte ihn immer dann, wenn die Kälte der Fremdheit und die Leere der Vereinsamung von ihm Besitz ergreifen wollte. Und klein würde er später alles finden, wenn er zurückkommen würde aus der anderen Welt, die er mit seiner Heimat tauschen würde, und irgendwann einmal, nach vielen, vielen Jahren, würde ihn die Erkenntnis anrühren, dass ,Heimat‘ dort gewesen sein könnte, falls für ihn überhaupt so etwas existieren und eine Bedeutung haben sollte, wo die Menschen genauso sprechen wie er selbst einst sprach – und alles verstand. Denn wo sonst weiß jemand, was ‚klapörtchen‘ heißt, wenn nicht da, wo Sebastian einmal zu Hause war? Und dass man dort ‚nachem Dokter und nicht etwa ‚zum Arzt‘ geht? Außerdem werden die Leute in der alten Stadt niemals ‚betrunken‘, gleichgültig, wie viele Halbe sie trinken – höchstens ‚dicke‘. ‚Einkaufen‘ geht auch niemand, sondern ‚Einholen‘. «Was ist denn Heimat für dich?» fragte der Graue, der plötzlich sehr aufmerksam geworden war, als Sebastian so zu schwärmen und zu träumen begann. Eine höchst schwierige Frage, kaum zu beantworten. «Wo ich keine Angst zu haben brauche und auch kein Heimweh kriege», stotterte der Kleine, der angesichts der ernsten Miene, die der Ältere aufgesetzt hatte, ganz und gar nicht davon überzeugt war, dass eine so simple Antwort überhaupt akzeptabel sein könnte. ‚Eine ans Dialektische grenzende Antwort: In der Heimat hat er kein Heimweh; was noch lange nichts darüber sagt, wo er Heimat fühlt; er scheint nur zu spüren, wo er sie nicht hat – und wie steht’s denn mit mir in dieser Beziehung? Wo ist denn überhaupt meine Heimat? In der alten Stadt, die mir fremd geworden ist? Obwohl ich einmal wusste, wann die Menschen hier fröhlich sind, wann sie lachen, was sie traurig macht, und wann sie weinen.‘ ‚Wie sie ihre Feste feiern, wie sie ihre Toten beerdigen und ihrer gedenken, wann man laut sprechen kann, und wann man besser still ist. All das fühle ich nicht mehr, obwohl ich es noch weiß.‘ ‚Im Herzberger Teich, am alten Bergwerk, habe ich das letzte Mal vor über dreißig Jahren gebadet, als Connie Francis «Die Liebe ist ein seltsames Spiel» von einer 45er Platte sang, und ich dabei fühlte, dass noch viel aufregend Unbekanntes auf mich wartete, als die Mädchen in ihren damals sehr gewagten Bikinis ihre Wirkung ausprobierten. Und was wartet jetzt noch auf mich? Jetzt, da mir die Menschen immer durchsichtiger werden? Wo sind die verlockenden Blüten der Illusion geblieben?‘ ‚Ich laufe stundenlang durch die alten Straßen und kenne niemanden mehr; die Häuser und die steinalten wohlgenährten Türme, sie wissen nicht mehr, wer ich bin, und sprechen nicht mehr zu mir; ich treffe kein zerbrechlich wirkendes blondes Mädchen, das mir verschmitzt-schüchtern zulächeln würde; ich fühle keine rastlose Sehnsucht wie einst – und wie der Jasmin in diesem Jahr geduftet hat, kann ich nicht sagen‘, rätselte der Graue, dessen Schweigen und Nachdenklichkeit den Kleinen zutiefst beunruhigten. «Hab’ ich was Falsches gesagt?» wandte er sich zaghaft an den Alten und zippelte an dessen Hosenbein. «Nein, nein, das ist schon alles in Ordnung, mein Lieber», lächelte der Graue, strich dem Kind zärtlich über den Kopf, sah ihm in die Augen und sagte: «Es ist schade, dass jeder von uns etwas hat, das der andere sehr gut gebrauchen könnte, aber unmöglich bekommen kann. In der Tat überaus schade.» ‚Er scheint langsam etwas wunderlich zu werden‘, dachte Klein-Sebastian und lief schnell in den Garten, um den Schmetterlingen zuzusehen, wie sie um die wehrhaften Brennnesseln und den wohlwollend im Wind nickenden Sauerampfer herumschwirrten.“ * Und manchmal, weit weg von meiner Heimatstadt, in warmen Sommernächten, da komme ich zurück in mein altes Goslar, am liebsten mit Rainer Maria Rilke: „Ich möchte sein wie die, die durch die Nacht mit wilden Pferden fahren“ – und denke dann ganz still bei mir: „Ob wohl draußen vor der alten Stadt, auf dem Osterfeld, immer noch ab und zu Zigeuner lagern, und ob dort ein kleiner Junge verstohlen zusieht, wie ein Mädchen im Feuerschein tanzt?“ ***