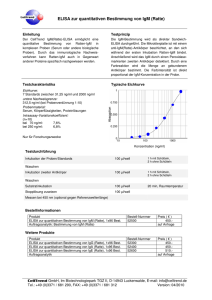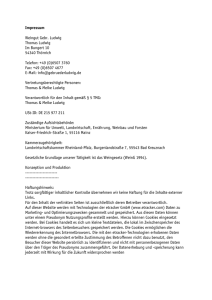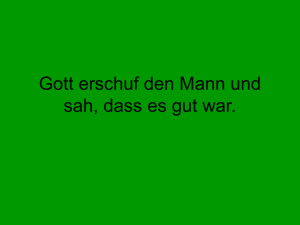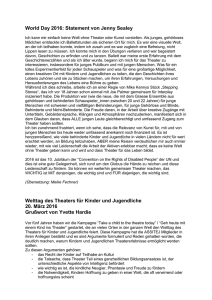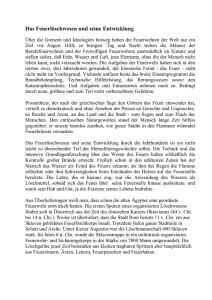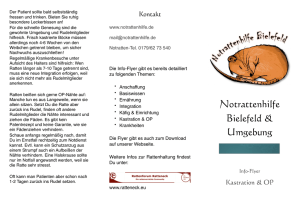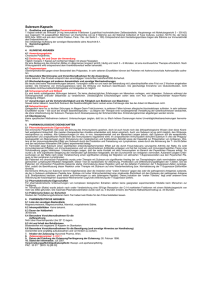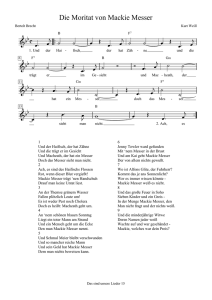Mike Winter Mitleid mit einem Mörder -1
Werbung

Mike Winter Mitleid mit einem Mörder -1Als Markus Bode an jenem Freitag Nachmittag mit der übrigen Belegschaft der Zimmerei Schacht die Esmeralda, einen Ausflugsdampfer der Weser Schifffahrtsgesellschaft, bestieg, ahnte er nicht, dass dies der letzte Tag in seinem noch so jungen Leben sein würde. Es war der alljährliche Betriebsausflug, den der Gründer und Inhaber der Firma, Friedel Schacht, zu einer lieben Tradition hatte werden lassen. Die achtzehnköpfige Gesellschaft hatte an diesem Tage früher Feierabend gemacht und war auf Firmenkosten Essen gegangen. Als besondere Überraschung hatte sich der Firmenchef in diesem Jahr eine Dampferfahrt nach Wilhelmshaven einfallen lassen. Eigens zu diesem Zweck hatte er in Absprache mit dem Kapitän eine Musikband augagiert. Sie sollte in Wilhelmshaven zusteigen und auf der Rückfahrt für Stimmung sorgen. Markus Bode hätte sich am liebsten vor der ganzen, in seinen Augen ätzenden Veranstaltung gedrückt, aber das war aus den genannten Gründen nicht möglich. Also machte er wohl oder übel eine mehr oder weniger gute Miene zum nervigen Spiel. Er hoffte nur, dass ihn keiner seiner Kumpel dabei sah. Es wäre ihm ziemlich peinlich gewesen. Wenigstens hatte er unter den anderen Fahrgästen einen hübschen Käfer gesehen, den er nach allen Regeln der Kunst anbaggerte. Leider verließ die junge Dame das Schiff in Wilhelmshaven. Andere Fahrgäste stiegen zu. Unter ihnen auch ein Südosteuropäer. Kümmels, wie er und seine Freunde sie abwertend nannten. Er sah angewidert zu ihnen hinüber und dachte an den Spaß, den sich seine Kameraden und er bei einer solchen Gelegenheit nicht entgehen lassen würden. Ein hämisches Grinsen verzerrte sein Gesicht zu einer fiesen Fratze. Er zog es vor den Platz zu wechseln. Vielleicht war es ja auch gut, sich mal bei den Kollegen sehen zu lassen? Sicher würden sie ihn schon vermissen. Das Boot hatte kaum abgelegt, als vom Vorderdeck auch schon laute Musik erklang. Die Band spielte ihre Eröffnungsnummer und die ersten Pärchen stürmten bereits auf die Tanzfläche. Ausgerechnet die Evergreens der achtziger Jahre, dass gleiche unerträgliche Gedudel, dass er sich jahrelang zu Hause anhören musste, wurde zum besten gegeben. Keine Minute länger wollte er sich dieser Körperverletzung aussetzen. Am Heck des Schiffes steckte er sich aus lauter Frust schließlich einen Joint an und zog tief durch. Seine Sinne benebelten sich und irgendwann wurde dieser Ausflug auch für ihn erträglicher. Nach einer Weile veranlasste ihn das schwankende Schiff und der getrübte Gleichgewichtssinn die Toilette aufzusuchen, um sich zu übergeben. Natürlich war ihm auch nicht bewusst, wie genau der Mann, den er zuvor so verächtlich angesehen hatte, ihn während der letzten Minuten nicht mehr aus den Augen ließ. Der Mann folgte ihm unauffällig. Immer wieder sah er sich nach allen Seiten kontrollierend um. Mit der Linken zog er Handschuhe aus der Tasche und streifte sie sich über. Mit der Rechten umklammerte er den Griff eines Messers. Die Gelegenheit war günstig. Niemand war gerade unter Deck. Nicht mal an den Toiletten, wo noch einige Minuten zuvor reges Gedränge herrschte, war nun noch Betrieb. Mit viel Geduld hatte der Unbekannte auf diesen Moment gewartet. Nun war er da! Der ziemlich zugedröhnte Lehrling hatte nicht einmal die Tür zum Klo verriegelt. Er stand nach vorn gebeugt über der Porzellanschüssel und spie. Der Mann mit der dunkleren Hautfarbe verlor keine Zeit, er nutzte die Situation und stieß seinem Opfer ein Messer in den Rücken. Dabei achtete er darauf, dass er den Dolch genau unterhalb des linken Schulterblattes eindringen lies. Er rammte es seinem Opfer gezielt zwischen den Rippen hindurch, bis in das Herz hinein. Dann zog er es wieder heraus und sah teilnahmslos zu, wie der Lehrling über der Kloschüssel zusammenbrach. Der Todeskampf seines Opfers dauerte nur einige Sekunden. Das aus der Wunde pulsierend sickernde Blut verfärbte das gelbe T-Shirt und bildete einen tiefroten Fleck. Doch das makabere Treiben war noch nicht am Ende. Der Mörder benetzte den Zeigefinger seines Handschuhs mit dem Blut seines Opfers und schrieb damit einige Buchstaben an die Trennwand. Dann erhob er sich und wischte in seliger Ruhe das Blut von der Klinge, warf das Papier zu Boden, steckte das Messer in die Scheide und zog die Tür hinter sich zu. Fast gleichzeitig kippte die Leiche seitlich neben das Becken und lag nun von der Trennwand zum zweiten Klo gestützt, merkwürdig verschränkt auf der rechten Körperseite. Der unbekannte Mörder wusch sich die blutverschmierten Gummihandschuhe sorgfältig ab. So als wolle er sie noch ein weiteres mal benutzen. Nachdem er sie mit Hilfe einigen Papiertüchern getrocknet hatte, zog er sie ab und steckte sie in eine der Taschen seines Jacketts. Von niemanden bemerkt verließ er die Toiletten wieder. Sein Gesicht war von Anspannung gezeichnet. Als er sich über Deck auf eine der Bänke setzte, glänzte seine schweißnasse Stirn in der Sonne. Er tupfte sie mit einem Taschentuch trocken. Seine Augen vergruben sich in ihren Höhlen, als wollten sie niemandem einen Einblick gewähren, als hätten sie Angst, dass jemand in ihnen sehen könnten, was sie selber gerade mit ansehen mussten. Es waren Leid geprüfte Augen, die schon viel erlebt hatten, aber sie waren auch voller Hass und Unerbittlichkeit. Der Mann, zu dem sie gehörten, schien äußerlich die Ruhe selbst, doch in seinem Innersten tobte ein Vulkan. Endlich kam der Anleger in Sichtweite. Die Geschwindigkeit des Schiffes verringerte sich. Zwei kräftige Männer sprangen an Land und zogen den Dampfer mit den Tauen, die sie um die Poller legten, so nah an den Kai heran, dass sich die Gummireifen, die außenbords hingen, dicht an die Kaimauer pressten. Anschließend wurde fest vertäut. Nun öffnete ein Mann das Schanzkleid und schob die Gangway an Land. Einige, ganz Eilige, drängten sich, um von Bord zu kommen. Die Musik, die während der Fahrt vom Sonnendeck aus nach hinten strömte, war verklungen. Die Band hatte ihre Instrumente bereits wieder eingepackt und die Belegschaft der Firma Schacht schwankte gut gelaunt, singend und tanzend durch den Niedergang. Keiner von ihnen vermisste Markus Bode. Der Unbekannte hatte inzwischen das Schiff verlassen und war ruhigen Schrittes in einer der angrenzenden Straßen verschwunden. Nachdem auch der letzte Fahrgast die Esmeralda verlassen hatte, inspizierte die Besatzung jeden Winkel des Ausflugsdampfers. Es war schon vorgekommen, dass der eine oder andere, der sich beim Umgang mit Alkohol ein wenig verschätzt hatte, die Ankunft verschlief. Natürlich wurde auch nach jeder Fahrt die Toilettenanlage gereinigt. Darauf legte Kapitän Paulsen besonders großen Wert. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Mordopfer gefunden wurde. Die neuen Fahrgäste sammelten sich bereits wieder auf der Mole, als ein fürchterlicher Schrei durch das Schiff gellte. Kapitän Paulsen vernahm in auf der Brücke. Er wusste sofort, dass etwas schreckliches geschehen sein musste. Als er den Sanitärbereich erreichte, fand er seine Tochter, zu einer Säule erstarrt, vor einer der offenen Klotüren vor. Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben. Mit der ausgestreckten Hand deutete sie auf etwas, was hinter der dünnen Sperrholzwand auf dem gefliesten Fußboden liegen musste. Paulsen hatte in den über dreißig Jahren, die er zur See fuhr, schon so manches gesehen. Eigentlich glaubte er, dass es nichts gab, was ihn noch erschüttern konnte, doch das Bild, des da vor ihm in einer Blutlache liegenden Jungen, verschlug selbst dem alten Haudegen die Stimme. Zunächst schaffte er seine völlig verstörte Tochter auf den Gang vor die Herrentoilette. Dort traf er auf seinen Sohn Sven. Bevor er wieder in der Toilette verschwand, trug er ihm auf Polizei und Rettungswagen zu alarmieren. Vorsichtig beugte er sich zu dem Jungen, griff ihn an den Hals und fühlte den Puls. So weit er es beurteilen konnte, war der arme Kerl tot. Aus einer Wunde auf dem Rücken des Rothaarigen sickerte Blut und ergoss sich in einer Lache, die inzwischen schon einen feinen Fluss zum Ablauf, in der Mitte des Raumes, bildete. -11In der Straßenbahn der Linie 6 herrschte dichtes Gedränge. Feierabendverkehr! Das Abteil war von einer schweißtreibenden Schwüle erfüllt. Die Luft stickig, nur noch mit einem geringen Anteil von Sauerstoff. Froh war, wer einen Sitzplatz ergattert hatte. Die meisten Fahrgäste mussten jedoch stehen. Aber das war ja nichts besonderes. Sie fuhren jeden Tag nach der Arbeit auf diese Weise nach Hause. Nur an diesem Nachmittag war es eben noch unerträglicher als sonst. Unter all diesen Menschen war einer, der dieses Abteil nicht mehr lebend verlassen sollte. Unauffällig und scheinbar ohne jeden Grund hatte sich der Mörder bereits durch die schwankende Menschenmenge hindurch, bis in den Rücken seines Opfers geschlichen. Noch machte der junge Mann mit den kurzgeschorenen Haaren und den markanten Wangenknochen keine Anstalten die Bahn zu verlassen. Der Zug rumpelte mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen der Stadt. Zu dieser Tageszeit war es immer noch die schnellste Art durch die City nach Hause zu gelangen. Und Ralf Schröder musste durch die Innenstadt, um in sein Apartment zu gelangen. Nur schemenhaft konnte er durch die beschlagenen Scheiben hindurch eine der vielen Baustellen sehen, an der die Bahn gerade vorbeihuschte. Der blonde junge Mann war hoch aufgewachsen, schlank und von kräftiger Statur und doch sollte ihm das nichts nutzen. Er würde keine Chance haben seinem Schicksal zu entgehen. Jedes mal, wenn die Bahn an eine der Haltestellen stoppte, drängten die Massen zur Tür, um ja mit hinauszugelangen. Heilfroh, die Strapazen der Fahrt gut überstanden zu haben, stürzten sie sich in das Getümmel an den Haltestationen. Wer noch weiterfahren musste, hielt sich an den Stangen, um nicht mit hinausgeschoben zu werden. An der nächsten Station war es soweit. Ralf Schröder hatte sein vorläufiges Ziel erreicht. Er musste in die Linie 4 umsteigen. Noch während der Fahrt schob er sich nach vorn, um als einer der Ersten diesen Brutkasten zu verlassen. Der Mann mit der etwa fünfzehn Zentimeter langen Klinge folgte ihm Schritt um Schritt. Ganz kurz, nur für einen Augenblick, sahen sich die beiden Männer in die Augen. Hatte Ralf den Mann hinter ihm nicht schon einmal gesehen? Er dachte darüber nach, woher er das Gesicht kannte. Doch als die Bahn in den Hauptbahnhof einrollte, verwarf er den Gedanken. Somit hatte er seine letzte Chance vertan. Die Bremsen quietschten und brachten das Ungetüm aus Glas und Stahl zum Stillstand. Die Hand des Mörders fuhr in die Herrentasche aus schwarzem Leder. Sie umklammerte den Griff des todbringenden Messers. Er zog es behutsam aus der Scheide, die in der Tasche verblieb und deckte es gegen die Blicke der anderen Fahrgäste geschickt mit seinem Körper ab. Jeden Moment würde es soweit sein! Jeden Moment würden sich die Türen erneut öffnen und eine weitere Masse aus Menschen würde sich aus der Tür drängen. Das war der Augenblick, auf den der Mörder geduldig wartete. Nicht eine Sekunde zu früh oder zu spät durfte er zustechen. Sie standen jetzt etwa noch einen Meter von der Tür entfernt. Hinter ihnen standen ebenso viele Menschen, die hinauswollten, wie vor ihnen. Alles war bestens, nur noch Sekunden, bis dass die Straßenbahn in der entgültigen Halteposition stand. Dann war es soweit. Die Türen öffneten sich. Die Menschen drängten sich durch den schmalen Ausgang, um endlich an die frische Luft zu gelangen. Genau in diesem Moment stach der Mörder zu. Rammte seinem Opfer das Messer durch den Rücken bis in das Herz hinein. Das laute Stöhnen des jungen Mannes ging im Lärm der Masse unter. Mit der behandschuhten Linken zog der Mörder das Messer heraus, mit der Rechten steckte er seinem Opfer einen Zettel zu und hielt den einknickenden Körper aufrecht. Unbemerkt verstaute er das Messer wieder in seiner Ledertasche. Dann schob er sich an dem Sterbenden vorbei, zusammen mit den von hinten Nachschiebenden ins Freie. Ralf Schröder sackte ein, klappte wie ein Taschenmesser zusammen und ging schließlich mitten im Gewühl zu Boden. Die Frau hinter ihm hatte noch versucht ihn aufzufangen, musste jedoch mit ansehen, wie der junge Mann stürzte und lang hinschlug. Einen Moment lang glaubte sie einen Betrunkenen vor sich liegen zu sehen, aber dann sah sie auf ihre Hände und begann zu schreien. Als ihr schriller Hilferuf durch den Bahnhof gellte, drehte sich der Mann mit dem Messer noch einmal um. Zwischen ihm und der allmählich begreifenden Menschentraube waren noch nicht mehr als fünf Meter. Noch kein ausreichender Abstand, um unentdeckt davonzukommen. Und trotz der enormen Anspannung die er in sich spürte, fühlte er Genugtuung, aber auch Scham, Angesichts des furchtbaren Verbrechens, das er soeben begangen hatte. Ralf Schröder lag röchelnd auf dem Boden des Abteils, seine Beine baumelten aus der Tür. Immer mehr Menschen riefen um Hilfe. Ein Mann versuchte das Opfer in eine stabile Seitenlage zu bringen. Die Frau mit den blutigen Händen brachte nach ihrem markerschütternden Schrei keinen Laut mehr heraus. Noch wusste keiner der um den Verletzten herum stehenden Fahrgäste, was mit dem jungen Mann geschehen war. Erst jetzt, da ihn der Mann herumdrehte, sahen die, die ihm am nächsten standen, dass er einen Einstich im Rücken hatte. Der Killer nutzte die anhaltende Verwirrung und verschwand mit den Leuten, die aus den anderen Abteilen strömten. Als er die Station verlassen hatte, und er sein Gesicht nach Mekka wandte, tupfte er sich dankbar und erleichtert den Schweiß, der zum Großteil Angstschweiß war, von der Stirn. Der zweite Teil seines Rachefeldzugs war erfolgreich abgeschlossen. -21„Kameraden! Einige von euch haben sicher schon davon gehört: In der vergangenen Woche hat es zwei von unseren Leuten erwischt. Sie wurden feige und heimtückisch hinterrücks erstochen!“ Ein Raunen ging durch den Saal. Der Führer der nationalen Kampfgruppe zur Rettung des Vaterlandes erhob sich. Die anderen Männer folgten seinem Beispiel. „Wir werden unsere Kameraden Markus Bode und Ralf Schröder als Kämpfer gegen die dekadente Gesellschaft in Erinnerung behalten. Wir werden diese bestialischen Meuchelmorde nicht ungesühnt lassen! Wer immer das getan hat - er wird sterben!“, schrie er. „Er wird langsam krepieren - wie ein Stück Vieh, das man zum Ausbluten an den Haken hängt!“ Wir werden die Mörder unserer Kameraden suchen und vernichten!“ Dann hob er seinen ausgestreckten rechten Arm und grölte, genau wie alle anderen im Saal: „Heil Hitler!“ Die etwa vierzig Männer, meist gerade erst dem Kindesalter entwachsen, standen in Reih und Glied hinter den Tischen und hielten einige Zeit inne. Eine Schweigeminute, die am ehesten widerspiegelte, was jeder Einzelne von ihnen in diesem Moment empfand. Trauer, Wut aber auch Entsetzen spiegelte sich in ihren Augen wieder. Zwei der ihren waren ermordet worden. Keiner von ihnen wusste, aus welchem Grund. Aber alle bedrückte derselbe Gedanke. Würde noch ein Kamerad sein Leben lassen? Wenn ja, warum, und wer von ihnen würde der nächste sein? Doch niemand von ihnen wagte es diese Fragen zu stellen. Denn Angst war in diesem Kreise von Gleichgesinnten verpönt. Angst war die Geißel der Schwachen, doch sie waren stark, sie waren die Elite, die das Vaterland in eine bessere Zukunft führen sollte. Das hatte man den achtzehn bis fünfundzwanzigjährigen Kameraden zumindest eingeimpft. Und sie glaubten an das, was ihnen der Führer ihrer Kampfgruppe vorlebte. Immerhin hatte er bereits einige Erfolge vorzuweisen. Er stand in Verbindung mit anderen Kampfgruppen die größer waren. Dessen Mitglieder sich bereits erfolgreich an nationalen Befreiungsaktionen beteiligt hatten. Ihre Gruppe befand sich noch im Aufbau. Doch nun stand auch ihnen eine erste Bewährungsprobe bevor. Eine Probe, die sie mit den erworbenen Schießkünsten und ihrer Nahkampfausbildung allein nicht bestehen konnten. „Bisher liegt uns leider noch kein Hinweis oder ein Verdacht vor, weshalb die Kameraden ermordet wurden. Aber seid versichert, wir werden nicht eher ruhen, bis die feigen Hunde, die es gewagt haben ihre schmierigen Hände gegen die arische Rasse zu erheben, dafür gebüßt haben! Bis dahin seid gewarnt und haltet die Augen offen.“ Die ausnahmslos in schwarzen Hosen und weißem Hemd gekleideten Männer trommelten mit den zu Fäusten geballten Handrücken auf die Tische und spendeten dem Redner Beifall. „Und nun Kameraden wollen wir auf den Geburtstag unseres Kameraden Daniel Specht anstoßen.“ Wieder erhoben sich die Männer und brachten, auf den edlen Spender, lautstark einen Trinkspruch aus. Doch dem schlanken Zwanzigjährigen mit dem strohblonden Haaren, der nur drei Querstraßen weiter bei seiner Schwester wohnte, war nicht so recht zum feiern zumute. Er war von seinen Gedanken hin und hergerissen. Hatte sein Freund, Gerd Gruber, wirklich Recht und der Tod ihrer Kameraden war nur ein fataler Zufall? Seit Daniel von dem zweiten Mord in der Zeitung gelesen hatte, ließen ihn die Gedanken an jene Nacht nicht mehr los. Sie hatten ihn ohnehin ein halbes Jahr lang Nacht für Nacht in seinen Träumen verfolgt, hatten ihn nicht zur Ruhe kommen lassen. Doch nun, da der Tod auch an seine Tür klopfte, brachte er die Geschehnisse unausweichlich in Verbindung. Der junge Mann mit den betrübten blauen Augen, die einst soviel Begeisterung ausstrahlten, hatte noch am Morgen seinen Freund Gruber angerufen und ihm seine Befürchtungen mitgeteilt. Doch der Kamerad hatte ihn nur ausgelacht und ihm gedroht, ja den Mund zu halten, da sie sonst beide für Jahre hinter Gitter kämen. Dann hatte er wegen einer einzigen Dummheit sein ganzes Leben verpfuscht. Das durfte er seiner Schwester, die am Sterbebett ihres Vaters geschworen hatte, sich um ihn zu kümmern, nicht antun. Also schwieg er, von Zweifeln zerrissen und soff, um seinen Kummer zu ertränken. -33Die blanke Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Die Hände zitterten und sein Atem ging schnell und gehetzt. Daniel Specht verfolgte die regionalen Nachrichten des Bremer Rundfunks. Eigentlich mehr aus Zufall. Denn der schlanke Zwanzigjährige mit dem strohblonden Haar interessierte sich nicht sonderlich für das, was es in der Welt an Neuigkeiten gab. Der Radiosender hatte die geile Mucke einfach unterbrochen und die Nachricht von einem neuen Leichenfund, dieses mal in Vegesack, gesendet. „Es ist bereits der dritte Jugendliche, der innerhalb weniger Tage in Bremen erstochen wurde,“ berichtete der Sprecher und machte der untätigen Polizei große Vorwürfe. „Wer weiß, wer der nächste junge Mann sein wird, den wir beklagen müssen,“ fuhr der Mann im Funkhaus in reichlich theatralischem Ton fort. Im nächsten Moment dudelte das Radio den nächsten Szenehit. Daniels Finger griffen zum Telefon und tippten zitternd die Handynummern seines Freundes. „Der Teilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar,“ ertönte eine freundliche Bandstimme. Daniel knallte das Telefon auf den Tisch. Er war erregt. War es wirklich sein Freund Gerd, von dem im Radio gesprochen wurde? Er musste es wissen! Die nächste Zahlenkombination gehörte zum Privatanschluss der Grubers. Gerd hatte ihm zwar verboten diese Nummer zu wählen, aber schließlich war es ja ein Notfall. Seit der Sache mit der Vergewaltigung durften Gerds Eltern nicht wissen, dass ihr Sohn noch der Kameradschaft angehörte. Er hatte es dem Staatsanwalt versprechen müssen. Wenn es nicht Gerd war, der an das Telefon ging, wollte Daniel einfach einen anderen Namen sagen und nach seinem Freund fragen. Trotzdem erschrak er, als sich Gerds Vater am anderen Ende der Leitung meldete. Als dieser ihm schließlich offenbarte, dass sein Sohn nicht mehr am Leben sei, fiel Daniel das Telefon aus der Hand. Und da, wo vorher Angst in seinem Gesicht stand, brach nun Panik aus. Zwar vernahm er noch die quäkende Stimme des Staatsanwalts aus dem Lautsprecher des auf dem Sofa liegenden Telefons, aber er war nicht mehr fähig auch nur noch ein einziges Wort mehr herauszubringen, geschweige denn sich noch mit dem Mann zu unterhalten. Als er schließlich das Gespräch beendete, hatte der Staatsanwalt bereits aufgelegt. Daniel hatte unsagbare Angst, denn das, was er bereits nach Ralfs Tod befürchtete, war zu tödlicher Realität geworden. Seine drei toten Freunde und er hatten vor mehr als einem Jahr eine Frau vergewaltigt. Eigentlich wollte er damals gar nicht mitmachen, hatte sich dann aber doch von den anderen überreden lassen. Und dafür, das sich die blöde Kuh ein paar Tage später umbrachte, dafür konnten schließlich weder er noch seine Kameraden etwas. Daniel zwang sich zur Ruhe. Ein großes Glas Doppelkorn half ihm dabei. Er überlegte so gut er es in dieser Situation eben vermochte. Es konnte nur der Typ aus dem Auto sein, der ihnen während der ganzen Zeit zuschauen musste. Der Kerl war ihr Ehemann gewesen. Das hatte der Blondschopf damals in der Zeitung gelesen. Er und seine Kameraden hatten die ganze Sache längst vergessen, aus ihrem Gedächtnis gestrichen. Aber dieser Kerl wollte allem Anschein nach Rache. Und plötzlich war dem Blondschopf klar, dass er diesem Mann nicht entkommen konnte. Er musste sich Bernd Müller, seinem Gruppenleiter anvertrauen. Das war jetzt seine einzige Chance, um lebend aus der Sache raus zu kommen. -41Bernd Köster war Intensivpfleger in der chirurgischen Unfallklinik im Josephstift. Er hatte gerade seine zwölf Stunden Dienst hinter sich gebracht und befand sich auf seinem letzten Gang für heute. Er war mit einem Rollwagen voller Schmutzwäsche im Lastenaufzug auf dem Weg in den Keller. Außer der Wäscherei befanden sich auch die Personal - und Waschräume im Untergeschoss. Es war also durchaus logisch, dass er auf dem Weg nach unten gleich die Lore mit der Schmutzwäsche mitnahm. Die Übergabe der Krankenakten an die Ablösung und die Absprache des neuen Dienstplanes hatte er hinter sich gebracht. Nun wollte er nur noch nach Hause. Eine ordentliche Mütze Schlaf nehmen und am Abend, zusammen mit seinem Freund schick Essen gehen. Bernd war homosexuell und er stand dazu. Noch vor einigen Jahren, als er ausgerechnet in diesem Krankenhaus anfing, hatte er mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Doch inzwischen wurde er von seinen Kollegen anerkannt und wegen seines freundlichen Wesens geschätzt. Der Aufzug ruckte und kam zum Stillstand. Er hatte das Untergeschoss erreicht. Ein heller Gong ertönte und die breite Stahltür schob sich ineinander. Manchmal, vor allem des Nachts war es hier unten direkt unheimlich. Noch ein Stockwerk tiefer, im U2, befand sich die pathologische Abteilung. Dort wurden die Leichen seziert oder warteten in den Kühlboxen auf ihre Bestattung. Ohne Zweifel, schon für einen weniger zart besaiteten Zeitgenossen, als Bernd es war, eine unangenehme Vorstellung. Der kahlköpfige Krankenpfleger legte seine Hände auf den Haltebügel des Wäschewagens und löste mit dem Fuß die Feststellbremse. Dann schob er die einem Einkaufswagen ähnlich sehende Lore mit Schwung hinaus in den hell beleuchteten Gang. Und obwohl es noch nicht Nacht war, überkam ihn ein unheilvolles Gefühl. Durch die sich automatisch öffnende Tür kam ihm ein Mann entgegen. Der Pfleger kannte den Mann mit dem dunklen Teint nicht. Er hatte ihn noch nie zuvor hier unten gesehen. Bernd musste sich beherrschen. Er nahm all seinen Mut zusammen und sprach den Mann an. Jetzt erst, da sich beide gegenüberstanden und er dem Unbekannten ins Gesicht sehen konnte, bemerkte er dessen Narbe, die sich quer über die rechte Wange zog. „Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?“, erkundigte sich der Pfleger. Der Mann mit dem Narbengesicht trat zwei Schritte zur Seite, so dass sich der Wäschewagen nicht mehr zwischen ihnen befand. Der kahlköpfige Pfleger, der mehr als einen halben Kopf kleiner als sein Gegenüber war, schluckte trocken. „Verstehen Sie die deutsche Sprache nicht?“, fragte er mit eigenartig krächzender Stimme. Doch auch jetzt antwortete das Narbengesicht nicht. Stattdessen zog er mit einer schnellen Bewegung ein langes Messer hinter seinem Rücken hervor, packte den Pfleger mit der freien Hand im Nacken und hielt ihm die Klinge an den Hals. „Ganz ruhig und es geschieht dir nichts!“ Der Mann in den weißen Krankenhausklamotten wagte sich nicht zu rühren. Außer einem gedrungenem „Ja.“ kam ihm kein Laut über die Lippen. Der Moslem sah sich um. Er entdeckte in geringer Entfernung eine schmale Seitentür. „Los, mitkommen!“, befahl er seiner Geisel. Bernd Köster umklammerte nach wie vor den Wäschewagen. Es schien, als suche er den Schutz seiner Nähe. Immer noch die Klinge des Messers an seinem Hals spürend tat er, was ihm der Unbekannte befahl. Sekunden später hatte das merkwürdige Gespann die Tür erreicht. „Was ist dort hinter?“, herrschte der Unbekannte den Kahlkopf an. Doch der war vor lauter Angst zu keiner Antwort fähig. Der Mann mit dem Messer öffnete vorsichtig die Tür und sah in den Raum. Es schien niemand drinnen zu sein. Er schaltete das Licht an und zerrte den Pfleger mitsamt dem Wäschewagen mit sich hinein. „Was wollen Sie von mir?“, stammelte der Kahlkopf, der allmählich seine Stimme wiederfand. „Was ist das hier?“, fragte der Mann mit dem dunklen Teint, anstatt die Frage seiner Geisel zu beantworten. „Der Ruheraum von Doktor Bonnysa,“ stotterte der Pfleger und fügte noch hinzu: „glaube ich.“ Der Druck des Messers an seiner Kehle lies etwas nach. „Wann kommt er?“ Die Geisel zuckte mit den Schultern. Der Blick des Tunesiers durchdrang ihn kalt und hasserfüllt. „Weist du wenigstens wo ich Daniel Specht finde?“ Der Pfleger erschrak. Das Unfallopfer lag auf seiner Station. Der Mann mit dem Messer wollte sicher keinen Höflichkeitsbesuch machen. Trotz dessen, dass das Schlagen seines Herzens beinahe seine Brust zu sprengen drohte, log er das Narbengesicht an. „Nein,“ entgegnete er ihm mit bebender Stimme. „Du lügst!“, entgegnete ihm der Mann in beängstigend ruhigem Ton. Und der Schmerz, den Bernd Köster im selben Moment an seinem Hals verspürte, gab seinem Gefühl recht. Die Klinge hatte ihm einen feinen aber schmerzhaften Schnitt in den Hals geritzt. Nicht besonders lang und auch nicht tief, aber tief genug, dass die Wunde zu bluten begann. Der Unbekannte erhob seine Stimme. „Ich frage dich noch einmal. Und Gott wird nicht hinsehen, wenn ich dich für deine Lügen strafe!“ Dem Pfleger stand der Angstschweiß auf der Stirn. Sein blutleeres Gesicht glich dem einer tiefgekühlten Leiche. Er wagte es nicht noch einmal zu lügen. „Der Mann, den Sie suchen liegt auf Station sieben Intensiv.“ „Welches Zimmer,“ fragte der Tunesier ungeduldig weiter. Auch jetzt wagte Bernd Köster es nicht, den Mann mit der Narbe im Gesicht zu beschwindeln. Seine Stimme vibrierte. Er spürte wie sein warmes Blut über den Hals in den Kragen seines Hemdes hinunterrann. „Zimmer 22.“ Endlich lies der Druck des Messers wieder nach. „Hinsetzen!“, befahl ihm der Fremde. Seine Augen durchsuchten den Raum. Schließlich band er dem Pfleger ein Handtuch um den Hals, welches er an einem Haken neben dem Waschbecken entdeckte. Ein weiteres drehte er zu einer Wurst, drückte es dem Pfleger zwischen die Lippen und band es an seinem Hinterkopf zusammen. Dabei achtete er darauf, dass es straf saß. Anschließend riss er das Anschlusskabel aus dem Telefon und zog den Stecker aus der Dose. Dann fesselte er den völlig eingeschüchterten Mann damit an der Liege und drohte ihn umzubringen, falls er sich nicht ruhig verhielt. Um nicht aufzufallen, zog er sich den Arztkittel, der an der Garderobe hing über, löschte das Licht und öffnete die Tür vorsichtig einen Spalt. Auf dem Gang war keine Menschenseele. Er trat hinaus, schloss die Tür hinter sich und ging zum Aufzug. Als sich wenig später die Stahltür des Lifts öffnete, begegneten ihm zwei Schwestern in Nonnentracht. Der Mann mit der Narbe senkte seinen Kopf, als sie ihn grüßten und betrat den Fahrstuhl. Die Tür schloss sich hinter ihm. Der Moslem drückte auf den Schaltknopf neben dem Schild, auf dem Station sieben stand und der Aufzug setzte sich in Bewegung. Doch bereits im Erdgeschoss stoppte er wieder. Eine Ärztin und ein Arzt stiegen zu. Sie nickten dem Tunesier freundlich zu und unterhielten sich angeregt weiter. Wenn Karim es richtig verstand, ging es um die Notwendigkeit eines Eingriffs. Der Arzt hielt eine Operation für dringend erforderlich, wohingegen es die Ärztin erst mit einem Mix aus Bestrahlungen und einer neuartigen Medizin versuchen wollte. Genau wie Karim verließen auch sie den Aufzug im dritten Stock. Während sie zielstrebig den rechten Gang hinuntersteuerten, musste sich der Tunesier erst orientieren. Um diese Tageszeit herrschte reger Besucherandrang. Einige der Leute standen vor einer großen Hinweistafel, die an der Wand gegenüber den Personenfahrstühlen angebracht war. Einige Minuten später drückte er die Glastür zur Station sieben auf. Ganz am Ende des Ganges befand sich eine weitere Tür, die diese von der Intensivstation trennte. Doch als er sie öffnen wollte, musste er feststellen, dass sie verschlossen war. Rechts neben dem Eingang befand sich eine Sprechanlage. Wahrscheinlich für Besucher, ging es ihm durch den Kopf. Aber er konnte sich doch unmöglich anmelden. Karim beschloss unauffällig zu warten, um in einem geeigneten Moment mit hineinzuschlüpfen. Er brauchte sich nicht lange gedulden. Schon kurze Zeit später klingelte ein älterer Herr mit Hut an der Sprechanlage. Eine Stimme fragte ihn zu wen er wolle und Sekunden später summte der Türöffner. Kurz bevor die schwere Glastür wieder ins Schloss fiel, sprang der Tunesier hinzu und drückte sie langsam wieder auf. Er sah gerade noch wie der Mann mit dem Hut in Begleitung einer Krankenschwester in einem Raum verschwand. Bis hier hin war es nicht sonderlich schwer gewesen, freute sich der Moslem. Zimmer 22 hatte ihm der Pfleger verraten. Karim sah sich orientierend um. Die Wände links und rechts des Ganges waren aus Glas. Nur zwischen den Zimmern waren sie aus massiven Stein. An den Glaswänden hingen von innen breite Jalousien herunter. Einige waren zugezogen. Gerade, als er sich aufmachen wollte, um nach Zimmer 22 zu suchen, traten die Krankenschwester und der ältere Herr, jetzt ohne Hut, dafür mit einer Plastikhaube auf dem Kopf, in einem weißen Kittel und mit Mundschutz, zurück auf den Gang. Der Mann mit dem Narbengesicht wich zurück. Erst als die Luft wieder rein war, tastete er sich weiter vor. Die meisten Türen, an denen er vorbei kam, waren geöffnet. Die Jalousien auf Durchsicht gedreht. Unmittelbar neben ihm sprang eine Tür auf und ein Arzt und eine Krankenschwester traten auf den Gang. Sie sprachen über den Patienten, den sie gerade verlassen hatten. Karims rechte Hand fuhr erschrocken unter den Kittel und umklammerte den Griff des Messers, um es wenn nötig möglichst schnell einsetzen zu können. „Suchen Sie jemanden?“, fragte ihn die Schwester während sich der Doktor entfernte. Der Druck um den Messergriff verstärkte sich. Der Tunesier starrte sie an, und suchte nach einer Ausrede. „Nein, meine Verlobte ist gerade bei ihrem Bruder drinnen.“ Dabei deutete er wahllos den Flur hinunter. „Bitte gehen Sie nicht in den Gängen spazieren. Wir wollen doch die Privatsphäre der Patienten wahren, oder?“ Dabei lächelte sie Karim mildtätig an. „Ja natürlich, Sie haben recht!“ Endlich, Zimmer 22! Er hatte es gefunden. Durch die offenstehende Tür sah der Tunesier das Bett, in dem Daniel Specht lag. Er ging hinein und schloss die Tür. Während er die Jalousie zudrehte, sah er einen Pfleger, der einen Wagen voller Medikamente genau vor das Fenster rollte und sich entfernte. Daniel Specht schlief. Neben seinem Bett überwachten verschiedene elektronische Geräte seinen Schlaf. In seinem Arm steckte eine Kanüle, dessen dünner Schlauch in einem Tropf über dem Bett endete. Ein monotones Piepen gab seinen gleichmäßigen Herzschlag wieder. Der Kopf des Verletzten war fast vollständig von einem weißen Verband umhüllt. Das linke Bein des Burschen lag in einer Schiene, die auf einer Art Rampe ruhte. Oberhalb des Knies waren Stahlseile befestigt, die über eine Rolle führten und an denen Gewichte hingen. Karim betrachtete den jungen Mann, der so hilflos und friedlich in dem einzigen Bett in diesem Raum schlummerte. Fast hätte er Mitleid mit diesem Kerl gehabt. Für einen Moment lang überlegte er, ob dies schon die Strafe war, die ihm Allah zugedacht hatte. Aber dann kamen ihm wieder die entsetzlichen Bilder jener Nacht in Erinnerung. Die Bilder die er einfach nicht mehr verdrängen, geschweige denn vergessen konnte. Er sah das um Hilfe flehende Gesicht seiner Fatima, hörte ihre von Schmerz verzerrten Schreie und er dachte an die Schande, die diese Halunken über ihn und seine Familie gebracht hatten. Und im selben Augenblick wusste der Mann, dem man alles genommen hatte, was sein Leben ausmachte, dass dieser Sheitan sterben musste. Er löste sich vom Fußende des Bettes und trat direkt neben den Verletzten. Gleichzeitig zog er das Messer aus der Scheide. Sein Puls beschleunigte sich, sein Herzschlag wurde heftiger. In seinen Augen blitzte so etwas wie Genugtuung auf und die Gedanken des Märtyrers waren bei seiner Frau. Er hob den ausgestreckten Arm in dessen Faust sich das Messer befand und flüsterte: Fatima, bald werde ich bei dir sein! -44Die junge Frau lag auf der alten Matratze, mitten auf dem gekachelten Fußboden des Badezimmers und versuchte zu schlafen. Mit der Eisenkette an ihrem rechten Handgelenk war dies nur äußerst umständlich und jedes mal, wenn sie sich im Schlaf zu drehen versuchte, überaus schmerzhaft. Seit ihrer Entführung war sie zum zweiten mal allein im Haus. Der Tunesier hatte sie wieder an den Heizungsrohren angekettet. Zwischen dem Entführer und Meike Ruhland hatte sich so etwas wie ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie hatte ihm bei seinen Erzählungen über seine Familie und seiner Religion, dem Islam, aufmerksam zugehört. Wenn er im Hause war, konnte sie sich immerhin frei bewegen. Er war ihr sogar dafür dankbar, dass sie im Wohnzimmer und der Küche ein wenig sauber machte. Eigentlich empfand sie diesen Mann weniger als ihren Peiniger, in ihren Augen war er, genauso wie sie, ein Opfer. Der Mann mit der Narbe im Gesicht hatte das Haus verlassen um Rache zu nehmen. Rache für das, was diese Leute seiner Frau und ihm angetan hatten. Denselben Leuten, die sie vor ein paar Tagen vergewaltigen wollten. Meike hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, und somit war sie zwischen dem Verständnis, das sie Karim Bahraui entgegenbrachte und den Buchstaben des Gesetzes hin und hergerissen. Es war so etwas wie ein innerer Disput, den sie mit sich ausfocht, über den sie schließlich eingeschlafen war. Doch nun waren es neben dem Schmerz an ihrem Handgelenk die merkwürdigen Geräusche, die sie im Unterbewusstsein wahrnahm. Es war ein leises, abgehacktes Pochen. Ein feines Schleifen, Scharren und Tackern. So, als wenn kleine Füßchen herumkrabbelten. Zuerst glaubte sie, die Geräusche seien Bestandteil ihres Traumes, doch dann spürte sie deutlich, wie etwas warmes, pelziges an ihrem nackten Fuß entlang glitt. Meike schreckte entsetzt auf. Die Fessel an ihrer Hand rissen sie zurück. Sie hatte in diesem Moment des Entsetzens nicht daran gedacht. Die Kettenglieder drückten sich in das Fleisch ihres Armes. Im diffusen Licht der mit Fliegendreck übersäten Glühbirne sah sie in die rot leuchtenden Augen einer Ratte. Einer verdammt großen Ratte. Mit schrillem Pfeifen zog sich das Tier in die gegenüberliegende Ecke des winzigen Bades zurück. Die junge Frau konnte sich beim besten Willen nicht erklären, woher das Tier gekommen war. Sie ekelte sich vor diesen stinkenden Tieren. Die Ratte verharrte fast regungslos und beobachtete jede Meikes Bewegungen. Angewidert blickte sie auf den pelzigen Körper, auf den nackten Schwanz, der sich auf den Kacheln des Fußbodens kringelte, die lange, schlanke Schnauze des Tiers, die unentwegt zuckte und schnüffelte. Meike hatte sich so weit es ging von der Bestie entfernt. Hatte soviel Luft wie möglich zwischen sich und der nach Kot und Fäulnis stinkenden Ratte gebracht. Zitternd, dass Vieh nicht für eine einzige Sekunde aus den Augen lassend, kauerte die junge Frau zwischen Heizkörper und Waschbecken. Nichts, was sich in ihrer Reichweite befand, hätte ihr bei einem Angriff als Waffe dienen können, nichts hätte sie vor der Bestie schützen können. Ohne das Tier dabei aus den Augen zu lassen, wanderte ihr Blick über die Wände ihres Gefängnisses. Die Ratte musste über den Lüftungsschacht hereingekommen sein. Wie sie schon in der vergangenen Nacht festgestellt hatte, fehlte das Lüftungsgitter. Wahrscheinlich war es schon vor Jahren abgenommen worden. Meikes Gedanken kreisten um die Möglichkeit, das dort, wo sich eines dieser Nager aufhielt, auch noch andere sein konnten. Ratten sind Herdentiere. Sie besann sich auf das, was sie vor Jahren in der Schule darüber gelernt hatte. Hatten sie damals nicht gelernt, dass eine Ratte nur dann einen Menschen angreift, wenn sie sich bedroht, in die Enge getrieben fühlt? Hoffentlich wusste die Ratte, was über sie in den Schulbüchern geschrieben stand. Sie musste also Ruhe bewahren, musste dem Vieh zeigen, dass sie keine Angst vor ihm hatte und musste beten, dass ihr Entführer bald nach Hause kommen würde. Die Ratte begann sich nun zu bewegen, aufgeregt an der eingefliesten Badewanne auf und abzulaufen. Sie fauchte und pfiff, krabbelte an den Heizungsrohren empor und verharrte etwa einen Meter über dem Kopf der in Angst erstarrten jungen Frau. Plötzlich vernahm Meike die gleichen Geräusche, wie zuvor, als sie erwachte. Das gleiche Trippeln. Als wenn kleine spitze Krallen über Blech krabbelten. Vorsichtig wandte Meike ihren Kopf zum offenen Loch des Lüftungsschachtes und erblickte eine zweite Ratte, die vermutlich ihren Artgenossen rief. Auch sie schickte sich an über die Rohre der Heizung herunterzuklettern. Meike war drauf und dran in Panik zu verfallen. Schweiß perlte von ihrer Stirn und lief in ihr linkes Auge. Die junge Frau wagte es nicht sich zu bewegen. Wagte es nicht einmal ihre Hand zu heben, um sich mit einem Finger, die in ihrem Auge brennende Flüssigkeit auszuwischen. Von zwei Augenpaaren argwöhnisch beobachtet, vermochte sie nicht mehr einen klaren Gedanken zu fassen. Es schien als warteten die Bestien nur auf eine falsche Bewegung von ihr. Während sich die zweite Ratte auf dem Wannenrand, direkt vor ihr, niedergelassen hatte und sie weiter misstrauisch beäugte, hörte Meike, wie sich die erste Ratte, welche sich über ihr befunden hatte, in Bewegung setzte. Das schleifend trippelnde Geräusch kam näher, veränderte, sich als die Ratte das Waschbecken erreichte. Fast schien es ihr, als würden die stinkenden Biester einen gewissen Plan verfolgen. Nur das Porzellan des Beckens trennte ihren Kopf nun noch von der schlanken, spitzen Schnauze mit den messerscharfen Zähnen. Jetzt dachte sie an das Schweizer Taschenmesser, welches sie als Kind stets mit sich führte. Oder an das kleine Döschen mit dem Pfefferspray, dass sie von ihrem Vater zum Schutz bekommen hatte. Damals lachte sie insgeheim über die übertriebene Fürsorglichkeit ihrer Eltern. Schon bei dem Überfall des Rechtsradikalen hätte sie das Spray zum ersten mal gebrauchen können und heute ein zweites mal. Sie schwor sich, falls sie diese Geschichte unbeschadet überstehen sollte, nie wieder ohne eine Waffe das Haus zu verlassen. Das schnuppernde Geräusch der nervös umherzuckenden Schnauze des Nagers kam immer näher. Der penetrante Gestank nach Verwesung und Fäkalien brachten ihre Magensäfte in Wallung. In diesem Moment hatte das Vieh ihre Schulter erreicht. Das war der Augenblick, in dem die junge Frau nicht mehr inne halten konnte. Mit einer einzigen heftigen Bewegung war es ihr gelungen das Biest abzuschütteln. Es knallte quiekend gegen die Kloschüssel. Gleichzeitig schrie und trampelte die Studentin in blinder Panik um sich. Erst als sie die starken Arme des Tunesiers festhielten und sie seine beruhigende Stimme hörte, kam sie wieder zu sich. Erst jetzt, als er ihre Kette gelöst und sie in seine Arme genommen hatte, begann sich die Anspannung in ihr zu lösen. Sie schluchzte und japste immer wieder nach Luft. Karim Bahraui war gerade nach Hause gekommen, als er ihr Schreien vernahm und in das Badezimmer stürmte. Aber außer ihrem wilden Trampeln und dem Geschrei, das die junge Frau machte, konnte er nichts ungewöhnliches feststellen. Als er sich zu ihr herabbeugte, um sie zu beruhigen, hatte er ihre weit aufgerissenen Augen und die Panik darin bemerkt. Er hatte sich in dem kleinen Zimmer umgesehen, aber nichts besonderes bemerkt. „Sie hatten einen Albtraum,“ sagte er mit weicher Stimme. Tröstend strich er über ihre Haare. „Es ist vorbei. Sie brauchen sich nicht zu fürchten.“ Aber für Meike war es noch nicht vorbei. Immer wieder starrte sie auf das Loch vor dem Lüftungskanal. Sie konnte nicht glauben, dass alles nur ein böser Traum gewesen sein sollte. Erst Stunden später hatte sich die junge Frau wieder halbwegs beruhigt. Sie saß ihrem Entführer an dem alten Holztisch gegenüber und schlürfte den heißen Kaffee, den er ihr aufgebrüht hatte. Erst jetzt bemerkte sie, dass etwas mit dem rechten Handgelenk des Tunesiers nicht stimmte. Er hatte es notdürftig mit einem Verband umwickelt. „Was ist geschehen?“, fragte sie ihn anteilnehmend. „Nichts!“, antwortete er knapp. Meike wandte sich wieder ihrem Kaffee zu. Sie schwieg eine Weile und sah ihm dabei zu, wie er an etwas Elektronischem herumbastelte. „Aber ich sehe doch, dass etwas mit Ihrem Arm nicht stimmt!“ Immer noch etwas angeschlagen, erhob sie sich und umrundete den Tisch. „Nun zeigen Sie schon her!“ Der Moslem gehorchte. Vorsichtig wickelte Meike die Binde von seinem Arm. Der Tunesier verkniff sich offensichtlich den Schmerz. Das Handgelenk war dick und blau angelaufen. Als sie den Arm sachte anhob, hing die Hand schlaff herunter. „Ich habe zwar nicht viel Ahnung davon, aber allem Anschein nach ist das Gelenk gebrochen. Damit müssen Sie sofort zum Arzt!“ Karim schüttelte den Kopf. Er brauchte nichts zu sagen, Meike wusste auch so, dass er zu keinem Arzt gehen konnte. „Ich versuche die Hand zu schienen, aber ich weiß nicht, ob es mir gelingt.“ Ihr Entführer hielt ihr den Arm entgegen. „Es reicht, wenn ich ihn einigermaßen bewegen kann.“ Die junge Frau nahm die zwei dünnen Kupferrohre, mit denen Karim offensichtlich etwas ganz anderes vor gehabt hatte und benützte sie als Schienen. „Haben Sie den Jungen getötet,“ fragte sie den Tunesier plötzlich. Er sah ihr in die Augen und bemerkte die Unsicherheit und ihre Angst, die sich darin widerspiegelte. „Nein, es hat nicht geklappt. Zufrieden?“ Und obwohl sich eine gewisse Erleichterung in ihr ausbreitete, zuckte sie nur scheinbar gleichgültig mit den Schultern. „Ich weis nicht mehr was richtig ist!“ „Es ist sicher nicht richtig, wenn solche Bestien ungeschoren davon kommen! Die Polizei hat ihre Chance gehabt. Ich habe lange genug im Krankenhaus gelegen, ohne das etwas geschehen ist. Nun ist es an mir, Gerechtigkeit vor dem Gesetz und vor Allah wieder herzustellen.“ Wenn Ihnen das erste Drittel des Romans gefallen hat und Sie gern wissen möchten wie er zu Ende geht, dann schicken Sie mir Ihre Bestellung. Für 0,99 € Bearbeitungsgebühr sende ich Ihnen gern den Rest zu. Alles weitere per E-Mail. [email protected] Sollten Sie in Wolfenbüttel und Umgebung wohnen, besteht ebenso die Möglichkeit das Buch als Vorabdruck für nur 4.-- € im Kaffeeklatsch (Fußgängerzone) zu erwerben. Mit freundlichen Grüßen U.Brackmann