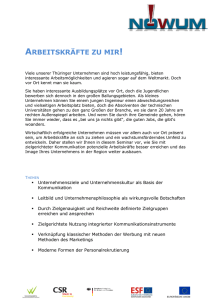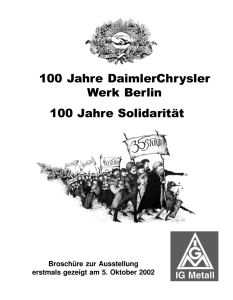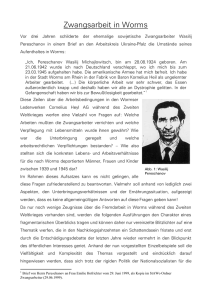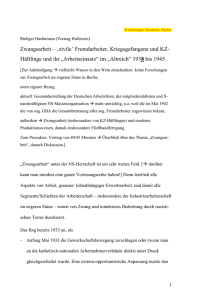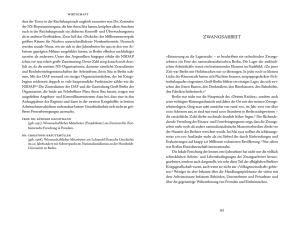„Rassisch hochwertiger als die sudetendeutsche Bevölkerung
Werbung
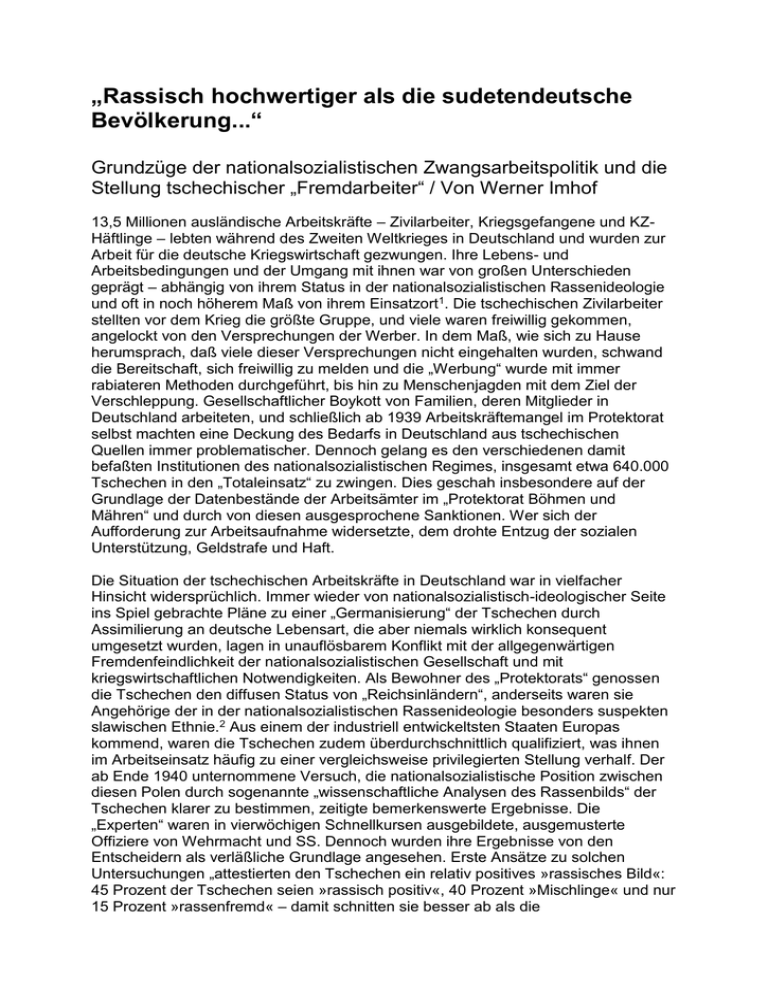
„Rassisch hochwertiger als die sudetendeutsche Bevölkerung...“ Grundzüge der nationalsozialistischen Zwangsarbeitspolitik und die Stellung tschechischer „Fremdarbeiter“ / Von Werner Imhof 13,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte – Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZHäftlinge – lebten während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und wurden zur Arbeit für die deutsche Kriegswirtschaft gezwungen. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Umgang mit ihnen war von großen Unterschieden geprägt – abhängig von ihrem Status in der nationalsozialistischen Rassenideologie und oft in noch höherem Maß von ihrem Einsatzort1. Die tschechischen Zivilarbeiter stellten vor dem Krieg die größte Gruppe, und viele waren freiwillig gekommen, angelockt von den Versprechungen der Werber. In dem Maß, wie sich zu Hause herumsprach, daß viele dieser Versprechungen nicht eingehalten wurden, schwand die Bereitschaft, sich freiwillig zu melden und die „Werbung“ wurde mit immer rabiateren Methoden durchgeführt, bis hin zu Menschenjagden mit dem Ziel der Verschleppung. Gesellschaftlicher Boykott von Familien, deren Mitglieder in Deutschland arbeiteten, und schließlich ab 1939 Arbeitskräftemangel im Protektorat selbst machten eine Deckung des Bedarfs in Deutschland aus tschechischen Quellen immer problematischer. Dennoch gelang es den verschiedenen damit befaßten Institutionen des nationalsozialistischen Regimes, insgesamt etwa 640.000 Tschechen in den „Totaleinsatz“ zu zwingen. Dies geschah insbesondere auf der Grundlage der Datenbestände der Arbeitsämter im „Protektorat Böhmen und Mähren“ und durch von diesen ausgesprochene Sanktionen. Wer sich der Aufforderung zur Arbeitsaufnahme widersetzte, dem drohte Entzug der sozialen Unterstützung, Geldstrafe und Haft. Die Situation der tschechischen Arbeitskräfte in Deutschland war in vielfacher Hinsicht widersprüchlich. Immer wieder von nationalsozialistisch-ideologischer Seite ins Spiel gebrachte Pläne zu einer „Germanisierung“ der Tschechen durch Assimilierung an deutsche Lebensart, die aber niemals wirklich konsequent umgesetzt wurden, lagen in unauflösbarem Konflikt mit der allgegenwärtigen Fremdenfeindlichkeit der nationalsozialistischen Gesellschaft und mit kriegswirtschaftlichen Notwendigkeiten. Als Bewohner des „Protektorats“ genossen die Tschechen den diffusen Status von „Reichsinländern“, anderseits waren sie Angehörige der in der nationalsozialistischen Rassenideologie besonders suspekten slawischen Ethnie.2 Aus einem der industriell entwickeltsten Staaten Europas kommend, waren die Tschechen zudem überdurchschnittlich qualifiziert, was ihnen im Arbeitseinsatz häufig zu einer vergleichsweise privilegierten Stellung verhalf. Der ab Ende 1940 unternommene Versuch, die nationalsozialistische Position zwischen diesen Polen durch sogenannte „wissenschaftliche Analysen des Rassenbilds“ der Tschechen klarer zu bestimmen, zeitigte bemerkenswerte Ergebnisse. Die „Experten“ waren in vierwöchigen Schnellkursen ausgebildete, ausgemusterte Offiziere von Wehrmacht und SS. Dennoch wurden ihre Ergebnisse von den Entscheidern als verläßliche Grundlage angesehen. Erste Ansätze zu solchen Untersuchungen „attestierten den Tschechen ein relativ positives »rassisches Bild«: 45 Prozent der Tschechen seien »rassisch positiv«, 40 Prozent »Mischlinge« und nur 15 Prozent »rassenfremd« – damit schnitten sie besser ab als die Sudetendeutschen“3. Die ambivalente, aber im Vergleich mit anderen Slawen eher positive rassistische Einschätzung der Tschechen durch die Nazis ist eine der Erklärungen dafür, warum sie insgesamt etwas weniger diskriminiert wurden. „Es bleibt eine der verblüffenden Erfahrungen dieses Krieges, daß Hitler dem eigenen Volke jene Belastungen ersparen wollte, die Churchill oder Roosevelt ihren Völkern ohne Bedenken auferlegten“ wunderte sich Albert Speer in seinen apologetischen „Erinnerungen“4 im Blick auf die „Diskrepanz zwischen der totalen Mobilisierung der Arbeitskräfte im demokratischen England und der lässigen Behandlung dieser Frage im autoritären Deutschland“5. Im Gegensatz zu England und den Vereinigten Staaten wurden jedoch unter der Naziherrschaft Millionen durch Arbeit „zu Tode geschunden“6 – doch dies traf eben nicht die deutsche Bevölkerung. Als Architekt von Hitlers gigantomanischen Bauten, vollends dann als sein Rüstungsminister trug Speer selbst keinerlei Bedenken gegen die menschenverachtende Zwangsarbeitspolitik und war selbst wesentlich am Ausbau ihrer Infrastruktur beteiligt. Bereits Mitte der dreißiger Jahre war infolge der Mobilisierung aller Ressourcen zur Kriegsvorbereitung in Deutschland Vollbeschäftigung erreicht. Der Lebensstandard war dennoch gering7, und das NSRegime war sich der Loyalität der Bevölkerung nicht sicher. Aus der Innensicht der Führungselite beobachtete Speer: „Es war das Eingeständnis politischer Schwäche; es verriet beträchtliche Sorge vor einem Popularitätsverlust, aus dem sich innenpolitische Krisen entwickeln könnten.“8 Der Arbeitskräftemangel hatte sich noch erheblich durch die Wiedereinführung der Wehrpflicht 1935 und nach Kriegsbeginn verschärft. Auch die Einführung des einjährigen Arbeitsdienstes für Frauen 1935 konnte den Bedarf nicht decken, zumal alle Instrumente zur Steuerung des Arbeitsmarktes nur „zögerlich und inkonsequent angewendet“9 wurden. Eine unüberschaubare Kompetenzvielfalt in der Arbeitsmarktpolitik brachte vielfach sich widersprechende Regelungen hervor und verstärkte noch die Rechtlosigkeit der ausländischen Arbeitskräfte und die Willkür, der sie ausgesetzt waren. Es war dem Zufall überlassen, mit welchen Lebens- und Arbeitsumständen sich jeder einzelne arrangieren mußte. „Die enormen Spielräume subalterner Instanzen und lokaler Akteure waren eines der zentralen Charakteristika des nationalsozialistischen »Ausländereinsatzes«.“10 So bedurfte im Einzelfall – ein harmloses Beispiel – der Entzug der auch für Nichtraucher als Tauschmittel wertvollen Zigarettenration durch einen Lagerführer zwar eines schriftlichen Antrages, aber keiner Begründung11. Als im März 1942 Fritz Sauckel zum „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ ernannt wurde, sollten noch ungenutzte Arbeitsreserven mobilisiert und in die Rüstungsproduktion geworfen werden. Von verschiedenen Seiten – etwa von Goebbels und Speer – war dabei zunächst auch an deutsche Arbeitskräfte, vor allem Frauen, gedacht worden. Speer wollte noch im Januar 1944 „eine noch nicht eingesetzte Reserve von 16 % oder von 4,9 Millionen deutscher Frauen“ 12 heranziehen. Aber dazu kam es nicht. Sauckel sah die „Gefahr einer sittlichen Schädigung der deutschen Frauen durch die Fabrikarbeit; darunter könne nicht nur ihr »Seelen- und Gemütsleben«, sondern auch ihre Gebärfähigkeit leiden.“13 Statt dessen, so teilte Sauckel seinen Gauleiter-Kollegen mit „hat mich der Führer beauftragt, aus den Ostgebieten ca. 400.000-500.000 ausgesuchte, gesunde und kräftige Mädchen in das Reich hineinzunehmen.“14 Deren Gebärfähigkeit, gar ihr Seelen- und Gemütsleben war den Nazi-Schergen herzlich gleichgültig. Im Blick auf die Organisation der millionenfachen Deportation ausländischer Zwangsarbeiter war die Frauenarbeit indes ein relativ unbedeutender Teilaspekt, und namentlich tschechische Frauen waren erstmals 1944 mit der Rekrutierung des Jahrgangs 1924 in größerem Umfang betroffen. Selbstverständlich war diese relative Schonung nicht menschlicher Rücksichtnahme geschuldet, sondern der hochentwickelten Wirtschaftsstruktur der böhmischen Länder, die eine offen terroristische Zwangsarbeitspolitik nicht opportun erscheinen ließ. Die Quoten für die Rekrutierung tschechischer Arbeitskräfte mußten die verantwortlichen Stellen im „Reich“ zudem ihrem eigenen Statthalter in Prag in zähen Verhandlungen abringen – und sie wurden stets unterschritten.15 Namentlich Albert Speer hat durch die nachdrückliche Forderung einer „Effektivierung der Arbeitsrekrutierung“ beträchtlich zu einer unnötigen, verlustreichen Verlängerung des Krieges und zum schweren, oft tödlichen Los der Zwangsarbeiter beigetragen. Eher beiläufig bekennt seine Mitverantwortung für millionenfaches Leiden: „Für Sauckels unglückselige Arbeiterpolitik fühle ich mich mitverantwortlich. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten war ich immer mit den von ihm betriebenen Massendeportationen ausländischer Arbeiter nach Deutschland einverstanden.“16 Skrupel im Blick auf Herkunft, Behandlung und Schicksal der Menschen, die dem kriegsbedingten Mangel an Arbeitskräften in Deutschland abhelfen mussten, waren Speer fremd. Wenn er persönlich Standorte für Konzentrations- und Arbeitslager aussuchte, weil dort Rohstoffe abgebaut werden sollten, trat diese technokratische Unmenschlichkeit besonders deutlich hervor. Ausländer, die in Deutschland und den besetzten Gebieten zum Arbeitseinsatz angeworben oder zwangsweise deportiert wurden, zahlten den grausamen Preis dafür, daß der deutschen Bevölkerung allzu große Belastungen erspart bleiben sollten. Wenn auch die Behandlung der „Fremdarbeiter“ abhängig von ihrer Herkunft und ihrem Status unterschiedlich war, litten doch alle mehr oder weniger unter den gleichen Lebensumständen: erbärmlich verpflegt, schlecht und zum Kriegsende hin häufig gar nicht entlohnt, schutzlos den Luftangriffen ausgesetzt, zumeist untergebracht in Lagern, in denen sie unter Kälte und großer Seuchengefahr litten, rechtlos, diskriminiert, nicht selten mißhandelt17, und überdies der ständigen Bedrohung ausgesetzt, als Opfer der NS-Sicherheitsorgane oder von Denunziation in „Arbeitserziehungs-“ oder Konzentrationslager deportiert zu werden. Am schlimmsten traf es die sogenannten „Ostarbeiter“18, sowjetische Kriegsgefangene und die italienischen Militärinternierten19. Für die anderen Gruppen der Zwangsarbeiter waren die Umstände in der Regel besser, aber gemeinsam war allen ein Zustand der Rechtlosigkeit – niemand konnte davor sicher sein, wehrloses Opfer von Mißhandlungen und nicht selten tödlich endender Willkür zu werden. Zum Einsatz ausländischer Arbeitskräfte entschloß sich die das NS-Regime infolge seiner ausgesprochen fremdenfeindlichen Ideologie nur mit großen Bedenken. Aus Sorge vor einer Bedrohung der „arischen Rasse“ durch Kontakt mit Ausländern wurden damit einhergehend die Befugnisse der Polizei ständig erweitert und mit propagandistischen Mitteln vor Kontakten mit den „Feinden“ im Inneren gewarnt 20. Als nach 1939 in wachsender Zahl polnische Kriegsgefangene vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, reichten diese von der Verhängung von Schutzhaft bis hin zur Exekution21. Auf intime Kontakte zu Deutschen stand die Todesstrafe22. Die Abschottung und Diskriminierung der Ausländer wurde 1940 zunächst mit den „Polen-Erlassen“ kodifiziert; noch unmenschlicher und tödlicher wirkten sich die 1942 folgenden „Ostarbeiter-Erlasse“ für die betroffenen Menschen aus. Neben den verqueren rassenideologischen Vorbehalten fürchtete die NSDiktatur die politische Beeinflussung der deutschen Bevölkerung besonders durch jene Ausländer, die – wie die Tschechen – aus demokratischen Herkunftsländern stammten. Durch Arbeitsniederlegungen, Langsamarbeiten, „Aufsässigkeit“, Sabotage gaben diese auch immer wieder ihrem Protest Ausdruck. Ab 1942 verschärfte sich im Gefolge der veränderten Kriegslage die Situation der Zwangsarbeiter erheblich.23 Herbert zitiert die grauenerregende Begründung des Reichsjustizministers Otto Thierack für die Abtretung der Zuständigkeit von „Sicherheitsverwahrten“ (vor allem angezeigte Ausländer und Deutsche, denen schwere Strafen drohten) an die SS aus dem September 1942. Sie mag stellvertretend den Hintergrund einer Vielzahl von Maßnahmen ausleuchten, die eine zunehmende Rechtlosigkeit und Verfolgung aller Ausländer zur Folge hatten: „Ich gehe hierbei davon aus, daß die Justiz nur in kleinem Umfang dazu beitragen kann, Angehörige dieses Volkstums auszurotten.“24 Stephan Posta charakterisiert die Entwicklung: „Aus den letzten Monaten des Krieges sind zahlreiche Exzesse und Massaker an »Fremdarbeitern« überliefert. Bis buchstäblich in die letzten Tage vor der Befreiung wurden ausländische Arbeitskräfte wegen Bagatelldelikten, auf bloßen Verdacht hin oder ohne erkennbare Gründe ermordet.“25 Nach 1942 setzte sich auf Betriebsebene „vielfach ein Trend durch ... die steigenden Produktionsforderungen des Regimes nicht mit kapitalintensiven Erweiterungen der Maschinenkapazität, sondern mit brutalerer Ausbeutung der Arbeitskräfte“26 zu beantworten. Geld war inflationsbedingt ein riskanter Aggregatszustand des Kapitals, Realkapitalinvestitionen wurden nur für Rüstungsaufträge genehmigt, und diese konnten nur mit „Fremdarbeitern“ durchgeführt werden. Es wird weithin unterschätzt, wie stark insofern die Zwangsarbeit zum sogenannten deutschen „Wirtschaftswunder“ beigetragen hat.27 Wer sich das grausame Schicksal namentlich der überlebenden russischen „Fremdarbeiter“ nach ihrer Rückkehr und die heutigen Lebensumstände der noch lebenden Zwangsarbeiter aus Osteuropa vergegenwärtigt, muß vor diesem Hintergrund Zeitpunkt, Umstände und Höhe der „Entschädigungsleistungen“ nach 60 Jahren als beschämend empfinden. Was versäumt wurde, ist nicht mehr gutzumachen. Ermutigend sind Projekte, welche die letzte Chance nutzen, den wenigen Überlebenden eine Stimme verleihen, ihre Erinnerungen vor dem Vergessen bewahren und für die Zukunft fruchtbar machen. 28 Die ehemaligen tschechischen Zwangsarbeiter können dazu besonders viel beitragen. Sie waren „Wanderer zwischen den Welten“, konnten sie sich doch in der Regel frei unter den Deutschen bewegen, während ihre schlechter gestellten Kollegen aus Osteuropa das Lager oft nur zur Arbeit verlassen konnten. Aber sie haben zugleich den traurigen Lageralltag erlebt. Dem Bemühen, dieser Zeitzeugenschaft Gehör zu verschaffen29, entsprechen in der Forschung Ansätze, die Geschichte aus dem Elfenbeinturm in die Gegenwart holen, indem sie sie „von unten“, aus der Opferperspektive, als Alltagsgeschichte beschreiben und nicht selten in der Gegenwart zu Konsequenzen aufrufen – etwa in der Form von Gedenkstättenpädagogik oder Zeitzeugenprojekten: oral history30, visual history31, regional- und alltagsgeschichtliche Arbeiten von Geschichtswerkstätten 32. Vor allem tragen sie dem Umstand Rechnung, daß der Forschungsgegenstand im Fall des Nationalsozialismus nichts Fernes ist, sondern viele seiner Opfer und Täter noch unter uns leben. Anmerkungen 1. Vgl. Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, Stuttgart – München 2001, S. 258f. In der Regel war die Arbeit in der Landwirtschaft vorteilhafter, weil auf dem Land die Kontrolle geringer und die Nahrungsmittelversorgung aus eigener Produktion reichhaltiger war. In Städten war die Situation der Fremdarbeiter um so schlechter, je größer der Betrieb und je geringer ihre Qualifikation war. Vgl. auch Andreas Mai, „Haltet Abstand von den Ausländern!“ NS-Ideologie und Lebenswelten von ausländischen Arbeitskräften in Nordwestsachsen, in: Sächs. Staatsmin. des Innern (Hrsg.), Fremd- und Zwangsarbeit in Sachsen 1939-45. Beiträge eines Kolloquiums in Chemnitz am 16. April 2002, Halle/Dresden 2002, S. 27-48, hier: S. 28: „Das Ausmaß an Ausbeutung und Diskriminierung, das der oder die Einzelne zu erdulden hatte, hing im Wesentlichen von der hierarchischen Kategorisierung der Arbeiter und Arbeiterinnen nach Ethnie und Geschlecht ab, des Weiteren vom Einsatzort und Wirtschaftszweig, von der Größe des Betriebes und der spezifischen Verwendung etwa als Hilfs- oder Fachkraft.“ 2. Im Einzelfall konnte ihnen dieser Umstand durchaus auch zum Nachteil gereichen – darauf weist Stephan Posta (Tschechische „Fremdarbeiter“ in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Dresden 2002, S. 143. Der Autor dankt Stephan Posta für die konstruktive Kritik des vorliegenden Textes.) hin: „Zwar wurden sie in der Regel als Ausländer bezeichnet und behandelt, konnten jedoch auch Repressionsmaßnahmen, die ansonsten Deutschen «vorbehalten» waren, unterworfen werden, wenn es «im deutschen Interesse lag».“ 3. Posta, S. 66f. 4. Albert Speer, Erinnerungen, Frankfurt/M. – Berlin 1969; zit. n. Aufl. 1982, S. 229 5. Ebd. 6. Spoerer, S. 253 7. Posta, S. 25, beleuchtet die Kontroverse um die These Richard Overys („Blitzkriegswirtschaft?“ Finanzpolitik, Lebensstandard und Arbeitseinsatz in Deutschland 1939-1942. In: VfZ 36, 1988, S. 379-435), die deutsche Bevölkerung habe „bereits Ende der dreißiger Jahre nur knapp über dem Existenzminimum gelebt“, verweist aber auf berechtigte Kritik an dessen Argumentation und betont, die Tendenz der NS-Politik zur „größtmöglichen Schonung“ der eigenen Bevölkerung sei davon unberührt. 8. Speer, S. 229; vgl. Posta, S. 24 und Ulrich Herbert, Arbeiterschaft im “Dritten Reich”. Zwischenbilanz und offene Fragen. In: Geschichte und Gesellschaft 15 (1989), S. 320-360, hier: 334f. 9. Grundlegend erforscht von Timothy W. Mason, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft. Dokumente und Materialien zur deutschen Arbeiterpolitik 1936-1939, Opladen 1975, vgl. Marie-Luise Recker, Nationalsozialistische Sozialpolitik im Zweiten Weltkrieg, München 1985, und Posta, S. 23 10. ebd., S. 142, vgl. auch Heusler, Ausländereinsatz: Zwangsarbeit für die Münchner Kriegswirtschaft 1939-1945, München 1996, S. 422ff. 11. Dokumentiert in der Wanderausstellung „… das Allerletzte an Arbeitsleistung herauszuholen“ – Fremd- und Zwangsarbeit in Sachsen 1939 – 1945, Gemeinschaftsausstellung der Sächsischen Staatsarchive in sächsischen Städten von 2002 bis 2004. Vgl. den in diesem Zusammenhang entstandenen Begleitband mit Beiträgen ein wissenschaftlichen Kolloquiums (s. Anm. 1). 12. Speer, S. 548 13. Ebd., S. 234 14. Zit. n. Speer, S. 235 15. Zu den Zahlen vgl. Posta, S. 67f. 16. Speer, S. 548 17. „Deutsche, die Ausländer mit der Peitsche antrieben und züchtigten, waren keine Seltenheit“, Spoerer, S. 260 18. Im Zweiten Weltkrieg bezeichnete der Begriff Zivilarbeiter aus den „ehemals sowjetischen Gebieten“, aus Rußland, Weißrußland und der Ukraine. Zur grundsätzlichen Definition vgl. Ulrich Herbert, Fremdarbeiter – Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in der Kriegswirtschaft, Essen 1985, zit. n. Neuauflage Bonn 1999, S. 437. Eine pragmatische Definition des Oberbegriffs „Zwangsarbeiter“ bietet Spoerer an: Jene, die „das Arbeitsverhältnis nicht lösen konnten und ‚fern der Heimat′ eingesetzt waren.“ (Zwangsarbeit im Dritten Reich – Fakten und Zahlen, www.uni-hohenheim.de 2003) 19. Nach 1943 20. Beispiele dokumentiert eindrucksvoll die Ausstellung „… das Allerletzte an Arbeitsleistung herauszuholen“ (wie Anm. 10). 21. Posta, S. 48 22. Mai verweist darauf, daß intime Kontakte mit Deutschen eigentlich allen Ausländern verboten waren, aber nie Ausführungsbestimmungen erlassen wurden. Mit Todesstrafe waren zunächst nur Polen, ab 1942 auch Russen bedroht (wie Anm. 1, S. 33, Anm. 24). 23. Dem widerspricht nicht, daß es für Russen nach 1942 zu gewissen Erleichterungen hinsichtlich der Reglementierung ihrer Lebens- und Arbeitswelt kam (vgl. Mai, S. 34). Vielmehr gilt Andreas Heuslers mit Blick auf die relativ gute Behandlung durch viele Unternehmer und Betriebsleiter getroffene Feststellung: „Daß derartige Bemühungen um menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht einzig durch humanitäre Impulse, sondern auch durch pragmatische, »arbeitseinsatztechnische« Überlegungen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und Arbeitsfreude der Ausländer angeregt wurde, ist als sicher anzunehmen.“ (Wie Anm. 9, S. 424) 24. Herbert, S. 284, vgl. Spoerer, S. 178 25. Posta, S. 92. Welchen Terror die „mörderische Untergangsdynamik des NS“ (Posta, S. 91) hervorrief und wie sie damit in der letzten Kriegsphase zu einer erheblichen Verschlechterung der Lage aller „Fremdarbeiter“ beitrug, haben besonders Gabriele Lotfi (KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich, Stuttgart 2000, S. 267-79) und Ulrich Herbert (S. 264-69, 288-94, 327-35) dokumentiert. 26. ebd., S. 91 27. Vgl. Spoerer, S. 190 28. Etwa Steven Spielbergs „Survivors of the Shoah – Visual History GmbH“, deren erstes Projekt in Deutschland in der CD-ROM nebst Handbuch „Erinnern für Gegenwart und Zukunft“, Berlin 2000, Früchte getragen hat. – Noch dichter am hier besprochenen Thema: Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg.), „Totaleinsatz“ – Zwangsarbeit in Berlin 1943-1945. Tschechische ZeitzeugInnen erinnern sich. Briefdokumentation der Projektgruppe „Vergessene Lager – vergessene Opfer. ZwangsarbeiterInnen in Berlin 1939-1945“, Berlin 1998 29. Ein Projekt der Brücke/Most-Stiftung zur deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit und des Koordinierungszentrums deutsch-tschechischer Jugendaustausch, Tandem, gefördert aus dem Fonds „Erinnerung und Zukunft“ der Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, wird ab 2003 tschechische Zeitzeugen an deutschen Schulen berichten lassen und so einen Beitrag zur lebendigen Vermittlung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges leisten. Zwei Jahre lang werden an deutschen Schulen zusammen etwa 90 Begegnungen stattfinden. Kontakt: [email protected] 30. Stellvertretend für viele seien die Arbeiten Lutz Niethammers genannt, etwa – als Herausgeber – „Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis“. Die Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985. Für den Geschichtsunterricht auch im Blick auf diesen Ansatz noch immer hilfreich: Klaus Bergmann u. a., Handbuch der Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber 1997. 31. Dazu liegen interessante Arbeiten und methodische Überlegungen von Cord Pagenstecher vor: „Privatfotos ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter – eine Quellensammlung und ihre Forschungsrelevanz, in: Winfried Meyer/Klaus Neitmann (Hrsg.), Zwangsarbeit während der NS-Zeit in Berlin und Brandenburg. Formen, Funktion, Rezeption. Potsdam 2001, S. 223-246“ und „Erfassung, Propaganda und Erinnerung. Eine Typologie fotografischer Quellen zur Zwangsarbeit, in: Wilfried Reinighaus (Hrsg.), Zwangsarbeit in Deutschland 1939 bis 1945. Archiv- und Sammlungsgut, Topographie und Erschließungsstrategien, Münster 2001, S. 252-264. 32. Z. B.: Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg.), Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte. Zur Theorie und Praxis der Alltagsgeschichte, Münster 1994