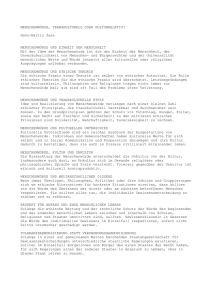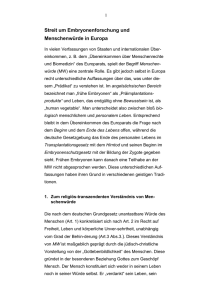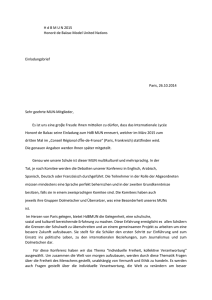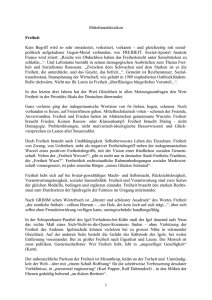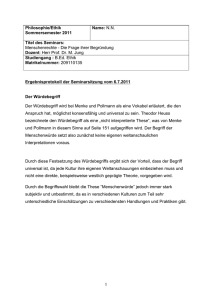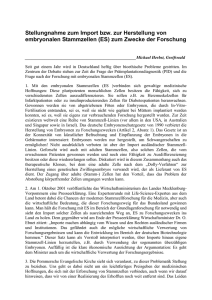Bioethik zwischen Norm- und Nutzenkultur - Ruhr
Werbung
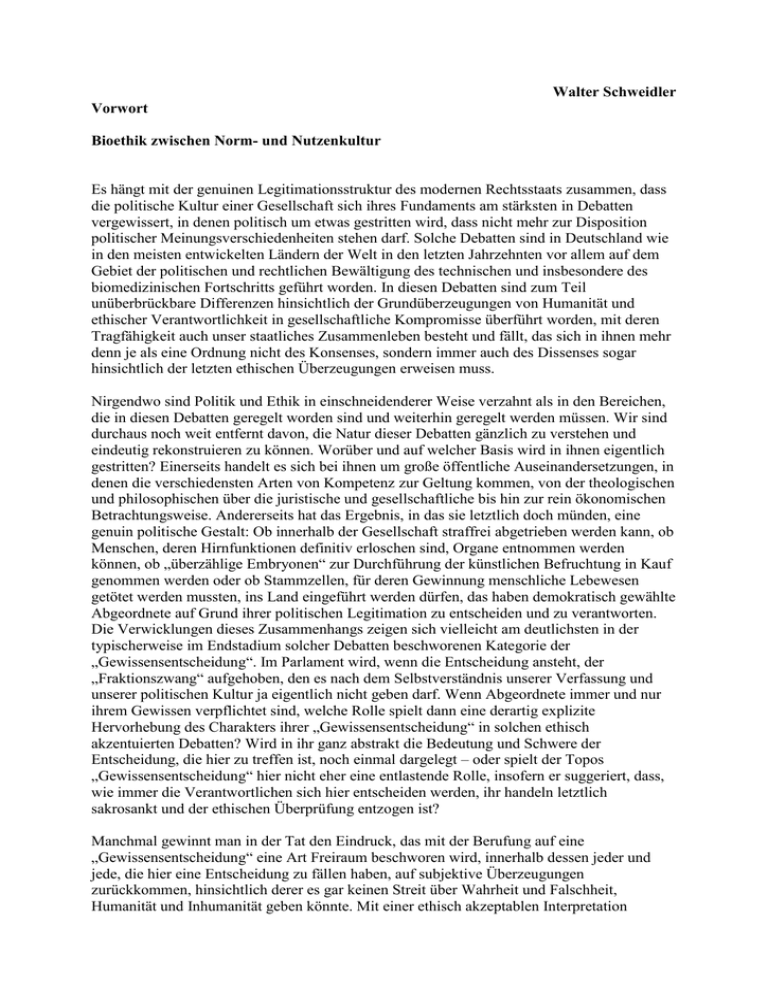
Walter Schweidler Vorwort Bioethik zwischen Norm- und Nutzenkultur Es hängt mit der genuinen Legitimationsstruktur des modernen Rechtsstaats zusammen, dass die politische Kultur einer Gesellschaft sich ihres Fundaments am stärksten in Debatten vergewissert, in denen politisch um etwas gestritten wird, dass nicht mehr zur Disposition politischer Meinungsverschiedenheiten stehen darf. Solche Debatten sind in Deutschland wie in den meisten entwickelten Ländern der Welt in den letzten Jahrzehnten vor allem auf dem Gebiet der politischen und rechtlichen Bewältigung des technischen und insbesondere des biomedizinischen Fortschritts geführt worden. In diesen Debatten sind zum Teil unüberbrückbare Differenzen hinsichtlich der Grundüberzeugungen von Humanität und ethischer Verantwortlichkeit in gesellschaftliche Kompromisse überführt worden, mit deren Tragfähigkeit auch unser staatliches Zusammenleben besteht und fällt, das sich in ihnen mehr denn je als eine Ordnung nicht des Konsenses, sondern immer auch des Dissenses sogar hinsichtlich der letzten ethischen Überzeugungen erweisen muss. Nirgendwo sind Politik und Ethik in einschneidenderer Weise verzahnt als in den Bereichen, die in diesen Debatten geregelt worden sind und weiterhin geregelt werden müssen. Wir sind durchaus noch weit entfernt davon, die Natur dieser Debatten gänzlich zu verstehen und eindeutig rekonstruieren zu können. Worüber und auf welcher Basis wird in ihnen eigentlich gestritten? Einerseits handelt es sich bei ihnen um große öffentliche Auseinandersetzungen, in denen die verschiedensten Arten von Kompetenz zur Geltung kommen, von der theologischen und philosophischen über die juristische und gesellschaftliche bis hin zur rein ökonomischen Betrachtungsweise. Andererseits hat das Ergebnis, in das sie letztlich doch münden, eine genuin politische Gestalt: Ob innerhalb der Gesellschaft straffrei abgetrieben werden kann, ob Menschen, deren Hirnfunktionen definitiv erloschen sind, Organe entnommen werden können, ob „überzählige Embryonen“ zur Durchführung der künstlichen Befruchtung in Kauf genommen werden oder ob Stammzellen, für deren Gewinnung menschliche Lebewesen getötet werden mussten, ins Land eingeführt werden dürfen, das haben demokratisch gewählte Abgeordnete auf Grund ihrer politischen Legitimation zu entscheiden und zu verantworten. Die Verwicklungen dieses Zusammenhangs zeigen sich vielleicht am deutlichsten in der typischerweise im Endstadium solcher Debatten beschworenen Kategorie der „Gewissensentscheidung“. Im Parlament wird, wenn die Entscheidung ansteht, der „Fraktionszwang“ aufgehoben, den es nach dem Selbstverständnis unserer Verfassung und unserer politischen Kultur ja eigentlich nicht geben darf. Wenn Abgeordnete immer und nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, welche Rolle spielt dann eine derartig explizite Hervorhebung des Charakters ihrer „Gewissensentscheidung“ in solchen ethisch akzentuierten Debatten? Wird in ihr ganz abstrakt die Bedeutung und Schwere der Entscheidung, die hier zu treffen ist, noch einmal dargelegt – oder spielt der Topos „Gewissensentscheidung“ hier nicht eher eine entlastende Rolle, insofern er suggeriert, dass, wie immer die Verantwortlichen sich hier entscheiden werden, ihr handeln letztlich sakrosankt und der ethischen Überprüfung entzogen ist? Manchmal gewinnt man in der Tat den Eindruck, das mit der Berufung auf eine „Gewissensentscheidung“ eine Art Freiraum beschworen wird, innerhalb dessen jeder und jede, die hier eine Entscheidung zu fällen haben, auf subjektive Überzeugungen zurückkommen, hinsichtlich derer es gar keinen Streit über Wahrheit und Falschheit, Humanität und Inhumanität geben könnte. Mit einer ethisch akzeptablen Interpretation dessen, was „Gewissen“ heißt, hätte dies natürlich nichts mehr zu tun. Das Gewissen, so hat es Augustinus definiert und so ist es der Sache nach noch bei Kant und bis heute immer gesehen worden, ist „das sittliche Gesetz, insofern es in unsere Brust geschrieben ist“. Das heißt, das jede moralisch relevante Entscheidung auf der Anstrengung des Gewissens aufruht. Wenn man in einem konkreten Fall unter dem Titel „Gewissensentscheidung“ diesen Aspekt besonders hervorhebt, dann kann das in der Sicht der philosophischen Definition des Gewissens nur eines bedeuten, nämlich, dass das sittlich gebotene Handeln den Handelnden in einen Konflikt mit anderweitigen Verpflichtungen führt. Das klassische Beispiel bei Thomas von Aquin ist die Frau, die ihren Mann vor dem Richter versteckt und zwischen ihrer Verpflichtung für das Wohl der Familie und dem Gebot des Gesetzes eine Entscheidung finden muss. Wer sich in seinem Handeln auf sein Gewissen beruft, entlastet sich deshalb in keinem Fall von der Pflicht der ethischen Rechtfertigung seines Handelns, sondern er erlegt sich höchstens eine zusätzliche Bürde auf. Denn seinem Gewissen zu folgen, ist selbst eine sittliche Pflicht, so dass man, wenn das eigene Gewissen dem ethisch gebotenen Handeln widerspricht, eigentlich nur noch schlecht handeln kann, weil man entweder das falsche tun oder sein Gewissen verraten muss. Was aber das sittliche Gebot ist, was in einer Entscheidungsfrage falsch oder richtig, human oder inhuman bedeutet, das ist ja eben das Thema jener großen öffentlichen Debatten, in denen zu Recht darüber gestritten wird, wie die Gewissensentscheidung der politisch Verantwortlichen ausfallen soll. Aber selbstverständlich lassen sich die Auseinandersetzungen, die in den Gesprächen dieses Bändchens dokumentiert sind, philosophisch nicht einfach so lösen, dass man aus einem angeblichen Kanon bestimmter Inhalte des „Sittengesetzes“ gewissermaßen ethisch deduziert, welches die richtige Entscheidung in so schwierigen Konfliktbereichen sei. Gerade zu den biomedizinischen und bioethischen Themen gibt es verschiedene einander teilweise völlig entgegengesetzte ethische Standpunkte, und selbst, wenn man auf Grund einsichtiger Abwägung des Für und Wider zu einem eindeutigen Ergebnis hinsichtlich der Bewertung bestimmter in Frage stehender Handlungsweisen kommt, erhebt sich immer noch die Frage nach den Grenzen, in denen der Staat das moralisch gebotene mit Hilfe juristischer Gesetze durchzusetzen legitimiert ist. Es ist wichtig, zu sehen, das gerade in den Debatten der jüngsten Zeit über bioethische Probleme nicht immer nur einfach über die richtige ethische Betrachtungsweise in Frage stehender Konflikte, sondern oft auch über die Grenzen und Möglichkeiten gestritten wird, an denen sich das staatliche Handeln auszurichten hat, wenn es per Gesetzgebung in das Leben der Bürger eingreift. Die Abtreibungsfrage ist das eklatanteste Beispiel dafür, wie ein ethischer Streit über die Erlaubtheit der Tötung menschlichen Lebens auf der rechtstheoretischen Ebene der Reflexion über die Durchsetzbarkeit staatlicher Strafgebote entschieden bzw. einem mehr oder weniger dilatorischen Kompromiss zugeführt worden ist. Den Herausgebern dieses Bändchens scheint die Frage, welcher Art eigentlich eine Debatte wie die, welche sich in den letzten Jahren um die Möglichkeiten der Stammzellforschung und die Probleme des Embryonenschutzes in Deutschland und Europa ergeben hat, sei, so klärungsbedürftig, das sie eben aus diesem Grunde das Gespräch selbst in seiner Eigenart möglichst kongenial zu dokumentieren versuchen. Die Gespräche fanden um die Jahreswende 2001/2002 in einer Situation statt, in der die parlamentarische Entscheidung um die Zulassung der Einführung von Stammzellen zur Forschung nach Deutschland getroffen und gerechtfertigt werden musste. Es erschien den Herausgebern sinnvoll, die in diesen Gesprächen vorgetragenen Erwägungen in dieser für die konkrete Gestaltung der parlamentarischen Entscheidung relevanten Situation festzuhalten und die Verbindung zwischen grundsätzlicher Begründung und konkretem Entscheidungsbezug, die in ihnen gezogen ist, für die künftigen und der Sache nach wahrscheinlich noch zugespitzten Etappen des Streites um die rechtliche Bewältigung der Probleme des biomedizinischen Fortschritts fruchtbar zu machen. Die Gespräche bewegen sich entlang einer Grenzlinie, die für die gesamte künftige Entwicklung der politischen Kultur in modernen Verfassungsstaaten von charakteristischer Bedeutung sein wird. Man kann sie ohne Übertreibung als eine kulturelle Spaltung innerhalb der entwickelten modernen Gesellschaften bezeichnen. Es handelt sich bei ihr um ein schon insofern höchst interessantes Phänomen, als diese Spaltungsdynamik den kulturellen Vereinheitlichungstendenzen, wie sie eigentlich für die internationale „Globalisierung“ charakteristisch sind, entgegengesetzt ist. Während ethnische, nationale und religiöse Kulturen sich ungeachtet aller retardierenden Momente einem immer größer werdenden Vereinheitlichungsdruck ausgesetzt sehen, klaffen innerhalb der modernen Gesellschaften Gegensätze zwischen Lagern auf, die man als „ethische“ Kulturen bezeichnen könnte; das heißt, der gesellschaftliche Konsens gerät in eine Zerreißprobe zwischen Grundüberzeugungen von Humanität und zwischenmenschlicher Verpflichtung, die einander in ihrem Kern so entgegengesetzt sind, dass sie hinsichtlich wesentlicher moralischer Konfliktfragen zu diametral entgegengesetzten Ergebnissen führen, durch welche die Träger der gesellschaftlich relevanten Handlungs- und Entscheidungssysteme quer zu allen professionellen, ideologischen und religiösen Identitäten getrennt werden und durch die jene für jede politische Kultur so entscheidende „Einigkeit über das Unabstimmbare“ verloren zu gehen droht. Es gibt eine Tendenz zur sozialen und kulturellen Teilung entlang mentaler Grenzlinien, die sehr konkrete Konsequenzen für die politischen und vor allem die rechtlichen Institutionen hat, weil sie den Citizens’ Rights and the New Technologies: A European Challenge. Report of the European Group on Ethics in Science and New Technologies on the Charter on Fundamental Rights related to technological innovation as requested by President Prodi on February 3, 2000 in: Biomedical Ethics, vol. 5 (2000), No. 2, 52-62, 54. ethischen Konsens in Frage stellt, der für die institutionelle Stabilität jeder politischen und insbesondere der demokratischen Ordnung ausschlaggebend ist. Entscheidend ist dabei, das der intrakulturelle Streit in dieser Hinsicht die tragenden begrifflichen Fundamente der modernen Verfassungsstaatlichkeit verfasst hat, nämlich die Ideen der Menschenrechte, der Menschenwürde und der politischen Freiheiten, wie sie im modernen Staat als dem politischen Streit entzogene Vorgegebenheiten betrachtet werden. Schon jetzt haben sich Tendenzen tiefer Inkonsistenz und Widersprüche innerhalb der Normen, durch die das gesellschaftliche Zusammenleben und die Verantwortlichkeit für die Bewahrung der Grenzen der Humanität getragen werden, eingestellt. Der Unfrieden in demokratischen Gesellschaften könnte gerade in der Zukunft mehr durch diese intrakulturellen Differenzen, die man zunehmend über die verschiedensten geographischen Regionen der Welt hinweg wiederfindet, als durch interkulturelle Streitigkeiten geprägt werden. Man kann diese kulturelle Spaltung als einen Konflikt zwischen einer Norm- und einer Nutzenkultur charakterisieren. Die Prinzipien unserer geschriebenen Verfassungen und der internationalen Konventionen, die sich auf Menschenwürde und Menschenrechte berufen und die die Gesellschaft als die Organisation des Respekts und des Schutzes aller menschlichen Wesen gegen jeden Versuch zur Teilung der Menschheit verstehen, basieren auf unteilbaren Normen, die als Grundlage des Zusammenlebens aller Menschen auf der Welt angesehen werden. Die Idee einer derartigen Normkultur geht davon aus, dass es eine Verbindung zwischen allen Angehörigen des Menschengeschlechts gibt, die es uns verbietet, irgendeinen Angehörigen der Menschheit daraufhin zu beurteilen, ob sein Leben es „wert“ ist, gelebt zu werden oder ob es für anderes menschliches Leben zu opfern oder zu instrumentalisieren sei. Zu einer Normkultur in diesem Sinne bekennt sich auch noch die sogenannte „Bioethik- Konvention“1 des Europarats, in der Menschenrechte und Menschenwürde als die Leitprinzipien der europäischen Gesetzgebung angesehen werden und zu der in einem ihr beigegebenen „Erläuternden Bericht“ ausdrücklich präzisiert wird, dass die Menschenwürde und die Identität des menschlichen Lebewesens „von Beginn des Lebens an“ zu respektieren sind. Eine solche Normkultur ist vorausgesetzt im Bericht des US-Gesundheits- und Bildungsministeriums über die Grenzen der Stammzellforschung, wenn dieser „grundlegenden Respekt“ auch für Embryonen außerhalb des Mutterleibes verlangt. In der universalen Erklärung der Vereinten Nationen über das menschliche Genom und die Menschenrechte von 1998 wird festgehalten, dass das Prinzip der Menschenwürde es unbedingt gebietet, „Individuen nicht auf ihre genetischen Eigenheiten zu reduzieren und ihre Einmaligkeit und Diversität zu respektieren“.2 Und im Bericht der „European Group on Ethics in Science and New Technologies“ für den Entwurf einer europäischen Grundrechtecharta werden als spezifische Gefahrenfaktoren, die für die Bewahrung der Grundrechte der europäischen Bürger aus neuen Möglichkeiten und Ergebnissen der molekulargenetischen und biotechnologischen Forschung folgen, insbesondere „die Instrumentalisierung menschlicher Wesen durch genetische Manipulation“, „neue Formen der Diskriminierung auf Grund des Wissens über die genetischen Eigenschaften von Menschen“ und „die Kommerzialisierung des menschlichen Körpers“ genannt.3 In einer Normkultur kann es ihrem Selbstverständnis nach eine Abstufung oder Relativierung des Schutzes eines menschlichen Wesens zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Existenz nicht geben. Die gesamte Brisanz der bioethischen Debatte, die in den hier versammelten Gesprächsbeiträgen geführt wird, ergibt sich daraus, dass dieser scheinbar selbstverständlichen Berufung auf die Normkultur eben in den fortgeschrittenen Gesellschaften, die sich als ihre rechtlichen und politischen Anwälte betrachten, eine die Realität unseres Zusammenlebens tendenziell immer stärker bestimmende Gegenkraft erwachsen ist, die sich auf konkurrierende, mit der Normkultur in unweigerliche Konflikte führende gegensätzliche ethische Prinzipien und moralische Überzeugungen beruft. Es handelt sich um die Entwicklung zu dem, was man eine „Nutzenkultur“ oder „Kultur der Nützlichkeit“ nennen könnte. Charakteristisch für eine derartige Kultur ist die mehr oder weniger explizite Grundannahme, dass es eine bestimmte „Qualität“ des menschlichen Lebens ist, die es zu etwas schützens- und respektierenswertem macht. In einer Kultur der Nützlichkeit wird das menschliche Leben als ein Vorrat erwünschter Zustände gesehen, um deren Verwirklichung es normalen Exemplaren der menschlichen Art von Natur aus geht; sie sind es, was wir eigentlich fordern, wenn wir unser Recht als Menschen einfordern und einfordern wollen. In dieser Sichtweise kann sowohl ein menschliches Leben als qualitativ „höherwertig“ betrachtet werden als ein anderes, als auch von Zuständen gesprochen werden, in denen zwar ein biologisch als Exemplar der Menschheit zu klassifizierendes Wesen existiert, dies jedoch kein im eigentlichen Sinne „menschliches“ Leben hat und womöglich nie mehr haben kann. In der Konsequenz wird das menschliche Leben in dieser Sichtweise in zwei Teile aufgespalten: Das Leben vollgültiger Personen, die von anderen ihresgleichen respektiert und geschützt werden müssen einerseits und Zonen des menschlichen Lebens, die nicht Personen angehören, sondern eine Art „Rohmaterial“ für die Lebensrettung, Lebensverbesserung und Lebensgestaltung der eigentlichen menschlichen Wesen zur Verfügung stehen können andererseits. In diese letztere Kategorie fallen etwa die Organe der 1 Vgl. Unten S. 69. Vgl. Artikel 2 b) der Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights der UN von 1998. 3 Vgl. „Citizens’ Rights and the New Technologies: A European Challenge. Report of the European Group on Ethics in Science and New Technologies on the Charter on Fundamental Rights related to technological innovation as requested by President Prodi on February 3, 2000“, in: Biomedical Ethics, vol. 5 (2000), No. 2, 5262, 54. 2 für Hirntod erklärten Menschen, die man dringend Hilfsbedürftigen Transplantation überträgt, die bei der künstlichen Befruchtung „anfallenden überzähligen Embryonen“, die zur Forschung und zur Aufbewahrung für bestimmte medizinische Zwecke freigegeben werden können, zu züchtendes Gewebe, Stammzellenmaterial, aber, wenn man die Logik der Denkweise konsequent ernst nimmt, auch die Embryonen und Föten, die einer vorgeburtlichen Untersuchung unterzogen werden, um daraufhin beurteilt zu werden, ob ihr Leben wirklich lebenswert ist oder einem anderen, lebenswerteren zu weichen habe. Überhaupt ist die Frage nach der Grenze zwischen diesen beiden Teilen der Menschheit eines der Hauptprobleme, dem sich die theoretische Reflexion einer solchen Nutzenkultur zu stellen hat. Auf diesem Gebiet und in verschiedenen an es angrenzenden Kernfragen werden nun wiederum eine ganze Reihe verschiedenartiger Debatten geführt, bei denen der theologische, der ethische, der rechtstheoretische und der politische Aspekt oft in schwer nachzuverfolgender Weise ineinander spielen. Die Auseinandersetzung um den Konflikt und auch um die mögliche Vereinbarung zwischen Norm- und Nutzenkultur spielt sich auf so unterschiedlichen Ebenen ab wie der spezifisch philosophischen Debatte um die Natur der menschlichen Personalität und um die Frage, ob alle Menschen Personen seien oder das Personsein nur in einem bestimmten Stadium des Menschseins anzusiedeln wäre, in der juristischen Auseinandersetzung um mögliche Konzepte einer abgestuften Menschenwürde, in der rechtstheoretischen Diskussion darüber, wo die Notwendigkeit der Durchsetzung staatlichen Rechts gegenüber der Selbstbestimmung der Bürger gegebenenfalls zu enden habe, aber auch in der politischen und ökonomischen Diskussion um Wettbewerbsvorteile und Globalisierungszwänge im Umgang mit den Möglichkeiten der neuen biomedizinischen Forschung. Die Herausgabe der in diesem Band vereinigten Gespräche soll einerseits gerade die Vielfalt und Komplexität dieser Gesichtspunkte noch einmal aktuell vor Augen führen und insofern zu ihrer analytischen Differenzierung beitragen, sie soll aber vor allem auch andererseits das Bewusstsein für die gravierenden Probleme schärfen, die sich jenseits aller theoretischen Fragestellungen hier und jetzt für unsere Gesellschaften aus diesem Konflikt zwischen Nutzen- und Normkultur ergeben. Es handelt sich bei ihm keinesfalls um eine akademische Angelegenheit. Die Inkonsistenzen und Widersprüche, die sich hier ergeben, finden sich zunehmend als elementare Probleme gesellschaftlicher Kommunikationsbarrieren, Destabilisierungen politischer Grundwertüberzeugungen, vor allem aber auch konkret greifbarer Rechtsunsicherheit wider. Das menschliche Leben ist nach der deutschen Verfassungsrechtsprechung von der Nidation an geschützt, aber von der Abtreibung bis zur Verwendung von Stammzellen ist dieser Grundsatz mit einer ihrerseits rechtlich geordneten und angeordneten entgegengesetzten Praxis der Gesellschaft konfrontiert. Behindertes menschliches Leben darf nach unserem Grundrechtsverständnis in keiner Weise diskriminiert werden, aber zwei Senate des höchsten deutschen Gerichts kommen zu diametralen gegengesetzten Entscheidungen hinsichtlich der Frage, ob die Geburt eines behinderten Menschen ein Schadensfall sei, der zu finanzieller Kompensation zu führen hat. 4 Ein „menschliches Wesen“ ist nach der Bestimmung der Bioethik-Konvention des Europarats gegen jede Instrumentalisierung für Zwecke, die nicht seiner Erhaltung oder Heilung dienen, geschützt. Aber in Erläuterung dieses Rechtssatzes wird ausdrücklich gesagt, dass die Definition dessen, was ein „menschliches Wesen“ sei und wann es beginne, dem nationalen 4 Vgl. dazu im einzelnen: Eduard Picker: Menschenwürde und Menschenleben. Das Auseinanderdriften zweier fundamentaler Werte als Ausdruck der wachsenden Relativierung des Menschen. Stuttgart 2002, S. 43 ff., S. 195 f. Gesetzgeber überlassen bleibe.5 Ein und dasselbe Lebewesen kann in einem Staat der europäischen Gemeinschaft als Mensch zu betrachten sein, in einem anderen nicht, so wie man auf Grund unterschiedlicher Anwendung der Hirntod-Definition in einem amerikanischen Bundesstaat (juristisch) heute als Leiche und in einem anderen als lebendiger Mensch klassifiziert wird. Gerade in so entscheidenden Lebensfragen kann es natürlich gar nicht anders sein, als dass der nationale Gesetzgeber sich die letzte Entscheidung über die Anwendung bioethischer Standards in seiner Gesetzgebung vorbehalten muss. Zugleich ist wiederum klar, dass durch die finanziellen und ökonomischen Zwänge der „Globalisierung“ der Spielraum der nationalen Gesetzgebung gegenüber Entwicklungen, die durch das Voranschreiten anderer Länder ausgelöst werden, tendenziell geringer wird. Insofern ist eine internationale Regelung der wesentlichen Fragen auf diesem Gebiet, nicht zuletzt aber auch eine konsistente Bestimmung der wichtigsten Begriffe, auf die Gesetze hier rekurrieren müssen, dringend geboten. Walter Schweidler 5 Abschnitt 6 des Explanatory Report zur Bioethik-Konvention vom 17.12.1996 (DIR/JUR (97) 5).