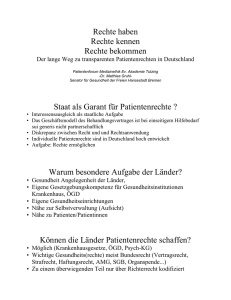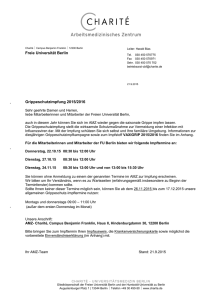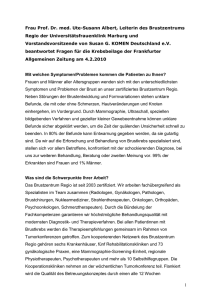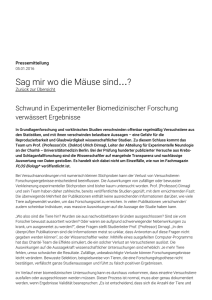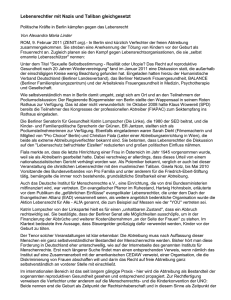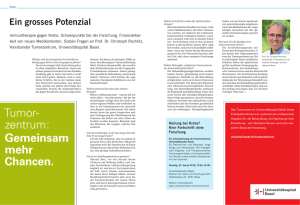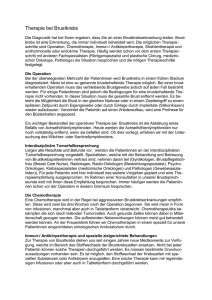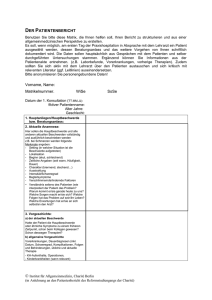Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin auf Große
Werbung
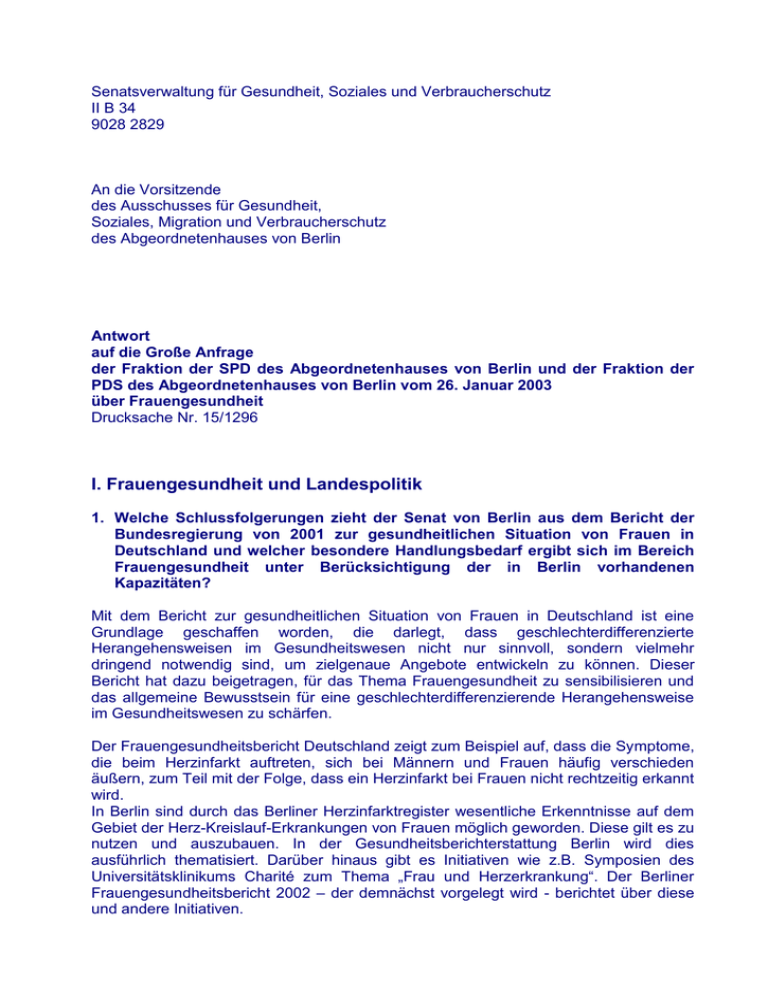
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz II B 34 9028 2829 An die Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Migration und Verbraucherschutz des Abgeordnetenhauses von Berlin Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD des Abgeordnetenhauses von Berlin und der Fraktion der PDS des Abgeordnetenhauses von Berlin vom 26. Januar 2003 über Frauengesundheit Drucksache Nr. 15/1296 I. Frauengesundheit und Landespolitik 1. Welche Schlussfolgerungen zieht der Senat von Berlin aus dem Bericht der Bundesregierung von 2001 zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland und welcher besondere Handlungsbedarf ergibt sich im Bereich Frauengesundheit unter Berücksichtigung der in Berlin vorhandenen Kapazitäten? Mit dem Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland ist eine Grundlage geschaffen worden, die darlegt, dass geschlechterdifferenzierte Herangehensweisen im Gesundheitswesen nicht nur sinnvoll, sondern vielmehr dringend notwendig sind, um zielgenaue Angebote entwickeln zu können. Dieser Bericht hat dazu beigetragen, für das Thema Frauengesundheit zu sensibilisieren und das allgemeine Bewusstsein für eine geschlechterdifferenzierende Herangehensweise im Gesundheitswesen zu schärfen. Der Frauengesundheitsbericht Deutschland zeigt zum Beispiel auf, dass die Symptome, die beim Herzinfarkt auftreten, sich bei Männern und Frauen häufig verschieden äußern, zum Teil mit der Folge, dass ein Herzinfarkt bei Frauen nicht rechtzeitig erkannt wird. In Berlin sind durch das Berliner Herzinfarktregister wesentliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Frauen möglich geworden. Diese gilt es zu nutzen und auszubauen. In der Gesundheitsberichterstattung Berlin wird dies ausführlich thematisiert. Darüber hinaus gibt es Initiativen wie z.B. Symposien des Universitätsklinikums Charité zum Thema „Frau und Herzerkrankung“. Der Berliner Frauengesundheitsbericht 2002 – der demnächst vorgelegt wird - berichtet über diese und andere Initiativen. 2 Der Frauengesundheitsbericht Deutschland hat zudem Themen ins Blickfeld gerückt, die außerhalb der Fachwelt nur wenig Beachtung gefunden hatten, wie z.B. die latente Gefahr der Medikamentenabhängigkeit älterer Frauen, das gesamte Problemfeld häuslicher Gewalt und die Diskussion über den Umgang mit einem vorhandenen Kinderwunsch bei geistig Behinderten. Im Land Berlin hat die Auseinandersetzung mit den damit zusammenhängenden Fragen schon vor geraumer Zeit begonnen; ein Beispiel dafür ist der Arbeitskreis „Sexualität, Partnerschaft und Behinderung“, der vom Landesamt für Gesundheit und Soziales geleitet und moderiert wird und bereits seit 1995 existiert. Er besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der unterschiedlichsten Berliner Institutionen und Beratungsstellen der Behindertenhilfe. Dieser Arbeitskreis hat im November 2000 eine Fachtagung zu diesem Thema veranstaltet und eine Handreichung mit dem Titel „Menschen mit Behinderung als Mütter und Väter!?“ erarbeitet und herausgegeben. Häusliche Gewalt ist ebenfalls ein Thema, das in Berlin ein besonderer Handlungsschwerpunkt ist und bei dem bereits richtungweisende Weichenstellungen – wie mit dem im März 2002 beschlossenen Berliner Aktionsplan zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt - erfolgt sind. Dies wird unter IV. ausführlicher dargestellt. Innovativer Handlungsansätze und Initiativen bedarf es auch für die Gestaltung von Gesundheitsangeboten für Migrantinnen; dies stellt auch der Frauengesundheitsbericht Deutschland fest, der diese Zielgruppe aus verschiedenen Gründen nicht eingehend thematisiert, dies aber als erforderlich und notwendig benennt. Im Berliner Frauengesundheitsbericht wird zur gesundheitlichen Situation von Migrantinnen in Berlin ausführlich Stellung genommen werden. Dies geschieht insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Land Berlin Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten intensiver Auseinandersetzung mit Integrationsfragen zur Verfügung stehen. Die Erkenntnis, dass Gesundheitsangebote und –konzepte für die deutsche Bevölkerung nicht einfach nur übertragen werden können, sondern den jeweiligen kulturellen Kontext berücksichtigen müssen, beinhaltet(e) einen Lernprozess, der keineswegs abgeschlossen ist. Insgesamt hat der Frauengesundheitsbericht Deutschland deutlich gemacht, dass geschlechtersensible Herangehensweisen im Gesundheitswesen in vielen Bereichen noch entwicklungsbedürftig sind; häufig fehlt es bereits an der Erhebung geschlechterdifferenzierter Daten. Der Berliner Frauengesundheitsbericht wird zu dem Schluss kommen, dass ein notwendiger Schritt eine geschlechts- und nationalitätendifferenzierte Datenerfassung in allen Gesundheitsbereichen wäre, um eine geschlechtersensible Aus- und Bewertung konsequent durchführen und etwaige nationalitätenbezogene Abweichungen überhaupt aufspüren zu können. Als ein anzustrebendes Ziel wird der Berliner Frauengesundheitsbericht 2002 die erneute Durchführung eines Gesundheits- und Sozialsurveys für die Berliner Bevölkerung benennen. Damit könnten Entwicklungen im Vergleich zum 1991er Survey gezeigt und insbesondere Fragen der subjektiven Morbidität, zur (Selbst-) Medikation, zum Gesundheitsverhalten, zur Inanspruchnahme von medizinischen und sozialen Angeboten sowie zum Zusammenhang von gesundheitlichen und sozialen Aspekten erkannt und ausgewertet werden. 3 Grundsätzlich wurde mit dem Senatsbeschluss, das Gender Mainstreaming flächendeckend in der Berliner Verwaltung einzuführen, die Voraussetzung dafür geschaffen, dass alle politischen Handlungsfelder systematisch im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit betrachtet werden. Die damit verbundene Entwicklung einer geschlechtssensiblen und –differenzierten Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit stellt einen weiteren Schritt hin zu einer Verbesserung der Berliner Angebotsstruktur im Gesundheitsbereich dar. 2. Welche Initiativen, Anträge und Forderungen zur Frauengesundheit wurden von Berlin in den Jahren 2001 und 2002 im Rahmen der Gesundheits- bzw. Frauenministerkonferenzen der Länder eingebracht, unterstützt und umgesetzt? Im Jahr 2002 wurden von Berlin zwei Anträge in die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und –senatoren der Länder (GFMK) eingebracht und dort einstimmig beschlossen. Es handelt sich im einzelnen um die Anträge “Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen“ und „Gesundheitliche Versorgung gewaltbetroffener Frauen - Forschung“. Ausgehend von Kenntnisdefiziten der im Gesundheitswesen Beschäftigten über die Auswirkungen von Gewalt auf die körperliche und psychische Gesundheit der Frauen und der daraus folgenden defizitären psychischen und medizinischen Versorgung wurden die Bundesministerin für Gesundheit bzw. Einrichtungen des Gesundheitswesens aufgefordert, sich für eine Sensibilisierung der im Gesundheitswesen Beschäftigten, Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte/innen, Leitlinien zur Diagnostik und Versorgung gewaltbetroffener Frauen, die Einarbeitung der Thematik in die Weiterbildungsverordnungen der Ärztekammern, die Erstellung von Informationsmaterialien durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einzusetzen. In einem gesonderten Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Forschungsauftrag zu den gesundheitlichen Folgen von häuslicher und sexueller Gewalt zu vergeben, der auch die Folgekosten für das Gesundheitswesen berücksichtigt. In Berlin ist durch Einwirken der Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Arbeit und Frauen und Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz und durch das Netzwerk Frauengesundheit Berlin das Thema gesundheitliche Folgen von Gewalt gegen Frauen und deren gesundheitliche Versorgung bei der Ärztekammer und den Kassen (insbesondere bei der AOK Berlin) aufgegriffen worden. Es haben bereits entsprechende Maßnahmen (Informationen für Ärzte/innen und Versicherte) stattgefunden. Eine weitere Zusammenarbeit ist geplant. Weiterhin hat das Land Berlin in den Jahren 2001 und 2002 folgende Anträge in die GFMK mit eingebracht oder unterstützt: 4 2001: 1. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, rechtliche Voraussetzungen zur Ermöglichung einer anonymen Geburt als ergänzende Maßnahme zu prüfen. 2. Die GFMK hat eine Resolution zum Thema Fortpflanzungsmedizin gefasst und eine Sonderkonferenz der GFMK zum Thema Fortpflanzungsmedizin beschlossen. 3. Die GFMK hat die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen des Programms „Gesundheitsforschung: Forschung für den Menschen“ einen Kriterienkatalog für geschlechtsspezifische Aspekte bei Gesundheitsforschungsvorhaben zu entwickeln, Gutachtergremien für Projekte des Gesundheitsforschungsprogramms paritätisch zu besetzen und frauenspezifische Aspekte bei Gesundheitsforschungsprogrammen zu finanzieren. 2002: Die GFMK hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gebeten, 1. u. a. die Bundesgesundheitsberichterstattung unter geschlechtsspezifischen Kriterien weiterzuentwickeln. 2. (und das Bundesministerium für Bildung und Forschung), das Prinzip des Gender Mainstreaming bei allen Aktivitäten der Gesundheitspolitik und der Gesundheitsforschung umzusetzen. 3. Informationsmaterial zu den Wechseljahren, das diese Lebensphase insbesondere unter einem gesellschaftlich-kulturellen Blickwinkel betrachtet, entwickeln zu lassen. 4. nationale Maßnahmen zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission empfohlenen Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Brustimplantaten darzulegen. Die Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder (GMK) behandelt die Thematik Frauen und Gesundheit seit Jahren jeweils als eigenen Themenblock. Sie findet daneben aber auch Eingang in Beschlüsse im Rahmen anderer Themenblöcke der GMK. Das Land Berlin hat 2002 einen Antrag zur Einrichtung eines nationalen embryonaltoxikologischen Referenzzentrums eingebracht. Hintergrund des Antrags bzw. Beschlusses der GMK ist, dass das Land Berlin nunmehr die bundesweit einzige spezialisierte Beratungsstelle für Embryonaltoxikologie – EB - betreibt, die von allen Bundesländern in unterschiedlicher Intensität genutzt wird und faktisch als einzige derartige Stelle in Deutschland bereits Dokumentation und Auswertung betreibt und deshalb gemäß dieser Inanspruchnahme zu einem nationalen Referenzzentrum ausgebaut werden sollte. Sie erfüllt damit eine wichtige Funktion für Frauen, die auf die Einnahme von Arzneimitteln in der Schwangerschaft angewiesen sind. Die EB ist Teil des Berliner Betriebs für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben - BBGes. Die EB gehört zu den Gründungsmitgliedern der 1990 eingerichteten europäischen teratologischen Fachgesellschaft ENTIS. Die Kooperation mit anderen EmbryotoxInstituten in Europa, Israel und Nordamerika ist Voraussetzung für ein Frühwarnsystem zur Aufdeckung neuer Teratogene (Substanzen, die Missbildungen verursachen) und für die Präzisierung von Arzneimittelrisiken. 5 Embryotox-Zentren verfügen durch regelmäßige Auswertung aktueller Fachliteratur und eigene wissenschaftliche Forschungsarbeit über den bestmöglichen Überblick zum aktuellen Kenntnisstand und können diesen für eine individuelle Beratung zusammenfassen. Das Referenzzentrum Embryonaltoxikologie stellt den vor Ort beratenden Fachärzten (Gynäkologen/innen, Humangenetiker/innen, Pränataldiagnostiker/innen), regionalen Beratungsstellen, Giftinformationszentren, Gesundheitsbehörden etc. aktuelle Informationen zur Verfügung. Diese basieren auf regelmäßiger Auswertung einschlägiger Fachliteratur und Kooperation mit anderen Zentren in Europa und erlauben eine Risikoabschätzung auch in seltenen und komplizierten Situationen einer Schwangeren. Sie stellen eine rationale Grundlage dar für Therapieempfehlungen einerseits und für das Management nach Anwendung riskanter Arzneimittel andererseits. Denn nicht selten lässt sich in der Praxis beobachten, dass notwendige Behandlungen unterbleiben oder unzureichend erprobte Arzneimittel verordnet werden oder nach bereits erfolgter Medikation erwünschte und intakte Schwangerschaften abgebrochen werden oder überzogene Diagnostik aus Furcht vor vermeintlicher Arzneimittelschädigung praktiziert wird. Fehlentscheidungen solcher Art verursachen nicht nur unnötiges Leiden, sondern auch immense vermeidbare Kosten. Die EB trägt durch individuelle Beratung und Fachöffentlichkeitsarbeit z.B. mittels des von dort herausgegebenen Lehrbuchs Schaefer/Spielmann „Arzneiverordnung in der Schwangerschaft und Stillzeit“ für Ärztinnen/Ärzte und Apotherkerinnen/Apotheker konkret dazu bei, äußerlich verursachte Missbildungen zu verhüten und Schwangerschaftsabbrüche und überzogene Diagnostik Risikoüberschätzung zu vermeiden. aufgrund von Die Dokumentation und wissenschaftliche Auswertung beratener Schwangerschaften über die Geburt hinaus ist Bestandteil des Konzepts eines Referenzzentrums und stellt neben der Beratungstätigkeit eine ebenso wichtige Aufgabe dar. Denn zu den meisten heute verfügbaren Medikamenten und auch zu Schadstoffen in der Umwelt und am Arbeitsplatz gibt es keine oder nur unzureichende Informationen zu Auswirkungen auf die Schwangerschaft bzw. auf die embryonale Entwicklung. Da keine anderen Institutionen systematisch Auswirkungen von Arzneimitteln bei Schwangeren und Stillenden beobachten, sind Embryotox-Zentren eine einmalige Datenquelle zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit in diesem Bereich. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als nationale Zulassungsbehörde für Arzneimittel – BfArM - sieht daher einen dringenden Kooperations-Bedarf mit der Berliner Embryonaltoxikologie. Durch den Ausbau der Einrichtung erwartet man eine größere Datenbasis, die präzisere Angaben zum Arzneimittelrisiko erlaubt und mittels derer aufkommende Verdachtsmomente gegen einzelne Arzneimittel fundierter widerlegt oder bestätigt werden können. 6 Ziel des Antrags war es, die jahrelangen Erfahrungen der Berliner Beratungsstelle zu erhalten und sie einfließen zu lassen in ein nationales Referenzzentrum. Es soll ein Finanzierungskonzept für diese Einrichtung erarbeitet werden, an dem sich die anderen Bundesländer beteiligen sollen. Der Bund prüft, ob finanzielle Mittel zugewiesen werden können auf der Grundlage eines Werkvertrages, wenn das Referenzzentrum Aufgaben für das BfArM erfüllt. So könnte die systematische Erfassung und Dokumentation von Risiken der Arzneimittelanwendung in der Schwangerschaft, das Erstellen von Arzneimittelprofilen, besondere Anfragen zu Arzneimittelgruppen und eine systematische Zusammenarbeit mit Fehlbildungsregistern zu einer erhöhten Sicherheit bei der Arzneimittelanwendung in der Schwangerschaft führen. Wenn 2003 keine Aussicht auf ein länderübergreifendes Finanzierungskonzept beschlossen und die EB geschlossen würde, gäbe es in Deutschland keine Einrichtung mehr, die Arzneimittelnebenwirkungen auf die vorgeburtliche Entwicklung systematisch registriert und Rat beim Management von potentiell riskanten Einwirkungen in der Schwangerschaft gibt. Das wäre (im ohnehin noch unzureichend erforschten Bereich der Arzneimittelsicherheit des Kindes) wissenschaftlich untragbar und präventionsmedizinisch ein Rückschritt. Das bevölkerungsreichste Land Europas wäre dann international nicht mehr in diesem Bereich vertreten. Die GMK hat außerdem in den Jahren 2001 und 2002 diverse Anträge zum Thema Frauengesundheit beschlossen, die vom Land Berlin unterstützt wurden. Bei der Umsetzung der Beschlüsse ist zu berücksichtigen, dass sich der weitaus überwiegende Teil an das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung bzw. an Bundesgremien im Rahmen der Selbstverwaltung richtet, da hier überwiegend auf bundesgesetzlich zu regelnde Umstände Einfluss genommen werden soll. Insofern ergibt sich aus den Beschlüssen der GMK nur gelegentlich eine unmittelbare Handlungsverantwortung für das Land Berlin. Das Land Berlin beteiligt sich selbstverständlich an der verbindlichen Arbeit länderübergreifender Gremien, aber auch z.B. in der länderoffenen Arbeitsgruppe der GMK „Bioethik und Recht“, die sich u.a. mit Fragen der Präimplantationsdiagnostik befasst. Eine Erfolgskontrolle über die Umsetzung aller GMK – Beschlüsse erfolgt zur jeweils nächsten GMK. Nicht in jedem Fall kann aber zu diesem Zeitpunkt bereits festgestellt werden, dass das Ziel des jeweiligen GMK-Beschlusses erreicht ist. In solchen Fällen werden jedoch auf Antrag auch weiter zurückliegende GMK-Beschlüsse erneut einer Erfolgskontrolle unterworfen und gegebenenfalls erneute Beschlüsse in späteren Konferenzen gefasst. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung eines qualitätsgestützten Mammographie-Screenings und die adäquate Behandlung von Brustkrebs, die die GMK seit mehreren Jahren beschäftigen. Aufgrund der Vielzahl der zum Thema Frauengesundheit gefassten GMK-Beschlüsse und der Vielzahl der Adressaten der Beschlüsse werden im Folgenden neben den Beschlüssen der GMK, die vom Land Berlin unterstützt wurden, nur diejenigen Umsetzungsstände mitgeteilt, bei denen die Länder und somit das Land Berlin Adressaten des jeweiligen GMK-Beschlusses sind. 2001: 7 1. Die GMK hat die Bundesregierung aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen zur Ermöglichung einer anonymen Geburt für besondere Notfälle als ergänzenden Bestandteil eines ganzheitlichen Hilfeangebots zu schaffen. 2. Die GMK hält es für notwendig, geschlechtsspezifische Aspekte von Gesundheit und Krankheit als Voraussetzung für eine qualitätsgesicherte, wirksame Diagnostik und Behandlung zu berücksichtigen, Angebote der Prävention verstärkt geschlechtsspezifisch auszurichten und die Gesundheitsberichterstattung verstärkt nach Geschlecht zu differenzieren. Sie hält eine Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildungsinhalte in den Gesundheitsberufen für notwendig und hat an die Forschungseinrichtungen appelliert, geschlechtsspezifische Fragen zu unterschiedlichen Ausprägungen von Krankheitsentstehung, -verlauf und –behand-lung stärker zu berücksichtigen. Umsetzungsstand im Land Berlin: Geschlechtsspezifische Aspekte von Gesundheit und Krankheit wurden auch schon in der Vergangenheit bei Angeboten der Prävention berücksichtigt. Verschiedene Beispiele werden im in Kürze vorliegenden Frauengesundheitsbericht Berlin dargestellt. Auch in Zukunft wird der Senat im Rahmen seiner Einflussmöglichkeiten darauf hinwirken, dass geschlechtsspezifische Aspekte bei Präventionsangeboten angemessen berücksichtigt werden. Im Rahmen der Berliner Gesundheitsberichterstattung (GBE) werden alle verwendeten Indikatoren – z.B. zu den Themen Gesundheitszustand, -verhalten, ambulante und stationäre Versorgung, Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen – geschlechtsspezifisch dargestellt und beschrieben. Auch die soziodemographischen Basisinformationen (z.B. Altersstruktur, Schul- und Ausbildungsabschluss, Einkommen, Erwerbstätige, Arbeitslose) sind nach Geschlecht differenziert. Mit dem Jahresgesundheitsbericht und den Spezialberichten zur Gesundheitsberichterstattung liegen somit regelmäßig Daten vor, die eine geschlechtsspezifische Betrachtung ermöglichen. Für die Inhalte der Ausbildung z.B. in der Krankenpflege sind in Berlin die Krankenpflegeschulen selbst die für die Curricula Verantwortlichen. Der Senat hat die Krankenpflegeschulen gebeten, den Beschluss der GMK bei der Weiterentwicklung der Curricula zu berücksichtigen. Bezüglich der Forschung wird auf den Teil II. verwiesen. 3. Die GMK hat die Bundesregierung gebeten, im Rahmen des Gesundheitsforschungsprogramms „Forschung für den Menschen“ ausreichende Finanzmittel zu reservieren, um gezielt frauenspezifische Gesundheitsaspekte aufgreifen zu können und dafür Sorge zu tragen, dass Gutachtergremien für Projekte und – verbünde im Forschungsprogramm geschlechtsparitätisch besetzt werden. 4. Die GMK hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gebeten, zur Produktsicherheit von Brustimplantaten und zur medizinisch-ärztlichen Betreuung eine abgestimmte fachliche Einschätzung herbeizuführen und der GMK darüber zu berichten. 5. Die GMK hat das BMG gebeten, sich dafür einzusetzen, dass auch in Deutschland epidemiologische Studien zur Quantifizierung der Nutzen und Risiken einer Hormonersatztherapie (in den Wechseljahren) durchgeführt werden und entsprechende neutrale und sachgerechte Informationsmaterialien zu erstellen und für eine flächendeckende Verbreitung Sorge zu tragen. 8 6. Die GMK hat den Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen ersucht, in die Richtlinien über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung die Untersuchung zur Früherkennung des Gestationsdiabetes mellitus einzubeziehen. 7. Die GMK hat das BMG gebeten, die Ausbildungslage in der Krankenpflege zu verbessern und die Krankenpflegeausbildung neu zu ordnen. 2002: 1. Die GMK hat die AG der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften gebeten, einen Leitfaden und qualitätssichernde Standards für die Diagnostik und Versorgung für die gesundheitliche Versorgung von „häuslicher Gewalt“ betroffener Frauen und Kinder zu erstellen und zu veröffentlichen. Weiterhin hat die GMK die Bundesministerin für Bildung und Forschung gebeten, die medizinische (auch psychosoziale) Versorgung der von „häuslicher Gewalt“ betroffenen Frauen und Kinder zu einem Forschungsschwerpunkt zu machen und vermehrt entsprechende Forschungsaufträge zu vergeben. Die GMK hat die Ärztekammern gebeten, diese Problematik bei der geplanten Überarbeitung der Weiterbildungsordnung und in der ärztlichen Fortbildung zu berücksichtigen. Umsetzungsstand in Berlin: S. Ausführungen zu Teil IV. 2. Die GMK hat das BMG gebeten, darauf hinzuwirken, dass eine hohe Qualität in Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs flächendeckend auf der Basis evidenzbasierter Leitlinien gewährleistet wird. Für den Fall, dass die Selbstverwaltung bis Ende 2003 ihrer Zusage zur flächendeckenden Einführung des Mammographie-Screenings nicht nachgekommen sein sollte, hat die GMK das BMG aufgefordert, schnellstmöglich die Grundlagen für ein flächendeckendes Mammographie-Screening zu schaffen. 3. Die GMK hat den Bericht des BMG zur Produktsicherheit von Brustimplantaten begrüßt und das Ministerium aufgefordert, die diesbezüglichen Empfehlungen der Europäischen Kommission zeitnah umzusetzen. 4. Im Zusammenhang mit der Befassung zum Thema „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen – Prävention, Früherkennung und Frühförderung müssen verstärkt werden“ hat die GMK für eine Weiterentwicklung der Gesundheitsberichterstattung unter verstärkter Berücksichtigung auch geschlechtsspezifischer Aspekte plädiert. Umsetzungsstand in Berlin: Im Land Berlin werden basierend auf den Einschulungsuntersuchungen Kindergesundheitsberichte veröffentlicht. Die Daten werden geschlechterbezogen z. B. bezogen auf Impfungen oder Übergewicht analysiert. 5. Die GMK hat die Arbeitsgruppe „Prävention, Gesundheitsförderung, Rehabilitation und Sozialmedizin“ der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden gebeten, die Aufnahme der Methode (Säuretests bei Schwangeren) zur Vermeidung von Frühgeburtlichkeit als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung zu prüfen. Die Ergebnisse sollen der diesjährigen GMK vorgelegt werden. 9 3. Wie soll das vom Senat angekündigte stärkere Engagement im Netzwerk Frauengesundheit Berlin konkret aussehen ? Der Senat hat sich von Anbeginn für die Gründung des Netzwerks Frauengesundheit Berlin stark gemacht, das sich nach einjähriger Vorbereitungsphase im Dezember 2001 gegründet hat. In diesem Bündnis mit heute ca. 45 Mitgliedsorganisationen - Vereinen, Verbänden, Behörden, wissenschaftlichen Einrichtungen, Projekten - arbeiten dauerhaft und verbindlich Fachfrauen aus verschiedenen Institutionen (Universitäten, Kliniken, Projekten, Verbänden, Bezirken, Senatsverwaltungen). Vorrangiges Anliegen des Netzwerkes ist es, die gesundheitlichen Belange von Mädchen und Frauen gleichberechtigt in die maßgeblichen Strukturen des Gesundheitswesens und andere die Gesundheit von Frauen beeinflussende Bereiche der Gesellschaft zu integrieren und die gesundheitlichen Chancen von Frauen zu verbessern. Als aktuelle Handlungsfelder mit besonderer Priorität hat das Netzwerk Frauengesundheit Berlin die Themen „Verbesserung der Qualität im Bereich der Brustkrebsfrüherkennung und der kurativen Mammografie“ und die „Sensibilisierung der verschiedenen Bereiche des Gesundheitssystems für die Erkennung von und den Umgang mit den physischen und psychischen Auswirkungen von Gewalterfahrungen bei Patientinnen“ erklärt. Das Thema Gewalt stand bereits in der Gründungsphase des Netzwerks Frauengesundheit Berlin im Blickpunkt: Die Fachtagung „...Als wäre nichts gewesen – der Umgang des Gesundheitswesens mit von Gewalt betroffenen Frauen“ wurde im September 2001 von der ehemaligen Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen in Kooperation mit der Initiative Netzwerk Frauengesundheit Berlin durchgeführt. Zum Thema Brustkrebs beobachtet und forciert das Netzwerk die von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV Berlin) abgeforderte Zertifizierung der Radiologen/innen für eine qualitätsgesicherte Mammographieerstellung. Es führt Gespräche aus Patientinnensicht mit den zuständigen Einrichtungen zum Thema Disease-Management-Programme für Brustkrebs. Dazu wurden Forderungen entwickelt, die bei der Erstellung der Programme (laut Auskunft der KV Berlin ab April 2003) berücksichtigt werden sollen. Außerdem setzt sich das Netzwerk Frauengesundheit Berlin für die Einrichtung zertifizierter Brustzentren in Berlin ein und bietet hierzu, gemeinsam mit ihrer Mitgliedsorganisation „Ärztinnen gegen Brustkrebs e.V.“ an, ein entsprechend den EUSOMA - Richtlinien gestaltetes Vorhaben (Modell) in Berlin durchzuführen. Das o.g. Angebot ist den zuständigen Kassen, der KV Berlin und der Ärztekammer bekannt und wird von allen positiv bewertet. Ein weiteres Anliegen des Netzwerks ist die fachlich-kritische Begleitung des in Kürze erscheinenden Berliner Frauengesundheitsberichts und daraus abzuleitende 10 Handlungsnotwendigkeiten für Berlin. So ist die Fachkompetenz des Netzwerks bereits in die Erarbeitungsphase des Berichts mit eingeflossen. An den Aktivitäten des Netzwerks nehmen Vertreterinnen der Mitgliedsverwaltungen teil und unterstützen auf diese Weise ganz konkret die Arbeit des Netzwerks. Außerdem wird die Geschäftsführung für das Netzwerk von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen sichergestellt. Damit trägt der Senat der besonderen Bedeutung des Netzwerks Frauengesundheit Berlin von Anbeginn an Rechnung. Der Senat wird dies im Rahmen seiner Möglichkeiten auch in Zukunft kontinuierlich tun. II. Frauengesundheit und Forschung 1. Welche Forschungseinrichtungen/-projekte an Berliner und/oder Wissenschaftseinrichtungen beschäftigen Themenstellungen zur Frauengesundheit? Hochschulsich mit Sowohl an der Freien Universität Berlin als auch an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin sowie an der Alice-Salomon-Fachhochschule werden Forschungsarbeiten zur Frauengesundheit durchgeführt. Nach dem wissenschaftlichen Kontext kann bei den Forschungsarbeiten grob zwischen Studien mit überwiegend naturwissenschaftlich-medizinischem und Studien mit eher sozialwissenschaftlichem Hintergrund unterschieden werden: a) Naturwissenschaftlich-medizinische Studien Der Fachbereich „Humanmedizin“ der Freien Universität Berlin und die medizinische Fakultät „Charité“ der Humboldt Universität zu Berlin sowie die Universitätsklinika Charité und Benjamin Franklin greifen in ihren Lehrveranstaltungen und ihren Forschungsarbeiten immer wieder aktuelle medizinische Themen der Frauengesundheit auf. In den einzelnen Kliniken, die aufgrund ihrer Konzeption auf bestimmte frauenspezifische Thematiken spezialisiert sind, werden eine Vielzahl von entsprechenden Forschungsprojekten durchgeführt. Forschungsprojekte zu Aspekten der reproduktiven Gesundheit von Frauen, wozu z.B. die Schwangerschaft, die Geburt oder die ungewollte Kinderlosigkeit gehören, werden aus den Kliniken für Geburtshilfe und Gynäkologie und den Frauenkliniken beider Universitätsklinika initiiert. In der Frauenklinik des Universitätsklinikums Benjamin Franklin existiert seit 2000 ein überregional bedeutendes Endometriosezentrum, das auf der Basis einer Förderung des Deutschen Stifterverbandes eingerichtet werden konnte. Die Behandlung von Brustkrebs steht im Fokus der Forschung der Charité-Klinik für Frauenheilkunde als auch der Frauenklinik am Universitätsklinikum Benjamin Franklin, wobei für die Optimierung von Therapien Spezialistinnen und Spezialisten anderer Fachgebiete z.B. der Radiologie, der Strahlentherapie und der Onkologie hinzugezogen werden. Außerdem existieren zu diesem Thema verschiedene interdisziplinäre Forschungsprojekte, die sozialpsychologische Aspekte von betroffenen Frauen aufgreifen. Am Fachbereich „Humanmedizin“ der Freien Universität werden wissenschaftliche Fragestellungen der Wechseljahre und der Zeit danach umfassend und interdisziplinär behandelt. Besonders hervorzuheben sind die Aktivitäten zum 11 Aufbau einer interdisziplinären klinischen Forschungsgruppe auf dem Gebiet der postmenopausalen Frauengesundheit mit besonderer Berücksichtigung osteologischer Fragestellungen. Eine Kardiologin an der Charité ist auf die Erforschung von Unterschieden in Krankheitsverläufen, Diagnose und Therapie von Herzkrankheiten bei Frauen spezialisiert. Auf ihre Initiative gehen eine Vielzahl von drittmittelgeförderten klinischen Forschungsprojekten zurück. b) Sozialwissenschaftliche Studien Aktuelle Besonderheiten und Entwicklungstrends der gesundheitlichen Lage und Versorgung von Frauen - vor allem mit nationalem und internationalem Bezug spiegeln sich in den wissenschaftlichen Themenstellungen des Institutes für Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität Berlin sowie des Zentrums für Human- und Gesundheitswissenschaften der Berliner Hochschulmedizin (Freie Universität Berlin und Humboldt-Universität Berlin) wider. Darüber hinaus existiert mit dem Berliner Zentrum Public Health (BZPH) ein organisatorischer Rahmen für die interdisziplinäre und interinstitutionelle Koordination der Forschungs- und Lehraktivitäten zur Gesundheitsforschung, die auch der Koordination von wissenschaftlichen Projekten der Frauengesundheit zugute kommt. Z.B. waren an dem 2001 veröffentlichten Frauengesundheitsbericht in Deutschland in einer Verbundstudie 1999 im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Senioren und Frauen aus Berlin Wissenschaftlerinnen der HU (Charité) und der TU beteiligt und haben an seiner Erstellung institutionenübergreifend gearbeitet. Als andere wichtige Arbeitsschwerpunkte wären u.a. Gewalt gegen Frauen, reproduktionsmedizinische, geburtshilfliche und gynäkologische Fragestellungen wie auch Fragen aus der Geschichte der Frauengesundheit zu nennen. Die Forschungsaktivitäten finden ihren Niederschlag im Postgraduiertenstudiengang „Public Health“, in Lehrveranstaltungen im Regelstudiengang Humanmedizin und jüngst in einer gemeinsamen Initiative des Institutes für Gesundheitswissenschaften und der HU (Charité) – in Fortsetzung der Internationalen Frauenuniversität -, einen postgradualen Studiengang „Health and Society“ International Gender Studies Berlin an der Charité als spezialisiertes Lehrangebot zur Frauengesundheit zu etablieren. Weiterhin beschäftigt sich an der Freien Universität der Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie mit seinen Arbeitsbereichen Prävention und psychosoziale Gesundheitsforschung/Geriatrieforschung, Psychologie und Geschichte der Psychologie mit entsprechenden Problemstellungen. Bedeutende drittmittelgeförderte Beiträge leistet ebenfalls die Alice-SalomonFachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Ihre Beiträge befassen sich insbesondere mit der anwendungsbezogenen Analyse frauenspezifischer Versorgungsangebote. Ein Fülle von Studien, die im Rahmen des Berliner Zentrums Public Health erarbeitet wurden, sind z.B. auf der Internetseite der Technischen Universität Berlin (www.TUBerlin.de/bzph) genannt. 12 c) Praxismodell „S.I.G.N.A.L.“ Ein innovatives Praxismodell zur Frauengesundheit ist in Berlin mit dem deutschlandweit einmaligen Projekt „S.I.G.N.A.L.“ zur Prävention von Gewalt an Frauen am Universitätsklinikum Benjamin Franklin 1999 eingeführt worden. Ziel dieses Pilotprojektes ist es, durch Steigerung der Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Gewaltproblem bei Pflegekräften und beim ärztlichen Personal eine verbesserte gesundheitliche Versorgung von Frauen, die misshandelt worden sind, zu erreichen und damit einen Beitrag zur Gewaltprävention zu leisten. Der Name S.I.G.N.A.L. steht als Akronym für konkrete Hinweise, welche Schritte Professionelle der Gesundheitsversorgung unternehmen sollten, um eine adäquate Versorgung gewaltbetroffener Frauen sicherzustellen: Sprechen Sie die Patientin an, signalisieren Sie Ihre Bereitschaft, Interview mit konkreten einfachen Fragen, Grundsätzliche Untersuchung alter und neuer Verletzungen, Notieren und Dokumentieren Sie alle Befunde und Angaben, Abklären des aktuellen Schutzbedürfnisses, Leitfaden mit Notrufnummern und Unterstützungsangeboten. Mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde die wissenschaftliche Begleitforschung vom Institut für Gesundheitswissenschaften an der Technischen Universität durchgeführt (s.a. Teil IV). 2. Wie gedenkt der Senat den geringen Anteil an Professorinnen in den medizinischen Fakultäten zukünftig zu erhöhen und welchen Stellenwert hat dabei das Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses? Durch den Berliner Senat wird dem Anliegen der Gleichberechtigung von Frauen und der Forderung nach Chancengleichheit hohe Priorität eingeräumt. Bezogen auf den universitären Bereich findet das seinen Niederschlag im Berliner Hochschulgesetz und den geltenden Hochschulverträgen. Außerdem wird die Steigerung des Frauenanteils als Variable bei dem Modell der leistungsbezogenen Zuschussverteilung zwischen den Hochschulen berücksichtigt. Daneben gehen das Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und das Berliner Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre auf eine zusätzliche Finanzierung des Senats zurück. Als Konkretisierung der allgemeinen Zielsetzung hat nach dem Berliner Hochschulgesetz jede Hochschule im Rahmen ihrer Selbstverwaltung Frauenförderrichtlinien aufzustellen und zu verabschieden. In diesen Richtlinien, die auch für die medizinischen Fachbereiche gelten, gibt es Zielvorgaben und Verfahrensregelungen für Berufungsverfahren, die zur Erhöhung des Anteils von Professorinnen und der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen NachwuchsPersonals führen sollen. In den vergangenen Jahren war es jedoch trotz der Richtlinien nicht in dem gewünschten Maße gelungen, den Anteil der Professorinnen in der Medizin zu erhöhen. Bedauerlicherweise gelang es nicht bei allen Neubesetzungen, Bewerberinnen zu finden, die die geforderten wissenschaftlichen und praktischen Voraussetzungen für einen Listenplatz erfüllen. 13 Aus diesem Grund haben zielgruppenorientierte Maßnahmen der medizinischen Einrichtungen, die zur Förderung und Anwerbung von weiblichem wissenschaftlichen Nachwuchs beitragen, besondere Bedeutung. Die Nachwuchsförderung in der Charité besitzt vor diesem Hintergrund ein anerkennenswertes Gewicht: Um den Frauenanteil unter den Habilitationen zu steigern, hat die Fakultät ein eigenes Habilitationsstipendienprogramm für Frauen ausgeschrieben. Dieses Programm erhielt den Namen „Rahel-Hirsch-Stipendium“ in Würdigung der ersten Professorin der Charité, Rahel Hirsch (1870-1953). Seit 1997 wurden in mehreren Ausschreibungsrunden insgesamt 22 solcher Stipendien vergeben. Aus dem Berliner Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen, das vom Berliner Senat eingeführt wurde, sind seit 1997 drei C 1 WissenschaftlerinnenStellen an der medizinischen Fakultät Charité und eine C 1 Wissenschaftlerinnen-Stelle am medizinischen Fachbereich der Freien Universität besetzt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Qualifizierungsverfahren an den Medizinischen Fakultäten oft länger dauern als in anderen Fächern, und dass hier C 1Stellen eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren haben. Die Berliner Hochschulen haben insgesamt drei Professuren, die im engeren Sinne die Frauengesundheit als wissenschaftlichen Schwerpunkt abdecken. Als wichtiger Schritt wird insbesondere die Entscheidung der medizinischen Einrichtungen gewürdigt, durch Einrichtung zweier auf Frauengesundheit spezialisierter Professorenstellen die Berücksichtigung dieses Forschungsaspekts zu verstärken: a) Freie Universität Berlin, Fachbereich „Humanmedizin“, Universitätsklinikum Benjamin Franklin, Professur für Frauenforschung und Osteologie, Frau Prof. Dr. Dören b) Humboldt-Universität, medizinische Fakultät Charité: Universitätsklinikum Charité Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung mit Schwerpunkt HerzKreislauf-Erkrankungen, Frau Prof. Dr. Regitz-Zagrosek - Charité c) Technische Universität Berlin - C 3 – Professur für Soziologie insbesondere Gesundheitssoziologie, Frau Prof. Dr. Maschewsky-Schneider Zu deren Aufgaben gehört neben der Vertretung des bereits vorhandenen Forschungsstandes die Analyse und Auswertung von Studien unter dem Gesichtspunkt geschlechtsspezifischer Differenzen in Krankheitsverlauf und Therapie. Ein weiteres Ziel ist es, dass die Kenntnis über geschlechtsspezifische Zusammenhänge im Kontext des sozialen Umfelds Eingang in die klinische Praxis, die Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung sowie in die medizinische Ausbildung findet. 3. Welche Projekte beschäftigen sich im Rahmen des Berliner Programms zur Förderung der Chancengleichheit in Forschung und Lehre mit Problemstellungen der Frauengesundheitsforschung? Projekte zu Problemen der Frauengesundheitsforschung im Rahmen des Berliner Programms zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre: a) Maßnahmen der Hochschulen 14 Hochschule Projekt Humboldt Uni Humboldt Uni Humboldt Uni Förderbetrag 1 Professur für Frauengesundheitsforschung 87.000 € (C3) / Kardiologie (seit 10/2002) Tagung „gender and cardiovaskular disease“ / 10.000 € Geschlechtsspezifische Differenzen bei Herzkrankheiten (1/2003) Internationaler Workshop zur Vorbereitung eines 32.000 € Masterstudienganges: „Health and Society: International Gender-Studies Berlin“ (4/2003) Der medizinische Fachbereich der Freien Universität hat aus diesem Programm die Finanzierung zweier C2 –Stellen erhalten. Eine weitere C2-Stelle mit weiblicher Besetzung wurde im Fachbereich Humanmedizin im Rahmen von Zielvereinbarungen eingerichtet. b) Stipendien auf dem Gebiet der Frauengesundheitsforschung (im Rahmen des Stipendienprogramms) Es wurden aus den Mitteln dieses Programms von der Humboldt-Universität 10 Stipendien an Frauen für Dissertationen und Studien zu Fragen der Frauengesundheit vergeben. 4. Werden die an den medizinischen Fakultäten in Berlin durchgeführten klinischen Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz so angelegt, dass bei arzneilichen Wirkstoffen, die auch bzw. überwiegend bei Frauen zur Anwendung kommen sollen, ausreichende frauenspezifische Daten gewonnen werden können und werden die klinischen Daten im Rahmen von Menschenversuchen geschlechtsdifferenziert erhoben und ausgewertet? Eine generalisierte und standardisierte Erfassung frauenspezifischer Daten ist nach den geltenden gesetzlichen Regelungen für klinische Studien in der Bundesrepublik Deutschland – anders als beispielsweise in den USA – nicht vorgesehen. In der Vergangenheit ist deshalb entsprechenden Kriterien nur in einzelnen Studien Beachtung geschenkt worden. Mit der Einrichtung einer zentralen Erfassungs- und Beratungsstelle für klinische Studien an der Charité wird dieser Problematik zunehmend Rechnung getragen. 5. Nehmen die Ethikkommissionen der Universitätsklinika Einfluss darauf, dass bei den klinischen Prüfungen entsprechende Rahmenbedingungen für geschlechtsdifferenzierte Datenerhebungen gewährleistet sind? In der Vergangenheit war der Einfluss der Ethikkommissionen auf das Studiendesign, was beispielsweise auch die Beachtung frauenspezifischer Aspekte bei der Datenerhebung betrifft, wegen der Forschungsfreiheit des Studienleiters begrenzt. Die erforderlichen Standards, die im Sinne einer „good clinical practice“ bei 15 Studienvorhaben einzuhalten sind, unterliegen in Deutschland – veranlasst durch internationale Entwicklungen – einer am Anfang stehenden methodischen Diskussion in der Wissenschaftsöffentlichkeit. Hierzu hat eine Pilotstudie „Gender & Research Ethic Committees“ begonnen, die auf eine Initiative aus den Niederlanden zurückgeht. In dieser Studie sollen die Ethikkommissionen der Charité und der Ärztekammer im Hinblick darauf befragt werden, ob und wie Gender-Aspekte in ihren Begutachtungen aufgenommen werden. III. Frauengesundheit und Brustkrebs 1. Wie haben sich Melderaten und Qualität der gemeldeten Daten von Brustkrebserkrankungen in Berlin seit Inkrafttreten des Krebsregistergesetzes am 1.1.1995 entwickelt? Ist die Erfassungsrate ausreichend, um für Berlin valide Aussagen zur Inzidenz, regionalen Verteilung und zu Überlebenszeiten zu treffen und können auf der Grundlage der Daten des gemeinsamen Krebsregisters (GKR) auch Schlussfolgerungen zur Inanspruchnahme und zum Stellenwert von Früherkennungsmaßnahmen getroffen werden? Wie bereits der Frauengesundheitsbericht Deutschland festgestellt hat, ist mit der Einrichtung von Krebsregistern in Deutschland ein wichtiger Schritt erfolgt, um eine Datenbasis für die Forschung zur Entwicklung von Krebserkrankungen in Deutschland zu erhalten. Die Qualität eines bevölkerungsbezogenen Krebsregisters ist in erster Linie von der Erfassung aller Krebserkrankungsfälle einer Region (Vollzähligkeit) und der Erhebung aller Angaben zu einem Erkrankungsfall (Vollständigkeit) abhängig. Für wissenschaftlich valide Auswertungen eines Krebsregisters, insbesondere für die Ermittlung von Erkrankungshäufigkeiten, ist eine Vollzähligkeit der Erfassung von mehr als 90% erforderlich. Der Anteil sogenannter DCO-Fälle, d.h. der Fälle, die nur anhand des Leichenschauscheines erfasst werden (death certificate only) und von denen keine ärztliche Meldung vorliegt, soll dabei nicht höher als 10 Prozent liegen. Seit 1995 ist in Berlin eine kontinuierliche Verbesserung der Melderate für Brustkrebs zu verzeichnen. Während aus dem Diagnosejahr 1995 nur knapp 60% der Erkrankungsfälle gemeldet wurden, konnten für die Diagnosejahre 1997-2000 bereits Melderaten von über 90% erreicht werden (für 2001 und 2002 liegen noch keine stabilen Raten vor). Dabei liegen in etwa 20 bis 30% der Fälle jedoch lediglich Leichenschauschein-Informationen vor, d.h. die ärztliche Melderate liegt bei maximal 80%. Von den erwarteten rd. 1.850 Neuerkrankungsfällen pro Jahr (berechnet mittels eines Schätzverfahrens des Robert-Koch-Institutes) wurden dem Gemeinsamen Krebsregister somit nur maximal 1.500 Fälle pro Diagnosejahr im Rahmen der Behandlung gemeldet. Die Qualität der ärztlich gemeldeten Daten ist überwiegend hoch, da in der Regel alle für das Krebsregister erforderlichen Angaben übermittelt werden. Anders sieht es bei den DCO-Fällen aus, bei denen die klinischen Informationen zum Krebsfall, z.B. Diagnosejahr, histologischer Befund, Tumorstadium, Therapie etc., fehlen. Die im Vergleich zu anderen Tumorentitäten (Tumorarten) in Berlin seit einigen Jahren erreichten hohen Erfassungsraten bei Brustkrebs erlauben inzwischen wieder Aussagen zum Inzidenztrend. 16 Eine Analyse der regionalen Verteilung ist aufgrund der beobachteten großen Unterschiede im DCO-Anteil zwischen den Bezirken, die ein Indikator für Vollzähligkeitsunterschiede zwischen den Bezirken sind, gegenwärtig noch nicht sinnvoll. (Bei einem Mittelwert von 25% liegt der DCO-Anteil in den Bezirken zwischen 6 und 54%). Für Überlebenszeitanalysen, die neben den o.g. Voraussetzungen eine Beobachtungszeit von mindestens 5 Jahren nach Diagnosestellung erfordern, können Berechnungen frühestens vom nächsten Jahr an für das Diagnosejahr 1997 durchgeführt werden; Überlebensraten für vor 1990 erfasste Erkrankungsfälle (BerlinOst) liegen vor. Angaben zur Teilnahme an Früherkennungsmaßnahmen sind in den epidemiologischen Daten, die gem. § 2 Krebsregistergesetz von bevölkerungsbezogenen Krebsregistern gespeichert werden dürfen, nicht enthalten. Aussagen zur Inanspruchnahme und zum Stellenwert von Früherkennungsmaßnahmen können aus den Daten des Gemeinsamen Krebsregisters daher nur indirekt gewonnen werden. Entsprechende Indikatoren sind z.B. die Zunahme prognostisch günstigerer Tumorstadien, das vermehrte Auftreten von nichtinvasiven Tumortypen und Mortalitätsraten. Die Identifizierung sog. Intervallkarzinome (nicht erkannte Karzinome) im Krebsregister kann für die Prüfung der Sensitivität von Früherkennungsmaßnahmen genutzt werden. 2. Wie hat sich die Qualität der klinischen Tumordokumentation bei Brustkrebserkrankungen durch die Arbeit des 1998 gegründeten Tumor Zentrum Berlin (TZB) insbesondere in bezug auf Verlauf und qualitative Verbesserungen von Diagnostik, Therapie und Nachsorge entwickelt und welche Fortschritte sind beim „Onkonet“ diesbezüglich zu verzeichnen? Zu dieser Frage ist das Tumor Zentrum Berlin e.V. um eine Stellungnahme gebeten worden, die hier wiedergegeben wird. Das Tumor Zentrum Berlin e.V. hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass an der Beantwortung dieser Frage auch die regionalen Tumorzentren mitgewirkt haben. a) Die klinische Tumordokumentation Eine umfassende klinische Tumordokumentation u.a. bei Brustkrebserkrankungen erfolgt in sechs der sieben regionalen Tumorzentren. Diese EDV-gestützten Dokumentationen erfassen im einzelnen die Diagnostik, Therapie (operative, medikamentöse und strahlentherapeutische Therapie) und Nachsorge des Mammakarzinoms. Vier Zentren (Buch, Moabit, Spandau und Neukölln) dokumentieren mit dem Giessener Tumordokumenationssystem (GTDS). Die Leitstelle des Tumorzentrums Charité erfasst mit Hilfe des TuDok-Systems seit ca. 2 Jahren auch die vom Tumorzentrum UK Virchow gemeldeten malignen Erkrankungen. Das GTDS wird regelmäßig an die neuesten Entwicklungen der Onkologie angepasst. So wurden für Brustkrebserkrankungen neue diagnostische und therapeutische Entwicklungen berücksichtigt. Schlüsselkataloge werden zentral angepasst und bilden somit die Grundlage für vergleichbare Auswertungen. Am Beispiel von vier regionalen Tumorzentren soll im folgenden der aktuelle Stand und die Qualität der Tumordokumentation sowie der Versorgung von Brustkrebspatientinnen detaillierter dargestellt werden. 17 Hervorzuheben ist, dass die von einzelnen Tumorzentren skizzierten kritischen Anmerkungen keine Einzelfallschilderungen sind, sondern die Situation der Tumordokumentation in Berlin insgesamt widerspiegeln. Die Berliner Tumorzentren wurden alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegründet. Exemplarisch hervorzuheben sind die Tumorzentren Berlin-Moabit e.V. und BerlinBuch. Beide Zentren widmen sich seit mehr als 20 bzw. über 10 Jahren einer qualitätsgesicherten und interdisziplinären Versorgung u.a. von Brustkrebspatientinnen auf der Grundlage von (evidenzbasierten) Leitlinien zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms: Alle gesichert diagnostizierten Brustkrebsfälle werden dokumentiert. Tumorzentrum Berlin-Buch Im Tumorzentrum Berlin-Buch wurden im Jahre 2000 ca. 480 primär behandelte Brustkrebspatientinnen registriert. Innerhalb des Tumorzentrums Berlin-Buch wurden die Strukturen zur Umsetzung einer qualitätsgesicherten Brustkrebsversorgung verstärkt. Mit der offiziellen Gründung des Mammazentrums vor drei Jahren wurden die Voraussetzungen geschaffen, um krankhafte Gewebeveränderungen der weiblichen Brust möglichst früh zu erkennen, präzise zu befunden, zu entfernen und adäquat nach zu behandeln. Eine enge Kooperation auch mit niedergelassenen Fachärztinnen/-ärzten und Radiologinnen/Radiologen ist gegeben. Dieses Mammazentrum ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt das erste im Land Berlin, dass auf der Grundlage der Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Mastologie (EUSOMA) arbeitet. Diese definieren die Anforderungen an ein Mammazentrum, an die Qualitätssicherung in der Brusterkrankungsdiagnostik und an die Qualitätssicherung in der Brustkrebsbehandlung. Das Mammateam im Klinikum-Buch konnte 98,5% aller Karzinome bereits vor der Operation durch eine Gewebeprobe sicher nachweisen; bei den nicht tastbaren Karzinomen betrug dieser Anteil 96,3%. Beide Ergebnisse liegen über den von der EUSOMA geforderten Mindeststandards. Im Frühstadium gelang die präoperative feingewebliche Diagnose in 93,2% aller Fälle. Auf der Grundlage dieser histologischen Daten konnte die Operations- und Therapieplanung verbessert und die Zahl unnötiger operativer Eingriffe bei Frauen, die nicht an einem Tumor erkrankt waren (falsch-positive Befunde) verringert werden. Die Zielvorgabe der EUSOMA konnte somit unterschritten werden. Ein weiterer Erfolg ist für Patientinnen mit einer brusterhaltenden Therapie zu verzeichnen: Bei 82% dieser Fälle konnte die Therapie mit einer einzigen Operation abgeschlossen werden. Diese Zahlen sind ein erster Beleg, dass effektive Strukturen und interdisziplinäres Zusammenwirken im Rahmen hoher Qualitätsanforderungen einen Beitrag zum Nutzen der betroffenen Frauen darstellen. Die klinische Dokumentation hat dabei den Stellenwert eines wesentlichen Instruments zur nachhaltigen und nachprüfbaren Qualitätssicherung. Tumorzentrum Berlin-Moabit e.V. Die aufbereiteten Informationen der Tumordokumentation sind hier regelmäßig Bestandteil eines fachübergreifenden Qualitätsmanagements in der interdisziplinären Versorgung u.a. von Brustkrebspatientinnen. Alle Brustkrebspatientinnen mit einer histologisch gesicherten Tumordiagnose werden routinemäßig sowohl im klinischen Register erfasst als auch im Onkologischen Arbeitskreis besprochen. Der Onkologische Arbeitskreis, ein interdisziplinäres Gremium onkologisch erfahrener Ärzte und Ärztinnen aus Abteilungen des Vivantes-Klinikums im Friedrichshain, Facharztpraxen und 18 onkologischen Schwerpunktpraxen tagt wöchentlich. Dadurch kann die Qualität der Diagnostik, Therapie und Dokumentation nicht nur für "schwierige Brustkrebsfälle", sondern auch für die Regelversorgung von Brustkrebspatientinnen gesichert werden. Mit Schließung des Krankenhauses Moabit konzentriert sich seit November 2001 das Engagement des Tumorzentrums Moabit ausschließlich auf die Region Berlin Mitte innerhalb des Vivantes Klinikums im Friedrichshain. Brustkrebspatientinnen aus Krankenhäusern anderer Träger des ehemals etablierten Kooperationsverbundes nehmen aufgrund der Umstrukturierungen an dieser qualitätsgesicherten Versorgungsstruktur nicht mehr teil. Im Jahr 2000 konnte bei mehr als der Hälfte (52%) aller registrierten neu erkrankten Frauen (295) ein Brustkrebs in einem frühen Stadium gesichert diagnostiziert werden. Bei 49% dieser Frauen konnte die brusterhaltende Operation durchgeführt werden. Tumorzentrum Neukölln Im Tumorzentrum Neukölln erfolgt die Diagnostik und Behandlung bei Brustkrebspatientinnen interdisziplinär. Dabei wird jede Brustkrebsneuerkrankung in der zentralen Datenerfassung dokumentiert. Erfasst wird sowohl die Diagnose als auch der Verlauf der Erkrankung. Die bildgebende Diagnostik wird in der Regel zweimal begutachtet. Besondere Fälle werden in der Tumorkonferenz vorgestellt. Die pathohistologische Diagnose, entsprechend den Richtlinien der UICC/WHO (International Union against Cancer/World Health Organization) in Bezug auf Subtypen, Größe und Resektionsrand wird in der Tumorkonferenz mit dem Ziel diskutiert, die Behandlung nach den gültigen internationalen Kriterien festzulegen. Mit dem Tumorzentrum kooperierende niedergelassene Ärzte und Ärztinnen werden über die im Konsil und der Dokumentation erarbeiteten Ergebnisse informiert und um Rückmeldungen zur Nachsorge gebeten. Mit kooperierenden Krankenhäusern wie zum Beispiel mit dem St. Gertraudenkrankenhaus werden seit über 10 Jahren gemeinsame Tumorkonferenzen für Brustkrebspatientinnen ausgerichtet. Auch diese Patientinnen werden im Dokumentationssystem des Tumorzentrum Neukölln registriert. Tumorzentrum Spandau e.V. Im Tumorzentrum Spandau mit seinen drei Mitgliedsorganisationen unter jeweils unterschiedlichen Trägerschaften unterziehen sich jährlich ca. 500 Brustkrebspatientinnen einer Primärbehandlung. Die Qualität der klinischen Tumordokumentation bei Brustkrebserkrankungen von Frauen hat sich seit 1998 deutlich verbessert. Es werden jetzt alle Neudiagnosen dokumentiert. Teilweise ist es auch gelungen, eine Verlaufsdokumentation aufzubauen, allerdings leidet diese noch an „Schnittstellenproblemen“ zwischen dem stationären und ambulanten Bereich. Hier wäre eine gemeinsame Dokumentationsbasis z.B. auf der Plattform des „Onkonet“ sehr zu begrüßen. Im klinischen Bereich müssen hinsichtlich der sehr aufwändigen Verlaufsdokumentation die personellen Engpässe, für die es auch in absehbarer Zeit keine Abhilfe gibt, berücksichtigt werden. Die Ärztinnen und Ärzte sind durch die übliche klinische Dokumentation und die Dokumentation im Rahmen des DRG-Systems erheblich zeitlich belastet. Insgesamt ist deshalb eine einheitliche Dokumentation anzustreben, bei der sowohl auf der einen Seite den klinischen Anforderungen genüge getan wird und auf 19 der anderen Seite gleichzeitig ein Leistungsnachweis für die DRG-Abrechnung erfolgt. Die derzeit übliche teilweise Dreifachdokumentation hinsichtlich der klinischen Dokumentation im Rahmen des stationären Aufenthaltes, der Tumordokumentation und schließlich der Leistungsdokumentation beansprucht zu viel Personalressourcen im ärztlichen Bereich. Als wesentlicher Aspekt hinsichtlich der Versorgungsqualität der betroffenen Patientinnen ist hervorzuheben, dass die im Tumorzentrum arbeitenden Klinika regelmäßige interdisziplinäre Tumorkonferenzen durchführen, in denen gemeinsam die optimale Behandlung der Patientinnen besprochen wird. Solche Besprechungen finden teilweise für einzelne Patientinnen wiederholt statt, wenn sich neue klinische Probleme im Verlauf ergeben. An diesen Tumorkonferenzen sind auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen beteiligt. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass seit 1998 Brustkrebserkrankungen in sechs der sieben Tumorzentren dokumentiert werden. Dies stellt zumindest im Hinblick auf die Quantität der Dokumentation eine erhebliche Verbesserung dar (1998 geschah dies nur in drei Tumorzentren). Auch im Hinblick auf die Nutzung dieses Instruments zur nachhaltigen Qualitätssicherung und -verbesserung der Brustkrebsversorgung ist vor allem auf die deutlichen und nachweisbaren Verbesserungen für Patientinnen in den Tumorzentren Buch und Moabit zu verweisen. Für das Land Berlin sind jedoch aus der Perspektive des Tumor Zentrum Berlin e.V. noch weitere Anstrengungen notwendig, um allen Frauen und Brustkrebspatientinnen der Region eine nach den neuesten Erkenntnissen optimierte und qualitätsgesicherte Diagnostik und Behandlung zu garantieren. Die Dokumentation der klinisch betreuten Patientinnen hat sich seit 1998 verbessert. Nach wie vor mangelhaft ist die Verlaufs- und Nachsorgedokumentation. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Berlin beteiligen sich nur sehr sporadisch an der Dokumentation. Allein das Tumorzentrum Berlin-Buch verzeichnet für seine mit Wohnsitz im Land Brandenburg betreuten Krebspatientinnen und –patienten (40%) eine vollständige Nachsorgedokumentation. Die nachsorgenden Ärztinnen und Ärzte im Land Brandenburg erhalten eine Aufwandsentschädigung für die Nachsorgedokumentation. Die nach wie vor als defizitär zu bezeichnende klinische Tumordokumentation für das Land Berlin ist im wesentlichen auch dadurch verursacht, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern eine gesicherte Finanzierungsgrundlage nicht existiert. Angesichts der angespannten Haushaltslagen sowie der knappen personellen Ressourcen in den regionalen Tumorzentren sind qualitative Verbesserungen der klinischen Tumordokumentationen in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. 2. Das Onkonet Das Onkonet-Projekt des Tumor Zentrum Berlin e.V. kann erhebliche Fortschritte verzeichnen. Am Beispiel der Hodenkrebserkrankungen konnte nunmehr ein erster Praxistest mit fünf dokumentierenden Zentren erfolgreich abgeschlossen werden. Die bereichsübergreifende, qualitätssichernde Online-Dokumentation integriert zudem alle Datenanforderungen des epidemiologischen Krebsregisters. Das GKR hat ein Teilprojekt "Integration der GKR Datensatzanforderung" des Onkonet-Projektes auch finanziell unterstützt. Ein erster Datentransfer zum GKR wurde im Februar 2003 erfolgreich durchgeführt. 20 Eine automatische Nachsorgemeldung an das GKR entsprechend den in den Leitlinien zur Diagnostik und Therapie vorgesehenen Nachsorgeschemata nach 5 bzw. 10 Jahren ist gewährleistet und wird dazu beitragen, Überlebensraten präziser zu ermitteln. Die Übertragbarkeit auf alle weiteren Entitäten ist gegeben; ggf. sind entitätenspezifische Modifizierungen analog des jeweiligen Modulaufbaus vorzunehmen. Die Vorarbeiten zur Implementierung der Online-Dokumentation für die kolorektalen Karzinome sind abgeschlossen. Eine Beauftragung zur technischen Umsetzung soll im April 2003 erfolgen. Ferner sind nun auch erste Vorbereitungen für das Mammakarzinom und das Bronchialkarzinom getroffen. Ende des ersten Quartals 2003 wird eine zweite Schulung für alle beteiligten Nutzer der Hodentumordokumentation stattfinden. Die Einbindung von GKR-MitarbeiterInnen ist selbstverständlich. Problematisch bleibt jedoch die Finanzierung des Vorhabens. Bislang wurden die Kosten für die technische Umsetzung dieses Projektes allein aus den Mitteln des Tumor Zentrum Berlin e.V. getragen. Sowohl die Krankenkassen als auch die Kassenärztliche Vereinigung Berlin haben eine Beteiligung an der Finanzierung des Teilprojektes Mammakarzinom abgelehnt. Die von der Berliner Krebsgesellschaft in Aussicht gestellte Teilförderung wird nur nach Sicherstellung der Gesamtfinanzierung gewährt. Trotz einer erfolgreichen Erprobung dieses Dokumentationssystems, dass mit erheblichem Nutzen für Ärztinnen/Ärzte und vor allem für Patientinnen/Patienten verbunden ist, scheint seine Realisierung ernsthaft gefährdet. Um so bedauerlicher, da in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche klinisch und ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte aus allen notwendigen Fachdisziplinen hoch engagiert und motiviert an der Umsetzung dieses Projektes gearbeitet haben. Diese Ärztinnen und Ärzte haben eindrucksvoll die Notwendigkeit eines qualitätssichernden Systems demonstriert. Nicht politische oder finanzielle Unterstützung haben dies bewirkt, sondern allein die Motivation, die notwendige Transparenz und Qualitätssicherung in der Versorgung onkologischer Patientinnen und Patienten herzustellen und die Überzeugung, dass Onkonet ein realistischer und praxisbezogener Weg dorthin ist. 3. Wie bewertet der Senat die Bemühungen auf Bundesebene zur Einführung eines qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings, das u. a. von der Berliner Ärztekammer als medizinisch fragwürdig kritisiert wird? Die GMK hat am 21./22.06.2002 mit Zustimmung Berlins einen Beschluss gefasst, mit dem die Bedeutung und Notwendigkeit eines systematischen Qualitätsmanagements im Bereich Früherkennung, Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs bekräftigt wird. Darüber hinaus begrüßte die GMK in ihrem einstimmigen Beschluss die „Absicht der Selbstverwaltung, ab 2003 ein flächendeckendes Mammographie-Screening, basierend auf den europäischen Leitlinien, einzuführen. Sie erwartet, dass die bislang vorliegenden Erfahrungen und Ergebnisse der Modellprojekte für das bundesweite Screening unverzüglich vorgelegt und herangezogen werden. Die Notwendigkeit einer epidemiologisch abgesicherten Evaluation wird betont.“ Der Senat ist sich bewusst, dass der Nutzen des Mammographie-Screenings gegenwärtig kontrovers diskutiert wird. Er folgt – auch unter Berücksichtigung neuester Studien – dennoch der Auffassung des Sachverständigenrates (Gutachten 2000/2001 21 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Band III, S. 450-465), „dass die vorliegenden Ergebnisse aus bevölkerungsmedizinischer Sicht nicht gegen die Implementierung eines flächendeckenden qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings in Deutschland sprechen, insbesondere wenn dieses zugleich mit der Verbesserung der gesamten diagnostisch-therapeutischen Versorgungskette einhergeht.“ Ein entscheidendes Zusatzargument ist dabei die Vermeidung von Schäden und Kosten, die durch das sogenannte „graue“ Mammographiescreening in Deutschland verursacht werden. Der Umfang dieser nicht qualitätsgesicherten, verdeckten Screening-Mammographien wird vom Sachverständigenrat auf 2 – 4 Mio. pro Jahr geschätzt. 4. Wie bewertet der Senat die in Nordrhein-Westfalen unterstützte Bildung zertifizierter Brustkrebszentren, die als Initiative einer „Konzertierten Aktion gegen Brustkrebs“ im dortigen Landesausschuss für Krankenhausplanung entwickelt wurden und neben qualitätssichernden Auflagen auch die Einbeziehung von Patientinnen in die Therapieentscheidung vorsehen? Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz fordert, wie die Initiatorinnen und Initiatoren der „Konzertierten Aktion gegen Brustkrebs“ in NordrheinWestfalen, die Qualität bei der Behandlung von Krebskranken durch optimale Vernetzung der bestehenden stationären, ambulanten und rehabilitativen Angebote zu verbessern. Dies ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung des beschlossenen Disease-Management-Programms der Bundesregierung in der Brustkrebsbehandlung. Bei gleichen Zielen unterscheidet sich das Berliner Modell in der Vorgehensweise, vor allem deshalb, weil die Ausgangssituation in Berlin eine andere ist. Bereits 1996 wurde in Berlin der Verein „Tumorzentrum Berlin“ gegründet. Dieser Verein ist der Dachverband von sieben regionalen Tumorzentren Berlins. Diesen regionalen Tumorzentren und dem „Tumorzentrum Berlin“ kommt bei der Behandlung bösartiger Erkrankungen eine Leitfunktion zu. Neben der direkten Behandlung von Krebspatientinnen und –patienten ist es speziell die Aufgabe der Tumorzentren und ihres Dachverbandes, den ständigen Erfahrungsaustausch untereinander und mit externen Partnerinnen und Partnern (ambulant tätige Ärztinnen/Ärzte, Rehabilitationseinrichtungen, Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, soziale Bereiche, Patientenvertretungen) zu pflegen und über Konsilien und Tumorkonferenzen als Ansprechpartner für alle onkologisch Tätigen zu fungieren. Damit die Tumorzentren ihren Aufgaben gerecht werden können, werden im Berliner Krankenhausplan strukturelle Festlegungen getroffen, die die Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige onkologische Therapie in diesen Zentren – auch bei der Behandlung von Brustkrebs – darstellen. Die darüber hinausgehende fachliche Zuständigkeit sieht die Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz beim „Tumorzentrum Berlin“ und seinen regionalen Mitgliedern. Das betrifft auch die Verantwortung für die geforderte Verbesserung der intersektoralen und interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Tumortherapie. 22 IV. Frauengesundheit und Gewalt 1. Wie weit ist der Stand zur Umsetzung des Berliner Aktionsplans zur Bekämpfung häuslicher Gewalt? Anfang Dezember 2002 fand die konstituierende Sitzung des Runden Tisches zur Umsetzung des Berliner Aktionsplans zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt statt. Aufgabe des Runden Tisches ist es, die Umsetzung des Aktionsplans zu begleiten und die dort aufgeführten Maßnahmen zu koordinieren. Am Runden Tisch beteiligt sind die Senatsverwaltungen für Wirtschaft, Arbeit und Frauen, für Justiz, für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, für Inneres, für Bildung, Jugend und Sport, der Polizeipräsident, die Bezirke Marzahn/Hellersdorf und Mitte sowie verschiedene Projekte aus der Anti-Gewalt-Arbeit. Bei der Sitzung wurde eine erste Zwischenbilanz für den Zeitraum seit der Verabschiedung des Aktionsplans im März 2002 gezogen. Neben der Thematisierung u.a. des Standes der Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes, der geplanten (und im Februar 2003 vollzogenen Änderung) des Berliner Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (bezüglich des Platzverweises des Täters), der Problematisierung von Auskunftssperren und des erfolgreichen Verlaufs des sechsmonatigen Modellversuchs zum Platzverweis des Täters aus der Wohnung wurde im Bereich Gesundheit folgender Umsetzungsstand festgehalten: Zur Sensibilisierung der (Fach-) Öffentlichkeit hat im November 2002 anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen eine gemeinsame Pressekonferenz der Senatorin für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz und des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Frauen stattgefunden. Dabei wurde übereinstimmend deutlich gemacht, dass - wie im Aktionsplan enthalten – die Verbesserung der medizinischen Erstversorgung und Diagnostik und die langfristige medizinische, therapeutische und soziale Betreuung gewaltbetroffener Frauen oberstes Ziel ist. Für niedergelassene Ärzte und Ärztinnen ist geplant, einen Leitfaden, wie er bereits für den Bereich Gewalt gegen Kinder existiert, für den Bereich Gewalt gegen Frauen zu entwickeln. Ein wichtiger Schritt hierzu ist mit der vom Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt (BIG) in Zusammenarbeit mit S.I.G.N.A.L. und dem Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte Frauen LARA - erarbeiteten und mit Hilfe der Ärztekammer verteilten Informationsbroschüre „Wenn Patientinnen von Gewalt betroffen sind“ gemacht worden. Demnächst soll ein Workshop zu stationären Angeboten für psychisch kranke Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen durchgeführt werden. Seit der ersten Sitzung des Runden Tisches haben sich zwischenzeitlich weitere Entwicklungen ergeben: Als eine der Schlussfolgerungen des in Kürze erscheinenden Frauengesundheitsberichts Berlin ist die Entwicklung von „Leitlinien für frauengerechte Angebote in der psychiatrischen Versorgung“ beabsichtigt. Darin wird auch das Thema „Folgen von Gewalt“ berücksichtigt werden. 23 Es ist beabsichtigt, die Krankenpflegeschulen in Berlin für eine Aufnahme der Thematik „häusliche Gewalt“ in die Curricula zu motivieren. In den Entwurf der Musterweiterbildungsordnung für Ärzte und Ärztinnen ist der Bereich der Gewaltprävention aufgenommen worden (s.a. Antwort zu Teil IV 2b). Noch in diesem Jahr wird ein zweiter Runder Tisch stattfinden, bei dem die weitere Umsetzung der Maßnahmen erörtert werden soll. 2. Wie weit sind die angekündigten Bemühungen zur Umsetzung des S.I.G.N.A.L-Interventionsprogrammes mit seinem Schulungsangebot im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) gediehen, und wie ist der Stand der Bemühungen, bei der Ärztekammer in Berlin das Thema „Häusliche Gewalt und gesundheitliche Folgen“ in die fachliche Fort- und Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte einzuführen? a) Umsetzung des S.I.G.N.A.L.-Angebotes im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Für den öffentlichen Gesundheitsdienst bestehen zwischen SIGNAL und dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg seit 2002 Kontakte. Gegenwärtig werden im Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg Daten zur Prävalenz häuslicher Gewalt unter den Klientinnen erfasst, Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten und Interventionsmaßnahmen diskutiert. Ziel ist, das derzeit im Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg erprobte System von Datenerhebungen und Interventionsmaßnahmen zukünftig auch für andere Gesundheitsämter nutzbar zu machen. b) Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten Eine neue Musterweiterbildungsordnung wird voraussichtlich auf dem 106. Deutschen Ärztetag im Mai 2003 beschlossen werden, die als Empfehlung an die Landesärztekammern gerichtet ist. Nach dem derzeitigen Informationsstand ist das Thema „Häusliche Gewalt und gesundheitliche Folgen“ mindestens in den Weiterbildungsinhalten der Gebiete „Innere Medizin und Allgemeinmedizin“ und „Kinderheilkunde“ wiederzufinden. Konkret wurden folgende Formulierungen aufgenommen: a) Innere Medizin und Allgemeinmedizin: „Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Gesundheitsberatung, der Früherkennung von Gesundheitsstörungen einschließlich Gewalt- und Suchtprävention, ..... b) Kinder- und Jugendmedizin: „Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in der Gewalt- und Suchtprävention und der Erkennung und Bewertung von Kindesmisshandlungen und Vernachlässigungen, von sozialund umweltbedingten Gesundheitsstörungen. c) Für das Gebiet „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ wurden folgende Formulierungen aufgenommen: „Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in psychogenen Symptomen, somatopsychischen Reaktionen, psychosozialen und psychosexuellen Störungen unter Berücksichtigung der gesellschaftsspezifischen Stellung der Frau und ihrer Partnerschaft“. Es ist davon auszugehen, dass die Ärztekammer Musterweiterbildungsordnung weitgehend übernehmen wird. Berlin die 24 Die Ärztekammer Berlin hat bereits Fortbildungsveranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte zum Thema häusliche Gewalt geplant. Aus aktuellem Anlass mussten diese jedoch zurückgestellt werden (Anlass sind mehrere Veranstaltungen zum Thema „Pockenschutzimpfungen“). Dennoch wird noch in diesem Jahr die Durchführung von Fortbildungen zu „häuslicher Gewalt“ angestrebt. 3. Wird bei der derzeitig vorbereiteten Fortschreibung des Krankenhausplanes 1999 das Projekt „S.I.G.N.A.L.“, das durch die Sensibilisierung des medizinischen Sektors für das Gewaltproblem eine verbesserte gesundheitliche Versorgung misshandelter Frauen erreichen soll, als Teil der Grundversorgung in allen Plankrankenhäusern berücksichtigt? Das Projekt S.I.G.N.A.L. dient der Verbesserung der Qualität u.a. der Krankenhausbehandlung betroffener Frauen. Sie soll auf Struktur- und Prozessebene durch Schulung und Training der Beteiligten, die Anwendung des Programms und die Vernetzung mit anderen Projekten des Anti-Gewalt-Bereichs erreicht werden. Die Modellphase, die im März 2003 ausläuft und mit einem wissenschaftlichen Bericht in Form eines Handbuchs abschließt, wurde im Universitätsklinikum Benjamin Franklin angesiedelt. Darüber hinaus arbeiten auch das Vivantes - Klinikum Spandau und das Ev. Waldkrankenhaus Spandau nach dem S.I.G.N.A.L.- Interventionsprogramm. Das Institut für Fort- und Weiterbildung der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH plant, alle Leiterinnen und Leiter der Rettungsstellen in Krankenhäusern über dieses Programm zu informieren und es als verpflichtende Fortbildung anzubieten. In der Fortschreibung des Krankenhausplans 1999 wird das Projekt S.I.G.N.A.L. nicht berücksichtigt, da es die Regelungstiefe krankenhausplanerischer Festlegungen überschreitet. Generell werden Qualitätssicherungsprogramme zu einzelnen Behandlungsbereichen nicht im Krankenhausplan ausgewiesen. Berlin, den . April 2003 ------------------------------------------Senatorin für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz