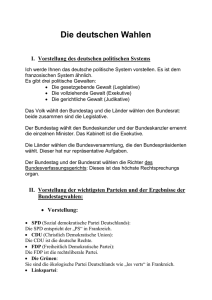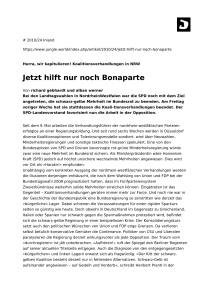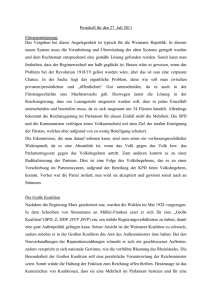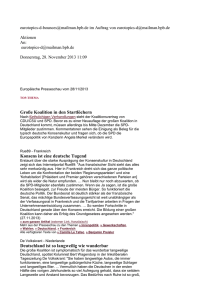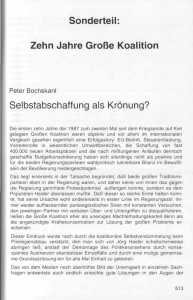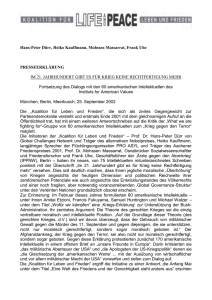Neuland, unbekannt
Werbung
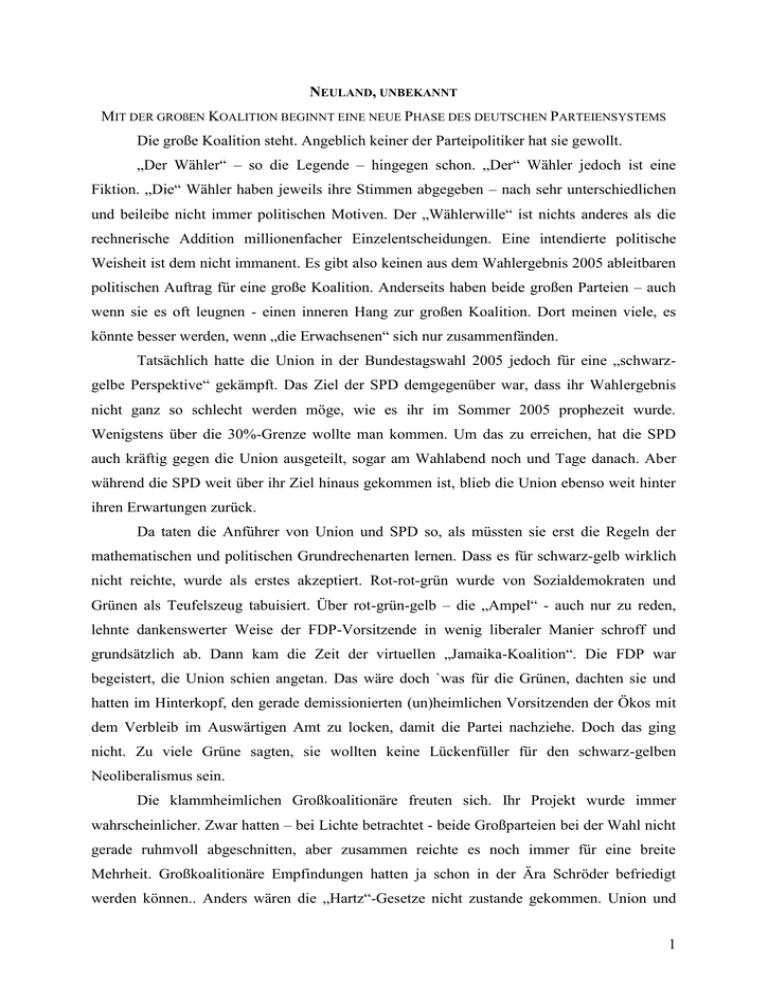
NEULAND, UNBEKANNT MIT DER GROßEN KOALITION BEGINNT EINE NEUE PHASE DES DEUTSCHEN PARTEIENSYSTEMS Die große Koalition steht. Angeblich keiner der Parteipolitiker hat sie gewollt. „Der Wähler“ – so die Legende – hingegen schon. „Der“ Wähler jedoch ist eine Fiktion. „Die“ Wähler haben jeweils ihre Stimmen abgegeben – nach sehr unterschiedlichen und beileibe nicht immer politischen Motiven. Der „Wählerwille“ ist nichts anderes als die rechnerische Addition millionenfacher Einzelentscheidungen. Eine intendierte politische Weisheit ist dem nicht immanent. Es gibt also keinen aus dem Wahlergebnis 2005 ableitbaren politischen Auftrag für eine große Koalition. Anderseits haben beide großen Parteien – auch wenn sie es oft leugnen - einen inneren Hang zur großen Koalition. Dort meinen viele, es könnte besser werden, wenn „die Erwachsenen“ sich nur zusammenfänden. Tatsächlich hatte die Union in der Bundestagswahl 2005 jedoch für eine „schwarzgelbe Perspektive“ gekämpft. Das Ziel der SPD demgegenüber war, dass ihr Wahlergebnis nicht ganz so schlecht werden möge, wie es ihr im Sommer 2005 prophezeit wurde. Wenigstens über die 30%-Grenze wollte man kommen. Um das zu erreichen, hat die SPD auch kräftig gegen die Union ausgeteilt, sogar am Wahlabend noch und Tage danach. Aber während die SPD weit über ihr Ziel hinaus gekommen ist, blieb die Union ebenso weit hinter ihren Erwartungen zurück. Da taten die Anführer von Union und SPD so, als müssten sie erst die Regeln der mathematischen und politischen Grundrechenarten lernen. Dass es für schwarz-gelb wirklich nicht reichte, wurde als erstes akzeptiert. Rot-rot-grün wurde von Sozialdemokraten und Grünen als Teufelszeug tabuisiert. Über rot-grün-gelb – die „Ampel“ - auch nur zu reden, lehnte dankenswerter Weise der FDP-Vorsitzende in wenig liberaler Manier schroff und grundsätzlich ab. Dann kam die Zeit der virtuellen „Jamaika-Koalition“. Die FDP war begeistert, die Union schien angetan. Das wäre doch `was für die Grünen, dachten sie und hatten im Hinterkopf, den gerade demissionierten (un)heimlichen Vorsitzenden der Ökos mit dem Verbleib im Auswärtigen Amt zu locken, damit die Partei nachziehe. Doch das ging nicht. Zu viele Grüne sagten, sie wollten keine Lückenfüller für den schwarz-gelben Neoliberalismus sein. Die klammheimlichen Großkoalitionäre freuten sich. Ihr Projekt wurde immer wahrscheinlicher. Zwar hatten – bei Lichte betrachtet - beide Großparteien bei der Wahl nicht gerade ruhmvoll abgeschnitten, aber zusammen reichte es noch immer für eine breite Mehrheit. Großkoalitionäre Empfindungen hatten ja schon in der Ära Schröder befriedigt werden können.. Anders wären die „Hartz“-Gesetze nicht zustande gekommen. Union und 1 SPD neigen eben dazu, sich als Garanten des Staatswesens zu sehen, wenn es ihnen auf der politischen Szene zu bunt zu werden scheint. So gesehen war die Regentschaft Schröders gelegentlich eine verdeckte große Koalition, und so gesehen war es nur folgerichtig, dass Gerhard Schröder bei der Vorbereitung der zweiten großen Koalition in Deutschland mit am Verhandlungstisch saß. 1966 war der Hang zur großen Koalition zum ersten Mal manifest geworden. Die Union hatte damals unter dem Kanzler Ludwig Erhard den Partner FDP und die Mehrheit verloren. Das sollte die SPD kompensieren, und diese brauchte die Metamorphose zur Regierungspartei, um im Zuge ihres Godesberger Reformprojektes in der Bundesrepublik endgültig als Bonner Partei anerkannt zu werden. So fanden sich Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt zusammen. Die mit bestem Personal besetzte „Koalition der Köpfe“ verknüpfte die Aufgaben des Bundes mit denen der Länder und legte die Grundlagen für die später so gescholtene Politikverflechtung. Sie betrieb eine von Karl Schiller und Franz Josef Strauß getragene keynesianische Wirtschaftspolitik und war damit erfolgreich. Aber das Bündnis polarisierte. Die Protestbewegung der APO vor allem stieß sich am als Symbol der „Versöhnung“ ausgegebenen Zusammengehen des ehemaligen „PG“ Kiesinger mit dem Emigranten Brandt. Brandt selber war es, der sich 1969 mit der sozial-liberalen Koalition und Walter Scheel als neuem Partner aus dieser ihn auch persönlich bedrückende Lage befreite. 2005 machten sich andere die Arbeit – zuerst Merkel, Müntefering, Stoiber und Co., dann noch Platzeck und Glos. Diese polarisierten nicht, sie bauten vielmehr dem Pragmatismus eine Gasse. Entgegen sonstigen Koalitionsverhandlungen wurden vorab die Ressorts verteilt und dann Inhalte besprochen. Die am Ende getroffenen Vereinbarungen sind nicht statisch – als abzuarbeitender Vertrag – zu verstehen, sondern dynamisch. Zuerst soll ein Investitionsprogramm kommen, dann Steuererhöhungen. Im ersten Jahr soll ein fragwürdiger Haushalt aufgestellt werden, damit nachfolgende Haushalte nicht nur solide werden, sondern auch den EU-Kriterien entsprechen. Es wird eine Wirtschaftspolitik jenseits aller ökonomischen „Schulen“ werden. Reformgebiete wie das Gesundheitswesen werden vorerst ausgespart, sollen vielleicht später bearbeitet werden. Zwar soll der Föderalismus erneuert werden, aber von einer Reform des Wahlrechts mit dem beiden großen Parteien naheliegenden Mehrheitswahlrecht wird nicht geredet. Alles, vieles oder auch wenig kann noch werden: ein echter Neuanfang der Regierung. Und nicht nur die Regierung, auch die einzelnen Parteien stehen vor einem Neuanfang. 2 Die SPD musste zugestehen, dass die rot-grüne Koalition ein Milliardenloch hinterlassen hatte. Die Union musste eine symbolische Erhöhung des Spitzensteuersatzes und staatliche Konjunkturspritzen akzeptieren. Was sie gestern noch im Wahlkampf sagten, gilt nicht länger. Beide Großparteien werden ihre Programme neu justieren müssen. In der CDU hat sich mit Angela Merkel eine Führungsperson neuer Art etabliert: eine Frau aus dem Osten, ohne Junge-Union-Sozialisation, erst vor 15 Jahre über den Demokratischen Aufbruch mit dem Pfarrer Rainer Eppelmann in die Union gespült. In der CSU verblasste das Charisma des Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. In der SPD trat mit Franz Müntefering der Wegbegleiter der sprunghaften Politik Gerhard Schröders ab. Es folgte Matthias Platzeck, ähnlich wie Angela Merkel vor 15 Jahren über eine Zwischenstufe – das Bündnis 90 – in diesem Fall durch Manfred Stolpe zur großen Partei gekommen, aus dem Osten stammend und wenig belastet mit älterer Parteigeschichte. Union und SPD haben beide das Problem, dass ihr Status als Volkspartei gefährdet ist. Das Wahlergebnis 2005 hat ihnen deutlich gemacht, wie flüchtig ihre Anhängerschaften sind: Parteipolitischen Quereinsteigern haben sie nun die jeweilige Führung anvertraut. Auch die kleinen Parteien stehen vor einer ungewissen Zukunft. Den Rechten ist es nicht gelungen, sich in der Kampagne 2005 bemerkbar zu machen, obwohl das Geißeln der Arbeitslosigkeit, des Sozialabbaus und der Probleme mit den Ausländern zu ihrer Agenda gehören. 2005 noch hatten DVU und NPD geprahlt, durch Listenverbindungen würden sie bei der kommenden Bundestagswahl ins deutsche Parlament einziehen. Als die Wahl vorgezogen wurde, waren die Rechten nicht mehr gefragt. Die Listenverbindung jedoch gab es auf der linken Seite. Mithilfe der Gewerkschaftsabspaltung WASG hat es die PDS als „Linkspartei“ geschafft, in Fraktionsstärke wieder in den Bundestag einzuziehen. Ob allerdings diese Gruppierung den Spagat zwischen Ostmilieu und bundesrepublikanischem Reformfrust schaffen wird, steht dahin. Ebenso fragil wie die inhaltliche Basis dieser Gruppierung ist ihre Personalisierung. Gregor Gysi und Oskar Lafontaine sind bundesweit bekannte Mediatisierer, die beide an der harten Arbeit in der politischen Ebene schon einmal gescheitert sind. Und harte Arbeit wird es sein, die Anhänger eines Ostmilieus einerseits mit frustrierten Kollegen und Genossen aus den Restbeständen der westdeutschen Arbeiterbewegung andererseits zu verketten. Ohne Regierungsmacht und ohne ihren (un)heimlichen Vorsitzenden stehen die Grünen da. Ihre einstigen Grundsätze haben sie aufgegeben: im Formalen wie im Inhaltlichen. Die Rotation gehört ebenso ihrer Vergangenheit an wie der Einheitslohn auf Sozialarbeiterniveau. Der bittere Streit zwischen Realos und Fundies ist zugunsten der Realos 3 entschieden. Seit diese als Grüne an der Macht waren, gibt es bei den Grünen keinen Pazifismus mehr. Die ökonomischen Grenzen des Umweltschutzes haben sie akzeptiert. Viele Beobachter haben den Grünen prophezeit, dass sie untergehen würden, wenn die Macht entschwunden und Joschka Fischer nicht mehr da sein werden. Nun bemühen sich Renate Künast und Fritz Kuhn mit anderen aus der bisherigen zweiten Reihe, der Partei eine neue Perspektive zu geben. Sie müssen dem Publikum erklären, wozu Deutschland eine durch sieben Jahre Regierungstätigkeit geläuterte ehemalige „Anti-Parteien-Partei“ braucht. Wieder nicht geschafft hat es die FDP und muss sich nach der Wahl 2005 damit trösten, unter den Kleinen die Größte zu sein. 2002 wollte die 1998 von der Macht entlassene FDP wieder an die Regierung. Sie versuchte, mit dem medienorientierten „Projekt 18“ dorthin zu gelangen und patzte. Daraufhin besann sie sich auf Sachpolitik, gab sich radikal neoliberal und diente sich der Union in einer „Koalition in der Opposition“ an. Beim Wahlgang 2005 jagte sie der Union so viele Zweitstimmen ab, dass diesmal dem großen Wunschpartner Stimmen fehlten und es wieder nicht für schwarz-gelb reichte. Die FDP startete in die 3. Oppositionsperiode jedoch nicht, indem sie sich bemühte, ihr neoliberales Image durch das Ziel der Gerechtigkeit zu verbessern, sondern sie wandelte sich zu einer Einmann-Partei, der Guido Westerwelle seinen persönlichen kryptischen Liberalismus-Stil aufdrängt. So kam die Wortschöpfung „neosozial“ ans Licht der Welt ohne dass sich die Politik der Partei änderte. Alle deutschen Parteien sind Gefangene des Wahlergebnisses von 2005. Die Karten sind neu gemischt. Gelingt es der großen Koalition, die Arbeitslosigkeit in Deutschland abzubauen, wird das den großen Parteien zugute kommen. Schafft sie das nicht, steigen die Chancen der Kleinen. Wahrscheinlicher ist, dass das zuerst der sozialistischen Linken nützen würde – wenn diese nicht wieder auseinander fällt – und weniger der neoliberalen FDP, falls diese an ihrem marktradikalen Kurs festhält. Denn das Scheitern der großen Koalition an der Arbeitslosenfrage würde mehr ihren neoliberalen Reformen als ihren linken Symbolen angelastet werden. Eine Chance könnten dabei die Grünen bekommen, wenn eine pragmatische Alternative zur großen Koalition gesucht wird: eine Alternative, die soziale Veränderungen als unumgänglich erkennt und zugleich nach sozialem Ausgleich sucht. Eines ist sicher: 2005 hat eine neue Phase der Entwicklung des deutschen Parteiensystem begonnen. Nach der Gründungs- und der Konzentrationsphase in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren der alten Bundesrepublik und der durch das Hinzukommen der Grünen charakterisierten Erweiterungsphase in den Achtzigern, nach der Phase der territorialen Erweiterung in die neuen Länder und der organisatorischen Erweiterung durch die PDS in den neunziger Jahren folgt eine politische 4 Neuorientierungsphase für alle Parteien. Da kann viel geschehen. Die Großen können größer werden und die Kleinen verdrängen. Die Kleinen oder einige von ihnen können aber auch als Alternativen wachsen, gar das Gefüge des gesamten Systems neu justieren. Ob das eine oder das andere kommt, hängt von den Wirkungen der Politik der neuen Koalition auf die Arbeitslosenfrage ab. Das zielgenau zu berechnen ist niemand in der Lage. So gesehen betritt die große Koalition nicht nur parteipolitisches Neuland, sondern wirtschaftspolitisch unbekanntes Territorium. CDU/CSU und SPD haben einen mutigen Schritt getan. Den Kleinen bleibt nichts übrig, als ihnen dabei zu folgen – zu neuen, unbekannten Gefilden. JÜRGEN DITTBERNER 5